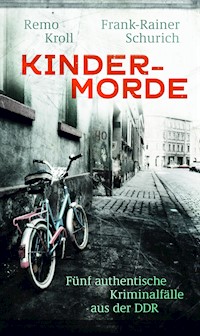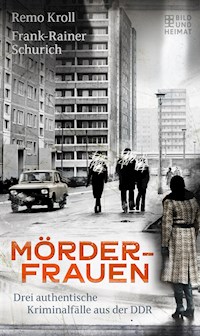Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bild und Heimat
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Berlin, Hauptstadt der DDR, tötet der Sektionsgehilfe Hilmar S. am 14. Fe bruar 1969 drei Frauen in ihren jeweiligen Wohnungen. Wie kommt es dazu, dass der brutale Mörder in einen regelrechten Blutrausch verfällt? Mit einem einzigen Faustschlag will der Arbeiter Burkhard Sch. am 6. Mai 1970 der Rentnerin Elise K. in ihrer Wohnung in Lutherstadt Wittenberg das Leben auslöschen. Als ihm dies misslingt, quält er sein Opfer, bis es endlich regungslos daliegt. Beim Anblick der Getöteten gerät er in sexuelle Erregung. Rostock, in der Nacht vom 12. zum 13. Dezember 1972: Prof. Dr. med. habil. Burkhard W., Pharmakologe und Toxikologe, meldet sich bei der Rostocker Volkspolizei und gibt an, dass seine Ehefrau Suizid begangen hätte. Während der Ermittlungen verstrickt er sich immer tiefer in Widersprüche. Ist er der Mörder seiner Gattin? Am Abend des 21. Februar 1977 macht der Mittweidaer Traktorist U. eine schreckliche Entdeckung. Auf der Straße liegt eine junge Frau in einer großen Blutlache. Wenig später kann nur noch ihr Tod festgestellt werden. Was ist passiert? Femizide waren in der DDR ein Tabuthema. Das erfolgreiche Autorenduo Remo Kroll und Frank-Rainer Schurich rekonstruiert vier erschütternde Gewaltverbrechen an Frauen auf Basis der originalen Akten und lässt die Leser minutiös und aufwühlend an der Spurensuche und Aufklärung teilhaben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Remo Kroll und Frank-Rainer Schurich
Frauenmorde
Vier authentische Kriminalfälle aus der DDR
Bild und Heimat
Von Remo Kroll und Frank-Rainer Schurich liegen bei Bild und Heimat außerdem vor:
Tötungsdelikt Gisela G. und zwei weitere Fälle (Blutiger Osten, 2018)
Postraub am Spreekanal und zwei weitere Verbrechen (Blutiger Osten, 2018)
Brudermord und zwei weitere wahre Verbrechen von Sowjetsoldaten in der DDR (Blutiger Osten, 2019)
Polizistenmorde. Vier authentische Kriminalfälle aus der DDR (2. Auflage, 2019)
ISBN 978-3-95958-791-4
1. Auflage
© 2020 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin
Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin
Umschlagabbildung: © akg-images / picture-alliance / ZB / Wilfried Glienke
Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:
BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat
Alexanderstr. 1
10178 Berlin
Tel. 030 / 206 109 – 0
www.bild-und-heimat.de
Vorwort
Morde an Frauen, sogenannte Femizide, waren in der DDR ein Tabuthema. Dennoch geschahen sie, denn männliche Egos zu kränken, war auch in diesem Land zuweilen lebensgefährlich. Obwohl die Gleichberechtigung nicht nur auf dem Papier stand. Die Sozialisation der Frauen war, verglichen mit heute, privilegiert. Sie hatten Berufe und Partner auf Augenhöhe. Jedenfalls vorwiegend …
Der Begriff »Frauenmorde« stellt allerdings eine ziemlich verwässerte kriminalistische oder kriminologische Kategorie dar, die alle Tötungen von Frauen – überwiegend durch Männer – umfasst. Die Motive können höchst unterschiedlich sein. Bei unseren Fallbeschreibungen haben wir Sexualmorde ausgeklammert. In zwei von den hier dargestellten Fällen war jenes gekränkte männliche Ego der entscheidende Antrieb für die Tötungen der Ehefrauen. Bei den beiden anderen Fällen handelt es sich um klassische Raubmorde, bei denen sich die Opfer zur falschen Zeit am falschen Ort befanden und die mit dem »sozialen Nahraum«, wie es in der Kriminologie heißt, also mit der Familie, mit Freunden oder Bekannten, rein gar nichts zu tun hatten.
Femizide sind heute ein hochaktuelles gesellschaftliches Thema. Nach einer Studie der Vereinten Nationen (United Nations, UN) wurden 2017 weltweit fünfzigtausend Frauen von Partnern, Ex-Partnern und Familienangehörigen »wegen ihrer Rolle und ihres Status als Frau«, wie es heißt, getötet, und die Zahlen steigen beängstigend. Als Gründe führt die UN-Studie unter anderem Eifersucht, Angst, verlassen zu werden, und den Wunsch, Frauen zu kontrollieren, an. Ist der Partner oder Ex-Partner der Täter, kommt es meist nicht spontan zum Mord; die Taten folgen vielfach aus einer »Gewaltspirale«.
Nach Zahlen des Bundeskriminalamts versucht in Deutschland im Durchschnitt jeden Tag ein Mann, seine Frau oder Ex-Partnerin umzubringen. 2018 wurden bundesweit 123 Frauen von ihren Lebensgefährten oder (Ex-)Männern getötet, hinzukamen 208 Mord- beziehungsweise Totschlagsversuche.
Bei den von uns hier dokumentierten authentischen Kriminalfällen aus der DDR konnten alle Verbrechen aufgeklärt werden, wobei den Kriminalisten in der Lutherstadt Wittenberg das Glück zur Seite stand und im Berliner Mordfall der Täter auf frischer Tat gestellt werden konnte. Beim Verbrechen von Mittweida wurde der Mörder zunächst nicht ermittelt; das gelang erst nach zwölf Jahren zum Ende der DDR. Der Mord in Rostock dagegen war als Suizid getarnt worden.
Auf Basis der originalen Akten rekonstruieren wir in bewährter Weise die realen Tathergänge und schildern minutiös die kriminalistischen Untersuchungen, die Spurensuche und -sicherung sowie die Befragungen und Vernehmungen, aber auch die Gerichtsverfahren und die psychiatrische Begutachtung der Beschuldigten beziehungsweise Angeklagten.
Die Namen der Täter, Opfer und Zeugen sind von uns aus personenrechtlichen Gründen verändert worden. Für die so neu erfundenen Namen erklären Verlag und Autoren, dass Personen mit diesen Namen in den behandelten vier Kriminalfällen niemals existiert oder agiert haben. Übereinstimmungen wären rein zufällig.
Ein längeres Zitat aus einem Originaldokument (Protokoll über die geführten Ermittlungen vom 7. Mai 1970 im Fall Elise Kunze/Lutherstadt Wittenberg) ist kursiv gesetzt. Zitierungen von Vernehmungen sind daran zu erkennen, dass wir die uns vorliegenden Protokolle wie im Original veröffentlichen – immer mit Frage und Antwort. Auslassungen in den Dokumenten sind generell mit (…) gekennzeichnet worden. Die Abbildungen haben wir bis auf einige Ausnahmen den Akten der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU) entnommen.
Wir danken allen sehr herzlich, die unser Projekt engagiert unterstützt haben, an erster Stelle Frau Christel Brandt von der BStU für die Bereitstellung der Akten. Unser besonderer Dank gilt der Diplomkriminalistin Ines Friedrich für ihre ausgezeichnete Diplomarbeit von 1994 zum Thema »Zur Aufklärung von Tötungsverbrechen multipler Täter – eine retrospektive Fallanalyse«, die der Beschreibung des Berliner Kriminalfalls zugrunde liegt.
»Der scharlachrote Faden des Mordes durchzieht die farblose Oberfläche des Lebens, und wir haben die Pflicht, ihn zu finden und zu isolieren und auf ganzer Länge bloßzulegen«, sagte der Meisterdetektiv Sherlock Holmes in Arthur Conan Doyles Roman Eine Studie in Scharlachrot.
Wir möchten mit unserem neuen Buch zeigen, dass es die Kriminalisten der DDR durchaus verstanden haben, die »scharlachroten Fäden« der Morde sichtbar zu machen, Tötungsdelikte aufzuklären und damit Mörder im Interesse des Schutzes der Gesellschaft dingfest zu machen. In einem Fall gelang dies erst nach zwölf Jahren, aber Ähnliches passiert ja heute auch noch …
Und wir möchten, dass diese entsetzlichen Geschichten mit herübergenommen werden in die neue Zeit, damit die Taten, vor allem aber deren Opfer nicht in Vergessenheit geraten.
Remo Kroll und Frank-Rainer Schurich
Blutrausch
Berlin, Hauptstadt der DDR. Freitag, 14. Februar 1969
Im Osten Berlins gab es in der Wilhelm-Pieck-Straße 89 mit der Postleitzahl 1054 – heute Torstraße 89, 10119 Berlin – eine HO-Gaststätte, das Casino-Eck. Eigentlich eine Berliner Eckkneipe, in der der Zigarettenqualm wie ein Schleier hing, es nach Alkohol roch und das Ausmaß des Bier- und Schnapskonsums am Gesprächslärm ablesbar war. Wer heute dort einkehren will, findet ein gänzlich anderes Ambiente vor als damals. Die Wende hat der Kneipe den Garaus gemacht, nunmehr befindet sich dort die Neue Odessa Bar.
DieNeue Odessa Bar
Nichts an jenem Ort erinnert mehr an einen denkwürdigen Tag vor über fünfzig Jahren. Es war der 13. Februar 1969, kein Unglücksfreitag, sondern ein Donnerstag. Hilmar Switalla, dreißig Jahre alt und Sektionsgehilfe, hatte mit seinem Kneipenkumpel Johannes Kasbohrer, »Henne« genannt, in der Gaststätte Krainberg Bier getrunken; mit anderen würfelten sie um eine Runde Berliner Pilsner. Danach spielten sie um Geld, aber die Einsatzsumme betrug nur 50 Pfennig. Als sie beide gegen 21 Uhr die Kneipe, deren Ausschank schloss – Hilmar Switalla hatte dort drei Bier und zwei Erdbeerliköre getrunken –, verließen, waren sie noch in Spiel- und Alkohollaune, so dass sie zum nicht weit entfernten Casino-Eck weiterzogen.
Dort spielten sie Klammern, ein kombiniertes Karten- und Würfelspiel. Ob alles mit rechten Dingen zuging, kann heute nicht mehr überprüft werden. Aber Hilmar Switalla verlor fast jede Runde und 60 Mark an »Henne«. Zudem bezahlte er fortwährend »Hennes« Bier, da vereinbart war, dass der Verlierer das Getränk spendiert. Nur zwei Spiele gewann er.
Dann kam der vorerst letzte Einsatz, und Switalla verlor noch einmal 40 Mark. Sie diskutierten darüber eine halbe Stunde heftig, was dazu führte, dass Hilmar Switalla herausfordernd zwei 50-Mark-Scheine auf den Tisch legte. Abermals verlor er, und »Henne« steckte die 100 Mark ein. Switalla wurde wütend, da er ja noch 10 Mark zurückbekäme: »Ich gebe dir fünf Minuten Zeit, zu überdenken, ob du nicht einen Fehler gemacht hast.«
»Was für einen Fehler?«, erwiderte der Spielpartner. »Ich habe keinen Fehler gemacht. Du hast schlecht gespielt, und ich habe gewonnen. So einfach ist das nun einmal.«
Nun herrschte tatsächlich für fünf Minuten Schweigen zwischen den beiden, bis Switalla endlich sagte: »Ich bekomme noch zehn Mark!«
»Ach so, sag das doch gleich«, lenkte »Henne« ein und reichte Switalla zwei 5-Mark-Scheine.
Doch dieser wies sie energisch zurück. »Du hast mich betrogen, ich will mein ganzes Geld wiederhaben. Jetzt und sofort. Du bist ein elender Betrüger!«
»Beruhige dich doch«, versuchte »Henne«, ihn zu beschwichtigen. »Du hast eben schlecht gespielt, kein Glück gehabt. Ich habe heute gewonnen, und das nächste Mal gewinnst du. So einfach ist das immer im Leben …«
In Hilmar Switalla brodelte es, Hass- und Rachegedanken stiegen in ihm hoch. »Mit dir wird es ein schlimmes Ende nehmen. Ich schwöre es!«
Nun war es Kasbohrer wohl zu viel, und er versuchte, die Situation zu entspannen, indem er erst einmal auf die Toilette flüchtete. Doch Unheil drohte, denn sein Widersacher folgte ihm sogleich mit aufgeklapptem Taschenmesser in der Manteltasche. Auf der Toilette verlangte Switalla wiederholt sein Geld zurück, was Kasbohrer jedoch strikt ablehnte. »Ich habe gewonnen«, betonte er abermals, »und du hast verloren. So ist das nun einmal.«
Unvermittelt stach Switalla seinem Kneipenkumpel »Henne« mit dem Messer in die Nackengegend und in die linke Halsseite. Blut strömte aus den Wunden, und »Henne« rückte in Todesangst umgehend die geforderten 100 Mark heraus. Aber Switalla streckte das Messer weiter drohend seinem Opfer entgegen und verlangte nun noch 20 Mark, die »Henne« ihm ohnehin noch schulden würde. Kasbohrer weigerte sich, aber nur für einen kurzen Moment, denn nun schlug ihn Switalla so lange mit der Faust ins Gesicht, bis er auch diese 20 Mark erhielt.
»Na bitte, es geht doch.« Er säuberte das Messer unter dem Wasserhahn und steckte es wieder in seine Manteltasche. »Henne« blutete sehr stark, Switalla gab ihm sein Taschentuch und verließ eilig das Casino-Eck.
Als Kasbohrer die Kneipe verließ, wurde er von Switalla abgepasst. Eingeschüchtert schlug »Henne« den Weg zu seiner Wohnung ein, Switalla folgte ihm.
»Natürlich kannst du eine Anzeige erstatten. Das steht dir frei. Aber ich sage dir, wenn ich inhaftiert und verurteilt werde, dann gnade dir Gott! Irgendwann komme ich wieder raus, dann schlage ich dich tot.«
Diese Drohung wiederholte Hilmar Switalla mehrfach sowohl auf dem Weg zur als auch in der Wohnung von »Henne«. Nach einer guten Viertelstunde verabschiedete sich der Übeltäter höflich. Zuvor hatte er noch das blutverschmierte Taschentuch an sich genommen, das ihm ja gehörte. Er wusste natürlich, dass das im Ernstfall ein wichtiges Beweismittel wäre, das ihn sehr belasten könnte.
»Mach’s gut, mein Lieber!«, rief er beim Hinausgehen. »Halt dich zurück! Aber vielleicht siehst du mich in diesem Leben auch nicht wieder. Mal sehen.«
Switalla schlenderte in Richtung seiner Wohnung in der Linienstraße, wo er zusammen mit seiner Mutter lebte. In seinem Kopf kreisten in verworrenen Bahnen die Gedanken. Noch ließen sie sich nicht zusammenfügen und zu einem Sinn verbinden. Noch nicht. Na klar, er musste jetzt handeln, denn der Streit mit »Henne« hatte seinen Plan erheblich durcheinandergebracht. Was ist, wenn der Schlappschwanz doch zur Polizei geht und Anzeige erstattet?
Um Mitternacht traf Switalla bei sich zu Hause ein, seine Mutter schlief schon. Er reinigte seine Hände gründlich und befreite sich vom Blut seines Widersachers. Während er so am Waschbecken stand, verfestigte sich der Gedanke, dass er jetzt und heute handeln müsse. Aber er war unsicher, ob er für das, was er vorhatte, überhaupt den Mut aufbringen und relativ emotionslos handeln könnte. Rein technisch hatte er keinerlei Bedenken. So entschloss er sich, erst einmal einen Selbstversuch zu wagen.
Im Haus schräg gegenüber wohnte Inge Schubert – fünfzehn Jahre älter als er. Kurz nach seiner Haftentlassung 1965 hatte er sie durch seine Mutter kennengelernt, und alsbald waren sie ein Paar. Ein Dreivierteljahr lebte er sogar bei ihr, aber er war eigentlich nur an den intensiven intimen Momenten interessiert, eine Ehe war für ihn ausgeschlossen. Die Streitigkeiten zwischen beiden wurden immer heftiger – sie gerieten schon aus nichtigen Anlässen aneinander. Immer öfter kam Switalla alkoholisiert nach Hause. Wenn sie nur die kleinste kritische Bemerkung machte, schlug er sie und demolierte die Wohnungseinrichtung.
Eines Tages hatte Inge Schubert ihn ausgeschlossen. Daraufhin schlug er mit der Axt die Wohnungstür ein, attackierte seine Freundin mit einem Messer und verprügelte sie. Sie erlitt drei klaffende Wunden am Arm und eine Platzwunde im Gesicht. Er verschwand zu seiner Mutter, die er beauftragte, am nächsten Tag mit Inge Schubert zu sprechen. Die Botschaft, die die Mutter übermittelte, war eindeutig: Falls Inge Schubert ihn bei der Polizei anzeigen würde, würde er sie so zurichten, dass sie einem Menschen nicht mehr ähnlich sähe.
Aus Angst vor Rache unterließ es Inge Schubert tatsächlich, eine Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Später bat Hilmar Switalla sie sogar um Verzeihung, und beide verkehrten wieder ganz partnerschaftlich miteinander – bis zum 3. Dezember 1965. An diesem Tag wurde Switalla wegen verbrecherischer Trunkenheit inhaftiert, und Inge Schubert trennte sich abermals von ihm. Aber nicht endgültig, denn nach seiner erneuten Haftentlassung wohnte er einige Tage bei ihr. Es ist zu vermuten, dass es wieder Streit gab. Zudem hatte er eine andere Frau kennengelernt, so dass sie sich als Paar endgültig trennten. Während seiner Ehe mit Rosemarie, wobei es sich bei dieser Beziehung am Anfang vielleicht wirklich um Liebe gehandelt hatte, besuchte er aber Inge Schubert noch einige Male. Sie tranken Alkohol (selbstredend!) und plauderten über die Probleme, die Switalla nun mit seiner neuen Frau hatte.
Am 31. Dezember 1968, er erinnerte sich noch sehr gut an dieses Silvester, suchte er Inge Schubert in ihrer Wohnung auf, die aber gerade mit ihrem neuen Freund den Jahreswechsel feiern wollte. Switalla war eifersüchtig, sehr verärgert über ihre neue Beziehung; es kam zu einer Prügelei zwischen ihm und dem Freund, und da Switalla gewann, warf er ihn kurzerhand aus der Wohnung. Und er erklärte: »Ich sage dir eins, ich bestimme hier, wer sich bei dir aufhalten darf, und wenn ihr – du oder dieser Blödmann – Anzeige erstattet, schlage ich dich tot.«
Er erinnerte sich auch daran, dass er Anfang Februar 1969 nochmals bei Inge Schubert geklingelt hatte. Sie gewährte ihm Einlass, erklärte ihm aber in der Wohnung, dass er sie doch nun in Ruhe lassen möge, sie wolle nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Mit all diesen Gedanken und Erinnerungen verließ er am 14. Februar 1969 gegen 0.30 Uhr seine Wohnung. Bekleidet war er mit einer braunkarierten Hose und einem weißen Kunstfaserhemd mit dunklen Knöpfen, darüber trug er ein weiß-grün gesprenkeltes Sakko sowie einen hellen Mantel mit kariertem Futter. In die innere Manteltasche hatte er ein Brotmesser aus der Küche gesteckt. Die Scheidungsklage, ein Notizbuch, ein persönlicher Brief von seiner Frau und ein Krankenhauseinlieferungsschein aufgrund suizidaler Tendenzen vom 15. Januar 1969 befanden sich ebenfalls in seinen Taschen. Er wollte auf alles vorbereitet sein.
Hilmar Switalla ging schräg über die Straße, klingelte an der Wohnungstür von Inge Schubert, die etwas verschlafen im Morgenmantel (sie war schon zu Bett gegangen) die Tür öffnete. Er fragte: »Kann ich bei dir übernachten? Ich hab zurzeit keine Bleibe.«
Nach kurzem Überlegen willigte sie ein. »Komm rein, du kennst dich ja hier aus.«
Im Wohnzimmer rauchten beide noch eine Zigarette, dann gingen sie zu Bett, wie sie das ja schon so oft getan hatten. Inge Schubert zog ihren Morgenmantel aus, Switalla legte seine Kleidung bis auf die Unterwäsche ab. Seine Brille behielt er auf. Er verbrannte noch das von »Hennes« Blut verschmierte Taschentuch im Kachelofen, der behaglich knisterte.
Dann löschte er das Licht. Sie lagen nebeneinander im Bett – wie alte Eheleute. »Gemütlich bei dir, wie immer«, sagte Switalla. Inge Schubert erwartete jetzt ein paar Zärtlichkeiten, aber er schwieg. Nach einer Pause fragte er, ob sie beten könne.
»Nein, warum sollte ich? Ich habe doch noch nie gebetet, das weißt du doch.«
Nach einer weiteren Pause legte er sich plötzlich auf sie, packte sie am Hals und drückte mit beiden Händen kräftig zu. Inge Schubert strampelte in Todesangst mit den Beinen und versuchte, ihn wegzustoßen. Aber es gelang ihr nicht. Nach einer kurzen heftigen Gegenwehr wurden ihre Bewegungen zunehmend kraftloser, bis sie ohne sichtbare Lebenszeichen liegen blieb.
Switalla stand nun auf, schaltete das Licht wieder ein und ging in das Wohnzimmer, wo er seine Kleidungsstücke abgelegt hatte. Er nahm das Brotmesser aus seinem Mantel. An das Bett zurückgekehrt, schlitzte er ihr die linke Halsschlagader auf, durchschnitt anschließend die vordere Halspartie völlig und setzte mehrere Stiche in die Herzregion. Er war sich plötzlich nicht mehr sicher, ob er sie durch das Würgen wirklich getötet hatte.
Als das grausame Werk getan war, begann er, den Leichnam zu sezieren, denn er verfügte ja über einige berufliche Erfahrungen auf diesem Gebiet. Sektionsgehilfe, das war schon immer sein Traumberuf gewesen. Er fügte dem Opfer mehrere Schnittverletzungen im Gesicht zu und öffnete den Bauchraum, wobei er bemerkte, dass das Messer mehr riss als schnitt. Darüber war Switalla sehr verärgert und stellte das Massaker umgehend ein. Er ging in das ans Schlafzimmer angrenzende Wohnzimmer und wollte sich wieder anziehen, da entschloss er sich zu einem weiteren Selbstversuch.
Da ihn die Tat nicht sonderlich erregt hatte und er ruhig geblieben war, kehrte er in das Schlafzimmer zurück, um zu testen, ob ihn der Anblick mit dem vielen Blut erschüttern würde. Das war nicht der Fall. Die Ermordung von Inge Schubert hatte ihn nicht berührt, er fühlte sich befreit, irgendwie so, als ob gar nichts geschehen wäre. In aller Ruhe zog er sich nun an und steckte eine Packung Schlaftabletten der Marke »Kalypnon« ein, die sich in einer Glasschale auf dem Wohnzimmertisch befand. Mit diesen wollte er sein Leben beenden, nachdem er seinen Plan nun endlich vollendet haben würde.
Aus der Manteltasche von Inge Schubert nahm er noch den Haus- und Wohnungsschlüssel. Er wollte schon gehen, da stiegen wieder Zweifel in ihm auf: Diese Prüfung hast du bestanden, dachte er, du bist ruhig und gelassen geblieben. Aber gelingt das auch, wenn es dann wirklich darauf ankommt? Und willst du das auch? Er entschied sich für eine weitere Prüfung. Er löschte das Licht und verschloss die Tür; sein mörderischer Besuch hatte etwa dreißig Minuten gedauert.
Gegen 1.30 Uhr klingelte er nach einem Fußweg von ungefähr einer halben Stunde (wir befinden uns also immer noch im Stadtbezirk Berlin-Mitte) an der Wohnungstür von Ursula Kaschube, mit der er eine konfliktbehaftete, oft in Alkohol ertränkte lose Beziehung unterhielt. Er wusste, dass sie allein lebte. Trotz aller Konflikte in der Vergangenheit (die Volkspolizei in Mitte musste Ursula Kaschube mehrmals schützen!) wurde er eingelassen, so wie er es vorausgedacht hatte. Es gab kein Licht in der Wohnung, denn in den elektrischen Leitungen hatte es geknistert, so dass sie vorsichthalber alle Sicherungen herausgedreht hatte. Auf dem Betttisch stand nur ein kleiner Kerzenrest, den Switalla bei seiner Ankunft anzündete, da in der Wohnung auch keine Streichhölzer vorhanden waren.
Sie rauchten gemeinsam eine Zigarette und legten sich auf das Sofa im Zimmer. Switalla zog sich bis auf die Unterhose aus; da an seinem Unterhemd bereits viel Blut war, wollte er es nicht noch mehr beschmutzen.
Beide sprachen noch drei Minuten miteinander, dann legte er unvermittelt seine Hände um ihren Hals und würgte sie, bis keine Bewegungen mehr zu verzeichnen waren. Als er losließ, machte Ursula Kaschube noch einige röchelnde Atemzüge. Switalla nahm ein Kissen vom Sofa und drückte es ihr aufs Gesicht, bis er glaubte, dass sie tot sei. Er legte sein Ohr an ihre Brust, hörte keine Herzschläge mehr und nahm auch keinerlei Bewegung in ihrem Körper wahr.
Nun wollte er wie bei Inge Schubert mit dem mitgebrachten Messer seinem zweiten Opfer die Halsschlagadern aufschneiden, um den Tod mit Sicherheit herbeizuführen. Er nahm zunächst davon Abstand, weil er plante, dort in der Wohnung zu übernachten, sich auszuschlafen und Kraft zu sammeln für die eigentliche Prüfung – und auf einem blutüberströmten Sofa war das wohl kaum möglich. Um sein Vorhaben trotzdem realisieren zu können, legte er einige Matratzen, die an der Schrankecke standen, und einige Bekleidungsstücke auf den Fußboden des Wohnzimmers. Anschließend bettete er das Opfer darauf und schlitzte ihm mit dem mitgebrachten und schon verwendeten Brotmesser die linke Halsschlagader auf. Zur Sicherheit wollte er ihr das Messer noch in das Herz stoßen. Dabei waren ihm allerdings die Kleidungsstücke, die Ursula Kaschube trug, im Wege. So riss er ihr den BH und den Hüfthalter vom Körper, bis sie völlig nackt dalag.
Nun stieß er ihr mehrere Male mit dem Messer in die Herzregion und schnitt ihr den Hals durch. Er vollzog an ihr einen Kragenschnitt von Schulter zu Schulter, wobei er wieder die »Vision des Sezierens« hatte. Anschließend schnitt Switalla die Haut vom Kragenschnitt aus über dem Brustbein auf, verlängerte den Schnitt über die Bauchdecke bis zu den Genitalien und setzte dann das Messer am rechten Oberschenkel an. Er hatte die Absicht, den Oberschenkelknochen herauszulösen, was er aber nicht realisieren konnte, da das Messer zu stumpf war. Er wollte nun ihren rechten Unterschenkel abtrennen, was ihm aber wegen des unscharfen Messers auch nicht gelang. Er ärgerte sich sehr über sein mangelhaftes Sektionswerkzeug und gab sein Vorhaben auf, auch seinen Plan, in der Wohnung zu übernachten. Man konnte ja auch kaum etwas sehen; nur der kleine brennende Kerzenstummel spendete etwas Licht …
Er nahm das blutige Messer, tastete sich durch die dunkle Wohnung zur Küche, säuberte es dort unter dem Wasserhahn und trocknete es an einem Handtuch ab.
Wie schon bei Inge Schubert hielt er auch hier einen Moment lang inne, um seine Erregungszustände zu begutachten. Wieder fiel ihm dabei auf, dass er während der gesamten grausamen Tat ruhig und gelassen geblieben war. Er ging zum Wohnzimmer zurück, steckte das Messer in die linke Innentasche seines Mantels und zog sich an. Er steckte Wohnungs- und Haustürschlüssel, die auf dem Tisch lagen, ein, löschte ordnungsgemäß die Kerze und verließ die Wohnung. Mit einem Taxi begab er sich auf den Nachhauseweg in die Linienstraße, wo er gegen 2.30 Uhr eintraf.
Die Mutter hatte ihren Sohn bei seiner Rückkehr offensichtlich nicht kommen hören. Switalla ging in die Küche, wo sein Bett stand, entkleidete sich und legte sich schlafen. Zuvor hatte er sich den Wecker gestellt, da er bereits um 6 Uhr in Berlin-Karlshorst sein wollte.
Seit einer tätlichen Auseinandersetzung im Dezember 1968 und der darauf von seiner Ehefrau Rosemarie erstatteten Anzeige gegen ihn reifte in ihm der feste Entschluss, seine Angetraute zu ermorden. Er glaubte, sie für immer verloren zu haben, und wollte nicht, dass sie ein anderer Mann bekommt.
Zur Tötung seiner Frau hatte er mehrere Pläne in Erwägung gezogen. Einer sah vor, einen Polizisten zu überfallen, um so an eine Pistole zu gelangen. Diesen Plan hatte er jedoch wieder verworfen. Terminlich hatte sich Switalla eigentlich auf den 25. Februar 1969 festgelegt, den Tag der Ehescheidung vor Gericht. Er stellte sich vor, im Gerichtssaal seine Rosemarie mit einem Messer zu töten und anschließend seinem Leben selbst ein Ende zu setzen.
Aber nun, nach der Auseinandersetzung mit »Henne« und der drohenden Anzeige, schien es ihm angebracht, sein Vorhaben umgehend auszuführen.
Um 5.30 Uhr klingelte der Wecker, und Switalla, beseelt von seinem Projekt, das er nun verwirklichen wollte, stand sofort auf. Er dachte schnell und unkontrolliert, aber war ganz ruhig. Heute schaffe ich es, sagte er zu sich selbst, heute kommt die Vollendung, ich koste den Gedanken aus, bis ich da bin und weiß, dass nichts mehr angefangen werden kann. Alles geht seinem Ende entgegen.
Er fuhr mit der S-Bahn nach Karlshorst, wo er ungefähr nach einer Stunde ankam. Dann lief er in die Brehmstraße. Hier wohnte seine Frau in einem Mehrfamilienhaus zusammen mit ihrem geschiedenen Ehemann Wolfgang Kirchhoff, deren drei Töchtern und dem gemeinsam mit Switalla gezeugten Sohn. Es war noch früh am Tag, doch Switalla mutmaßte, dass Wolfgang Kirchhoff bereits auf seiner Arbeitsstelle verweilte.
Er war sich aber nicht ganz sicher. Die Haustür war verschlossen. Es war noch dunkel, und seine Beobachtungen der unbeleuchteten Fenster brachten ihm keine neuen Erkenntnisse.
So entschloss er sich, noch einige Zeit verstreichen zu lassen, und spazierte im Wohngebiet umher, auch zum nahe gelegenen Friedhof. Hinter den Bahnschienen lag der Tierpark, und er nahm Raubtiergerüche vom Alfred-Brehm-Haus wahr. Oder bildete es sich ein.
Als er zurückkehrte, stand die Haustür offen, und Switalla begab sich zur Wohnung ins Hochparterre. Auf mehrfaches Klopfen reagierte niemand. Er ging nochmals im Wohngebiet spazieren. Nach seiner nunmehrigen Wiederkehr klopfte er energisch an die Wohnungstür. Nichts. Er nahm Anlauf und rannte gegen die Tür, die daraufhin aufsprang. Er ging in den Flur hinein.
Rosemarie Switalla, die noch im Bett gelegen hatte, kam auf den Flur gestürzt und fragte scharf, warum er auf diese Weise in die Wohnung eingedrungen sei. Er antwortete, dass er seinen Sohn sehen wolle und das Stammbuch holen müsse. Er sah sich in der Wohnung um. Neben seinem fünfmonatigen Sohn hielten sich auch seine drei Stieftöchter zu Hause auf.
Seine Frau war ihm gegenüber zuerst kühl und abweisend, wurde aber nach und nach zutraulicher, so dass es zum Austausch von Zärtlichkeiten kam. In dieser Phase befielen ihn Zorn und Verzweiflung, und er weinte fast ununterbrochen. Daraufhin erklärte sie sich bereit, die Anzeige, die diesen ganzen Streit ja ausgelöst hatte, gegen ihn zurückzuziehen. Er meinte, dass es dafür zu spät wäre, denn er hätte bereits entsetzliche Dinge getan. Als sie nachfragte, was passiert sei, gestand er, zwei Menschen getötet zu haben. Nach dieser Offenbarung wirkte sie sehr verzweifelt und wollte wissen, wie sie ihm helfen könne. Er antwortete, dass er mit dem Vorsatz erschienen sei, auch sie zu töten. Dabei zeigte er ihr das Brotmesser mit dem Hinweis, dass es für sie bestimmt wäre. Er holte auch die Packung mit den vierzig »Kalypnon«-Tabletten aus der Tasche und wies darauf hin, dass er nach ihrer Ermordung seinem Leben ein Ende setzen wolle. Gegenüber seiner Frau äußerte Switalla den Wunsch, dass sie vorher noch einmal mit ihm schlafen solle, da er sie sehr liebe.
Rosemarie Switalla versuchte, ihren Mann vom Tötungsvorhaben abzubringen. Nach zwei Stunden, gegen 13.30 Uhr, war sie unter der Voraussetzung, dass er sein Messer und die Tabletten auf den Wohnzimmertisch lege, bereit, sich mit ihm zum Geschlechtsverkehr auf die Couch zu begeben. Switalla hatte von seiner Frau erfahren, dass sie am Nachmittag Besuch erwarte. Die Zeit drängte, und er ließ sich auf ihre Forderung ein und legte das Messer und die Tabletten auf den Wohnzimmertisch. Sie nahm beides an sich und ging in die Küche. Dort legte sie die Sachen in den Küchenschrank, den sie verschloss. Danach bat sie ihre Tochter, zu einer Nachbarin zu gehen. Das Mädchen sollte der Nachbarin sagen, dass Hilmar ihre Mutti schlagen würde, die Nachbarin solle dringendst die Volkspolizei rufen. Rosemarie Switalla sprach sehr leise, so dass ihr Mann das Gespräch nicht hörte. Um keinen Verdacht zu erregen, rief sie der Tochter hinterher, dass sie draußen spielen gehen solle.
Switalla hatte eine Waschmaschine, die sich im Korridor befand, hinter die Wohnungstür gestellt, damit niemand mehr diesen Ort betreten konnte. Und seine Frau ihm nicht davonliefe. Denn die Wohnungstür ließ sich nicht mehr verschließen; das Schließblech war durch sein gewaltsames Eindringen beschädigt. Mehr Absicherung schien in diesem Moment nicht möglich.
Dann begab er sich ins Wohnzimmer und zog sich bis auf die Unterhose aus, und auch seine Frau kam wieder in das Zimmer, ohne zu fragen, warum er die Wohnungseingangstür so versperrt hatte. Er verschloss die Stubentür, und beide legten sich auf die Klappcouch. Sie war noch voll bekleidet; Switalla begann, sie langsam zu enthüllen. Doch plötzlich klopfte es an der Wohnungstür. Beide sprangen auf. Der Besuch kommt wohl zu früh, dachte sie und zog sich schnell ihre Hose über. Und er wusste: Es war nicht der Besuch, sondern die Polizei!