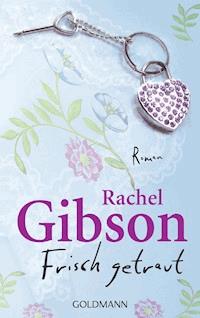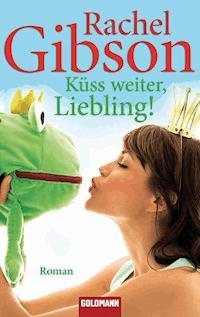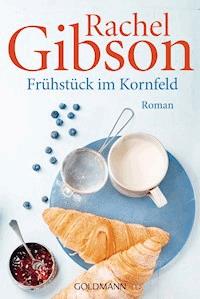
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem kleinen Nest in Idaho will sich die Sensationsreporterin Hope Spencer von ihrer missglückten Ehe erholen. Sheriff Dylan Taber erkennt sofort, dass die blonde Schönheit Ärger bedeutet. Und bis sich Hope und Dylan endlich näher kommen, haben sie noch so manche Turbulenzen zu überstehen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Rachel Gibson
Frühstückim Kornfeld
Aus dem Amerikanischenvon Elisabeth Hartmann
Frühstück im Kornfeld
In einer kleinen Provinzstadt in Idaho will sich die Sensationsreporterin Hope von ihrer missglückten Ehe und einer hartnäckigen Schreibblockade erholen. Doch die blonde Schönheit aus L.A. sorgt für allerlei Verwirrung im beschaulichen Gospel. Als sich dann auch noch der gut aussehende Sheriff Dylan Taber in Hope verliebt, ist es endgültig vorbei mit der Ruhe ...
Autorin
Seit sie sechzehn ist, erfindet Rachel Gibson mit Begeisterung Geschichten. Damals allerdings brauchte sie ihre Ideen vor allem dazu, um sich alle möglichen Ausreden einfallen zu lassen, wenn sie wieder etwas ausgefressen hatte. Ihre Karriere als Autorin begann viel später. Mittlerweile hat sie nicht nur die Herzen ihrer Leserinnen erobert, sondern wurde auch mit dem »Golden Heart Award« der Romance Writers of America und dem »National Readers Choice Award« ausgezeichnet. Rachel Gibson lebt mit ihrem Ehemann, drei Kindern, zwei Katzen und einem Hund in Boise, Idaho.
Die Originalausgabe von »Frühstück im Kornfeld« erschien 2001 unter dem Titel »True Confessions« bei Avon Books, Inc., Imprint of Harper Collins Publishers, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Einmalige Sonderausgabe Juni 2007 »Frühstück im Kornfeld« Copyright © der Originalausgabe 2001 by Rachel Gibson Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2002 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagfoto: Getty Images/Greune MR·Herstellung: sc
eISBN 978-3-641-19444-4V001
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de
Voller Dankbarkeit widme ich dieses Buchdem großen Kahunafür seine unzähligen Recherchestunden.
Inhaltsverzeichnis
1. KAPITEL
Gottes Angesicht, fotografiert in Wolken
Zwei allumfassende Wahrheiten kannte man in Gospel, Idaho. Erstens: Mit der Erschaffung des Sawtooth-Wildnisreservats hatte Gott sein Meisterstück vorgelegt. Und abgesehen von dem unglückseligen Zwischenfall im Jahre 1995 war Gospel seit jeher der Himmel auf Erden.
Zweitens – eine Wahrheit, an die man fast genauso unerbittlich glaubte wie an die erste –: Jegliche zwischen Himmel und Erde bekannte Sünde war Kaliforniens Schuld. Kalifornien wurde für alles und jedes verantwortlich gemacht, vom Ozonloch bis zu der Marihuanapflanze im Tomatenbeet der Witwe Fairfield. Schließlich hatte ihr Enkel gerade erst im vergangenen Herbst Verwandte in L. A. besucht.
Es gab noch eine dritte Wahrheit – wenngleich diese eher als unumstößliche Tatsache gehandelt wurde –: Mit jedem Sommer war damit zu rechnen, dass sich Idioten aus dem Flachland zwischen den Granitgipfeln der Sawtooth-Berge verirrten.
In diesem Sommer belief sich die Zahl der verirrten geretteten Wanderer bereits auf drei. Falls sie sich nicht erhöhte und falls noch ein weiterer Bruch und zwei weitere Fälle von Höhenkoller hinzukamen, dann würde Stanley Caldwell den Jackpot aus den Wetten über die Zahl vermisster Flachländer gewinnen. Doch Stanley war allgemein als optimistischer Spinner bekannt. Kein Mensch, nicht einmal seine Frau, die ihr Geld auf acht Vermisste und sieben Brüche gesetzt und um des Nervenkitzels wegen noch ein paar Fälle von Giftsumach draufgelegt hatte, erwartete, dass Stanley gewann.
So ziemlich jeder in der Stadt spielte mit und versuchte, die anderen zu übertrumpfen und den beträchtlichen Einsatz einzustreichen. Dank der Wette hatten die Leute aus Gospel etwas, das sie über die Gedanken ans Vieh, die Schafe und das Holzfällen hinaus beschäftigte. Sie sorgte neben den Bäume umarmenden Umweltschützern für Gesprächsstoff, gab Anlass zu Spekulationen jenseits der Frage nach dem Vater von Rita McCalls neugeborenem Jungen. Immerhin warf die Tatsache, dass Roy und Rita inzwischen schon bald drei Jahre geschieden waren, den Mann nicht gleich aus dem Rennen. Doch in erster Linie bot die Wette den Einheimischen einen harmlosen Zeitvertreib während der heißen Sommermonate, in denen sie den Touristen das Geld aus der Tasche zogen und auf den relativ ruhigen Winter warteten.
In der Bierabteilung des M&S-Supermarkts drehten sich die Gespräche um das Angeln mit Fliegen im Gegensatz zum Angeln mit Lebendködern, um die Jagd mit dem Bogen im Gegensatz zur »echten« Jagd und natürlich um den Zwölfender-Bock, den der Eigentümer des Supermarkts, Stanley, seinerzeit im Jahre 1979 geschossen hatte. Das riesige, glänzend polierte Geweih hing hinter der verbeulten Registrierkasse, wo es schon länger als zwanzig Jahre zur Schau gestellt wurde.
Drüben im Sandman-Motel an der Lakeview Street redete Ada Dover immer noch von damals, als Clint Eastwood in ihrem Haus abgestiegen war. Er war richtig freundlich gewesen und hatte sogar mit ihr gesprochen.
»Sie führen ein nettes Haus«, hatte er gesagt, und seine Stimme klang eindeutig nach Dirty Harry: Dann hatte er nach der Eismaschine gefragt und um zusätzliche Handtücher gebeten. Ada wäre um ein Haar hinter ihrem Empfangstresen tot umgefallen. Es folgten Spekulationen, ob seine Tochter mit Frances Fisher wohl in Zimmer neun gezeugt worden sein könnte oder nicht.
Die Bürger von Gospel lebten vom neuesten Klatsch. Im Friseursalon war der Sheriff von Pearl County, Dylan Taber, das beliebteste Gesprächsthema, meistens weil die Besitzerin persönlich, Dixie Howe, beim Plaudern während des Shampoonierens und Frisierens seinen Namen fallen ließ. Sie hatte ihre Angel nach ihm ausgeworfen und plante, ihn wie eine fette Forelle an Land zu ziehen.
Freilich hatte auch Paris Fernwood ihren Köder für Dylan ausgelegt, doch darüber machte sich Dixie keine Sorgen. Paris arbeitete für ihren Daddy im Cozy Corner Café, und Dixie betrachtete eine Frau, die Kaffee und Rührei servierte, nicht als Konkurrenz für eine Geschäftsfrau ihres Formats.
Noch andere Frauen wetteiferten um Dylans Gunst, zum Beispiel eine geschiedene Mutter von drei Kindern im benachbarten Bezirk und wahrscheinlich weitere, von denen Dixie nichts wusste. Doch auch deswegen zerbrach sie sich nicht den Kopf. Dylan hatte eine Zeit lang in L. A. gelebt und würde daher natürlich jemanden mit Pep und Weltgewandtheit bevorzugen. Und in Gospel fand sich keine einzige Frau mit mehr Pep als Dixie Howe.
Eine Virginia-Slim-Zigarette zwischen die Finger geklemmt, die blutroten Fingernägel blitzend im Licht, lehnte sich Dixie in einem der beiden Friseursessel aus schwarzem Vinyl zurück und wartete auf ihre für zwei Uhr angekündigte Kundin zum Schneiden und Färben.
Ein dünner Rauchfaden kräuselte sich von ihren Lippen, während sie an ihr Lieblingsthema dachte. Es ging nicht nur darum, dass Dylan der einzige heiratsfähige Mann über fünfundzwanzig und unter fünfzig Jahren im Umkreis von siebzig Meilen war. Nein, er hatte auch so eine gewisse Art, eine Frau anzusehen. Er legte dann kaum merklich den Kopf in den Nacken und blickte sie aus seinen tiefgrünen Augen an, sodass es bei ihr an ganz gewissen Stellen zu kribbeln begann. Und wenn seine Lippen sich langsam zu einem freundlichen Lächeln bogen, dann war es ganz aus.
Dylan hatte noch nie einen Fuß in den Friseursalon gesetzt, sondern fuhr lieber den ganzen Weg bis nach Sun Valley, um sich die Haare schneiden zu lassen. Das nahm Dixie nicht persönlich. Manche Männer genierten sich eben, einen so schicken Salon wie den ihren wegen eines Fasson-Schnitts aufzusuchen. Aber liebend gern wäre sie einmal mit den Fingern durch sein dichtes Haar gefahren. Liebend gern hätte sie ihn mit Händen und Mund überall gestreichelt. Wenn sie den Sheriff erst einmal in ihrem Bett hatte, würde er bestimmt nicht wieder gehen wollen. Man hatte ihr schon versichert, sie wäre die beste Nummer diesseits der kontinentalen Wasserscheide. Sie glaubte es, und es war an der Zeit, dass sie auch aus Dylan einen Gläubigen machte. Es war an der Zeit, dass er seinen großen, durchtrainierten Körper für etwas anderes benutzte als zum Schlichten von Schlägereien in der Buckhorn-Bar.
In Dixies Zukunftsplänen gab es nur eine einzige potenzielle kleine Gewitterwolke, und das war Dylans siebenjähriger Sohn. Der Kleine mochte Dixie nicht. Kinder mochten sie grundsätzlich nicht. Vielleicht, weil sie sie für eine Landplage hielt. Aber mit Adam Taber hatte sie sich wahrhaftig Mühe gegeben. Einmal hatte sie ihm ein Päckchen Kaugummi gekauft. Er hatte sich bedankt, etwa zehn Streifen in den Mund geschoben und sie dann nicht mehr beachtet. Wogegen weiter gar nichts einzuwenden gewesen wäre, hätte er sich nicht mit seinem mageren Hinterteil auf das Sofa zwischen sie und seinen Daddy gedrängt.
Doch wegen Adam machte Dixie sich auch keine Sorgen. Sie hatte einen neuen Plan. Am Morgen hatte sie von Dylans Sekretärin Hazel erfahren, dass er seinem Sohn einen jungen Hund gekauft hatte. Dixie plante, nach Ladenschluss nach Hause zu gehen und ihre augenfälligsten Vorzüge in ein knappes Oberteil zu zwängen. Dann würde sie mit einem großen, saftigen Knochen für den neuen Hund vorbeikommen. Damit musste sie den Kleinen doch endlich gewinnen. Genauso, wie sie mit ihrer Körbchengröße DD endlich den Daddy gewinnen musste. Falls Dylan nichts merkte und nicht nahm, was sie ihm offerierte, dann war er eindeutig schwul.
Natürlich wusste sie, dass er nie im Leben schwul war. Damals in der High School war Dylan Taber ein wilder Draufgänger gewesen, hatte mit seinem schwarzen Dodge Ram, eine Hand am Steuer, die andere auf dem Oberschenkel irgendeines glücklichen Mädchens, die Straßen von Gospel unsicher gemacht. Meistens, wenn auch nicht immer, war Dixies ältere Schwester Kim dieses glückliche Mädchen gewesen. Dylan und Kim hatten nach Dixies Einschätzung eine echte heiß-kalte Beziehung. Entweder loderte es zwischen ihnen, oder es war eisig. Dazwischen gab es nichts. Und wenn es gerade mal loderte, dann heizte es Kims Zimmer zu höllischen Temperaturen auf. Damals hatte Dixies Mutter den Großteil ihrer Zeit in einer der Bars am Ort verbracht, und Kim hatte ihre Abwesenheit schamlos ausgenutzt – was nicht heißt, dass ihre Mutter es gemerkt hätte, wenn sie zu Hause gewesen wäre. Vor ihrer »Wiedergeburt« hatte Lilly Howe die meiste Zeit mit Trinken, Betrunkensein oder im Koma zugebracht.
Zwar war Dixie zu jener Zeit erst elf Jahre alt, doch sie wusste wohl, was die Geräusche auf der anderen Seite ihrer Schlafzimmerwand zu bedeuten hatten. Das schwere Atmen, das tiefe kehlige Stöhnen, die lustvollen Seufzer. Mit elf wusste sie längst genug über Sex, um sich vorstellen zu können, was ihre Schwester trieb. Doch es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis sie zu würdigen wusste, wie lange die beiden die Sprungfedern zum Quietschen brachten.
Dylan war siebenunddreißig, Sheriff von Pearl County und Vater eines siebenjährigen Jungen. Er war angesehen, doch Dixie hätte ihre letzte Flasche Blondtönung darauf verwettet, dass er unter seiner Uniform draufgängerischer war denn je. Dylan Taber war inzwischen eine Respektsperson in der Gemeinde, und den Gerüchten zufolge, die in der Stadt kursierten, hatte er auch dort, wo es zählte, Respektables aufzuweisen. Es war an der Zeit, dass Dixie sich selbst davon überzeugte.
Während Dixie Pläne schmiedete, zog das Objekt ihrer Begierde sich den schwarzen Stetson tief in die Stirn und trat hinaus auf die verzogene Veranda vor dem Büro des Sheriffs. Vom schwarzen Asphalt und den Motorhauben der zu beiden Seiten längs der Main Street geparkten Autos stieg wellenförmig Hitze auf. Der Geruch füllte seine Nase.
»Die Wanderer wurden zuletzt auf halber Höhe vom Mount Regan gesehen«, informierte Dylan seinen Stellvertreter, Deputy Lewis Plummer, als sie zum Wagen des Sheriffs, einem braun-weißen Blazer, gingen. »Doktor Leslie ist schon auf dem Weg hinauf, und ich habe Parker angefunkt, dass er mit den Pferden am Basislager zu uns stoßen soll.«
»Ich habe nicht die geringste Lust, den Tag mit einem Marsch in die Wildnis zu verbringen«, nörgelte Lewis. »Es ist viel zu heiß, verdammt noch mal.«
Gewöhnlich störte es Dylan nicht, wenn er helfen musste, verirrte Rucksacktouristen zu suchen. So kam er aus dem Büro heraus und weg von dem verhassten Papierkram. Aber Adams Hund hatte ihn fast die ganze Nacht nicht schlafen lassen, und daher freute er sich nicht unbedingt auf einen Aufstieg auf über zweitausendsiebenhundert Meter. Er ging zur Beifahrertür des Blazer und schob eine Hand in die Tasche seiner braunen Hose, entnahm ihr den »coolen« Stein, den Adam ihm am Morgen geschenkt hatte, und steckte ihn in die Brusttasche. Es war noch nicht einmal Mittag, und trotzdem klebte ihm das baumwollene Uniformhemd schon am Rücken. Scheiße.
»Was zum Teufel ist das?«
Dylan sah Lewis über das Dach des Chevy hinweg an, dann richtete er seine Aufmerksamkeit auf den silbernen Sportwagen, der auf sie zukam.
»Der muss kurz vor Sun Valley falsch abgebogen sein«, vermutete Lewis. »Hat sich bestimmt verfahren.«
In Gospel, wo die Farbe eines Männernackens vorzugsweise rot ist und wo Pick-ups und Nutzfahrzeuge die Straßen beherrschten, war ein Porsche etwa genauso unauffällig wie eine Demo für die Rechte der Schwulen vor dem Himmelstor.
»Wenn er sich verfahren hat, wird ihm schon jemand Bescheid sagen«, bemerkte Dylan, schob erneut die Hand in die Hosentasche und zog dieses Mal seine Schlüssel heraus. »Früher oder später«, fügte er hinzu. In dem Urlaubsort Sun Valley war ein Porsche kein so seltener Anblick, doch hier in der Wildnis war er schon verdammt ungewöhnlich. In Gospel waren manche Straßen nicht einmal gepflastert. Und von diesen Straßen wiesen einige zudem noch Schlaglöcher auf, die so groß wie ein Basketball waren. Wenn dieser kleine Wagen sich einen falschen Schlenker erlaubte, konnte es ihn durchaus die Ölwanne oder eine Achse kosten.
Der Wagen rollte langsam vorüber, die getönten Scheiben verbargen die Insassen. Dylan senkte den Blick zu den reflektierenden Kennzeichen, bestehend aus sieben Buchstaben: MZBHAVN. Miz Behaving – Miss Anständig. Als wäre das noch nicht schlimm genug, wies das Schild am oberen Rand auch noch in roter Farbe, grell wie eine Neonreklame, das Wort »Kalifornien« auf. Dylan hoffte von Herzen, der Wagen würde eine verbotene Kehrtwende machen und die Stadt auf schnellstem Wege wieder verlassen.
Stattdessen wurde der Porsche vor dem Blazer eingeparkt, der Motor abgeschaltet. Die Fahrertür öffnete sich. Ein türkisfarbener Tony-Lama-Stiefel mit silberner Spitze traf aufs Pflaster, ein schlanker nackter Arm hob sich zum oberen Türrahmen. Das Licht fing sich glitzernd auf einer schmalen goldenen Uhr an einem grazilen Handgelenk. Und dann stand Miss Anständig vor ihnen und sah aus, als wäre sie soeben einem Hochglanzmagazin für Schönheitstipps entstiegen.
»Heilige Scheiße«, bemerkte Lewis.
In ihrem glatten blonden Haar schimmerte das Sonnenlicht so golden wie auf ihrer Uhr. Von einem Seitenscheitel aus fiel das glänzende Haar ohne eine Spur von widerspenstigen Locken oder Wellen auf ihre Schultern. Die Spitzen waren so gerade, als wären sie mit der Wasserwaage geschnitten worden. Eine schwarze Sonnenbrille verbarg die Augen, nicht aber die Bögen ihrer blonden Brauen und ihre glatte, makellose Haut.
Die Autotür schlug zu, und Dylan sah Miss Anständig auf sich zukommen. Diese vollen Lippen waren schlicht unmöglich zu übersehen. Ihr glänzender roter Mund zog seine Aufmerksamkeit auf sich wie die leuchtendste Blume im Garten Schwärme von Bienen, und er fragte sich, ob sie ihre Lippen wohl hatte unterspritzen lassen.
Als Dylan Julie, die Mutter seines Sohnes, zum letzten Mal gesehen hatte, hatte sie der Natur gerade nachgeholfen, und ihre Lippen hatten irgendwie unbeteiligt auf ihrem Gesicht aufgelegen, wenn sie sprach. Richtig unheimlich.
Selbst wenn er nicht das kalifornische Autokennzeichen dieser Frau gesehen hätte und wenn sie noch dazu in einen Kartoffelsack gekleidet gewesen wäre, hätte er doch gewusst, dass sie der mondäne Typ war. Er erkannte es an der Art, wie sie sich bewegte, selbstbewusst, zielstrebig und eilig. Mondäne Großstadtfrauen hatten es immer so eilig. Sie sah aus, als gehörte sie auf den Rodeo Drive, aber doch nie im Leben in die Wildnis von Idaho. Ein weißes Stretch-Top bedeckte die vollen Rundungen ihres Busens, und ihre Jeans klebten an ihr wie Frischhaltefolie.
»Entschuldigen Sie«, sagte sie und blieb neben der Motorhaube des Blazer stehen. »Ich dachte, Sie könnten mir vielleicht helfen.« Ihre Stimme war glatt wie alles an ihr, klang aber ausgesprochen gereizt.
»Haben Sie sich verfahren, Madam?«, fragte Lewis.
Sie stieß den Atem aus mit diesen tiefroten Lippen, die bei näherer Betrachtung jedoch völlig natürlich erschienen. »Ich suche die Timberline Road.«
Dylan tippte mit dem Zeigefinger an seinen Hut und schob ihn höher in die Stirn. »Sind Sie mit Shelly Aberdeen befreundet?«
»Nein.«
»Nun ja, außer Shelly und Paul Aberdeens Haus gibt es nichts an der Timberline.« Er zog seine verspiegelte Sonnenbrille aus der Brusttasche und setzte sie auf. Dann verschränkte er die Arme vor der Brust, verlagerte sein Gewicht auf einen Fuß, ließ den Blick ihren schlanken Hals entlang bis zu ihren vollen, runden Brüsten wandern und lächelte. Sehr hübsch.
»Sind Sie sicher?«, fragte sie.
Ob er sicher war? Paul und Shelly wohnten seit ihrer Hochzeit vor etwa achtzehn Jahren dort in ihrem Haus. Er lachte leise und blickte wieder auf in ihr Gesicht. »Ziemlich sicher. Ich war heute Morgen noch bei ihnen, Madam.«
»Man hat mir gesagt, Haus Nummer zwei Timberline läge an der Timberline Road.«
»Sind Sie da ganz sicher?«, fragte Lewis und warf Dylan einen Blick zu.
»Ja«, antwortete die Frau. »Ich habe die Schlüssel beim Makler in Sun Valley abgeholt, und der hat mir diese Adresse genannt.«
Allein die Erwähnung des Hauses beschwor bei den Bewohnern von Gospel grausige Erinnerungen herauf. Dylan hatte gehört, dass das Haus endlich an einen Immobilienmakler verkauft worden war, und offenbar hatte die Firma jetzt ein Opfer gefunden.
»Und Sie wollen wirklich zu Timberline Nummer zwei?«, vergewisserte sich Lewis und wandte sich wieder der Frau zu. »Da haben früher die Donnellys gewohnt.«
»Ganz recht. Ich habe es für das kommende halbe Jahr gemietet.«
Dylan zog sich den Hut wieder tiefer in die Stirn. »Dort hat seit einiger Zeit niemand mehr gewohnt.«
»Tatsächlich? Davon hat der Makler kein Wort gesagt. Wie lange steht es schon leer?«
Lewis Plummer war ein Kavalier von altem Schrot und Korn und zählte zu den wenigen in der Stadt, die Flachländern gegenüber nicht schamlos schwindelten. Außerdem war Lewis in Gospel geboren und aufgewachsen, und hier galten Ausflüchte als Kunst. Er hob die Schultern. »Ein, zwei Jahre.«
»Ach, ein, zwei Jahre, das ist nicht so schlimm, wenn das Haus in Stand gehalten wurde.«
In Stand gehalten, Teufel auch. Als Dylan das letzte Mal das Haus der Donnellys betreten hatte, lag überall fingerdicker Staub – selbst auf dem Blutfleck im Wohnzimmer. Miss Anständig stand ein gehöriger Schock bevor.
»Bleibe ich einfach auf dieser Straße?« Sie drehte sich um und deutete die Main Street entlang, die den natürlichen Kurven der Uferlinie des Gospel-Sees folgte. Sie trug diesen zweifarbigen französischen Nagellack, den Dylan schon immer irgendwie sexy fand.
»Ja«, antwortete er. Hinter seiner verspiegelten Sonnenbrille folgte sein Blick den natürlichen Kurven ihrer schlanken Hüften und Schenkel, glitt an ihren langen Beinen hinab bis zu den Füßen. Ein Mundwinkel zuckte, und Dylan kämpfte gegen den Drang, laut über die auf ihre Stiefel mit den silbernen Spitzen gemalten Pfauen zu lachen. Derartiges hatte er bisher höchstens mal an einer Rodeo-Tunte gesehen. »Fahren Sie etwa vier Meilen weiter, bis Sie zu einem großen weißen Haus mit Blumenkästen voller Petunien und einem Schaukelgerüst im Garten kommen.«
»Ich liebe Petunien.«
»Aha. Bei dem Haus mit den Petunien biegen Sie links ab. Das Haus der Donnellys liegt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Sie können es gar nicht verfehlen.«
»Man sagte mir, das Haus sei grau und braun. Stimmt das?«
»Ja, so würde ich es auch beschreiben. Was meinst du, Lewis?«
»Ja. Es ist braun und grau, genau.«
»Schön. Danke für Ihre Hilfe.« Sie wandte sich zum Gehen, doch Dylans nächste Frage hielt sie zurück.
»Keine Ursache, Ms. –?«
Sie sah ihn lange an, bevor sie antwortete: »Spencer.«
»Willkommen in Gospel, Ms. Spencer. Ich bin Sheriff Taber, und das ist Deputy Plummer.« Sie sagte nichts darauf, und er fragte: »Was wollen Sie da draußen an der Timberline Road?« Nach Dylans Meinung hatte jeder Mensch Anspruch auf seine Privatsphäre, ebenso gut aber auch das Recht zu fragen.
»Nichts.«
»Sie mieten ein Haus für ein halbes Jahr und haben keinerlei Pläne?«
»Ganz recht. Gospel erschien mir als der richtige Ort für einen schönen Urlaub.«
Dylan hegte gewisse Zweifel an der Aufrichtigkeit ihrer Antwort. Frauen, die flotte Sportwagen fuhren und Designer-Jeans trugen, verbrachten ihren Urlaub in »netten« Ferienorten mit Zimmerservice und Animateuren, zum Beispiel im Club Med, aber nicht in der Wildnis von Idaho. Zum Kuckuck, das Einzige, was in Gospel entfernte Ähnlichkeit mit Erholungseinrichtungen hatte, war Petermans Whirlpool.
»Hat der Makler was über den alten Sheriff Donnelly verlauten lassen?«, fragte Lewis.
»Über wen?« Sie zog die Brauen zusammen, sodass sie unter ihrer Sonnenbrille verschwanden. Ungeduldig schlug sie sich mit der flachen Hand auf den Schenkel und sagte: »Also, vielen Dank für Ihre Hilfe, meine Herren.« Dann machte sie auf dem Absatz kehrt und marschierte zurück zu ihrem Porsche.
»Glaubst du der?«, wollte Lewis wissen.
»Dass sie hier Urlaub macht?« Dylan zuckte mit den Achseln. Ihm war es gleich, was sie tat, solange sie keinen Ärger machte.
»Sie sieht nicht aus wie eine Rucksacktouristin.«
Dylans Blick heftete sich auf ihr Hinterteil in den engen Jeans. »Oh, nein.« Das Dumme an jeder Art von Ärger war, dass er sich früher oder später eben doch einstellte. Kein Grund, ihn zu suchen, wenn man Besseres zu tun hatte.
»Möchte wissen, warum eine Frau wie die den alten Kasten mietet«, sagte Lewis, als Ms. Spencer die Wagentür öffnete und einstieg. »So was wie die hab ich lange nicht gesehen. Vielleicht noch nie.«
»Du kommst nicht genug aus Pearl County raus.« Dylan setzte sich hinters Steuer des Blazer und schlug die Tür zu. Dann schob er den Schlüssel ins Zündschloss und blickte dem davonfahrenden Porsche nach.
»Hast du dir diese Tony-Lama-Stiefel mal genau angesehen?«, fragte Lewis und ließ sich auf dem Beifahrersitz nieder.
»Die waren nicht zu übersehen.« Als Lewis die Tür geschlossen hatte, ließ Dylan den Motor an und fuhr los. »Sie hält’s dort keine sechs Minuten aus, geschweige denn sechs Monate.«
»Wollen wir wetten?«
»So blöd bist nicht mal du, Lewis.« Dylan riss das Steuer herum und folgte der Straße stadtauswärts. »Wenn sie das alte Donnelly-Haus sieht, hält sie gar nicht erst an, sondern fährt gleich weiter.«
»Mag sein, aber ich hab ’nen Zehner in der Brieftasche, und der sagt, sie bleibt eine Woche.«
Dylan dachte daran, wie Miss Anständig auf ihn zugekommen war: glatt, glänzend und kostspielig. »Ich setze dagegen, alter Freund.«
2. KAPITEL
Blutdürstige Fledermäuse greifen ahnungslose Frau an
Hope Spencer schlug die Wagentür zu, verschränkte die Arme unter der Brust und lehnte sich mit dem Hinterteil an ihren silbernen Porsche. Die Sonne brannte weißglühend von einem endlosen blauen Himmel und versengte unversehens ihre bloßen Schultern und ihren Scheitel. Nicht einmal die Ahnung von einem Lufthauch fächelte ihr Gesicht oder durchdrang das Top aus einem Baumwoll-Lycra-Gemisch, das auf ihrer Haut klebte. Das unablässige Summen von Insekten gesellte sich zum Jaulen eines schnulzigen Countrysongs aus dem einsamen Haus jenseits des Kieswegs.
Hopes Augen wurden schmal, und ihre Ray-Ban-Sonnenbrille glitt ihren Nasenrücken herab. Timberline Nummer zwei war tatsächlich braun und grau. Braun an den Stellen, wo die graue Farbe abgeblättert war.
Das Haus erinnerte an das Motel in dem Film Psycho, keineswegs an das »Sommerhaus«, das sie nach der Schilderung des Maklers erwartet hatte. Sicher, die »Ländereien« waren kürzlich gemäht worden. Im Umkreis von sechs Metern um das Haus und an einem Weg, der zum Strand führte, waren hüfthohes Unkraut und Wiesenblumen niedergemacht worden. Von Hopes Standpunkt aus wirkte der See wie eine Mischung aus Licht und dunklen Grüntönen. Sonne kollidierte mit Schatten und prallte von kleinen Kräuselwellen ab, als ob Aluminiumfolie auf dem Wasser trieb. Ein Fischerboot war am sandigen Ufer festgemacht und schaukelte auf den sanften Wogen.
Hope rückte ihre Sonnenbrille zurecht und blickte zu den zerklüfteten Sawtooth-Bergen auf, die so nah wirkten, als stünden sie in ihrem Garten. Der Anblick stimmte vollkommen mit den Ansichtskarten dieser Gegend überein, die ihr Arbeitgeber ihr gezeigt hatte. Das schöne Amerika. Dicke, hohe Fichten und granitene Gipfel ragten steil auf und berührten den unendlichen Himmel. Vermutlich weckten die aromatische Luft und diese gewaltige Bergherrlichkeit in den meisten Leuten ein Gefühl der Ehrfurcht. Als würde Gott seine Gnade ausgießen. Wie eine religiöse Offenbarung.
Hope glaubte ungefähr genauso sehr an religiöse Offenbarungen wie an Bigfoot-Sichtungen. Während ihrer Berufszeit hatte sie zu viel gelernt, um Geschichten von haarigen, wilden Affenmenschen, weinenden Statuen oder Strychnin trinkenden Eiferern für bare Münze zu nehmen. Sie glaubte keinem Menschen, der Bigfoot, den riesigen Affen, durch den Wald hatte laufen sehen oder behauptete, das Antlitz Jesu auf einer Tortilla erkannt zu haben.
Himmel, einer ihrer erfolgreichsten Artikel, »Verlorene Arche des Alten Bundes im Bermudadreieck entdeckt«, hatte eine riesige religiöse Gefolgschaft nach sich gezogen und zwei weitere ebenso erfolgreiche Artikel inspiriert: »Garten Eden im Bermudadreieck gefunden« und »Elvis lebt im Garten Eden im Bermudadreieck«. Elvis und das Bermudadreieck kamen bei ihren Lesern immer gut an.
Doch wenn Hope die mächtigen Berge und den endlosen Raum vor ihren Augen betrachtete, fühlte sie sich in erster Linie klein. Unbedeutend. Allein. Die Art von Alleinsein, die sie überwunden geglaubt hatte. Die Art, die aus der trockenen Gebirgsluft nach ihr zu greifen und sie zu ersticken drohte, falls sie es zuließ. Dass sie sich in diesem Augenblick nicht wie der letzte Mensch auf dem Planeten fühlte, verdankte sie einzig und allein dem entnervenden Jaulen der elektrischen Gitarre im Radio der Nachbarn.
Hope nahm ihre Tasche aus dem Wagen und ging den unbefestigten Holperweg entlang zur Haustür. Vorsicht lenkte sie jeden Schritt ihrer Tony-Lama-Stiefel. Sie hatte gründlich recherchiert. In diesem Teil des Landes gab es Schlangen. Klapperschlangen.
Der Makler hatte ihr versichert, dass die Klapperschlangen in den Bergen blieben, und demzufolge befand sich Timberline Nummer zwei ihrer Meinung nach mitten drin im Klapperschlangengebiet. Sie überlegte, ob Walter sie mit Absicht hierher geschickt hatte, um sich für den Ärger zu rächen, den sie ihm und dem Blatt in letzter Zeit bereitet hatte.
Eine feine Staubschicht bedeckte die Veranda, und die alten Stufen knarrten ein bisschen unter ihren Füßen, doch zu ihrer maßlosen Erleichterung fühlte sich das Holz solide an. Wenn sie auf der Veranda einbrach, würde drei Tage lang kein Mensch sie vermissen. Erst, wenn ihr Ultimatum abgelaufen war, käme überhaupt jemand auf die Idee, nach ihr zu suchen, und vielleicht nicht einmal dann.
Weder ihr oberster Chef noch ihr Verleger noch ihr Herausgeber, Walter Boucher, war im Augenblick sonderlich zufrieden mit ihr. Dieser »Arbeitsurlaub« war deren Idee gewesen. Sie hatte seit Monaten nichts Gutes mehr zu Stande gebracht, und sie hatten sie nachhaltig bekniet, doch mal einen Tapetenwechsel vorzunehmen. Irgendeine Gegend, die sie zu Bigfoot-Geschichten und Außerirdischen-Artikeln inspirierte. Und dann war da natürlich noch das endlose Fiasko wegen Micky, dem magischen Gnom. Deswegen waren sie immer noch sauer.
Hope schob den Schlüssel ins Schloss und stieß die Tür auf. Sie wusste nicht, was sie erwartet hatte, aber nichts geschah. Kein Messer schwingender Psychopath in den Kleidern seiner Mutter, keine Gespenster, keine wilden Tiere, die sie in Angst und Schrecken versetzten. Nichts. Nur der Geruch nach abgestandener Zimmerluft und nach Staub, und hinter ihr ergoss sich das Sonnenlicht in den Hauseingang und erhellte den Raum zu ihrer Rechten. Hope fand einen Lichtschalter direkt neben der Eingangstür und betätigte ihn. Die Deckenleuchte summte kurz und warf dann schimmerndes Licht über die verbliebenen Schatten.
Sie schob ihre Sonnenbrille in die Tasche, ließ für alle Fälle die Tür offen stehen und drang tiefer ins Haus vor. Das Speisezimmer links von ihr war angefüllt mit schweren Anrichten und einem geschnitzten Geschirrschrank. Alles schrie geradezu nach Möbelpolitur und Glasklar. Ein langer Tisch nahm den Großteil des Raums ein, eine Ausgabe einer Jagdzeitschrift und ein Holzblöckchen waren unter ein Bein geschoben. Alles war von einer feinen Staubschicht bedeckt.
Während das Speisezimmer den Eindruck vernachlässigter Eleganz erweckte, erinnerte das Wohnzimmer zu ihrer Rechten an eine Jagdhütte. Prall gepolsterte Leder- und Holzmöbel, ein Fernseher mit Antenne, ein Bärenfell über dem Kamin aus Felssteinen. Auf der Umrandung stand ein ausgestopfter Luchs mit gefletschten Zähnen und ausgestreckten Krallen. Couch- und Beistelltische bestanden aus auf Geweihen angebrachten Glasplatten. An die Wände oberhalb der Holzverkleidung waren noch mehr Geweihe und Dutzende von imposanten Tierköpfen genagelt. Hemingway hätte seine helle Freude daran gehabt, doch nach Hopes Meinung sah es aus wie ein Unfall, der auf ein Opfer wartet. Sie konnte sich gut vorstellen, dass sie sich hier aufspießte, wenn sie bei Nacht durch den Raum ging.
Das Klappern ihrer Absätze hallte durch das leere Haus, als sie den Weg zur Küche suchte. Bis auf die letzten drei Jahre hatte Hope immer mit jemandem zusammengelebt. Mit ihren Partnern, Zimmergefährtinnen auf dem College und dann mit ihrem Ex-Mann. Jetzt lebte sie allein, doch wenngleich ihr das wirklich gefiel, wünschte sie sich zum ersten Mal seit langer Zeit einen großen kräftigen Mann, der ihr vorausging und sie vor dem Unbekannten beschützte. Einen Mann, bei dem sie sich anschmiegen und hinter dem sie sich verstecken konnte. Einen Mann von der Größe des Sheriffs, den sie kurz zuvor kennen gelernt hatte. Hope war eins vierundsiebzig groß, und der Sheriff überragte sie locker um mindestens fünfzehn Zentimeter, hatte breite Schultern, stahlharte Muskeln und kein Gramm Fett am Körper.
Sie betrat die Küche und schaltete das Licht ein. Golden. Das Linoleum, die Arbeitsflächen und die Installationen – alles bis auf das schmiedeeiserne Topf- und Pfannenregal über dem Herd. Sie öffnete die Ofenklappe und fand eine tote Maus, die auf dem Grillrost alle viere von sich streckte. Hope ließ los, die Klappe schnellte zurück und schloss krachend, und sie dachte erneut an den Sheriff und daran, dass Männer manchmal doch ganz nützlich sein konnten.
Bevor Sheriff Taber seine Sonnenbrille aufsetzte, hatte er sie mit tief grünen Augen genau gemustert, und zu diesen Augen gehörte ein Gesicht, das entschieden besser auf eine Kinoleinwand passte als in die Wildnis von Idaho.
Er war attraktiv, aber nicht wie ein hübscher Junge. Hübsche Jungen verloren ihre Schönheit, wenn sie in die Jahre kamen, und kein Mensch wäre je auf die Idee gekommen, den Sheriff für einen Jungen zu halten. Er war ein Mann durch und durch, ein großer schöner Mann mit einem Lächeln, das ohne weiteres ein Nein in ein Ja umwandeln konnte, eine schwache Frau straffer stehen und die Brust rausstrecken ließ und den Wunsch weckte, ihr Haar in den Nacken zu werfen. Hope betrachtete sich nicht als schwache Frau, doch selbst sie musste sich eingestehen, dass sie während ihres kurzen Gesprächs mehrere Male ihre Haltung kontrolliert hatte.
Sie wusste nicht, was sie vom Aussehen der Hüter von Recht und Ordnung in diesem Teil der Welt erwartet hatte. Vielleicht hatte sie sich diese eher wie den bleistiftdünnen Deputy vorgestellt oder vielleicht wie Andy Griffith. Wie einen Bauernlümmel. Doch hinter diesen grünen Augen und dem bereitwilligen Lächeln steckte unübersehbar eine Intelligenz, die nicht mit einem Strohkopf zu verwechseln war.
Hope ging durch das Wohnzimmer zurück zur Treppe in den ersten Stock. Am Fuß der Treppe betätigte sie den Lichtschalter, aber nichts geschah. Entweder funktionierte das Licht nicht, oder die Glühbirne war hinüber. Einen Moment lang stand sie da und blickte nach oben in die tiefen Schatten im ersten Stock, dann überwand sie sich und stieg die dunkle Treppe hinauf. Das Herz klopfte ihr bis zum Halse.
Aus vier oder fünf offenen Türen ergoss sich Sonnenlicht in den Flur, und die heiße Luft war durchdrungen von einem schwachen Geruch nach etwas, das ihr aus Kindertagen verschwommen vertraut war, wie eine lange verschüttete Erinnerung. Hope ging weiter zum ersten Zimmer und spähte hinein. Die schweren Vorhänge waren geschlossen und sperrten das Licht aus, doch sie konnte den Umriss des Betts erkennen und die Kommoden, auf denen Deckchen lagen. Sie sah die Silhouette eines alten Schranks mit offenen Türen. Der Geruch wurde intensiver, und Hope erahnte Ammoniak und erinnerte sich schwach an den Sommer 1975 – das einzige Mal, dass sie an einem Zeltlager der Pfadfinderinnen teilgenommen hatte.
Sie tastete nach dem Lichtschalter neben der Tür. Auf dem Fußboden und den Deckchen bemerkte sie Flecken wie von getrocknetem Schlamm; und was das war, wurde ihr nur eine Sekunde später, bevor sie das verräterische Kreischen, das Kratzen scharfer Krallen und Flattern von Flügeln vom Schrank her hörte, klar.
Zwei Schatten schossen auf sie zu, und als wäre sie wieder zehn Jahre alt und stünde in der Tür ihrer Hütte im Camp von Piney Mountain, riss sie den Mund auf und schrie. Doch im Gegensatz zu jener Zeit vor fünfundzwanzig Jahren wirbelte sie nun auf ihren Stiefelabsätzen herum und rannte, was das Zeug hielt. Dieses Mal wartete sie nicht, bis sie das Klatschen von Fledermausflügeln an der Wange oder das Festhaken von Krallen in ihrem Haar spürte.
Sie hetzte die Treppe hinunter, vorbei an der Wand mit den Geweihen und zur Haustür hinaus. Sie schrie noch, als sie von der Veranda sprang und ihre Füße vorwärts strebten, bevor sie den Boden berührt hatten. Ihr Herz raste noch schneller als ihre Füße, und sie blieb erst stehen, als sie sich hinter ihrem Auto in Sicherheit gebracht hatte. Ihre Lungen brannten, als sie auf den Knien durch den Schmutz kroch und keuchend nach Luft rang.
»O mein Gott, o mein Gott«, japste sie und fuhr sich mit den Händen an die Kehle. Vor ihren Augen tanzten Sterne, und ihr Puls raste wie verrückt. Wenn sie sich nicht beruhigte, würde sie umkippen oder einen Herzinfarkt kriegen, oder in ihrem Kopf würde eine lebenswichtige Ader platzen. Sie wollte nicht sterben. Nicht hier im Dreck. Nicht in der Wildnis von Idaho.
Hope holte tief Luft und senkte den Kopf zwischen die Knie. Diesen Makler würde sie umbringen. Sobald sie wieder bei Atem war, würde sie ins Auto springen, nach Sun Valley fahren und ihn zur Schnecke machen. Sie stellte sich das Gesicht des Maklers vor, und sie hörte zum ersten Mal das Gelächter – wirkliches Gelächter.
Als sie den Blick hob, erspähte sie links von ihr zwei kleine Jungen, die sich krümmten vor Lachen. Beide hatten kein Hemd an, und beide trugen nichts als blaue Nylon-Shorts und braune Cowboy-Stiefel. Einer zeigte auf sie, während der andere sich einen gewissen Körperteil hielt, als fürchtete er, in die Hose zu machen. Sie amüsierten sich großartig auf ihre Kosten. Es war ihr gleich. Sie spürte praktisch schon, wie in ihrem Kopf etwas platzte, und hatte längst nicht mehr die Kraft, sich auch nur annähernd beschämt zu fühlen.
»Du-du-du«, stammelte der Junge, der auf sie zeigte, bevor er sich mit vor lauter Lachen bebenden, mageren Schultern auf der Straße wälzte.
Hope erhob sich so weit, dass sie über das Heck ihres Wagens hinweg zum Haus hinüberblicken konnte. »Habt ihr gesehen, ob Fledermäuse aus dem Haus hinter mir hergeflogen sind?«, fragte sie laut, um das schrille Lachen zu übertönen.
Der Junge mit der Hand im Schritt schüttelte den Kopf.
»Bist du sicher?« Sie stand auf und wischte sich den Staub von den Knien.
»Ja.« Er kicherte und ließ endlich die Hände sinken. »Hab nur gesehen, wie du rausgeflogen kamst.«
Sie griff nach der Sonnenbrille in ihrer Handtasche, die nicht mehr über ihrer Schulter hing. Sie überschattete die Augen mit einer Hand und spähte über den staubigen Vorgarten hinweg. Keine Tasche. Keine Sonnenbrille. Keine Autoschlüssel. Wahrscheinlich hatte sie ihre Tasche da drinnen fallen gelassen. Wahrscheinlich oben. Beim Fledermauszimmer.
»Jungs, wollt ihr euch ein paar Dollar verdienen?«
Die Aussicht auf ein wenig Geld ließ den Jungen, der auf der Straße lag, auf die Füße springen, obwohl er sein Lachen noch immer nicht ganz unter Kontrolle hatte. »Wie viel?«, brachte er schließlich hervor.
»Fünf Dollar.«
»Fünf Dollar!«, staunte der andere. »Zusammen oder für jeden?«
»Für jeden.«
»Wally, wir könnten uns einen Haufen Pfeile für unsere Schießeisen holen.«
Jetzt erst bemerkte Hope die neon-orangefarbenen Gewehre und dazu passenden Gummipfeile, die beide Jungen im Bund ihrer Shorts trugen.
»Ja, und obendrein noch Süßigkeiten«, fügte Wally hinzu.
»Was sollen wir machen?«
»Geht ins Haus und holt mir meine Tasche.«
Das Lächeln der beiden erstarb. »Ins Donnelly-Haus?«
»Da spukt’s.«
Hope musterte die Gesichter der beiden. Der Junge namens Wally hatte kupferrotes Haar und war über und über mit Sommersprossen bedeckt. Der andere blickte sie aus großen grünen Augen an, und sein Gesicht war von kurzen dunklen Locken umrahmt. Ihm fehlte ein Schneidezahn, und der neue wuchs ein wenig schief nach. »Da drin wohnen Geister«, sagte er.
»Ich habe keine Geister gesehen«, versicherte Hope und wandte den Blick zur Haustür, die immer noch weit offen stand. »Nur Fledermäuse. Habt ihr Angst vor Fledermäusen? Ich könnte es durchaus verstehen.«
»Ich nicht. Du, Adam?«
»Nee. Meine Großmutter hatte letztes Jahr Fledermäuse in ihrer Scheune. Die tun dir nichts.« Nach einer kurzen Pause fragte Adam seinen Freund: »Hast du Angst vor Geistern?«
»Du?«
»Wenn du keine Angst hast, hab ich auch keine.«
»Und wenn du keine hast, hab ich keine. Und außerdem haben wir ja diese Dinger.«
Hope wandte sich wieder den Jungen zu und sah, wie sie ihre Plastikwaffen mit Gummipfeilen bestückten. Hope persönlich hätte es lieber mit einem ganzen Heer von Geistern statt mit einer einzigen Fledermaus aufgenommen.
Ihr Blick wanderte von einem Jungen zum anderen. »Wie alt seid ihr zwei?«
»Sieben.«
»Acht.«
»Bist du gar nicht.«
»Aber fast. In ein paar Monaten werde ich acht.«
»Was wollt ihr mit diesen Spielzeuggewehren machen?«, fragte sie.
»Uns verteidigen«, antwortete Adam und leckte über den Saugnapf eines Gummipfeils.
»Moment mal, ich glaube, das ist keine gute Idee«, sagte Hope, doch die Jungen hörten sie schon nicht mehr, sondern rannten bereits quer durch den Vorgarten. Sie folgte ihnen bis zum Fuß der Verandatreppe. Im Grunde hatte sie nie viel mit Kindern zu schaffen gehabt, und ihr kam in den Sinn, dass sie vielleicht erst die Erlaubnis der Eltern hätte einholen sollen, bevor sie die zwei in ein von Fledermäusen verseuchtes Haus schickte. »Sollte ich nicht lieber erst mit euren Müttern sprechen, bevor ihr reingeht?«
»Meine Mom stört’s nicht«, warf Wally über die Schulter hinweg, während sie die Treppe hinaufstiegen. »Außerdem telefoniert sie gerade mit Tante Genevieve. Das dauert bestimmt noch ein paar Stunden.«
»Meinen Dad kann ich nicht anrufen. Er arbeitet heute in den Bergen«, vervollständigte Adam.
Die Fledermäuse waren wahrscheinlich längst verschwunden, und ihre Tasche stand vermutlich gleich neben der Eingangstür, sagte sich Hope. Die Jungen wurden bestimmt nicht angegriffen und mussten auch nicht an Tollwut sterben. »Wenn ihr es mit der Angst zu tun bekommt, rennt einfach wieder raus. Die Tasche ist dann nicht so wichtig.«
An der offenen Tür hielten sie inne und drehten sich zu Hope um. Wally flüsterte etwas über Geister, woraufhin ein kurzer Faustkampf entstand. Dann fragte er: »Wie sieht deine Tasche aus?«
»Leder mit burgunderroten Kroko-Applikationen.«
»Hä?«
»Weiß und rötlich braun.«
Sie verschränkte die Arme und beobachtete die Jungen, die, die Gewehre im Anschlag, langsam in das Haus vordrangen. Sie hob die Hand, um erneut ihre Augen vor der grellen Sonne zu schützen, und sah, wie sie sich zuerst nach links wandten und dann durch den Flur zum Wohnzimmer gingen. Sie waren kaum eine halbe Minute im Haus verschwunden, als sie schon wieder herausgerannt kamen. Adam hielt Hopes Tasche in der freien Hand.
»Wo habt ihr sie gefunden?«, fragte Hope.
»In dem großen Zimmer mit den Geweihen.« Adam reichte ihr die Tasche, und sie griff hinein, auf der Suche nach ihrer Sonnenbrille. Sie setzte sie auf und zog zwei Fünf-Dollar-Scheine aus ihrer Brieftasche.
»Ganz herzlichen Dank.« In ihrem Arbeitsleben steckte Hope Türstehern, Ärzten und Gnomen Geld zu. Doch das hier war eine Premiere. Kinder hatte sie noch nie für einen Gefallen bezahlt. Die Augen der Jungen blitzten auf, ihr Lächeln wurde geldgierig.
»Wenn wir noch was für dich tun können, sag’s uns einfach«, empfahl Wally und stopfte sich das Gewehr in den Bund seiner kurzen Hose.
Der Mittagsbetrieb hatte kaum nachgelassen, als Sheriff Dylan Taber das Cozy Corner Café betrat. Die Scheiben waren so getönt, dass man zwar von drinnen nach draußen blicken konnte, doch von der Straße aus wirkten sie wie Aluminiumfolie. Wenn die Sonne im richtigen Winkel darauf fiel, konnten sie einem ein Loch in die Augenhornhaut brennen.
In der Musikbox neben der Eingangstür sang Loretta Lynn über ihre Wurzeln in Kentucky, während Jerome Fernwood vom Grill her eine fertige Bestellung ausrief.
Der Duft von Brathähnchen und Kaffee fiel über Dylans Sinne her und verursachte ihm Magenknurren. Er versuchte, so selten wie möglich zu Hause Fast Food zum Abendessen aufzutischen, doch heute war er müde und staubbedeckt und hatte nicht die geringste Lust, jetzt noch zu kochen. Nicht einmal Hot Dogs und Makkaroni mit Käse, Adams Leibgericht.
Nachdem er nun endlich Feierabend hatte, wollte er nur noch essen, ausgiebig duschen und dann ins Bett fallen. Das Duschen stellte kein nennenswertes Problem dar, doch sein Bett würde wohl noch ein paar Stunden auf ihn warten müssen. In einer Dreiviertelstunde hatte Adam ein T-Ball-Spiel, und danach war er immer total aufgedreht. Die Aufregung wegen des Spiels, der neue Hund und die »coole Kiste«, die Adam am Nachmittag für seine Steinesammlung erstanden hatte, ließen Dylan bezweifeln, dass sein Sohn vor dreiundzwanzig Uhr einschlafen würde.
Als er kurz zuvor einmal nach Adam gesehen hatte, berichtete sein Sohn ihm eine merkwürdige Geschichte über Fledermäuse und Geister und eine Frau mit »Vogel-Stiefeln«, die ihm dafür, dass er ihre Tasche holte, fünf Dollar gegeben hatte. Wenn Dylan die besagte Dame nicht schon selbst kennen gelernt hätte, würde er Adams Geschichte wohl nicht geglaubt haben. Adam neigte dazu, allerlei Fantastisches zu erfinden, aber nicht einmal er hätte sich diese Stiefel ausdenken können.
»He, Dylan«, rief Paris Fernwood und kam, voll beladen mit gefüllten Tellern, eilig hinter dem Tresen hervor.
»He, Paris«, erwiderte er und tippte an seinen schwarzen Stetson. Er setzte ihn ab und fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Auf dem Weg zu einem freien Barhocker begrüßte er einige Leute aus dem Ort.
»Was darf ich Ihnen bringen, Sheriff?«, fragte Iona Osborn von der anderen Seite des Tresens.
»Das Übliche.« Er setzte sich auf den mit rotem Vinyl bezogenen Hocker und legte den Hut aufs Knie.
Iona zog einen verborgenen Stift aus ihrem zu einer Wolke aufgetürmten feinen grauen Haar und notierte seine Bestellung. Den Zettel klemmte sie in den dafür vorgesehenen Halter aus rostfreiem Stahl. »Zweimal Fritten und zwei Cheeseburger zum Mitnehmen!«, schrie sie, obwohl der Koch direkt auf der anderen Seite der halbhohen Mauer stand. »Einmal mit allem, einmal nur mit Mayo«, fügte sie hinzu.
Ohne sich beim Fleischwenden unterbrechen zu lassen oder auch nur den Blick zu heben, um nachzusehen, wer die Bestellung aufgegeben hatte, sagte Jerome: »Kommt sofort, Sheriff.«
»Das wäre nett.«
Iona griff sich eine große graue Wanne und fing an, schmutzige Teller und Gläser vom Tresen zu räumen. »Also, haben Sie den Flachländer gefunden?«
Dylan machte sich nicht die Mühe zu fragen, wieso die Kellnerin über die Unternehmungen der Polizei informiert war. In Gospel wusste eben jeder Bescheid. Iona fiel nicht nur durch die voluminöseste Haarfrisur der ganzen Stadt auf, sondern war auch bekannt als größte Klatschbase, was in Gospel schon etwas heißen wollte.
»Wir haben ihn weiter unten auf der Ostseite von Mount Regan gefunden. Er hatte den Schnee gesehen und wollte ein bisschen Ski fahren«, sagte Dylan und hakte einen Stiefelabsatz hinter die Metallsprosse des Hockers. »Und zwar in Shorts und Tennisschuhen.«
Iona legte das letzte Glas in die graue Wanne und griff nach einem Wischlappen. »Flachländer«, schnaubte sie und wischte den Tresen sauber. »Die meisten tappen in die Wildnis hinaus und haben nicht mal eine Erste-Hilfe-Ausrüstung dabei.« Sie arbeitete grimmig an einem Ketchupfleck und stellte ihre wichtigste Frage. »Wie nun, hat er sich was gebrochen? Melba hat dieses Jahr auf einen ganzen Haufen Knochenbrüche gewettet.«
Natürlich wusste Dylan von der Flachländer-Wette. Er beteiligte sich nicht, hielt das Spielchen aber für einigermaßen harmlos. »Hat sich den rechten Knöchel gebrochen und ein paar Bänder im Knie gezerrt«, antwortete er. »Und war obendrein ganz schön unterkühlt.«
»Den rechten Knöchel, sagen Sie? Ich habe auf einen verstauchten rechten Knöchel gewettet. Aber einen Bruch kann man wohl nicht als Verstauchung ausgeben, wie?«
»Nein, das geht wohl nicht«, sagte er und warf seinen Hut auf den inzwischen sauberen Tresen.
Die Eingangstür öffnete sich und brachte die mit dem Türgriff verbundene Kuhglocke zum Läuten. Loretta sang ihre letzte Note, irgendwo im hinteren Teil des Lokals zerbrach ein Teller, und Iona lehnte sich über den Tresen und sagte in gut hörbarem Flüsterton: »Da ist sie wieder!«
Dylan warf einen Blick über die Schulter, und dort neben der Musikbox stand rosig und frisch wie ein Pfirsich Miss Anständig höchstpersönlich. Sie hatte ihre engen Jeans gegen ein Sommerkleidchen mit schmalen Trägern ausgetauscht. Das Haar hatte sie am Hinterkopf hochgebunden, und statt ihrer Stiefel trug sie flache Sandalen mit Zickzackriemchen über dem Spann.
»Sie war gegen Mittag schon mal hier«, erklärte Iona leise. »Hat einen Chefsalat bestellt, Dressing extra, und wollte alles Mögliche wissen.«
»Was wollte sie wissen?« Dylan drehte sich um und sah Ms. Spencer nach, die direkt an ihm vorüberging, den Blick geradeaus gerichtet, als bemerkte sie gar nicht, wie viel Aufmerksamkeit sie erregte. Durch den Dunst von Bratfett und den Duft des abendlichen Spezialtellers hindurch roch er beinahe einen Hauch von Pfirsich, der von ihrer Haut ausging, das hätte er schwören mögen. Der Saum ihres Kleides umschmeichelte ihre Oberschenkel, als sie auf eine Nische im hinteren Teil des Lokals zustrebte. Sie glitt über den verschlissenen roten Vinylbezug bis ganz in die Ecke und griff nach der Speisekarte. Eine blonde Strähne fiel über ihre Wange, und sie hob die Hand und schob sich das Haar hinters Ohr zurück.
»Sie wollte wissen, ob alle Zutaten in ihrem Salat frisch wären und ob Männer zur Verfügung stehen.«
»Ob Männer zur Verfügung stehen?« Hunger ballte sich tief in Dylans Leib zusammen, und er war nicht restlos überzeugt, dass er dieses Mal etwas mit Essen zu tun hatte.
»Ja, sie fragte, ob junge Männer zur Verfügung ständen, die das Donnelly-Haus für sie aufräumen könnten. Das sagte sie zumindest.«
Er drehte sich wieder zu Iona um. »Und Sie glauben ihr nicht?«
Die Kellnerin schürzte missbilligend die Lippen. »Ich habe Ada drüben im Motel angerufen, und tatsächlich, die Frau hat sich dort ein Zimmer genommen. Vermutlich hat sie in der Lobby ein Ferngespräch geführt. Ada jedenfalls sagte, sie hätte einen furchtbaren Aufstand gemacht, geschrien und geflucht und sich über Unkraut und Schmutz beschwert, und anscheinend ist das Haus voller Fledermaus-Sie-wissen-schon-was, aber ›Sie-wissen-schon-was‹ hat sie nicht gesagt. Ada sagt, sie hätte ein unflätiges Mundwerk und wäre schrecklich aufbrausend. Ada hat auch gesagt, die Frau hätte sofort einfach so nach verfügbaren Männern gefragt, als die Tinte auf ihrem Anmeldeformular noch nicht mal trocken war. Sie trägt keinen Ehering, also ist sie wahrscheinlich geschieden. Und sie hat gesagt, wenn wir jemanden wüssten, der Lust hat, ihr zu helfen, sollten wir ihn ins Sandman-Motel schicken. Sie wohnt ein paar Tage dort. Für mich hört sich das so an, als wollte sie da draußen in dem Haus weitermachen.«
Was nach Dylans Meinung das Dümmste war, das er seit einiger Zeit gehört hatte, aber es überraschte ihn nicht. Selbst nach fünf Jahren redeten die Leute in der Stadt immer noch liebend gern über Sheriff Donnelly und das, was er in dem alten Haus getrieben hatte. Die unappetitlichen Details aus dem Privatleben des Sheriffs waren für die Stadt der größte Schock seit dem Erdbeben von 83 gewesen. »Hört sich eher so an, als brauchte sie jemanden, der ihr hilft, den Fledermauskot zu beseitigen. Dagegen ist doch nichts einzuwenden.«
Iona schob die Wanne unter den Tresen und verschränkte die Arme unter ihrem mächtigen Busen. »Sie kommt aus Kalifornien«, sagte die Kellnerin, als erübrigte sich jede weitere Erklärung. Sie führte trotzdem noch eine ins Feld. »Ada sagt, als die Frau im Motel war, hätte sie unglaublich enge Jeans angehabt. Und kein Höschen hätte sich darunter abgezeichnet, und deshalb nehmen wir an, dass sie wahrscheinlich so einen String-Tanga trägt, und der einzige Grund für eine Frau, dermaßen unbequeme Unterwäsche zu tragen, ist der, dass sie Männer reizen will. Jeder weiß doch, dass diese Kalifornierinnen leichte Mädchen sind.«
Dylan warf einen Blick über die Schulter und sah zu, wie Paris die Bestellung der blonden Frau aufnahm. Ms. Spencer wies auf verschiedene Stellen in der Speisekarte, und Paris’ gequältem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, gehörte sie offenbar zu diesen lästigen Mädchen, die ständig etwas »extra« bestellten. Ms. Spencer roch nach Ärger, schon, aber nicht nach der Art von Ärger, die Iona meinte. Dylan löste seinen Absatz aus der Verhakung mit der Hockersprosse und stand auf. »Ich frag sie lieber mal nach diesen Höschen«, sagte er. »Kann doch nicht zulassen, dass eine Frau hier in String-Tangas rumläuft und ich nichts davon weiß.«
»Sheriff, Sie sind ein ganz Schlimmer.« Iona kicherte wie ein Teenager, als er über das rotweiße Linoleum in Richtung Nische davonschritt.
Als Ms. Spencer nicht einmal aufblickte, sagte er: »Hallo, wie ich hörte, hatten Sie einen ziemlich schweren Tag.«
Da hob sie doch den Blick. Sah ihn aus den klarsten blauen Augen an, die er je gesehen hatte. Augen so blau wie der Sawtooth-See. So klar, dass man bis auf den Grund blicken konnte.
»Sie haben von meinem Problem gehört?«
»Ich habe von Ihren Fledermäusen gehört.«
»Gute Nachrichten sprechen sich offenbar schnell herum.«
Sie forderte ihn nicht auf, Platz zu nehmen, und er wartete ihre Einladung nicht ab. Er setzte sich ihr gegenüber. »Einer von den Jungen, denen Sie Geld gegeben haben, damit sie Ihre Tasche holten, ist mein Sohn.«
Ihr Blick wanderte über sein Gesicht, und sie sagte: »Das dürfte Adam sein.«
»Ja, Madam.« Er lehnte sich auf der Bank zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Ihre Miene verriet nicht das Geringste. Diese Frau war aalglatt, hatte sich völlig unter Kontrolle.
»Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich Ihren Sohn angeheuert habe.«
»Es stört mich nicht, aber ich finde, Sie haben diesen Jungen zu viel dafür bezahlt, dass sie einfach nur Ihre Tasche holen sollten.« Er machte sie nervös, was allerdings auch nicht sehr aufschlussreich für ihn war. Sein Abzeichen machte sie meisten Leute nervös. Konnte bedeuten, dass sie irgendwelche Strafzettel nicht bezahlt hatte, sonst nichts. Es konnte aber auch bedeuten, dass sie etwas zu verbergen hatte, aber solange sie keinen Ärger machte, mochte sie ihre Geheimnisse doch für sich behalten. Himmel, gerade mit Geheimnissen kannte er sich gut aus. Er hatte ja selbst ein großes. »Ich hörte außerdem, dass Sie junge Männer suchen, die Ihnen bei der Reinigung des Hauses helfen.«
»Hinsichtlich des Alters habe ich mich nicht festgelegt. Offen gestanden, selbst Ihr Urgroßvater wäre mir herzlich willkommen, wenn er nur diese verdammten Fledermäuse beseitigen könnte.«
Dylan streckte die Beine aus, und sein Fuß stieß gegen ihren. Er hatte die Grenze ihrer Privatsphäre überschritten, und genau, wie er es erwartet hatte, zog sie unverzüglich ihre Füße zurück und straffte ihre Haltung. Er versuchte nicht einmal, sein Lächeln zu verbergen. »Fledermäuse tun Ihnen nichts zu Leide, Ms. Spencer.«
»Das sagen Sie, Sheriff«, entgegnete sie und hob den Blick, als Paris ein Glas Eistee und ein Tellerchen mit Zitronenscheiben auf den Tisch stellte.
»Frischer kriegt man sie nicht.« Paris’ dichte Brauen senkten sich auf ihre braunen Augen herab. »Ich habe sie gerade erst geschnitten.«
Ms. Spencers Mundwinkel hoben sich zu einem äußerst unaufrichtigen Lächeln. »Danke.«
Dylan war mit Paris aufgewachsen. Er hatte in der Schule Blindekuh und Ball mit ihr gespielt, die meisten Kurse in der Oberstufe gemeinsam mit ihr belegt und auf dem Abschlussfest ihre Abschiedsrede angehört. Er konnte behaupten, dass er sie ziemlich gut kannte. Gewöhnlich war sie recht umgänglich, aber irgendwie war es Miss Anständig gelungen, Paris ungeheuerlich zu reizen.
»Ms. Spencer ist unsere neueste Mitbürgerin«, sagte er. »Wie es scheint, wird sie im Donnelly-Haus wohnen.«
»Das habe ich auch gehört.«
Als Heranwachsender hatte er immer ein bisschen Mitleid mit Paris gehabt, und deswegen hatte er sich alle erdenkliche Mühe gegeben, nett zu ihr zu sein. Sie hatte wunderschönes langes Haar, das sie meistens zu einem Zopf geflochten trug. Sie war schüchtern und redete nicht viel, und wenn das manchem Mann auch an einer Frau gefallen mochte, hatte sie doch zusätzlich das Pech, die Statur ihres Vaters Jerome geerbt zu haben: groß, grobknochig, mit großen Männerhänden. Ein Mann konnte eine ganze Menge körperlicher Mängel an einer Frau übersehen. Eine große Nase und Schultern wie ein Footballspieler waren die eine Sache, aber breite Hände und fleischige Finger waren etwas, was ein Mann nicht hinnehmen konnte. Sie hatten den gleichen Stellenwert wie ein Schnauzbart. Der Kuss eines Mädchens mit Gesichtsbehaarung konnte einen Mann einfach nicht erregen, und die Vorstellung, an sich herabzublicken und Männerhände nach seinem guten Stück greifen zu sehen, war absurd.
»Kann ich dir etwas bringen, solange du wartest, Dylan?«, fragte Paris.
»Nein, danke, Schätzchen. Meine Hamburger sind doch sicher gleich fertig.« Und es war wohl auch kein Trost, dass Paris’ Mutter nur wenig femininer war als ihr Vater.
Paris lächelte und faltete die Hände vor dem Bauch. »Wie hat dir die Himbeer-Kaltschale geschmeckt, die ich dir neulich vorbeigebracht habe?«
Dylan verabscheute jede Art von Obst, dessen Kerne zwischen seinen Zähnen stecken blieb. Adam hatte nur einen Blick in die Schüssel geworfen, festgestellt, dass das Zeug »ganz blutig« aussah, und dann hatten sie es weggeworfen. »Adam und ich haben sie mit Eis gegessen«, log er, um ihr eine Freude zu machen.
»Morgen habe ich frei, dann backe ich ein paar Amish-Kuchen. Ich bringe dir einen rüber.«
»Das ist echt lieb von dir, Paris.«
Ihre Augen leuchteten. »Ich bereite mich auf die Veranstaltung im nächsten Monat vor.«
»Willst du in diesem Jahr ein paar Preise gewinnen?«
»Natürlich.«
»Unsere Paris«, sagte Dylan und blickte Ms. Spencer an, »gewinnt mehr Preise als jede andere Frau in der Gegend.«
Ms. Spencer hob ihren Eistee an die Lippen. »Oh, wie aufregend«, sagte sie leise, bevor sie trank.
Paris zog erneut die Brauen zusammen. »Meine nächste Bestellung kommt gerade«, sagte sie und machte auf dem Absatz kehrt.
Dylan neigte ein wenig den Kopf zur Seite und lachte leise. »Sie sind noch nicht einmal vierundzwanzig Stunden in der Stadt, und wie ich sehe, schließen Sie bereits Freundschaften.«
»Diese Stadt hat mir nicht unbedingt ein Willkommenskomitee entgegengeschickt.« Sie stellte ihr Glas auf den Tisch und fuhr mit der Zunge über ihren Mundwinkel. »Oder ich war nicht zu Hause, als es kam. Da stand ich wohl gerade am Empfangstresen im Sandman-Motel und musste mich von einer Frau mit Lockenwicklern im Haar beschimpfen lassen.«
»Ada Dover? Was hat sie getan?«
Ms. Spencer lehnte sich zurück und entspannte sich ein wenig. »Sie benötigte praktisch meine ungekürzte Familiengeschichte, um mir ein Zimmer vermieten zu können. Sie wollte wissen, ob ich vorbestraft bin, und als ich fragte, ob sie auch eine Urinprobe brauchte, sagte sie, ich wäre vielleicht nicht so ordinär, wenn meine Jeans nicht so eng wären.«
Dylan erinnerte sich gut an diese Jeans. Sie waren tatsächlich eng, aber es gab auch ein paar Frauen in der Stadt, deren Anblick in Wranglers geradezu Schmerzen verursachte. »Das war sicher nicht persönlich gemeint. Ada nimmt ihre Arbeit manchmal übertrieben ernst. Als würde sie Zimmer im Weißen Haus vermieten.«
»Mit etwas Glück bin ich morgen Nachmittag da raus.«
Er senkte den Blick auf ihre vollen Lippen, und für einen kurzen Augenblick gestattete er sich die Überlegung, ob sie wohl genauso gut schmeckte, wie sie aussah. Er fragte sich, wie es wäre, den Lipgloss von ihrem Mund zu lecken und seine Nase in ihrem Haar zu vergraben. »Sie wollen wirklich ganze sechs Monate hier bleiben?«
»Natürlich.«
Er bezweifelte immer noch, dass sie es länger als ein paar Tage aushalten würde, aber wenn sie bleiben wollte, sollte er ihr vielleicht mal genau vor Augen führen, worauf sie sich einließ. »Dann lassen Sie sich von mir ein paar Ratschläge geben, die Sie bestimmt nicht hören wollen und genauso sicher auch nicht beherzigen werden.« Er hob den Blick und setzte den Abschweifungen seiner Gedanken rasch ein Ende, bevor es peinlich für ihn wurde. »Wir sind hier nicht in Kalifornien. Den Leuten hier ist es schnuppe, ob Sie aus Westwood oder aus South Central kommen. Es ist ihnen schnuppe, ob Sie einen Mercedes oder einen alten Buick besitzen, und es ist ihnen schnuppe, wo Sie einkaufen. Wenn Sie ins Kino wollen, müssen Sie nach Sun Valley fahren, und wenn Sie keine Satellitenschüssel auf dem Dach haben, empfangen sie vier Fernsehprogramme.
Wir haben zwei Lebensmittelgeschäfte, drei Tankstellen und zwei Restaurants. In dem einen sitzen Sie gerade. Das andere liegt ein Stück die Straße runter, aber ich würde Ihnen raten, nicht dort zu essen. Es ist im vergangenen Jahr zweimal wegen Missachtung der Gesundheitsvorschriften geschlossen worden. Wir haben zwei verschiedene Kirchen und einen großen Landjugendklub.
Gospel verfügt über fünf Bars und fünf Waffen-und-Zubehör-Läden. Nun, das müsste Ihnen doch was sagen.«
Sie griff nach ihrem Tee und hob ihn an die Lippen. »Was denn? Dass ich in eine Stadt voller alkoholabhängiger, Waffen tragender, Schafe liebender Klubmitglieder gekommen bin?«
»O Mann«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Das habe ich befürchtet. Sie werden Ärger machen, stimmt’s?«
»Ich?« Sie stellte das Glas ab und legte unschuldsvoll die Hand aufs Herz. »Ich schwöre bei Gott, Sie werden nicht einmal merken, dass ich mich in der Stadt aufhalte.«
»Irgendwie glaube ich das nicht ganz.« Er stand auf und blickte auf sie herab. »Wenn Sie Hilfe im Donnelly-Haus brauchen, wenden Sie sich an die Aberdeen-Jungs. Die werden bald achtzehn und haben diesen Sommer nichts zu tun. Sie wohnen da draußen an der Timberline Ihnen direkt gegenüber, aber fragen Sie sie vor Mittag, sonst sind sie schon auf dem See.«
Hope blickte zu dem großen Mann auf, betrachtete seine tiefgrünen Augen und die braune Haarlocke, die ihm kringelförmig in die Stirn fiel. Das Licht, das durch die Fenster hereinfiel, malte goldene Strähnchen hinein, und Hope hätte ihren Porsche darauf verwettet, dass sie von der Sonne stammten und nicht aus einem Friseursalon. Pech, dass er keinen Sinn für Humor hatte, aber wenn ein Mann aussah wie dieser Sheriff, war Humor wohl nicht so wichtig. »Danke.«
Er lächelte, und erst jetzt fiel ihr auf, dass seine Zähne nicht ganz so regelmäßig waren wie bei einem Filmstar, was aber nicht hieß, dass er nicht trotzdem in einem erstklassigen Western hätte auftreten können. Sie waren strahlend weiß, das schon, standen jedoch unten ein bisschen dicht gedrängt. »Und viel Glück, Ms. Spencer«, sagte er gedehnt.
Sie nahm an, er meinte, dass sie bei der Suche nach jemandem, der ihr half, das Fledermausproblem zu lösen, Glück brauchen würde, und sie hoffte, es ginge auch ohne. Er schlenderte nach vorn zum Tresen, und ihr Blick folgte ihm.
Sein hellbraunes Hemd spannte sich eng um seinen Rücken und steckte in einer hellbraunen Hose mit einem dunkelbraunen Streifen seitlich am Bein. Diese Hose hätte wie der Albtraum jedes modebewussten Menschen aussehen müssen, doch am Körper des Sheriffs betonten sie die festen Hinterbacken und die langen Beine. Er hatte einen Revolver an die Hüfte geschnallt, dazu hingen noch ein Paar Handschellen und eine Anzahl Lederfutterale an seinem Gürtel.
Trotz all des Leders und Zubehörs bewegte er sich leicht und geschmeidig, als wäre Eile ihm unbekannt und seine Umgebung absolut sicheres Terrain. Er strahlte das Selbstvertrauen und die Autorität eines Mannes aus, der durchaus auf sich selbst und die Frau in seinem Leben Acht geben konnte. Ein Testosteron-Cocktail, den manche Frau bestimmt unwiderstehlich fand. Hope aber nicht.
Mit der gleichen fließenden Bewegung, mit der er sich durchs Haar fuhr, griff er jetzt nach dem Cowboyhut auf dem Tresen, stülpte ihn auf und sprach mit der älteren Bedienung an der Kasse. Die Frau mit dem aufgetürmten Haar kicherte wie ein kleines Mädchen, und Hope wandte den Blick ab. Es hatte einmal eine Zeit in ihrem Leben gegeben, in der auch sie vielleicht ein kleines bisschen unter seinem nicht völlig perfekten Lächeln dahingeschmolzen wäre. Jetzt nicht mehr.