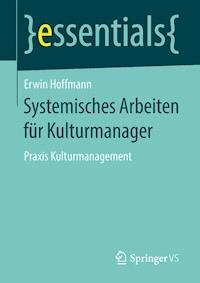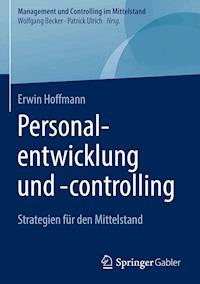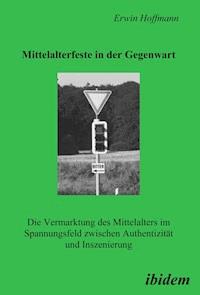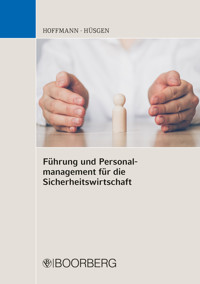
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Richard Boorberg Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wachsende Aufgaben Der privaten Sicherheitswirtschaft kommt bei Bedrohungslagen und Krisen eine stetig wachsende Bedeutung zu. Sie trägt wesentlich zur Aufrechterhaltung der Inneren Sicherheit bei. Dabei können nur gut ausgebildetes Führungspersonal sowie ein professionell umgesetztes Personalmanagement gewährleisten, dass die private Sicherheitswirtschaft in der Lage bleibt, den erhöhten Anforderungen gerecht zu werden. Kompetenter Leitfaden Vor diesem Hintergrund erläutert das Buch im ersten Teil die Rahmenbedingungen, die Entwicklungen und die aktuellen Herausforderungen der Branche und ihrer Unternehmen. Im zweiten Teil behandeln die Autoren die konkreten Herausforderungen und Lösungen für das Personalmanagement und die Mitarbeiterführung in Sicherheitsunternehmen. Die Autoren bringen ihre langjährige Erfahrung als Berater, Personal- und Organisationsentwickler in das Werk ein und geben wichtige branchenspezifische Hinweise zur Mitarbeiterführung. Aus dem Inhalt: Herausforderungen des Personalmanagements innerhalb von Organisationen der Sicherheitswirtschaft Personalführung als persönliche Verantwortung Führungskräfteentwicklung Personalbeurteilung als Führungsaufgabe Handlungsempfehlungen Damit steht der Sicherheitswirtschaft ein fundierter und wegweisender Leitfaden zur Verfügung. Das Problem Noch vor wenigen Jahrzehnten stellte sich sowohl die nationale und europäische als auch die globale Sicherheitslage anders dar als heute: Krisen erscheinen mittlerweile omnipräsent. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat durchaus nachvollziehbar »Krisenmodus« zum Wort des Jahres 2023 gewählt. Im Zusammenhang mit Krisen und damit einhergehenden Bedrohungslagen stellt sich nachdrücklich die Frage, welche Rolle der privaten Sicherheitswirtschaft bei der Aufrechterhaltung der Inneren Sicherheit zukommt bzw. zukommen soll. Nicht zuletzt im Referentenentwurf zum Sicherheitsgewerbegesetz (SiGG) wird darauf hingewiesen, dass die private Sicherheitswirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in Deutschland leiste. Dabei handelt es sich auch in ökonomischer Hinsicht um eine Frage von einiger Tragweite, hat doch die private Sicherheitswirtschaft im Jahr 2023 mit mehr als 284.000 Beschäftigten einen Gesamtumsatz von über 13,4 Mrd. Euro erwirtschaftet. Die Lösung Um eine befriedigende Antwort geben zu können, ist es zentral, die Aspekte Führung und Personalmanagement in den Blick zu nehmen. Nur gut ausgebildetes Führungspersonal sowie ein professionell umgesetztes Personalmanagement gewährleisten, dass die private Sicherheitswirtschaft für die Zukunft gut gerüstet ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Führung und Personalmanagement für die Sicherheitswirtschaft
Prof. Dr. Erwin Hoffmann
Studiendekan Wirtschaftspsychologie,
Hochschule Fresenius, Düsseldorf
Siegfried Hüsgen
Business Manager, Consultant & Coach
in den Bereichen Safety & Security
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek | Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Print-ISBN 978-3-415-07660-0
EPUB-ISBN 978-3-415-07662-4
© 2024 Richard Boorberg Verlag
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Titelfoto: © gesrey – stock.adobe.com
E-Book-Umsetzung: abavo GmbH, Nebelhornstraße 8, 86807 Buchloe
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG | Scharrstraße 2 | 70563 Stuttgart
Stuttgart | München | Hannover | Berlin | Weimar | Dresden
www.boorberg.de
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Autoren
Teil I RAHMENBEDINGUNGEN, ENTWICKLUNGEN UND HERAUSFORDERUNGEN DER SICHERHEITSWIRTSCHAFT (Siegfried Hüsgen)
1. Geschichte und Entwicklung des Sicherheitsgewerbes
1.1. Arbeitsmarktpolitische Betrachtung
1.2. Personalpolitische Betrachtung
2. Das Arbeitssystem „Sicherheit“
2.1. Sicherheit als Querschnittsthema
2.2. Das Arbeitssystem „Sicherheit“ unter dem Aspekt der Digitalisierung
2.3. Das Arbeitssystem „Sicherheit“ unter dem Aspekt der Technisierung
2.4. Die Gegenseite
2.5. Relevante externe Schnittstellen
2.6. Abgrenzung der Rechtsgrundlagen
2.7. Sicherheitsdienstleistungen
3. Die behördliche und militärische Sicherheit
3.1. Zeitenwende und Paradigmenwechsel
3.2. Die Bundeswehr
3.3. Polizeien der Länder und die Bundespolizei
4. Die private Sicherheitswirtschaft in Zahlen
5. Funktionen und Dimensionen von Sicherheit
5.1. Begriffe und Bezeichnungen
5.2. Risiko- und Krisenmanagement im Personalmanagement
6. Aktuelle Herausforderungen der Sicherheitswirtschaft
6.1. Markttreiber und Megatrends
6.2. Bereiche der Veränderung – Change und Transformation
6.3. Referentenentwurf zum KRITIS-Dachgesetz
6.4. Forschungsinstitut für Unternehmenssicherheit und Sicherheitswirtschaft (FORSI)
6.5. Studie der CoESS & UNI Europa: INTEL 2022
6.6. Compliance
6.7. Nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung
6.8. Das Sicherheitsgewerbegesetz (SiGG)
Teil II PERSONALMANAGEMENT UND FÜHRUNG (Prof. Dr. Erwin Hoffmann)
1. Herausforderungen des Personalmanagements innerhalb von Organisationen der Sicherheitswirtschaft
1.1. Aufgaben und Bedarf
1.2. Weitere Herausforderungen
1.3. Relevante Bestandteile des Personalmanagements
1.4. Personalpolitik
1.5. Strategisches Personalmanagement
1.6. Herausforderungen im Recruiting: Personalplanung und Personalbeschaffung
1.7. Personaleinsatz, -verwaltung, -controlling und -entlohnung
1.8. Personalentwicklung (PE)
1.9. Personalfreisetzung
2. Personalführung als persönliche Verantwortung von Führungskräften in der Sicherheitswirtschaft
2.1. Führung von Mitarbeitern
2.2. Bewertung der Führungsleistung
2.3. Gründe für Führungsmängel
2.4. Hilfreiche Ansätze zur Mitarbeiterführung
2.5. Führung im Einsatz
2.6. Vom Militär lernen!
3. Führungskräfteentwicklung
3.1. Benötigte Kompetenzen
3.2. Führungskräfteentwicklung: Der Führerschein für Führungskräfte mit „10 plus 10“
4. Personalbeurteilung als Führungsaufgabe
5. Handlungsempfehlungen
Literatur
Anmerkungen
Orientierungsmarken
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Einleitung
Die Innere Sicherheit ist der Schutz des Staates und der Gesellschaft vor Kriminalität, Extremismus, Terrorismus und den damit verbundenen Bedrohungen. Der Staat hat die Aufgabe, die Innere Sicherheit zu gewährleisten.[1] Zahlreiche Phänomene und Gruppierungen innerhalb Deutschlands bedrohen aktuell die Innere Sicherheit.[2]
Noch vor wenigen Jahrzehnten stellte sich sowohl die nationale und europäische als auch die globale Sicherheitslage anders dar als heute. Im Jahr 2008 gab es die Weltfinanzkrise und die Immobilienkrise, 2015 die Flüchtlingskrise und 2020 die Corona-Pandemie. Im Februar 2022 erfolgte der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, in dessen Folge sich kurzzeitig eine europäische Energiekrise entwickelte. Durch den Sabotageakt auf die Gaspipelines Nordstream I und II in der Ostsee am 26.09.2022 wurde Europa die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen ins Bewusstsein gerufen.
Am Morgen des 7. Oktober 2023 hat die Terrororganisation Hamas einen Angriff auf die Zivilbevölkerung in Israel durchgeführt, bei dem mehr als 1.000 Menschen getötet wurden. Nach israelischen Angaben wurden darüber hinaus über 200 Menschen von der Hamas entführt und verschleppt.[3]
Die Bundesregierung war bemüht, mehrere Tausend in Israel lebende oder urlaubende deutsche Staatsangehörige aus dieser unvermittelt akuten Krisenregion zurück nach Deutschland auszufliegen. Auch die Sicherheitsabteilungen von privatwirtschaftlichen Unternehmen in Deutschland sorgten sich um ihre Beschäftigten in Israel, beriefen interne Krisenstäbe ein und versuchten ebenfalls, mit eigenen Mitteln und Ressourcen Rückholoptionen zu eruieren und zu organisieren.
Nach einer neuen Studie des Rheingold Instituts vom Juli 2023 ziehen sich immer mehr Menschen angesichts dieser globalen Krisen in ihr Privatleben zurück.[4] Krisen erscheinen offenbar nicht wenigen Menschen mittlerweile omnipräsent. Sie sind nicht nur „draußen“ in der Welt, sondern wirken bis in das private und vertraute, individuelle Lebensumfeld hinein. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat durchaus nachvollziehbar „Krisenmodus“ zum Wort des Jahres 2023 gewählt.
Seit August 2023 liegt ein Referentenentwurf zum Sicherheitsgewerbegesetz (SiGG) vor. Es geht dabei im Kern um die zukünftige Bedeutung der privaten Sicherheitswirtschaft, die im Jahr 2023 mit mehr als 284.000 Beschäftigten[5] einen Gesamtumsatz von über 13,4 Mrd. €[6] erwirtschaftet hat. Damit eng verknüpft ist die Frage, wie diese in die Innere Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland eingebunden werden kann und soll. Aus der Sicht der Autoren ist dabei die Führung und das Personalmanagement der Beschäftigten von entscheidender Bedeutung, damit die private Sicherheitswirtschaft als Ganzes auch weiterhin einen nutzbringenden Beitrag zur Inneren Sicherheit in Deutschland leisten kann.
Zu einer der größten Herausforderungen scheint sich die abnehmende Verfügbarkeit von einsatzfähigem und einsatzbereitem Personal zu entwickeln, das die für die jeweiligen, recht unterschiedlichen Einsatz- und Tätigkeitsbereiche relevanten Kompetenzen und Resilienzen besitzt.
Im Referentenentwurf zum Sicherheitsgewerbegesetz wird unter „A. Problem und Ziel“ darauf hingewiesen, dass die private Sicherheitswirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in Deutschland leiste. Im § 1 Abs. 1 „Anwendungsbereich“ wird allerdings formuliert, dass das Gesetz dazu dienen soll, die Auftraggeber sowie die Allgemeinheit vor der unsachgemäßen Erbringung von Bewachungstätigkeiten zu schützen. Dass dieser Entwurf darüber hinaus in der Begründung für die Notwendigkeit dieses Gesetzes der privaten Sicherheitswirtschaft in einigen Geschäftsfeldern Nähe zur organisierten Kriminalität vorwirft und im Rahmen des Erlaubnisverfahrens unter § 17 bei der Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung persönliche Gespräche mit der antragstellenden Person vorsieht, stößt bei den Marktteilnehmern auf unterschiedliche Resonanz. Daher stellt sich grundsätzlich die Frage nach der zukünftigen Rolle der privaten Sicherheitswirtschaft zur Aufrechterhaltung der Inneren Sicherheit angesichts der sich stetig verändernden Sicherheitslage in der Welt.
Das vorliegende Buch ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil stellt Siegfried Hüsgen die Rahmenbedingungen, die Entwicklungen und die aktuellen Herausforderungen der Sicherheitswirtschaft und ihrer Unternehmen dar. Im zweiten Teil behandelt Erwin Hoffmann die konkreten Herausforderungen und Lösungen für das Personalmanagement und die Mitarbeiterführung in Sicherheitsunternehmen.
Um den Lesefluss des Textes nicht zu unterbrechen, wird durchgängig die männliche Form verwendet. Natürlich wendet sich der Text aber immer an alle Personen.
Wir wünschen den Lesern spannende Einsichten!
Siegfried Hüsgen und Erwin Hoffmann
Die Autoren
Siegfried Hüsgen
Inhaber der SHC Siegfried Hüsgen Consulting; Business Manager, Consultant & Coach in den Bereichen Safety & Security, langjähriger Ausbildungs- und Schulungsleiter der Securitas Akademie GmbH in Düsseldorf; QM-Beauftragter; Personenschutzkoordinator und Prokurist Securitas Deutschland; Sicherheitsfachwirt (FH), Fachkraft für Arbeitssicherheit, Umweltmanagementbeauftragter; Datenschutzbeauftragter; vormals Securitas Sicherheit & Service GmbH & Co. KG, Essen; Industriekaufmann/DV; ehemaliger Zeitsoldat der Feldjäger als Militärpolizist und stellvertretender Leiter der Personenschutzabteilung beim NATO-Oberkommando SHAPE; Zugführer Spezialausbildung an der NATO-Militärpolizeischule der Bundeswehr in Köln; stud. Rechtswissenschaften und Kriminalpsychologie an der Fernuniversität Hagen.
Prof. Dr. Erwin Hoffmann
Prof. Dr. Erwin Hoffmann ist Sozialwissenschaftler, Studiendekan für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius in Düsseldorf und Oberstleutnant der Reserve der Bundeswehr. Neben seiner militärischen Ausbildung und Tätigkeit (ehemaliger Zeitoffizier (SaZ 12), Verwendung beim Militärischen Abschirmdienst, militärische Ausbildung im Katastrophenmanagement) verfügt er über eine jahrzehntelange Erfahrung als leitender Personal- und Organisationsentwickler sowie als Organisationsberater, Trainer und Coach. An der Hochschule Fresenius hat er an der Konzeption des MBA-Studiengangs zum Sicherheits- und Katastrophenmanagement mitgewirkt.
Teil IRAHMENBEDINGUNGEN, ENTWICKLUNGEN UND HERAUSFORDERUNGEN DER SICHERHEITSWIRTSCHAFT (Siegfried Hüsgen)
1.Geschichte und Entwicklung des Sicherheitsgewerbes
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Branche vom Stigma des klassischen Nachtwächters und Pförtners befreien können und sich zu einem leistungsstarken und vielfältigen Dienstleistungssektor und Sicherheitspartner entwickelt.[7] Seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt es zudem eine etablierte und von den Marktteilnehmern anerkannte Ausbildungs- und Schulungsstruktur, deren Qualifikationen und Weiterbildungen sich mittlerweile auch in den unterschiedlichen Tarifgruppen der einzelnen Tarifverträge der Sozialpartner widerspiegeln.
Die Unternehmen aus dem Dienstleistungsspektrum der privaten Sicherheit sind aus Sicht und gemäß Beschluss der Innenministerkonferenz ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsarchitektur in Deutschland. Die Unternehmen der privaten Sicherheitswirtschaft bieten neben fachlichem Wissen ein breites Produktportfolio und sind im Bereich der Gefahrenprävention auf vielfältige Weise tätig.[8]
Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW), der bis zum Jahr 2011 unter dem Namen Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen e. V. (BDWS) tätig war, setzt sich für eine ständige Verbesserung der Dienstleistungsqualität seiner Mitgliedsunternehmen ein.
„An der Einführung einer Sachkundeprüfung für Kontrolltätigkeiten im öffentlichen Raum, eines Ausbildungsberufs für die Sicherheitswirtschaft und einer eigenständigen Norm ‚Anforderungen an Sicherungsdienstleistungen‘ war der Verband aktiv beteiligt.“[9]
1.1.Arbeitsmarktpolitische Betrachtung
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) nutzt den Markt der privaten Sicherheitswirtschaft seit vielen Jahren als eine attraktive Möglichkeit, geringqualifizierte und ältere Beschäftigte in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Im Vergleich zu anderen Berufen und angelernten Tätigkeiten sind die im Sicherheitsgewerbe durch den § 34a der Gewerbeordnung (GewO) und der Bewachungsverordnung (BewachV) definierten Gewerbezugangsvoraussetzungen und die mit dem Unterrichtungsverfahren (UV) und der Sachkundeprüfung geforderten Leistungsanforderungen in relativ kurzen Zeiträumen von mindestens 40 Unterrichtseinheiten (UE) zu bewältigen.
Nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) im Rahmen ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Sicherheitsgewerbegesetz scheinen bei den Schulungsteilnehmern und den Prüflingen die Kenntnisse der deutschen Sprache eine Herausforderung zu sein.[10] Insbesondere die Formulierungen der Prüfungsaufgaben und die entsprechenden Fachtermini in der Sicherheit bedürfen zukünftig womöglich einer ergänzenden Schulung. Die individuellen sprachlichen und nonverbalen Kompetenzen im Kommunikations- und Deeskalationsmanagement sind für eine erfolgreiche ziel- und kundenorientierte Dienstleistung in der Sicherheitswirtschaft wesentliche Faktoren.
In der Zusammenarbeit mit Behörden und anderen Organisationen, die mit der Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben betraut sind (BOS), ist die korrekte, einheitliche und unmissverständliche Verwendung des Fachvokabulars von besonderer Bedeutung.
Eine Vielzahl von Projekten des Europäischen Sozialfonds (ESF) hat zum Ziel, unter Einsatz von Fördermitteln einen Transfer von Arbeitssuchenden in den ersten Arbeitsmarkt durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen und Vermittlungsaktivitäten zu ermöglichen.[11] Dazu zählte z. B. seit 2006 das Programm WeGebAU (Förderung der Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter Älterer in Unternehmen).
Am 1. Januar 2019 ist das Qualifizierungschancengesetz (QCG) in Kraft getreten. Es regelt in erster Linie die Weiterbildungsförderung für Arbeitnehmer. Es ist Teil der Qualifizierungsoffensive der Bundesregierung und stützt sich auf drei zentrale Maßnahmen:
–
Weiterbildungsförderung für alle
–
Verbesserter Schutz in der Arbeitslosenversicherung
–
Entlastung der Beitragszahlenden der Arbeitslosenversicherung
[12]
Die Implementierung dieser staatlichen Fördermaßnahmen hat eine Landschaft von zertifizierten Bildungsträgern innerhalb und außerhalb der Sicherheitswirtschaft entstehen lassen. Die über sog. Bildungsgutscheine (BGS)[13] des Fachbereiches „Förderung der beruflichen Weiterbildung“ (FbW) für Arbeitssuchende oder Beschäftigte in der Sicherheitsbranche überwiegend geförderte Maßnahme war und ist die Sachkundeprüfung gemäß § 34a Gewerbeordnung (GewO). Die Industrie- und Handelskammern haben sich als prüfende Institutionen etabliert und begrüßen in ihrer Stellungnahme durchaus nachvollziehbar, dass diese Praxis gemäß dem Referentenentwurf beibehalten werden soll.
Der Standard bzw. die Norm für eine Zertifizierung ist im Rahmen des erforderlichen Qualitätsmanagements die Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV), bis 2012 als Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) bekannt.
Angelehnt an die Vorgaben der AZAV hat der BDSW ein Zertifizierungsverfahren für zugelassene Sicherheitsfachschulen des BDSW[14] entwickelt und auditiert diese eigenverantwortlich in regelmäßigen Intervallen. Es ist eine langjährige, zielführende und erfolgreiche Kooperationsstruktur zwischen den Bundesagenturen, den Industrie- und Handelskammern, den Bildungsträgern, den Arbeitgebern und -nehmern entstanden.
Die Flüchtlingskrise 2015/2016 und der damit verbundene Personalbedarf innerhalb der privaten Sicherheitsbranche für die Betreuung bzw. Bewachung der neu geschaffenen Flüchtlingsunterkünfte und Erstaufnahmezentren haben das bis dahin funktionierende System an seine Grenzen geführt. Nachvollziehbar waren die Kapazitäten der IHK nicht auf den erhöhten Schulungs- und Prüfungsbedarf ausgelegt und ließen sich nicht in der Kürze der Zeit anpassen, sodass es zu verlängerten Wartezeiten kam.
Die Gesellschaft, die Regierung und die Institutionen der Bildungspolitik sollten die Einschätzung und Wahrnehmung der privaten Sicherheitsbranche und ihrer Beschäftigten kritisch hinterfragen. Es sollte im Kern nicht nur darum gehen, Beschäftigungsmöglichkeiten für diejenigen Menschen zu offerieren, die in anderen Berufen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht oder nicht mehr Fuß fassen können oder für den allgemeinen Arbeitsmarkt womöglich als zu alt angesehen werden. Dem gegenüber steht mittlerweile das deutlich wahrnehmbare erhöhte Bedürfnis der Bevölkerung und der Wirtschaft nach Schutz und Sicherheit in vielfältigster Art und Weise.
1.2.Personalpolitische Betrachtung
Bedingt durch die in den letzten Jahren zunehmend angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt und dem damit verbundenen Mangel an Fach- und Führungskräften entwickelte sich das Phänomen der sog. „Quereinsteiger“ oder „Seiteneinsteiger“. Aktuell gibt es einen Arbeitnehmermarkt, der den Fachkräften die Chance bietet, zwischen verschiedenen Jobangeboten und Beschäftigungsmöglichkeiten wählen zu können.
Auch wer bezogen auf ein Berufsbild überwiegend fachfremd ist, kann sich als Quereinsteiger durchaus eine Karriere in einem anderen Tätigkeitsfeld erhoffen, da er oder sie mittlerweile als personell opportune und interessante Ressource gilt. Beispielsweise wirbt das Land NRW im November 2023 um Seiteneinsteiger ohne Lehramtsstudium, welche die Schulen als Lehrer ohne dieses entsprechende Studium sogar bereichern sollen.[15]
In der Öffentlichkeit, der Politik und den Medien wurden und werden nach wie vor Begriffe und Bezeichnungen wie bspw. „Wachpersonen“ und „Bewachung“ genutzt. Es haben sich in den letzten Jahren allerdings eher der Gedanke und das Leitbild von Schutz und Sicherheit, also Safety und Security, durchgesetzt. Auch die private Sicherheitsbranche selbst beklagt bisweilen die mangelnde Attraktivität des Berufes und der in diesem Berufsbild relevanten Tätigkeiten und sieht sich vonseiten der Politik in einer „Schmuddelecke“ verortet. Im bisherigen Sprachgebrauch, auch innerhalb der Branche, wurde und wird noch immer von der „Bewachungsbranche“ und dem „Wachpersonal“ gesprochen. Die Bezeichnung des im Jahr 2019 in Kraft getretenen Bewacherregisters (BWR), welches vom Statistischen Bundesamt (Destatis) betreut wird, orientiert sich an eben diesen Begrifflichkeiten. Die zuletzt im Mai 2019 überarbeitete Verordnung über das Bewachungsgewerbe (Bewachungsverordnung – BewachV) trägt ebenfalls diese Entstehungsgeschichte des Gewerbes im Titel.
Auf Zertifikaten einiger Industrie- und Handelskammern (IHK) werden bereits in den beigefügten englischsprachigen Bescheinigungen dieser nationalen Bildungsabschlüsse innerhalb der Sicherheitswirtschaft andere Begriffe genutzt. Die von einigen Industrie- und Handelskammern auf den englischsprachigen und somit international verwendbaren Zertifikaten verwandte Entsprechung bei der Fortbildung für Seiteneinsteiger zur „Geprüften Schutz -und Sicherheitskraft“ lautet „Certified Security Officer“. Der Meister für Schutz und Sicherheit wird von einigen Kammern im englischen als „Bachelor Professional of Protection and Security“ betitelt. Hier wird die Kategorisierung des Deutschen Qualitätsrahmens DQR bzw. des Europäischen Qualitätsrahmens EQR sichtbar, da der Meister gemeinsam mit dem Bachelor und dem Sicherheitsfachwirt in der Gruppe DQR6 gelistet ist.[16] Interessanterweise werden im Referentenentwurf des Sicherheitsgewerbegesetzes (SiGG) teilweise andere Termini und Begriffe verwandt, die allerdings bei den Marktteilnehmern, die sich in ihrer jeweiligen Stellungnahme zu diesem Entwurf positioniert haben, nicht unumstritten sind.[17]
Andere Ansätze zur Steigerung der Attraktivität der Branche sind seit vielen Jahren in der Diskussion und Umsetzung. Dazu gehören beispielsweise die Umgestaltung der Dienst- und Arbeitszeiten, um sowohl alleinerziehenden Eltern als auch Frauen eine adäquate und krisensichere Beschäftigungsalternative zu bieten, sowie die kontinuierliche Anpassung und Erhöhungen der Stundenlöhne durch die Tarifverträge.
Der Anteil der beschäftigten Frauen im Sicherheitsgewerbe liegt in den letzten Jahren stabil bei etwa 21 %.[18] Wesentlich zur kontinuierlichen Anpassung der Löhne in der Branche hat die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes im Januar 2015 von seinerzeit 8,50 € beigetragen. Im Januar 2024 wurde dieser auf 12,41 € erhöht, für Januar 2025 sind 12,82 € geplant.
Die Branche kann sicherlich an Attraktivität gewinnen, wenn sie sich selbst auch weiterhin mehr als Teil der Inneren Sicherheit präsentiert, angemessene und tarifgebundene Löhne zahlt, ein selbstbewussteres und zukunftsorientiertes Mindset etabliert und nicht nach geringqualifizierten Beschäftigten sucht, um vakante Positionen bei ihren Kunden überwiegend margenoptimiert zu besetzen.
2.Das Arbeitssystem „Sicherheit“
Abb. 1: Das Arbeitssystem „Sicherheit“ (Quelle: eigene Darstellung)
Die private Sicherheitswirtschaft als Ganzes oder auch jede einzelne Tätigkeit darin kann als Arbeitssystem bzw. als Subsystem oder einzelnes Systemelement innerhalb der Systemgrenzen betrachtet werden.
Das Arbeitssystem besteht vereinfacht aus den folgenden Elementen:
–
der Eingabe: Information, Auftrag;
–
den Arbeitsmitteln: Einsatz- und Führungsmittel;
–
dem Arbeitsplatz oder der Arbeitsstätte sowie der Arbeitsumgebung;
–
der Arbeitsaufgabe: Dienstleistungsauftrag, Arbeitsvertrag, Dienstanweisung;
–
dem Arbeitsablauf: QM-Handbuch, IMS, Prozessbeschreibungen;
–
dem Menschen: individuelle Leistungsvoraussetzungen, Kompetenzen und Skills;
–
der Ausgabe bzw. dem Arbeitsergebnis: Schutz und Sicherheit.
Eingebettet in die Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland gibt es benachbarte Systeme, wie beispielsweise den Bereich der öffentlichen bzw. behördlichen Sicherheit sowie die sog. „BOS“, also diejenigen Behörden und Organisationen, die mit Sicherheitsaufgaben und der Abwehr von Gefahren betraut sind. Innerhalb der Branche werden diese auch als „Blaulichtorganisationen“ bezeichnet.
Ein hochwertiges und modernes Sicherheitsdienstleistungsunternehmen und die eingesetzten Beschäftigten sollten ein hohes Maß an Kompetenz und Qualität (an)bieten können. Kompetenz- und Qualitätsansprüche der Kunden gegenüber den Dienstleistern finden sich unter anderem in den folgenden Themenfeldern und Bereichen:[19]
–
„Zertifizierung nach den gängigen und aktuellen Richtlinien,
–
qualitative Aus- und Weiterbildung,
–
transparente Kostenpolitik,
–
fundamentiertes Fachwissen in Bereichen wie z. B.
–
Recht,
–
Umgang mit Menschen,
–
Wirkung der eigenen Person,
–
Umgang mit ethnischen Gruppen,
–
Deeskalationstechniken,
–
Sprachen,
–
serviceorientiertes Verhalten,
–
Sicherheitstechnik,
–
Arbeitssicherheit,
–
Umweltschutz,
–
Betriebswirtschaft,
–
Situationsbewertung und situationsgerechtes Verhalten,
–
individuelle Spezialkenntnisse im eingesetzten Bereich.“
[20]
„Sicherheitsdienste sind in der Regel (…) freiwillige und privatrechtliche Einrichtungen (…):
–
ohne hoheitliche (polizeiliche) Befugnisse,
–
weisungsgebunden und
–
eigenverantwortlich, um
–
den vorbeugenden und
–
abwehrenden Schutz eines Kunden (materiell, immateriell und personell) sicherstellen.“
[21]
Der für die Beschäftigten relevante sog. „Generalauftrag“ lautet:
Wach- und Sicherungsdienste haben die Aufgabe:
–
Sicherheit und Ordnung im Unternehmen aufrecht zu erhalten, sowie
–
Gefahren und Schäden zum Nachteil des Unternehmens, der Belegschaft und der Allgemeinheit abzuwenden,
–
Gebote und Verbote zu überwachen und durchzusetzen,
–
bei eingetretenem Schaden dessen Ausweitung zu verhindern,
–
deren Ursachen aufzuklären und der Unternehmensleitung zur Kenntnis zu geben.
2.1.Sicherheit als Querschnittsthema
Die heutige moderne Sicherheit ist ein Querschnittsthema, was bereits durch die Begriffe Safety und Security deutlich wird. Die Verteilung der Tätigkeitsfelder der privaten Sicherheitsdienstleister[22] sowie weitere Bereiche, wie Wirtschafts- und Umweltschutz, Unternehmens- und Arbeitssicherheit, Risiko- und Krisenmanagement, nicht zuletzt Business Continuity Management und Katastrophenschutz, zählen mittlerweile dazu. Weitere für das Querschnittsthema „Sicherheit“ relevante Aspekte und Gesetze sind:
–
Sicherheitsgewerbegesetz (SiGG, lt. RefE von 07.2023),
–
Bewacherregister (Version 4.6 von 05.2024/lt. RefE/SiGG: Sicherheitsgewerberegister),
–
KRITIS-Dachgesetz (2. Referentenentwurf von 12.2023),
–
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz von 01.2023 (LkSG, kurz: Lieferkettengesetz),
–
Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) seit Mai 2018,
–
Zweites Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme, (IT-Sicherheitsgesetz 2.0) seit Mai 2021,
–
Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), letzte Aktualisierung 05.2023.
2.2.Das Arbeitssystem „Sicherheit“ unter dem Aspekt der Digitalisierung
Die digitalen Systeme, welche in der privaten Sicherheitswirtschaft zum Einsatz kommen, werden immer zahlreicher und komplexer. Die richtige Beratung durch den beauftragten Sicherheitsdienstleister und der korrekte Umgang damit durch die eingesetzten Sicherheitsmitarbeiter werden von den Kunden erwartet und vorausgesetzt.
Die Digitalisierung und der Einsatz von Sicherheitstechnik werden in Zukunft weiter zunehmen. Dazu einige Beispiele:[23]
–
Connected Buildings/Smarthome, z. B. Einsatz von digitalen Zutrittskontrollsystemen (ZKS), Remote Controlled Areas, Remote Video Systems (RVS), zzgl. Biometrische Verfahren (Anm. d. Autors),
–
Connected Vehicles, z. B. durch GPS überwachte Geld- und Werttransporte und Sonderschutzfahrzeuge mit SOS-Funktion und Panic-Option (Remote Systems),
–
Drohnentechnologie, z. B. Drohnen zur Überwachung von Veranstaltungen und größeren Flächen sowie zur Detektion beim Einsatz im Brandschutz und zur Brandbekämpfung,
–
E-Ticketing, z. B. Einlasskontrollen mit Mobile-Ticketing-Geräten, wie bei der EURO 24 umgesetzt,
–
Protective Intelligence, z. B. Gefährdungen und Schutzbedarfe mithilfe automatisierter und intelligenter Datenauswertung detektieren und Maßnahmen ableiten (OSINT/AI),
–
Virtual Reality, z. B. mithilfe von VR-Brillen mögliche Fluchtwege und Gebäudeinformationen abrufen und erkennen, Notfalltrainings für spezielle Szenarien.
2.3.Das Arbeitssystem „Sicherheit“ unter dem Aspekt der Technisierung
Von den wesentlichen, zu prüfenden Fachbereichen Recht, Dienstkunde, Psychologie und Technik, zuzüglich u. a. der Betriebswirtschaftslehre bei der Fachkraft, dem Meister und einigen Studiengängen, unterliegt insbesondere die Technik einer permanenten und oftmals rasant anmutenden Entwicklung und Komplexität. Auch die AI/KI wird sich sicherlich mit ihren Schulungs- und Personalentwicklungsmöglichkeiten in der Sicherheitswirtschaft etablieren.
Der unbefugte Zutritt von Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ und das Festkleben auf den Rollfeldern der Flughäfen Hamburg und Düsseldorf während der Ferienzeit im Juli 2023 und in Leipzig im August 2024 haben erneut zu einer Diskussion über die Sicherheit der Flughäfen in Deutschland geführt. Ebenfalls in Hamburg durchbrach im November 2023 ein Geiselnehmer mit seinem Fahrzeug mehrere Schranken und gelangte zu den Rollfeldern. Vor dem Hintergrund eines Sorgerechtsstreits brachte der Vater mit der Geiselnahme seines vierjährigen Kindes den Flugbetrieb für mehrere Stunden zum Erliegen.
Obgleich diese Ereignisse mögliche Schwachstellen in der Perimeter-Sicherheit der Flughäfen betreffen, ist, wie oftmals in solchen Fällen, die Frage nach dem Sicherheitskonzept und den Kompetenzen der dort tätigen Sicherheitsmitarbeiter zu stellen, sofern sie mit der Bewachung der Flughäfen beauftragt waren. Auch diesmal hat die Polizei das Krisenmanagement in Kooperation mit dem Management des Flughafens und deren Sicherheitsverantwortlichen übernommen. Angehörige und Vertreter privater Sicherheitsdienstleister sind in den Massenmedien offensichtlich nicht erkennbar in Erscheinung getreten.
In der Praxis gehört der Einsatz von Drohen und biometrischen Verfahren in der Perimeter-Sicherheit und im Facility Security Management schon seit vielen Jahren zum Alltag. Die Fachliteratur zur Unterrichtung bzw. Schulung und Prüfungsvorbereitung gem. § 34a GewO hat allerdings mechanische und elektronische Sicherungseinrichtungen, Zäune, Schranken, Schließanlagen, Zutrittskontrollsysteme (ZKS), Gefahrenmeldeanlagen (EMA, ÜMA, BMA) sowie Kommunikationsmittel wie bspw. den Funk zum Inhalt.[24]
Dass es die DIHK in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf des Sicherheitsgewerbegesetzes begrüßt, dass die Durchführung der Sachkundeprüfung und Unterrichtung (Schulung) lt. RefE den Industrie- und Handelskammern vorbehalten bleiben soll, ist eher weniger durch die Aktualität der Schulungs- und Prüfungsinhalte zu rechtfertigen. Obgleich es nachvollziehbar immer einige Zeit in Anspruch nimmt, bis die jeweiligen „Prüfungsfragenerstellungsausschüsse“ der Kammern aktuelle Fragen erarbeitet haben und danach die aktualisierte Fachliteratur am Markt erhältlich ist. Die Sicherheitsfachschulen des BDSW und andere zertifizierte Bildungsträger anderer Organisationen und Verbände könnten hier bei der Durchführung des Unterrichtungsverfahrens und mittels eigenständig durchgeführter Prüfungen unterstützen. Viele dort eingesetzte Dozenten und Referenten sind aus der Branche und oftmals selbst in den Prüfungsausschüssen der Kammern als Prüfer aktiv.
2.4.Die Gegenseite
In der Sicherheitsbranche werden die potenziellen Angreifer und Organisationen oder die individuell motivierten Bedrohungen und Gefahren als „Gegenseite“ bezeichnet. Es ist davon auszugehen, dass sich die Gegenseite fortlaufend professionalisiert und in ihren Strukturen und Modi Operandi stets weiterentwickelt und anpasst. Es erscheint naheliegend, dass zu Zeiten der allgemeinen Wehrpflicht und auch aufgrund ausländischer militärischer und polizeilicher Institutionen Kriminelle in ihrem Leben eine hochprofessionelle behördliche, militärische oder andere sicherheitsrelevante Grund-, Aus- bzw. Fortbildung durchlaufen haben könnten. Mit der Entwicklung der Gegenseite Schritt zu halten, ist ein wesentlicher Grund, warum die Bildung der Sicherheitsmitarbeiter nicht auf eine ein- oder mehrwöchige Schulung begrenzt sein sollte, zumal die Wehrpflicht seit 2011 ruht und eine entsprechende Grundqualifizierung und -sensibilisierung bei den potenziellen Sicherheitsmitarbeitern hierzulande schon jetzt nicht mehr zu erwarten ist.
Eine professionalisierte Gegenseite ist höchstwahrscheinlich zu Spionage, Sabotage und Zersetzung (vgl. Insider-Threat-Policy) fähig. Die bis heute unaufgeklärten Sabotageakte an den Gaspipelines in der Ostsee sind dafür ein Beispiel. Die Fähigkeiten der Gegenseite beinhalten die Beobachtung und Ausspähung der strategischen, technischen, organisatorischen und personellen Komponenten und Systemelemente der Sicherheitsorganisation eines Unternehmens. Die Gegenseite bei ihren Aktivitäten zum Nachteil des auftraggebenden und zu schützenden Unternehmens zu entdecken, bestenfalls zu observieren, zu entlarven und einer behördlichen Strafverfolgung zuzuführen, erfordert mehr als nur latente Grundkenntnisse und Basiskompetenzen bei den Sicherheitsmitarbeitern.
2.5.Relevante externe Schnittstellen
Relevante externe Systemschnittstellen der privaten Sicherheitswirtschaft sind neben den Kräften der Polizeien das Technische Hilfswerk (THW), die Feuerwehren und Rettungsdienste (BOS), die auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 zum Einsatz kamen. Die FORSI stellte bei der ersten FORSI-Sicherheitstagung am 24. September 2021 in Hamburg zum Thema „Neuordnung des Bevölkerungsschutzes in Deutschland“ Überlegungen zu einem künftigen Bevölkerungsschutzkonzept unter Berücksichtigung und möglicher Einbeziehung der Sicherheitswirtschaft an.[25]
Es ging um die Frage, inwieweit Ressourcen der privaten Sicherheitswirtschaft zum Bevölkerungsschutz beitragen können und ob die Sicherheitsdienstleistungsunternehmen dies als ein neues Geschäftsfeld bewerten und demzufolge bereit sind, sich einzubringen.
Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hat als Bevölkerungsschutzthemen die folgenden Bereiche benannt:[26]
–
Zivil- und Katastrophenschutz
–
Internationale Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz
–
Krisenmanagement
–
Schutz kritischer Infrastruktur
–
Ehrenamt im Bevölkerungsschutz
–
Resilienzstrategie
2.6.Abgrenzung der Rechtsgrundlagen
Entscheidend für alle einsatztaktischen und personalentwicklungsrelevanten Maßnahmen ist die unterschiedliche Rechtsgrundlage der öffentlichen und der privaten Sicherheit.
Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist die Wahrnehmung „hoheitlicher Aufgaben“ durch behördliche und militärische Einsatzkräfte. Dies ist explizit in den jeweiligen Gesetzen definiert und erlaubt bspw. die Inanspruchnahme der Sonderrechte im Straßenverkehr nach § 35 StVO, welche den Beschäftigten privater Sicherheitsunternehmen nicht zugestanden werden.
Gemäß § 17 der Bewachungsverordnung (BewachV) muss jede Dienstanweisung den Hinweis enthalten, dass „die Wachperson nicht die Eigenschaften und nicht die Befugnisse von Polizeivollzugsbeamten oder eines sonstigen Bediensteten einer Behörde besitzt“[27]. Angehörige privater Sicherheitsdienstleister können sich lediglich im Rahmen sog. „Jedermannsrechte (Ausnahmerechte)“ bewegen. Das heißt, sie können nur diejenigen Rechte in Anspruch nehmen, die auch jedem anderen Bürger in der Bundesrepublik zustehen. Dies hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Arbeitsweise, die Einsatzplanung sowie die taktische und strategische Struktur der privaten Sicherheitsdienstleistungen.
Tab. 1 Rechtfertigungsgründe (Quelle: eigene Darstellung)
Tabellarische Darstellung der Jedermanns- bzw. Ausnahmerechte, die Angehörige privater Sicherheitsdienste in Anspruch nehmen können.
Die Rechtfertigungsgründe, sog. „Jedermannsrechte/Ausnahmerechte“
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 227
Notwehr, Nothilfe
§ 228
Verteidigungsnotstand
§ 229
Allgemeine Selbsthilfe
§ 859
Selbsthilfe des Besitzers
§ 860
Selbsthilfe des Besitzdieners
§ 904
Angriffsnotstand
Strafgesetzbuch (StGB)
§ 32
Notwehr, Nothilfe
§ 34
Rechtfertigender Notstand
§ 35
Entschuldigender Notstand (Entschuldigungsgrund)
Strafprozessordnung (StPO)
§ 127 Abs. 1
Vorläufige Festnahme
Sonstige
Einwilligung des Betroffenen
Z. B.: bei ärztlichen Behandlungen, Erster Hilfe
Tab. 2 ÖS vs. PS (Quelle: eigene Darstellung)
Systematische Darstellung der konstitutiven Unterschiede zwischen Öffentlichem und Privatem Recht.
Öffentliches Recht
Privates Recht/Zivilrecht
Staat
↕
Bürger
Bürger ↔ Bürger
Der Bürger ordnet sich dem Staat unter
Beide Parteien sind gleichgestellt
Subordinationsprinzip
Koordinationsprinzip
Interessen des Staates
Teil der staatlichen Rechtsordnung
Die (Vertrags-)Parteien sind gleichberechtigt, auch der Staat als fiskalischer Vertragspartner
Hoheitliche Aufgaben, spezielle Rechte (z. B. Strafverfolgung)
Keine hoheitlichen Befugnisse
Gewaltmonopol
In Ausnahmesituationen können die „Jedermannsrechte“ (Ausnahmerechte) in Anspruch genommen werden
Öffentliches Recht vs. Privatrecht
Sicherheitsmitarbeiter haben keinerlei hoheitlichen Rechte! Sie haben lediglich Rechte wie jeder andere Bürger auch. Dies sind die sog. „Jedermanns“- bzw. „Ausnahmerechte“.
Die Sicherheitsmitarbeiter haben vertragliche Pflichten (Garantenpflicht), die sich u. a. ergeben aus:
–
ihrem Arbeitsvertrag,
–
ihren Dienstanweisungen und
–
ggf. auch durch die Betriebsvereinbarungen etc.
Der Begriff der „Jedermannsrechte“ ist in Verbindung mit den Notwehr- und Selbsthilferechten sowie der vorläufigen Festnahme von Bedeutung. Diese Rechte haben die Beschäftigten in der Sicherheitswirtschaft während ihres Einsatzes genauso wie alle anderen Bürger. Da diese Rechte jedoch nur dann in Anspruch genommen werden dürfen, wenn obrigkeitliche, also staatliche Hilfe nicht rechtzeitig erreichbar ist, werden sie auch als „Ausnahmerechte“ zum Gewaltmonopol des Staates bezeichnet.
Diese klare Abgrenzung schließt eine Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsunternehmen und den Polizeien und Behörden ausdrücklich mit ein. Sog. Citystreifen bestehen z. B. meist aus je einem Mitarbeiter aus einer Behörde bzw. einem Sicherheitsunternehmen. Diese Zusammenarbeit nennt sich „Public Private Partnership“ (PPP). Dabei müssen die Zuständigkeitsbereiche und Kompetenzen klar definiert sein.
Treuepflicht vs. Garantenstellung
Die Treuepflicht im öffentlichen Dienst unterscheidet sich wesentlich von der Garantenstellung der Beschäftigten in der privaten Sicherheitswirtschaft.
Die Treuepflicht des Arbeitnehmers gehört zu seinen Nebenpflichten und ist in §§ 241, 242 BGB geregelt. Sie besagt, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung in Treu und Glauben zu erbringen hat. Er muss loyal gegenüber seinem Arbeitgeber sein und sein Verhalten darauf ausrichten, Schaden von dem Unternehmen fernzuhalten. Zu den Loyalitätspflichten gehört auch eine Verschwiegenheitspflicht.
Die sog. Garantenstellung ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag nach § 611a BGB in Verbindung mit § 13 StGB „Begehen durch Unterlassen“.
Artikel 33 Abs. 4 des Grundgesetzes lautet:
Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.
Nach § 41 Satz 2 TVöD (BT-V) und § 60 „Grundpflichten“ des Bundesbeamtengesetz (BBG) ist der Beschäftigte verpflichtet, sich durch sein gesamtes Verhalten zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen:
Sie haben ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und ihr Amt zum Wohl der Allgemeinheit zu führen. Beamtinnen und Beamte müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten.
Beamtinnen und Beamte haben gemäß § 64 Abs. 1 BBG folgenden Diensteid zu leisten: „Ich schwöre, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.“ Der Zusatz „so wahr mir Gott helfe“ ist nach § 64 Abs. 2 freiwillig.
Gemäß des Bundesbeamtengesetzes sind Beamte und Soldaten verpflichtet zur Zurückhaltung bei politischer Betätigung und im Ausland, zur Verschwiegenheit, zur Genehmigung von Nebentätigkeiten sowie dazu, keine Belohnungen und Geschenke anzunehmen. Beamte haben die Grundpflicht, dem ganzen Volk und nicht einer Partei zu dienen.
Garantenstellung innerhalb der privaten Sicherheitswirtschaft
Eine Garantenstellung aus der Übernahme von Pflichten haben die Sicherheitsmitarbeiter durch:
–
ihren Arbeitsvertrag,
–
ihre Dienstanweisungen,
–
ggf. auch durch die Betriebsvereinbarungen etc.
Durch die Übernahme der dort genannten Aufgaben und Verpflichtungen werden sie zum Garanten für deren Einhaltung. Jeder kann eine Garantenstellung durch Übernahme von Pflichten innehaben, bspw. durch:
–
den Arbeitsvertrag,
–
gesetzliche Pflichten (z. B. § 618 BGB „Schutzpflicht des Unternehmers“),
–
eine Gefahrengemeinschaft (z. B. Feuerwehr, Bergsteiger),
–
eine enge Lebensgemeinschaft (Eheleute, Eltern-Kinder etc.).
Eine Garantenstellung ergibt sich aus der Übernahme von Pflichten. Eine Zuwiderhandlung ist gesetzlich im Strafrecht § 13 StGB „Begehen durch Unterlassen“ geregelt:
(1) Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht.
(2) Die Strafe kann nach § 49 Abs. 1 gemildert werden.
Rechtsgrundlagen & Gewerbezugangsvoraussetzungen
Solange das Sicherheitsgewerbegesetz noch nicht verabschiedet ist, sind die Tätigkeits- bzw. Zugangsvoraussetzungen zur Branche in der Gewerbeordnung (GewO) und der Bewachungsverordnung (BewachV) definiert und nach wie vor gültig.
Als Konsequenz aus den Verfehlungen von Sicherheitsmitarbeitern in der Flüchtlingsunterkunft in Burbach im Jahre 2014 und der europaweiten Flüchtlingskrise 2015 gründete der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) einen Arbeitskreis, der sich kurz darauf zu einem regelmäßig tagenden „Fachausschuss zum Schutz von Flüchtlingsunterkünften“ etabliert hat.
Als ein Ergebnis dieses Arbeitskreises wurde das im Herbst 2014 vom BDSW erarbeitete 12-Punkte-Papier am 15. März 2016 als Positionspapier zum Schutz von Flüchtlingsunterkünften veröffentlicht.[28]
Darin beschreibt der BDSW die Notwendigkeit u. a. der folgenden Punkte:
–
Sicherheitskonzept und eindeutige Vertragsregelungen;
–
Schulungen der Fach- und Führungskräfte in interkulturellen Kompetenzen;
–
Entlohnung deutlich über dem Branchenmindestlohn;
–
Eigensicherung, 4-Augen-Prinzip, persönliche Schutzausrüstung, medizinische Vorsorge;
–
Erweiterte Zuverlässigkeitsüberprüfung für die eingesetzten Sicherheitsmitarbeiter;
–
Überprüfung und Kontrolle durch Behörden;
–
Erfordernis der Neuregelung der Auftragsvergabe;
–
Zwingende Berücksichtigung von Qualitätskriterien;
–
Ausschluss von Nachunternehmen, aber Ermöglichung von Arbeitsgemeinschaften.
Im Februar 2021 veröffentlichte der BDSW mit diesen Inhalten einen aktualisierten Leitfaden zum Schutz von Flüchtlingseinrichtungen und -unterkünften für öffentliche Auftraggeber. Dieser Leitfaden enthält ähnliche Regelungen, wie sie von Vertretern und Verbänden der privaten Sicherheitswirtschaft im Jahre 2019 in dem Eckpunktepapier des BDSW zum eingeforderten Sicherheitsdienstleistungsgesetz (SDLG) benannt wurden. Einher ging damit die Forderung, dass die Zuständigkeit vom Wirtschaftsministerium zum Innenministerium wechseln solle, was zum 01. Juli 2020 nach 93 Jahren dann auch erfolgte. Seit September 2023 liegt nunmehr der Referentenentwurf zum Sicherheitsgewerbegesetz (SiGG) vor.
Gewerbeordnung § 34a Bewachungsgewerbe; Verordnungsermächtigung
Im § 34a der Gewerbeordnung (GewO) heißt es:
(1) Wer gewerbsmäßig Leben oder Eigentum fremder Personen bewachen will (Bewachungsgewerbe), bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis kann mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutz der Allgemeinheit oder der Auftraggeber erforderlich ist; unter denselben Voraussetzungen sind auch die nachträgliche Aufnahme, Änderung und Ergänzung von Auflagen zulässig. Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn
1.Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller oder eine der mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten Personen die für den Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, 2.der Antragsteller in ungeordneten Vermögensverhältnissen lebt,3.der Antragsteller oder eine mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person nicht durch eine vor der Industrie- und Handelskammer erfolgreich abgelegte Prüfung nachweist, dass er die für die Ausübung des Bewachungsgewerbes notwendige Sachkunde über die rechtlichen und fachlichen Grundlagen besitzt; für juristische Personen gilt dies für die gesetzlichen Vertreter, soweit sie mit der Durchführung von Bewachungsaufgaben direkt befasst sind oder keine mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person einen Sachkundenachweis hat, oder 4.der Antragsteller den Nachweis einer Haftpflichtversicherung nicht erbringt.(…)
(1a) Der Gewerbetreibende darf mit der Durchführung von Bewachungsaufgaben nur Personen (Wachpersonen) beschäftigen, die
1.die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen und2.durch eine Bescheinigung der Industrie- und Handelskammer nachweisen, dass sie über die für die Ausübung des Gewerbes notwendigen rechtlichen und fachlichen Grundlagen unterrichtet worden sind und mit ihnen vertraut sind.
Verordnung über das Bewachungsgewerbe (Bewachungsverordnung – BewachV)
Die Inhalte des Unterrichtungsverfahrens (UV) sind in der Bewachungsverordnung (BewachV) aufgeführt:
§ 7 Inhalt der Unterrichtung
Die Unterrichtung umfasst nach näherer Bestimmung der Anlage 2 für alle Arten des Bewachungsgewerbes die fachspezifischen Rechte, Pflichten und Befugnisse folgender Sachgebiete:
1.Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Gewerberecht,2.Datenschutzrecht,3.Bürgerliches Gesetzbuch,4.Straf- und Strafverfahrensrecht, Umgang mit Waffen,5.Unfallverhütungsvorschrift Wach- und Sicherungsdienste,6.Umgang mit Menschen, insbesondere Verhalten in Gefahrensituationen, Deeskalationstechniken in Konfliktsituationen sowie interkulturelle Kompetenz unter besonderer Beachtung von Diversität und gesellschaftlicher Vielfalt und 7.Grundzüge der Sicherheitstechnik.
Die Notwendigkeit, Beschäftigte des Sicherheitsgewerbes in interkulturellen Kompetenzen zu schulen, ergab sich aus den Verfehlungen in Burbach 2014 und der Flüchtlingswelle im Jahre 2015. Aus dem Handlungsbereich „Rechts- und aufgabenbezogenes Handeln“ fehlt hier allerdings erkennbar das Themenfeld der Dienstkunde. Dieses beinhaltet bspw. Torkontrolle, Empfangs-, Posten- und Streifendienst, Veranstaltungsdienst und andere Bereiche, welche die wesentlichen Tätigkeiten des Sicherheitsmitarbeiters definieren.
§ 8 Anerkennung anderer Nachweise
Bei Vorliegen folgender Nachweise ist der Nachweis einer Unterrichtung nicht erforderlich:
1.Nachweis einer mit Erfolg abgelegten Abschlussprüfung a)als geprüfte Werkschutzfachkraft,b)als geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft,c)als Servicekraft für Schutz und Sicherheit,d)als Fachkraft für Schutz und Sicherheit,e)als geprüfter Meister für Schutz und Sicherheit oder als geprüfte Meisterin für Schutz und Sicherheit, f)als geprüfter Werkschutzmeister oder als geprüfte Werkschutzmeisterin,2.Prüfungszeugnis über den erfolgreichen Abschluss im Rahmen einer Laufbahnprüfung mindestens für den mittleren Dienst im Bereich der Ausbildung für den Polizeivollzugsdienst eines Landes oder des Bundes, für den Justizvollzugsdienst, für den waffentragenden Bereich des Zolldienstes und für den Feldjägerdienst der Bundeswehr, 3.Prüfungszeugnis über einen erfolgreichen Abschluss eines rechtswissenschaftlichen Studiums an einer Hochschule oder Akademie, die einen Abschluss verleiht, der einem Hochschulabschluss gleichgestellt ist, wenn zusätzlich ein Nachweis über eine Unterrichtung durch eine Industrie- und Handelskammer über die Sachgebiete nach § 7 Nummer 5 bis 7 vorliegt, 4.Bescheinigung über eine erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung nach § 11 Absatz 7.
§ 9 Zweck und Gegenstand der Sachkundeprüfung
(1) Zweck der Sachkundeprüfung nach § 34a Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 und Absatz 1a Satz 2 der Gewerbeordnung ist es, den Nachweis zu erbringen, dass die dort genannten Personen die für die eigenverantwortliche Wahrnehmung der Bewachungsaufgaben erforderlichen Kenntnisse über die dafür notwendigen rechtlichen Vorschriften und fachbezogenen Pflichten und Befugnisse sowie deren praktische Anwendung erworben haben.
(2) Gegenstand der Sachkundeprüfung sind die in § 7 in Verbindung mit Anlage 2 aufgeführten Sachgebiete; die Prüfung soll sich auf jedes der dort aufgeführten Gebiete erstrecken.
(…)
§ 17 Dienstanweisung
(1) Der Gewerbetreibende hat den Wachdienst durch eine Dienstanweisung nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 zu regeln. Die Dienstanweisung muss den Hinweis enthalten, dass die Wachperson nicht die Eigenschaft und die Befugnisse eines Polizeivollzugsbeamten, oder eines sonstigen Bediensteten einer Behörde besitzt. Die Dienstanweisung muss ferner bestimmen, dass die Wachperson während des Dienstes nur mit Zustimmung des Gewerbetreibenden eine Schusswaffe, Hieb- und Stoßwaffen sowie Reizstoffsprühgeräte führen darf und jeden Gebrauch dieser Waffen unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle und dem Gewerbetreibenden anzuzeigen hat.
(2) Der Gewerbetreibende hat der Wachperson vor der ersten Aufnahme der Bewachungstätigkeit einen Abdruck der Dienstanweisung gegen Empfangsbescheinigung auszuhändigen.
(3) Der Gewerbetreibende hat die in seinem Gewerbebetrieb beschäftigten Personen vor der ersten Aufnahme der Bewachungstätigkeit schriftlich zu verpflichten, auch nach ihrem Ausscheiden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Dritter, die ihnen in Ausübung des Dienstes bekannt geworden sind, nicht unbefugt zu offenbaren.
Durchaus als Versäumnis bei der damaligen Definition und Implementierung dieser Gewerbezugangsvoraussetzungen bezüglich der Schulungsinhalte für das Unterrichtungsverfahren und die Sachkundeprüfung gemäß § 34a Gewerbeordnung kann die Nichtberücksichtigung des Handlungsfeldes der Dienstkunde betrachtet werden. Die Dienstkunde ist in allen weiterführenden Qualifikationen und den beiden Ausbildungsberufen eines der Handlungs- bzw. Themenfelder. Im Lernfeld 1 der Fachkraft für Schutz und Sicherheit sind diese unter der Überschrift „Den Ausbildungsbetrieb und seine Leistungen im Tätigkeitsfeld der Sicherheitswirtschaft präsentieren“ wie folgt aufgeführt.[29]
–
Torkontroll- und Empfangsdienst
–
Posten- und Streifendienst
–
Alarm- und Interventionsdienst
–
Schließdienst
–
Revierdienst
–
Streifendienst im öffentlichen Raum
–
Sicherungs- und Kontrolldienst im ÖPNV
–
eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten
–
Methodentraining
DGUV Vorschrift 23
Die private Sicherheitswirtschaft ist hinsichtlich des Unfallversicherungsträgers der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zur Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) zugeordnet. Die DGUV Vorschrift 23 (DGUV V 23) „Wach- und Sicherungsdienste“ definiert klare Vorgaben für dieses Berufs- und Tätigkeitsfeld.
Darin heißt es u. a. zum Themenfeld Dienst- und Fachkunde:
§ 1 Geltungsbereich
(…)
§ 2 Allgemeines
(…)
§ 3 Eignung
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Wach- und Sicherungstätigkeiten nur von Versicherten ausgeführt werden, die die erforderlichen Befähigungen besitzen. Die Versicherten dürfen für diese Tätigkeiten nicht offensichtlich ungeeignet sein. Über die Befähigungen sind Aufzeichnungen zu führen.
In der Durchführungsanweisung DGUV Vorschrift 23 DA heißt es dazu:
Zu § 3:
Hierdurch soll hinsichtlich der Eignung auch einer Überforderung der Versicherten entgegengewirkt werden. Eignung und Zuverlässigkeit bedingen ein entsprechendes Persönlichkeitsbild. Demgemäß darf der Unternehmer für die jeweilige Wach- und Sicherungstätigkeit nur Versicherte einsetzen, die
–hierfür körperlich und geistig geeignet sowie persönlich zuverlässig sind,–das 18. Lebensjahr vollendet haben und–für die jeweilige Tätigkeit angemessen ausgebildet sind.