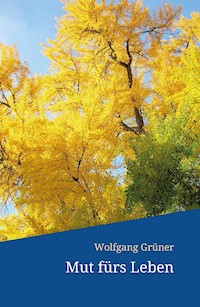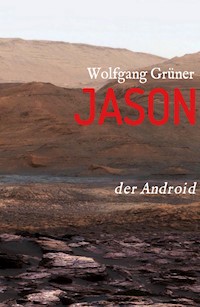2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Europa ist in Gefahr. Dieses Buch zeigt die Risiken in der Wirtschaft, einer falschen Politik und einer zunehmenden Abhängigkeit von fremdem Kapital. Die Gedanken über Wirtschaft, Zuwanderung und Politik sind in eine spannende und faszinierende Zeitreise eingebettet. Der Mittelstand schrumpft. Narzisstische Politiker, unkontrollierte Zuwanderung, extremer Reichtum in den Händen einiger Menschen, multinationale Unternehmen und ausufernde Sozialansprüche gefährden den sozialen Zusammenhalt. Gibt es eine Lösung?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Grüner Wolfgang
FUTURA
Der Staat aus der Zukunft
Verlag tredition GmbH, Hamburg
© 2017 Wolfgang Grüner
Umschlag: Neumann Josi
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
978-3-7439-1563-3 (Paperback)
978-3-7439-1564-0 (Hardcover)
978-3-7439-1565-7 (e-Book)
Futura - der Staat aus der Zukunft
Prolog
Noch geht es uns gut. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine fast durchgehende Periode des Aufschwungs und des Friedens erlebt. Handel, Innovationen und eine hart arbeitende Bevölkerung haben den westlichen Staaten einen ungekannten Wohlstand beschert. Zahlreiche Krisen wurden gemeistert.
Doch die Staaten – vor allem die europäischen - werden von zwei Seiten in die Zange genommen.
Von den Reichen und den multinationalen Firmen, die von Politikern hofiert und mit Steuergeschenken angelockt werden, die sich aber vor jeder Verantwortung für das Gemeinwohl drücken und immer mehr Macht erlangen.
Ebenso von jenen, denen sie langfristig unbezahlbare Sozialleistungen und Pensionen versprochen haben, unterstützt von Gutmeinenden einer Gesellschaft, die auf der Suche nach Sinn ihr Helfersyndrom austoben wollen, allerdings mit Geschenken, die oft andere, vor allem die nächsten Generationen, bezahlen sollen. Zu klein ist die Gruppe derer, die ihre Aufgabe darin sehen, die Welt durch eigene Leistungen zu verbessern und neue Lösungen für alte Trampelpfade zu suchen. Als Bürger unseres Landes – denen anderer Nationen geht es auch nicht besser droht uns das langsame Erstarren in Zwängen, Überlieferungen und Schulden. Immer weiter so, auch wenn die Richtung falsch ist. Wir verkaufen die Zukunft unserer Kinder, weil wir uns an einen munter sprudelnden Sozialstaat gewöhnt haben, selbst dann, wenn wir spüren, dass wir so nicht ewig weitermachen können. Wir halten an alten Gewohnheiten und Ideen fest, je besser es uns geht, desto mehr ängstigen Wandel und Ungewissheit.
Die Rezepte für ein besseres Miteinander gibt es längst, zu viel Pessimismus ist nicht angebracht. Wir werden länger und gesünder leben, der Medizin werden neue Fortschritte gelingen, manchen wird es noch besser gehen als bisher. Aber für viele Menschen in der Welt ist unsere Form des Lebensstandards unerreichbar, aber auch ziemlich sinnlos. Denn das Glück unseres Lebens liegt nicht in noch mehr Autos, noch mehr Konsum. Empathie, Bildung und Kommunikation sind dagegen beliebig teilbar, machen glücklich und verschmutzen keine Umwelt. Im Wesentlichen geht es darum, welches Menschenbild sich durchsetzen wird - das des Aktiven, Offenen und Engagierten, der sich täglich neu seinen Aufgaben stellt, oder das des wohlig Versorgten am Futtertrog sozialer Gaben. Zu oft halten wir unseren derzeitigen Wohlstand für selbst verdient und gottgegeben. Doch wir verdanken unseren Reichtum nicht allein unserer Leistung. Zu diesem haben in beträchtlichem Ausmaß die Steigerung der allgemeinen Produktivität, aber auch die Plünderung der Rohstoffe und die Ausuferung der Staatsschulden beigetragen. Nichts davon wird sich in einer endlichen Welt unendlich fortsetzen lassen.
Diese Erzählung ist eine Fiktion, die Personen und Orte sind frei erfunden, die Reiseberichte dagegen echt. Eine Fiktion sind natürlich auch manche der beschriebenen Techniken. Nicht alles wäre physikalisch möglich. Doch die Gedanken dieses Buches sollen zur Diskussion anregen. Unsere Zukunft ist offen, wir können sie gestalten. Neue Erfindungen werden dazu beitragen, so wie schon viele Entdeckungen und Verbesserungen zuvor, die unser Leben reicher und angenehmer gemacht haben. Grund genug, um dankbar zu sein.
Exponentielles Wachstum im Bereich der Informatik, Bionik und Kybernetik ist möglich, weil wir auf dem Wissen unserer Zeit aufbauen können und Wissen nicht die begrenzten Ressourcen unserer Erde belastet.
Exponentielles Wachstum des Wohlstandes und steigende Ansprüche sind dagegen nur für wenige möglich, die Grenzen unseres Lebensraumes werden trotz des technischen Fortschrittes immer stärker spürbar.
Die drohende Gefahr, dass sich der Reichtum unserer Erde in den Händen weniger sammelt, wird in diesem Roman komprimiert. Schon heute gehört einem Prozent der Reichsten ein Drittel dieser Welt oder anders gesagt: Zehn Männer haben so viel wie die ärmsten drei Milliarden Menschen. Einhundert Männer (und nur wenige Frauen) kontrollieren als CEO oder Aufsichtsrat fast die Hälfte der Weltwirtschaft. Die meisten Reichen sind nicht böswillig, das Geld fließt ihnen einfach zu. Aber wenn ihnen alles gehört, wohin gehen wir dann?
Die utopische Rahmenhandlung ist die Hülle für die politische und wirtschaftliche Aussage, dass Wohlstand ohne eigene Leistung nicht funktioniert, dass aber der angesammelte Reichtum in den Händen weniger uns zunehmend abhängig macht und damit die Gestaltung der eigenen Zukunft nimmt. Doch wir brauchen nicht in Pessimismus zu verfallen. Handel und kultureller Austausch vertiefen das Vertrauen in andere Menschen, und gegenseitiges Vertrauen ist ein mächtiger Impuls für eine bessere Zukunft. Mit dem vermehrten Austausch untereinander wachsen Empathie und Verständnis.
Kapitel 1: Der Aufbruch
20. Februar 2120
Hunderte Augen starrten fasziniert auf die Bildwand, die die ganze Raumseite des Kontrollzentrums einnahm. Trotz der frühen Stunde war der Raum dicht besetzt.
Eigentlich sollte es ein Routineunternehmen sein, immerhin war die Marsstation seit zwanzig Jahren in Betrieb.
Starts zum Mars und die Rückkehr zur Erde erfolgten im Fünfjahrestakt, der Aufbau der Station lag im Plan. Erfreulicherweise war bisher kein schlimmer Rückschlag zu verzeichnen. Eine Besatzung von fast zwanzig Wissenschaftlern und Technikern erforschte unter den Bedingungen der Marsatmosphäre den Weltraum und beobachtete mit den bisher leistungsfähigsten Teleskopen und Radiostationen Millionen von Lichtjahren entfernte Galaxien. Mit den neuesten wissenschaftlichen Apparaten war man den Geheimnissen der dunklen Materie und der Entstehung des Lebens auf der Spur.
Längere Zeit waren die Amerikaner die führende Weltraumnation gewesen. Schon seit über 100 Jahren, also etwa um die Jahrtausendwende, gelangen ihnen spektakuläre Marslandungen mit tausenden Fotos und Gesteinsanalysen. Auch Russen, Chinesen und Europäer arbeiteten als Wissenschaftler an einer Station, seit auch ihnen ab etwa 2050 Landungen am Mars gelungen waren. In den letzten zwanzig oder dreißig Jahren überrundeten dann die Wissenschaftler von Futura die anderen Nationen. Ihre Raketen konnten viel größere Mannschaften und Nutzlasten befördern und waren vor allem zuverlässiger.
Ihre Station lag in der Nähe der amerikanischen, war aber etwas geräumiger.
Die Versorgung mit Lebensmitteln und Energie gelang schon autark. Manche Gemüsesorten wie Tomaten und diverse Salate, die in Glashäusern auf der Erde wuchsen, gediehen auch hier recht gut. Aquarien lieferten Meeresfrüchte und Fische. Alles, was mehr Raum und Wärme brauchte wie Apfelbäume, Weinreben oder selbst einfache Kartoffeln, war reiner Luxus. Größere Tiere, die Auslauf und Weideflächen beanspruchten, waren erst recht nicht möglich. Die Aufzucht von Hühnern gelang, aber als glücklich durfte man sie nicht bezeichnen. Immerhin gaben sie sich mit wenig Platz, Algengewächsen und den Synthesekörnern zufrieden, die leicht herzustellen waren und den Wissenschaftlern der Station ohnehin nicht schmeckten.
Der Forschung war es gelungen, die Photosynthese der Pflanzen zu kopieren und aus den Abfallstoffen Kohlendioxid und Wasser mit Hilfe eines Katalysators und gebündelter Sonnenenergie Zucker und Stärke zu produzieren. Sauerstoff war dabei ein nützliches Begleitprodukt. Die Vielfalt der Natur mit ihren zehntausenden Geschmacksrichtungen blieb zum Leidwesen der Mannschaft unerreichbar. Trotzdem war das Verfahren ein gewaltiger Fortschritt, denn es lieferte sogar einen Überschuss der notwendigen Kohlenhydrate. Auch die Verwertung organischer Abfälle gelang in einem geschlossenen Kreislauf.
Die Probleme am Mars lagen in der stärkeren Strahlung, der geringeren Anziehungskraft des Planeten, der kaum vorhandenen Lufthülle, die vor allem aus Kohlendioxid bestand, und der Kälte, bedingt durch die größere Entfernung zur Sonne. Diese stand nur schwach leuchtend und wenig wärmend am Firmament. Ein Problem lag auch in der aufwändigen Gewinnung von Wasser, das trotz des Kreislaufes innerhalb der Station nur unter großem Aufwand ausreichend zur Verfügung stand. Ein Königreich für einen Wildbach, sprudelnd und klar, dachten sich manche immer wieder. Vorteile hingegen lagen in wertvollen Erzen, die eine neue Energietechnik und eine fast verlustfreie Speicherung von Strom ermöglichten. Lithiumverbindungen für Batterien lagen stark konzentriert vor.
Die heute startende Crew war die bisher größte, auch die mit den prominentesten Teilnehmern. Alle hatten militärische Ränge. Eine kurze Zeit beim Militär gehörte für alle dazu, die an den Raumfahrten teilnehmen oder zur Gesellschaft gehören wollten. Mit Gesellschaft war die Zugehörigkeit zur Elite gemeint, die in Futura regierte und das Sagen hatte. Ebenso selbstverständlich war die Ausbildung auf ihrer eigenen Universität, die zu den drei besten der Welt gehörte. Zwei oder drei Abschlüsse in verschiedenen Wissensgebieten waren durchaus normal. Wissen war der Schlüssel zur Anerkennung und zur Macht.
Die Familienherkunft war zwar wichtig, sie war so etwas wie es früher der europäische Adel gewesen war, aber ohne Ausbildung und eigene Leistung kam trotzdem niemand auf die gehobenen Positionen. Manche hatten auch öffentliche Ämter bekleidet, die aber für die Dauer der Reise ruhend gestellt wurden.
Das riesige Raumschiff lag noch träge im Licht der vor kurzem aufgegangenen Sonne. Dicke Kabelstränge und Leitungen banden die Rakete noch fest an die Rampe. Der aufgemalte Name Helion II blitzte silbrig auf.
Im Kontrollzentrum zeigte eingeblendet in die Bildwand eine große Digitalanzeige die Zeit. 8 Uhr 23 Ortszeit, darunter das Datum vom 20. Februar 2120. Nochmals darunter die rückwärts laufende Zeit bis zum Start: 01:24:16 - 01:24:15 - 01:24:14.
Ron Kurzweil, übrigens Nachfahre eines bekannten Forschers und Leiter des Kontrollzentrums, sah kurz auf. Auf der Anzeige sah er die Crew, die bereits ihre Plätze einnahm.
„Irgendwie sonderbar. Immer noch die gleichen Zeitangaben wie vor hundert Jahren“, sagte er zum Chef der Startvorbereitung.
„Was sollte denn anders sein?“, meinte der Angesprochene. „Die Erde kreist immer noch um die Sonne. Noch eine Stunde bis zum Start. Alles okay.“
Ron nickte. Hinter ihnen klangen die Stimmen der anderen Mitarbeiter des Zentrums. Die medizinischen Daten der Crewmitglieder wurden von ihren implantierten Körperchips direkt auf die Computer im Raum übertragen. Das lief seit Jahren vollautomatisiert. Auch die Daten aller anderen im Raum und außerhalb wurden übertragen. Die Voraussage seines Ururgroßvaters war Selbstverständlichkeit geworden. Die kurz nach der Geburt eingepflanzten Chips standen im ständigen Kontakt zum Zentralcomputer. Dieser überwachte ihre Körperfunktionen, erweiterte aber auch ihre Fähigkeiten, ermöglichte eine ständige Form von Kommunikation, Wissensvermittlung und Wahrnehmung. Die Bedenken, die noch ihre Elterngeneration wegen Anonymität, Privatleben und der möglichen Steuerung oder Beeinflussung gehabt hatten, waren den praktischen Vorteilen gewichen. Ihre Generation war vom Homo Sapiens zu einem Cyberwesen geworden. Die Anfänge waren schon lange zuvor mit dem Internet und den Smartphones grundgelegt worden. Sie trugen das Smartphone sozusagen in sich. Über ihren Biochip konnten sie mit dem Computer und dem Internet kommunizieren.
Ihre Gefühle, ihr Temperament und ihr Charakter waren ihnen geblieben, in diesem Bereich glichen sie dem Homo Sapiens noch immer. Sie liebten und waren traurig, waren frohe und meist auch soziale Wesen wie ihre Eltern und Großeltern auch. Ein bisschen smarter, klüger und gewandter waren sie schon, aber das war ja eigentlich auch bei früheren Generationen so gewesen. Ron erinnerte sich an alte Filme, in denen Jugendliche ihren Eltern den Umgang mit den digitalen Medien erklärten und noch mit gedruckten Büchern hantierten. Es gab auch in seiner Wohnung noch ein paar Bücher zur Erinnerung, aber sie waren nur noch Teil einer Sammlung nostalgischer Gegenstände, wobei er auf ein altes Nokiahandy durchaus stolz war. Trotz der damaligen Massenproduktion waren die meisten verloren gegangen und nur noch einige Exemplare in technischen Sammlungen erhalten.
Noch dreißig Minuten bis zum Start.
Die Crew lag inzwischen vollständig in ihren Schalensitzen, beobachtete die Anzeigen, hatte aber nicht wirklich zu tun, da die Kontrolle und der Countdown vom Zentralcomputer gesteuert wurden.
Dr. Pernstein winkte seinen beiden Söhnen im Kontrollzentrum zu. Er war der Kapitän des Raumschiffs, drahtig, energisch und hochintelligent. Gut, das waren eigentlich alle. Die aus neunzehn Personen bestehende Crew von 10 Männern und 9 Frauen war natürlich eine Eliteauswahl aus den Wissenschaftlern und wichtigen Familien ihres Staates. Alle fit und trainiert, alle Fachleute in mindestens zwei oder drei Wissensgebieten. Andere hätten die Chance zur Teilnahme ohnehin nie bekommen.
„Guten Flug, Daddy, du wirst uns abgehen“, riefen ihm seine gerade erwachsen gewordenen Söhne zu.
„Ihr mir auch, macht es gut“, antwortete ihnen ihr Vater. Dann wandte er sich wieder seiner Crew zu, um letzte Maßnahmen zu besprechen. „Irgendwie ein Abschied für so lange Zeit und ich finde nur die paar banalen Worte.“
Auf der Dachterrasse liefen die Kameras, deren Bilder ebenfalls eingeblendet wurden. Im Raumschiff waren alle zum Start bereit. Fünf Jahre Mars, neue Erfahrungen, aber auch harte Arbeit.
Das Schiff war für den Aufenthalt und die Rückreise ausgestattet, hatte aber auch eine Menge neuer Geräte an Bord, die ihnen das Leben in dieser Zeit wesentlich erleichtern sollten. Eines dieser Geräte, das neu entwickelt worden war, war die ausgereifte Ausgabe eines an sich seit hundert Jahren bekannten 3D-Druckers, der imstande war, mit den gespeicherten digitalen Anleitungen jeden beliebigen Gegenstand herzustellen. Dem Drucker gelang dies entweder direkt aus den Molekülen vorhandener Substanzen oder – allerdings zeitraubender – Atom für Atom. Von der Wurstsemmel bis zum Medikament, einem Computerchip oder was auch immer, alles war möglich. Die entsprechenden chemischen Elemente mussten natürlich vorhanden sein, das war aber nicht das Hauptproblem. Die größte Schwierigkeit lag in der enormen Computerleistung, die für komplexe Gegenstände notwendig war. Selbst ihr Hauptcomputer im Raumschiff arbeitete für die Reproduktion oder Herstellung komplizierter Gegenstände bis zu einer Stunde, obwohl er die millionenfache Rechenleistung älterer Computer hatte. Für einen einfachen Schlüssel benötigte der Drucker allerdings nur ein paar zehntel Sekunden. Für die medizinische Versorgung gab es zwei Medizinroboter mit den Möglichkeiten, die das 22. Jahrhundert bot, dazu die üblichen medizinischen Geräte, Medikamente, normales Werkzeug, Lasercutter, überraschenderweise auch einen Laserdefensor, eine tödliche Waffe, die jeden Panzer oder sonstigen Angreifer ausschalten konnte. Wozu um alles in der Welt sollten sie den am Mars brauchen?
Zwei Roboterbagger waren für den Abbau der Marserze bestimmt.
Noch acht Minuten bis zum Start.
Die Leitungen zum Raumschiff wurden gelöst. Ab nun hatte es keine materielle Verbindung zur Startrampe.
Für die Startphase war noch immer ein schon seit langer Zeit erprobter, allerdings verbesserter Flüssigtreibstoff nötig, den weiteren Antrieb besorgten ein Ionentriebwerk und Anti – Schwerkraftgenerator, die erst die langen bemannten Fahrten im Sonnensystem in einer vernünftigen Zeit ermöglichten.
Der Präsident ihres Landes wurde eingeblendet und wünschte der Mannschaft einen guten Flug.
Zwei Minuten bis zum Start.
Als die Zündung der Triebwerke erfolgte, bebte das ganze Schiff. Pünktlich mit nur einer Sekunde Verspätung erhob sich das riesige Raumschiff, schien noch einen kurzen Moment in seiner gewaltigen Feuerwolke zu verweilen, wurde schneller und schneller und verschwand im Dunst des sonnigen Tages.
An die hundert Augenpaare verfolgten den gelungenen Start im Kontrollraum. Man schien die Hitze zu spüren, die die Startrampe in einer Feuerwolke verschwinden ließ. Das Grollen der Triebwerke wurde authentisch mit übertragen. Nach verschiedenen 3D-Spektakeln war man in der Übermittlung von Bildern und Filmen wieder zum überwiegend zweidimensionalen Bild zurückgekehrt. Zu Hause vertiefte die dritte Dimension das Erlebnis, Bewegung und Düfte trugen ihren Anteil zum Gesamteindruck bei, im Bereich der raschen Informationsübertragung aus Bild und Schrift lenkte die Tiefenwirkung eher ab.
Klatschen brandete auf und die Spannung begann sich zu lösen. Als kleiner Punkt verschwand die Rakete vom Bildschirm, kurz darauf füllte sich die Bildwand wieder. In einer Direktübertragung aus dem Raumschiff meldete sich der Schiffsingenieur Raul Nonndorf:
„Wir sind alle wohlauf, der Flug ist jetzt ruhig.“ Raul war braunhaarig, lebendig, mit gerade mal 26 Jahren der Jüngste der Mannschaft. Aber das Schiff kannte er von oben bis unten, Teile davon gingen trotz seiner Jugend auf seine Entwürfe zurück.
Auch der Major Dr. Johann Urban, Freund des Generals und rangmäßig nach ihm der nächste, meldete sich. Er war ein Spezialist für Logistik, Finanzmathematik und Programmierung, außerdem der beste Schachspieler der Crew. Sogar den Rechner hatte er schon einmal geschlagen, was sonst noch niemandem gelungen war. Er war mit 34 Jahren schon einer der Älteren, ehrgeizig, halbe Sachen liebte er nicht.
Routinemäßig wurden ein paar technische Daten ausgetauscht.
„Der Blick auf die Erde ist traumhaft, diese blaue Kugel, gesprenkelt mit weißen Flecken, faszinierend. Richten sie Grüße an die Familie aus.“ Dann eine Pause von einer Minute, während im Hintergrund der Bildwand das Bild der Erde eingeblendet wurde: „Es wird mir plötzlich so stark bewusst, dass wir jetzt fünf Jahre unterwegs sind, dass es keine Berge und Wälder mehr gibt“, fast wie ein Selbstgespräch mit leiser Stimme. Dann wieder lauter und sachlich: „Das Ionentriebwerk arbeitet, wir beschleunigen auf 120 km pro Sekunde. Voraussichtliche Reisezeit bis zur Landung 38 Tage und 13 Stunden. Die Schwerkraft wurde auf 20 Prozent der Erdschwerkraft eingestellt.“
Es folgten noch ein paar dienstliche Gespräche. Daraufhin wurde der Sender für private Gespräche genutzt, Grüße an Freunde und die Familien geschickt.
Bei der Bodenstation und bei Präsident Aric Miller, dem Leiter des Stadtstaates Futura, waren inzwischen die Gratulationen anderer Wissenschaftler und ausländischer Politiker für den geglückten Start eingetroffen. Millers Sekretariat bedankte sich in den nächsten Stunden für die übersandten Glückwünsche.
Natürlich wusste Miller, dass nicht nur Freude und Anerkennung in deren Worten mitschwang. Zu tief war die Demütigung, dass diesem Emporkömmling von Stadtstaat der Erfolg nur so in den Schoß zu fallen schien. Dass ihr kleines Land trotz seiner geringen Größe wirtschaftlich und politisch mächtig und einflussreich geworden war. Es wurden zwar immer wieder dubiose und illegale Quellen für den plötzlichen Reichtum und die Macht dieses Staates vermutet, doch beweisen ließ sich nichts. Die Geheimdienste vieler großer Nationen hatten zwar riesige Sammlungen geheimer Dossiers, hatten aber ebenso wenig Beweise wie stichhaltige Theorien. Wie ein Tsunami war dieser neue Staat in ihre geordneten Reihen und Traditionen eingebrochen, hatte trotz des erbitterten Widerstands und aller politischen Hindernisse Marktanteile und ungeheuren Reichtum erobert. Wie, das war ein Geheimnis geblieben. Es schien diesen Politikern, Bankern und ihren Wissenschaftlern einfach alles zu gelingen, sie waren weder durch Skandale noch durch andere Exzesse angreifbar geworden.
Nein, Heilige waren sie sicher nicht, auch nicht wirklich sozial und schon gar nicht besonders demokratisch. Ihr damaliger Gründer, ein charismatischer, aber bis heute geheimnisvoller Machtmensch, war geradezu legendär. Wie aus dem Nichts waren er und einige Verbündete aufgetaucht und in kurzer Zeit reich und mächtig geworden. Im Hintergrund hatten sie ihre Fäden gezogen und mit Bestechung und ohne erkennbaren Einfluss plötzlich ihren inzwischen angehäuften Landbesitz in einen eigenen Staat verwandelt. Die neu gegründete Stadt Futura war rascher gewachsen als alle bisher bekannten Städte, ihr Erfolg wiederum hatte erfolgreiche Firmen und Millionäre wie Licht die Motten angezogen. Nirgendwo gab es mehr reiche Menschen. Das Wissen und das Geld der Erde schienen sich dort zu sammeln, während andere Staaten sich vergeblich bemühten, verhärtete Strukturen aufzubrechen und mit den wuchernden Defiziten, den häufigen Krisen und sonstigen Problemen zurechtzukommen.
21. Februar 2120
An Bord wurden die Schichtdienste angetreten. Es waren logischerweise keine Tag- und Nachtdienste, da es ja im Raumschiff weder Tag noch Nacht gab. Es wurde allerdings der gewohnte Rhythmus zum Teil fortgesetzt und Hell- und Dunkelphasen simuliert.
Die jeweilige Wache meldete sich alle zwei Stunden bei der gerade erreichbaren Bodenstation, die ihrerseits mit den anderen Bodenstationen Nachrichten austauschte. In der Zeit, in der die eigene Station im Sendebereich lag, wurden jeweils auch Privatgespräche übertragen. Sonst: Keine besonderen Vorkommnisse.
22. bis 29. Februar 2120
Mit der steigenden Entfernung zur Erde wurden auch die Pausen immer länger, die zwischen senden und empfangen lagen, was die Gespräche zunehmend kürzer und einsilbiger werden ließ. Schließlich waren zwar die elektromagnetischen Funkwellen wie das Licht mit 300.000 km pro Sekunde unterwegs, aber das Raumschiff war inzwischen schon einige Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Der Mars hatte fast schon die Größe einer kleinen Mandarine erreicht, die Erde lag wie ein grünblauer Ball von einem dünnen, geheimnisvollen Schimmer umgeben hinter ihnen. Sonst waren die Sterne ohne Funkeln in tiefes Schwarz eingebettet. Auch die Sonne war ein bisschen kleiner geworden, aber noch bei weitem zu hell, um ungeschützt ihr Leuchten zu beobachten.
Die Wissenschaftler an Bord begannen ihre vorbereiteten Experimente und Beobachtungen. Die direkte Einwirkung der kosmischen Strahlung konnte durch das vom Raumschiff aufgebaute Magnetfeld zwar vermindert aber nicht ganz unschädlich gemacht werden. Die geringe Schwerkraft erforderte tägliches Training, um nicht zu viel Muskelmasse und Kalzium aus den Knochen abzubauen.
Die Mannschaft am Mars verfolgte ebenfalls den Flug mit großem Interesse. Zwei Wochen würden sie etwas beengt noch miteinander verbringen, um die Marsstation geordnet zu übergeben. Es gab auch eine Menge Neuigkeiten auszutauschen. Trotz der täglichen Kommunikation mit der Erde blieb manches ungesagt. Ihre Familien erwarteten sie schon mit großer Sehnsucht. Ihre Gedanken kreisten vorwiegend um scheinbar banale Dinge wie einen Sprung in kaltes Wasser, durch raschelndes Laub laufen, Wind und Regen auf der Haut zu spüren, andere Leute um sich zu haben, neue Gesichter zu sehen. Zwei Babys, die inzwischen laufen konnten, waren in den letzten fünf Jahren geboren worden. Sie würden erstmals Wind und Wetter auf ihrer weichen Haut und die viel höhere Schwerkraft der Erde fühlen.
Der Commander der Station hatte einen jungen Offizier, dessen Frau auf der Erde zurückgeblieben war, um die erste Tätigkeit nach der Landung gefragt: „Ich trage Lisa ins Schlafzimmer und hole die letzten fünf Jahre nach“, antwortete er. „Und dann?“ „Dann ziehe ich die Schuhe aus.“
Kapitel 2: Das Wurmloch
1. März 2120
Horst Angold, 28 Jahre, schwarzhaarig, ein eher kumpelhafter Typ, der gutes Leben, feine Speisen, Anekdoten und Witze liebte, war gerade mit seiner Freundin Lena im Gespräch. Sein Spezialgebiet Maschinenbau, Künstliche Intelligenz und Bionik betrieb er mit enormer Fachkenntnis und er hatte schon ein paar wertvolle Patente in diesem Bereich erworben. Er richtete das Licht so, dass es ihn gut zur Geltung brachte. Auch seine Freundin sah mit ihrer neuen Frisur schick aus, Horst bereute schon, sie so lang allein zu lassen. Lena sprach ihn mit Herrn Doktor an. Sie war stolz darauf, er hatte seinen Titel erst zwei Wochen vor dem Start geschafft. Sie würde für ihren Abschluss noch zwei Jahre brauchen.
Das Gespräch verlief etwas holprig. Bilder und Sprache waren inzwischen ein paar Minuten unterwegs. Jede Antwort kam also erst nach längerer Zeit, woraus sich teils skurrile Situationen ergaben, über die Lena sich vor Lachen kaum halten konnte. Jeder versuchte möglichst viel mitzuteilen, der Partner antwortete bereits nach den ersten Sätzen um die Pausen kurz zu halten, sodass oft Text und Gesichtsausdruck und Antwort und Gegenantwort nicht mehr zusammenpassten.
Auf zwei anderen Bildschirmen wurde ebenfalls privat gesprochen, über weitere jedoch wissenschaftliche Daten durchgegeben oder Fotos der Teleskope gesendet.
„Kennst du den? Zwei Jäger sind im Wald unterwegs, als plötzlich einer von ihnen zu Boden sinkt. Er atmet offenbar nicht mehr; seine Augen sind verdreht. Der andere greift nach seinem Sapienta (ein Smartphone aus dem 22. Jahrhundert) und ruft die Notrufzentrale an. Atemlos schreit er ins Telefon: „Mein Freund ist tot! Was soll ich tun?“ Der Mann in der Notrufzentrale beruhigt ihn und sagt: „Keine Panik. Ich kann ihnen helfen. Zuerst versichern sie sich, dass er wirklich tot ist.“ Stille in der Leitung, dann ein Schuss. Die Stimme des Jägers spricht wieder ins Telefon: „Okay, was jetzt?“
Plötzlich blinkte auf einem der Schirme ein Warnlicht auf und eine Stimme der Kontrollstation sagte: „Achtung, Achtung. Erhöhte Strahlengefahr. Wir haben einen massiven Anstieg der Sonnenaktivität festgestellt. Stellen sie ihr Magnetfeld auf die höchste Stufe. Vermeiden sie alle Anstrengungen.“
Acht Minuten, nachdem Horst den Witz fertig erzählt hatte, begann Lena zu lachen. Sie schnappte nach Luft. „Er hat wirklich auf ihn ……?“
Plötzlich brach der Ton ab. Alle Bildschirme begannen zu flimmern, die Warnlichter im Raumschiff leuchteten grell auf. Eine Sirene heulte. Eine wilde Faust schien das riesige Raumschiff zu packen und zu schütteln. Die Schwerkraftanzeige stieg auf absurde Werte. Einige der Crewmitglieder flogen wüst durcheinander. Andere wurden von herumfliegenden Gegenständen getroffen. Die meisten schrien auf, weil sie sich wie auf einer Streckbank in die Länge gezogen und unheimlich schwer fühlten. Wer seinen Sitz erreichen und das automatische Anschnallen auslösen konnte, war noch am besten dran. Zeiger und digitale Anzeigen sprangen durcheinander. Irgendwo schien Feuer auszubrechen, aber das automatische Löschsystem funktionierte. Das Raumschiff stöhnte und ächzte in allen Fugen.
Der Major und der General hatten mit übermenschlicher Anstrengung ihren Sitz erreicht, zu mehr waren sie nicht in der Lage. Die Schwerkraftanzeige funktionierte noch und zeigte Werte im längst roten Bereich.
Pernstein glaubte noch, dass eine Explosion oder ein Meteorit das Schiff getroffen hatte, er sah seine Frau verrenkt auf einer Wand wie festgeklebt hängen, dann umfing ihn tiefe Schwärze.
Futura
In der Kontrollstation auf der Erde stieg in Ron Kurzweil Panik hoch. Die Verbindung mit dem Raumschiff war plötzlich weg, die Bildwand flimmerte, nur die digitalen Zeitanzeigen waren noch da.
Lena starrte fassungslos auf den Bildschirm. Das Lachen blieb ihr in der Kehle stecken. Eine Ahnung von Unheil drängte sich in ihre Gedanken.
Offensichtlich waren auch Satelliten ausgefallen. Sirenen heulten auf. Techniker rannten durcheinander, suchten verzweifelt nach einer Ursache der Störung. Ein automatischer Neustart des Zentralcomputers blieb erfolglos. Auch die Verbindung zur Marsstation war weg, ebenso das Internet. Einige Telefone, die am Festnetz hingen, begannen zu läuten. Techniker hoben ab, waren aber ratlos.
Die Uhr zählte quälend langsam Sekunde um Sekunde. Eine Minute, zwei, drei, vier. Nach 8 Minuten versuchte der Computer einen Neustart, einige Dateien und Anzeigen begannen wieder zu arbeiten, die Satelliten und die Bildwand blieben ohne Funktion. Über das Telefon trafen Anfragen und Meldungen ein. Sie konnten nicht antworten, es gab keine Antwort, nur Chaos.
Dahl, Geologe und Chemiker, krachte gegen die Wand des Raumschiffs, einen Moment lang kämpfte er verzweifelt gegen seine Lage, aber eine eiserne Faust presste ihn dagegen. Auf dem Weg in die Bewusstlosigkeit sah er sich plötzlich auf eine Wiese treten. Ein Schmetterling flog leicht von Blume zu Blume, verharrte, rollte seinen Rüssel aus, der plötzlich zu einem grauen Elefantenrüssel anschwoll, gleich darauf wieder wie ein Schmetterling aussah. Jetzt auf einem silbrig glänzenden Blatt sitzend, die Flügel aufgestellt, braun, mit einem großen und sechs kleinen schwarzen Augen darauf, einem blauen Flügelende, weißen Streifen und vom Körper ausgehenden Adern, die den Flügel ihre Steife gaben, dann noch ein Ruf von ganz weit weg. Flammen fraßen sich gegen den Schmetterling vor, der sich bemühte, vom Blatt zu fliehen aber wie festgeklebt schien, rot und schwarz wurde und sich hilflos seinem Schicksal ergab.
Nochmals wachte Pernstein kurz auf, seine Frau hing nicht mehr an der Wand, er sah sie nicht. Es war wahnsinnig heiß, das Schiff brannte. Undefinierbare Geräusche dröhnten an sein Ohr, der Druck, der ihn in den Sitz presste, war unerträglich. Als ihn wieder Dunkelheit umfing, jagten Gedanken durch seinen Kopf. Er hatte versagt. Die Mission war gescheitert.
Noch halb bewusstlos hörte er Schritte und Stöhnen. Im Raumschiff war es sonst ruhig, die Sirene hatte aufgehört, die Notbeleuchtung brannte, der Computer schien zu arbeiten. Er war nicht tot. Oder doch?
Als er die Augen aufbrachte, sah er die Ärztin Nora Fiedler, wie sie Patienten versorgte. Wie durch einen Schleier bemerkte er Blut an den Wänden, auch manche Instrumente waren verschmiert. Die Ärztin legte gerade einem der Offiziere einen Verband an. Er schien sich etwas gebrochen zu haben. Es war Dr. Georg Dahl, schwarze Haare, schlank, mit 190 cm der größte in der Mannschaft. Nebenbei ein guter Musiker. „Er wird eine Zeitlang nicht spielen können“, dachte er und war wütend auf sich selbst, dass ihm so banale Gedanken durch den Kopf schossen.
Er wollte aufstehen, kam aber nicht hoch. Erst jetzt dämmerte ihm so langsam, dass ihn sein Gurt festhielt. Er löste sich, er fühlte sich ungeheuer schwer. Durch die Panzerglasscheibe sah er nichts, spürte nichts, der Bildschirm war leer. Die Rakete war jedenfalls nicht verbrannt, auch wenn er sich an das Feuer erinnerte, vielleicht nur ein Albtraum. Ein Meteorit war es möglicherweise auch nicht, im Hintergrund rappelte sich jemand auf. Er erkannte ihn zuerst nicht. Blut hatte sein Gesicht verschmiert, aber es stockte bereits. John Merfield war noch etwas zittrig auf den Beinen und wischte sich mit dem Ärmel das Blut aus dem Gesicht. Nur eine kleine Platzwunde, auch er fühlte sich ungeheuer schwer.
Nora, die Schiffsärztin, trat auf den General zu, prüfte kurz dessen Äußeres und schien damit zufrieden zu sein. Mit brüchiger Stimme erstattete sie ihm Bericht:
„Fünf Besatzungsmitglieder sind noch bewusstlos, aber außer Lebensgefahr. Die Chips melden normale Herzfrequenz und normalen Atem, meist erhöhten Blutdruck, der aber durch den Chip bald reguliert sein wird.
Drei gebrochene Knochen, einige leichte Schnittverletzungen, zahlreiche Prellungen, Verstauchungen. Auch ihre Frau ist laut automatischem Gesundheitsbericht auf dem Weg der Besserung, Schmerzen durch den Aufprall.“
Am besten davongekommen waren jene, die gerade Wache hatten und daher in ihren Sitzen saßen. Doch auch sie hatte die ungeheure Beschleunigung, die für Minuten oder auch länger auf sie einwirkte, so belastet, dass sie bewusstlos oder zumindest bewegungsunfähig in ihren Sitzen hingen.
Trotz ihres harten Trainings für diese Mission hatte noch keiner eine Beschleunigung dieser Dimension ertragen müssen.
Weitere Crewmitglieder traten auf Dr. Pernstein zu. Auch wenn sie hinkten oder das Gesicht schmerzvoll verzogen, sie warteten auf Anweisungen.
„Ich weiß nicht, was passiert ist. Das müssen wir klären, weiters, wie weit wir vom Kurs abgekommen sind, Schäden am Raumschiff, mögliche Reparaturen. Sobald das Schiff stabilisiert ist, unterstützen bitte Marek und Penz die Ärzte. Der Major versucht Kontakt zur Erde und zur Marsstation aufzunehmen, Dr. Angold prüft Luft und Sauerstoff. Alle anderen machen Ordnung. Danke an Nora.“
Wie machte die das bloß? Leichtfüßig eilte sie zwischen den Patienten umher und versorgte sie.
Der Boden war mit Splittern, Schachfiguren und Kleinteilen übersäht. Auch wenn der General strikt auf Ordnung sah, hatte sich manches losgerissen. Doch der Reinigungsroboter war schon unterwegs, um das Chaos zu beseitigen. Die Schachfiguren saugt er genauso ein, stellt sie aber nach kurzer Überprüfung wieder auf ihren Platz zurück. Trotz der quälenden Unsicherheit musste der General lächeln.
Dr. Fiedler, der Arzt, wandte sich an den General: „General, es sind jetzt alle wach, einige haben Schmerzen, die Knochenbrüche bei den zwei Männern und bei Frau Nonndorf sind versorgt. Nur Dr. Dahl, Frau Nonndorf und ihre Frau sind für einen Tag dienstunfähig. Die Platzwunde von Merfield ist geklebt. Nora untersucht einige noch genauer.“
Der General drehte sich zum Major: „Schon Erfolge?“
„Nein, aber es liegt nicht an den Geräten. Die Frequenzen sind verstellt, es gibt unbekannte Geräusche. Da, jetzt kommt ein starkes Signal.“
Es knisterte und plötzlich gab es überlaute Musik. „Wo kommt die her? Portugiesisch.“ Er schüttelte ratlos den Kopf.
Dr. Angold meldete sich kreidebleich: „Unsere Tanks sind fast leer. Nach den Aufzeichnungen hat das Triebwerk 14 Minuten und 54 Sekunden mit voller Kraft gearbeitet.“
In diesem Moment schrie auch der Major durch den Raum: „Wir haben ein starkes Magnetfeld, keine Bewegung des Schiffes, wir …“, seine Stimme erstarb. Er schaute fassungslos in die Runde. Er begann nochmals: „Wir sind, nein, das gibt es nicht!“
„Was sind wir?“, fragte der General. Auch er, der sonst so kühl und beherrscht war, stand an seinen Grenzen.
„Wir, wir sind auf der Erde. Draußen ist normaler Luftdruck, die Zusammensetzung stimmt, es ist Luft mit 21% Sauerstoff und sie hat 32 Grad Celsius.“ Alle blickten Angold und Urban abwechselnd an, als ob die beiden übergeschnappt wären.
„Warum sehen wir beim Fenster und auf den Bildschirmen nichts?“, setzte der General fort. Alle waren plötzlich hellwach, das Herz von einigen schlug heftig. Zu unglaublich schien alles.
„Wir sind tot und in der Hölle“, murmelte einer in der hinteren Reihe.
Der General hatte sich wieder im Griff. „Angold und Urban, ich bitte um nochmalige Überprüfung. Wenn die Werte stimmen und die Anzeigen richtig arbeiten, öffnen wir eine Luke. Ich glaube es zwar noch immer nicht, aber wir müssen die Situation klären.“
Nach einer Minute bestätigten beide die Werte. Der General befahl, die äußere Schleuse zu öffnen.
Die neuerliche Überprüfung ergab 34 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit 89%, normalen Luftdruck von etwa 200 Metern Meereshöhe.
„Beide Schleusen öffnen.“ Modrige Luft, gemischt mit beißendem Rauch drang ins Raumschiff, Blätter rauschten ganz leise, ein paar Insekten flogen ins Licht des Raumschiffes.
Die Bäume rundum waren angekohlt und mussten zum Teil gebrannt haben. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und der nassen Blätter war das Feuer bis auf ein paar verstreute Glutnester rasch wieder erloschen. Die Baumkronen lagen noch im Dunkel der Nacht, das Raumschiff, so riesig es war, wurde von ihnen fast verdeckt. Die Umgebung sah nach Regenurwald aus, so wie sie ihn von ihren Reisen kannten.
Offensichtlich hatten sie unglaubliches Glück gehabt. Die Triebwerke hatten rechtzeitig und automatisch während ihrer Bewusstlosigkeit gezündet, deshalb der fehlende Treibstoff. Ihre Geschwindigkeit musste riesig gewesen sein, auch wenn sie noch keine Aufzeichnungen dazu überprüfen konnten. Der heiße Strahl hatte alles unter ihnen verbrannt und verdampft, sodass sie in einer tiefen Grube standen.
Was immer war, die Bodenstation musste ihren Beinaheabsturz auf den Radargeräten verfolgt haben, sodass in Kürze ein Rettungstrupp zu erwarten war. Die Äste oder die vorherigen Erschütterungen dürften die Außenkameras demoliert haben, sodass verständlicherweise auf den Bildschirmen nichts zu sehen war.
Der General wandte sich Thomas, dem Koch zu: „Thomas, ich habe Hunger und werde nicht der einzige sein. Bitte um ein gutes Essen, ich habe auch gewaltigen Durst. Wir müssen feiern, wir leben.“
Sie schlossen die Schleuse wieder und setzten sich an die Tische.
Thomas Kronberger, Koch aus Leidenschaft und Informatiker, begann mit vier Freiwilligen die Tische zu decken und kurz darauf die Speisen aufzutragen. Das Essen war köstlich, Kaffee und Kuchen gab es auch.
Fassungslos und bleich redeten sie wild durcheinander. Plötzlich stöhnte der Major auf. Zwischen Hauptgericht und Nachspeise hatten er und Georg Dahl die Nachrichten im Radio verfolgt. Neben den Ereignissen war auch das Datum genannt worden. Der Major stürzte zu den Geräten. Die Uhr im Schiff zeigte den 2. März 2120, kurz nach Mitternacht.
Die portugiesischen Nachrichten nannten den 2. Juni 1998, 4 Uhr 29 Minuten, Brasilien.
Kapitel 3: Staatstrauer
Futura, März 2120
Entsetzen füllte die Straßen. Trotz hektischer Suche mit riesigen Teleskopen war nicht die geringste Spur im Sonnensystem zu finden. Es gab kaum Hoffnung, ein im Weltall hilflos treibendes Raumschiff retten zu können. Auch die Marsstation sah keine Möglichkeit einer Rettungsaktion, zu riesig waren die Räume zwischen den Planeten. Die Nachrichten brachten gute und schlechte Vergleiche, vom fliegenden Holländer bis zu ewig kreisenden Gräbern. Schlagzeilen brachten Titel wie >Spurlos verschwunden< und >Tiefschlag für die Raumfahrt<.
Die Söhne Pernsteins waren zu Waisen geworden. Viele hatten ihre Freunde, Brüder oder Kinder verloren, ohne die leise Hoffnung, jemals an ihrem Grab stehen zu können. Die Flaggen wurden in ganz Futura auf halbmast gesenkt, eine 5-tägige Staatstrauer ausgerufen. Diesmal hatte das Schicksal die Elite des Staates getroffen und nicht wie so oft die Armen und Benachteiligten.
Lena saß in ihrem Zimmer und hielt ein Bild ihres Freundes in der Hand. Tränen tropften auf den Rahmen. Er sah doch so fröhlich aus, so lebendig. Wie konnte er tot sein?
Innerhalb weniger Stunden kamen Beileidsbekundungen von befreundeten Regierungen.
Für die Anfragen von Eltern, Verwandten oder Freunden wurde ein Krisenraum eingerichtet. Psychologen und Seelsorger standen Tag und Nacht den Trauernden zur Verfügung, aber auch sie hatten keine Antwort. Das Raumschiff war einfach verschwunden und neunzehn Menschen mit ihm.
Als nach vierzehn Tagen das Fehlen eines Funkspruchs oder einer wie auch immer gearteten Nachricht jede Hoffnung erlöschen ließ, wurde ein großes Ehrenmal für die >Helden der Raumfahrt< gebaut und eine große Trauerfeier im Dom und am Friedhof abgehalten. Zahlreiche Ehrengäste waren zur Feier gekommen. Symbolisch sank ein mächtiger Bronzesarkophag in die Gruft, Reden wurden gehalten und die Leistungen der jungen Menschen gewürdigt, die so jäh aus ihrem Leben gerissen worden waren.
Ron Kurzweil war unter jenen, die dem Senator Thomas Angold ihr Beileid aussprachen.
„Ihr Opfer rettet uns vielleicht das Leben“, flüsterte der Senator. Kurzweil verstand diese Antwort nicht, aber wer fragt schon bei einem Menschen nach, der eben seinen Sohn verloren hatte?
Der Senator betrachtete die anderen. Er hatte als Techniker und Computerspezialist für die Dateien gesorgt, die das Wissen des 20. und 21. Jahrhunderts enthielten. Er und noch jemand mussten hinter das Geheimnis gekommen sein, das diese Mannschaft begleitete und das sein Urgroßvater an ihn überliefert hatte. Auch wenn er jahrzehntelang das alles nur für eine Familiensaga gehalten hatte, war er doch nachdenklich geworden und hatte nachgeforscht. Beweisen konnte er nichts, aber wenn es stimmte, was ihm sein Ahn zugeflüstert hatte, dann lebte diese Crew tatsächlich weiter. Ein, wenn auch vager Beweis lag darin, dass er lebte, Futura und die Station noch existierten und die Menschen rund um ihn nicht einfach verschwanden, ja gar nicht verschwinden konnten, weil sie sonst ja nie existiert hätten. Die Geschichte wäre gänzlich anders verlaufen, ihn, seine Familie, das alles hätte es nie gegeben. Er begann zu weinen; was auch immer geschah oder geschehen würde, er würde sein Kind nie wieder sehen. War es das wert? Er wusste es nicht.
Kapitel 4: Überleben
2. Juni 1998
Manche erstarrten, andere wurden bleich, einige stöhnten vor sich hin. „Das gibt es nicht, das gibt es nicht, ich glaube es nicht.“ Zwei von ihnen begannen zu beten.
Dr. Pernstein wirkte inzwischen relativ gefasst. Wer ihn kannte, merkte seine Anspannung daran, dass er die Hand seiner Frau so fest hielt, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Er schluckte mehrmals.
„Wir leben, das ist vorerst das Wichtigste. Wie es dazu gekommen ist, wissen wir nicht. Es muss auch nicht das sein, was uns jetzt beschäftigt. Rettung können wir uns offensichtlich abschminken. Unser Schiff steht mitten im Urwald Brasiliens. Falls die Zeit stimmt, die wir eben gehört haben, sind wir weit in die Vergangenheit zurückgeworfen worden. Was immer das bedeuten mag, wir klären das Datum noch weiter ab. Unser Leben ist sicher, außer die brasilianische Luftwaffe hat unsere Landung entdeckt und hält uns für Invasoren. Deshalb werden wir den Luftraum permanent überwachen. Zum Schlafen haben wir keine Zeit. Wir brauchen eine Strategie. In vier Gruppen beraten wir unsere nächsten Schritte. Jede Gruppe hat eine halbe Stunde Zeit für Beratung und Überlebensstrategien. Dann treffen wir uns im Plenum wieder. Jeder von euch hat strategische Vorlesungen besucht, wir sollten also zu einer Lösung kommen. Um 5 Uhr 20 setzen wir gemeinsam fort.“
Kurze Sätze, wie im Stakkato. Fast wie einer der alten Roboter.
Lebhaft diskutierend trafen sich die Gruppen, fast auf die Minute pünktlich. Doch noch immer gab es heftige Diskussionen.
„Gruppe 1“, wandte er sich an den Major.
„Wir sollen auf alles vorbereitet sein, wahrscheinlich wird doch bald ein Rettungstrupp da sein, so schlecht war die Technik doch auch vor 100 Jahren nicht. Wir haben ein Wissen, das alle interessieren wird, wir werden uns schon durchschlagen können. Falls der Rettungstrupp nicht kommt, dürfte es auch nicht so schwierig sein. Wir haben das Landungsboot, sofern es noch funktioniert. Wir haben auch genug Nahrung und Ausrüstung, um uns durch den Urwald zu kämpfen.“
Die Gruppen 2 und 3 vertraten eine ähnliche Meinung.
„Gruppe 4.“
„Wir sind noch zu keinem endgültigen Ergebnis gelangt, es war ziemlich kontrovers. Aber wir glauben an keine positive Lösung wie die anderen Gruppen. Die Militärs werden uns aus Angst wie Feinde behandeln, oder wie Zootiere, die von allen bestaunt werden. Wir haben Wissen, das den anderen Nationen nützen, aber auch gefährlich werden kann. Außerdem kennen wir ja die Zukunft. Offensichtlich haben wir unser Wissen für uns behalten, sonst gäbe es unseren Staat nicht, von dem wir weggeflogen sind. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir die Zukunft ändern. Wir ändern dann möglicherweise alles.“ Dr. Lukas Miller sah sich suchend im Kreis um. „Ich will nicht wie ein Zootier angegafft werden.“
Eine Zeitlang herrschte Stille und Betroffenheit, dann brach die Diskussion wieder los.
Der General hob die Hand:
„Ich stimme Lukas zu. Was wäre die Alternative für uns? Okay, wir haben überlebt und sitzen in einer fremden Zeit mit einer fast unlösbaren Aufgabe. Sollen wir als Schiffbrüchige um Rettung und Asyl betteln?“
Für einen Moment brach ihm die Stimme.
Er suchte nach einem Taschentuch, irgendwie eine rituelle Handlung, um Zeit und Abstand zu gewinnen. Elen, seine Frau, legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Ja, alle würden sich um uns reißen. Zuerst die Abschirmung in einer Quarantäne und dann Verhör um Verhör, um aus uns und unseren Computern jeden noch so kleinen Schnipsel der uns bekannten Zukunft heraus zu quetschen. Wir hätten monatelange Befragungen und Untersuchungen vor uns. Unseren kleinen Wissensvorteil würden die Regierungen und ihre Schergen schamlos für ihre Zwecke nutzen. Und am Schluss brächten sie uns vielleicht sogar um, um uns als lästige Mitwisser aus dem Verkehr zu ziehen.“
Das bisher leichte Gemurmel und Gestöhne der Crew schwoll an.
„General, was sollen wir dann tun?“
„Denkt an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 170 Jahren. Das erste, was den Russen und Amerikanern einfiel und ihnen wichtig war, war das Kapern der deutschen Raketeningenieure. Sie wussten genau um den strategischen Vorteil, den deren Wissen bot. In Russland waren diese Techniker samt ihren Familien bis zum Tod in abgeschirmten Lagern eingesperrt.
Den deutschen Wissenschaftlern ging es zwar in Amerika besser, tauschen würde ich trotzdem nicht wollen.“
„Was sollen wir also tun?“, wiederholte Dr. John Merfield seine Frage. Er war 33 Jahre, Informatiker und Spezialist für Hedgefonds. Die meisten nannten ihn Johnny. Cool und braun gebrannt wirkte er trotz der eben überstandenen Tortur ruhig und gefasst. Im Kopf überschlug er bereits die Möglichkeiten, die das Wissen um die Entwicklung der Börsenkurse der letzten hundert Jahre bot. „Shit, das hätte ich ahnen sollen“, dachte er bei sich, „meine Unterlagen in meinem Hedgefonds wären jetzt Milliarden wert.“ Andererseits, er war nicht umsonst für sein brillantes Gedächtnis bekannt. Stunden später sollten er und die anderen eine zusätzliche freudige aber auch erstaunliche Überraschung erleben.
„Wir setzen die Überprüfung fort, ob wir bemerkt wurden. Möglicherweise hat dieses Etwas, das uns in diesen Urwald verschlagen hat, nicht nur unsere Instrumente durcheinandergebracht. Vielleicht wurden wir auch gar nicht bemerkt.
Als nächste Maßnahmen kümmern wir uns darum, suchen vor allem auch nach Informationen, vielleicht gibt es auch schon das Internet. Satelliten gibt es auf jeden Fall. Vielleicht gelingt es uns, einen Teil dieser Satelliten für uns zu nützen. Wozu haben wir schließlich 100 Jahre technischen Vorsprung?
Eine Gruppe wird die für den Mars vorgesehenen Teile überprüfen und nach Möglichkeit dazu verwenden, um unser Schiff von oben unsichtbar zu machen. Die Einteilung der Wachen bleibt aufrecht, alle anderen können drei Stunden schlafen. Zu mehr haben wir keine Zeit.
Wir werden unsere Ziele verfolgen, wie wir sie aus unserer Geschichte kennen. Ich glaube nicht, dass wir Schwäche zeigen dürfen. Um einen alten Philosophen zu zitieren:
>Hat der Mensch das Recht, sich für die Wahrheit totschlagen zu lassen?<
Möglicherweise ein Mensch, ich trage hier aber die Verantwortung für euch alle.“
Die Stimme des Generals klang kalt wie Eis. Manchen lief ein Schauder über den Rücken. Die eben erlittenen traumatischen Erlebnisse mischten sich mit einer zaghaften Hoffnung, ja, sie vertrauten dem General, sie schätzten sein Wissen, seine Kaltblütigkeit. Und totschlagen lassen wollten sie sich nicht.
„Das Zitat könnte übrigens von Kierkegard, einem alten Philosophen, sein“, ergänzte der General, „an die Arbeit oder eben die drei Stunden Schlaf. Um 11 Uhr Ortszeit sehen wir uns wieder.“
Einer der Vorteile ihrer Biochips lag darin, dass sie trotz aller Erregung und Anspannung sofort in einen tiefen und erholsamen Schlaf gesteuert wurden.
Während der Großteil der Mannschaft die kurze Schlafzeit nützte, deckten DI. Raul Nonndorf und ein Team Freiwilliger die Rakete ab. Nach einer Stunde schweißtreibender Arbeit war das Werk fertig und das Raumschiff von oben und von der Seite kaum noch sichtbar.
„Unser Kunstwerk ist gelungen, jetzt brauche ich es nur noch mit Christo zu signieren, das war doch mal so ein Verpackungskünstler. Übrigens, ich habe sogar eine echte Zeichnung von ihm zu Hause. Schaut echt toll aus.“ Er brach fast in Tränen aus, sein Zuhause würde er nie wieder sehen.
Der Major war inzwischen mit den Computerspezialisten Merfield, Penz, Mantini, Kronberger, Marek und Dahl, der fließend portugiesisch sprach, auf der Suche nach Informationen. Dahl hatte sich die Elle gebrochen, arbeitete aber trotz der Schiene. Allem Anschein nach waren sie nicht entdeckt worden, das elektromagnetische Feld oder was immer es war, hatte nicht nur sie aus der Bahn geworfen.
Zahlreiche Satelliten hatten ihre Arbeit unterbrochen, Stromnetze waren ausgefallen, in Sao Paulo, Brasilia, einigen anderen Städten und dem Umland waren Beleuchtung und Computer tot.
Der fortgeschrittenen Technik des 22. Jahrhunderts waren auch die Verschlüsselungen des 20. Jahrhunderts nicht gewachsen. Schon gegen Mittag hatten sie Zugang zu mehreren Satelliten.
Die Konferenz um 11 Uhr fand die Crew trotz der kurzen Schlafzeit erregt und heftig diskutierend vor. Alle, die bisher noch gearbeitet hatten, erstatteten kurz Bericht:
„Die Abdeckung der Rakete ist gelungen, sie ist vom Flugzeug aus nicht mehr sichtbar.“
Dr. Pernstein dankte ihnen und schickte die Mannschaft in die verdiente Schlafpause.
„Wir haben die Verschlüsselung von zwei Satelliten geknackt, wir werden weitere in Kürze schaffen. Damit haben wir den Zugang zu Wetterdaten, einigen Sendern, dem Schiffsfunk und sonstigen Informationen. Auf unserem Computer ist eine ausgezeichnete Spionage- und Entschlüsselungssoftware. Wir wissen allerdings nicht, wer diese Programme installiert hat und zu welchem Zweck sie unseren Dateien zugefügt wurde.“
Der General dankte auch ihnen und schickte auch sie in die verdiente Ruhepause.
Er wandte sich der verbliebenen Crew zu: „Wir haben offensichtlich noch weitere Geheimnisse vor uns, möglicherweise enthält unser Zentralrechner mehr als wir ahnen. Vorläufig scheinen wir nicht entdeckt zu sein, wir werden aber auch die nähere Umgebung noch absichern müssen.
Ich erwarte die nächsten Anregungen, gegen 13 Uhr würde ich gern essen, damit wir dann gestärkt weitere Vorbereitungen treffen können. Was gibt es also?“
„Wir sitzen jetzt im Schiff fest, aber irgendwann werden wir unter andere Menschen kommen. Möglicherweise ist unsere Kleidung für sie fremd, möglicherweise fallen wir auch sonst auf.“
„Wir brauchen Geld, mehr Informationen.“
„Wir brauchen neben Geld auch Dokumente, meines Wissens hat es damals so altmodische Ausweise gegeben, die man Reisepässe nannte.“
„Wir brauchen das alles, aber wir brauchen auch so etwas wie eine Vergangenheit. Irgendwer wird bald einmal wissen wollen, wo wir herkommen, wer unsere Eltern waren, möglicherweise Schulzeugnisse, einen Ort, wo wir offiziell wohnen können.“
„Das dürfte tatsächlich unser größtes Problem werden. Wir haben keine Vergangenheit, das heißt, wir können unsere Vergangenheit nicht angeben“, bestätigte der General.
„Uns fehlt alles, was Identität ist. Das heißt, wir haben eine Menge Arbeit vor uns.“
„Haben wir schon Anhaltspunkte, was das war, was uns gegen alle physikalischen Gesetze in diese Zeit geschmissen hat? Was uns alles genommen hat, was wir haben, unsere Freunde und unsere Heimat?“
„Nein, darüber wissen wir nichts. Wir haben allerdings nicht alles verloren. Wir leben, das ist schon überraschend genug. Unsere Technik hat funktioniert. Wir haben uns als Gemeinschaft und eine Aufgabe, die mehr von uns fordert, als irgendjemand jemals von uns verlangt hat. Wir werden noch mehr Schwierigkeiten finden.
Ich bitte euch aber alle bis zum Mittagessen so viel Informationen über diese Zeit zu sammeln wie es geht, über Verhaltensweisen, Kleidung, Manieren, Gewohnheiten, Alltagsgegenstände. Wir haben diese Aufgabe nicht gewählt, wir wurden dazu verdammt. Aber wir müssen sie meistern oder wir alle und möglicherweise die Zukunft unseres Staates gehen unter.“
Als der General aufstand, gingen sie zu ihren Bildschirmen. Trotz aller Sorgen hatten sie auch die Hoffnung auf eine gute Zukunft. Sie würden es schaffen.
Das Mittagessen war köstlich. Thomas und Elsa Kronberger hatten ein Kochrezept aus Brasilien gefunden, allerdings etwas an den veränderten Geschmack ihrer eigenen Zeit – sofern man es noch ihre eigene Zeit nennen konnte – angepasst. Natürlich wurde lebhaft diskutiert und manchmal sogar gelacht, zu komisch waren manche Situationen, die sie beobachtet hatten. Alte Autos, die man noch selbst lenken musste, tuckerten über noch ältere Straßen, dazwischen rannten Verkäuferinnen und Kinder. Letztere saßen meist am Vormittag auf alten Stühlen in Räumen, die sie als Schule bezeichneten und schrieben mit wackeliger Schrift in Dinge, die sie Hefte nannten. In den Wohnungen hatten sie uralte Kästen, in die sie ein paar Stunden am Tag hineinglotzten, über schwarze Geräte, die an Kabeln hingen, telefonierten sie, mussten aber zuerst eine schwarze Scheibe mit Löchern drehen. In den Läden zählten sie umständlich Münzen und Geldscheine, bevor sie ihre Waren einpacken konnten. Und komisch angezogen waren sie auch.
Was noch auffiel, es waren viele wahnsinnig dick.
„Wieso sind so viele dick, das ist doch nicht gesund“, wunderte sich Mantini. Sie sah sich um. Von der Crew waren alle schlank.
„Unser Biochip regelt auch unseren Hunger. Wir essen genug, um unser egoistisches Gehirn zu ernähren, das sofort nach Nahrung schreit, wenn unser Blutzuckerspiegel sinkt, aber er reduziert sofort unseren Appetit, wenn wir zu viel essen. Die haben diesen Chip nicht und wenn sie sich falsch ernähren, was leider viele tun, dann setzt sich ein fataler Kreislauf in Gang. Wenn sie dann noch zwischen Diäten und Heißhungerattacken abwechseln, passiert genau das, was dir aufgefallen ist“, erklärte der Schiffsarzt.
So hatte jeder seine Beobachtungen, die er als interessant oder lustig empfand. Als etwas abschreckend empfanden sie die Flughäfen, wo man anscheinend den halben Tag mit Warten verbrachte und ein Heft und einen Zettel herzeigen musste, wenn man ins Flugzeug wollte. Diese schienen sogar ganz gut zu fliegen, und mit den Apparaten, die sie noch aus alten Kriegsfilmen kannten, doch nichts gemeinsam zu haben.
Ein kleiner Trupp unternahm eine Untersuchung der näheren Umgebung, aber sie fanden rundherum nur dichten, feuchten Regenurwald. Wie zu erwarten gab es eine Menge Insekten und ein paar Vögel, anderen Tieren begegneten sie nicht. Aber es war eine Möglichkeit, sich nach längerer Zeit wieder frei zu bewegen und die Füße zu gebrauchen. Oft blieben sie an Dornen oder Wurzeln hängen. Die Bäume standen so dicht, dass es am Boden auch am Tag fast finster war. Um leben zu können, mussten Tiere und Pflanzen dorthin, wo es hell war, also möglichst bis ganz nach oben. Für Tiere schien dieser Weg einfach, sie kletterten und krabbelten soweit sie kamen, Pflanzen nutzten Bäume als Leiter um nach oben zum Licht zu gelangen. Die ihnen bekanntesten Kletterpflanzen waren die Lianen, aber alles Mögliche wand sich nach oben. Weiße und bunte Blüten hingen daran, alles war feucht und voller Insekten.
Bis zum Abend hatten sie weitere Erfolge. Neben dem Zugang zu weiteren Satelliten und verschiedenen Funknetzen fanden sie auch englisch- und spanischsprachige Sender und Fernsehprogramme. Die Adaptierung an die alten Übertragungsnetze war nicht ganz einfach, aber sie konnten sie nutzen.
Spät am Abend war ihnen noch der Zugang zu Banken gelungen, ebenso zu Kreditkarten, zu Depots und einem Melderegister. Sie lachten über das Wort Melderegister. Der Großteil an Aufzeichnungen schien aber noch aus Karteikarten zu bestehen, auf die sie natürlich nicht zugreifen konnten.
Facebook und Google schien es noch nicht zu geben, das noch wenig verbreitete Internet war langsam, die Brasilianer lebten offensichtlich noch in der Steinzeit. Die Firmen aus ihrem gewohnten Umfeld existierten sowieso nicht. Ohne digitale Daten und Glasfaserkabeln war der Zugriff schwieriger.
Die Verletzten hatten sich inzwischen gut erholt. Bis auf die Wachen, die alle drei Stunden abgelöst wurden, konnten sie bis fünf Uhr morgens schlafen. Vielen von ihnen gingen Gedanken durch den Kopf: „Wieso musste das gerade uns treffen? Was ist da wirklich passiert? Wieso gab es dieses Wurmloch – mangels eines besseren Begriffes nannten sie es so – das es nach ihrem Wissen gar nicht geben konnte? Es ist absurd, was uns da zugestoßen ist.“
Andere Gedanken kamen dazu.
Ihren Staat gab es ja bereits, waren sie in die Vergangenheit geworfen worden, um ihn zu gründen? Waren sie schon die Zweiten oder gar Dritten, denen dieses Schicksal widerfahren war? Ging es ihnen wie in dem vor kurzem neu verfilmten Thema: >Und täglich grüßt das Murmeltier<? so lange, bis sie geläutert, tot oder resigniert ihrem Schicksal entkamen?
Waren sie am Ende gar ihre eigenen Ururgroßväter und Ururgroßmütter?
Und – sie kannten ja ihre Vergangenheit, die für sie jetzt Zukunft war, mehr oder weniger genau – würde die sich ändern oder ändern lassen?
Oder würde alles in einer Katastrophe enden?
Fragen über Fragen, die ihnen durch den Kopf schossen, bis die Chips ihre Wirkung taten und sie tief in den notwendigen Schlaf sinken ließen.
3. Juni 1998
Wegen der Abdeckung und wegen des dichten Baumbestandes war ihr Schiff kaum zu entdecken, trotzdem mussten sie Vorkehrungen treffen. Im Schiff gab es Bewegungsmelder, die mit ihrem 3D-Drucker leicht vervielfältigt werden konnten. Sie stellten sie in größerer Entfernung zum Schiff auf, um rechtzeitig etwaige ungebetene Besucher fern zu halten.
Kurz nach Beginn der um 6 Uhr angesetzten Morgenkonferenz stürzte Graziella Mantini in den Kommandoraum der Rakete und unterbrach den General:
„Im Hauptrechner hat der Link über Notfälle eine neue Riesendatei geöffnet. Diese enthält eine genaue Geschichte seit dem Jahr 1900, Baupläne unserer Stadt, Wirtschaftsdaten und tausende Charts von Aktien und Derivaten. Merfield untersucht sie gerade weiter.“
„Als ob jemand gewusst hätte, dass wir nicht am Mars, sondern hier landen. So eine Datei hat doch nur in unserer Situation Sinn.“ Andere schrien dazwischen, die Situation begann zu eskalieren.
Der General brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen. „Es ist tatsächlich ungewöhnlich und überraschend. Aber was immer da ist, wir müssen es nützen. Wir haben nicht viel Zeit. Unsere Probleme mit Ausweisen, Geld und Identitäten sind noch nicht gelöst. Aus den bisherigen Filmen und Nachrichten ergibt sich, dass wir auch unsere Verhaltensweisen und unseren Wortschatz anpassen müssen, um nicht sofort aufzufallen.
Christine Vonn hat sich bereit erklärt, unsere Sprache zu trainieren, und wird uns auf Wörter aufmerksam machen, die uns verraten könnten. Die Brasilianer bewegen sich locker, aber wenig zielstrebig, sie wirken lebenslustig und offen. Das sollten wir imitieren, aber wir werden am besten ausländische Touristen spielen, mit Fotoapparat und so.
Kleine und größere Beträge werden mit Geld bezahlt, Einkäufe werden direkt im Geschäft getätigt und müssen mitgenommen werden. Die Autos fahren mit Benzin, man steuert sie selbst, daher gibt es auch häufiger Unfälle. Die nächste große Siedlung ist Manaus, etwa 400 Kilometer entfernt. Wir müssen prüfen, ob wir unseren Raumgleiter in die Nähe bringen können, denn unser Marsauto ist langsam und relativ schwerfällig. Da Manaus am Rio Negro liegt, können wir auch einen Teil der Strecke mit einem Boot zurücklegen.“
Der General hatte damit kurz und knapp die wesentlichen Erkenntnisse und Aufgaben zusammengefasst.
Die neue Lage wurde besprochen und die Mannschaft machte sich an die Arbeit. Verhaltensweisen in den Nachrichten wurden beobachtet, die Sprachtrainings wurden in Kleingruppen angesetzt und vor allem die neuen Rechnerdateien ausgewertet.
Zu ihrer Überraschung fanden sie eine Datei mit exaktem Molekularbauplan für Kredit- und Bankomatkarten aus verschiedenen Zeiten. Nach den Aufzeichnungen hielten sie eine American Expresscard und die Bankomatkarten einer brasilianischen Bank für vertrauenswürdig. Der 3D-Drucker stellte ein paar davon in wenigen Minuten her. Wenn der Bauplan stimmte, und das war anzunehmen, waren sie so echt wie die von American Express oder der Bank auch. Jetzt brauchten sie noch Konten und die Möglichkeit, von Banken oder den in diesem Jahrhundert gebräuchlichen Bankomaten, das waren relativ klobige Geldmaschinen, Bargeld abzuheben. Der Geldautomat erschien als die bessere Lösung, da vermied man den direkten Kontakt mit möglicherweise skeptischen Bankmitarbeitern, die Karte mit dem Magnetstreifen war das kleinste Problem.
Nach dem Mittagessen wurden die inzwischen gesammelten Daten besprochen. Wie Ausweise und Pässe aussahen, wussten sie jetzt, aber die Unterlagen waren nicht genau genug, um diese auszudrucken. Vielleicht fanden sie noch eine der Druckereien, die solche herstellten, hatten aber wenig Hoffnung, digitale Vorlagen zu finden, offensichtlich arbeiteten sie kaum anders als der alte Gutenberg, sechshundert Jahre früher. Da musste noch eine Lösung her.
Unauffällige Kleidung mussten sie in einem Geschäft kaufen, aber da hätte ihnen auch das 22. Jahrhundert nicht geholfen, schließlich hätten sie sich nicht mitten im Urwald beliefern lassen können.
Der Major hatte inzwischen zwei Erkundungsdrohnen auf den Weg nach Manaus geschickt. Diese waren zwar für die dünne Marsatmosphäre gebaut worden, konnten aber leicht umprogrammiert und angepasst werden. Sie übertrugen ihre Bilder in Echtzeit und flogen automatisch – rasch und fast unsichtbar. Einige unter ihnen hatten Manaus schon besucht, eine Stadt um das Jahr 2100 war aber etwas anderes als dieselbe Siedlung im Jahr 1998. Immerhin, ihre fliegenden Spione würden ausreichend Bilder und Anhaltspunkte liefern.
Ein guter Fortschritt war mit den Satelliten erreicht worden. Es war ihnen gelungen, sich einen Anteil an deren Informationen zu sichern. Sie hätten sie auch ganz kapern und dem Zugriff der alten Nutzer entziehen können, wollten aber möglichst wenig Spuren hinterlassen. Irgendwer würde alle diese Eingriffe möglicherweise sammeln, wie ein Puzzle zusammenfügen und sie auffliegen lassen. Also keine Spuren.
Die alte Technik rief öfter Erstaunen hervor. Wie konnten Menschen mit diesen primitiven Geräten überhaupt arbeiten, ohne sie wütend wegen ihrer Dysfunktionen und quälenden Langsamkeit in ein Eck zu schmeißen und darauf herum zu trampeln? Sie mussten eine unendliche Geduld haben, das Zeug lief doch kaum besser als die alten Dampfloks, die sie aus Museen kannten.
Laufend erschienen jetzt die Daten der Drohnen auf ihren Bildschirmen. Reger Verkehr auf dem Rio Negro vom Ruderboot bis zum Dampfer. Zahlreiche Touristen, die mit ihren dicken Bäuchen und Spiegelreflexkameras gut erkennbar waren. Was bedeutete, dass sie sich auch so etwas zulegen sollten. Ihre Kameras dagegen speicherten die Bilder in Echtzeit und waren von anderen nicht mehr zu erkennen. Früher trugen sie ja noch die Bildfunktionen in der Brille, aber durch die ausgefeilte Lasertechnik, mit der jede Fehlfunktion des Auges korrigiert wurde, waren die Brillen in die Museen gewandert.
Die Kleidung schien nicht das Problem zu sein. Die war billig zu kaufen, sah auch billig aus. Die Schuhe waren noch alte Lederhüllen ohne die Funktionen, die ihr Gehen leicht und ermüdungsfrei machten.
In ihrem Zeitbegriff lag noch eine Schwierigkeit. Was war jetzt ihre Zeit? Die ihrer Jugend oder die Zeit, in der sie jetzt wie in einer Zwangsjacke steckten?
Interessant waren auch die Bilder der Märkte. Da gab es so viel Plunder, aber auch alte Bücher, vielleicht sogar alte Dokumente, die ihnen so etwas wie eine Vergangenheit geben könnten.
Sie sahen sich die Bilder bis zum Abend an. Ein Teil der Angst und ihrer traumatischen Stunden war so etwas wie einem Gefühl von Abenteuer und Entdeckungsgeist gewichen. Sie fühlten sich ein bisschen wie der englische Forscher Stanley in Afrika auf der Suche nach Dr. Livingstone. Nur ein bisschen auf modern aufgemotzt. Sie fühlten sich inzwischen auch weniger als Opfer einer blinden Naturgewalt. Sie waren schon in ihrer Zeit, schon wieder, was war jetzt ihre Zeit, die Elite gewesen, reich, aus gutem Haus, fantastisch ausgebildet und fit, umgeben von Hauspersonal und Robotern.
Die utopischen Bilder früherer Filme waren kaum wahr geworden. So etwas wie einen Terminator gab es nicht. Fliegende Untertassen auch nicht und das Beamen wäre selbst für die modernen Supercomputer zu kompliziert. Ein Stromausfall oder eine kleine atmosphärische Störung und schon gäbe es keine Garantie, wieder genauso zusammengesetzt zu werden, wie man vorher war. Außerdem würde jeder Mensch beim Beamen zu einem bloßen Datensatz, der beliebig oft zusammengesetzt, aber auch beliebig manipuliert werden könnte. Ein Fahrzeug fuhr auf Rädern immer noch besser, auch wenn sie der fahrenden Kabine in ihrem Jahrhundert nur ihr Ziel sagen mussten und herkömmliche Autos out waren. Die Hausroboter brauchten nicht menschlich auszusehen, sie brauchten wie ihr Reinigungsroboter an Bord nur sauber zu machen und die Dinge zu ordnen, die falsch herumlagen. Hauspersonal hatten sie eher als Gesellschaft und weil die Einheimischen in der Umgebung Arbeit und Geld brauchten. So richtig notwendig waren Dienstleistungen nur noch selten, das meiste geschah so automatisch, dass sie die Funktion oft kaum noch bemerkten. Was sollten sie also mit solchen Dingern, die ihnen höchstens zwischen die Beine gerieten?
4. Juni 1998
In der Morgenkonferenz fasste Lisa Penz, die ab nun die Moderation übernehmen sollte, die bisherigen Ergebnisse zusammen. Sie waren nach wie vor in ihrer schützenden Hülle des Raumschiffs. Aber noch hatten sie weder Geld noch Kontakte zu anderen Menschen. Die Informationen lagen bereits in großer Zahl vor, jetzt ging es um deren Auswertung und Umsetzung.
Merfield, Miller und Marek, die mit ihren Kolleginnen auf Grund ihrer reichen Erfahrung die Finanzen übernehmen sollten, berichteten:
„Wir kennen die Zukunft, das ist ein ungeheurer Vorteil. Uns liegen inzwischen tausende Dateien vor, die wir natürlich erst auswerten müssen. Aber wir wissen, welche Firmen erfolgreich werden und welche untergehen. Wir brauchen eine Menge Geld für den Start, Portfolios, Handelsplattformen und so weiter, all das, womit wir aufgewachsen sind und was wir ohnehin kennen. Wir werden Tage und Wochen brauchen, um diese Informationen zu ordnen. Aber wenn wir einmal ausreichend Startgeld haben, wird die Vermehrung dieser Gelder kein echtes Problem sein. Eine statistische Hochrechnung hat durch die Vermeidung von Fehlinvestitionen und dem rechtzeitigen Kauf von erfolgreichen Firmen ein Potential von mehreren hundert Prozent für die nächsten zehn Jahre aufgezeigt, pro Jahr wohlgemerkt. Wem die exponentiellen Kurven geläufig sind, und das sind sie ihnen ja, wird den Ertrag abschätzen können.
Unser Vorteil liegt auch darin, dass sich eigentlich alle von uns in Finanzfragen ausreichend auskennen, mindestens fünf von uns in dieser Branche professionell und erfolgreich gearbeitet haben.
Das Problem besteht dann darin, dass wir hunderte Portfolios und Wertpapierdepots aufbauen müssen, aber durch den außergewöhnlichen Erfolg rasch die Aufmerksamkeit auf uns ziehen, dass Neider, Betrüger, Journalisten und Geheimdienste uns genauer unter die Lupe nehmen werden.
Zu allererst geht es jedoch um die Frage, woher wir das Startgeld nehmen!“