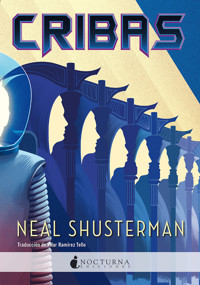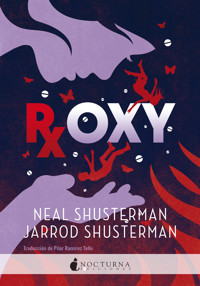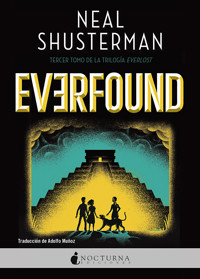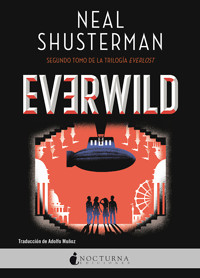Game Changer – Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, alles falsch zu machen E-Book
Neal Shusterman
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Spannung bis zur letzten Seite − 'Game Changer' von Neal Shustermann konfrontiert uns in diesem Jugendroman ab 14 schonungslos mit weißen Privilegien, gesellschaftlicher Verantwortung und den unendlichen Möglichkeiten, alles falsch zu machen. Im Blitzlicht eines Footballspiels wird Ash in parallele Dimensionen katapultiert. Er verfügt auf einmal über die Macht, die Welt zu verändern. Und genau das tut er auch. Mit jeder Entscheidung verschieben sich die Regeln der Realität, er testet die Grenzen von Gut und Böse und stellt unsere aktuellen Werte und Normen auf den Kopf. Ausversehen führt er die Rassentrennung wieder ein, und das Schrecken nimmt seinen Lauf. Dieser Science Fiction Thriller ist perfekt für Leser ab 14 Jahren, die spannende und dystopische Abenteuer lieben und gleichzeitig zum Nachdenken angeregt werden möchten. Neal Shustermann verbindet die großen Problemen und Fragen unserer Welt auf meisterliche Art und Weise mit einer ordentlichen Ladung Spannung, Action und absolutem Gänsehaut-Feeling. Mehr von Neal Shustermann's meisterlicher Erzählkunst: »Scythe – Die Hüter des Todes« (Bd. 1) »Scythe – Der Zorn der Gerechten« (Bd. 2) »Scythe – Das Vermächtnis der Ältesten« (Bd. 3) »Vollendet – Die Flucht« (Bd. 1) »Vollendet – Der Aufstand« (Bd. 2) »Vollendet – Die Rache« (Bd. 3) »Vollendet – Die Wahrheit« (Bd. 4) »Dry« (zusammen mit Jarrod Shusterman)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Ähnliche
Neal Shusterman
Game Changer
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, alles falsch zu machen
Aus dem amerikanischen Englisch von Andreas Helweg, Pauline Kurbasik und Kristian Lutze
FISCHER E-Books
Inhalt
Gewidmet den vielen Opfern des Ungeziefers Ignoranz und Intoleranz.
Bevor es losgeht: Da es in »Game Changer« u.a. um Rassismus, unterschiedliche Erfahrungen und Sozialisationen geht, wird in diesem Buch häufig benannt, ob eine Person Schwarz oder weiß ist. Dabei handelt es sich nicht um die Beschreibung einer Hautfarbe, sondern um eine politische und soziale Konstruktion. Um das deutlich zu machen, wird Schwarz in diesem Buch groß und weiß kursiv geschrieben.
Come as you were,
Not as you’ll be,
Remembering to bring back
the best part of me.
Take what you find,
Leave what you lost,
Light the way burning
the bridges you crossed.
aus »Come as You Were« von Konniption
Kapitel 1Vollbremsung
Ihr werdet mir nicht glauben.
Ihr werdet sagen, ich hätte den Verstand verloren oder zu viele Gehirnerschütterungen erlitten. Vielleicht denkt ihr auch, dass ich euch hochnehmen will und ihr das Opfer eines ausgefuchsten Streiches seid. Das ist okay. Glaubt, was ihr wollt, wenn es euch beim Einschlafen hilft. Denn so machen wir das doch, oder? Wir bauen uns wie kleine Spinnen ein Netz aus bequemer Realität, an das wir uns klammern, um durch die schlimmsten Tage zu kommen.
Und wir hatten jede Menge schwieriger Tage, stimmt’s? Wir alle. Der Boden unter unseren Füßen verschiebt sich, die Welt verändert sich, und wir geraten ins Taumeln. Manchmal dauert es nur so lange, wie ein Reisender braucht, um von Bord eines Auslandsflugs zu steigen und zu niesen. Oder so lange, wie es dauert, bis ein Mann mit eingedrückter Luftröhre aufhört zu atmen.
Ich habe all das gesehen, genau wie ihr … aber ich weiß noch andere Dinge. Ich weiß von weltverkrümmenden Ereignissen, die nicht von Wissenschaftlern oder den Nachrichten verfolgt werden können. Veränderungen, die niemand sonst auf der Erde je mitbekommen wird.
Aber ihr müsst mir nichts von dem abkaufen, was ich euch erzähle. Eigentlich ist es sogar besser, wenn ihr es nicht tut. Sagt euch, dass es nur eine Geschichte ist. Bleibt in der Mitte eures Netzes hocken. Fangt ein paar Fliegen. Lebt den Traum.
Ich heiße Ash. Bei allem, was sich verändert hat, ist mein Name derselbe geblieben, eine Konstante, um die der Rest meines Universums kreist, und dafür bin ich dankbar.
Eine nur mäßig interessante Tatsache: Ash ist die Abkürzung von Ashley – was, wie meine Großmutter ständig betont, »ein sehr männlicher Name« ist. Es war der Name ihres Bruders. Offenbar wurde er nach irgendeinem Typen aus Vom Winde verweht benannt, weil er das Pech hatte, 1939 geboren zu werden, als der Film herauskam – und lange bevor Menschen bereit waren zuzugeben, wie rassistisch er ist. Er hatte einen Zwillingsbruder namens Rhett, der an Kinderlähmung gestorben ist. Und jetzt kommt der Witz – der Typ, der in dem Film die Figur des Ashley Wilkes gespielt hat, hieß in Wirklichkeit Leslie Howard. Er hat einfach keine Chance gekriegt, nicht mal in der Fiktion.
Mein Name wird nur einmal im Jahr zum Thema, wenn ein ahnungsloser Lehrer ihn am ersten Schultag aufruft und sich nach einem Mädchen umsieht. Jeder, der dumm genug ist, eine blöde Bemerkung zu machen, kann sich im Prinzip darauf gefasst machen, seine Leber persönlich von meiner Wenigkeit überreicht zu bekommen, deshalb haben meine Mitschüler gelernt, ihn einfach zu ignorieren. Wie dem auch sei, Ash war für mich immer okay. Und nur meine oben erwähnte Großmutter nennt mich Ashley.
Obwohl diese Geschichte mit einem Football beginnt und endet, kommt es auf das Zeug dazwischen an. Das geheimnisvolle Fleisch in dem Sandwich, vor dem man euch immer gewarnt hat, weil es schwer genießbar und noch schwerer verdaulich ist. Trinkt Milch, das beruhigt den Magen!
Es wäre übertrieben zu behaupten, dass Football mein Leben war – aber ein großer Teil meines Lebens drehte sich darum. Ich hatte schon als kleiner Junge mit Football angefangen und war Stammspieler im Team meiner Highschool – den Tibbetsville Tsunamis. Ja, sagt nichts, ich weiß. Es ist nicht meine Schuld. Früher hieß die Mannschaft der Schule The Blue Demons, aber vor Jahren hat irgendein superfrommer Typ im Schulausschuss einen großen Skandal angezettelt, behauptet, der Name sei »unzuträglich«, und die Schule gezwungen, ihn zu ändern. Also wurde unser Maskottchen, ein grinsender blauer Dämon, der nie jemandem etwas zuleide getan hatte, durch eine zähnefletschende blaue Welle ersetzt, die in Südostasien 800000 Menschen getötet und das Sushi in Japan radioaktiv gemacht hat. Das war irgendwie weniger anstößig. Immerhin haben wir coole Helme.
Der Sport hätte mein Leben sein können, wenn ich Running Back oder Wide Receiver gewesen wäre oder – Traum der Träume – Quarterback. Aber ich bin nicht schnell. Ich bin nicht elegant. Nicht »Poesie in Bewegung«, eher ein Poetry-Slam. Man könnte sagen, dass ich stämmig bin. Nicht fett, aber stabil. Wie eine Eiche. Unter anderem deswegen bin ich ein toller Defensive Tackle.
Tackles und Linebackers – wir erledigen die Drecksarbeit und ernten keinen Ruhm –, aber wir sind immer, immer der Grund für Siege oder Niederlagen. Der Quarterback ist wie der Leadsänger einer Band, der so eingebildet wird, dass er eine Solokarriere startet und sich in Konzertverträgen ausschließlich blaue M & Ms garantieren lässt. Running Backs und Wide Receiver sind Gitarre und Bass. Und die Linebacker? Wir sind der Rhythmus. Die Drummer, die den Takt halten, aber immer im Hintergrund bleiben.
Das ist okay. Ich habe es nie um der Aufmerksamkeit willen gemacht. Ich habe die rohe Energie geliebt, wenn man durch eine Offensive Line bricht. Das Gefühl und den Sound von gegeneinanderkrachenden Helmen. Merkt euch das, denn es kommt noch mal vor.
Ich war bekannt für meine Tackles. Meine Treffer. Nur selten habe ich für meine Tackles eine Flag bekommen, und darauf war ich stolz. Ich machte es richtig, und ich machte es gut. Soweit ich weiß, habe ich nie eine Gehirnerschütterung verursacht – aber ich habe ausgeteilt und eingesteckt. Prellungen, Blutergüsse, manchmal ziemlich übel, aber ich habe mich nie beschwert. Zähne zusammenbeißen und weiter, war unser Familienmotto.
»Genieße es jetzt«, hat mein Vater mir einmal erklärt. »Denn es ist schneller vorbei, als du glaubst.«
Mein Dad hat auf der Highschool auch Football gespielt. Er hat auf ein College-Stipendium gehofft, das er nie bekommen hat. Stattdessen fing er an, für meinen Onkel zu arbeiten und den Vertrieb von Autoteilen zu organisieren. Er hat die Zähne zusammengebissen und weitergemacht. Mit seinem Gehalt und dem, was meine Mutter als Ernährungsberaterin verdiente, kamen wir gerade so durch. Der Herr sei gepriesen für Fast Food; es trieb die Leute zu meiner Mutter wie Rinder durch eine Viehgasse.
So war es. Das ist das, was Ärzte die Baseline nennen. Die vor Beginn der Behandlung genommenen Werte, an denen alles andere gemessen wird. Es war die Normalität, bevor alles zu irgendeinem Ort jenseits der Hölle gefahren ist.
Es gibt Entscheidungen, die wir treffen, Entscheidungen, die für uns getroffen werden, und Dinge, die wir so lange ignorieren, bis es ohnehin keine Wahl mehr gibt. Ich hab schon jede Menge Kram, mit dem ich mich nicht auseinandersetzen wollte, vorsätzlich so lange ignoriert, bis es keine Rolle mehr spielte oder so gründlich vermasselt war, dass sich die Mühe, noch irgendwas zu retten, nicht mehr lohnte. Wie als ich es hinausgezögert habe, mich für einen Übungstest zur Aufnahmeprüfung für die Uni einzuschreiben, bis es zu spät war. Meine Mom war wütend, aber mir war es egal. Sie hatte sowieso vor, mich für einen Kurs zur Vorbereitung auf den Uni-Aufnahmetest anzumelden, weshalb also sollte ich einen perfekten Samstag mit einem Übungstest verschwenden, den ich danach noch ein halbes Dutzend Mal machen würde? Außerdem hoffte ich auf das Stipendium, das Dad nie bekommen hatte.
»Das hat Jay von nebenan auch gedacht«, hatte meine Mom angemerkt. »Er hat alles auf ein Stipendium gesetzt, das er nicht bekommen hat, und ist am Ende nirgendwo angenommen worden.«
»Es gibt immer noch das Community College«, schaltete mein Vater sich ein, der immer die Seite einnahm, die meine Mutter nicht unterstützte. »Es ist nicht so teuer, und dann kann er in zwei Jahren auf eine Universität wechseln, die uns nicht ruinieren wird.«
Ich musste an meinen Freund Leo Johnson denken, der schon von großen Unis umworben wurde. Ich freute mich für ihn, und dadurch würden Talentscouts zu unseren Spielen kommen, doch ich wusste, dass sie nicht mich beobachten würden. Ich kann nicht leugnen, dass ich Leo um die Möglichkeiten, die er haben würde, beneidete – aber ich musste darauf vertrauen, dass auch ich Optionen bekommen würde.
Und so war es. Ich bin an den sonderbaren Orten gelandet. Nur wo und wann ich mich dafür entschieden habe, ist mir bis heute nicht klar. Meine Entscheidung, an dem Tag Football zu spielen, kann es nicht gewesen sein. Ich meine, wer bei gesundem Verstand ist, verzichtet nicht ohne guten Grund – wie etwa Tod oder Verstümmelung – auf seinen Sport. Es gab nur wenige Dinge, die mich vom Spielfeld fernhalten konnten. Ich hatte eine Verpflichtung gegenüber meinem Team. Und an jenem ersten Tag gab es nicht einmal eine Vorwarnung. Nichts, was darauf hingedeutet hätte, dass etwas begann, was sich nicht rückgängig machen ließ.
Vielleicht war es meine Entscheidung, überhaupt Football zu spielen, die alles in Bewegung gesetzt hatte. Aber war das wirklich meine Wahl gewesen? Football war die große Liebe meines Vaters. Über Football hatten wir eine Verbindung, also habe ich es auch geliebt. So ist das manchmal, wenn man Kind ist. Man isst, was einem die Eltern auf den Lebensteller legen.
Also lasst mich den Tisch für euch decken, bevor ich euch diesen total verrückten Auflauf auf den Teller häufe. Es ist Freitag, der 8. September. Es ist das erste Spiel der Saison. Ich hatte in den Sommerferien einen ordentlichen Schuss in die Länge gemacht und mich im Training die ganze Woche voll reingehängt. Ich war bereit. Bis zur Zeitumstellung waren es noch fast zwei Monate, deshalb würde das Spiel in der Spätnachmittagssonne beginnen, jedoch unter den grellen Halogenscheinwerfern enden, die das Gewöhnliche in ein Spektakel verwandeln konnten.
In der Umkleidekabine herrschte pure Energie, die der Coach zu »einem Wall und einem Keil« zügeln musste. So wollte er uns sehen. Die Tsunami-Defensive war ein undurchdringlicher Wasserwall. Die Offensive war ein Gischtkeil, der sich durch alles seinen Weg brach.
Sobald ich meine Ausrüstung angelegt hatte, ging ich zu Leo. Wir waren Freunde, solange ich mich erinnern kann. Wir spielten zusammen Football, seit wir als Kinder in der Pop-Warner-League angefangen hatten, wo die Polster unsere Körperschwerpunkte so weit nach oben verlagerten, dass eine leichte Brise uns umreißen konnte. Leo war ein fantastischer Wide Receiver. Es war, als hätte er Zugstrahlen in den Fingerspitzen, mit denen er einen Football aus dem Himmel saugen konnte. Er war Schwarz wie etwa ein Drittel unseres Teams. Tatsächlich war die Mannschaft ein ziemlich gutes Abbild der demographischen Zusammensetzung unserer Schule, eine ausgewogene Mischung aus Weiß, Schwarz und Lateinamerikanisch mit einem asiatischen Jungen, den alle Kamikaze nannten, obwohl er kein Japaner, sondern Koreaner war.
Ich war mit so ziemlich allen befreundet, und wir haben uns gegenseitig immer gutmütig verarscht.
»Wenn du noch weißer wärst, könnte ich dich schwenken, um einen Krieg zu beenden«, erklärte mir mein Freund Mateo Zuñiga einmal, nachdem er vergeblich versucht hatte, meine spanische Aussprache zu verbessern. Mateo war der beste Field-Goal-Schütze des Landes. Vielleicht hat er meine Aussprache nicht verbessert, doch was die Erziehung meiner Geschmacksknospen angeht, hat er einen ziemlich guten Job gemacht, weil die Kochkünste seiner Mutter einer religiösen Erfahrung gleichkamen – inklusive des Wunders ihrer spätabendlichen Pozole.
Damals dachte ich, weil ich eine diverse Gruppe von Freunden hatte, könnte ich mein Kästchen für soziale Verantwortung abhaken. Als ob es für mich nicht mehr zu tun gäbe, als ein bisschen Braun an meinem Tisch zu haben. »Hautfarbe sollte keine Rolle spielen«, hat man mich immer gelehrt – und ich habe es immer geglaubt. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was sein sollte, und dem, was ist. Und privilegiert sein heißt, diese Kluft nicht wahrzunehmen.
Während Mateo, Kamikaze und alle anderen sich in der Umkleidekabine in Ekstase johlten, wurde Leo vor einem Spiel immer still und konzentrierte sich.
»Wenn ich es bis in die Endzone schaffen will, muss ich im Kopf schon da sein«, hatte er mir einmal erklärt.
Aber ich wusste, dass heute mehr dahintersteckte.
»Bereit, die Streifengnus zu einer gefährdeten Art zu machen?«, fragte ich ihn in der Hoffnung, ihn in Stimmung zu bringen. (Ja, wir spielten gegen die Wharton Wildebeests – die Streifengnus –, dagegen klangen Tsunamis richtig gut.)
Leo grinste. »Sie sind bereits gefährdet«, sagte er. »Ich habe gehört, dass sie sich nur in Gefangenschaft fortpflanzen.«
Es war gut, ihm ein Lächeln zu entlocken. Ich wusste, dass dies sein erstes Spiel war, nachdem seine Freundin nach Michigan gezogen war – was ebenso gut der Mars hätte sein können. In den Wochen vor dem Umzug hatte Leo ständig davon geredet, sich an der Michigan State University zu bewerben, überzeugt, dass die beiden die Prüfung der Trennungszeit überstehen würden. Dann machte sie per SMS Schluss mit ihm. Aus dem Flugzeug. Das muss eine Premiere gewesen sein, aus 11,3 Kilometern Höhe abserviert zu werden. Buchstäblich aus allen Wolken gefallen.
»Sie hat das Richtige getan«, sagte Leo. »Im letzten Jahr auf der Highschool sollte man nicht auf jemanden warten, den man vielleicht nie wiedersieht. Und manchmal ist es das Beste, das Pflaster schnell abzureißen.«
Obwohl es mir eher vorkam wie ein komplettes Brustwaxing. Ich setzte mich neben ihn auf die Bank. »Du weißt, dass die Augen aller Mädchen auf der Tribüne auf dich gerichtet sein werden, oder?«
»Ich weiß«, sagte er. »Aber ich bin noch nicht so weit. Gib mir noch ein paar Wochen.«
Das musste ich ihm lassen. Andere Typen würden sich sofort in das nächste Paar offener Arme stürzen, aber nicht Leo. Er hatte seine Prinzipien.
»Na«, sagte ich, »dann kannst du vielleicht ein paar dieser Blicke in meine Richtung umlenken.«
»Mach ich«, sagte er, und sein Grinsen verrutschte leicht ins Schräge. »Das Problem ist bloß, dass das nur bei denen funktioniert, die eine Brille brauchen.«
Ich lachte, er lachte lauter, und ich lachte noch lauter. So war das zwischen uns. So würde es immer sein, dachte ich.
Die ersten fünf Minuten des Spiels waren geballte Energie, weil wir so aufgeregt waren, wieder vor jubelnden Zuschauern auf dem Spielfeld zu stehen. Die Wildebeests waren eine tüchtige, aber uninspirierte Mannschaft, ein gutes Team, um zu Beginn der Saison Routine zurückzugewinnen. Zu Beginn des zweiten Quarters hatte noch keine Mannschaft einen Treffer erzielt, doch wir waren siegesgewiss. Dann warf Layton Vandenboom, unser Quarterback, einen schlechten Pass, der abgefangen wurde. Während er sich noch deswegen fertigmachte (was er noch die ganze Woche tun würde, egal, ob wir gewannen oder verloren), ging die Defensive aufs Feld. Das heißt, ich, falls ihr nicht aufgepasst habt.
Die Wildebeests hatten ein Wiesel von einem Quarterback, der dafür bekannt war, sich wegen jeder Kleinigkeit bei den Schiedsrichtern zu beschweren. Das jammernde Wildebeest-Wiesel zu Fall zu bringen, würde sehr befriedigend sein.
Beide Teams gingen an der Trennlinie zwischen Offensive und Defensive in Position, und der Spielzug begann. Jemand schnappte sich den Ball, und ich setzte mich in Bewegung. Eigentlich soll man mit den Schultern rammen. Der Zusammenprall von Helmen ist zwar nicht ausdrücklich verboten, aber auch nicht ratsam, lässt sich jedoch nicht immer vermeiden. Dinge passieren. Und ich habe dieses Gefühl gegeneinanderprallender Köpfe immer geliebt. Ich hatte nichts dagegen. Meine Power-Attacke war wie gesagt mein Markenzeichen. Es war das, womit ich vielleicht die Stipendien ergattern würde, die mein Vater nie bekommen hatte.
Aber diesmal war der Zusammenprall anders.
Kennt ihr das, dass das Gehirn, wenn man von einem lauten Geräusch erschreckt wird, manchmal eine Fehlzündung hat und man gleichzeitig einen Phantomblitz sieht? Nun, dies war wie ein plötzlicher Schub von Phantomkälte. Kein Luftzug und auch kein fiebriges Frösteln – eher so, als ob mein Blut durch Eiswasser ersetzt worden wäre, aber nur für den Bruchteil einer Sekunde.
Dann war das Gefühl wieder verflogen, und ich lag auf dem Boden, hatte das Wildebeest-Wiesel getackelt, den Ball noch in der Hand, und die Menge johlte.
Ich kann mich nicht mal an die Zeitspanne zwischen dem Rammen des Lineman und dem Erreichen des Quarterback erinnern. Es war, als ob ich dorthin teleportiert worden wäre.
Zwölf Yards Verlust für die Wildebeests. Das Wiesel jammerte, die Aktion hätte mit einer Flag geahndet werden müssen, doch es gab keine, weil ich gegen keine Regel verstoßen hatte. An der Aktion war nichts Ungewöhnliches … bis auf die Kälte, die ich nicht mehr spürte, die aber sehr real gewesen war. Was zum Teufel war das?
High Fives, Klapse auf den Hintern, Faustgrüße und zurück auf die Linie. Nur dass ich jetzt so etwas wie Kopfschmerzen hatte. Nicht direkt Kopfschmerzen, aber so ähnlich. Es fühlte sich an wie ein elektrisches Summen, das man nicht hört, sondern spürt. Zähne zusammenbeißen und weiter, richtig? Das tat ich und dachte für den Rest des Spiels nicht mehr daran.
Wir gewannen vierundzwanzig zu vierzehn, und in unserer Euphorie nach dem Spiel war die Erinnerung an den Eisschock beinahe vergessen. Erst sehr viel später fiel er mir wieder ein.
Nach dem Spiel gingen wir mit einer Gruppe im Tibbetsville Towne Centre Hamburger essen – eine dieser angeberischen Anti-Malls mit »e«s an der falschen Stelle und »Fridaye- und Saturdaye«-Nights. Kinos, Bowlingbahnen und Restaurants sowie ein Fast-Food-Court für diejenigen, die bloß schnell und billig etwas herunterschlingen wollten. Als bestes Football-Team in einer sportverrückten Stadt waren die Tsunamis an einem Freitagabend praktisch die Gebieter des Food-Courts.
Layton hatte seine Freundin Katie mitgebracht. Sein Arm hing über ihren Schultern wie ein Fleischbrocken und drückte sie nach unten. Layton war ein durch und durch amerikanisches Weißbrot-Kid; wahrscheinlich sah er sich in seinen Träumen als Captain America. Katie war Cheerleaderin, hatte darüber hinaus jedoch noch etliches mehr zu bieten, was Layton nicht bemerkte. Er hatte Probleme, über ihre Pom-Poms hinauszublicken.
Kennt ihr das, wenn manche Menschen ein Stereotyp sehen und einfach damit verschmelzen? Der Weg liegt vor ihnen, breit und gut ausgetreten. Es ist leichter, ihm zu folgen, als sich zu widersetzen. Manche Menschen folgen diesem Weg bis in die Kiste, die am Ende auf sie wartet, inklusive Standardpredigt und Plastikblumen. Und so ist es und möge für immer so bleiben, der Quarterback und die Cheerleaderin, in jeder Schule, in jeder Stadt, jetzt und in alle Ewigkeit, Amen.
Ich glaube nicht, dass Katie wirklich aus freier Entscheidung Cheerleaderin geworden war. Im Frühling spielte sie Tennis – was sie erkennbar mit ganzem Herzen tat –, aber ihre Mutter war Cheerleaderin gewesen, genau wie ihre Schwester, und Katie war von klein auf dazu ermutigt worden. Wir essen wie gesagt von dem Teller, den uns unsere Eltern auftischen. An dieser Stelle muss ich gestehen, dass Katie und ich eine Geschichte hatten, aber nicht so, wie ihr denkt. Wir haben gemeinsam eine Leiche begraben. Aber dazu komme ich später.
Norris, ein Offensive Lineman (der auch abseits des Spielfelds gern über alles hinwegtrampelte), war ebenfalls dabei. Er war allein, weil seine On-off-Beziehung mit seiner Freundin gerade off war, wobei es allem Anschein nach wohl auch bleiben würde. Irgendwie schien die Vorstellung einer Beziehung Norris besser zu gefallen als die Realität. Vielleicht waren ihre ständigen Trennungen aber auch auf Norris’ chronische Idiotie und seine Bemerkungen zurückzuführen, die nur selten den Eindruck machten, als würde ein Gehirn dahinterstehen. Bestimmt kennt ihr einen Typen wie Norris. Jeder kennt einen. Jemand, der ständig die verkehrten Entscheidungen trifft und immer im falschen Moment das Falsche sagt, als wäre er vielleicht gerade kacken gewesen, als Gott den gesunden Menschenverstand verteilt hat. Einmal hat er einen Mexikaner-Witz nach dem anderen gerissen, was niemand hören wollte, bis Mateo ihm mit einem Schlag die Lichter ausgeknipst hat.
Man findet sich mit den Norrises dieser Welt ab, weil man erstens schon mit ihnen befreundet war, bevor sie Arschlöcher geworden sind, und weil sie zweitens wie ein Schwamm für alle schlechten Gedanken über einen selbst funktionieren, denn egal, wie beschissen ein Tag auch sein mag, man ist wenigstens nicht Norris.
Leo war natürlich auch da, zusammen mit seiner Schwester Angela, die es persönlich übernommen hatte, die Lücke in Leos Privatleben zu füllen, nachdem seine Ex-Freundin nun Marsianerin war. Angela war ein Jahr jünger als wir, doch die meisten Leute hielten sie und Leo für Zwillinge, weil sie immer mit uns Älteren rumhing. Ich kann nicht bestreiten, dass sie hot war. Vielleicht hätte ich sie gedated, doch das hätte auf verschiedenen Ebenen Probleme verursacht. Erstens will man nicht mit der Schwester seines besten Freundes zusammen sein, weil das meist an allen Fronten nicht gut endet. Zweitens hätte mein Großvater, auch wenn es mir peinlich ist, das zuzugeben, einen zweiten Herzinfarkt erlitten, wenn ich mit einem Schwarzen Mädchen zusammen gewesen wäre. Ich würde meinen Großvater nicht als Rassisten bezeichnen. Okay, also, ich würde ihn als Rassisten bezeichnen, nur nicht von Angesicht zu Angesicht.
»Es ist eine Generationsfrage«, sagte meine Mom immer, zu verlegen, das Thema auf irgendeine sinnvolle Weise anzusprechen. Mit Leo hatte Grandpa keine Probleme, aber einmal habe ich ihn dabei beobachtet, wie er seinen Wagen per Knopfdruck verriegelt hat, als Leo zu Besuch kam. Es war nicht so, dass er dachte, Leo würde den Wagen stehlen. Der Anblick eines Schwarzen Jugendlichen hatte ihn nur daran erinnert, sein Auto abzuschließen. Alte Leute, stimmt’s?
Leo hat deswegen nie ein großes Aufsehen gemacht, deshalb bin ich auch nie auf den Gedanken gekommen, dass es ihm vielleicht mehr ausgemacht hat, als er sich hat anmerken lassen.
Ich habe mich nur einmal mit Leo über bewusste und unbewusste Vorurteile gestritten – vor mehr als zwei Jahren, als ich in Gemeinschaftskunde eine dämliche Bemerkung über positive Diskriminierung gemacht habe. Ich sagte, dass Leo bessere Noten hatte als so ziemlich jeder andere in der Klasse – auf jeden Fall bessere Noten als jeder aus dem Football-Team. Für den schlichten Zehntklässler, der ich damals war, genügte das als Beweis dafür, dass niemand wegen seiner Hautfarbe einer bevorzugten Behandlung bedurfte.
Er machte mich mit einer Entgegnung nieder, in der er über all die Kids sprach, die nicht so viel Glück gehabt hatten wie er – die nicht die Chancen bekommen hatten, die er gehabt hatte, und feststellen mussten, dass alle Türen zugefallen waren, bevor sie sie erreichten. »Wenn man die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, die Tür einzutreten, ist man schon erschöpft und hinkt meilenweit hinter denen her, die einfach hindurchgetänzelt sind«, hatte er gesagt. »Hältst du das wirklich für gerecht?«
So hatte ich das noch nie gesehen, also habe ich mich entschuldigt und ihm erklärt, dass ich mir nichts dabei gedacht hatte, aber man kann vermutlich nicht zurückrudern, wenn man etwas Dummes gesagt hat, über das man nicht gründlich genug nachgedacht hat. Definitiv keiner meiner Glanzmomente. Aber immerhin bin ich nicht Norris.
»Dieses Land ist voll von gutmeinenden Ignoranten«, erklärte Leo mir. »Es ist eine verdammte Epidemie, und du bist der Überträger.«
Das Ende vom Lied war, dass Leo eine Woche lang nicht mit mir redete. Dann war es vorbei, und es war okay. Ich meine, er war mein bester Freund – da konnten wir keine Kleinigkeit wie Rassismus zwischen uns kommen lassen. Und später habe ich mit ihm zusammen gegen Polizeigewalt demonstriert und mich mit erhobener Faust und einem selbstgemalten Schild an die Straße gestellt. Ich dachte, das würde reichen, um ihm zu zeigen, dass ich auf der richtigen Seite der Geschichte stand. Heute habe ich eine andere Perspektive.
Jedenfalls aßen wir sechs unsere Burger. Wir Typen waren noch aufgekratzt von unserem Sieg und high von dem Adrenalin, das jeden Wettkampfsport so suchtgefährdend macht, aber darunter spürte ich eine seltsame Strömung der Beklommenheit. Es war keine Vorahnung, sondern das Nachbeben, denn es ging nicht um etwas, das noch geschehen würde. Es war bereits passiert: Ich wusste es nur noch nicht. Ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte. War dieses Gefühl in mir oder um mich herum? Oder beides? Im Augenblick konnte mein Körper die Empfindung nur in diesen eigenartigen summenden Kopfschmerz übersetzen.
»Ich kann nicht glauben, dass ich einen derart schlechten Pass geworfen habe«, jammerte Layton.
»Sei nicht so hart zu dir, Dude«, sagte Norris. »Wir haben die Wildefreaks geschlagen, das ist alles, was zählt.«
Aber Laytons Gesichtsausdruck sagte etwas anderes. Ungefähr in diesem Moment begann Katie, sich unter seinem Arm zu winden und sich eine Pommes nach der anderen in den Mund zu schieben – so schnell, dass Layton reagieren und seinen Arm von ihrer Schulter nehmen musste, um sich mit der Hand ein paar Pommes zu schnappen, bevor alle weg waren.
Ich grinste, weil mir klar wurde, dass sie es genau deshalb gemacht hatte. Nicht weil sie Appetit auf Pommes hatte, sondern weil sie Layton dazu bringen wollte, seinen Arm wegzunehmen und sie von dem Gewicht zu befreien.
Katie warf mir einen kurzen schuldbewussten Blick zu, weil sie wusste, dass ich es gesehen hatte, und ich zwinkerte ihr kurz zu, um zu signalisieren, dass ihr Geheimnis bei mir sicher war. Sie wandte den Blick ab, doch ich sah, dass sie ein Lächeln unterdrückte.
Ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe, ob es illoyal war, mich auf die Zeit zu freuen, wenn sie und Layton sich trennten, damit ich meine Chance bei ihr bekommen konnte – eine Chance, die ich vor einer Weile hätte ergreifen sollen, mich jedoch nicht getraut hatte. Aber ich hatte nicht vor, meine Gedanken allzu bald in diese Richtung wandern zu lassen. Ich behielt es bloß im Hinterkopf. Ich war nie der Typ, der die Freundin eines anderen anmacht, obwohl es Gerüchte gab, dass Layton sie nicht gut behandelte. Damals dachte ich, dass es mich nichts angeht, aber es war ein Grund mehr zu glauben, dass ihre Beziehung noch vor Ende der Football-Saison Schiffbruch erleiden würde.
Während des Essens redeten wir weiter über Football, bis Angela, Leos Schwester, anfing, sich zu langweilen. »Habt ihr Typen keine anderen Interessen?«
»Essen«, sagte Norris. »Und Sex.«
»In der Reihenfolge für Norris«, fügte ich hinzu.
»Wenn du keine Lust auf Football-Gerede hattest«, fragte Leo, »warum bist du dann mitgekommen?«
»Damit Katie nicht ganz allein gegen eure toxische Männlichkeit kämpfen muss.«
»Wir sind nicht toxisch«, entgegnete ich. »Nur weil wir Football-Spieler sind, heißt das nicht, dass wir hinterm Mond leben und so.«
»Und so«, spottete sie. »Ich konzediere, dass das aktuelle toxische Level im grünen Bereich ist, aber wenn der Wert steigt, sag ich dir Bescheid.«
Ein paar Meter entfernt ließ ein Kellner ein Tablett fallen. Da in dem Lokal alles in roten Plastikkörben serviert wurde, ging nichts zu Bruch, es war nur ein kraftloser dumpfer Aufprall und das Geklapper von Besteck. Doch mein Kopf schnellte herum, und danach drehte sich alles in meinem Kopf wie bei diesen Kompassen, die man aufs Armaturenbrett montieren kann.
Ich atmete tief ein und legte die Hände flach auf den Tisch, als könnte ich mich durch die Berührung einer festen stabilen Oberfläche vergewissern, dass die Schwerkraft nach wie vor in dieselbe Grundrichtung wirkte. Norris hatte begonnen, der unfreiwilligen Essensentsorgung obligatorisch zu applaudieren, und alle guckten in die Richtung des unglücklichen Kellners, der sich mühte, die Sauerei wegzuwischen, bevor der Manager rauskam. Es war Katie, die mich bemerkte, so wie ich sie bemerkt hatte.
»Alles okay, Ash?«
»Ja, alles gut«, antwortete ich. »Mir war nur kurz schwindlig.«
Layton sah Katie an, folgte ihrem Blick in meine Richtung und zog die Augenbrauen hoch. »Wohin ist dein Blut verschwunden, Mann? In deine Zehen? Du siehst aus, als wärst du bereit für die Leichenhalle. Musst du kotzen?«
»Nein, ich glaube nicht.«
Katie schob mir ihr Wasserglas zu. »Vielleicht bist du dehydriert«, sagte sie.
»Danke.« Ich trank ein paar Schlucke, und Layton erklärte mir, ich solle das Glas behalten – nur für den Fall, dass ich ansteckend war.
Das Schwindelgefühl ebbte ab, kam aber jedes Mal zurück, wenn ich den Kopf zu schnell drehte. War das eine Gehirnerschütterung? Ich hatte schon Gehirnerschütterungen – leichte – aber das hier fühlte sich anders an. Wenn Menschen Transplantate bekommen, stößt ihr Körper das Organ manchmal ab, so dass sie Medikamente nehmen müssen, um die Reaktion zu stoppen. Genauer kann ich das Gefühl nicht beschreiben.
Mein Körper stieß aber nicht mein Gehirn ab, sondern nur dessen Inhalt. Als ob mein eigener Verstand ein Eindringling wäre. Das ergab damals keinen Sinn, obwohl ich später verwundert feststellen sollte, wie präzise dieser Gedanke gewesen war. In dem Moment wollte ich ihn bloß leugnen und abtun. Ich würde die Zähne zusammenbeißen und weitermachen, verdammt nochmal! Ich würde weitermachen.
An jenem Abend fuhr ich Norris nach Hause, weil er noch keinen Führerschein hatte. Bei seiner letzten Fahrprüfung hatte er es fast bis zum Ende geschafft und dann eine alte Dame auf einem Zebrastreifen angehupt.
»Der Fahrprüfer hatte es auf mich abgesehen«, beklagte er sich. »Ich wette, die alte Dame war extra bestellt.«
»Pack es einfach zu deinen anderen Verschwörungstheorien«, erklärte ich ihm, denn davon hatte er viele.
»Lach nicht!«, sagte er. »Die Wahrheit wird ans Licht kommen!«
Und genau in diesem Moment hätte ich uns beinahe umgebracht.
Dinge, die dein Leben verändern – Dinge, die deine Welt verändern –, geschehen selten mit Vorwarnung. Sie kommen als volle Breitseite wie ein Sattelzug auf einer Kreuzung. Im Football nennt man das Clipping. Es ist streng verboten und wird hart bestraft. Aber das Universum spielt nicht nach Regeln, zumindest nicht nach Regeln, die uns, die wir an Zeit, Raum und physikalische Gesetze gebunden sind, logisch erscheinen.
Der fragliche Sattelzug donnerte auf die Kreuzung, obwohl ich offensichtlich Vorfahrt hatte. Er hupte, und ich wusste, wenn ich auf die Bremse trat, würde er uns garantiert voll von der Seite rammen, also drückte ich stattdessen aufs Gas. Der Laster bremste nicht mal ab, als ich über die Kreuzung schoss, und verpasste uns nur um Zentimeter.
Jetzt trat ich auf die Bremse. Zwanzig Meter weiter kamen wir zum Stehen, während der Lkw seines unheilvollen Weges gezogen war. Ich hielt noch immer mit weißen Fingerknöcheln das Lenkrad gepackt und versuchte, mich zu vergewissern, dass wir in der Tat noch lebendig waren.
»Mein Gott, Ash, was zum Teufel ist los mit dir?«, platzte Norris los, nachdem alles vorbei war. »Willst du uns umbringen?«
»Nur dich«, erwiderte ich. »Fehlversuch.« Ich hoffte, diese kleine abfällige Bemerkung würde uns in unseren normalen Bewusstseinszustand zurückreißen, doch das tat sie nicht.
Und dann sagte Norris: »Du hast ein Stoppschild glatt überfahren.«
»Hab ich nicht. Da war kein Stoppschild.«
Aber als ich mich umdrehte, sah ich die Rückseite eines vertrauten achteckigen Schildes. Ich dachte an meine Fahrstunden zurück. Unser Fahrlehrer hatte uns erklärt, dass die meisten Unfälle auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen waren. Heute war ich das menschliche Fehlverhalten.
Ich blickte mich um, um zu sehen, wer noch Zeuge meiner Kamikaze-Aktion geworden war. Auf der Straße war nur ein dünner Typ auf einem Skateboard unterwegs. Er rollte vorbei, ohne etwas von dem Beinaheunfall zu ahnen. Das heißt, wie sich herausstellen sollte, war der Skater keineswegs ahnungslos, aber das wusste ich damals noch nicht. Fürs Erste war er nur ein Typ auf einem Skateboard. Leicht zu übersehen. Leicht zu vergessen. Fürs Erste.
Ich trat sanft aufs Gaspedal, und wir setzten unsere Fahrt fort, ungleich vorsichtiger als zuvor. Aber obwohl ich größte Umsicht walten ließ, hätte ich das nächste Stoppschild beinahe wieder übersehen. Ich bremste – nicht heftig genug, dass Norris mitbekam, dass ich um ein Haar ein weiteres Stoppschild überfahren hätte, aber doch so abrupt, dass die Sachen, die auf der Rückbank lagen, auf den Boden purzelten. Und dann fiel es mir auf. Das, was ich bei dem Stoppschild zuvor nicht bemerkt hatte, weil es schon hinter mir gelegen hatte; ich hatte nur seine stählerne Rückseite gesehen.
Beim Autofahren macht man manche Dinge irgendwann automatisch. Man denkt nicht daran, in den Spiegel zu blicken und sich über die Schulter umzusehen, bevor man die Spur wechselt; man macht es einfach. Es wird einem zur zweiten Natur. Bei einem Stoppschild gibt es drei mentale Trigger. Das ist vermutlich Absicht, damit man es auf keinen Fall übersieht. Erstens die Form. Dann das Wort STOP selbst. Und dann die Farbe. Wenn eins dieser Merkmale fehlt, fällt einem das vielleicht nicht bewusst auf. Aber womöglich tritt man dann eben auch nicht auf die Bremse.
»Was ist denn damit?«, fragte ich Norris und zeigte auf das Schild.
»Womit?«, fragte er völlig ahnungslos.
Ich wies erneut auf das Stoppschild. »Es ist blau.«
Er sah mich an, als würde er auf die Pointe warten, schließlich sagte er: »Und?«
Also buchstabierte ich es ihm vor. »Ich hätte das Stoppschild beinahe übersehen, weil es blau ist. Wer hat je von blauen Stoppschildern gehört?«
Die Farbe eines Gegenstandes ist eine Kleinigkeit. Unwichtig für das größere Ganze. Folgenlos. Wie die Farbe eines Hauses. Ich wette, wenn ich euch fragen würde, welche Farbe das Haus eurer Nachbarn hat, könntet ihr es mir nicht mit Sicherheit sagen, weil ihr es nicht auf dem Schirm habt – und das solltet ihr auch nicht. Ihr habt wichtigere Dinge zu bedenken.
Die Farbe von Stoppschildern sollte keine Rolle spielen.
Aber das tut sie.
Meine Eltern waren bei dem Spiel gewesen und, nachdem sie mir zum Sieg gratuliert hatten, direkt nach Hause gefahren. Als ich heimkam, postete Mom gerade peinliche Bilder davon, und Dad guckte seine neueste Binge-Serie im Fernsehen.
»Mom«, sagte ich, bemüht, meine Worte mit Bedacht zu wählen, »was, würdest du sagen, ist die exakte Farbe eines Stoppschilds?«
Sie blickte von ihrem Laptop auf und sah mich genau wie zuvor Norris an, als wäre das eine Fangfrage.
»Blau«, sagte sie. »Einfach … normal blau.«
»Also, keine Schattierung einer anderen Farbe?«, hakte ich nach. »Wie … Rot zum Beispiel?«
Sie runzelte die Augenbrauen und atmete tief ein, als würde sie spüren, dass ein Sturm aufzieht. »Geht es dir gut, Ash?«
»Alles bestens«, fauchte ich. »Ich hab nur eine Frage gestellt. Warum musst du gleich denken, irgendwas wäre nicht in Ordnung, bloß weil ich eine Frage stelle.«
Sie bewahrte die Fassung, auch wenn ich meine verlor. »Weil es eine seltsame Frage ist«, sagte sie.
Ich öffnete den Mund, um zu entgegnen, dass das eine völlig unseltsame Frage sei, erkannte jedoch, dass es zwecklos war.
»Ist auch egal«, erklärte ich. »War bloß eine Frage.« Und dann ging ich ohne eine weitere Erklärung in mein Zimmer, weil es keine Erklärung gab. Ich versuchte, mir weiter einzureden, wie unwichtig das Ganze war, wie albern ich mich benahm. Aber hier schlummerte eine tiefere Wahrheit, und man kann im Gewebe seiner Welt nicht den kleinsten losen Faden tolerieren. Entweder alles funktioniert oder gar nichts.
Meine Kopfschmerzen waren nie ganz weg gewesen und meldeten sich jetzt so heftig zurück, dass sie mir wieder auffielen. Ich sollte Kopfschmerztabletten nehmen, dachte ich, doch ich war zu beschäftigt mit diesem losen Faden. An meinem Computer startete ich eine Suche nach Stoppschildern. Sie waren natürlich alle blau. Es hätte mich nicht schockieren sollen, doch das tat es. Und es waren nicht nur die Stoppschilder. Ampeln hatten drei Farben. Grün, gelb und blau, was mir auf der Fahrt nicht aufgefallen war, weil offenbar alle Ampeln auf Grün gestanden hatten.
Das Seltsamste aber war, je länger ich die Bilder betrachtete, desto normaler kamen sie mir vor. Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr Erinnerungen kamen mir, die bestätigten, was die Bilder mir zeigten. Aber direkt neben diesen Erinnerungen gab es rote Schilder und rote Ampeln – und der Versuch, mich an beides zu erinnern, ließ meinen Kopf widerhallen, als ob jemand mit einem Luftballon rumquietschen würde. Ich gab es auf und warf mich aufs Bett. Ich war müde, das war alles. Müde und aufgedreht nach einem langen Tag. Morgen würde alles einen Sinn ergeben. Es würde vorbeigehen. Am Morgen würde ich erkennen, dass alles in Ordnung war. Stoppschilder waren schon immer blau gewesen, und ich musste ernsthaft verdreht im Kopf sein, etwas anderes zu glauben.
Kapitel 2Seitwärts
Rot ist die Farbe des Blutes. Die Farbe der Gefahr. Das heißt, wenn es so etwas wie Intuition gibt, hätte ich überall Rot sehen müssen.
Am Montag verbrachte ich die Mittagspause in der Schulbibliothek, wo ich die Geschichte von Straßenschildern nachschlug. Ich war inzwischen davon besessen. Ich hätte es auch auf sich beruhen lassen und als »eins dieser Dinge« abtun können, aber ich bin mehr Pitbull, als gut für mich ist.
Die Geschichte von Straßenschildern ist übrigens viel interessanter, als ihr vielleicht denkt. Offenbar hat man die Farbe Blau aus zwei Gründen dem Rot vorgezogen. Erstens wegen Bedenken wegen Rot-Grün-Sehschwäche. Zweitens ruft Rot bei Säugetieren Aggressionen hervor. Deshalb wedeln Matadore mit roten Umhängen vor Stieren herum. Rote Ampeln und Schilder würden wütende Fahrer zur Folge haben, argumentierte man. Und so wurde 1954 im »Amerikanischen Handbuch für einheitliche Verkehrsregelungsvorrichtungen« Blau als universelle Farbe für Stehen bleiben festgelegt.
Der einzige Ort, an dem ich tatsächlich rote Stoppschilder gefunden habe, war Hawaii – und das auch nur auf Privatstraßen –, weil die offiziellen blauen Schilder nach hawaiianischem Gesetz nur auf öffentlichen Straßen erlaubt waren.
Es klang alles plausibel und hatte eine innere Logik. Es war nur so, dass diese innere Logik sich mir nicht erschloss, genauso wenig wie die Welt, die ich zu kennen glaubte.
Katie ertappte mich bei meinen Recherchen. Ich erzählte ihr, dass ich ein Referat über Straßenschilder halten müsste.
»Bestimmt spaßig«, sagte sie mit gelangweiltem Sarkasmus. »Für welchen Kurs?«
Das machte mich beinahe ratlos, und anstatt ihr einen dämlichen Das-hab-ich-wirklich-noch-nicht-durchdacht-Blick zuzuwerfen, sagte ich: »Mathe.« Was bewies, dass ich das Ganze wirklich noch nicht durchdacht hatte.
»Straßenschilder für Mathe?«
»Ich … ähm … sitze über Unfallstatistiken … das Verhältnis von Beschilderung zu Unfallzahlen«, sagte ich. Applaus dafür, dass ich überhaupt irgendwas Zusammenhängendes aus dem Ärmel gezogen habe.
»Klingt interessanter als Algebra«, meinte sie.
Und dann hatte ich plötzlich den überwältigenden Drang, mich ihr anzuvertrauen. Vielleicht lag es daran, dass wir bereits ein Geheimnis teilten, wenn auch ein dummes.
Kurz gesagt habe ich in der fünften Klasse auf dem Weg zur Schule mit dem Fahrrad einmal ein Eichhörnchen überfahren. Wie ein Eichhörnchen verdammt nochmal langsam genug sein konnte, unter einen Fahrradreifen zu geraten, ist mir schleierhaft, aber so war es. Ich bremste, kam schliddernd zum Stehen und ging zurück, weil ich noch nicht wusste, dass die Worte totgefahrenes Tier schon an die Wand geschrieben standen. Als ich das Eichhörnchen hochhob, lebte es noch. Es klappte zweimal den Mund auf und wieder zu, als würde es unter Wasser nach Luft schnappen. Dann starb es zitternd direkt in meinen Händen. Ihr denkt vielleicht: »Na und, es sterben ständig irgendwelche Kleintiere.« Aber wann ist zum letzten Mal etwas in euren Händen gestorben? Und kommt mir nicht mit der Jagd, denn das ist etwas anderes; man geht schon mit dem Vorsatz los zu töten. Aber wenn etwas unerwartet in euren Händen stirbt und euch mit diesem Was-verdammt-nochmal-hab-ich-dir-je-getan-Blick ansieht, trifft es einen auf unvorhergesehene Weise. Ich brach unvermittelt in Tränen aus und redete mit dem Ding, als könnte es mich noch hören. »Es tut mir leid, es tut mir leid«, wimmerte ich. »Das wollte ich nicht!« Als ich aufblickte, stand plötzlich Katie da, die das Ganze beobachtet hatte.
Ich dachte, sie würde etwas sagen wie: »Was für ein Monster tötet ein Eichhörnchen?« Oder mich vielleicht wegen meiner mega-uncoolen Tränen auslachen. Aber stattdessen sagte sie: »Wir sollten es begraben.«
Nicht »du«, sondern »wir«. Mit einem Wort hatte sie einen traurigen einsamen Unfall in eine gemeinsame Vertuschungsverschwörung verwandelt.
Wir begruben das Eichhörnchen in einem unmarkierten Grab im Garten eines Hauses in der Nähe, dessen Besitzer, wie wir wussten, keinen Hund hatten, der das Tier wieder ausgraben könnte. Keiner von uns hat es je wieder erwähnt, aber seitdem fühle ich mich auf seltsame Art mit ihr verbunden. Und alles, weil sie mich weinend über einem toten Nagetier erwischt und es nie jemandem erzählt hat.
Das hieß, sie würde vielleicht auch das hier keinem erzählen. Und vielleicht könnte aus dem »Ich« wieder ein »Wir« werden, damit ich mich in dieser Sache nicht völlig allein fühlte.
Ich rief einen Haufen Bilder von blauen Stoppschildern für sie auf und sagte betont beiläufig: »Komisch, ich dachte immer, Stoppschilder sind rot.«
Sie sah mich einen Moment lang an – nicht perplex oder verwirrt, sondern nachdenklich. Dann schob sie mich beiseite und startete eine eigene Suche. Wenig später erschien das Bild eines Kleides auf dem Bildschirm.
»Vor einer Weile gab es einen großen Hype um die Farbe dieses Kleides. Was für Farben siehst du?«
»Es ist weiß mit goldenen Streifen«, sagte ich. »Ganz klar.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich sehe etwas anderes. Wenn ich dasselbe Bild anschaue, sehe ich ein blaues Kleid mit schwarzen Streifen.«
Ich betrachtete es erneut. »Das ist verrückt. Du willst mich verarschen, oder?«
»Nein. Und damit bin ich auch nicht allein. Dreißig Prozent der Menschen sehen das Kleid so wie ich, und siebzig Prozent sehen es so wie du. Das heißt, verschiedene Menschen sehen die Welt verschieden … Wer will also sagen, dass dein Rot nicht das Blau aller anderen ist?«
Das war die bisher beruhigendste Erklärung für das alles. Ich wollte ihr danken, fürchtete jedoch, dass es schnell peinlich werden könnte, wenn ich das Maß von Gefühlen bekundete, das ich tatsächlich empfand, also sagte ich bloß: »Klingt einleuchtend.«
Sie lächelte und ging davon, zufrieden, mein Dilemma gelöst zu haben. Ich blickte ihr nach und sah mich um, ob jemand beobachtet hatte, wie ich sie beobachtete. Dann atmete ich tief durch und traf die bewusste Entscheidung, das Ganze gut sein zu lassen. Ich hatte Wichtigeres zu tun, als mich in einem Rätsel zu verbeißen, das ich ohnehin nie lösen würde. Katies Erklärung war logisch. Oder zumindest logisch genug, um mich daran zu klammern.
Vor dem Verlassen der Bibliothek hielt ich einen vorbeigehenden Schüler auf. »Hey«, sagte ich. »Welche Farbe hat dein Hemd?«
Er blickte nach unten. »Es ist rot.«
Und genauso sah ich es auch.
Das Training an dem Tag war hart. Das war es immer –, aber so hart es auch war, Spiele haben eine spezielle Energie, die man im Training nie erreicht. Ein Training ist eben genau das. Es geht darum, stark und versiert genug für den Wettkampf zu sein. Aber in einem Spiel lebt man im Augenblick; alles ist schärfer, jede Sekunde trifft einen härter. Mit anderen Worten, auch wenn ich im Training kräftig hinlangte, fühlten sich meine Tacklings an Spieltagen vollkommen anders an. Es war ein weltveränderndes Gefühl.
Deshalb gab es am Montag keine Wiederholung des Power-Tackles. Kein Eis in meinen Adern, keinen Filmriss. Es war bloß ein normales erschöpfendes Training. Aber für eine Zeitlang machte es meinen Kopf leer, was gut war. Ich musste mir keine Sorgen darüber machen, ob ich an einer seltsamen unerkannten Farbenblindheit litt oder vor lauter Chaos in meinem Kopf den Verstand verlor.
Doch als ich nach Hause kam, wartete ein neues Drama auf mich.
Ich entdeckte, dass mein Bruder meinen Spielstand für WarMonger 3 gelöscht hatte, um ein Game für sich zu starten.
»Das wollte ich nicht«, beteuerte er. »Es hat mir nicht gesagt, dass ich deinen Spielstand überschreibe, bis es zu spät war.«
Diese Sache mag im größeren Plan der Dinge mikroskopisch unbedeutend erscheinen, aber im Moment hatte ich es nicht mit großen Plänen – und in meinem kleineren Plan für mich selbst war es ein große Sache. Wie ihr bestimmt wisst, ist WarMonger 3 eins dieser Spiele, auf die man jahrelang wartet. Es ist so komplex, dass man circa ein halbes Jahr braucht, um es durchzuspielen. Ich war weit in meinem fünften Monat.
Das Spiel hatte drei Speicher-Slots, von denen zwei bereits mit anderen Kampagnen belegt waren, die Hunter führte. Wenn man versuchte, etwas zu speichern, indem man einen bereits existierenden Spielstand überschrieb, fragte einen das Spiel: »Bist du sicher, dass du diesen Spielstand löschen möchtest?« Und wenn man auf »Ja« klickte, leuchtete ein großes rotes Stoppschild auf, das jetzt vermutlich blau war, und teilte einem in Großbuchstaben mit: »WARNUNG! DAS LÖSCHEN DIESES SPIELSTANDS KANN NICHT RÜCKGÄNGIG GEMACHT WERDEN.« Im Grunde konnte es also nur ein Vollidiot aus Versehen löschen. Und auch wenn ich ihn oft als solchen bezeichnete, war Hunter kein Vollidiot. Was bedeutete, dass er es womöglich mit Absicht getan hatte.
»Ich klicke jedes Mal zu schnell, ohne zu lesen«, stieß Hunter hervor. »Das sagst du doch auch immer.« Sein Gesicht war gerötet, er wahrte Abstand und blieb auf den Ballen seiner Füße, um schnell abhauen zu können, falls ich mich auf ihn stürzte. Ich wusste nicht, ob er rot geworden war, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, oder ob er versuchte, mich glauben zu machen, er hätte ein schlechtes Gewissen.
Mein erster Impuls war, ihn zu verprügeln, doch ich musste mich zurückhalten. Hunter war drei Jahre jünger als ich. Exakt drei Jahre – wir haben am gleichen Tag Geburtstag, was keinem von uns gefiel, weil wir beide nicht gern teilten. Ich hatte meinen Wachstumsschub gemacht, er hingegen noch nicht, deshalb war ich mittlerweile so viel größer als er, dass ich ihn mit meinen Schlägen ernsthaft verletzen könnte.
Mein zweiter Impuls war, alle seine Dateien zu löschen, bis mir klar wurde, dass er damit wahrscheinlich gerechnet hatte und es ihm womöglich gar nichts ausmachte. Vielleicht war er schon mit dem Spiel fertig, so dass meine Rache wirkungslos bleiben würde. Er würde gewinnen und sich insgeheim diebisch freuen, dass er mich komplett verarscht und manipuliert hatte.
Ihr denkt jetzt vielleicht, dass ich zu viel in die Sache hineindeutete, aber vielleicht habt ihr nie die unfassbaren Bosheiten eines passiv-aggressiven Geschwisterteils erlebt.
Typisches Beispiel: vor drei Monaten.
Ich wollte mit ein paar Freunden zu einem Konzert der Band Konniption. Tatsächlich hat Konniption sich einen Tag nach dem Gig aufgelöst, so dass es das letzte Mal war, dass irgendjemand sie live sehen konnte.
Und ich hatte mein Ticket verloren.
Normalerweise wäre das kein Problem gewesen. Man druckt es einfach noch mal aus, richtig? Aber eine der Allüren der Band bestand darin, dass man tatsächlich zum Stadion fahren und sich in einer realen Schlange anstellen musste, um reale Eintrittskarten zu erwerben – eine Art bewusste Reminiszenz an die frühen Tage des Rock ’n’ Roll. Und mein Ticket war verschwunden.
»Bei dem Chaos in deinem Zimmer frage ich mich, wie du überhaupt irgendwas findest«, hatte meine Mutter bemerkt. Das stimmte, aber wenn es vorher ein Chaos gewesen war, war das nichts verglichen mit dem Trümmerfeld, das zurückblieb, nachdem ich auf der Suche nach diesem dummen Stück Papier wie ein Tornado durch den Raum gefegt war.
Ich fuhr ohne Ticket mit meinen Freunden, um meinen Fall am Eingang vorzutragen, aber natürlich war es den Ordnern egal, wenn sie mir überhaupt glaubten. So saß ich den ganzen Abend im Auto, hörte meine Konniption-Playlist und bildete mir ein, ich wäre drinnen und würde sie live hören.
Erst eine Woche später kam mir der Gedanke, dass ich die Eintrittskarte vielleicht gar nicht verloren hatte.
Als Hunter eines Abends bei einem Freund war, unternahm ich einer Ahnung folgend in seinem Zimmer eine sehr viel weniger destruktive Suche nach meinem Ticket. Und ich wurde fündig – es lag in der obersten Schreibtischschublade unter irgendwelchen alten Hausaufgaben. Er hatte es nicht mal besonders gut versteckt.
Ich war wütend, aber bis Hunter nach Hause kam, war meine Wut in traurige Fassungslosigkeit umgeschlagen.
»Warum?«, fragte ich ihn. »Warum hast du das gemacht?«
Zuerst behauptete er, die Karte erst nach dem Konzert gefunden zu haben, aber er wusste selbst, dass die Geschichte zu lahm war, um zu tragen. Schließlich lief er rot an und sagte mit Tränen in den Augen: »Du hättest mir auch ein Ticket besorgen können, aber du bist nicht mal drauf gekommen, mich zu fragen, oder? Ich hätte es sogar von meinem eigenen Geld bezahlt.«
»Also hast du aus Trotz dafür gesorgt, dass ich auch nicht gehen konnte?«
»Ich wollte es dir zurückgeben«, beteuerte er. »Ich wollte dich nur ein bisschen erschrecken.«
»Und warum hast du es mir nicht zurückgegeben?«
Er blickte zu Boden. »Weißt du noch, wie ich zu dir gekommen bin, als du dein Zimmer durchwühlt hast? ›Vielleicht suchst du an den falschen Stellen‹, hab ich gesagt und dich gefragt, ob ich dir helfen kann.«
Daran erinnerte ich mich. Zu dem Zeitpunkt war ich schon so auf hundertachtzig, dass ich ihm erklärte, er solle verdammt nochmal verschwinden. Und als er nicht gehen wollte, warf ich mit einem vergammelten Butterbrot nach ihm. Danach verzog er sich endlich.
»Ich wollte die Karte hinter deinem Schreibtisch fallen lassen, ihn abrücken und dich das Ticket finden lassen«, erklärte er mir. »Aber du wolltest meine Hilfe nicht. Also hast du sie auch nicht bekommen.«
Natürlich war nichts davon eine Entschuldigung für das, was er getan hatte. »Ich schwöre, Hunter, manchmal kommt es mir so vor, als ob ich dich gar nicht kennen würde«, erwiderte ich. Seine Antwort darauf lässt mich bis heute schaudern.
»Du kennst mich auch nicht«, sagte er. »Du hast es nicht mal versucht.«
Ich erzählte Mom und Dad nichts von dem Ticket. So etwas ist eine Sache unter Brüdern. Stattdessen montierte ich ein besseres Schloss an meiner Tür – mit einem Code, den außer mir niemand kannte. Das weckte zwar den Argwohn meiner Eltern, was ich dadrinnen wohl anstellte, aber wenn deine eigenen Eltern nicht ein bisschen paranoid sind, machst du irgendwas falsch.
Die Sache ist die, niemand traut seinen Geschwistern vollkommen – das ist normal –, aber man zählt darauf, dass sie einem den Rücken freihalten, wenn es wirklich drauf ankommt. Hunter und ich hatten nicht mal das.
Hat Hunter meinen WarMonger 3-Spielstand also mit Absicht gelöscht? Sagt ihr es mir!
»Du kannst einen von meinen Speicher-Slots benutzen«, bot er an, ohne während seiner gesamten Entschuldigung auch nur einmal tatsächlich zu sagen, dass es ihm leidtat. »Ich war auf keiner schon so weit wie du, aber es ist besser als nichts.«
Im Moment war ich noch erschüttert wegen des Verlusts und all der vergeudeten Zeit, die ich jetzt noch einmal vergeuden musste. Aber dann dachte ich an Hunter und daran, wie er mich manipulierte. Es war wie früher, als er als kleiner Junge beim Damespielen immer Steine vom Brett genommen hatte, wenn ich nicht hinguckte. Die einzige Art zu gewinnen, war aufzustehen, wegzugehen und ihm den Triumph zu verweigern. Also atmete ich tief ein und schluckte meinen Ärger runter.
»Mach dir keine Gedanken«, sagte ich. »Eigentlich hat mir das Spiel eh nicht gefallen.«
Er hatte einen Sturm erwartet, doch meine Reaktion erwischte ihn auf dem falschen Fuß. »Aber … aber du hast doch gesagt, WarMonger 3 wäre besser als die ersten beiden zusammen.«
Ich zuckte die Schultern. »Hab ich das? Ich kann mich nicht erinnern.« Dann verließ ich das Zimmer, ohne mich umzudrehen, weil ich Angst hatte, dass er in meinem Gesicht meine wahren Gefühle lesen könnte.
Wie bist du so geworden, Hunter?, wollte ich ihn fragen, aber das habe ich nie getan. Vielleicht hatte er es von Dad, der sich immer freute, Leuten zu überteuerten Preisen Autoteile zu verkaufen, die sie nicht brauchten. Oder vielleicht auch von Mom, die so entzückt über den Schneesturm zu Weihnachten war, weil es bedeutete, dass der große teure Karibikurlaub der Nachbarn – wie wir ihn uns nie hätten leisten können – jetzt eine große teure Folge abgesagter Flüge war.
Nicht dass ich perfekt wäre – ich bin sicher, ich habe jede Menge schlechte Eigenschaften von meinen Eltern geerbt, aber Schadenfreude beim Unglück anderer zu empfinden, ist keine davon. Es sei denn, man zählt die Demütigung eines gegnerischen Teams dazu.
Obwohl der Verlust eines virtuellen Spiels im Gesamtplan der Dinge unwichtig war, schmerzte es. Ich brauchte etwas, um mich fester in meiner realen Welt zu verankern. Einen Trost für die Seele – und auch für den Magen.
Und grundsätzlich galt, immer wenn Leos Mom ihre berühmten Makkaroni mit Käse und Hummer machte, war ich eingeladen. Ich hatte nie ein schlechtes Gewissen, Berge davon zu essen, weil es laut Mrs. Johnson nicht so vornehm war, wie es sich anhörte. Ein Beutel tiefgefrorener Hummer von Vostco reichte ziemlich weit, und eine vierköpfige Familie plus einen hungrigen Schnorrer damit satt zu bekommen, war allemal günstiger als Fast Food.
»Wusstest du, dass Hummer früher ein Armeleuteessen im Nordosten war?«, fragte Leo, als wir am Tisch saßen. »Dann hatte irgendjemand die schlaue Idee, es in der feinen Gesellschaft von New York zu vermarkten, und plötzlich wurde es ein Reicheleuteessen.«
»Alles eine Frage der Wahrnehmung«, sagte sein Vater. Mr. Johnson arbeitete in der Führungsetage einer Marketingagentur, er wusste also, wovon er sprach. »Man könnte den Leuten auch Vogelkacke auf Toast verkaufen, wenn sie nur sehen, dass die richtigen Menschen sie ebenfalls essen.«
»Dad«, beschwerte sich Angela, »das ist nicht gerade appetitanregend.«
»Ich mein ja bloß.«
»Ein bisschen weniger meinen und ein bisschen mehr essen«, sagte Mrs. Johnson. »Reste sind heute der Feind. Noch eine Tupperware-Dose, und wir verlieren unsere neueste Runde Kühlschrank-Tetris.«
Nach dem Essen gingen Leo und ich in den Keller, wo er eine richtige Männerhöhle hatte, obwohl Angela sich immer über die implizierte Exklusion beschwerte und drohte, den Raum pink zu streichen.
»Du hasst Pink«, hatte Leo sie erinnert.
»Manche Dinge sind es wert, dafür ein wenig zu leiden«, hatte sie erwidert.
Das Montagabendspiel hatte bereits begonnen – die Colts gegen die Jaguars. Ich ließ mich in einen Sessel sinken und dachte, dort könnte ich es mir in meiner Komfortzone bequem machen, aber manches findet einen immer, egal, wo man sich versteckt.
»Warte mal – welches Team ist das?«, fragte ich und zeigte auf den Fernseher, wo eine Mannschaft in violetten Trikots zum nächsten Spielzug bereitstand.
»Die Colts, wer sonst?«
»Aber die Colts sind blau. Blau und weiß.
Leo sah mich seltsam an. »Nein, die Jets sind blau und weiß.«
»Die sind grün und weiß!«
»Du denkst an die Vikings.«
Ich schwang mich aus dem Sessel. »Nein! Die sind die Violetten!«
Als ich so dastand, wurde mir ein bisschen schwindelig, und ich merkte, dass ich hyperventilierte. Ich klappte den Mund zu, kniff die Augen noch fester zusammen, ließ mich wieder in den Sessel sinken und vergrub das Gesicht in den Händen. Als ich die Augen wieder öffnete, starrte Leo mich an.
»Geht es dir gut, Ash?«
Es ging mir nicht gut, aber das konnte ich nicht mit Leo besprechen. Unsere Freundschaft war wie eine Insel der Normalität in einem ansteigenden Meer. Ich brauchte Normalität und wollte ihn nicht mit in die Wellen ziehen. Derweil sah er mich an, als hätte mein Gehirn einen Insult erlitten. So nennen Ärzte die verminderte Durchblutung – Insult, eine Beleidigung –, als würde es dem Gehirn vielleicht besser gehen, wenn es nur eine gute Antwort parat hätte.
»Es ist nicht, was du denkst«, erklärte ich ihm. »Es ist nichts … Körperliches.«
»Das habe ich auch nicht behauptet«, sagte er mit einer Ruhe, die sich aufgesetzt anfühlte – also zwang auch ich mich, ruhig zu bleiben.
»Mir geht es gut«, sagte ich. »Ich hab es bloß durcheinandergebracht. Was dem einen sein Grün ist, ist dem andern sein Lila, richtig?«
Er starrte mich immer noch an, als wollte er mich fragen, wovon zum Teufel ich redete, doch dann ließ er es gut sein, und wir konzentrierten unsere Aufmerksamkeit beide wieder auf das Spiel. Aber nicht wirklich. Immerhin waren die Jaguars immer noch blau-grün und gold, auch wenn die Wildkatze auf ihrem Helm in die falsche Richtung blickte.
Während einer Werbepause drehte Leo den Ton leiser. »Weißt du noch, wie Angela vor ein paar Jahren eine Hirnhautentzündung hatte?«, fragte er völlig unerwartet.
»Ja …«
»Es hat uns alle ziemlich erschüttert. Selbst als es ihr wieder besser ging, waren meine Eltern extrem angespannt, und ich konnte nicht schlafen. Ich hab mir ständig die seltsamsten Sachen ausgemalt. Jeder Regenschauer war ein Hurrikan, jeder Wind ein Tornado. Ich machte mich auf das Schlimmste gefasst, und obwohl es nie eintraf, wappnete ich mich weiter dafür. Das haben wir alle gemacht. Verrückt, was?«
»Wow …«, sagte ich. »Das tut mir leid, Leo. Das wusste ich nicht.«
»Jedenfalls haben wir damals mit einer Ärztin gesprochen. Sie sagte, es wäre eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie hat uns geholfen, sie zu überwinden. Es war das Beste, was wir je gemacht haben.«
Das Spiel ging weiter, doch er drehte den Ton nicht wieder lauter. »Ash, wenn irgendwas in deinem Kopf rumpfuscht, ist es okay, darüber zu reden. Und wenn du nicht mit mir darüber reden kannst, ist das auch in Ordnung. Das verstehe ich. Aber wenn du willst, kann ich dir ihre Nummer geben.«
Ich schaute wieder zu dem Fernseher, weil ich Leo nicht länger in die Augen sehen konnte. »Danke, Leo«, sagte ich. »Vielleicht nach dem Spiel.« Doch noch während ich das sagte, wusste ich, dass alle Gespräche der Welt mein Problem nicht lösen würden. »Aber könntest du für den Augenblick vielleicht … einfach … die Farbe rausdrehen? Einfach alles schwarz-weiß machen wie früher?«
Er sah mich an, und ich dachte, er würde eine Erklärung verlangen. Aber schließlich nahm er die Fernbedienung und sagte: »Das kann ich machen.«
Er tippte auf ein paar Knöpfe, und ich beobachtete, wie die Farben verblassten und dann ganz verschwanden. Und auch wenn es mich nicht restlos beruhigte, verengte es die Bandbreite meines Stresses auf den schlichten Unterschied zwischen Licht und Schatten.
»Bitte sehr«, sagte Leo. »Schwarz-weiß. Genau wie früher.«
Der Rest der Woche verlief so unspektakulär normal, dass ich mich von einem falschen Gefühl der Sicherheit einlullen ließ. Die Leute sprechen von »dem Elefanten im Raum«, aber ich redete mir diese Sache mit den Farben so lange klein, bis sie eher eine Maus in der Ecke war, ein verrückter Ausreißer in einer ansonsten rationalen Welt. Und wenn ich nervös wegen unseres nächsten Spiels war, dann verdrängte ich auch das.
Es gab keinen Grund zu der Annahme, dass sich das, was am vergangenen Freitag passiert war, wiederholen würde. Und so war es auch. Ganze drei Quarter lang. Das vierte Quarter war hingegen eine vollkommen andere Geschichte.
Es waren nicht mal mehr fünf Minuten zu spielen. Das gegnerische Team hatte ein drittes Down, mit Option auf Touchdown und Field Goal. Wir lagen sechs Punkte zurück, und der Quarterback der anderen Mannschaft warf Bälle wie ferngelenkte Raketen. Ich wusste, dass ich ihn zu Boden reißen musste, bevor er den Pass zum Touchdown spielen konnte.
Es begann wie ein normaler Spielzug – und vielleicht war es das für alle anderen auch. Der Center reichte den Ball durch die Beine zu dem hinter ihm stehenden Quarterback. Ich griff die Offensive Line an, schlüpfte durch sie hindurch wie ein eingefetteter Eber und hielt direkt auf den Quarterback zu. Ich fühlte mich schnell und stark wie eine Lokomotive.
Diesmal geschah es in dem Moment, in dem ich den Quarterback rammte und umriss.
Ich spürte den Aufprall. Ich spürte den eisigen Augenblick – und hatte diesmal tatsächlich das Gefühl, seitwärtszugleiten, aber das dauerte wie das Kältegefühl nur den Bruchteil einer Sekunde.
Und dann lief ich mit dem Rest der Defensive vom Feld. Ich erinnerte mich nicht daran, auf dem Boden aufgeschlagen und wieder aufgestanden zu sein. Ich musste den Quarterback getackelt haben, denn das gegnerische Team kickte den Ball aus der Hand möglichst weit in unsere Hälfte. Ich musste mindestens fünf, vielleicht zehn Sekunden verloren haben, und dieser seltsame Wirrwarr in meinem Kopf – der schmerzlose Kopfschmerz – war zurück.
Ich sagte mir, dass es nichts war. Ich hatte ein Spiel zu absolvieren und konnte mich von so was nicht aufhalten lassen. Was immer es war, was immer es zu bedeuten hatte, es konnte warten. Soweit ich wusste, war alles wieder normal, und das war das Ende der Geschichte.
Wir gewannen im Sudden Death und untermauerten mit