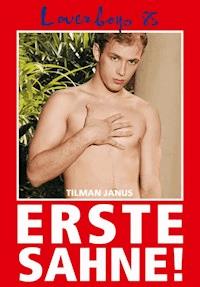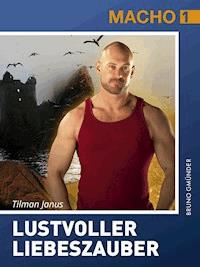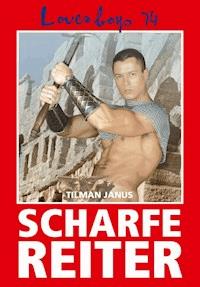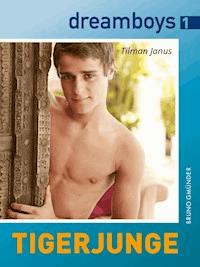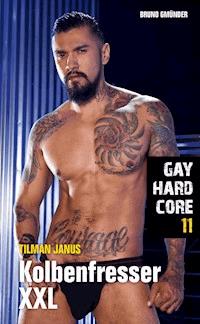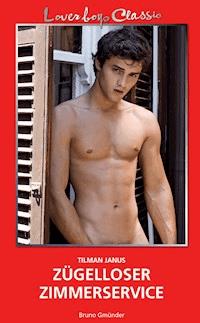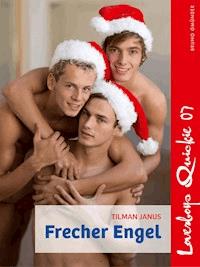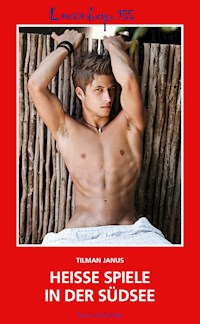Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bruno Gmünder Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Gay Hardcore
- Sprache: Deutsch
Der hübsche junge Adelsspross Maximilian von O. hält es nicht mehr aus: Ungeoutet lebt er auf dem Schloss seiner konservativen Großeltern und sehnt sich nach hartem Männersex. Aber mehr als harmlose Spielchen mit Schulfreunden laufen nicht. Als er endlich 18 ist, entflieht er dem adligen Muff und schließt sich einer Jugendgang an. Der geile Gang-Chef Dino hat zwar eine Freundin, nimmt Max aber heimlich grob ran. Komplett ausgeliefert, macht er alles, was Dino von ihm verlangt - und das ist genau das, was der verwöhnte Blaublüter braucht. Doch niemand darf von der Affäre wissen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2015 Bruno Gmünder GmbH Kleiststraße 23-26, D-10787 [email protected] © 2015 Tilman Janus Coverabbildung: © 2015 cockyboys.com (Model: Anthony Romero) eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-95985-052-0
Mehr über unsere Bücher und Autoren:www.brunogmuender.com
Die in diesem Buch geschilderten Handlungen sind fiktiv.
Im verantwortungsbewussten sexuellen Umgang miteinander gelten nach wie vor die Safer-Sex-Regeln.
Für J.
Heißer Saft auf kaltem Glas
Es war dunkel und eisig kalt. Ich stand in einem Wäldchen, das ich im Internet als Cruising-Treffpunkt ausgemacht hatte, und fror mir fast den Hintern ab. Cruising im Januar ist eine blöde Idee. Aber zwischen meinen Schenkeln, wo die Jeans immer irgendwie zu eng sind, kochte es, da merkte ich den Frost nicht.
Ewig nur selbst Hand anlegen ist einfach öde. Ich hatte vor ein paar Tagen meinen achtzehnten Geburtstag abgehakt und war immer noch »unschuldig«. Ätzend!
Etwas raschelte im kahlen Gebüsch. Sollte sich doch noch ein Typ trotz Schnee und Eis an diesem Freitagabend hierher verirrt haben?
Ich sah eine gewaltige Silhouette, die sich wie ein Koloss vor die dünne, tief hängende Mondsichel schob. Mein Herz klopfte stärker – vor Angst! Das Wäldchen gehörte zu einer privaten Jagdpacht, nachts war man total auf sich gestellt. Hier hätte mir niemand geholfen, da hätte ich noch so laut schreien können. Es gab keinen Menschen sonst weit und breit.
Der Koloss näherte sich. Der Kerl schien ein Hüne zu sein, viel größer und kräftiger als ich. Ich bin einen Meter sechsundsiebzig groß. Der Riese schob sich durch die Sträucher, die blattlosen Zweige peitschten zurück. Ich hätte weglaufen können. Doch ich blieb stehen wie angewurzelt. Mein Schwanz stand steinhart. Aus dem Slip war er längst hinausgewachsen. Der harte Jeansstoff kratzte an meiner empfindsamen Eichel. Was war es, das mich hielt, trotz meiner Angst? Ich wusste es nicht.
Jetzt stand der Kerl direkt neben mir. Ich roch kalten Zigarettenrauch, der an seiner Daunenjacke haftete und die frische, klare Winterluft verdrängte. Wie würde seine Männlichkeit riechen? Wie stark könnte er sein? Wie grob, wie sanft? Ich begann, leicht zu zittern. Würde er mich aufspießen, einfach so? Würde er mir sein Sperma ins Gesicht spritzen? Oder in die Augen pissen? Meine Finger krampften sich zusammen.
»Stehst du auf Rimming?«, brummte er heiser.
Scheiße! Was ist Rimming?, dachte ich. Ja!, wollte ich sagen, egal, was er erwartete. »Nein«, flüsterte ich. Die Angst hatte gesiegt. Würde er mich nun bestrafen für meine Weigerung? Mein Atem ging plötzlich flach.
Der Hüne stieß ein abschätziges Gebrabbel aus, eine Mischung aus Spott und Fluchen. Dann wandte er sich um und stampfte durch die Sträucher davon. Der Schnee knirschte unter seinen schweren Stiefeln.
»Warte!«, schrie ich ihm nach. Doch ich hatte nicht geschrien, nur gehaucht. Er hörte mich nicht mehr.
In mir ballten sich Wut und Wildheit zusammen. Was war ich doch für ein Idiot, Dummkopf, Angsthase, für ein durch und durch bekloppter Typ! Erregt riss ich die Knöpfe meiner Jeans auf und zerrte mein hartes Teil heraus in die Frostluft. Die Kälte machte ihm nichts aus. Ich wichste los, rücksichtslos und gefühllos, und heulte vor Wut über mich selbst. Meinem Ständer war es egal, er wollte sich entladen nach so viel enttäuschter Erwartung, er wollte nicht gehätschelt und getätschelt werden, sondern abgewichst und abgemolken. Ich kam schnell und heftig und brüllte dabei, dass es von den Baumstämmen des nächtlichen Winterwaldes widerhallte. Mein Sperma schien den Schnee zu verbrennen, es sank tief ein, weiß auf weiß.
Ein paar Minuten später saß ich auf meiner weißschwarzen Ducati Monster 696, den Integralhelm aufgestülpt, und jagte über die Landstraßen durch die Nacht zurück nach Hause. »Nach Hause« war nur die Bezeichnung für meinen Wohnort, für das Haus meiner Großeltern. Als mein wirkliches Zuhause empfand ich es nicht. Es handelte sich auch nicht um ein gewöhnliches Haus, sondern um ein ausgewachsenes Schloss im Taunus, dem Mittelgebirge nordwestlich von Frankfurt. Manch einer mochte mich beneiden um diese feudale Wohnstatt, aber derjenige kannte nicht die riesigen Nachteile.
Im Hochtaunus ist es immer kälter als in der Ebene, es regnet und es schneit mehr. Die Berge haben Namen wie »Grauer Stein« oder »Kalte Herberge«. Das sagt schon eine ganze Menge.
Unser Schloss liegt auf einem Hügel mitten in einem kleinen Ort. Der Name des Dorfes tut nichts zur Sache. Die alten Fachwerkhäuser umgeben den nur mäßig großen, ringförmigen Schlosspark auch wieder ringförmig. Für mich war dieser Ring immer ein Symbol – wie abgewürgt von der Außenwelt, abgeschnitten vom normalen Leben.
In den ersten drei Schuljahren hatte ich sogar nur Hauslehrer gehabt, war also noch mehr von aller Welt isoliert gewesen. Dann hatte ich dagegen rebelliert und durfte endlich eine normale Schule besuchen. Doch von meinen Schulkameraden wurde ich deshalb noch lange nicht normal behandelt. Hinter vorgehaltener Hand tuschelten sie: »Das ist der Graf!« – »Der ist sogar Herzog!« – »Quatsch, bloß niederer Adel!« – »Ja, ganz niedrig!« – »Die haben aber zehn Kammerdiener!« – »Und acht Köche!« – »Und eigene Pferde!« – »Und zwölf Superautos!« – »Und eine Schatzkammer!« – »Und sie schlafen in seidenen Betten!« Und so weiter und so weiter. Ich bekam das alles mit. Viel stimmte davon nicht.
In Wahrheit hatten wir einen Kammerdiener und eine Köchin, dazu zwei Haushaltshilfen und einen Chauffeur, außerdem einen Gärtner. Keine Pferde, keine seidenen Betten, keine Schatzkammer und nur eine einzige Limousine. Die genaue Lage des Schlosses und unseren vollständigen Familiennamen will ich aus Rücksicht auf die Verwandtschaft nicht nennen, nur so viel sagen, dass dieses Schloss ziemlich groß ist. Es hat zwei Stockwerke und zur Rückseite hin zwei dicke, runde Türme. Der finstere Bau war im Mittelalter begonnen und später zum Wohnschloss umgestaltet worden. Was nicht bedeutete, dass er wirklich wohnlicher wurde. Und natürlich war der Adelssitz an mehreren Tagen pro Woche für Besichtigungen geöffnet, was das Wohnen dort auch nicht angenehmer machte.
Irgendwie kam bei mir nie ein Heimatgefühl auf in diesem Gemäuer. Im Winter waren viele Räume kalt und ungemütlich. Der mit dunklem Holz vertäfelte Speisesaal sah riesig aus, der Salon mit Konzertflügel und Harfe wirkte wie ein Museumsraum. Auch mein eigenes Zimmer erschien mir immer sehr groß und düster. Durch die dicken Mauern wirkten die Fenster fast wie Schießscharten. Nicht einmal die Strahlen der Sommersonne trauten sich wirklich herein. Als Junge kannte ich es zuerst nicht anders, trotzdem hatte ich von Anfang an dieses heimatlose Gefühl.
Vielleicht lag es auch daran, dass ich ohne die wärmende Fürsorge meiner Eltern aufwuchs. Meine Großeltern Richmar und Doris von O. hatten mich aufgezogen. Sie waren in jenem Januar, als ich achtzehn wurde, beide zweiundfünfzig, also nicht wirklich alt. Bereits mit vierunddreißig waren sie Oma und Opa geworden, eine verdammt kurze Generationenfolge. Richmar und Doris erzählten offen, dass sie beide erst achtzehn Jahre alt gewesen waren, als ihre einzige Tochter Diana geboren wurde. Sie machten jedoch ein Riesengeheimnis um diese Diana, die doch immerhin meine Mutter war. Wenn mich meine Mathematikkenntnisse nicht total täuschten, musste Diana mich mit zarten sechzehn Jahren zur Welt gebracht haben. Kurz danach war sie zusammen mit meinem Vater durch einen Unfall ums Leben gekommen. So wurde es mir immer wieder erzählt. Was mich aber schon ziemlich früh verwunderte, war die Tatsache, dass für meine Mutter ein aufwendiges Grab im kleinen Familienmausoleum hinten im Schlosspark existierte, von meinem Vater jedoch jede Spur fehlte. Als ich älter wurde, staunte ich darüber, dass sowohl Diana als auch meine Wenigkeit den Adelsnamen »von O.« trugen. War meine Mutter mit meinem Vater nicht verheiratet gewesen? Die Großeltern sagten, mein Vater habe den schöneren Namen seiner Frau angenommen. Doch wo sich sein Grab befand, konnten sie mir nicht überzeugend erklären.
Diana wurde von ihnen verehrt und verklärt. Ich war eigentlich auf meine Mutter sauer, denn sie hatte mir eine Reihe schrecklicher Vornamen verpasst. Kurz vor meiner Geburt soll sie den alten Film »Rebecca« von Hitchcock etwa zehnmal verschlungen haben und närrisch gewesen sein nach der Hauptfigur Maxim de Winter, einem Spross alten britischen Adels. Nach ihm hatte sie mich »George Fortescue Maximilian« genannt, und ich konnte von Glück sagen, dass mein Rufname wenigstens »Maximilian« wurde und nicht »George« oder »Fortescue«! Aus Rücksicht auf ihre verblichene Tochter nannten mich die Großeltern immer »Maxim«. Grässlich! Ich selbst ließ mich am liebsten einfach »Max« rufen.
Übrigens nannte ich die Großeltern aus Rache »Grandpa« und »Grandma«, obwohl sie – bis auf »Rebecca« – alles Englische und Amerikanische hassten. Später las ich einmal den berühmten Roman »Rebecca«, nach dem der Film gedreht worden war, und stellte fest, dass mein Namenspatron Maxim de Winter eigentlich ein Mörder war. Als ich jedoch den Film anschaute, gefiel mir Laurence Olivier, der den Maxim spielte, dermaßen gut, dass ich mich mit allem versöhnt fühlte. Ein dunkelhaariger Mann, so gut aussehend, dass man ihn schon als schön bezeichnen musste, geisterte immer wieder durch meine Träume, und in den Zeiten der Pubertät waren diese Träume sehr, sehr feucht, eigentlich schon nass, denn bei der Verteilung der Spermaproduktion hatte ich wohl zweimal »Hier!« gerufen. Ich verspritze einfach Unmengen an Sahne!
Ich rollte meine Ducati in die Garage, legte Helm und Handschuhe auf eine Ablage und ging durch einen Nebeneingang ins Schloss. Mein Zimmer lag im zweiten Stock. Langsam schritt ich die breite Treppe hinauf. Ich dachte an den schrankkofferartigen Typen im Cruising-Wäldchen. Bestimmt wäre er völlig harmlos gewesen. Oder nicht? Dann fiel mir etwas ein. Ich blieb auf der Treppe stehen, zog mein iPhone und googelte nach »Rimming«. Aha, also Arschlecken. Hätte ich das bei dem nach kaltem Rauch stinkenden Schrankkoffertypen gemacht? Ich zuckte mit den Schultern und ging weiter. Sowieso vorbei, die Gelegenheit!
In meinem Zimmer angekommen, zog ich mich aus und duschte. Ich hatte ein eigenes Badezimmer und betrachtete mich beim Abfrottieren im bodentiefen Spiegel. Schlank und gut gebaut war ich auf jeden Fall, kein Muskelprotz, aber auch kein dürrer Strohhalm. Meine Augen blickten mir groß und sehr intensiv blau aus dem Spiegel entgegen, dafür sahen meine Haare eher durchschnittlich aus, dunkelblond und schlicht, aber wenigstens sehr dicht. Ich trug sie zu der Zeit etwas länger als der Normalbürger. Meine Haut wirkte glatt und leicht gebräunt. Ich hatte zum vorletzten Weihnachtfest eine eigene Sonnenbank geschenkt bekommen. Die Körper- und Schwanzhaare rasierte ich mir immer total ab, gefiel mir einfach besser.
Während ich mich vor dem Spiegel drehte wie ein eitler Pfau und meinen recht großen Schwanz und den für mein Alter sehr kompakten, dicken Sack streichelte, stellte ich mir einen schönen, schlanken, schwarzhaarigen Mann vor, der neben mir stehen und mich umarmen würde, so nackt wie ich. Unsere Schwänze würden sich aufrichten und wie mittelalterliche Schwerter überkreuzen. Und dann sollte er mich nehmen, mich endlich entjungfern, mich vollspritzen mit seinem Samen … Seufzend begann ich, noch einmal zu wichsen. Komm, schöner Fremder!, dachte ich. Komm! Meine Hand wurde schneller und schneller. Im weiten Bogen schoss mein Saft auf den Spiegel und lief in langen Schlieren über das kalte Glas. Wo war er, der schöne Fremde? Würde ich ihm je begegnen?
Ein Stück Fleisch
Du bist gestern sehr spät nach Hause gekommen, Maxim!«, rügte mich Doris am Samstagmorgen beim Frühstück. Wiktor, unser polnischstämmiger Kammerdiener, fünfundvierzig Jahre alt, servierte den Kaffee und hielt sich stumm und vornehm zurück.
»Ich bin achtzehn, Grandma!«, entgegnete ich sanft.
»Du warst bei Glatteis mit diesem schrecklichen Motorrad unterwegs. Man wird sich wohl noch Sorgen machen dürfen«, schnappte Doris ein.
Ich war zu gut erzogen, um eine Szene zu machen. Immer vornehm und gemäßigt, das war die Leitlinie, nach der die Familie lebte, und ich musste mich danach richten. Ich hätte gerne einfach mal laut geschrien oder getobt. Was wäre wohl geschehen, wenn ich mich geoutet hätte? »Ich bin schwul, mir platzen die Eier vor Geilheit, und ich will einen Kerl!«, hätte ich diesen blasierten Menschen gerne ins Gesicht gebrüllt. Okay, ich tat es nicht. Mir fehlte der Mut, ich war eher ein Träumer. In der Fantasie war ich ein Superheld, der hübschen Jungs in Bedrängnis zu Hilfe eilte. Zum Dank mussten sie es mir dann kräftig besorgen. Ach, leider nur Träume, Träume, Träume …
»Maxim fährt doch bestimmt sehr umsichtig«, mischte sich Richmar ein. »Er ist immer ein sehr braver Junge.«
Ich seufzte lautlos. Das war das Image, das mir anhing! Ronny fiel mir ein. Ich hatte wegen sehr guter Noten ein Schuljahr übersprungen und mit dem neunzehnjährigen Ronny gleichzeitig im letzten Sommer Abitur gemacht. Ich glaubte, dass er der Einzige in meiner Schule war, der möglicherweise – möglicherweise, was für ein blödes Wort! – schwul sein könnte. Könnte! Ich hätte mich gern in eine Stadt beamen lassen, die bis an die Außenmauern mit schwulen Kneipen, Cruising-Plätzen und obergeilen Typen vollgestopft sein müsste. Träume … Aber vielleicht kam ich wenigstens irgendwie an Ronny heran!
»Ich bin heute verabredet«, sagte ich möglichst gleichgültig. »Ich werde zum Mittagessen nicht hier sein.«
»Verabredet?« Doris zog eine ihrer fein nachgezogenen Augenbrauen hoch. »Mit einer früheren Klassenkameradin?«
Sinnlos, ihr das heute übliche Kurssystem an den Oberschulen zu erklären, das den Klassenverband ausgelöscht hat. Sinnlos, ihr zu erklären, dass ich natürlich nicht mit einem Mädchen verabredet war. »Ja, ja«, murmelte ich, stopfte mir den Rest des Lachsbrötchens in den Rachen, spülte mit Kaffee nach und sprang auf.
»Man wartet, bis alle mit dem Essen fertig sind, bevor man aufsteht!«, giftete Doris mir nach.
Sinnlos, alles sinnlos!
Auf dem Weg zur Garage begegnete mir Bernd, unser Chauffeur. Er war fünfunddreißig, dunkelhaarig und hatte braune Augen. Dabei fiel mir zum ersten Mal bewusst auf, dass alle unsere männlichen Angestellten – Wiktor, Bernd und der dreißigjährige Gärtner Peter – dunkle Haare und braune Augen hatten. Zufall?
»Guten Morgen, Herr Graf!«, sagte er mit einem frechen Grinsen.
»Was nennt er mich Graf?«, erwiderte ich mit einer perfekt gespielten Hoffärtigkeit. »Soll ihn der Teufel holen!«
Wir lachten zusammen. Ich verstand mich gut mit Bernd. Er putzte mir immer meine Ducati. Ich hätte mich sehr gerne von ihm ficken lassen. Übrigens auch von Peter oder sogar von Wiktor. Sie waren alle drei keine Schönheiten. Doch das Aussehen wäre mir erst einmal egal gewesen, auch das Alter. Aber es war einfach unmöglich, hier im Schloss, in der Nähe der Großeltern. Es wäre herausgekommen, es hätte einen schrecklichen Skandal gegeben, und die armen Männer hätten ihre Stellung verloren. Wieder einmal hatte ich Angst. Aber vermutlich waren meine Wünsche auch deshalb total daneben, weil alle drei Angestellten Heten waren. Wer wusste das schon so genau? Ich nicht!
Eigentlich hätte ich Ronny erst anrufen müssen, ob er Zeit hatte, ob er überhaupt zu Hause war. Doch ich wollte weg vom Schloss, bloß weg! Wenn Ronny nicht da wäre, würde ich mir etwas anderes einfallen lassen.
Offiziell studierte ich seit dem letzten Herbst Zahnmedizin. Doris hatte das so lanciert, dass ich einen der knappen Studienplätze in Frankfurt bekommen hatte, sie kannte den damaligen Präsidenten. Sie bestand allerdings darauf, dass ich jeden Tag die weite Strecke vom Schloss bis nach Frankfurt fahren sollte. Dazu hatte ich wirklich keine Lust, selbst wenn Bernd mich mit dem Wagen gebracht hätte. Ich wollte ein eigenes Zimmer in Frankfurt haben, vielleicht in einer WG, doch das erlaubten die Großeltern nicht. Sie wollten mich unter Kontrolle behalten. Also machte ich gar nichts. Nun war ich achtzehn, ich hätte mich absetzen können. Nur das Finanzielle war der weiche Punkt. Ohne Geld konnte ich mir kein Zimmer nehmen, und zum Jobben fehlte die Zeit, wenn ich ernsthaft studieren sollte. Ich hatte mich außerdem an das faule Leben gewöhnt und den Absprung noch nicht geschafft.
Ronny wohnte in einem bescheidenen, alten Fachwerkhaus am südlichen Rand des Dorfes. Seine Eltern arbeiteten als Busfahrer und Hostess für einen kleinen Reiseveranstalter, sie fuhren immer im Team, deshalb war Ronny oft allein. Gut für mich!
»Hab dich schon gehört!«, sagte er zur Begrüßung, als er mir die Tür aufmachte, bevor ich klingeln konnte. Ich hatte Glück, er war gerade erst aufgestanden.
»War ich so laut?«
»Du nicht, aber dein Bike!« Er grinste. »Darf ich ne Runde drauf drehen?«
»Klar!« Ich gab ihm den Schlüssel.
Ronnys Eltern konnten ihm kein Motorrad finanzieren. Auch gut für mich! So konnte ich etwas für ihn tun und hoffen, dass er dann auch mal etwas für mich tun würde.
Ronny hatte keinen Führerschein. Er fuhr trotzdem wie ein alter Hase, war einfach ein Naturtalent. Ich hätte ihm auch einen teuren Ferrari anvertraut, wenn ich einen besessen hätte. Doch ich mochte Autos nicht besonders. Das Direkte, der Druck des Windes auf der Brust, das Gefühl, auf einem wilden Tier zu sitzen, das nur aus Stahl und Kraft bestand – das liebte ich mehr. Die Ducati Monster war ein »Naked Bike«, ein Krad ohne Verkleidungen. Wunderschön!
Ich schaute Ronny zu, wie er auf dem Vorplatz umherkurvte. Er war etwa so groß wie ich und sah nicht schlecht aus. Dunkelhaarig! Ein bisschen zu mager war er mir, aber scheiß drauf – wenn er doch nur schwul gewesen wäre!
Plötzlich brauste er auf die Dorfstraße hinaus und entschwand aus meinem Blickfeld. Ich lächelte vor mich hin, während ich auf ihn wartete. Sorgen machte ich mir nicht.
Nach zehn Minuten war er wieder da. Seine braunen Augen leuchteten in der Wintersonne.
»Super!« Er stieg von der Ducati und streichelte noch einmal den Lenker. Er wollte sich gar nicht trennen von der Maschine.
»Sind deine Eltern zu Hause?«, erkundigte ich mich.
Ronny schüttelte den Kopf. »Komm doch rein!«
Ich folgte ihm ins Haus.
Ronnys Zimmer war winzig im Vergleich zu meinem »Schlossgemach«, doch ich hätte gerne mit ihm getauscht.
»Bier?«, fragte er.
Ich lehnte dankend ab. Bier mochte ich nicht. »Wasser! Wenn du hast!«
»Wasser! Kannst du dir Schnee von draußen auftauen!« Dann holte er doch ein Mineralwasser und für sich eine Dose Bier aus der Küche. Wir setzten uns auf sein schmales Bett. Ronny stellte Musik an, Heavy Metal.
»Hattest du schon mal was mit einer Frau?«, fragte ich. Irgendwie musste ich ja mal anfangen mit allem.
Er schwieg eine Weile lang. »Warum fragst du?«, gab er dann gedehnt zurück.
»Nur so … «
»Du?«
»Nein!«
»Du siehst doch gut aus.«
»Na und?«
»Laufen dir die Weiber nicht nach?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Achte ich nicht so drauf.«
»Schwul?«
»Und du?«
Er schwieg wieder.
»Hattest du nun eine Frau oder nicht?«, bohrte ich nach.
»Jaa … «, brabbelte er.
»Wen?«
»Kennst du nicht.«
»Also hattest du keine!«
»Warum interessierst du dich so dafür?«
Ich holte tief Luft. »Ich hab Lust zum Wichsen.«
Ronny starrte mich an. Er sagte nichts mehr. Seine Hand wanderte zu seinem Schwanzpaket und presste sich fest an. Ich konnte sehen, wie sein Teil wuchs, und das machte mich ganz verrückt vor Geilheit. Da hatte ich so lange überlegt, mir vergeblich den Arsch abgefroren im Cruising-Wäldchen, aber hatte mich nicht getraut, Ronny einfach zu fragen. Langsam ließ ich die Finger zu meinem Hosenstall gleiten und machte die Jeansknöpfe auf.
Ronny sah mir fasziniert zu. Zum ersten Mal im Leben holte ich meinen Schwanz vor den Augen eines anderen heraus. Nie hatte ich in der Schule geduscht nach dem Sport, nie hatte ich gepinkelt, wenn ein anderer zugesehen hatte. Immer hatte ich Angst gehabt, dass mein Rohr steif und geil geworden wäre und mich verraten hätte.
Die Sehnsucht von Jahren ließ meinen Schwanz aus den Jeans wachsen und in Sekunden hart werden. Da griff Ronny zu und packte meinen Schaft. Ich hätte fast geschrien vor Geilheit. Endlich eine andere Hand! Endlich ein anderes Gefühl! Ich suchte mit meiner Linken nach Ronnys Kolben, wühlte in seinem Hosenschlitz. Es war warm und leicht feucht dort. Endlich ein fremdes Männerglied! Endlich begann mein Leben! Meine Finger schlossen sich um Ronnys Teil. Es war nicht besonders groß, doch das war mir gleich. Ich fühlte seine glatte, warme Haut, nur das. Meine ganze Wahrnehmung verengte sich auf dieses schmale Stück Fleisch, das in meiner Hand lag und leicht klopfte.
Wir begannen, uns gegenseitig zu wichsen. Ronny wusste natürlich nicht, wie ich es am liebsten hatte, und ich war mit der linken Hand auch nicht besonders geschickt. Aber es war mein erstes Mal! Irgendwann würde er ihn mir in den Mund stecken, irgendwann würde er mich ficken, ganz bestimmt! Die Erregung quirlte in meinem Unterbauch. Keine Schmetterlinge, nein, das waren größere und kräftigere Tiere! Mir war, als ob hundert Nashörner auf meinen Nervenenden herumtrampelten. Ich hatte es immer geahnt, dass ich Kerle brauchte, aber nun wusste ich, dass ich ohne sie nicht leben konnte.
Da lief mir etwas warme Suppe über die linke Hand. Ronny war gekommen, ganz plötzlich und unspektakulär. Und doch genügte sein matter Orgasmus, um mich zu einer Spitzenleistung zu bringen. Mein ganzer Körper spannte sich an. Mit Macht schoss mir der Samen aus der Eichel und spritzte im weiten Bogen auf Ronnys Teppich. Fünf Schüsse brachte ich, während Ronny mich weiter durchwalkte. Ich keuchte laut. Das Nachbeben hielt mich noch eine ganze Minute lang im Griff.
Wir saßen auf Ronnys Bett, lehnten uns mit dem Rücken an die Wand und starrten beide vor uns hin. Inzwischen hatten wir uns wieder angezogen. Die nassen Flecken von mir auf dem Teppich waren riesig.
»Ist das immer so viel bei dir?«, fragte Ronny irgendwann.
Ich nickte nur. Mein Hals war noch wie zugeschnürt von der Lust – und von der Angst, die sich nun wieder in mir ausbreitete. Die Angst, dass meine Großeltern alles erfahren würden.
»Wow!«, machte Ronny.
Die Heavy Metal Kids sangen »Blow It All Away« vom Album »Hit the Right Button«. Den richtigen Knopf drücken – genau das hatte ich zum ersten Mal getan. Bestimmt gab es noch viele Knöpfe, die Spaß und Sex bedeuteten – ich musste sie unbedingt finden! Ob mir das gelingen würde?
Leder und Gold
Nach diesem Samstag traf ich mich öfter mit Ronny. Wir redeten nie viel. Er fuhr immer eine Zeit lang mit meiner Ducati, dann wichsten wir. Immerhin verriet er mich nie, alles blieb unter uns. Meine Hoffnung auf mehr musste ich allerdings begraben. Einmal sagte Ronny mir, dass er nicht schwul sei. Ich glaubte das nicht, aber wenn er es sich selbst einreden wollte, dann konnte ich ihn nicht daran hindern. Ich spürte ohnehin, dass Ronny mir nicht das geben konnte, was ich brauchte. Was brauchte ich eigentlich?
An manchen Tagen fühlte ich mich innerlich zerrissen, besonders nach wüsten Träumen. Da ich noch nie wirklichen Sex kennengelernt hatte, war das Gefühl im Traum seltsam unbestimmt und unkörperlich. Manchmal träumte ich, dass Bernd, der Chauffeur, mich verfolgte. Sein Schwanz ragte dabei aus seiner Chauffeursuniformhose. Ich rannte weg, bis ich nicht mehr konnte. Dann winselte ich um Gnade, doch er ließ nicht von mir ab und jagte mich weiter. Nach dem Aufwachen fragte ich mich, warum ich so etwas geträumt hatte. Der Hüne vom Cruising-Wäldchen kam mir wieder in den Sinn. Auch von diesem fremden Kerl hatte ich einmal etwas Ähnliches geträumt. Doch es sollte noch eine Weile dauern, bis ich meine Gefühle verstand.
Ende Januar gab es auf dem Schloss ein großes Fest. Grandpa Richmar feierte seinen Geburtstag immer sehr aufwendig. Er nutzte die Gelegenheit, einmal im Jahr alle Verwandten wiederzusehen. Ich mochte diese familiären Großereignisse nicht besonders. Verwandtschaft fand ich öde. Die alten Tanten fragten mich, ob ich mir denn nicht endlich eine Freundin »anschaffen« wollte, und die alten Onkel fragten, ob ich denn mein Studium nun schon begonnen hätte. Die Cousinen präsentierten mir ihre hochgepolsterten Brüste, und die Cousins versuchten, mich mies zu machen. Eine reizende Gesellschaft!
Doch in diesem Jahr erfuhr ich eine interessante Neuigkeit, die mich den ganzen Rummel vergessen ließ. Großonkel Hoimar, ein ehemaliger Bankmanager, der Bruder von Grandpa, traf mich im Schlosspark, als ich gerade vor dem nervenden Volk ausrücken wollte. Hoimar war neun Jahre älter als sein Bruder Richmar und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich war, recht nett. Zumindest nannte er mich nie »Maxim«!
»Max!«, rief er mir nach. »Warte doch mal!«
Pflichtschuldig drehte ich mich um. »Ja, Onkel Hoimar?«
Der alte Herr klopfte die Asche seiner Zigarre ab, fasste mich am Arm und betrachtete mich wohlgefällig. »Du hast wirklich viel Ähnlichkeit mit Adrian«, sagte er.
»Adrian? Meinst du meinen Vater?« Viel mehr als den Vornamen wusste ich ja nicht von meinem Erzeuger.
Hoimar nickte. »Deine schönen, blauen Augen hast du von Diana, zweifellos, aber das dichte Haar, das Gesicht, die Stirn, diese gerade Nase, sogar die hübschen Lippen … und die Figur …« Er beguckte mich für meinen Geschmack etwas zu intensiv. »Ja, das ist Adrian! Weißt du, Max, ich mochte deinen Vater gern. Er hat übrigens graue Augen.«
»Hat? Er ist doch längst tot«, gab ich zurück.
Der Onkel sah mich eine Weile lang nachdenklich an und paffte seine Zigarre dabei. »Doris will es so«, sagte er schließlich und senkte dabei seine Stimme. »Aber ich finde, du bist nun alt genug, um die Wahrheit zu erfahren.«
»Welche Wahrheit, Onkel Hoimar?« Die Spannung stieg bei mir.
»Sei jetzt bitte nicht schockiert, Max!« Er strich sich das volle, graue Haar zurück. »Dein Vater ist nicht tot. Ihm geht es gut. Hoffe ich wenigstens.«
Ein Teil meiner alten Welt brach zusammen. Da hatten mich die Großeltern also achtzehn Jahre lang belogen! Ich schnappte nach Luft.
»Ganz ruhig!«, sagte Hoimar und umfasste freundschaftlich meine Schultern. »Das war damals eine dumme Geschichte. Diana war so wohlerzogen und schüchtern und gar nicht auf das Leben vorbereitet. Und dann verliebte sie sich Hals über Kopf in ihren Klavierlehrer. Adrian war nur zwei Jahre älter als sie. Die Hormone gingen wohl mit den beiden durch, und Diana wurde schwanger – mit fünfzehn! Richmar und Doris akzeptierten diese unstandesgemäße Verbindung nicht, das kannst du dir denken. Sie jagten Adrian zum Teufel. Ich habe ihm damals noch mit Geld ausgeholfen. Mehr konnte ich nicht tun. Und dann … na ja, das weißt du ja, wie es mit deiner Mutter endete.«
»Ein Unfall«, murmelte ich. Ich stand noch ziemlich unter dem Schock dieser Neuigkeiten.
»Ach«, machte der Onkel.
»Kein Unfall?«
Er schüttelte den Kopf. »Sie … hatte kurz nach deiner Geburt eine schwere Depression … und hat sich umgebracht.«
Ich stand stumm da, unfähig, auch nur ein Wort zu sagen.
Hoimar streichelte meine Hand tröstend. »Es ist nun alles sehr lange her. Und ob sie mit Adrian auf lange Sicht glücklich geworden wäre … das weiß ich nicht. Wohl eher nicht.«
»Warum?« Meine Stimme krächzte irgendwie. Ich räusperte mich.
»Adrian war ein ganz anderer Typ als sie, er kam aus einer sehr armen Pianistenfamilie, lebte hauptsächlich für seine Musik. Er war damals außerordentlich lebhaft, voller Ideen, voller Leben. Er hatte regelrecht revolutionäre Ansichten … « Er zögerte. »Na ja, so viel weiß ich auch nicht über ihn.«
»Sie haben also nie geheiratet?« Ich atmete sehr tief durch.
»Nein. Richmar hätte es vielleicht erlaubt und beim Familiengericht eine Erlaubnis für die minderjährige Diana beantragt, aber Doris war strikt dagegen.«
»Dann hat er auch nicht den Namen ›von O.‹! Wie heißt er?«
»Adrian … Aber verrat mich nicht bei deinen Großeltern!« Er paffte wieder mächtig. »Adrian Krieger.«
»Krieger … Hast du ein Bild von ihm? Hier gibt es gar nichts, nicht mal ein Jugendfoto von meinem Vater.«