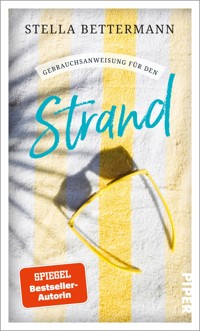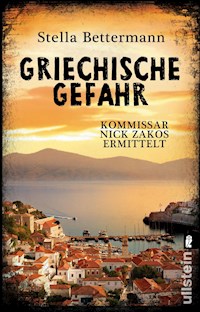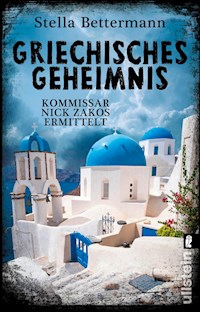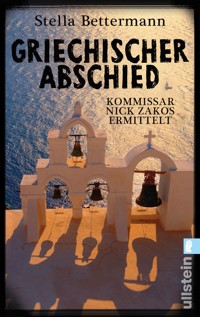12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Von Astypalea bis Zakynthos - eine vielseitige Reise durch das griechische InselreichWeiß getünchte Häuser mit blauen Kuppeln, glasklares Wasser, ein Hauch von wildem Thymian – und sofort denkt man an die griechischen Inseln. Dabei gleicht kaum eine der anderen: 3054 Inseln gibt es, und sie sind groß oder klein, besiedelt oder menschenleer, üppig grün oder karg und bergig. Stella Bettermann stellt Ihnen die wichtigsten vor: die Inseln für Pauschalurlauber, die Inseln für Individualisten, die Hippie- und die Luxusinseln, die Inseln zum Wandern, Surfen oder Baden. Sie verrät, wo die schönsten Strände zu finden sind, wo man noch in traditionelles Dorfleben eintauchen kann und wo es sich am besten feiern lässt. Und weil jedes Eiland einzigartig ist, ist auch für wirklich jeden eine Lieblingsinsel dabei!Von der Autorin der Bestseller »Ich trink Ouzo, was trinkst du so?« und »Ich mach Party mit Sirtaki«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2020Karte: cartomedia, KarlsruheLitho: Lorenz & Zeller, Inning am AmmerseeCovergestaltung: Birgit KohlhaasCovermotiv: Massimo Ripani/Huber-Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Eine griechische Insel ist eine griechische Insel ist eine griechische Insel
Unterwegs zu den Inseln, unterwegs auf den Inseln – oder: Ein Schiff wird kommen
Geschichte – und Geschichten
Von Hippies und Liebesgöttern
Griechenland kriegt die Krise – und die Inseln kriseln mit
Inseln für alle
Inselkatzen – und andere Kuscheltiere
Inseln für Spezialisten
Inseltraditionen
Luxus und Labels
Inseln à la Karte
Inseln für Eingeweihte
Eine für alle – Kreta
Laskarina Bouboulina – griechische Urmutter der Frauenbewegung
Von Kunst und Raub
Die schönsten Inselstrände (und andere Badeplätze)
Port Beach, Sikinos/Alopronia
Kolona Beach, Kythnos
Plaka Beach, Naxos
Livadi Beach, Iraklia
Agios Georgios und Agios Nikolaos, Symi
Kamares, Sifnos
Emporio, Chalki
Sarakiniko, Milos
Eine griechische Insel ist eine griechische Insel ist eine griechische Insel
Gibt man die Worte »Griechische Insel« mit Bilderfunktion bei Google ein, erscheint es: das hellenische Eiland schlechthin. Weiß gekalkte Türmchen, herrliche blaue Kuppeln, ein grandioser Sommerhimmel, der sich über pittoresk verschachtelte Häuschen und enge Gassen spannt, kontrastiert von einem tiefblauen Meer. Die Wirkung des Bildes ist frappant: Sofort stellt sich Sehnsucht ein. Sehnsucht nach gleißender Helligkeit, einer warmen Brise, die nach wildem Thymian duftet, nach einem Strand, der sich in der Mittagshitze wunderbar aufheizt. Der Weg zu diesem Strand führt über einen malerischen Trampelpfad, der aber nicht zu unwegsam ist, um ihn mit Ledersandalen zu bewältigen. Natürlich ist das Wasser in der Bucht glasklar. Und wenn sich nach dem erfrischenden, aber keinesfalls zu kühlen Bad der Appetit meldet, findet sich im Schatten der Tamarisken eine kleine Taverne, in der die Speisen nach Oregano, Olivenöl und Zitronensaft schmecken und geharzter Wein gereicht wird.
Kenner wissen: Bei dem Sehnsuchtsort auf dem Bild handelt es sich um Santorini. Dabei ist Santorini eigentlich ganz und gar nicht typisch für eine griechische Insel. Nirgendwo sonst in der Ägäis findet man so kühne Steilklippen. In Wahrheit ist auch längst nicht alle griechische Inselarchitektur weiß und blau. Manche Häuser sind bunt getüncht und errichtet im Griechischen Neoklassizismus – mit Schrägdächern und prächtig verzierten Haustüren. Dann wieder gibt es Häuschen aus kostbarem Naturstein, unverputzt und rustikal. Am bekanntesten jedoch ist sicherlich der sogenannte Inselstil: weiße Kuben mit einem Maß von drei mal vier Metern, typisch für die Kykladen und die Sporaden. Allerdings nicht für alle Kykladen. Kea beispielsweise sieht ganz und gar nicht aus wie eine Kykladeninsel, dort überwiegen die bereits erwähnten neoklassizistischen Häuschen in allen Farben, wie man sie unter anderem oft auf den Dodekanesinseln findet. Aber auch das ist nicht allgemeingültig.
Auf Rhodos zum Beispiel entdeckt man Ausnahmen. Rhodos ist zwar eine Dodekanesinsel, in dem Ort Lindos sind die Häuschen allerdings nicht bunt, sondern weiß wie auf den Kykladen. Ach ja, Dodekanes – das bedeutet übrigens Zwölferinseln. Tatsächlich sind es aber gar nicht zwölf, sondern doppelt so viele. Nun sind Sie endgültig verwirrt?
Kein Wunder. Tatsächlich gibt es auf den griechischen Inseln architektonisch beinahe nichts, was es nicht gibt: venezianische Paläste auf Korfu (aus der Zeit der venezianischen Herrschaft), Betonburgen auf Kos, sogar Bauhaus-Einflüsse auf der winzigen Insel Leros, bei denen es sich um Zeugnisse des Italienischen Realismus handelt.
Auch sonst herrscht Vielfalt – landschaftlich ist (fast) alles zu entdecken: Manche Inseln sind flach, manche bergig, einige sind grün, andere karstig. Es finden sich Felsenstrände und Kieselstrände. Selbst der Sand ist nicht überall gleich: Es gibt weißen Muschelsand, gelben aus zerriebenem Sandstein, außerdem Vulkanstrände in Rot, Schwarz, Grau. Auf Naxos und Kreta locken Dünenstrände. Auf Milos badet man in Buchten aus schneeweißem Kalksteintuff und fühlt sich wie in einer Mondlandschaft.
Es gibt weitgehend unbekannte Inseln wie Donousa oder Lipsi, die sich bestens für einen Urlaub im August eignen, denn dort geht es naturgemäß entspannter zu als auf großen Touristenmagneten wie Paros oder Mykonos. Kreta und Rhodos sind ideal für die ersten Sonnenstrahlen im Frühling, und fast hätte ich geschrieben, selbst Wintersportler kommen auf ihre Kosten – aber das stimmt nicht ganz. Das Skifahren ist nämlich nur auf Zypern möglich, wo ein kleines Skigebiet existiert, doch Zypern zählt nicht zu den griechischen Inseln, sondern bildet bekanntlich eine eigene Republik.
Fakt ist: Keine griechische Insel ist wie die andere. Aber diese Unterschiedlichkeit zur Gemeinsamkeit zu erklären – das wäre auch wieder zu leicht. Was also ist das Besondere an den griechischen Inseln? Das Charakteristische, was sie alle verbindet?
Nähert man sich dieser Frage an, stolpert man zunächst über eine Zahl: 3054. So viele griechische Inseln existieren – zumindest im Meer. Zählt man die Binneninseln auf dem Festland dazu, kommt man auf 3057. Sie liegen im Pamvotida-See und im Kleinen Prespasee. 3054 Meeresinseln also, 113 davon sind dauerhaft bewohnt. Ob es jemanden gibt, der all diese Inseln wirklich kennt? Ich bezweifle es. Als Rekordhalter gilt der Dichter Kimon Friar, der immerhin 46 Inseln bereiste – und zwar nicht nur, wie die Matrosen auf den Fährschiffen, lediglich die Häfen, sondern er verbrachte tatsächlich Zeit auf den Inseln und schrieb dort. Meine persönliche Liste ist nicht ganz so lang. Was Inselbesuche angeht, gehöre ich zu den Wiederholungstätern: Wenn es mir an einem Ort gefällt, dann komme ich immer wieder.
Als Münchner Tochter einer Griechin verbrachte ich als Kind die Sommerferien stets bei den Großeltern in Piräus – und auf dem von dort leicht erreichbaren Peloponnes und den Argolischen Inseln. Oft war ich auf Hydra, dem schicken Inselchen nahe Athen, das meine Mutter so mochte, weil dort auch immer ihre alte Schulfreundin Athina urlaubte. Deren Mann Takis war damals Steuerprüfer auf Hydra, weshalb wir in jedem Lokal wie Könige bedient wurden. Später, als ich fünfzehn oder sechzehn war, besuchten wir Poros, Hydras Nachbarinsel, wo wir in einem damals modernen Hotel mit Freiluftdisco und Strandbar abstiegen (heute würde man sagen: Beachclub). Bald darauf zog ich ohne Familie los, schlief auf Spetses im Schlafsack am Strand oder bewunderte mit meiner griechischen Cousine den Sonnenuntergang auf Santorini, der damals schon berühmt war. Ich tanzte auf Naxos zu Nisiotika (νησιώτικα), der typisch griechischen Inselmusik, und wanderte Händchen haltend mit einer großen Liebe durch die Gassen von Symi. Ich erkundete Kreta und Korfu, Serifos und Sifnos, Kythnos und Rhodos und noch viele weitere Inseln.
Dann hatte ich erst mal genug. Wer will schon ständig ins selbe Land reisen? Die Welt ist doch so groß. Ich hatte vor, möglichst viel davon zu sehen. Doch am Ende habe ich meine Urlaubsbegleiter stets damit genervt, dass italienische Kirchtürme, spanische Zikaden oder südfranzösische Ginsterbüsche in Griechenland doch viel schöner wären. Nach fast zehn Jahren, in denen ich keinen Fuß auf eine griechische Insel setzte, erkannte ich: Ich hatte Heimweh – und buchte einen Hellas-Flug. Sofort verliebte ich mich erneut. Und diesmal kam ich nicht mehr los, die Liebe wuchs und wuchs. Ein Griechenlandaufenthalt pro Jahr reichte mir oft nicht mehr, deshalb reiste ich zusätzlich zum Sommer oft auch im Frühling, sogar im tiefsten Winter an – und entdeckte ein ganz anderes Land, mit grünen Hügeln, kräftigen Regengüssen und einer unvergleichlich frischen Luft, in der sich die Griechen selbst bei Kälte gerne aufhalten. Ich sage nur: Heizpilze. Ohne diese Stromfresser würden Griechen wohl eingehen, denn sie lieben es, trotz Regen und Wind unter einer Markise im Freien zu sitzen.
Zwei Inseln kenne ich inzwischen so gut, dass ich mich dort zu Hause fühle und nach der Ankunft erst einmal ein paar Tage brauche, um allen Hallo zu sagen. Die erste ist Chalki, ein Inselchen nahe Rhodos, wo die Häuser so nah am Meer stehen, dass man von den Terrassen ins gar nicht so kühle Nass springen kann (das Meer heizt sich im August bis auf 28 Grad auf!). Zahlreiche Familienurlaube haben wir dort zelebriert, stapelweise Fotos zeigen die Kleinen buddelnd im Sand oder mit Schwimmflügeln in türkisblauem Wasser. Aus späteren Jahren mischen sich dann ebenso viele Bilder aus Iraklia ins Fotoalbum, einem verträumten Eiland nahe Naxos, wo man beim Schnorcheln Wasserschildkröten beobachten kann (wenn man Glück hat). Zu jenem Zeitpunkt hatte mein Sohn schon die erste Freundin dabei.
Womit ich nur sagen will: Ich reise nicht erst seit gestern auf die Inseln. Ich fühle mich in ihnen verwurzelt. Eine Weile dachte ich sogar darüber nach, mir ein Häuschen oder ein Apartment auf einer der bewohnten 113 Inseln zuzulegen. Aber ich schaffte es nie, einer einzigen Insel den Vorzug vor allen anderen zu geben. Dann hatte ich eine Idee: Ich renovierte das baufällige Häuschen meiner Familie in Piräus, wo ich einst meine Sommerferien verbrachte, und befinde mich nun immer in Sprungweite zu allen Inseln. Die Fähren fahren schließlich direkt unten im Hafen ab.
Mittlerweile weiß ich auch, was die griechischen Inseln in Wahrheit so besonders macht: Es ist das Licht. »Es gibt nirgends solche Strahlen, nicht in Italien, nicht in Spanien«, schrieb der britische Schriftsteller und Griechenlandliebhaber Lawrence Durrell, der jahrelang auf Rhodos lebte und gemeinsam mit Henry Miller Korfu bereiste. Er wusste: Im griechischen Licht wird »jede Zypresse zum Sinnbild der Zypresse«, zur platonischen Idee von der Zypresse gar.
Durrells Worte stammen aus dem Jahr 1978, doch am grandiosen griechischen Licht hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert. Wie ein Brennglas illuminiert es alle Dinge in seinem Strahlfeld. Selbst ein gewöhnlicher Insel-Esel wird von diesem Licht einzigartig ausgeleuchtet – nach dem Motto: Es werde Esel! Natürlich scheint dieses Licht auch aufs Festland. Das allgegenwärtige Meer filtert es jedoch auf eine Weise, die Euphorie auslöst und süchtig macht. Da geht es mir nicht anders als den Griechen. Sie hängen wie Junkies an ihrem Land – und seinem Licht. Verfrachtet man einen Inselgriechen in den Norden, wird er schwermütig. Mein Athener Freund und Lichtliebhaber Nikos zum Beispiel fährt niemals in Urlaub. Nicht, dass er noch nie gereist wäre. Doch es hat ihm nirgends gefallen. Das ist nicht untypisch. Angesichts der Krise müssen zwar viele Griechen das Land verlassen. Ob sie aber in der Ferne ihr Glück finden? Eher nicht.
Apropos Krise: Was wurde den Griechen in den vergangenen zehn Jahren nicht alles nachgesagt! Meist erscheinen sie in den Berichterstattungen als Schlawiner, unehrliche Trickser oder Faulpelze. Dem kann ich ganz und gar nicht zustimmen. Der Durchschnittsgrieche ist fleißig und ehrlich – und ein klein wenig verrückt.
Nikos, besagter Lichtliebhaber, ist einer dieser Verrückten. Äußerlich scheint er zwar ganz normal: Er ist knapp über fünfzig, trägt Polohemden, arbeitet als Steuerberater und gibt sich konservativ. Seine Leidenschaft jedoch gilt der Philosophie. Seit etwa hundert Semestern ist er an der Athener Universität für Philosophie eingeschrieben, und zwar ganz einfach weil er Philosophie liebt – nicht nur, aber natürlich besonders die griechische. Eigentlich ist er Betriebswirt und war als solcher in einem großen Konzern angestellt. Unterordnung und Hierarchien waren jedoch nichts für ihn, deswegen ist er nun lieber selbstständig tätig. Wenn er mit der Arbeit fertig ist, oft erst spätnachts, widmet er sich seinem Philosophiestudium. So ist er ein wandelndes Buch philosophischer Zitate, die er gerne in allen Lebenslagen von sich gibt. Nach einem gemeinsamen Abend kann es vorkommen, dass er seine Gäste umarmt und Aristoteles rezitiert: »Freundschaft ist eine Seele in zwei Körpern!«
Seine beiden Söhne sind davon natürlich genervt, vor allem wenn er sie mit Sokrates zum Hausaufgabenmachen animieren will: »Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.« Sie äffen ihn nach, wie er dasteht, mit leicht vergeistigtem Gesichtsausdruck, den rechten Finger erhoben. Doch da steht Nikos drüber und lacht mit. Er steht überhaupt über den Dingen, aber dies liegt nicht nur an der Philosophie, sondern auch am Raki. Aber das ist eine andere Geschichte.
Überhaupt sind die Griechen – neben dem Licht – einer der wichtigsten und schönsten Bestandteile der griechischen Insel. Denn Griechen sind einfach wahnsinnig nett – anders kann man es nicht sagen. In dem kleinen Supermarkt gegenüber von meinem Häuschen in Piräus werde ich zum Beispiel beim Wiedersehen immer von der Kassiererin einmal links und einmal rechts auf die Wange geküsst. Dies käme mir in München bei Edeka völlig abwegig vor. Fragt man in Griechenland jemanden nach dem Weg, dann kann es durchaus passieren, dass derjenige einen die ganze Strecke über begleitet, damit man das Ziel auch wirklich findet. Und in griechischen Airlines kommt es vor, dass Kinder und Jugendliche zuerst ihr Essen serviert bekommen – und keiner der griechischen Fluggäste etwas einzuwenden hat. Noch ein Beispiel: Auf Rhodos lief mir eine Putzfrau aus dem Hotel durch die ganze Stadt hinterher, um mir meine Flip Flops zu bringen, die ich bei der Abreise vermeintlich im Bad vergessen hatte. Ich hatte sie freilich absichtlich dort entsorgt, weil sie völlig durchgetreten waren …
Natürlich muss man diese Art nicht mögen, manche finden die Griechen aufdringlich. Küsse unter Fremden können nervig sein, auch nicht unbedingt appetitlich. Und die Griechen haben auch noch andere potenziell lästige Angewohnheiten. Viele beispielsweise reden ein bisschen zu viel. Sie sind distanzlos und neugierig und stellen Fremden persönliche Fragen. Sie knuddeln fremder Leute Kinder – und küssen natürlich auch die. Außerdem können Griechen störrisch und missgelaunt sein. Sie schreien sich mitten auf der Straße laut an. Als Servicepersonal taugen sie nur bedingt, denn mein Freund Nikos ist nicht der einzige, der sich nur ungern unterordnet. Außerdem sind Griechen oft beleidigt. Sehr oft sogar. Das Beleidigtsein ist in Griechenland eine Art Volkssport, ständig gibt es »Missverständnisse« (Parexigisis, παρεξήγηση), die eigentlich keine sind, sondern tief empfundene Kränkungen. Es gelten rigide Höflichkeits- und Benimmregeln, welche die Griechen selbst nicht eben selten überschreiten – und dann ist jemand sauer, oft jahrelang.
Eine Geschichte von Gastfreundschaft und Verrücktheit ist zum Beispiel die des Kapitäns Manolis von der Insel Iraklia. Nachdem er jahrzehntelang zur See gefahren war, baute er, als er alt wurde, auf seiner Heimatinsel eine kleine Pension und kündigte an, den dazugehörigen Garten zum grünen Paradies machen zu wollen. Darüber lachte das ganze Dorf. Man muss wissen, dass auf Iraklia kaum etwas wächst, denn es handelt sich um eine Insel der westlichen Kykladen, die eher karstig und knochentrocken sind. Noch dazu weht ständig Wind, welcher die fruchtbare Erdkrume abträgt. Doch Manolis ließ sich nicht beirren. Er nahm den Pensionsbetrieb auf, holte junge deutsche Rucksacktouristen mit seinem alten Pick-up von der Mole ab und karrte sie zu sich nach Hause. Er machte sie sich zum Freund und bekochte sie Abend für Abend auf seiner Terrasse. Einfach so, weil es ihm gefiel.
Und natürlich war er beleidigt, wenn jemand es wagte, anderswo zu essen. So wurde seine Pension nach und nach zur Institution. Und auch sein Garten Eden gedieh: Jeden Tropfen Wasser, der abfiel, wenn Nudeln gekocht oder Teller gespült wurden, sammelte er und goss damit die Bougainvillea, die Feigen und Pistazienbäume, die duftenden Jasminsträucher und das Gemüsebeet mit Tomaten, Paprika und Auberginen in seinem Garten. Heute ist Kapitän Manolis lange tot, doch die Freunde, die damals auf seiner Terrasse beisammensaßen, kommen nach wie vor nach Iraklia. Denn die malerische Pension mit dem schönen Garten gibt es immer noch. Und wenn die Rede auf Manolis kommt, wischen sie sich die Augen.
Es ist dies eine sehr griechische Geschichte. Es ist aber auch eine sehr deutsche Geschichte. Und zwar deshalb, weil viele Deutsche immer wieder auf dieselben Inseln kommen. Kaum ein Grieche würde alljährlich auf dasselbe Eiland fahren. Es sei denn, er stammt von dort. Dies wiederum ist keine Seltenheit. Nur der kleinste Teil der Griechen in den großen Städten Thessaloniki und Athen stammt ursprünglich von dort. Die meisten Familien sind in den Sechzigerjahren aus der Provinz in die Städte gezogen, aus Bergdörfern oder eben von den Inseln, auf denen sich Landwirtschaft und Fischfang immer weniger lohnten und die Infrastruktur schlecht war. Doch die Sehnsucht nach der Heimatinsel blieb bestehen. Manchmal leben noch die Großeltern auf den Inseln, manchmal gibt es noch ein Häuschen oder wenigstens entfernte Cousinen und Cousins, die man im Sommer besuchen kann. Mitunter kommen auch inselstämmige Auswanderer aus den USA oder Kanada, aus Deutschland oder Frankreich in die Heimat zum Baden – und zum alljährlichen Inselfest.
Beinahe auf jeder bewohnten griechischen Insel findet im Sommer nämlich ein rauschendes Fest statt. Schließlich gibt es überall Kirchen oder kleine Klöster, die Heiligen gewidmet sind, und deren Namenstage seltsamerweise fast alle in die Sommermonate fallen. Und falls nicht, dann feiert man eben Maria Himmelfahrt am 15. August. Der Ablauf der Inselfeste ist bis auf kleine Details überall der gleiche: Erst gibt es eine Messe, dann ein riesiges Gelage am Grill und schließlich ein Tanzfest bis in den nächsten Morgen. Ein paar Tage später reisen dann alle ab.
Ansonsten pendeln urlaubende Festlandgriechen, insbesondere die jüngeren, mal hierhin, mal dorthin – je nachdem, welche Insel gerade im Trend ist: Noch kürzlich war es en vogue, im Naturschutzgebiet auf Zakynthos Schildkrötenbabys beim Schlüpfen zuzusehen. Derzeit ist Tinos angesagt, es gibt dort eine große Gemeinde von Biobauern, eine Mikrobrauerei sowie einen Sternekoch. Ansonsten kann man die Urlaubspräferenzen moderner Griechen recht einfach zusammenfassen: Es soll möglichst schick und es soll möglichst grün sein. Ums Ausruhen geht’s in den Ferien eher nicht. Es hat sowieso jeder Stadtgrieche eine Exochiko (εξοχικό), eine Datsche außerhalb im Grünen, wo er am Wochenende entspannt.
Typisch: Der Grieche macht vor allem Kurztrips. Eine Woche gilt ihm bereits als langer Urlaub. In dieser Zeit lässt man es sich richtig gut gehen und zeigt, was man hat. Deswegen geht es (neben den aktuellen Trendspots) auch gern an schöne Glitzerorte: Mykonos, Santorini, vielleicht auch Naoussa auf Paros. Hier lohnt es sich, die besonders hübschen Sommersachen einzupacken und das Glätteisen für die lange Mähne.
Natürlich liegt man dann nicht einfach am Strand auf seinem Handtuch, sondern bezieht ein schattiges Plätzchen in einem Beachclub und bestellt nachmittags, wenn das Licht schon schräg fällt, einen Aperol Spritz, den es mittlerweile auch in Griechenland überall gibt. Ganz im Gegensatz übrigens zu Retsina, der nur noch in den Träumen betagter Urlauber vorkommt. (In den meisten Tavernen wird schon seit Jahren nur noch klassischer Weißwein ausgeschenkt.)
Das Konzept der Beachclubs kommt aus Mykonos, Griechenlands Partyinsel Nummer eins. Und ich muss zugeben, dass viele dieser Clubs unfassbar schön gestaltet sind. Es gibt Cabanas aus Bast, kleine tropische Wäldchen oder wehende Gazevorhänge, die Schatten spenden. Die Interior-Designer schöpfen aus dem Vollen, und es ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Die Mykonos-Clubs haben allerdings auch ihren Preis: Im wohl berühmtesten, dem Nammos, kosten zwei Liegen mit Schirm stolze 120 Euro am Tag. Dort gibt es sogar eine Tiefgarage unterm Strand, außerdem eine Designer-Mall und natürlich edle Gastronomie (Hauptgerichte ab vierzig Euro). Und man ist live dabei, wenn sich Promis und Multimillionäre im Helikopter an den Strand fliegen oder von einem Steward mit dem Dingi von der Jacht dorthin bringen lassen. Tatsächlich kommt es im August in den Stoßzeiten zu regelrechten Dingi-Staus.
Promistau am Strand: Für die einen mag das eine Traumvorstellung sein. Bei Individualtouristen stellen sich da eher die Nackenhaare auf, denn sie lieben ursprüngliche Strände ohne Liegestuhlverleih, kleine Pensionen und lauschige Tavernen. Mir sind solche Orte auch am liebsten. Aber wenn es sein muss, kann ich mich auch in einem Beachclub erholen. Außerhalb von Mykonos sind die Beachclubs ohnehin bescheidener und bieten zusätzliche Liegemöglichkeiten, Lounge-Möbel oder Schatten spendende Planen. Selbst auf Paros, das als nächstes Mykonos gilt, kosten die Liegen oft nur wenige Euro oder sind gratis für Gäste, die Getränke konsumieren. Es gibt nur ein Problem: Ständig dudelt laute Musik. Und das gilt nicht nur für Beachclubs.
Auf griechischen Inseln ist es oft laut, und zwar nicht nur an überfüllten Orten – auch in menschenleeren Lokalen. In Griechenland gilt: Wenn es irgendwo einen frei zugänglichen Lautstärkeregler gibt, dann dreht ihn irgendjemand voll auf. Griechen finden das gemütlich – oder sie hören es gar nicht mehr. Ich behaupte, dass es in ganz Europa keine lautere Nation gibt. Alles, was man in Griechenland auf Höchststufe stellen kann, wird auch auf Höchststufe gedreht – Radios, Handyklingeltöne, aber auch Klimaanlagen.
Ein weiteres Extrem: kalte Getränke. Getränke kommen nicht nur gekühlt, sondern derart kalt auf den Tisch, dass beim Trinken die Zähne schmerzen. In den Kühlschränken der Lokale werden nicht nur Bierflaschen, sondern sogar Biergläser geeist. Ich erkläre es mir so: Die Griechen besitzen traditionell eine große Leidensfähigkeit. Griechenland war in der Nachkriegszeit und bis hinein in die Siebzigerjahre meist bitterarm. Es galt als normal, dass selbst gut ausgebildete Griechen zwei oder mehr Jobs machen mussten, um ihre Familie durchzubekommen. Dies hat allerdings keineswegs dazu geführt, dass das Land vorangekommen wäre, denn eine korrupte Elite bereicherte sich an der harten Arbeit des Volkes und versäumte es, moderne Sozialsysteme zu installieren.
Und dann kam die Krise. Die Griechen kämpfen also weiter ums Überleben – so hart wie eh und je. Und sie sind dabei ungeheuer tapfer und tragen ihr Kreuz mit großer Würde. Wenn aber die Getränke nicht kalt genug sind, ist es mit ihrer Duldsamkeit vorbei. Das ist dann im wahrsten Sinne der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Erst unlängst kanzelte mich eine Freundin ab, weil bei mir in Piräus nicht genug Eis im Kühlschrank war: »In Zukunft ist Eismachen das Erste, was du tun wirst, wenn du nach Griechenland kommst. Das Erste!« Meinen Einwand, dass mir Eiswasser oft zu kalt sei, ließ sie nicht gelten. »Wem’s zu kalt ist, der trinkt vorher eben Ouzo«, herrschte sie mich an. Ouzo wärmt den Bauch, deswegen wird der Anisschnaps, im Gegensatz zu Retsina, auch nie aus der Mode kommen.
Passend zu diesem Drang nach Extremen wurde in früheren Zeiten das Essen in den Inseltavernen bei grellem Licht serviert. Griechen fanden grelles Licht nicht ungemütlich, im Gegenteil. Außerdem konnte man dann die Speisen besser inspizieren. Viele Lokale benutzten sogar Neonlicht, welches dem Essen einen bläulichen Touch verlieh. Kein Mensch störte sich daran – zumindest kein Grieche. Zum Glück wird das nicht mehr so gehandhabt, und man isst auf den Inseln fast immer bei normaler Beleuchtung. Die Geschmäcker gleichen sich eben an.
Das gilt für so manches: Als ich als junges Mädchen mit dem Schlafsack von Insel zu Insel zog, war ich die einzige Griechin inmitten von Deutschen, Franzosen, Niederländern und Briten. Mittlerweile hat sich das geändert. Heute sehe ich mehr Griechen als andere Nationen beim Wildcampen. Oft sind es ganze Cliquen junger Leute, die aussehen, als würden sie direkt aus Athens Linkenviertel Exarchia kommen (was wahrscheinlich auch der Fall ist): Sie umwabert der Geruch selbst gedrehter Zigaretten, sie tragen Dreadlocks und lustige Bärte. Sie bleiben nicht nur ein paar Tage, sondern verbringen den ganzen Sommer am Strand. Klar, dass die wilden Camper nicht von allen gern gesehen werden – eigentlich ist das Campen abseits ausgewiesener Plätze verboten. Mitunter werden die Leutchen auch tatsächlich verjagt. Aber dann tauchen sie eben am nächsten Strand oder auf der nächsten Insel wieder auf. Auf Kreta habe ich an einem Strand einmal ein Schild gesehen, auf das die Gemeinde in großen Lettern die Worte »No Camping« hatte drucken lassen. Das Wort »No« war jedoch durchgestrichen, stattdessen hatte jemand »Go« hingekritzelt.
Es ist also wirklich gut auf den Inseln auszuhalten: Es gibt wilde Strände, es gibt Beachclubs, und es gibt Ohropax für alle, denen es dort zu laut ist. Es gibt keinen Retsina, dafür aber Ouzo, Aperol Spritz und arktisch kaltes Bier. Und schrecklich nette Griechen. Freilich mit der Einschränkung, dass sie manchmal gar keine Griechen sind. Nicht nur in Deutschland, auch in Griechenland hat es in den letzten Jahren sehr viel Zuwanderung gegeben. Mehr als einmal habe ich erlebt, dass deutsche Freunde von einem »griechischen« Kellner schwärmten, der tatsächlich Albaner, Bulgare oder Georgier war. Kein Wunder, die meisten Einwanderer sind sehr gut assimiliert. Und wenn diese Kellner einen »Griek Sälat with extra Feta-Tsies« an den Tisch bringen, klingt ihr Englisch so original Griechisch wie überall im Land.
Unterwegs zu den Inseln, unterwegs auf den Inseln – oder: Ein Schiff wird kommen
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, deswegen erschienen mir mit siebzehn Jahren die ersten Fährfahrten ohne Eltern als die aufregendsten und verheißungsvollsten überhaupt – endlich frei und selbstbestimmt. Die Fähren damals waren freilich kaum mit den modernen Schiffen der heutigen Zeit zu vergleichen, wie unförmige Kolosse wirkten sie, stinkend von Ruß und Öl und mit dicken Farbschichten versehen, die im Kampf gegen den Rost immer wieder drangekleistert worden waren, sodass ihre Haut rau und wellig wirkte wie von einem versehrten Wal. Dennoch zweifelte ich nicht einen Moment daran, dass sie ihre Passagiere sicher über das Meer tragen würden, war doch schon das Tuten des Schiffshorns von so großer Kraft.
Natürlich reichte das Geld nur für die billigsten Plätze, Deckspassage also, eine Fahrt unter freiem Himmel. Die Sonne knallte nur so runter, denn man war gerade noch im letzten Moment an Bord gerannt und hatte keinen Schattenplatz ergattert. Aber wen störte das schon? Man wollte ja sowieso braun werden, und zu heiß war es ohnehin nie, denn der Fahrtwind fuhr einem ins Haar und bauschte die Kleidung. So blickte man also windumtost stundenlang in die herrliche tiefblaue Meereslandschaft, und ab und zu brachten mitreisende Freunde Frappé, den eiskalten griechischen Nescafé, von der Bar, und später Büchsenbier.
Nach einiger Zeit schmeckten die Lippen salzig von der Gischt, und die Hände waren überzogen von einer feinen Schicht aus Ruß und Dreck, der sich aus den Schiffskaminen auf alles legte. Unter der pappigen Sonnencreme rötete sich ein stattlicher Sonnenbrand, denn keine Creme ist stark genug, um ungebräunte Haut acht Stunden lang vor praller südeuropäischer Hochsommersonne zu schützen. Und außerdem gab es in meiner Jugend sowieso kaum höhere Schutzfaktoren als sechs.
War das Ziel endlich erreicht, fühlte man sich wirklich urlaubsreif beziehungsweise fix und fertig, so sehr hatten einem Sonne, Bier und der Motorenlärm zugesetzt, und von der Bindehautentzündung und dem steifen Nacken, die man sich auf der Fahrt fast zwangsläufig zuzog, hatte man noch länger was. Irgendwie blieb trotzdem das Gefühl, es wäre großartig gewesen – zumindest wenn man seefest war.
Ich war es offensichtlich, den Beweis hatte ich erbracht, trotz Frappé und Bier. Damit hatte ich meine Familie widerlegt, die der Theorie folgte, man dürfe bei Schiffsfahrten nur so wenig trinken wie möglich.
Die Annahme, die Seekrankheit rühre von zu starker Flüssigkeitsaufnahme, stammte von meiner griechischen Oma, der Yiayia (γιαγιά), die bei uns in der Familie als Reiseexpertin galt. Sie liebte Reisen. Sie war zwar fast blind, und außerdem hatte sie es in den Beinen, doch davon ließ sie sich nicht abhalten, und so ging es regelmäßig auf große Fahrt, etwa nach Poros im Saronischen Golf oder nach Methena auf dem Peloponnes – damals ein trubeliger Kurort, der von Piräus endlose sieben Stunden entfernt lag (heute braucht man per Autofähre etwa dreieinhalb, und das Dörfchen wirkt etwas verlassen, seit der Kurbetrieb eingestellt wurde).
Diese Reisen als kleines Kind mit der Familie sind mir noch äußerst präsent, wegen der großen Vorfreude und Aufregung der Großeltern. Für die meisten Griechen waren diese Reisen mit den Fähren ja auch die einzigen, die sie je unternahmen (und oft ist das auch heute noch so, schließlich gibt es bei 3054 Inseln im eigenen Land genug zu sehen).
Auch die Nordeuropäer reisten damals, in den späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahren, noch nicht so oft. Ausländische Touristen traf man deswegen nur selten an. Wenn mein kleiner Bruder und ich uns untereinander auf Deutsch unterhielten, wurden wir noch neugierig angestarrt. Wir starrten zurück, schließlich gab es genügend Faszinierendes zu entdecken. Zum Beispiel das sonderbare Gepäck der Mitreisenden, die nicht mal Reisetaschen benutzten, sondern ihre Sachen oft nur in Körben, Bündeln oder sogar in Kartons transportierten, versehen mit zu Griffen geknüpften Hanfseilen, welche ihren Trägern rote Striemen in die Handflächen gruben.
Wir hatten natürlich Koffer, um die kümmerte sich die Yiayia, die als geschickteste Kofferpackerin galt. Ging die Fahrt dann los, mästete sie alle mit trockenen Snacks, Brot mit Kefalotyri (κεφαλοτύρι, Käse), Kekse und Koulouria (κουλούρια, Sesamkringel). Nur mit Wasser geizte sie, und Limo von der Kaffeebar gab es für uns Kinder grundsätzlich auf diesen Schiffsfahrten nie, damit die viele Flüssigkeit im Bauch nicht hin- und herschwappen konnte. Wer weiß, vielleicht hatte meine Yiayia mit dieser Taktik sogar recht – sie selbst verspürte nicht mal bei ärgstem Seegang Übelkeit.
Griechenland ist und war immer eine Seefahrernation, bereits in vorantiker Zeit kreuzten griechische Handelsschiffe, Kriegsflotten, Fischerboote, aber auch Piratenschiffe die Meere. Die Schifffahrt prägte das Leben auf vielfältige Weise, sie brachte Wohlstand, verband abgeschiedene Inseln mit der großen, weiten Welt – und zerstörte die Landschaft: Das Abholzen der Wälder für die griechischen Flotten ließ das Land über große Strecken wüstenähnlich verkarsten und verursacht bis heute Dürre und Hitzewellen. In puncto Umweltsünden waren die Griechen schon vor 3000 Jahren echte Vorreiter … Das Problem war unter anderem der stete Wind, der hier weht – und der die Erdkrume forttrug, sodass, als die Bäume einmal gefällt waren, vielerorts fast nur kahler Stein und eine flache Staubschicht übrig blieben, worauf allenfalls Sträucher gedeihen. Weil die Landwirtschaft daher vielerorts fast zum Erliegen kam, musste der Lebensunterhalt erst recht auf dem Meer erwirtschaftet werden. Ein Teufelskreis.
Auch heute noch verfügen Griechen über die größte Privatflotte der Welt. Die innergriechischen Fähren sind dabei im Vergleich zu den Containerschiffen und Handelsschiffen eine eher kleine, nicht wirklich nennenswerte Sparte. Obwohl auch sie zahlenmäßig nicht unterschätzt werden sollten: Insgesamt finden wöchentlich über 60 000 Fährfahrten statt, buchbar bei knapp zwanzig Unternehmen wie etwa Anek Lines oder Blue Star Ferries, wobei man sowohl direkt bei den entsprechenden Reedereien buchen kann als auch bei übergeordneten Online-Buchungsunternehmen wie beispielsweise ferries.gr oder ferriesingreece.com. (Die Sache funktioniert ganz ähnlich wie eine Online-Flugbuchung – im Prinzip muss man nur das gewünschte Ziel und den Begriff ferry googeln, dann wird man an entsprechende Anbieter weitergeleitet.) Nahe Ziele werden dabei zumeist von rasanten Tragflächenbooten angefahren, während man für große und weit entfernte Inseln gigantische moderne Fährschiffe besteigt.
Verglichen mit den trägen alten Rostlauben, auf denen wir in meiner Kindheit und Jugend reisten (von denen naturgemäß nur noch wenige existieren), wirkt eine moderne Fähre in manch malerischem kleinem Hafen wie ein Raumschiff aus fernen Galaxien. An Orten, in denen die Häuser nah ans Wasser gebaut wurden, wie etwa in Katapola auf der Kykladeninsel Amorgos oder in der schmalen Hafenbucht der Dodekanesinsel Chalki, bekommt man außerdem beim Zusehen Angst, die Riesenschiffe könnten jeden Moment zu weit ausscheren und ein paar Gebäude am Wasser auf die Hörner nehmen. In Wahrheit passieren Fährunfälle dank der Routine der versierten Kapitäne aber eigentlich (fast) nie.
Größer ist die Gefahr, ein Schiff zu verpassen, obwohl man bereits direkt am Anlieger steht. Gerade noch sah man die Fähre in weiter Ferne, einen Wimpernschlag später schon legt sie an, fast geräuschlos – wenn man mal von dem enervierenden Piepton absieht, der als Warnung vor der sich herabsenkenden Öffnungsklappe dient, dem Hupen der Autos und Rufen der Fahrgäste. Und ehe man sichs versieht, wird die Klappe schon wieder hochgefahren, um dem zumeist recht straffen Fahrplan Genüge zu tun. Wer sich zu langwierig von Zurückbleibenden verabschiedet oder im Café an der Mole nur noch einen Moment auf das Wechselgeld wartet, hat das Nachsehen und kann dem davondüsenden Meeresriesen oftmals nur noch fassungslos hinterherblicken.
Reisende aber, die es rechtzeitig an Bord geschafft haben, werden mitunter sogar per Rolltreppe ins Innere gehievt, wo sie dann umgehend schockgefrostet werden wie frisch gefangener Fisch. Jedenfalls beinahe, denn die Klimaanlage läuft stets auf Hochtouren, weshalb dringend langärmlige Kleidung mitzuführen ist.
Ansonsten geht es recht heiter zu: In der Hochsaison, besonders rund um den 15. August, wenn alle Griechen, Italiener und Franzosen Urlaub machen, sind meist sämtliche Plätze ausgebucht, und es herrscht ein großes Hallo. Wer keine nummerierten Sitzplätze besorgt hat, besetzt jetzt Stühle und Sitzecken der Restaurantbereiche. Besonders turbulent geht es dabei vor den Fast-Food-Restaurants zu, außerdem existieren stark frequentierte Kaffeebars, die Snacks und Getränke bereithalten. Wer hier immer noch kein Plätzchen ergattern kann, für den kramt das Bordpersonal Klappstühle hervor. Junge Leute lassen sich oft auch einfach auf dem Boden nieder, von wo sie aber häufig von den Stewards vertrieben werden – außer nachts, wenn sie schlafen und die meisten Stewards Gnade walten lassen.
Ende der Leseprobe