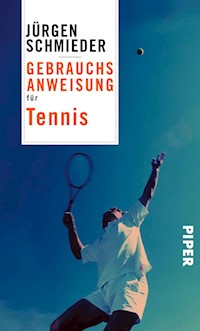
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wer schon mal mit einem Schläger auf diese Filzkugel eingeprügelt hat, der weiß: Tennis ist viel mehr als ein Sport. Es ist Lebensgefühl, Stilschule und philosophische Feldforschung. Als Hobbyspieler und Sportjournalist kennt Jürgen Schmieder den Nervenkitzel auf dem Platz ebenso gut wie die kultivierte Langeweile auf den Tribünen der großen Turniere. Er erklärt, warum Tennisspieler professionelle Verlierer sind, welche Rolle das richtige Outfit beim gelungenen Aufschlag spielt und warum jeder Spieler ähnliche Ticks hat wie Rafael Nadal. Dass Roger Federer der einzige vollkommene Tennisstar ist, warum Steffi Graf keine Lust auf den Zirkus hat und wer die größten Nachwuchshoffnungen sind. Schließlich verrät er das Geheimnis der hohen Kunst, mit seinem erbitterten Rivalen auch nach dem Spiel noch befreundet zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deISBN 978-3-492-99039-4 © Piper Verlag GmbH, München, 2018Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaasbuchgestaltung.de Covermotiv: Sebastien Starr / Contributor / Getty Images Datenkonvertierung: Fotosatz Amann, Memmingen Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Legendäre Duelle
Der schönste Sport der Welt
Null-Null, Fünf-Satz-Langweiler und warum manche Spieler öfter gewinnen
Der Sport der Verlierer
Ruhe, bitte!
Feierbiester und Liniensäuberer
Der Ballmaschinen-Trainierer
Liniensäuberer
Der Tester
Der Lamentierer
Der Selbsthasser
Der Gegner-Lober
Der Lehrer
Die verlorene Tochter
Der Barfuß-Spieler
Der Präsident
Der Vergnügungswart
Das Model
Der Ehemalige
Der Netzrollerfreuer
Verdammter Sand
Griffbänder und andere Folterinstrumente
Nur nicht nachdenken
Der König der Neurosen
Ausraster
Ilie Nastase, Wimbledon 1977
Tim Henman, Wimbledon 1995
Jeff Tarango, Wimbledon 1995
Martina Hingis, French Open 1999
Xavier Malisse, Miami 2005
Andy Roddick, Australian Open 2008
Serena Williams, US Open 2009
Caroline Wozniacki, Qatar 2015
Viktor Troicki, Wimbledon 2016
Fabio Fognini, US Open 2017
Die Tragik des Zweidimensionalen
Kunst und Kommerz
Steuern, Tod und Auslosung
Der Becker-Moment
Reden über Tennis
Stefanie
Nummer eins
Mit Angie Kerber in New York
Die Beste
Der Übermenschliche
Auf dem Platz und doch nicht dabei
Tenniseltern
Die Modell-Eltern
Immer-Eins-mehr-als-Du
Die Floskel-Schleuder
Der Vergangene
Der Karriereplaner
Der Kritiker
Der Organisator
Der Fragensteller
Der Uninteressierte
Der Ums-Spielfeld-Schleicher
Die Zukunft des Sports
Wer beim Tennis häufiger gewinnt
Ratschläge eines Mittelmäßigen
Dank
Legendäre Duelle
»Wenn ich gegen sie spiele,
dann hasse ich sogar meine Schwester.«
Serena Williams
Ich habe Martin gehasst, aufrichtig und aus reinster Seele. Er war kein böser Mensch, ganz im Gegenteil, er war sogar ein ziemlich cooler Typ. Wir haben ein paar Mal versucht, gute oder vielleicht sogar beste Freunde zu werden, doch es ging nicht. Der einzige Grund, warum ich Martin zwölf Jahre lang nicht leiden konnte und warum er bis heute der Einzige ist, den ich in meinem Leben jemals aufrichtig gehasst habe: Er konnte genauso gut Tennis spielen wie ich. Wahrscheinlich war er sogar ein bisschen besser, aber das würde ich niemals zugeben. Er war ein ebenbürtiger Rivale, ein ewiger Feind, ein Duellant auf Augenhöhe.
Ich möchte behaupten, dass jeder, der schon mal einen Tennisschläger in der Hand hatte, kennt so jemanden, den er nur wegen dieses Sports nicht leiden kann.
Freilich gibt es diese wunderbaren Geschichten über die innige Freundschaft zwischen Chris Evert und Martina Navratilova. Es gibt die wahnwitzig schlechte Autobiografie von Tracy Austin, Beyond Center Court: My Story, in der sie über Navratilova schreibt: »Sie ist eine wunderbare Person, sehr sensibel und fürsorglich.« Es gibt diese witzigen Videos von Roger Federer und Rafael Nadal, wie sie beim Werbeauftritt für einen Sponsor miteinander feixen oder beim Laver Cup gemeinsam im Doppel antreten. Es gibt aber auch dieses Wimbledon-Finale 2008, bei dem beide am Ende kaum noch stehen können und sich trotzdem gegenseitig über den Platz scheuchen.
Serena Williams, die wohl beste Tennisspielerin der Geschichte, sagte mal: »Ich liebe meine Schwester Venus – doch wenn ich gegen sie spiele, dann hasse ich sie.« Sie sagte nicht: »Ich will gegen sie gewinnen.« Sie sagte: »Ich hasse sie.« Ich glaube, das bringt eine Rivalität besser auf den Punkt als »Sie ist eine wunderbare Person, sehr sensibel und fürsorglich«.
Mein erstes Duell mit Martin fand im Juli 1985 statt. Boris Becker hatte gerade Wimbledon gewonnen, weshalb sämtliche Eltern wie die Lemminge in die Tennisclubs liefen und ihre Kinder in sogenannte Schnupperstunden schickten. Tennis, das war plötzlich nicht mehr nur der Sport für Ärzte und Anwälte und Unternehmer. Tennis, das war in Deutschland plötzlich ein Sport für alle – also auch für jemanden wie mich, der davor eher mit einem Fußball auf Bolzplätzen herumgekugelt ist. Die Partie gegen Martin im Tennisclub meiner Heimatstadt Tirschenreuth war die erste in meinem Leben, bei der ich den Ball nicht über unseren Gartenzaun zu meinem Vater oder meinen Bruder spielte. Sie fand auf einem Sandplatz statt, mit richtigen Linien und richtigem Netz. Ich verlor, 5:7, 6:7. Das Spiel dauerte drei Stunden und war der Beginn einer wunderbaren Feindschaft.
Ich wurde im Laufe der Jahre paranoid, ja regelrecht obszessiv. Ich lag nachts wach und dachte: Woran denkt Martin? Welche Schläge hat er verbessert? Was hat er gegessen? Und warum ist er immer noch zwei Zentimeter größer als ich? Ich habe seine Spielweise analysiert und aufgemalt. Ich habe seine Geschwindigkeit berechnet und einen nur für ihn nicht erreichbaren Vorhand-Cross entwickelt. Ich habe für einen Sieg gegen ihn gebetet. Ja, ich war besessen von Martin.
Eine Rivalität verbindet die Duellanten auf Lebenszeit. Ein Duell wird nicht unvergesslich, wenn der eine den anderen vom Platz prügelt. Das ist der Grund, warum sich Dirk Nowitzki nicht an seinen Sieg gegen mich bei einem Turnier in Franken erinnert. Er war 14 Jahre alt, ich ein Jahr jünger. Er gewann 6:0, 6:0 – und die Partie war längst nicht so spannend, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Ich erinnere mich auch nur deshalb daran, weil ich ein paar Jahre später sein Gesicht im Fernsehen gesehen und dabei bemerkt habe, dass er Basketball noch viel besser spielte als Tennis, was bei mir zwei Wochen lang für tiefe Depressionen aufgrund meiner offensichtlich mangelnden Begabung zum Profisportler gesorgt hat. Ich bin dann zunächst in den Fußball und später in den Journalismus abgedriftet.
Legendäre Siege kriegt man nicht geschenkt. Für legendäre Siege muss man an eine Grenze gehen, von der man vorher nicht gewusst hat, dass es sie überhaupt gibt und dass überhaupt jemand jemals so weit gehen kann, geschweige denn man selbst. Wer bereit ist, an diese Grenze zu gehen, braucht jemanden, der ihn dorthin treibt. Er braucht einen ebenbürtigen Rivalen, der selbst an eine Grenze getrieben werden will. Unvergessliche Duelle sind immer Kämpfe zwischen Athleten auf Augenhöhe. John McEnroe gegen Björn Borg. Chris Evert gegen Martina Navratilova. Boris Becker gegen Stefan Edberg. Steffi Graf gegen Monica Seles. Roger Federer gegen Rafael Nadal. Martin Stützel gegen Jürgen Schmieder.
Es ist völlig egal, ob diese Grenze ein Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier ist oder das Finale bei einer Stadtmeisterschaft. Es ist nur wichtig, dass es sie gibt. Sie und diesen Rivalen, der einen dorthin treibt. Das genügt.
In der bayerischen Kleinstadt Tirschenreuth waren Martin und ich weltberühmt – auch wegen anderer Sachen abseits des Tennisplatzes, die ich hier keinesfalls erwähnen werde, weil wir nun beide verheiratet sind, Kinder erziehen und unsere Jobs behalten möchten. Außerhalb dieser Stadt interessierte sich niemand für diese Rivalität. Ach was, außerhalb des Tennisclubs interessierte sich niemand dafür. Aber für Martin und mich und ganz sicher auch für unsere Eltern waren diese Duelle mindestens so wichtig wie das Leben selbst.
Einmal, ich war zwölf Jahre alt, habe ich vor einem Match gegen Martin mit meinem Vater einen Gottesdienst besucht und eine Kerze angezündet. Ich habe gewonnen, 6:1, 6:4. Richtig locker. Danach habe ich, das ist kein Witz, vor jeder Partie gegen Martin in dieser Kirche eine Kerze angezündet.
Diese Angewohnheit liegt auf der Verrücktheits-Hitliste dieser Rivalität auf Platz drei. Rang zwei belegt Martins Mutter bei der Stadtmeisterschaft 1994. Sie hat jedes einzelne meiner Spiele in den Runden davor vom Zaun aus beobachtet und mich nach jedem Aufschlag darauf hingewiesen, dass meine Bewegung doch sehr nach Fußfehler aussehe. Auf Platz eins liegen die 100 gebräuchlichsten Beleidigungen der deutschen Sprache, die wir in beinahe jedem Match aufeinander anwandten in einer Lautstärke, dass es jeder hören konnte – bisweilen auch während eines Doppels gegen zwei Fremde.
Ja, Martin und ich sind tatsächlich gemeinsam zum Doppel angetreten und haben uns dabei ein Mal derart heftig gestritten, dass uns die Gegner beruhigen mussten. Wer jemals Tennis gespielt und so was nicht erlebt hat, der werfe den ersten Schläger.
Solche Rivalitäten gibt es zwar auch in anderen Sportarten auch, doch nirgends sind sie für Zuschauer und Sportler so intensiv wie beim Tennis. Beim Fußball verlieben sich Fans in einen Verein, wie sie sich nicht mal in Menschen verlieben, doch Akteure kommen und gehen und manchmal wechseln sie sogar zum feindlichen Verein – eine Team-Rivalität kann deshalb niemals an persönliche Duelle zwischen zwei Personen heranreichen.
Boxen kommt dem Tennis sehr nahe, ein einzelner Kampf ist aufgrund der Möglichkeit des Niederschlags womöglich gar intensiver als eine Partie mit der Filzkugel. Muhammad Ali und Joe Frazier haben sich 1975 in Manila gegenseitig zu einer Nahtoderfahrung geboxt. Mike Tyson hat Evander Holyfield ins Ohr gebissen. Arturo Gatti und Micky Ward haben sich drei Mal geprügelt, als wären sie vor einer schäbigen Bar in New York. Sugar Ray Leonard gegen Thomas »Hit Man« Hearns. Tony Zale gegen Rocky Graziano. Boxer begegnen sich allerdings zu selten im Ring, um die langfristige Intensität einer Tennis-Rivalität zu erreichen. Das Endspiel der Australian Open 2017 war das zwölfte Finale bei einem Grand-Slam-Turnier zwischen Roger Federer und Rafael Nadal in 13 Jahren. Serena Williams und Maria Scharapowa haben mehr als 20 Mal gegeneinander gespielt.
Es ist bei einer Rivalität völlig egal, ob 20.000 Menschen im Stadion von Wimbledon sitzen und noch ein paar Millionen vor den Fernsehern weltweit – oder ob nur zwei Leute zusehen wie beim letzten legendären Duell zwischen Martin und mir. Wenn sich zwei Rivalen auf Augenhöhe begegnen, dann endet der Horizont in den Augen des anderen. Es ging bei unserem letzten Spiel gegeneinander um einen Platz in der Trainingsgruppe der Männermannschaft, den wir beide bereits sicher hatten. Wir wollten gewinnen, auch wenn es um rein gar nichts ging.
Ich habe mich vor ein paar Jahren mit Boris Becker über diese Rivalitäten unterhalten, schließlich hatte er sich während seiner aktiven Karriere einige legendäre Duelle geliefert. Mit Stefan Edberg in Wimbledon. Mit John McEnroe im Davis Cup. Mit Michael Stich. »Ich habe sie natürlich alle respektiert – doch gemocht habe ich sie nicht. Sie wollten etwas, das ich auch haben wollte«, sagte Becker, der zu diesem Zeitpunkt der Trainer von Novak Djokovic war. Der sollte am nächsten Tag im Finale der US Open gegen Roger Federer spielen: »Es ist für die Zuschauer zwar möglich, beide Spieler zu mögen – wenn sie jedoch gegeneinander antreten, dann müssen sie sich entscheiden. Es ist unmöglich, so eine Partie zu gucken und zu sagen: Möge der Bessere gewinnen.«
Alles, was Becker da sagte, galt auch für Martin und mich. Wir waren beide 17 Jahre alt bei unserem letzten Duell. Es ging, wie schon gesagt, um rein gar nichts, und es sahen nur Martins Mutter und ein anderer Spieler zu. Wir haben uns über den Platz gejagt, wir haben uns gegenseitig beleidigt – und ich glaube, dass ich einen Schmetterball absichtlich auf seinem Rücken platziert habe. Irgendwann, nach knapp vier Stunden, da stand es 6:6 im dritten Satz. Wir wollten beide aufhören. Nur: Der andere Spieler, der uns zusah, war ein Opportunist – und Opportunisten brauchen immer einen Sieger, dessen Freund sie dann sein können. Er forderte, dass wir einen Tie Break spielen.
Martin und ich haben diesen Tie Break gespielt – wir haben niemals jemandem erzählt, wer gewonnen hat. Wir haben kaum noch stehen können und uns dennoch gegenseitig über den Platz gejagt. Nach dem letzten Punkt haben wir uns am Netz umarmt. Wir haben danach nie wieder gegeneinander gespielt und sind bis heute miteinander befreundet. Wir haben vereinbart, uns irgendwann, zum 50. Geburtstag vielleicht, mal wieder auf dem Tennisplatz zu treffen.
Ach ja: Martin hat den Tie Break gewonnen. Dieses verdammte Arschloch.
Der schönste Sport der Welt
»Tennis ist die perfekte Kombination gewaltsamer Handlungen
in einer Atmosphäre aus Seelenruhe und Beschaulichkeit.«
Billie Jean King
Es gibt zwei Gesichtsausdrücke, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Der eine ist der meiner Frau bei der Geburt unseres Sohnes, der andere der eines Vaters bei einem Tennisturnier. Ich hatte gerade gegen seinen Sohn gewonnen, der, wenn ich ehrlich bin, ein viel besserer Spieler war als ich und nur aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände gegen mich verloren hatte. Dieser Vater identifizierte mich als diese Verkettung unglücklicher Umstände, als eine Art Tennis-Missgeburt, und sah mich angewidert an.
Ich hatte Sand an Schuhen und Kleidung, an Waden und Unterarmen. Ach, ich hatte sogar Sand in den Haaren. Ich hatte an diesem Samstagmorgen nicht Tennis gespielt, sondern Tennis gearbeitet und gekämpft – und der Blick des Vaters teilte mir mit: So ein wilder Rabauke gehört nicht auf einen Tennisplatz. Dann sagte er zu meiner Mutter so was wie: »Geht zurück zum Fußball, ihr Prolls!« Es gab für mich schon damals nichts Schöneres als Siege gegen Leute mit solchen Eltern.
Ich muss zugeben, dass meine Spielweise nicht das war, was man im herkömmlichen Sinne als »schön« bezeichnet. Ich hatte einen waffenscheinpflichtigen ersten Aufschlag und einen zweiten, bei dem die Gegner ein Buch hätten lesen können, bevor sie mir den Return um die Ohren hauten. Ich habe erst vor ein paar Wochen erfahren, dass ich genau deshalb viele Partien verloren habe. Dazu später mehr.
Ich stand bei der Talentvergabe leider nicht in der Schlange, wo technische Fertigkeiten oder Beinarbeit verteilt worden sind. Ich hatte keine Zeit, weil ich zum zweiten Mal dort anstand, wo es geometrisches Denken und Ehrgeiz gab. Menschen mit Sinn für Ästhetik schüttelten bei meinem Ballwurf vor dem Aufschlag, bei meinem Rückhand-Slice und jedem Volley gramgebeut den Kopf, wunderten sich danach allerdings, wie ihr hochbegabter Sohn mit der schön geschwungenen Vorhand und der wunderbaren Beinarbeit gegen eine im Laufe der Partie immer schmutziger werdende Pflaume wie mich verlieren konnte.
Vater und Sohn interpretierten die Niederlage als verrückte Anomalie, als schlechten Tag ihrerseits und Gnade Gottes für mich, doch das stimmte nicht. Ich gewann zu viele Partien auf genau die gleiche Weise, als dass es Zufall hätte sein können. Ich selbst war so was wie eine verrückte Anomalie. Nur wusste ich das nicht. Ich habe das erst durch die Recherche für dieses Buch und meine Gespräche mit zahlreichen Profis und Trainern erfahren. Die Analysen der Experten hörten sich nicht immer nett für mich an, aber sie waren immer korrekt.
Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich Tennis für das schönste Spiel der Welt halte. Natürlich wäre es töricht, ein Buch über eine Sportart zu schreiben, die man nicht besonders mag – meine Beziehung zum Tennis jedoch ist eine besondere. Ich war ein brauchbarer Fußballer, ein ordentlicher Basketballer und ein passabler Tennisspieler, ich habe darüber hinaus für ein Projekt jede einzelne Sportart probiert, die vom Internationalen Olympischen Komitee als solche anerkannt ist. Ich habe mich dabei wacker geschlagen (Biathlon, Rudern), schwer verletzt (Rodeln, Motorradsport) und prächtig blamiert (Synchronschwimmen, Vielseitigkeitsreiten).
Tennis ist für mich die nahezu perfekte Kombination aus allem, was Sport faszinierend macht: Es ist ein Mano-a-Mano-Duell zweier Kontrahenten und damit nicht selten ein hochgradig psychologisches Duell. Es erfordert Schnelligkeit und Explosivität, außerordentliche Hand-Augen-Koordination, Beweglichkeit und Ausdauer. Dieser Sport findet auf einem Feld statt, das aussieht wie eine aufgeklappte Pizzaschachtel: 23,77 Meter lang und im Einzel 8,23 Meter breit, in der Mitte getrennt von einem Netz, das in der Mitte 0,914 Meter und an der Seite 1,07 Meter hoch ist. Dann gibt es noch dieses 6,40 Meter lange und 4,12 Meter breite Aufschlagfeld.
Es geht beim Tennis darum, den Ball so über ein Netz zu schubsen, dass er in einem bestimmten Bereich aufspringt. Rückschlagspiel nennen sie das an deutschen Sporthochschulen, was schrecklich klingt und den einzelnen Sportarten nicht gerecht wird – wenn man sich mal bewusst macht, was bei einem einzigen Schlag passiert. Die Geschwindigkeit des Balles beim Aufschlag: bis zu 240 Kilometer pro Stunde. Bei den Grundschlägen: bis zu 160 Kilometer pro Stunde. Da fliegt einem, außer beim eigenen Aufschlag, eine Filzkugel mit einem Durchmesser von maximal 6,86 Zentimetern entgegen, die übrigens nur deshalb hellgelb ist, weil Anfang der 1970er Jahre jemand erkannte, dass sie dann auf Farbfernsehern besser zu entdecken sind.
Kleiner Exkurs: Es lohnt, mal darüber nachzudenken, welche Regeländerungen in verschiedenen Sportarten die Suche nach dem Besten tatsächlich gerechter gemacht haben – und welche eine Disziplin attraktiver für den TV-Zuschauer machen sollten. Die Farbe des Tennisplatzes bei den US Open (Pantone Blue 2965 U – oder mittlerweile: US Open Blue) ist auf dem Farbspektrum das genaue Gegenteil der Farbe eines Tennisballs, der somit am besten zu erkennen ist. Den Videobeweis (im Tennis Hawkeye genannt) gibt es deshalb, weil der amerikanische Fernsehsender NBC seinen Kunden bei den Olympischen Spielen 1964 in Squaw Valley durch eine Verlangsamung der Geschehnisse faszinierendere Bilder bieten wollte. Die Kampfrichter fragten irgendwann, ob sie sich diese Zeitlupe mal ansehen dürften, um den Sieger zu bestimmen.
Zurück zum Schlag. Wo der Ball letztlich landet, wird durch eine Reihe von Faktoren bestimmt, die der Spieler bestenfalls überhaupt nicht wahrnimmt oder unterbewusst ausführt: Position auf dem Spielfeld, Abstand zum Ball, Winkel des Körpers zu Ball und Spielfeld. Treffpunkt des Balles, Geschwindigkeit des Schlägers, Winkel des Schlägers zu Ball und Spielfeld. Es gibt dann noch diese kleine Bewegung mit dem Handgelenk, um dem Ball ein Schleudertrauma zu verpassen, damit er sich ins Spielfeld senkt oder um den Gegner herumdreht.
Man muss sich das, was da beim Tennis passiert, ein bisschen vorstellen wie Autofahren: Ein Anfänger ist überwältigt von all den Sachen, die er tun muss, um das Fahrzeug überhaupt losrollen zu lassen. Kuppeln. Ersten Gang einlegen. Kupplung loslassen. Gas geben. Hände ans Lenkrad. Blick auf die Straße. Wer ein paar Jahre lang fährt, führt diese Bewegungen aus, als würde er atmen. So funktioniert das auch beim Tennis: Wer lange genug übt, muss nicht mehr darüber nachdenken.
Wer seinen Gegner während einer Partie mal so richtig aus der Fassung bringen möchte, sollte all diese Faktoren während des Seitenwechsels erwähnen und den Gegner bitten, mal darüber nachzudenken – und vielleicht noch externe Faktoren wie Balldruck, Windrichtung oder Platzbeschaffenheit erwähnen. Wer bei der Berechnung der einzelnen Variablen nicht verrückt wird, kann auch den Start einer Rakete zum Mars planen.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der Gegner auf der anderen Seite des Netzes. Ich möchte behaupten, dass jeder Hobby-Tennisspieler schon mal einen Ball perfekt ins Eck geprügelt, einen Passierschlag um den Gegner herumgezwirbelt oder einen gefühlvollen Volleystopp gezaubert hat – so wie wohl jeder Fußballer schon mal den Ball aus 30 Metern im Kreuzeck versenkt hat und auch 50 Jahre später noch darüber berichten darf. Mache ich genauso, dieses Lobpreisen eigener Heldentaten, beim Fußball, beim Tennis und bei noch vielen anderen Sportarten und in beinahe jeder Lebenslage.
Diese ohnehin unmöglich bewusst zu absolvierende Bewegung beim Tennis wird dadurch verkompliziert, dass der Ball nur beim Einspielen schön auf einen zufliegt, danach jedoch vom Gegner so gespielt wird, dass er möglichst schwer oder bestenfalls gar nicht zu retournieren ist. Das ist in anderen Sportarten ähnlich – beim Boxen etwa will einem der andere Typ im Ring andauernd auf die Murmel hauen –, doch wird die eigene Leistung nur selten derart unterschwellig von der Kunst des Gegners beeinflusst wie beim Tennis.
Ich habe mal gegen jemanden gespielt, dessen Fähigkeiten ich bei der Beobachtung einer Partie davor als »lösbar« beurteilt hatte: weiche, nicht allzu platzierte Schläge, mangelnde Fitness, unterdurchschnittlicher Aufschlag. So sah das jedenfalls aus. Er verpasste seinen Spieleröffnungen jedoch einen derartigen Kick, dass der Ball so hoch absprang, dass ich drei Meter hinter der Grundlinie retournieren musste. Seine Vorhand schlug er mit immensem Topspin, bei der Rückhand verwendete er ausschließlich Slice. Um es kurz zu machen: Bis ich mich an diese krummen Bälle gewöhnt hatte, stand es schon 3:6, 1:4 – ich verlor 3:6, 4:6.
Wer diese Partie von außen sah (es war zum Glück niemand da), musste glauben, dass ich einen wahnwitzig schlechten Tag erwischt haben musste. Das stimmte jedoch nicht: Ich kam ganz einfach nicht mit der Spielweise meines Gegners zurecht und verlor völlig verdient. Er gewann danach sogar das Turnier, weil keiner seine Aufschläge beantworten konnte und er einmal pro Satz irgendwie ein Break schaffte.
Das führt zu meinen Partien als Teenager gegen Sebastian Jäger, der später Profi werden sollte, es jedoch niemals in die Top 100 der Welt schaffte. Ich konnte niemals gegen ihn gewinnen, wurde jedoch auch niemals vom Platz geschossen. Meine Eltern waren immer stolz, dass ich ihn teilweise zu spektakulären Schlägen zwang und dass einige Ballwechsel durchaus sehenswert waren. Mit dem Abstand von 25 Jahren und nicht durch die persönliche Brille betrachtet, muss ich zugeben: Sebastian hat damals nicht gegen mich gespielt. Er hat mit mir gespielt, so wie ich nun mit meinem Sohn spiele. Er hat mich mit jedem einzelnen Schlag weiter in die Bredouille gebracht und dann die meisten Punkte locker für sich entschieden. Hin und wieder ging eine Partie 4:6, 4:6 aus. Das klang gut, doch in Wirklichkeit hätte es auch 1:6, 0:6 ausgehen können.
Nur: Es gab Leute, gegen die hatte Sebastian überhaupt keine Chance. Das war die Nummer 100 der Welt. Diese Nummer 100 der Welt hat keine Chance gegen jemanden, der zu den 20 besten Spielern der Welt gehört. Und dann gibt es noch Leute wie Roger Federer oder Novak Djokovic oder Rafael Nadal. Ein Hobbysportler träumt ja davon, mal gegen einen Profi anzutreten und zu überprüfen, ob da nicht doch was ginge. Basketball gegen Michael Jordan. Kicken mit Lionel Messi. Ein Autorennen gegen Sebastian Vettel.
Beim Tennis kann ich sagen: Eine Partie gegen Roger Federer wäre nicht einseitig oder langweilig. Sie wäre absurd. Für mich. Für Federer.
Das ist das nächste Wunderbare an diesem Sport: Die Faktoren Glück und Zufall gehen gleich Null. Es gewinnt womöglich nicht der mit der schöneren Vorhand, aber es gewinnt der an diesem Tag Bessere.
Ich wurde auf den Sandplätzen in Nordbayern sozialisiert, so wie die meisten deutschen Tennisspieler diesen Untergrund ihr sportliches Zuhause nennen. Es gibt ein paar Eigenheiten dieses Geläufs, die den Verlauf einer Partie nicht unerheblich beeinflussen können. Die Bälle verlieren beim Aufprall an Geschwindigkeit und springen aufgrund kleinerer Unebenheiten bisweilen unberechenbar auf.
Ich hatte, wie schon erwähnt, einen ziemlich harten ersten Aufschlag, weil ich das immer wieder daheim im Hof und auf den beiden Hartplätzen in unserem Tennisclub, die niemand nutzen wollte, geübt habe. Es spricht nicht gerade für die sozialen Fähigkeiten eines Zwölfjährigen, wenn er als eines seiner Hobbys angibt: alleine Aufschläge üben. Es half allerdings bei Partien gegen talentiertere Spieler, weil ich meine eigenen Aufschlagspiele mit vier oder fünf brauchbaren Spieleröffnungen gewinnen konnte.
Ich war ein technisch eher minderbegabter Spieler und bin es noch immer – ich war damals jedoch flink und und mit einer Pferdelunge gesegnet und konnte deshalb auch extrem schwierig zu erreichende Bälle locker erlaufen, ins Feld zurückspielen und auf einen Fehler warten. Außerdem war ich mir nicht zu schade, Bällen hinterherzuhüpfen und im Sand zu kugeln und spätestens nach dem dritten Spiel auszusehen wie ein Tough-Mudder-Teilnehmer.
Das alles führte oftmals dazu, dass meine Kontrahenten mich in den ersten vier Minuten des Warmspielens gar nicht mal so heimlich auslachten und sich sicher waren, diese Partie locker zu gewinnen. Einer sagte nach ein paar Schlägen sogar mal zu seiner Mutter, die draußen wartete: »Das sind doch keine Gegner.« Beim Aufschlagtraining wunderten sie sich womöglich kurz, machten sich aber keine größeren Sorgen. Mitte des ersten Satzes verfielen sie in Selbsthass aufgrund der zahlreichen leichten Fehler, ein paar Minuten später mündete es in Selbstbeschimpfung und Schlägerwerfen und gegen Ende des ersten Durchgangs in Halsschlagaderzerrung und Hirnaneurysma. Gegen den Typen, der mich einen Nicht-Gegner schimpfte, gewann ich 6:4, 6:0.
Wenn meine Gegner den ersten Satz verloren, erkannten sie die Unsinnigkeit, gegen diese Verschwörung von Natur, Universum und vielleicht sogar Gott höchstpersönlich anzukämpfen – und gaben einfach auf. Das häufigste Ergebnis meiner aktiven Turnierzeit: 7:6, 6:0. Es kam sogar einmal zum Ergebnis 6:7, 6:0, 6:0. Das war die Partie, nach der ich vom Vater meines Gegners diesen Todesblick kassierte, weil ich es gewagt hatte, seinen Sohn zum Verzweifeln und am Ende gar zum Heulen zu bringen.
Was ich übrigens als Jugendlicher aus diesen Partien gelernt habe: gar nichts. Ich hielt mich für eine Mischung aus Boris Becker und Goran Ivanisevic – und es für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass in Europa ausschließlich auf diesem blöden Sand gespielt wurde. Auf einem schnelleren Hartplatz wie etwa bei den US Open oder gar auf Rasen wie in Wimbledon, da war ich mir ganz sicher, würde ich zu den weltbesten Akteuren gehören. Ich redete mir tatsächlich ein, dass ich, wenn ich es irgendwie in die USA schaffen würde, durchaus Profi werden könnte.
Um es kurz zu machen: Auf Rasen ist ein Slice-Service viel effizienter als mein geprügelter erster Aufschlag, auf Hartplatz kann man nicht so schön rutschen und kugeln wie auf Sand. Meine Fähigkeiten waren darauf beschränkt, mit dem ersten Aufschlag Druck zu machen und auf Sand gegen psychisch instabile Gegner zu gewinnen. Wer gegen mich geduldig spielte (und noch heute geduldig spielt) und nicht an sich zweifelte (und auch heute nicht zweifelt), der durfte (und darf) mir eine Lehrstunde erteilen. Dann übrigens wurde ich zu einem Nervenbündel, verschlug 90 Prozent meiner ersten Aufschläge und bearbeitete gelegentlich den Untergrund mit meinem Schläger, bis einer von beiden (meist der Schläger) aufgab. Noch so ein häufiges Ergebnis deshalb: 6:7, 0:6.
Deshalb gibt es noch einen dritten Gesichtsausdruck, den ich in meinem Leben nie vergessen werde: den meines Vaters nach so einer Niederlage, bei der ich zuerst öffentlich meinen Hass auf den Untergrund, dann auf den Gegner und die Zuschauer und schließlich auf mich selbst kundgetan und nebenbei noch einen Schläger zertrümmert habe. Er nahm mich in den Arm und tat so, als wollte er mich trösten. Ich sah aber, wie er sich bei meinem Gegner, dessen Vater und so ziemlich jedem Anwesenden entschuldigte. Sein Blick sagte: Was kann ich dafür? Der Bengel wird weitgehend von seiner Mutter erzogen.
Null-Null, Fünf-Satz-Langweiler und warum manche Spieler öfter gewinnen
»Egal, wie gut ich spiele –
ich werde nie so gut sein wie eine Mauer.«
Mitch Hedberg
Wer schon mal ein Match verloren hat, weiß: Es gibt kaum etwas Schlimmeres als diesen Spaziergang vom Platz zurück zur Umkleidekabine. Wer es im Leben besonders schlecht getroffen hat, dessen Weg führt vorbei an vielen anderen Plätzen, der Spielerterrasse oder gar der Theke des Vereinswirtshauses. Der Sieger darf allen Anwesenden das Ergebnis verkünden und womöglich gar ein wenig über seine Heldentat philosophieren, der Verlierer muss mit gesenktem Kopf nebenherlaufen und darf seine Leistung noch nicht einmal schönreden oder irgendwie begründen. Er muss die Klappe halten.
Diese ungeschriebene Regel führte zu einem der peinlichsten Momente meines Teenagerdaseins: Halbfinale der Bezirksmeisterschaft gegen Stefan Oberndorfer, auf einem Platz der Anlage, den nur Menschen finden, die auch einem Mausoleum entfliehen können. Zuschauer: zwei, die beiden Mütter, die sich aufgrund früherer, durchaus dramatischer Drei-Satz-Duelle bis Mitternacht angefreundet hatten und die Partien zwischen uns eher als Kaffeeklatsch denn als sportliches Ereignis betrachteten.
Stefan war mit außerordentlichem Talent und Ballgefühl gesegnet, er spielte tatsächlich Tennis. Ich dagegen kämpfte und rannte Tennis, ich prügelte und wühlte Tennis, hin und wieder hechtete ich auch Tennis. Das war kein Problem für mich, weil ich als Teenager schwitzte wie ein Berserker auf Raubzug, weshalb ich bei 30 Grad im Schatten locker fünf Stunden lang durchhielt, solange ich genügend Wasser in mich hineinkippte und ausreichend Hemden zum Wechseln dabeihatte. Schwitzen ist keine Eigenschaft, die einen als Teenager beliebter werden lässt. Bei Duellen gegen technisch begabtere Spieler kann es allerdings zu erstaunlichen Resultaten führen.
Stefan und ich bekämpften uns an diesem Tag fast zwei Stunden lang, es war eine packende Partie mit einigen herrlichen Ballwechseln. Es sah nur keiner, weil selbst unsere Mütter irgendwann mal nachfragten, wie es denn überhaupt stehen würde. Nach dem Match gingen wir auf diesen verschlungenen Wegen zurück zum Clubhaus und wurden von wirklich jedem einzelnen Menschen auf der Anlage nach dem Ergebnis gefragt.
Da liefen wir, der als Teenager vom Schweiß verschonte Stefan und sein Gegner mit knallrotem Kopf, der so aussah, als hätte er im Monsun einen Marathon absolviert. Stefan teilte den Leuten mit, und das Gelangweilte in seiner Stimme sorgt noch heute für nervöses Zucken in meinen Augen: »Null-Null.«
Ich hatte verloren. 0:6, 0:6. Eine Brille. Zwei Löcher. Eine der größtmöglichen Demütigungen in diesem Sport. Das Kuriose daran: Die Partie hatte länger als zwei Stunden gedauert. Bei elf der zwölf Spiele hatte es irgendwann mal »Einstand« geheißen, bei neun davon hatte ich einen Spielball. Es hätte, und das rede ich mir heute noch ein, nach zwölf Spielen also auch 6:3, 3:0 für mich heißen können. Das Ergebnis war jedoch: Null-Null.
So ein Null-Null kommt häufiger vor, als man vielleicht denken mag. Legendär ist freilich das French-Open-Finale 1988, bei dem Steffi Graf ihre Gegnerin Natascha Zvereva mit diesem Ergebnis demütigte. Sie ließ sich dafür allerdings Zeit, das kürzeste Grand-Slam-Finale der Geschichte gewann Suzanne Lenglen im Jahr 1922 in Wimbledon: Sie brauchte für das 6:2, 6:0 gegen Molls Mallory gerade mal 20 Minuten. Das kürzeste Finale bei den Männern: 36 Minuten. 1881 in Wimbledon beim 6:0, 6:1, 6:1 von William Renshaw gegen John Hartley.
Ende der Leseprobe





























