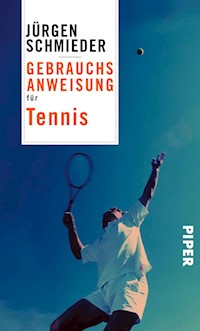8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kaum aufgewacht – schon straffällig: unsere alltäglichen Rechtsbrüche und Gesetzesverstöße
Wir alle sind Verbrecher. Wir fahren zu schnell, wir stehlen Handtücher aus Hotels, wir betrügen bei der Steuererklärung, wir saugen Filme aus dem Internet. Doch zugeben würden wir es nie. Dabei beläuft sich der volkswirtschaftliche Schaden solcher Untaten auf mehr als eine Billion Euro pro Jahr. Wie wäre es, wenn man ein Jahr lang jeden Tag 24 Stunden von einem Polizisten begleitet würde? Jürgen Schmieder hat es gewagt. Er versucht, ein Jahr lang gesetzeskonform zu leben, im Einklang mit unseren mehr als 100 000 Gesetzen und Verordnungen. Ein schwieriges Unterfangen, wo ihn doch schon deren Lektüre schier in den Wahnsinn treibt. Er sieht sich gezwungen, seine Frau anzuzeigen, verfolgt einen russischen Milliardär, bekommt sogar eine Todesdrohung … Am Ende steht die Erkenntnis, dass es viel zu viele Gesetze gibt, aber kaum jemand dafür sorgt, dass die wirklich wichtigen eingehalten werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Jürgen Schmieder
Mit einem Bein im Knast
Mein Versuch, ein Jahr lang gesetzestreu zu leben
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. 1. Auflage
© 2013 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: buxdesign, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-08966-5V002
www.cbertelsmann.de
Inhalt
Kapitel 1 321835,92 Euro!
Kapitel 2 Im Paragrafendschungel
Kapitel 3 Atmen ist noch erlaubt
Kapitel 4 Wir sind alle Verbrecher
Kapitel 5 Liebe Ehefrau, ich zeige dich an!
Kapitel 6 Das Gesetz bin ich!
Kapitel 7 Gesetzesbrecher I: Der Pokerspieler
Kapitel 8 Durchgefallen!
Kapitel 9 Gesetz gebrochen! Na und?
Kapitel 10 Verbrechen lohnt sich
Kapitel 11 Die Abmahner
Kapitel 12 »Versicherer sind die größten Schweine!«
Kapitel 13 Wie krumm darf eine Gurke sein?
Kapitel 14 Gesetzesbrecher II: Der Drogendealer
Kapitel 15 Der Letzte zahlt die Rechnung
Kapitel 16 Du lebender Ödipuskomplex!
Kapitel 17 Ich bin Anwalt! Ich auch! Ich auch!
Kapitel 18 27000 Euro für ein Fußballspiel
Kapitel 19 Liebe Ehefrau, jetzt muss ich dich verprügeln!
Kapitel 20 Gehen Sie ins Gefängnis!
Kapitel 21 Gesetzesbrecher III: Der Räuber und Erpresser
Kapitel 22 Pay and Pray!
Kapitel 23 Das metastasierende Geschwür
Kapitel 24 Gesetzesbrecher IV: Der Schwarzarbeiter
Kapitel 25 Warten auf den großen Knall
Kapitel 26 Der gläserne Mensch
Kapitel 27 Ich, Anonymus
Kapitel 28 Gesetzesbrecher V: Die Nutte
Kapitel 29 Früher war alles besser
Kapitel 30 Was wirklich jeder darf
Kapitel 31 Die Chance deines Lebens
Kapitel 32 Gesetzesbrecher VI: Der Schmuggler
Kapitel 33 Wehrt euch!
Kapitel 34 Was brauchst du?
Kapitel 35 Generation Zuseher
Kapitel 36 Die Gesetze und wir
Kapitel 37 Dieser Jemand bist du!
Dank
Die in diesem Buch geschilderten Situationen habe ich erlebt. Ich habe sie nicht so aufgeschrieben, wie sie tatsächlich passiert sind – sondern wie ich mich an sie erinnere. Einige Namen habe ich geändert, um den Ruf, die Freiheit oder zumindest die Ruhe der erwähnten Personen nicht zu gefährden. Sollten Sie glauben, dass Sie gemeint sind, dann sei Ihnen hiermit versichert: Sie sind nicht gemeint!
Kapitel 1 321835,92 Euro!
321835,92 Euro.
Das ist die Strafe, die mein Freund Adam für seine Untaten im Jahr 2012 bezahlen müsste. Er wäre pleite. Ruiniert. Es ist die Summe der Bußgelder und Strafen für Sachen, die er innerhalb eines Jahres angestellt hat.
321835,92 Euro.
Er käme vielleicht nicht ins Gefängnis – aber mit einem Bein stünde er im Knast. Aufgrund der Vielzahl der Vergehen wäre es durchaus möglich, dass er wegen mangelnder Einsicht eine Bewährungsstrafe bekommen würde. Sicher allerdings ist: 2013 würde er den zweiten Fuß ins Gefängnis nachziehen. Dieser Verbrecher müsste in den Knast.
Adam ist kein Verbrecher, er ist noch nicht einmal ein Gauner. Er war noch nie im Gefängnis, er stand in seinem Leben bislang nur als Zeuge vor Gericht, mit Anwälten hatte er nur zu tun, wenn er einen Vertrag für seine Firma aushandeln musste. Er hat ein paar Strafzettel wegen Falschparkens und zu hoher Geschwindigkeit bekommen, als Teenager wurde er mal beim Klauen erwischt – ansonsten jedoch ist Adam ein Vorzeigebürger.
Einer, wie man ihn sich wünscht.
Einer, der so ist wie wir.
Denkt er.
Denken wir.
Und der hat innerhalb eines Jahres Verbrechen und Ordnungswidrigkeiten im Wert von 321835,92 Euro begangen.
Natürlich ist die Summe fiktiv. Sie wäre nur dann real, wenn Adam 24 Stunden am Tag von einem Polizisten begleitet würde und alle Taten zur Anzeige gebracht würden. Wenn also auch dann einer aufgepasst hätte, wenn er sich unbeobachtet gefühlt hat. Menschen machen recht verrückte Sachen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen: Sie popeln in der Nase. Sie singen unter der Dusche. Sie brechen das Gesetz.
Ich habe Adam begleitet und hatte dabei stets Kontakt zu zwei Polizisten, einem Finanzbeamten, einem Beamten auf der Bußgeldstelle, zwei Rechtsanwälten, einem Richter und einem Steuerberater. Es war ein Live-Ticker des Rechts, wir hatten stets sämtliche Informationen zum Vergehen, zum möglichen Verfahren und zur zu erwartenden Strafe im Falle eines Vergleichs, einer Abmahnung oder einer Gerichtsverhandlung. Dann habe ich gerechnet.
Aufgedröselt sieht das so aus:
Urheberrechtsverletzungen auf seiner Facebook-Seite: 12000 Euro.
Andere Urheberrechtsverletzungen: 101795,92 Euro.
Diebstahl: 100 Euro.
Steuerhinterziehung: 11200 Euro.
Versicherungsbetrug: 1490 Euro.
Schmuggel: 750 Euro.
Beleidigungen und üble Nachrede: 128000 Euro.
Delikte im Straßenverkehr: 37500 Euro – wobei in diesem Fall anzumerken wäre, dass er seinen Führerschein für etwa sieben Jahre abgeben müsste, weshalb in den kommenden Jahren in diesem Bereich keine Strafen zu erwarten wären.
Andere Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten wie Zigaretten auf die Straße werfen oder ohne Helm radfahren oder einen Hund ohne Leine im Englischen Garten spazieren führen: 29000 Euro.
Macht insgesamt 321835,92 Euro.
Natürlich wird kein Mensch in Deutschland 24 Stunden pro Tag kontrolliert und niemand für all seine Vergehen sofort angeklagt und bestraft. Adam hält sich für einen Menschen, der noch nie in seinem Leben das Gesetz gebrochen hat. Mittlerweile hat er jedoch akzeptiert, dass diese Summe vollkommen in Ordnung ist. Und er behauptet, dass andere noch viel mehr bezahlen müssten.
Adam hat diese Taten begangen – und nur weil sie niemand kontrolliert hat, werden sie nicht ungeschehen. Und er hat in nicht wenigen Fällen anderen damit geschadet. Irgendjemand muss den Schaden bezahlen – über höhere Steuern, höhere Versicherungsbeiträge oder steigende Kosten für die Reinigung der Straße.
Den wahren Charakter eines Menschen erkennt man in jenen Momenten, in denen er sich unbeobachtet fühlt.
321835,92 Euro.
Das ist eine unfassbare Summe – aber sie stimmt. Anwälte, Polizisten, Richter und Beamte haben sie bestätigt. Adam, der Vorzeigebürger, begeht offensichtlich pro Jahr mehr Verbrechen und Ordnungswidrigkeiten, als er sich leisten kann. Wir alle begehen mehr Verbrechen und Ordnungswidrigkeiten, als wir uns leisten können.
Aber kaum jemand von uns wird zugeben, ein Verbrecher zu sein. Warum ist die Summe dann nicht 0 Euro?
Kann man ein Jahr lang überstehen, ohne auch nur ein Gesetz zu brechen oder eine Ordnungswidrigkeit zu begehen? Ist das möglich?
Ich will es versuchen. Ich möchte ein Jahr lang so tun, als stünde ständig ein Polizist neben mir und würde mich kontrollieren.
Ich möchte, dass die Summe, die letztlich in meinem Sündenregister vermerkt wird, bei 0 Euro liegt. Noch glaube ich, dass es möglich ist.
Ich will mich ein Jahr lang an alle Gesetze und Verordnungen halten, die es in Deutschland gibt. Das Gesetz bin ich!
Der Plan scheint perfekt: Ich muss einfach nur ein Jahr lang das tun, was ohnehin von mir verlangt wird. Wahrscheinlich denken jetzt alle: »An Gesetze halten? Kein Problem! Das tu ich doch sowieso!« Keine Sorge, das denke ich auch. Noch.
Ich will mich mit ein paar Polizisten unterhalten, mit Anwälten und Richtern. Vielleicht jedes fünfte der Beamtendeutsch-Wörter in meinem Block notieren und daraus ein Lexikon »Anwalt – Deutsch, Deutsch – Anwalt« machen. Vielleicht noch ein paar verrückte Gesetze finden, über die der Witze reißen kann, der sich für einen ganz tollen Nachwuchskabarettisten hält. Am Ende vielleicht noch voller Betroffenheit ein ernstes Kapitel mit dem Zusatz hinzufügen, dass es zu viele Gesetze in Deutschland gibt, sowie noch ein paar lustige Wörter zur Bürokratie und Gesetzestreue der Deutschen.
Leicht verdientes Geld.
Leider ist der Plan nicht perfekt.
Noch ahne ich nicht, dass dieses Vorhaben, ein Jahr lang nach allen deutschen Gesetzen zu leben, verdammt schwierig ist. Dass es unmöglich ist.
Wer sich ein Jahr an alle Gesetze hält, der sieht, wie es wirklich zugeht in Deutschland – und stellt fest, dass er viele Dinge lieber nicht gesehen hätte.
Kapitel 2 Im Paragrafendschungel
Robinson Crusoe hatte deutsche Gene in sich. Er wurde zwar in York geboren und war damit englischer Staatsbürger, doch sein Vater war ein deutscher Kaufmann aus Bremen, der nach England ausgewandert war. Die Geschichte von Daniel Defoe über den Seefahrer und Abenteurer ist deshalb natürlich Quatsch. Sie muss so gehen:
Crusoe vermisst erst einmal die Insel, zäunt sie ein und sucht die Inselverwaltung, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Nach zwei Stunden Suche beschwert er sich, dass es keine Behörde gibt, und notiert in seinem Logbuch, dass er den Reiseveranstalter sofort auf Rückerstattung der Hälfte des Preises verklagen werde. Die fehlenden sanitären Einrichtungen, da ist er sich sicher, könnten nochmals zehn Prozent wert sein. Und natürlich fehlt der Balkon. Ach was, das ganze Hotel fehlt!
Dann lernt er Freitag kennen – und verlangt, dass der bitte schön nur genormte Kokosnüsse bringen möge und um 22 Uhr sein Feuer am Strand ausmachen soll, um die abendliche Ruhe nicht zu stören. Natürlich arbeitet er für sich und Freitag einen exakten Plan aus, wer wann mit welchem Gerät Fische zu fangen hat – und führt sogleich Disziplinarstrafen für den Fall ein, dass Fischfangquoten nicht erreicht werden. Gleich am ersten Tag muss Freitag vier genormte Kiwis abliefern, weil er den spitzen Speer für die Jagd verwendet hat und außerdem dort gefangen hat, wo Robinson das Schild »Jagen verboten« errichtet hat.
Robinson gründet einen Verein für Krebszucht und fordert von Freitag, ebenfalls einen zu gründen. Die Vereine schließt Robinson zusammen zu einem Verband mit strikten Regeln und einem Spielplan, der festlegt, wann die Krebse zum Wettlauf miteinander anzutreten haben und an welchem Strand die nächste Weltmeisterschaft stattfindet. Dann beschwert er sich über den Wildwuchs der Bäume; den Bau einer Hütte verhindert er, weil sie nicht den baulichen Vorschriften entspricht, die Brandschutzverordnungen verletzt und sowieso nicht ins Inselbild passt.
Dann noch kurz Etiketten mit Ampelkennzeichnung auf die Bananen gepappt, ein Rauchverbot am Strand und eine Kleidergrößennorm eingeführt – und es ist fast perfekt. Dann nämlich sitzt Robinson abends vor seiner Hütte und beschwert sich darüber, welche Unzahl von Gesetzen es auf der Insel gebe und dass das alles entbürokratisiert gehöre.
Deutschland ist das Land der Gesetze und Normen – das stelle ich fest, als ich meine erste Gesetzessammlung aufschlage. Ich habe bereits 50 Bücher zum Thema Gesetze gelesen und festgestellt, dass Jura so trocken ist, als würde man Salzstangen mit Sandkuchen und Vollkornbrot essen und das Ganze mit einem Löffel Zimt hinunterspülen. Dennoch bin ich auf dieses Projekt in etwa so vorbereitet wie ein Bundesliga-Manager-Spieler auf einen Job als Sportdirektor beim FC Bayern oder ein Call-of-Duty-Zocker auf eine Schlacht in Afghanistan.
Aber es gibt ja den Schönfelder.
Zu behaupten, dass es sich beim Schönfelder um ein dickes Buch handelt, das ist ungefähr so, als würde man behaupten, dass der Mount Everest ein ziemlich hoher Hügel sei. Die Sammlung der wichtigsten deutschen Gesetze und Verordnungen ist neun Zentimeter dick und 2,385 Kilogramm schwer, die Seiten sind so dünn, dass man hindurchsehen kann. Es ist ein riesiger Wälzer, durchaus geeignet für Muskelübungen. Ich habe mir als Gegengewicht den Sartorius besorgt, ebenso dick und fast so schwer wie der Schönfelder und bestückt mit Verwaltungsgesetzen. Insgesamt sind das knapp fünf Kilo Gesetze – und da sind noch nicht einmal alle drin, die es in Deutschland gibt. Es gibt noch den Aichberger mit Gesetzen zum Sozialrecht und den Nipperdey zum Arbeitsrecht und auch eine Sammlung der Steuergesetze von Georg Müller, aber kein Buch ist so bedeutsam wie der Schönfelder.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was Dr. Heinrich Schönfelder eines Tages dazu veranlasst hat, die wichtigsten deutschen Gesetze zwischen zwei Buchdeckel zu pressen. Womöglich war er ein Fan des Alten Testaments und insbesondere von Moses, womöglich dachte sich Schönfelder: Steintafeln sind nicht mehr en vogue, aber ich könnte etwas herstellen, das genauso schwer ist. Wenn Kollege Sartorius mitmacht, dann wird das großartig aussehen, wenn künftig ein Anwalt in seiner Robe daherkommt und unsere beiden Bücher präsentiert, als wären sie Gottes Gesetze.
Das erste Mal habe ich das Buch während meiner Studienzeit an der Universität Regensburg gesehen. Ich dachte immer, das Herumtragen dieses dicken roten Buches wäre das Aufnahmeritual einer Studentenverbindung: Wer seinen Schönfelder vergisst, muss auf der nächsten Wohnheimparty einen Schnaps trinken. Doch es war anders: Der Schönfelder war die Bibel der Jurastudenten, das heilige Buch, das Nekronomikon des Rechts. Die Studenten zitierten daraus, als wäre darin der Code für ein glückliches Leben enthalten oder zumindest die Blaupause für erfolgreiche Gerichtsverhandlungen. Auch in Gerichtsshows steht der Schönfelder immer auf dem Pult.
Ich habe die aktuelle Ausgabe von vorne bis hinten durchgelesen.
Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Warnhinweis geben: Wer jemals vorhat, sich als Nichtjurist durch den Schönfelder von Buchbrust zu Buchrücken durchzuarbeiten, dem rate ich dringend, sich einem Psychiater anzuvertrauen oder zumindest einem Taxifahrer, der Psychologie oder Jura studiert hat. Ich habe in meinem Leben langweilige Bücher gelesen wie etwa Schoßgebete von Charlotte Roche, schwierige wie Krieg und Frieden von Leo Tolstoi – und aufgrund des Vornamens meines Sohnes habe ich mich sogar an wahnsinnige Bücher wie Finnegans Wake von James Joyce gewagt und bis Seite 20 durchgehalten.
Doch der Schönfelder ist die Vereinigung aller drei Kategorien in einem Buch – und es ist mir bis heute nicht klar, warum in Guantanamo komplizierte Folterwerkzeuge eingesetzt werden. Die amerikanischen Soldaten müssen die Gefangenen nur zwingen, die deutschen Gesetze auswendig zu lernen. Nach zwei Tagen wäre jeder Terrorist ein gebrochener Mensch.
Der Schönfelder überragt nicht nur mit seiner Wucht, sondern auch mit seinem Inhalt. Wer von der Quantität nicht überrollt wird, der wird von der Qualität der Texte geplättet. Es ist, als hätte ein erlesenes Team aus Schriftstellern möglichst komplizierte Sätze formuliert. Dann haben Franz Kafka und Thomas Mann eine Vorauswahl getroffen, Roger Willemsen ist als Lektor tätig gewesen und hat dafür gesorgt, dass auch ganz sicher kein Mensch mehr einen Satz versteht.
Wissen für Nichtjuristen
Heinrich Schönfelder war wäh-rend der Nazi-Diktatur in Deutsch-land Mitglied der NSDAP. Von 1936 an waren Gesetze mit den Ord-nungsnummern 1 bis 19 den Geset-zen der NS-Diktatur vorbehalten. Nummer 1 war das Parteipro-gramm der NSDAP.
Zusammengesetzt wurden die Sätze dann vom Regisseur des Films Der englische Patient, der sich darum kümmerte, dass auch wirklich nichts Spannendes oder Interessantes übrig bleiben würde.
Schon beim Lesen der Schnellübersicht habe ich das Gefühl, dass dieses Buch einen Teil meiner Seele einfach in sich aufsaugt, mindestens aber die rechte Hälfte meines Gehirns einfach grillt. Da stehen Begriffe wie »Partnerschaftsgesellschaftsgesetz« und »Untersuchungshaftvollzugsordnung« und »Aufwendungsausgleichsgesetz«, aber auch Abkürzungen wie »REITG«, »CISG« und »RiStBV«.
Es gibt das »AtHaftProtParis2004G«, und es geht darin um nichts weniger als das »Gesetz zu den Protokollen vom 12. Februar 2004 zur Änderung des Übereinkommens vom 29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie in der Fassung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 1964 und des Protokolls vom 16. November 1982 und zur Änderung des Zusatzübereinkommens vom 31. Januar 1963 zum Pariser Übereinkommen vom 29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie in der Fassung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 1964 und des Protokolls vom 16. November 1982«. Alles klar?
Es gibt auch die »JArbSchSittV«, eine »Verordnung über das Verbot der Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren mit sittlich gefährdenden Tätigkeiten«, die »ZAGMonAwV«, eine »Verordnung zur Einreichung von Monatsausweisen nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz« – und natürlich die »GASV«, die »Verordnung zur Bestimmung von weiteren grundlegenden Anforderungen an Geräte sowie zur Bestimmung von Äquivalenzen nationaler Schnittstellen und Geräteklassenkennungen auf dem Gebiet der Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen«.
Ich habe mir das wirklich nicht ausgedacht.
Es gibt auch ein Gesetz, wann sich ein Ort »Luftkurort« nennen darf – also quasi gesetzlich vorgeschrieben ist, dass die Luft dort besser zu sein hat als an anderen Orten. In Bayern ist das der Paragraf 9 in der »Verordnung über die Anerkennung alsKur- oder Erholungsort und über die Errichtung desBayerischen Fachausschusses fürKurorte, Erholungsorte und Heilbrunnen«.
Was passiert mit einem Menschen, der den Schönfelder liest?
Wissen für Nichtjuristen
Das Verunglimpfen ausländischer Flaggen wird ähnlich hart bestraft wie das Verunglimpfen der deut-schen Flagge. (§ 104 StGB)
Ich habe mich zurückgezogen auf die Burg Feuerstein in Franken. An diesem Abend ist die Burg leer, es gibt nur den Schönfelder und mich. Ich beginne um 17 Uhr und lese die ersten 500 Paragrafen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Dafür brauche ich gut zwei Stunden – nur um am Ende zu bemerken, dass ich alles vergessen habe, was an diesem Tag zuvor passiert ist. Ich habe über Personen und Tiere gelesen, über Rechtsgeschäfte, Schuldverhältnisse und deren Erlöschung, über Tausch und Teilzeit-Wohnrechteverträge – und habe festgestellt, dass mein Gehirn für jedes neue Gesetz eine schöne Erinnerung aus meinem Leben gelöscht hat. Der Schönfelder ist das schwarze Loch der Literatur: Sorry, du unglaublich hübsche Frau aus dem ersten Semester – ich habe keine Ahnung mehr, wie du heißt und wie du ausgesehen hast. Es liegt weder an dir noch an mir. Der Schönfelder ist schuld.
Bei Paragraf 1000 des BGB, in dem es um das Zurückbehaltungsrecht des Rechtvorgängers geht, vergesse ich, wann meine Frau Geburtstag hat. Dieser Paragraf heißt »Verbindlichkeiten zu Lasten der Abkömmlinge« und hat damit zu tun, dass ich offensichtlich für die Schulden meines Vaters aufkommen muss, wenn er einmal stirbt. Bei Paragraf 1240 muss ich aufhören, zum einen ist es bereits vier Uhr morgens, zum anderen finde ich, dass der Paragraf zu Gold- und Silbersachen ein perfekter Moment für eine Pause ist: »Gold- und Silbersachen dürfen nicht unter dem Gold- und Silberwert zugeschlagen werden.« Das hilft bestimmt bei der nächsten Finanzkrise.
Am nächsten Tag mache ich weiter. Paragraf 2000 handelt von der Unwirksamkeit der Fristbestimmung, um fünf Uhr morgens bin ich beim letzten Paragrafen angelangt. Er trägt die Nummer 2385 und regelt die »Anwendung auf ähnliche Verträge«, was ich als einen doch recht misslungenen Abschluss empfinde. Ich meine, man hätte ja durchaus mit Mord aufhören oder zumindest ein Happy End mit einem neuen Gold- und Silberparagraphen wählen können. Ein Paragraf über ähnliche Verträge wirkt da ein wenig unbefriedigend.
Ich bin fertig, ich habe das Bürgerliche Gesetzbuch von vorne bis hinten durchgelesen. Ich würde nun gerne meine Frau anrufen, doch ich habe leider vergessen, wie sie heißt. Dafür weiß ich nun, dass eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, der Genehmigung des Familiengerichts bedarf. Und ich weiß, dass die Kündigung eines Mietverhältnisses unzulässig ist, wenn der Vertrag auf Lebenszeit geschlossen wurde. Ich weiß auch das: Bei der Ausübung einer Grunddienstbarkeit hat der Berechtigte das Interesse des Eigentümers des belasteten Grundstücks tunlichst zu schonen.
Dafür habe ich meinen Hochzeitstag vergessen. Nicht das Datum – nein, für einige Stunden habe ich nicht mal eine Ahnung, was an diesem Tag vorgefallen ist. Dafür weiß ich, dass ich mich scheiden lassen dürfte, wenn ich bei der Eheschließung nicht gewusst hätte, dass es sich um eine Eheschließung gehandelt hat: »Eine Ehe kann ferner aufgehoben werden, wenn die Ehe im Zustand der Bewusstlosigkeit geschlossen wurde.«
Ich habe 480 Seiten und 2385 Paragrafen gelesen – und stelle fest, dass ich damit nicht einmal ein Zehntel des kompletten Schönfelders geschafft habe.
Man kann sich das BGB mittlerweile auch anhören, vorgelesen von Christoph-Maria Herbst. Ich habe zehn Minuten durchgehalten: Es geht weniger darum, einem Menschen die Gesetze näherzubringen, sondern darum, Junkies ruhigzustellen, bei denen harte Drogen keine Wirkung mehr zeigen.
Zur Ablenkung sehe ich mir weiter hinten die Verkehrsschilder an, die es in Deutschland gibt, dann schlafe ich ein und träume von einem Vorfahrtszeichen und diesen Sätzen: »Mit einem Vermächtnis kann der Erbe oder ein Vermächtnisnehmer beschwert werden. Soweit nicht der Erblasser ein anderes bestimmt hat, ist der Erbe beschwert.«
Wir glauben, kaum mit dem Gesetz in Berührung zu kommen. Doch Gesetze und Verordnungen berühren uns nicht nur, sie springen uns jeden Tag an. Es gibt einen Zehn-Stufen-Plan, wie die meisten von uns mit dem Gesetz umgehen:
1.»Das Gesetz bin ich!« Wir sind allwissend, wir haben alles gesehen und alles erlebt. Wir müssen weder Gesetzestexte noch Bedienungsanleitungen noch Packungsbeilagen lesen. Was wir nicht wissen, das existiert nicht.
2.»Das weiß doch jeder!« Wir wollen zwar gerne Individualisten sein, am Ende jedoch sind wir Lemminge, die dorthin rennen, wo alle hinlaufen. Wenn alle seit 40 Jahren behaupten, dass etwas so ist, wie alle es behaupten, dann kann das doch nicht falsch sein. Denken wir. Wer am Stammtisch recht bekommt, der bekommt auch vor Gericht recht. Denken wir. Der Komiker Werner Koczwara wollte in einer Fernsehshow einen Witz machen und sagte: »Die Zehn Gebote haben 179 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung hat 300 Wörter – und die EU-Verordnung über die Einfuhr von Karamellbonbons hat 23911 Wörter.« Der Satz wurde zitiert. Von Komikern, Journalisten, Stammtischphilosophen – bis ihn alle für wahr hielten. Selbst Juristen und Politiker.
3.»Das ist mein gutes Recht!« Irgendwann merken wir, dass das, was wir für wahr gehalten haben, vielleicht doch falsch sein könnte. In Koczwaras Fall: Die Zehn Gebote haben nicht 179 Wörter, sondern nur 63, dafür hat die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 1322 Wörter. Und die Verordnung über die Einfuhr von Karamellbonbons? Die gibt es gar nicht. Nun beginnen wir, Gesetze zu lesen – aber nur die, die uns versichern, dass wir im Recht sind. Das wäre ja noch schöner, wenn da einer daherkäme und etwas für falsch erklärt, was wir für richtig halten.
4.»Wir sehen uns vor Gericht!« Es gibt einen schönen Witz über Briten, der geht so: »Was macht ein Brite, wenn er eine Schlange sieht? Er stellt sich hinten an.« Man könnte diesen Witz umschreiben in: »Was macht der Deutsche, wenn er ein Gericht sieht? Er prozessiert.« Es gibt etwa den Fall eines Gabelstaplerfahrers, der betrunken zur Arbeit erschienen war, obwohl in seinem Arbeitsvertrag deutlich stand, dass er nüchtern sein muss, wenn er arbeitet. Der Vorarbeiter schickte ihn nach Hause, der Betrieb sendete eine Kündigung. Fall erledigt? Nein, natürlich nicht. Der Gabelstaplerfahrer klagte, dass er mitnichten betrunken gearbeitet habe, schließlich sei er ja daran gehindert worden – und in seinem Vertrag steht, dass er nur entlassen werden kann, wenn er betrunken arbeitet. Welcher kranke Geist kommt auf die Idee, tatsächlich gegen diese Entlassung zu klagen? Ein kluger kranker Geist, denn der Staplerfahrer bekam vor dem Landgericht Frankfurt tatsächlich Recht und musste wieder eingestellt werden.
5.»Das kann doch gar nicht sein!« Wir verlieren vor Gericht – doch jetzt fängt der Spaß erst an. Denn natürlich haben wir immer noch recht, der Richter hat lediglich einen Fehler gemacht und sich geirrt. Denn: Bei Gericht bekommt man keine Gerechtigkeit, sondern ein Urteil.
6.»Ich wusste es!« Jetzt beginnt die rechtliche Generalmobilmachung. Nun werden Gesetze durchgeackert, Internetseiten durchforstet, Zeitungsartikel durchwühlt, Experten befragt, Gerichtsshows analysiert, Fachbücher gekauft. Und natürlich kommt nun eine wichtige Figur ins Spiel, die lange Zeit herumstand wie der Turm beim Schachspiel, nun aber plötzlich in das Geschehen eingreifen darf: der Anwalt, der Hoffnung spendende Übersetzer von Gesetzestexten und Fachliteratur, der treue Begleiter des zu Unrecht Verurteilten, der gegen ein geringes Entgelt alles behauptet, was der Mandat behauptet haben möchte.
7.»Das wird hohe Wellen schlagen!« Nun kämpfen wir nicht mehr für uns, sondern für alle Unterdrückten. Der Prozess muss nun einer sein, bei dem ein Ruck durch Deutschland geht und wegen dem die Verfassung geändert werden muss. Wir kämpfen nun nicht mehr für uns, sondern gegen alle anderen.
8.»Waaaaaas?« Nun kommt der Richter, von dem wir uns im Gegensatz zum ersten Prozess ein faires Urteil erwarten. Aber: Da kämpft ein Jurist gegen einen Juristen – und der Kampf wird von einem Juristen entschieden. Gesetzestexte sind schwieriger zu übersetzen als die Bücher von Laotse, die Interpretation lässt so viele Varianten zu wie die Weisheiten des Konfuzius.
9.»Armes Deutschland!« Nun haben wir verloren – und müssen einsehen, dass unser ehrenwerter Kampf vergeblich war und dass die Ungerechtigkeit wieder einmal gesiegt hat. Immerhin: Es gibt nun Stoff für mindestens zehn Geschichten, bei denen die Kollegen am Stammtisch oder beim Kaffeekränzchen verständnisvoll nicken. Wir leben schon in einem schlimmen Land.
10.»Goodbye Deutschland!« Der letzte Ausweg des Geknechteten: Er hält es nicht mehr aus in diesem Land, in dem es nur ungerecht zugeht. Damit beginnt er den Zyklus des Trash-TV-Nachmittags, der später in diesem Buch noch eine Rolle spielen wird. Wir gehen irgendwohin, wo die Menschen anders sind. Gerechter. Zuverlässiger.
Ich habe während des Projekts insgesamt 327 Stunden damit verbracht, Gesetzestexte zu lesen. 327 Stunden meines Lebens, die ich niemals wiederbekommen und für die ich von Gott einen gewaltigen Anschiss bekommen werde, weil ich mein Leben so verplempert habe. Ich habe in diesen Stunden nicht nur Nerven und Gehirnzellen eingebüßt, sondern vor allem auch Menschenverstand und die Fähigkeit zu logischem Denken.
(Un-)Wichtiges Wissen
Aus dem Deutschen Lebensmittel-buch: »Gewürzmischungen sind Mischungen, die ausschließlich aus Gewürzen bestehen.« (Leit-sätze für Gewürze und andere würzende Zutaten)
Sollten Sie nun denken, ich würde übertreiben, dann möchte ich Ihnen noch ans Herz legen, wie das Reichsgericht am 17. März 1879 die Eisenbahn definiert hat:
»Ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte Fortbewegung von Personen oder Sachen über nicht ganz unbedeutende Raumstrecken auf metallener Grundlage, welche durch ihre Konsistenz, Konstruktion und Glätte den Transport großer Gewichtsmassen, beziehungsweise die Erzielung einer verhältnismäßig bedeutenden Schnelligkeit der Transportbewegung zu ermöglichen bestimmt ist, und durch diese Eigenart in Verbindung mit den außerdem zur Erzeugung der Transportbewegung benutzten Naturkräften (Dampf, Elektrizität, tierischer oder menschlicher Muskeltätigkeit, bei geeigneter Ebene der Bahn auch schon der eigenen Schwere der Transportgefäße und deren Ladung etc.) bei dem Betriebe des Unternehmens auf derselben eine verhältnismäßig gewaltige (je nach den Umständen nur in bezweckter Weise nützliche, oder auch Menschenleben vernichtende oder die menschliche Gesundheit gefährdende) Wirkung zu erzeugen fähig ist.«
Freilich geht es auch einfacher – im Deutschen Lebensmittelbuch steht:
»Blut ist die beim Schlachten aus den Blutgefäßen gewonnene, zellige Bestandteile enthaltende Flüssigkeit.«
Wissen für Nichtjuristen
Es gibt nicht nur Gesetzestexte, sondern auch wunderbare Schrif-ten wie die Neue Juristische Wo-chenzeitung. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs ist seit 1968 jeder Anwalt verpflichtet, sie zu lesen. Darin stehen auch Urteile wie dieses des Bezirksgerichts Wien: »Schnee auf dem Autodach gehört dem Fahrzeughalter.«
Und das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden:
»Ein Verschollener hat seinen Wohnsitz bei der Ehefrau.«
Es ist ein Dschungel – aber immerhin bekommt man einen wegweisenden Satz mit auf die Reise. Er steht im Handbuch der Rechtsförmlichkeit und lautet:
»Es gehört zur Verantwortung des Gesetzgebers, verlässliches, übersichtliches und verständliches Recht zu schaffen.«
Kapitel 3 Atmen ist noch erlaubt
Die Toten Hosen haben im Jahr 1988 das Lied »1000 gute Gründe« veröffentlicht. Die Toten Hosen haben in ihrer Karriere eine ganze Menge tolle Lieder veröffentlicht – wahrscheinlich hat jeder Mensch in Deutschland zwischen 20 und 45 Jahren ein Lied dieser Band, das ihn besonders berührt. Kein Liebeskummer ohne »Alles aus Liebe«, keine Party ohne »Zehn kleine Jägermeister«, und seit 2012 wohl auch nie mehr ein Oktoberfest ohne »Tage wie diese«. Bei mir sind es, seit ich dieses Projekt angefangen habe, die »1000 guten Gründe« – und das vor allem wegen dieser Textzeile:
»Hohe Berge, weite Täler, / klare Flüsse, blaue Seen, / dazu ein paar Naturschutzgebiete, / alles wunderschön. / Wir lieben unser Land! / Totale Pflichterfüllung, / Ordnung und Sauberkeit, / alles läuft hier nach Fahrplan, / der Zufall ist unser Feind. / Wir lieben unser Land! / Unser Fernsehprogramm, / unsere Autobahn. / Wir lieben unser Land! / Es gibt 1000 gute Gründe, / auf dieses Land stolz zu sein.«
Ein wenig später heißt es: »Keiner scheint hier zu merken, / dass man kaum noch atmen kann.«
Ich habe es sicherheitshalber gerade noch einmal getestet. Erst daheim, dann auf der Straße, in der U-Bahn, dann vor einem Polizisten: Atmen ist noch erlaubt.
Bei allem anderen kann man sich nicht mehr sicher sein. Was nicht ausdrücklich erlaubt ist, das ist verboten.
Ich war kürzlich mit meinem Sohn auf einem Spielplatz in der Nähe des Münchner Ostparks. Das ist ein Ort, an dem sich Kinder wohlfühlen sollen. Wo sie Spaß haben sollen. Ich habe mich kurz umgesehen. Auf diesem Spielplatz hängen acht Schilder. Darauf steht nicht: »Es macht besonders Laune, wenn man Wasser in die Röhren spritzt!« Darauf steht auch nicht: »Rutscht, so schnell ihr könnt!« Und auch nicht: »Habt einfach Spaß!« Auf diesen acht Schildern sind insgesamt 42 Verbote vermerkt – wie man nicht rutschen soll, wie man das Karussell nicht benutzen darf, wie man das Klettergerüst nicht besteigen darf.
Immerhin: Atmen ist noch erlaubt.
Und doch ist interessant, was auf so einem Spielplatz passiert. Da tollen Kinder umher und sind eigentlich nur damit beschäftigt, sich gegenseitig zu Höchstleistungen anzustacheln. Wer kann besser klettern? Wer kann schneller rutschen? Wer baut die beste Sandburg? Daneben sitzen Eltern, die versuchen, genau das zu verhindern, wobei sich die Eltern in drei Kategorien unterteilen lassen: die Mitmacher, die Apathischen und die Weltuntergänger.
Die Mitmacher nutzen die Zeit auf dem Spielplatz dazu, selbst wieder Kind zu sein, jedoch mit dem Verantwortungsbewusstsein eines Erwachsenen. Sie rutschen, sie klettern, sie bauen – aber sie erklären ihrem Kind andauernd, dass es beim Rutschen die Beine zusammen-, beim Klettern auseinander- und beim Bauen angewinkelt halten sollte. Lustig dabei: Die Mitmacher verstoßen damit gegen das Gesetz, weil die Nutzung von Spielplätzen nur bis zu einem Alter von 14 Jahren erlaubt ist. Steht auf einem der Schilder.
Die Apathischen findet man am Rand des Spielplatzes, sie sitzen ihre Zeit ab und warten darauf, dass das Kind endlich fertig ist mit Spaß haben. Sie haben entweder ein Buch in der Hand oder ein Handy, sie unterhalten sich mit anderen Eltern oder starren in den Himmel. Manchmal schlafen sie auch.
Die Weltuntergänger vermuten hinter jedem Spielzeug ein Werk des Teufels. Die Rutsche ist zu steil, die Schaufel voller Keime, und das Karussell wurde nur deshalb erfunden, um der Zentrifugalkraft dabei zu helfen, kleine Kinder ins Jenseits zu befördern. Ein Stein ist ebenso eine Mordwaffe wie ein Spielzeugbagger, und die anderen Kinder sind sowieso Diebe, Gangster und Totschläger. Die Kinder der Weltuntergänger heißen Linus, Malte oder Cajus. Die Eltern finden es prima, dass es so viele Verbote gibt – und sie erinnern ihre eigenen und auch die anderen Kinder stets daran: »Linus, bitte, nimm nicht die Schaufel von diesem Kind, die ist so schmutzig. Und rutsch nicht mit dem Kopf nach vorne, das ist gefährlich. Cajus, Sand im Mund ist giftig.«
Die Weltuntergänger sind die Zivilpolizisten des Spielplatzes.
Auch an anderen Orten kann man nicht so einfach machen, was man will. Ich habe es mal probiert. Zu meinem 33. Geburtstag wollte ich im Ostpark grillen.
Es gibt jedoch »Regeln für das Grillen im Ostpark« und sogar ein »Grilltelefon«, bei dem der Bürger erfährt, wo überall das Grillen verboten ist. Zusammengefasst steht in den Regeln: keine organisierten Feiern, kein Funkenflug, kein Lärm, keine eigenen Grills, keine freie Platzwahl. Am Ende steht da: »Verstöße gegen die Regelungen der Grünanlagensatzung werden mit Geldbußen geahndet. Die Einhaltungen der Schutzbestimmungen werden von der Anlagenaufsicht, einem beauftragten Sicherheitsdienst und der Polizei überwacht.«
Ich habe meinen Geburtstag dann auf unserem Balkon gefeiert.
Deutschland ist ein Verbotsland. Verbieten und Bestrafen gehören zum Katechismus des Zusammenlebens.
Das liegt nicht zuletzt am nicht zu unterschätzenden Einfluss, den die beiden christlichen Kirchen immer noch auf die deutsche Gesellschaft haben. Die Menschen gehen zwar kaum noch in die Kirche, doch das Prinzip von Schuld, Sühne und Bestrafung ist nach wie vor präsent. Das habe ich schon bei meinem Projekt, verschiedene Religionen zu testen, mehr als deutlich bemerkt. Schuld ist die Unique Selling Proposition des katholischen Glaubens. Der Priester sagt zu Beginn eines Gottesdienstes: »Wir müssen Buße tun und umkehren.« Er sagt nicht: »Wir sind auf dem richtigen Weg, lasst uns einfach weitergehen.« Er sagt auch nicht: »Schön, dass Sie heute hier sind.« Er sagt lieber: »Ach herrje, die Kirchen werden immer leerer – die laden alle Schuld auf sich. Ihr seid alle Sünder.«
Kein Pfarrer versprach mir jemals: »Wenn Sie das so und so machen, dann kommen Sie in den Himmel.« Sie drohten lieber: »Wenn du das machst, dann kommst du in die Hölle.«
Das Christentum ist eine Verbotsreligion. Es darf nicht hinterfragt werden, ob ein Verbot Sinn macht oder nicht – es ist einfach so. Und das Totschlagargument ist natürlich, dass der Sünder nicht nur im Diesseits bestraft wird, sondern dass auf ihn bei genügend Verstößen die ewige Verdammnis wartet. Wer braucht schon Argumente, wenn er seine Verbote mit der Androhung von Höllenfeuer untermauern kann? Wenn Argumente fehlen, kommt meist ein Verbot heraus.
Man muss sich nur einmal umsehen. Mehr als 20 Millionen Verkehrsschilder gibt es in Deutschland, die den Menschen im Straßenverkehr befehlen: Fahr bloß nicht zu schnell! Bieg nur ja nicht nach links ab! Lass dein Auto nicht hier stehen! In der deutschen Straßenverkehrsordnung sind neben 53 Paragrafen auch 684 verschiedene Verbots- und Hinweisschilder vermerkt. Schild Nummer 17 ist ein Pferd mit Reiter auf einem blauen Kreis, Nummer 9 ist rotes Dreieck, in dem ein Fähnchen zu sehen ist. Es gibt auch eines, auf dem ein Auto in einen Fluss fällt.
Die ersten Verkehrsschilder in Deutschland gab es im Jahr 1910. Auf einer internationalen Konferenz ein Jahr zuvor in Paris wurde angeregt, gefährliche Passagen durch sogenannte Warnungstafeln zu kennzeichnen. Es waren runde Zeichen mit blauem Hintergrund und weißer Farbe – und ein genialer Mensch kam gar auf die Idee, diese Schilder mit Werbung zu versehen. So sah etwa ein Schild im Jahr 1925 aus:
Das Schild warnte vor einer kurvigen Strecke und warb ganz nebenbei noch für den Hessischen Automobil-Club in Darmstadt. Erst 1927 wurden die Warnungstafeln durch Verkehrszeichen ersetzt, wie wir sie heute an jeder Straße sehen müssen. Einige davon in der gleichen Ausführung wie 1927.
Ich habe nach Durchsicht aller Verkehrsschilder meine fünf Lieblinge gekürt. Hier sind sie:
Das bedeutet nicht: »Wer sein Auto irgendwo hinauffährt, möge es bitte schön wieder herunterfahren.«
Es bedeutet: »Parken auf Gehwegen quer zur Fahrtrichtung (Ende).«
Das bedeutet nicht: »Vorsicht! Skifahrer kreuzen die Fahrbahn!«
Es bedeutet: »Wintersport erlaubt!« Wobei ich dann doch für mich entschieden habe, dass ich lieber nicht auf einer Straße fahren möchte, auf der ich jederzeit damit rechnen muss, von einem Skifahrer überholt zu werden – oder noch schlimmer: von einem Snowboarder übersprungen zu werden.
Das bedeutet nicht: »Zu langsam fahrende Fahrzeuge dürfen beschossen werden.«
Es bedeutet: »Ab hier nur militärische Fahrzeuge!«
Also übersetzt: »Leute, ab hier beginnt der Krieg!«
Das bedeutet nicht: »Dieses Fahrzeug kann übers Wasser fahren.«
Es besagt: »Streckenverbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung.«
Was allerdings der Satz »Streckenverbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung« bedeutet, das weiß nicht einmal mehr der Erfinder des Schildes.
Das bedeutet nicht: »Eine Straße, viele Bäume – ja, das ist eine Allee!«
Es bedeutet: »Eingeschränktes Lichtraumprofil durch Bäume!«
Gott segne den Menschen, der das Wort »Lichtraumprofil« ersonnen hat, er möge ihn alleine dafür in den Himmel aufnehmen.
Durchschnittlich steht auf deutschen Straßen alle 28 Meter ein Verkehrsschild – wer also von Hamburg nach Berlin fährt, der erblickt 10357 Schilder. Von Köln nach Erfurt: 13142 Schilder. Von Bremen nach München: 26750 Schilder. Bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern muss das Gehirn pro Sekunde ein Schild verarbeiten – wobei dafür ein berühmtes Gedächtnisexperiment helfen kann: Man lässt sich pro Sekunde eine Zahl vorsagen und versucht, sie alle zu addieren. Nach 15 Sekunden fragt der Aufsager: »Was war die dritte Zahl, die ich gesagt habe?« Nur etwa zehn Prozent der Menschen können sich daran erinnern. Bei Verkehrsschildern ist das noch schlimmer: Wer mit der Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern fährt, sieht durchschnittlich alle 0,77 Sekunden ein Schild. Probieren Sie mal aus, wie viele Schilder sie tatsächlich wahrnehmen und an welchen Sie einfach vorbeifahren.
Ein Verkehrsschild kostet laut ADAC übrigens 350 Euro, bei der Fahrt von Bremen nach München passiert der Autofahrer also Verkehrsschilder im Wert von 9,36 Millionen Euro.
Bei diesen Studien hat der ADAC auch herausgefunden, dass 30 Prozent aller Verkehrsschilder unnötig sind. Das war in den 80er-Jahren – und das damalige Bundesministerium für Verkehr hat daraufhin den Modellversuch »Weniger Verkehrszeichen« unterstützt. Die Maßnahme zeigte durchaus Wirkung: Bis zum Jahr 1997 ist die Anzahl der Verkehrsschilder um 24 Prozent gestiegen. Also gab es wieder eine Initiative. Diesmal wurde die Straßenverkehrsordnung geändert und festgelegt, dass Beschränkungen des fließenden Verkehrs nur dann angeordnet werden dürfen, wenn eine Gefahr besteht, die über dem allgemeinen Risiko liegt. Auch diese Aktion war ein voller Erfolg: Bis zum Jahr 2010 ist die Anzahl der Verkehrsschilder noch einmal um 17 Prozent gestiegen.
Wie lautet die Definition von Wahnsinn laut Albert Einstein? Immer und immer wieder das Gleiche tun und ein anderes Ergebnis erwarten. Genau das machen die Menschen, die sich diese Initiativen ausdenken.
Wer muss schon das Aufstellen neuer Schilder begründen, wenn er dem Autofahrer einfach drohen kann, ihm den Führerschein zu entziehen, wenn der sich nicht an die Verbote hält?
Zu den Verkehrsschildern und Hinweisen kommen natürlich die Schilder, die Privatpersonen angebracht haben: »Ausfahrt freihalten«, »Hunde dürfen hier nicht rein«, »Bitte unterlassen Sie es, beim Verlassen des Lokals Lärm zu machen«. In einem Lokal in der Nähe meiner Heimatstadt hängt sogar ein Verbotsschild, das nur wegen mir dort angebracht wurde und auf das ich ziemlich stolz bin – dazu später mehr.
Es gibt laut einer Studie neben den 20 Millionen Verkehrsschildern noch weitere 56 Millionen Schilder in Deutschland, die uns darauf hinweisen, dass wir etwas machen sollen oder etwas nicht dürfen.
Also: Alle 9,8 Meter hängt irgendwo in Deutschland ein Schild, das einem sagt, was man zu tun und was man zu lassen hat.
Ich habe mich auch auf die Suche gemacht nach den lustigsten Verbotsschildern in Deutschland. Hier sind meine persönlichen Top fünf:
Dieses Schild könnte bedeuten: »Kein Stagediving!«
Es könnte aber auch bedeuten: »Pep Guardiola darf hier nicht Trainer werden.«
Dieses Schild gehört meiner Meinung nach an jede Ampel.
Es könnte bedeuten: »Keine öffentliche Skigymnastik durchführen.«
Es könnte aber auch etwas zu tun haben mit Menschen, die sich gerne zwischen Bäumen erleichtern.
Könnte bedeuten: »Wer Klimmzüge macht, könnte sich mit Tee, der gerade an der Decke gebrüht wird, die Genitalien verbrühen.«
Und mein absoluter Liebling:
Ich überlege seit Wochen – und das ist die beste Erklärung, die mir eingefallen ist: »Es ist toten Menschen verboten, Bauarbeiter zu erschrecken.«
Die Deutschen lieben ihre Schilder und ihre Verbote – und je nach Ausgang der Bundestagswahl 2013 könnte das Mega-Verbot hinzukommen. Die Grünen planen, das Tempo in geschlossenen Ortschaften zu reduzieren. Statt Tempo 50 soll es heißen: Tempo 30. Warum eigentlich nicht? Würde das gehen? Spricht man mit Polizisten, so hört man Sätze wie: »Der Aufwand, die Regeltreue der Bürger zu überprüfen, wäre schon enorm.« Redet man mit Autofahrern, so hört man eigentlich nur den Satz: »Was für ein Unsinn!« Hört man Politikern wie dem Grünen-Abgeordneten Toni Hofreiter zu, so wird das Telefon zu einem Duschkopf, weil sich ein Redeschwall über einen ergießt. Man bekommt Studien und Statistiken aufgetischt – etwa dass nur zehn Prozent aller Tempo-30-Unfälle tödlich enden, jedoch 90 Prozent aller Unfälle, die bei Tempo 50 passieren. Dass es nach dieser Rechnung am besten wäre, überhaupt nicht mehr mit dem Auto zu fahren, weil die Überlebenschance bei Tempo null bei 100 Prozent liegt, das sagen Menschen wie Hofreiter nicht.
Meine Mitbürger scheinen die Verbote nicht zu stören – ganz im Gegenteil. Gemeinsam mit dem renommierten Institut für Demoskopie Allensbach und dem Mainzer Institut für Publizistik hat sich das Heidelberger John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung aufgemacht, im »Freiheitsindex Deutschland« die Freiheitsliebe der Deutschen zu ergründen.
Die Studie wurde im Juli 2012 veröffentlicht, die Ergebnisse sind eindeutig: Die Deutschen wünschen sich noch mehr Verbote, als es sie ohnehin schon gibt.
Natürlich ist es sinnvoll, radikale Parteien und Kinderpornografie zu verbieten – da wird wohl kaum jemand widersprechen, bei dem noch alle Synapsen im Gehirn funktionieren.
Was aber nach Ansicht einiger auch noch verboten werden sollte: Gotteslästerung (25 Prozent), hochprozentiger Alkohol (20 Prozent), jede Form der Pornografie (36 Prozent). Mehr als ein Drittel möchte also das Internet abschaffen – denn meiner Meinung nach gäbe es nach dem Verbot von Pornografie nur noch eine Webseite mit dem Namen: www.gebtunspornografiezurueck.de.
(Un-)Wichtiges Wissen
Das nach allgemeinem Dafürhal-ten grandioseste internationale Schild weltweit steht in Raynes Park in Süd-London. Auf einem zertretenen Stück Rasen von der Größe eines Quadratmeters ist ein Schild in den Boden gesteckt: »Keep Off The Grass«.
Viele Menschen definieren Freiheit darüber, was ihnen alles verboten wird – denn nur wer sich an alle Regeln hält, darf im gesetzten Rahmen frei sein. Alle anderen werden bestraft. Das Ziel scheint nicht zu sein, möglichst glücklich zu leben oder möglichst viele Dinge auszuprobieren, sondern möglichst ohne Strafe davonzukommen. Aus dem amerikanischen Recht, dass jeder Mensch nach persönlichem Glück streben dürfe, wird hierzulande ein Streben nach Fehlerlosigkeit. Wer sich nicht richtig verhält, ist schuldig – und gehört bestraft.
Mit jedem Verbot allerdings gibt der Bürger ein Stück seiner Mündigkeit ab – und es hat den Anschein, dass die Bequemlichkeit wichtiger ist als die Möglichkeit der Selbstbestimmung. Das Leben war einmal eine bunte Wiese, auf der die Menschen sich frei bewegen durften. Dann wurden links und rechts Zäune errichtet, und es wurde verkündet, dass jeder bestraft wird, der es wagt, über den Zaun zu springen. Aus Zäunen wurden meterhohe Mauern, über die niemand mehr springen kann. Zusätzlich wurden Elektroden angebracht, die jedem einen elektrischen Schlag verpassen, der es wagt, die Mauern zu berühren. Dann wurde vorne und hinten zugemauert – und es scheint, als würde gerade jemand auch noch einen Deckel anbringen wollen.
Aus Strukturen wurden Fesseln, aus Richtlinien ein Dschungel, aus Gesetzen ein Gefängnis. Was nicht ausdrücklich erlaubt ist, das ist verboten.
Es gibt aber auf der anderen Seite kaum jemand, der versucht, diese Mauern einzureißen. Wir sitzen in diesem Gefängnis und beschweren uns darüber, aber wir unternehmen kaum etwas dagegen. Wir verlieren immer mehr die Möglichkeit, selbst über unser Leben zu bestimmen – aus Angst vor Bestrafung oder einfach nur aus Bequemlichkeit.
In anderen Ländern ist das nicht so, dort gilt: Was nicht ausdrücklich verboten ist, das ist erlaubt. In Schottland etwa gibt es seit ein paar Jahren den sogenannten Scottish Outdoor Access Code. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet der Code, dass Parks, Strände, Seen und Wälder frei zugänglich sind. Campen ist ebenso erlaubt wie Wandern, Fahrradfahren und Fußballspielen. Einzige Regel: Nimm deinen Müll wieder mit – und wenn du Müll von anderen siehst, dann motz nicht drüber, sondern pack ihn eben in deine Mülltüte. Der Code funktioniert wunderbar. Die Götter haben den Schotten also nicht nur wunderbare Landschaften, herausragenden Whisky und herzerweichende Lieder geschenkt, sondern ganz offensichtlich auch sehr vernünftige Gesetzgeber.
Dass es auch hierzulande anders geht, zeigte der Verkehrsplaner Hans Mondermann, der vom Spiegel als »Die Axt im Schilderwald« bezeichnet wurde. Er probierte vor 20 Jahren etwas, was vorher noch keiner gewagt hatte. Er schaffte in einem Dorf in Nordholland einfach alle Ampeln, Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen ab. »Was ich wichtig finde, sind zwei Verkehrsregeln«, sagte Mondermann in einem Interview. »Erstens, dass man rechts fährt, sonst würde es ja ein riesiges Chaos geben, wenn jeder auf einer anderen Seite die Straße benutzt. Und zweitens, dass der von rechts Kommende Vorfahrt hat. Mehr braucht man nicht zu wissen.« Das Kuriose: Es wurde sicherer, je weniger Regeln es gab. Mondermann durfte es auch in Deutschland ausprobieren, in der kleinen Stadt Bohmte in Niedersachsen – ebenfalls mit Erfolg. Könnte es wirklich sein, dass weniger Regeln sinnvoll wären?
Wie viele Verbote muss ein Mensch aushalten?
Ich habe es vier Wochen lang ausprobiert. Ich habe mir ein Fahrrad ausgeliehen und bin in dieser Zeit durch München gefahren. Durch die Innenstadt, durch den Englischen Garten, zu meinem Arbeitgeber in Steinhausen. Ich bin auf Hauptstraßen geradelt, durch öffentliche Parks, ich war sogar in U-Bahn-Stationen. Wenn ich nicht mit dem Fahrrad unterwegs war, habe ich mir München mit Google Street View angesehen. Street View ist nicht nur eine geniale Erfindung – gegen die natürlich nicht wenige Deutsche protestiert haben, weil hierzulande nichts eingeführt werden kann, ohne dass jemand dagegen protestiert. Der Höhepunkt der Street-View-Proteste war die Familie, die sich energisch dagegen eingesetzt hat, dass Google ihr Haus fotografiert und jedem Menschen in Deutschland visuell zugänglich macht – und sich dann vor dem Haus für Bild hat ablichten lassen.
Street View ermöglicht es, München ein bisschen besser kennenzulernen und diese Stadt womöglich auch irgendwann einmal zu mögen. Man kann auch an vielen Orten stehen bleiben und sich umsehen. Was ich dabei herausgefunden habe: Man kann sich innerhalb der Stadtgrenzen Münchens an keinem öffentlichen Ort aufhalten, ohne ein Verbotsschild im Blickfeld zu haben. Zumindest an keinem Ort, der sich auf einer Straße oder einem Radweg erreichen lässt.
Wenn ich nicht unterwegs war, habe ich diesen lustigen Dienst exzessiv genutzt, von dem ich dachte, er sei nur dazu da, um die künftige Wohnung auszuspionieren oder um Menschen zu ärgern, die gerne an Fenstern herumlungern und andere Leute beobachten. Ich habe mir per Zufallsgenerator aus dem örtlichen Telefonbuch eine Adresse ausgesucht und sie bei Street View eingegeben. Dann habe ich mich virtuell um die eigene Achse gedreht und gezählt, wie viele Schilder ich finde – und ich habe meine Freunde gebeten, das Gleiche zu tun. Meine Arbeitskollegen. Meine Bekannten bei Facebook. Es entwickelte sich ein interessantes Projekt, bei dem ich irgendwann 50 Euro Prämie ausgelobt habe für den, der bei Street View einen Ort in Deutschland findet, an dem man sich einmal um die eigene Achse drehen kann, ohne auch nur ein Verkehrsschild zu erblicken. Und noch einmal 50 Euro für den Ort mit den meisten Schildern.
Wer vor meiner Haustür steht, der hat 37 Schilder im Sichtfeld, vor dem Gebäude meines Arbeitsplatzes habe ich 45 Schilder entdeckt, am Marienplatz waren es 136. Ich habe meine Freunde aufgefordert, Deutschlands Ort mit den meisten Schildern zu finden. Ergebnis nach vier Wochen: Der Karlsplatz in München ist nicht nur die meistbefahrene Kreuzung Deutschlands, sondern nach diesen Recherchen der Ort in Deutschland mit den meisten Schildern. Wer sich auf die Grünfläche zwischen Karlsplatz und Bayerischem Staatsministerium der Justiz stellt und sich ein Mal um die eigene Achse dreht, sieht 163 Schilder. Vier Menschen haben nachgezählt und sind zum gleichen Ergebnis gekommen – und bislang hat mir keiner einen Ort mit mehr Schildern präsentiert. An einer Kreuzung in Köln gibt es 157, in Stuttgart hat einer in der Nähe des Stadions 156 gefunden.
Danach habe ich einen Ort in Deutschland gesucht, an dem der Mensch kein einziges Schild und keine einzige Vorschrift ertragen muss. Am Ende waren es mehr als 1100 Teilnehmer, die sich auf die Suche begeben haben. Es gab lustige Zuschriften, skurrile Notizen – und auch wütende Nachrichten wie etwa von Sebastian, der mir schrieb, dass er nun acht Stunden seines Lebens damit vergeudet habe, bei Google nach einem schilderlosen Ort zu suchen und doch keinen gefunden habe. Ein Teilnehmer schickte im Laufe des Wettbewerbs insgesamt 24 Street-View-Links – doch die Jury, die aus einem Juristen, einem Google-Mitarbeiter, einem Fahrlehrer und mir bestand, fand doch ein Hinweis- oder Verbotsschild. Irgendwann gab er auf.
Nach vier Wochen war es dann so weit. Nach einigen erfolglosen Versuchen verrät mir mein Bekannter Gerhard einen Ort in Deutschland, an dem man sich tatsächlich umdrehen kann, ohne ein einziges Schild zu sehen. Der Ort befindet sich in Bremen – und natürlich beschließe ich, ihn aufzusuchen.
Auf der Fahrt nach Bremen habe ich die wildesten Vorstellungen, was man an so einem Platz machen könnte: einen Bison grillen, ein Feuerwerk zünden, nackt durch die Gegend hüpfen und dabei wild onanieren. Ich weiß es nicht, die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt. Als würde man ein acht Jahre altes Kind in einem Spielzeuggeschäft aussetzen, das an eine Schokoladenfabrik angeschlossen ist und an ein Kino, in dem nur Comics gezeigt werden.
»An Knoops Park 1«, sage ich dem Taxifahrer am Bahnhof. Als ich 20 Minuten später aus dem Wagen steige, drehe ich mich ein Mal um die eigene Achse und sehe 13 Schilder. Dann gehe ich in eine Allee und weiß von nun an, was ein »eingeschränktes Lichtraumprofil durch Bäume« ist. Es fehlt aber das Schild, das mir das mitteilt. Rechts erkennt man ein weißes Haus, links nur Bäume. Es riecht nicht nach Freiheit, sondern nach Holz und irgendwie auch nach Hundescheiße. Ich gehe zwanzig Meter, dann bin ich da.
Das ist er also, der Ort ohne Schilder.
Ich drehe mich ein Mal, es gibt tatsächlich kein einziges Schild. Kein Verkehrsschild, kein Hinweisschild, kein Pfosten, kein Warnschild. Nichts. Ich schließe die Augen, dann atme ich ein und wieder aus. Ich denke an all die Dinge, die an so einem Ort möglich sind.
Ich warte auf eine Epiphanie – ich meine, an so einem Ort kann so was schon passieren. Man muss nicht immer auf einen Berg steigen oder in einen Floating-Tank, um Ruhe und Kreativität zu verspüren. Mir genügt schon ein Platz, an dem es keine Verbote gibt. Ich warte auf ein Woodstock-Gefühl, auf den Leonardo-DiCaprio-Titanic-König-der-Welt-Moment und den Gedanken, den Pearl Jam im Song »Given to Fly« beschreiben.
Ich bin nicht Leonardo DiCaprio, der in Woodstock »Given to Fly« hört. Ich bin Jürgen Schmieder in Bremen mit einem Bier in der Hand. Das Bier schmeckt genauso wie an allen anderen Orten auch, es riecht penetrant nach Hundescheiße – und die Jogger, die hin und wieder vorbeilaufen, wissen gar nicht zu schätzen, dass sie einen heiligen Ort passieren.
Ich überlege schon, ein Hinweisschild aufzustellen: »Das hier ist der Ort ohne Schilder!«
Ich muss ein wenig kichern, als mir die Unsinnigkeit dieses Gedankens bewusst wird.
Nach fünf Minuten ist mir langweilig. Ich habe keinen Bison zum Grillen dabei und auch keine Feuerwerkskörper – und fürs Nackt-Herumhüpfen ist es mir einfach zu kalt. Ich spaziere ein wenig zum Fluss hin; es sieht ein wenig aus wie im Computerspiel »Die Sims«, in dem sich auch alle Menschen in der gleichen Geschwindigkeit recht hölzern bewegen. Natürlich sehe ich auch wieder die ersten Schilder. Sie haben damit zu tun, nicht in den Fluss zu hüpfen und nur ja nicht in verschiedenen Positionen die Rutsche am Spielplatz zu benutzen.
Ich will schnell zurück zum Platz ohne Verbote und werde dabei von einer älteren Frau begleitet, die ihren Hund ausführt.
»Wissen Sie eigentlich«, beginne ich feierlich, »wissen Sie eigentlich, dass wir gleich an einen besonderen Ort kommen?«
Sie sieht mich freundlich an: »Nein, warum?«
»Es ist der nach meinen Informationen einzige Ort in Deutschland, an dem man keine Schilder sieht, wenn man sich um die eigene Achse dreht.«
»Hier? Ach nee! Wirklich? Das ist aber schön!«
Ich freue mich, weil diese Frau keine Ahnung hatte von der Besonderheit dieses Platzes.
»Seit 20 Jahren gehe ich hier spazieren, ich wohne gleich da vorne. Das ist schon ein schönes Fleckchen Erde! Heutzutage gibt’s ja überall diese Schilder, dass sich niemand mehr auskennt und sich keiner mehr zurechtfindet! Ich wusste gar nicht, dass es so einen Ort gibt.«
»Hier sind wir!«
Wir stehen beide da und sehen uns um – und das Gefühl, mit dieser alten Frau diesen Moment zu teilen, ist tatsächlich wunderbar. Irgendwie majestätisch.
Dann stinkt es wieder nach Hundescheiße.
Der Hund der Frau legt ein wunderschönes Ei neben den Weg. Wir sehen ihm dabei zu, dann macht er ein paar Scharrbewegungen mit den Hinterbeinen und deutet dann durch Weiterlaufen an, dass er hier fertig ist.
»Einen schönen Tag noch«, sagt die Frau, dann geht sie weiter.
Ich sehe auf den Hundehaufen. Daneben liegt noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Der ganze Platz ist zugekackt. Und er stinkt erbärmlich.
Es ist der erste schlimme Moment in meinem Projekt: Ich bin beim Lesen der Gesetze beinahe verrückt geworden, mein Kumpel hat mir die Freundschaft gekündigt, als ich ihm all seine Verfehlungen vorgerechnet habe, ich habe Platzangst bekommen ob der Verbote, die es in Deutschland so gibt.
Doch es gab da diese Hoffnung, dass dieser eine Ort existiert, an dem die Welt in Ordnung ist. An dem man sich hinsetzen und ein Bier trinken kann, ohne ein Verbotsschild sehen zu müssen und von jemandem darauf hingewiesen zu werden, was man gerade falsch gemacht hat oder falsch machen könnte.
Dieser Platz allerdings ist zugeschissen wie ein Dixi-Klo auf dem Campingplatz von »Rock im Park«.
Kann jemand bitte ein Schild aufhängen, auf dem steht: »Nehmt eure Hundekacke wieder mit!«
Und noch eins: »Und euren Müll auch!«
Dieser Platz stinkt – im wahrsten Sinn des Wortes. Der Ort, der der schönste in Deutschland sein sollte, ist einfach nur erbärmlich.
Die Anzahl der Schilder wächst im Jahr 2013 um mindestens 100000 – und ich hoffe, dass ein Schild niemals entfernt wird. Es wurde nämlich nur wegen mir angebracht. Darauf steht: »Heute wegen gestern geschlossen!« Ich finde, es sollte zumindest so lange aufgestellt bleiben, bis ich meinem Sohn davon erzählen kann. Oder bis er Kapitel 35 in diesem Buch gelesen hat.
Ich habe es gerade noch einmal überprüft: Ja, wir dürfen noch atmen in diesem Land. Aber es könnte schon sein, dass es bald das Einzige ist, was noch ohne Einschränkung erlaubt ist.
Kapitel 4 Wir sind alle Verbrecher
Einige Menschen behaupten, noch niemals in ihrem Leben gelogen zu haben – zumindest nach ihrer Definition: Eine Notlüge ist keine Lüge. Eine gelogene Höflichkeit ist keine Lüge. Eine nett gemeinte Lüge ist keine Lüge. Wenn jemand anmerkt, dass auch eine nett gemeinte Lüge eine Lüge ist, so wie ein unabsichtliches Foul beim Fußball auch ein Foul ist, dann antworten sie: »Das ist doch Quatsch!«
Ähnlich ist es mit Gesetzen: Viele Menschen behaupten, noch niemals in ihrem Leben ein Gesetz gebrochen zu haben. Ich merke das zum ersten Mal an dem Tag, an dem ich meinem Freund Adam erzähle, ein Jahr lang gesetzestreu leben zu wollen. »Wo ist das Problem?«, fragt er. »Das mache ich seit mehr als 30 Jahren. Das Projekt ist Blödsinn – lustiger wäre es, sich ein Jahr lang nicht an Gesetze zu halten.« Was ich noch nicht weiß: Während des Jahres werde ich diesen Vorschlag ungefähr 500 Mal hören.
»Glaubst du das wirklich? Dann müsstest du sagen, dass jede dieser Behauptungen zutrifft«, entgegne ich.
Ich zähle die Statements auf, die ich vorbereitet habe: