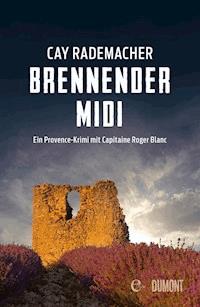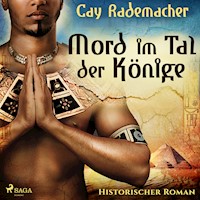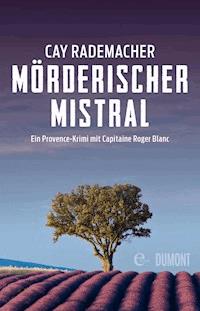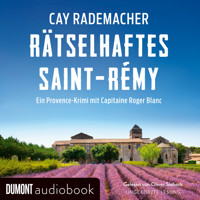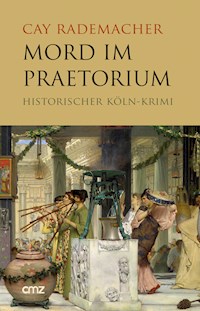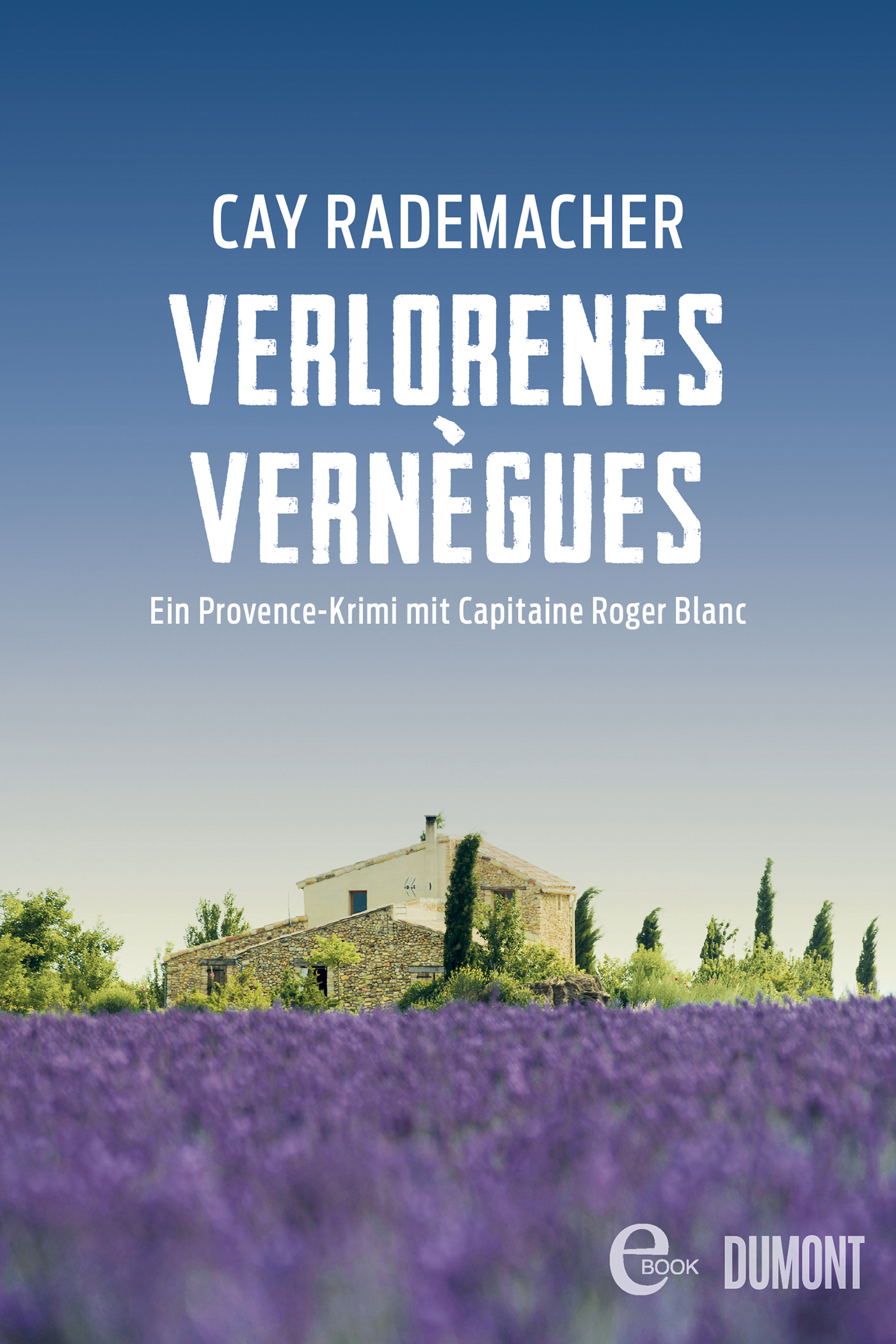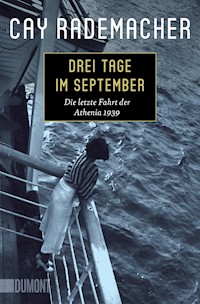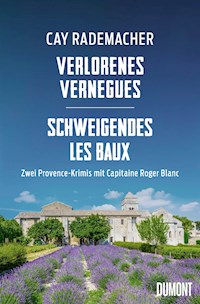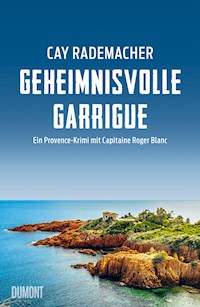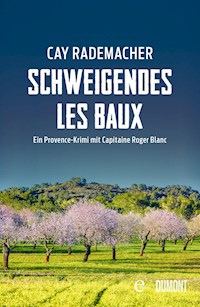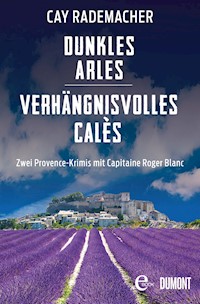9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Capitaine Roger Blanc ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der vierte Fall für Capitaine Roger Blanc Capitaine Roger Blanc und sein Kollege Marius Tonon sollen an der Côte Bleue Froschmänner der Regierung während eines geheimnisvollen Auftrags schützen. Ein erholsamer Job auf türkisblauem Meer, vor den pinienbewachsenen Steilwänden der Mittelmeerküste – bis ein unbekannter Taucher im Wasser treibt, eine Harpune steckt in seinem rechten Auge. Alle glauben an einen schrecklichen Unfall, nur Blanc kommt dieser Tod merkwürdig vor. Er forscht nach und findet heraus, dass der Tote zu den Wracktauchern zählte, Spezialisten, die ohne Rücksicht auf die Natur jahrhundertealte, gesunkene Schiffe plündern, um die Beute an reiche Sammler zu verkaufen. Eine ebenso gefährliche wie illegale Arbeit, die bei vielen Einheimischen verrufen ist. Besonders die Fischerin und Ökoaktivistin Christin Antunes protestiert heftig dagegen. Reicht das als Motiv? Als es an der Küste zu einem weiteren, nicht weniger grauenhaften »Unfall« kommt, ist klar: Blanc steckt wieder einmal in einem neuen Fall. Mord in der Provence – Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues Band 8: Schweigendes Les Baux Band 9: Geheimnisvolle Garrigue Band 10: Stille Sainte-Victoire Band 11: Unheilvolles Lançon Band 12: Rätselhaftes Saint-Rémy Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die letzten warmen Tage in der Provence: Capitaine Roger Blanc und sein Kollege Marius Tonon sollen an der Côte Bleue Froschmänner der Regierung während eines geheimnisvollen Auftrags schützen. Ein erholsamer Job auf türkisblauem Meer, vor den pinienbewachsenen Steilwänden der Mittelmeerküste – bis ein unbekannter Taucher im Wasser treibt, eine Harpune steckt in seinem rechten Auge. Alle glauben an einen schrecklichen Unfall, nur Blanc kommt dieser Tod merkwürdig vor. Er forscht nach und findet heraus, dass der Tote zu den Wracktauchern zählte – jenen Spezialisten, die ohne Rücksicht auf die Natur jahrhundertealte, gesunkene Schiffe plündern, um die Beute an reiche Sammler zu verkaufen. Eine ebenso gefährliche wie illegale Arbeit, die bei vielen Einheimischen verrufen ist. Besonders die Fischerin und Ökoaktivistin Christin Antunes protestiert heftig dagegen. Reicht das als Motiv? Als es an der Küste zu einem weiteren, nicht weniger grauenhaften »Unfall« kommt, ist klar: Blanc steckt wieder einmal in einem neuen Fall.
© Françoise Rademacher
Cay Rademacher, geboren 1965, ist freier Journalist und Autor. Bei DuMont erschienen seine Kriminalromane aus dem Hamburg der Nachkriegszeit: ›Der Trümmermörder‹ (2011), ›Der Schieber‹ (2012) und ›Der Fälscher‹ (2013). Seine Provence-Krimiserie umfasst: ›Mörderischer Mistral‹ (2014), ›Tödliche Camargue‹ (2015), ›Brennender Midi‹ (2016), ›Gefährliche Côte Bleue‹ (2017), ›Dunkles Arles‹ (2018) und ›Verhängnisvolles Calès‹ (2019). Außerdem erschien 2019 der Kriminalroman ›Ein letzter Sommer in Méjean‹. Cay Rademacher lebt mit seiner Familie in der Nähe von Salon-de-Provence in Frankreich.
Mehr über das Leben im Midi erfahren Sie im Blog des Autors: Briefe aus der Provence
CAY RADEMACHER
GEFÄHRLICHECÔTE BLEUE
Ein Provence-Krimimit Capitaine Roger Blanc
eBook 2017
© 2017 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Getty Images/by Xiaoran Jiang
Karte: Kartografie Angelika Solibieda, Cartomedia-Karlsruhe
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8940-2
www.dumont-buchverlag.de
L’histoire n’est pas faite pour rassurer l’homme, mais pour l’alerter.
Tod eines Tauchers
Capitaine Roger Blanc stand mit bloßen Füßen auf dem warmen Stahldeck eines Schiffes. Die weißen Aufbauten reflektierten die Mittagssonne so grell, dass seine Augen trotz der getönten Brille schmerzten. Das Wasser war glatt und klar, als wäre die André Malraux in eine türkisfarbene Glasfläche eingeschmolzen. Die Kette am Bug reichte bis in zehn, vielleicht sogar fünfzehn Meter Tiefe, wo sich der Anker in einen Teppich aus braungrünen, sanft in der Strömung schwingenden Pflanzen gegraben hatte. Ein Schwarm handgroßer, silbriger Fische umschwamm die eisernen Glieder.
Etwa hundert Meter rechts von Blanc strichen träge Wellen gegen eine beinahe lotrechte Felswand, die den Himmel begrenzte. Der grauweiße Kalkstein war uralt, von Rissen und Spalten zerfurcht, am Meeressaum dunkel und glänzend vor Feuchtigkeit, darüber trocken wie Kreide. Dicht unter dem Kamm lagen rote Gesteinsbrocken frei, aus denen der Regen über Äonen die Farbe in langen Fäden ausgewaschen hatte. Calanque des Roches Sanglantes wurde die Bucht genannt, die Calanque »der blutenden Felsen«. Dunkle Kammern öffneten sich auf halber Höhe der Klippen und erinnerten Blanc an leere Augenhöhlen. Pinien krallten sich mit verknoteten Wurzeln über dem Abgrund fest, ihre Äste streckten sich dem Licht entgegen.
Die Sonne brannte auf Blancs nackten Unterarmen, mit jedem Atemzug schmeckte er Rosmarin, Thymian und Salz auf den Lippen. Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Wir haben den ersten Oktober, aber es ist, als hätten wir Hochsommer. Das fühlt sich nicht echt an.«
»Echter als ein Freudenmädchen«, erwiderte sein Freund und Kollege Lieutenant Marius Tonon gelassen. Er lehnte neben ihm an der Reling und prostete ihm mit dem Becher seiner Thermoskanne zu, in die er einen »Kaffee« gekippt hatte, der nicht gerade nach gerösteten Bohnen duftete. »Das sieht hier immer so aus.«
»Wir sollen auf diesem Schiff arbeiten. Aber wir haben nichts zu tun und braten in der Sonne. Das ist zu schön. Da stimmt etwas nicht.«
»Wir könnten eine Runde schnorcheln, falls du dich langweilst«, schlug Marius gut gelaunt vor. »Das Wasser ist noch mindestens zweiundzwanzig Grad warm. Die silbernen Fische unter uns, das sind Saupes, die ›Rinder des Meeres‹. Die knabbern die Pflanzen von den Felsbrocken und sind so blöd, dass du sie mit der Hand fangen kannst. Wir könnten uns auch einen Seeigel holen, seine Schale knacken und ihn mit einem Stück Baguette ausschlürfen.«
»Den ganzen rohen Seeigel?«
»Nur seinen Schließmuskel. Köstlich.«
Blanc verzog das Gesicht. »Du weißt genau, was ich meine«, erklärte er und blickte sich um. »Dieser Job muss einen Haken haben. Wir sind nicht hier, um die Schließmuskeln von Seeigeln zu essen. Wir räumen Scheiße weg.«
Commandant Nicolas Nkoulou hatte sie am frühen Montagmorgen auf die André Malraux beordert. Mehr als eine Stunde lang hatte Nkoulou Blanc und Marius zuvor in seinem Büro instruiert. Blanc tat nun schon seit einem Vierteljahr Dienst in der Gendarmeriestation von Gadet, doch alle seine bisherigen Besuche im Büro des Commandanten zusammengenommen hatten nicht so lange gewährt wie dieser eine.
Als Calanques wurde, wie Nkoulou ihm ausführlich erklärt hatte, die zerklüftete Felsenküste westlich und östlich von Marseille bezeichnet. Blanc hatte schon vom karibischen Wasser und von harzigen Pinien gehört, von halsbrecherischen Wanderwegen zwischen mürbem Gestein – und von abendlichen Pétanque-Partien vor den Cabanes, den Ferienhäusern jener Glücklichen, die in den Naturschutzgebieten gebaut hatten, als das zwar schon illegal gewesen war, aber noch niemand so genau hingesehen hatte. Er war jedoch noch nie dort gewesen.
»Ein Taucher hat dort vor ein paar Wochen unter Wasser eine Höhle entdeckt«, hatte Nkoulou erklärt. »Die Höhle ist so verwinkelt, dass es lebensgefährlich wäre, dort einzudringen. Aus gewissen Erwägungen hat sich unsere Regierung deshalb entschlossen, den Zugang zu versperren.«
Marius hatte gelacht und gerufen: »Eine zweite Cosquer-Höhle?«
Blanc hatte diesen Namen schon einmal irgendwo gehört, aber er erinnerte sich an keine Einzelheiten mehr.
»Die Höhle, die man 1985 entdeckt hat«, hatte Marius eingeworfen. »Die Höhle mit den Steinzeitbildern, Bären, Löwen, solche Sachen. Tausende Jahre alt und sehr empfindlich. Damit nicht jeder Trottel dort hineinschnorcheln kann, haben sie vor einigen Jahren die Unterwasseröffnung mit Beton und Stahl verrammelt.«
Nkoulou hatte gehüstelt. »Offiziell wissen wir so gut wie nichts. Eine neu entdeckte Unterwasserhöhle, deren Zugang zur allgemeinen Sicherheit versperrt wird. Punkt. Ob dort Bilder von zotteligen Neandertalern an die Wände geschmiert wurden, muss uns nicht interessieren.« Er hatte eine fleckige blaue IGN-Wanderkarte der Calanques auf seinem Schreibtisch ausgebreitet, deren Faltkanten schon mürbe waren. Macht unser Chef Trekkingtouren?, hatte sich Blanc flüchtig gefragt. Nkoulous perfekte Uniform schien ihm von Funktionskleidung und Goretex-Schuhen so weit entfernt zu sein wie eine Priestersoutane von Reizwäsche.
Der Zeigefinger des Commandanten war die Küstenlinie von West nach Ost entlanggefahren. »Das Schiff wartet im Hafen von Martigues auf Sie, Messieurs. Es wird Sie an Cap Couronne vorbeifahren, an Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet … bis hierhin.« Er hatte mit dem Finger auf eine Bucht getippt, deren runde, fast geschlossene Form Blanc unwillkürlich an die Sprechblase eines Comics erinnerte. Erst als sein Chef die Fingerkuppe wieder anhob, hatte er den Namen lesen können: Calanque des Roches Sanglantes.
»Dort wird die André Malraux ankern. Das Forschungsschiff gehört zum DRASSM, zum Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Es hat einen Kran an Bord – und ein achthundert Kilogramm schweres Gitter aus massivem Stahl. Vor einiger Zeit hat das Forschungsschiff den Eingang zur Grotte mit einem ultrasensiblen akustischen Scanner abgetastet, der ein 3-D-Modell des Höhleneingangs erzeugt hat, auf dessen Grundlage wiederum ein passendes Gitter an Land gebaut worden ist. Ein paar Taucher werden es einsetzen. Es sollte nicht lange dauern.«
»Und warum sind wir dabei, mon Commandant?«, hatte Blanc gefragt. »Ich habe zuletzt als Junge geschnorchelt, im Ärmelkanal, ungefähr drei Meter vom Strand entfernt.«
Nkoulou hatte auf einige dunkle, eckige Symbole auf der Landkarte gedeutet. »Ferienhäuser. Die meisten werden um diese Jahreszeit verlassen sein. Einige Hundert Meter weiter östlich erkennen Sie den Fischerhafen von La Redonne. Da wohnen keine zwanzig Familien. Es werden also wahrscheinlich kaum Menschen in der Calanque des Roches Sanglantes sein. Aber ›wahrscheinlich‹ bedeutet ja nicht ›sicher‹. Und da die Mission der Taucher«, er hatte gezögert, »eh bien, sensibel ist, hat mich gestern Abend ein leitender Angestellter des DRASSM gebeten, zwei Beamte abzustellen. Nur zur Sicherheit.«
»Glauben die Eierköpfe aus Paris denn ernsthaft, dass jemand die Froschmänner angreifen könnte?«, hatte Marius wissen wollen.
»Ich vermute eher, dass man seitens der Regierung nicht will, dass jemand zu genau hinsieht, wo die Taucher arbeiten. Sollte sich ein Schwimmer bis zu Ihnen verirren oder ein Fischer seine Fangleine direkt neben der André Malraux ausbringen wollen, dann bitten Sie ihn höflich, sich zum Teufel zu scheren.«
»Und wenn er sich nicht schert?«
»Dann nehmen Sie ihn fest und stecken ihn unter Deck in eine fensterlose Kammer, bis Sie wieder in Martigues ankern.«
»Die Taucher mögen keine Gaffer, was?«
»Ich habe schon mit entspannteren Menschen telefoniert.«
Und so standen Blanc und Marius einige Stunden später am Bug der André Malraux und zählten Fische. Das Schiff war neu, sauber und gut sechsunddreißig Meter lang. Für Blancs in maritimen Dingen ungeschultes Auge sah es nicht aus wie ein Forschungsschiff, sondern wie eine Luxusjacht aus einem James-Bond-Film der Sechzigerjahre. Nur dass sich am Heck, wo ein Milliardär wohl einen Hubschrauberlandeplatz installiert hätte, ein eckiger Kran über ein großes Arbeitsdeck wölbte. Vom Kran aus führte ein straff gespanntes Stahlkabel ins Wasser. Vor einer halben Stunde hatten die Matrosen an ihm das Gitter in die Tiefe gelassen. Jetzt standen noch ein Mann und eine Frau in hellgrauen Arbeitsoveralls am Heck. Die Frau beobachtete aufmerksam den armdicken Draht. Der Mann hielt das Steuergerät des Krans in den Händen, das aussah wie eine übergroße Spielkonsole. Seine Körperhaltung verriet, dass er nicht sonderlich angespannt war. Dort, wo das Stahlseil in den Wellen verschwand, stiegen Luftblasen nach oben. Sechs Taucher arbeiteten irgendwo unter ihnen.
Blanc blickte zum Ufer hinüber. Einige Häuser klebten geradezu an der Steilküste, die meisten schienen nur aus übereinandergeschichteten Terrassen zu bestehen und waren hinter Pinienzweigen, Hecken und Mauern kaum zu erkennen.
»Jede Hütte ein Milliönchen«, bemerkte Marius. »Meeresblick, reiche Nachbarschaft, ruhige Lage.«
»Sehr ruhig.« Blanc nickte. Auf den meisten Grundstücken war überhaupt keine Bewegung auszumachen. Am Rinnstein der schmalen Straße zwischen den Häusern parkte ein Auto. Blanc inspizierte es durch ein Fernglas: Kleine Haufen Piniennadeln bedeckten schon Motorhaube und Dach.
An der nordöstlichen Seite der Calanque bildeten Felsbrocken und Kiesel eine Art Strand. Blanc glaubte, dass man von der Küstenstraße aus mit ein wenig Geschick bis dort hinunterklettern könnte. Doch niemand hatte sich diese Mühe gemacht, kein Schwimmer oder Sonnenanbeter war zu sehen. Weil er nichts weiter zu tun hatte, untersuchte er die Bucht mit dem Fernglas Meter für Meter. Ein paar angeschwemmte Plastikflaschen, Reste eines Fischernetzes, Treibholz. Bis auf eine hölzerne Segeljacht am gegenüberliegenden Ende der Bucht störte kein weiteres Boot die Ruhe in der Calanque. Die Jacht hatte schon dort geankert, als die André Malraux an diesem Vormittag eingelaufen war. Seither hatte Blanc auch ihr hin und wieder Aufmerksamkeit geschenkt. Doch auf deren Deck bewegte sich ebenfalls nichts.
»Schönes Boot.« Er deutete hinüber. »Kostet das auch eine Million?«
»Ich schätze, der Kahn ist nicht einmal zehn Meter lang«, erwiderte Marius. »Der kostet bloß so viel wie ein Auto.«
»Mein Espace ist keine hundert Euro mehr wert.« Blanc betrachtete den hölzernen Rumpf, dessen Lack in der Sonne glänzte. Von Messingrahmen eingefasste Bullaugen reflektierten das Licht, die Segel am Mast schienen sorgfältig verzurrt worden zu sein, alle Leinen waren aufgerollt. »Sieht aus, als könnte man damit direkt Kurs auf ein Museum nehmen«, meinte er bewundernd. »Das muss doch einen Haufen Geld gekostet haben.«
»Geld ist nicht das Problem. Die Jacht ist in den Fünfzigerjahren gebaut worden oder vielleicht sogar schon vor dem Krieg. Wenn du nicht willst, dass dein schönes Holzboot vom Meersalz zerfressen wird, dann musst du ständig basteln. Eine Stunde segeln, zwei Stunden basteln. Wer viel Geld hat, der kann normalerweise auch gut rechnen – und wer rechnen kann, kauft sich ein Boot aus Kunststoff. Holz ist etwas für Wahnsinnige.«
»Wahnsinnige kommen in der freien Wildbahn viel zu selten vor.« Blanc gab Marius das Fernglas und kramte in seinem Rucksack. Er holte seine vierzig Jahre alte Leicaflex SL heraus und drehte ein Hundertfünfunddreißiger-Teleobjektiv in dessen Halterung.
Marius starrte ihn fassungslos an. »Kannst du nicht ein Bild mit deinem Handy machen?«
Blanc wog die schwere Spiegelreflexkamera stolz in der Hand. »Der Apparat ist mir beim Aufräumen in die Hände gefallen. Ich habe ihn vor Jahren in Paris auf einem Flohmarkt gekauft und irgendwann vergessen«, erklärte er. »War gar nicht so einfach, noch einen Film dafür aufzutreiben.« Blanc blickte durch den Sucher und fokussierte. Der Batterietyp für den Belichtungsmesser der Leica wurde längst nicht mehr hergestellt. Er stellte Blende und Belichtungszeit nach Gefühl ein und betrachtete den warmen Braunton vom Holzrumpf, die Schattenspiele der gefalteten Segel, Lichtreflexe auf dem Wasser, im Hintergrund die Felsküste mit dem Fleckenmuster der Pinienkronen. Ein unbenutzter zweiter Anker auf dem Vordeck der Jacht. Ein in der Sonne blitzender Bootshaken. Zu kunstvollen Schlangenfiguren aufgerollte Taue. Die Pinne des Steuerruders, das Endstück dunkel von unzähligen Stunden, die es jemand in der Hand gehalten haben musste. Er drückte den Auslöser und vernahm ein sattes Klack. Geht doch, dachte Blanc, spulte den Film ein Bild weiter und schoss das nächste Foto. Und das nächste.
»Ich hatte eine Minolta. Die muss irgendwo in unserem Keller liegen, wenn meine Frau sie nicht inzwischen in den Müll geworfen hat.« Ein Mann in weißer Uniform war lautlos an sie herangetreten.
»Wollen Sie mal hindurchsehen,Kapitän?«, fragte Blanc und nahm die Leica hinunter. Xavier-Marie Nargeolet war der Kommandant der André Malraux und sah aus wie Sigmund Freud auf Steroiden: klein, drahtig, beweglich, ein Bantamgewichtsboxer, mit dem sich der liebe Gott einen milden Scherz erlaubt hatte, als er auf den Athletenkörper einen kahlen, graubärtigen Gelehrtenkopf pflanzte.
Der Kapitän nickte erfreut, nahm die alte Leica vorsichtig in die Hände und blickte durch den Sucher zum Holzboot hinüber. »Merde«, murmelte er nach einem Augenblick. Dann, lauter und immer lauter: »Merde, merde, merde!«
Nargeolet warf Blanc den Fotoapparat zu und hob sein Fernglas an die Augen. Nach einem Augenblick ließ er es wieder sinken und schüttelte fassungslos den Kopf, bevor er sich umdrehte und Richtung Achterdeck lief. »Das Schlauchboot!«, schrie er seinen beiden Crewmitgliedern zu. »Macht das verdammte Zodiac fertig!«
»Was ist denn mit der Jacht los?«, rief ihm Blanc verblüfft nach.
»Sehen Sie sich das Wasser an! Ungefähr fünf Meter vor dem Bug!«
Blanc riss die Leica ans Auge, drehte am Objektiv und musterte das stille Meer.
Marius griff nach dem Fernglas. »Merde«, hörte Blanc seinen Kollegen murmeln.
Blanc wurde fast verrückt, weil er noch immer nichts erkennen konnte. Endlich sah er im Sucher eine dunkle Kontur zwischen den Wellen, ein Stück weit vor der Jacht. Er hätte dies für ein Stück Treibholz gehalten oder ein Bündel abgerissenen Seegrases. Er fokussierte das Tele genau auf das Objekt, bis auch er es endlich klar erblicken konnte. »Merde«, murmelte er.
Im Meer trieb ein Mann in einem dunklen Neoprenanzug. Er lag bäuchlings auf den Wellen, doch sein Kopf war zur Seite, das Gesicht in Richtung der André Malreaux gedreht. Eine Tauchermaske verdeckte seine Züge. Ihr Glas war zersprungen. Denn in der Maske steckte eine Harpune.
Geisterschiff
Blanc stopfte die Leica hastig in seinen Rucksack und eilte über das Deck. Das Zodiac dümpelte schon links neben dem Rumpf im Wasser. Der Matrose hielt es noch an einer Leine fest. »Ich behalte unsere Taucher im Auge!«, versicherte er dem Kapitän gerade.
Nargeolet drückte auf den Starterknopf des Motors, die junge Frau aus der Crew hockte am Bug des Zodiacs. Als sie sah, wie sich Blanc über die Reling zu ihnen hinunterschwang, griff sie unter die Mittelbank und warf ihm wortlos eine orangefarbene Rettungsweste zu. Blanc kannte bislang nur bunte Gummiboote aus der Zeit der Badeurlaube mit seinen Eltern. Er war überrascht, wie stabil sich das Zodiac anfühlte. Obwohl er eins neunzig groß war, stand er sicher im Boot und hatte die Schwimmweste in wenigen Sekunden übergestreift. Nur das Schulterhalfter mit der SIG Sauer behinderte ihn für einen Augenblick.
»Putain!« Marius’ hochroter Kopf erschien erst jetzt über der Reling. Er war mindestens zwanzig Kilogramm schwerer als Blanc und nicht gerade der schnellste Sprinter der Gendarmerie.
»Wir haben keine Schwimmweste mehr im Boot!«, rief die junge Frau ungehalten.
»Ich will ja auch nicht aussehen wie ein holländischer Fußballspieler«, schnaufte Marius, überstieg mühsam die Reling und ließ sich auf die mittlere Bank des Zodiacs fallen.
Die Frau zuckte mit den Schultern und ließ die Leine los, Nargeolet drehte den Motor hoch. Sie rauschten über das Wasser, niemand sprach, die Matrosin kniete am Bug und gab ihrem Kapitän mit der Hand Zeichen, wo er hinzusteuern hatte. Kaum eine Minute später stoppte er das Schlauchboot wieder.
»Dem kann niemand mehr helfen«, brummte Marius. Er war der Erste, der über Bord griff und den Toten packte. Blanc half ihm und bekam einen Arm zu fassen, Nargeolet griff nach einer Schwimmflosse, bis er ein Bein so weit zu sich gezogen hatte, dass er das Fußgelenk umklammern konnte. Fluchend und stöhnend zerrten die Männer an der Leiche. Tote waren so schwer zu tragen wie Zementsäcke. Sie wuchteten den Schnorchler mühsam auf den prall aufgepumpten Gummiwulst des Zodiacs, doch er blieb irgendwo an einer Leine hängen.
»Auf mein Kommando«, keuchte Nargeolet. »Eins, zwei, DREI!«
Sie packten energischer zu und hievten den Toten schließlich wie einen riesigen Fisch über die linke Seite ins Zodiac. Die junge Frau übergab sich auf der anderen Seite ins Wasser.
»Sie müssen sich das nicht ansehen«, sagte Blanc schwer atmend zu Nargeolet.
Doch der Kapitän blickte bloß kühl auf den Schnorchler. »Ich habe schon ganz andere Wasserleichen gesehen.«
Der Mann war sechzig Jahre alt, schätzte Blanc, und er war klein gewachsen, doch von jener tiefen Sonnenbräune, die nur durch viele Jahre im Freien in den Körper gebrannt wird. Um seinen kahlen Schädel wandt sich ein Kranz schwarzer Haare, auf seinen Wangen lag ein Bartschatten. Sein Körper steckte in einem Neoprenanzug, der den Leib schützte, nicht jedoch Arme und Beine. Seine Knie waren von frischen Schürfwunden gezeichnet. Der Unbekannte hatte blauschwarze Flossen an den Füßen und trug eine wuchtige stählerne Rolex-Taucheruhr am linken Handgelenk. Der größte Teil seines Gesichts wurde von der zersplitterten Tauchermaske verdeckt.
Die Harpune sah aus wie eine übergroße, schwarze Nadel. Sie mochte einen Meter dreißig lang sein, vermutete Blanc. Das Geschoss steckte tief in der rechten Augenhöhle, vom Auge selbst war kaum noch etwas zu erkennen. Eine dünne Leine führte von der Harpune über den Bordrand bis unter Wasser. Marius zog daran und hielt ein paar Sekunden später die Harpunenkanone in der Hand. Es war eine Art leichtes Plastikrohr mit Pistolengriff und Abzug, ein starker Gummizug schlackerte lose herum.
»Damit spannt man die Harpune«, erklärte Marius. »Das funktioniert im Prinzip wie ein Flitzebogen, nur dass du damit keinen Pfeil abschießt, sondern ein Stahlgeschoss mit Widerhaken. Damit jagst du kleine Kraken in den Calanques. Du musst schon auf weniger als zwei Meter an sie herankommen, damit so eine Harpune gefährlich ist.«
»Sie war gefährlich genug«, erwiderte Blanc leise.
»Typischer Anfängerfehler«, meinte Nargeolet nüchtern. »Der Kerl schwimmt im Wasser und hat keinen festen Halt, während er die Harpune ins Rohr einlegt. Mit der Maske sieht er nicht gut, er bewegt sich hin und her. Das Meer wirkt hier still wie eine Badewanne, aber das täuscht. In den Calanques zerrt ständig eine Strömung an dir. Der Schnorchler legt den Gummizug um das Geschoss und versucht gleichzeitig, sich gerade zu halten und kein Wasser zu schlucken. Er fummelt am Abzug herum – und plötzlich geht die Harpune los …« Der Kapitän deutete auf einen kleinen roten Hebel oberhalb des Pistolengriffs, der auf »Off« stand. »Der hatte seine Harpune nicht einmal gesichert. Ein Anfänger eben.«
Blanc betrachtete den muskulösen Körper des Toten, seine tief gebräunte Haut, die teure Taucheruhr; selbst der Neoprenanzug und die Flossen sahen nicht danach aus, als seien sie Sonderangebote von Decathlon. »Er wirkt aber wie ein Profi«, erwiderte er.
Nargeolet zuckte mit den Achseln. »Sie werden ja herausfinden, wer er ist. Der Mann ist Ihr Problem.«
Die junge Frau drehte sich endlich wieder zu ihnen um, blickte kurz auf den Schnorchler, dann in den Himmel. Sie war sehr blass. »Würden Sie bitte dieses … dieses Ding da aus seinem Kopf ziehen?«, flüsterte sie ihrem Kapitän zu.
Blanc hob die Hand. »Das wird die Gerichtsmedizinerin tun!« Er nickte Marius zu, der bereits sein Handy gezückt hatte und dabei war, die Nummer von Doktor Fontaine Thezan vom Hospital in Salon-de-Provence anzurufen. »Sie soll uns in Martigues erwarten«, fuhr Blanc fort, dann wandte er sich wieder der Matrosin zu. »Mademoiselle …« Er entzifferte das Namensschild auf ihrem Overall: »… Dufour. Es tut mir sehr leid, aber wir sollten den Toten so wenig wie möglich berühren.«
»Ich werde ihn ganz sicher nicht anrühren!«, rief sie.
»Sehen Sie einfach auf das Meer und versuchen Sie, sich zu entspannen, Mademoiselle.«
»Ich wünschte, wir wären schon wieder auf der André Malraux.«
»Wir müssen vorher noch etwas erledigen.«
Sie blickte ihn alarmiert an.
Blanc lächelte entschuldigend und deutete auf das hölzerne Segelboot, das in ihrer Nähe ankerte. »Ich denke, wir sollten uns dort umsehen«, sagte er.
»Sie glauben, dem Taucher gehörte das Segelboot?«, fragte Nargeolet zweifelnd, während er den Motor startete.
»Von irgendwoher muss er ja gekommen sein«, erklärte Blanc.
»Die meisten Schnorchler gehen von der Küste aus ins Wasser. Touristen. Oder Leute, die in den Cabanes wohnen.«
Blanc deutete auf die Felsen. »Der Tote hat Flossen an den Füßen. Wenn er über die Felsen ins Meer gegangen ist, dann müsste dort irgendwo ein Paar Schuhe zu sehen sein und wahrscheinlich auch ein Handtuch und ein T-Shirt. Aber da liegt bloß Treibgut am Ufer.«
Nargeolet zuckte mit den Achseln und steuerte das Zodiac zum Heck der Jacht. »Gehen Sie achtern rüber, da ist die Bordwand so niedrig, dass Sie es ohne Leiter schaffen.«
Am Heck leuchtete das Namensschild des Segelbootes, eine Holzplakette mit geschnitzten und vergoldeten Buchstaben: »Pytheas«.
Nargeolet deutete auf einige aufgeklebte Buchstaben und Zahlen unterhalb des hölzernen Schildes. »Die Zulassungsnummer beginnt mit ›MT‹«, sagte er. »Die Jacht ist in Martigues zugelassen.«
»Kommt sie Ihnen bekannt vor?«, fragte Blanc.
»Da dümpeln viele Boote im Hafen.«
Blanc nickte. »Dann wollen wir mal an die Haustür klopfen.« Er schwang sich an Bord der Pytheas, pochte mit der Hand gegen das Holzdeck und rief: »Jemand da?« Tiefe Stille umhüllte ihn. Ein Geisterschiff, dachte er.
Eine offene Luke wies ihm den Weg zur Kajüte. Vorsichtig trat er zum Niedergang und beugte sich unter Deck. Vorhänge hingen innen vor den Bullaugen. Als sich seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, schüttelte er überrascht den Kopf. Blanc hatte erwartet, dass die Kajüte genauso poliert wäre wie das Deck. Doch innen sah es aus, als hätte sich der Inhalt eines schmuddeligen Wohnwagens in eine Werkstatt ergossen. Er blickte backbord auf eine Koje mit speckiger Matratze und eine winzige Kombüse, auf deren einflammigem Gasbrenner die verspritzten Soßen vieler Jahre festgebrannt waren. Gegenüber war eine Art Werkbank an die Bordwand geschraubt worden, auf der Zangen und Hämmer lagen, in einer Schraubzwinge steckte ein technisches Teil, dessen Funktion Blanc nicht verstand. Zwei stählerne Taucherflaschen waren schräg an die Wand gelehnt, Neoprenanzüge unterschiedlicher Größen, Masken und Bleigürtel hingen an Haken.
Marius polterte auf das Deck und drängte sich zu ihm in die Kajüte. »Glaubst du, dass die Jacht dem Toten gehört?«, fragte sein Kollege.
Blanc deutete auf die schmale Koje. »Sieht so aus, als würde es hier nur Platz für eine Person geben. Und die Luke stand offen.«
Marius strich sich nachdenklich über seine dichten, etwas zu langen Haare. Um sein Handgelenk blitzte es. Blanc kannte den Talisman schon, ein Goldkettchen mit einer Plakette der Sainte Geneviève, der Schutzpatronin der Flics – und zufälligerweise der Heiligen, nach der Blancs Frau benannt worden war. Seine baldige Exfrau. Er zwang sich, den Blick von dem Goldkettchen zu nehmen. Marius und er sahen sich in der Kajüte um, ohne etwas anzufassen.
»Wenn ich bei diesen Temperaturen mit einer Harpune Tintenfische fangen wollte«, fuhr Marius fort, »dann würde ich eine Kühlbox mitnehmen. Oder ein paar Beutel Eis in einem Eimer. Irgendetwas, um meine Beute frisch zu halten. Aber davon sehe ich hier nichts. Der Typ da draußen schießt Tintenfische und tuckert anschließend mit seinem schwimmenden Oldtimer bis Martigues zurück? Er wäre erst abends im Hafen, und seine Fische würden inzwischen stinken wie die Unterhose eines Clochards.«
»Alors?«
»Also ist der Tote entweder doch nicht der Besitzer dieser Jacht und treibt hier bloß zufällig herum.«
»Klingt nicht sehr wahrscheinlich.«
»Oder er hat sich die Sache nicht überlegt, bevor er zur Harpune gegriffen hat.«
Blanc deutete auf die schmutzige Kochstelle. »Vielleicht wollte er sich bloß einen frischen Fisch für die Pfanne besorgen«, vermutete er. »Er ankert mit seiner Jacht in dieser schönen Bucht. Das Wetter ist herrlich. Er hat Hunger – und springt spontan über Bord, um sich sein Mittagessen zu fangen. Das wäre genau so eine Situation, wie sie Nargeolet beschrieben hat: Du denkst nicht richtig nach, du passt nicht richtig auf, und plötzlich bist du tot.«
»Ich sehe hier aber weder Pfanne noch Topf. Kein Baguette, nichts zu trinken.« Marius zog sich Gummihandschuhe über und griff unter die Kombüse, wo eine alte, blaue Campinggasflasche stand. Er hob sie an und schüttelte den Kopf. »Die ist leicht. Da ist kein Gas mehr drin. Das wäre nichts mit dem spontan gebratenen Fisch geworden.«
Blanc deutete auf die Pressluftflaschen. »Das sieht nach einer richtigen Taucherausrüstung aus. Und denk an die Rolex am Handgelenk des Toten. Und die Pytheas ist gut in Schuss. Du hast es selbst gesagt: Man muss viel Zeit auf diese Holzboote verwenden. Wenn der Tote der Eigner der Jacht ist, dann war das kein Anfänger. Das war niemand, der sich seine eigene Harpune in den Schädel jagt, nur weil irgendwo ein Gummi klemmt!«
Blanc streifte sich ebenfalls Handschuhe über und öffnete die Tür eines Schapps, woraufhin ihm eine speckige Ledermappe in die Hände fiel. Als er sie öffnete, entdeckte er die Kopie der Versicherungspolice und die Zulassungspapiere der Pytheas. Und darunter eine Taucherlizenz, einen Führerschein und einen Personalausweis, alles ausgestellt auf einen »Luc Mignaux«. »Laut der Adresse auf seinen Papieren wohnt er in La Redonne.« Blanc zückte seinen Notizblock und notierte die Angaben.
»Das ist das Fischerdorf in den Calanques, ganz in der Nähe. Aber der Hafen ist so flach, da kommst du mit einem Segelboot nicht rein, der Kiel geht zu tief. Wahrscheinlich liegt die Pytheas deshalb in Martigues.«
Blanc schaute auf das Geburtsdatum im Ausweis und rechnete nach. »Luc Mignaux ist einundsechzig Jahre alt.«
»Der Typ, den wir aus dem Wasser gezogen haben, hatte Muskeln wie ein dreißigjähriger Bodybuilder. Aber er hatte Altersflecken auf den Händen.«
Blanc verließ die Kajüte und sprang wieder in das Zodiac. »Würden Sie bitte auf das Meer sehen, Mademoiselle Dufour?«, bat er. »Ich muss mich leider doch am Toten zu schaffen machen.« Er holte tief Luft und zerrte an der Maske, wobei noch einige Splitter abbrachen. Die Harpune blieb im Auge stecken, doch es gelang ihm, die Maske so weit vom Kopf zu lösen, dass sie das Gesicht freigab. Er hielt den Ausweis neben den Kopf des Toten und verglich das Foto mit den verunstalteten Zügen. »Das ist unser Mann«, murmelte Blanc nach ein paar Augenblicken.
Krämpfe schüttelten die junge Frau, weil sie wieder würgen musste, aber ihr Magen längst leer war.
Ein illegaler Job
Auf dem Achterdeck der André Malraux legten sechs Taucher ihre Stahlflaschen, Gürtel und Werkzeuge ab. Die Männer wirkten erschöpft, aber heiter. »Der Job ist erledigt!«, riefen sie und machten Scherze. Doch als das Zodiac näher herangekommen war, hörten sie auf zu winken.
»Feierabend«, sagte Nargeolet zu Blanc. »Das Gitter ist unten, die Männer sind oben. Je schneller wir wieder in Martigues sind, desto besser.«
»Können Sie die Jacht abschleppen?«
»Dann müssen wir langsamer fahren.«
»Das macht mir nichts aus.«
»Ihnen vielleicht nicht. Aber ich wäre den Kerl gern los. Wo soll ich ihn hinlegen?«
»Haben Sie keine Krankenstation an Bord?«
»Eine Liege. Aber wenn ich da den Toten aufbahre, wird keiner meiner Leute je wieder …«
»Bringen Sie ihn auf das Achterdeck und breiten Sie eine Plane darüber. Und packen Sie Eis aus der Kombüse dazu.«
Zwanzig Minuten später fuhr die André Malraux aus der Bucht und zog die Pytheas hinter sich her. Zwei Männer vom Forschungsschiff waren auf die Jacht gegangen und passten auf, dass sich die Schlepptrosse nicht löste. Blanc hatte ihnen eingeschärft, möglichst wenig anzufassen.
Nargeolet und ein Matrose standen auf der Brücke. Der Mann steuerte das Forschungsschiff mit einem Joystick, der Kapitän starrte unverwandt nach vorne, als könnte er allein durch die Kraft seines Blickes das Schiff schneller in den Heimathafen zwingen. Die übrigen Taucher waren unter Deck verschwunden. Mademoiselle Dufour stand im Bugkorb, so weit entfernt vom Achterdeck wie möglich.
Marius blickte zu dem länglichen Bündel unter dem Kran, man hätte denken können, dass unter der blauen Plane bloß ein paar Schläuche oder Werkzeuge lagen, aus denen Wasser abfloss. »Das Eis ist schon weggetaut. Unter dem Plastik wird es ganz schön warm«, murmelte er. »Das wird Doktor Thezan den Job nicht gerade erleichtern.«
»Wenn wir den Toten offen auf dem Deck liegen lassen, hacken ihm die Möwen sein einziges Auge aus, bevor wir in Martigues sind«, erwiderte Blanc düster. Er griff nach seinem Nokia und rief Nkoulou an.
»Ich sage dem Hafenmeister Bescheid und schicke einen Streifenwagen«, antwortete sein Chef, nachdem er ihm kurz erklärt hatte, was vorgefallen war. Dann legte er auf.
»Nkoulou war so gelassen, als hätte ich ihm einen Auffahrunfall in einer Tiefgarage gemeldet«, erklärte Blanc, als er sein Handy wieder wegsteckte.
»Manchmal hat es seine Vorteile, dass der Commandant ein kalter Frosch ist«, sagte Marius. Er machte sich nicht die Mühe, den Rest seines »Kaffees« in den Becher zu kippen, sondern schraubte die Thermosflasche auf und trank sie in drei tiefen Zügen leer.
Blanc beobachtete ihn, sagte jedoch nichts. Dann blickte er zur Küste hinüber. Das späte Nachmittagslicht färbte die Felsen rosa, sodass es wirkte, als seien die Steine plötzlich weich geworden. Die Pinien standen nun als Scherenschnitte vor dem Himmel, in dessen Bläue ein Halbmond schimmerte. Die tief stehende Sonne hatte das Meer in flüssiges Gold verwandelt. Eine Brise war aufgekommen und trug den Duft der Pinien bis zu ihnen, obwohl Nargeolet sein Schiff nun etliche Hundert Meter vom Land entfernt auf Kurs hielt.
»Wirklich schön hier in den Calanques«, murmelte Blanc.
Die Idylle endete, nachdem sie Cap Couronne passiert hatten. Die Küste knickte nach Nordwesten ab und wäre fast so schön gewesen wie die Calanques, wenn sich nicht die Schlote und Riesentanks einer gewaltigen Raffinerie über die Landschaft ausgebreitet hätten.
»Den Komplex von Lavéra haben die Arschlöcher in Paris geplant«, brummte Marius missvergnügt, »als sie nach dem Krieg dachten, dass sie uns die Industrie bringen müssten.«
»Irgendwoher muss unser Benzin ja kommen«, erwiderte Blanc. Er war jahrelang Flic in Paris gewesen. Hässliche Industriebauten erschütterten ihn nicht mehr.
»Öl und Gas kommen mit den Tankern aus Algerien. Und die Algerier sind gleich mitgekommen. Wir hätten im Midi eine ganze Menge Probleme weniger, wenn sie damals ihre Raffinerie einfach an den Champs-Elysées hochgezogen hätten.«
Die André Malraux fuhr an vier Tankern vorbei, die vor der Küste ankerten. Rostschlieren überzogen die kolossalen Schiffsrümpfe. Blanc blickte zu den Decks hoch, wo er bloß ein Gewirr aus Rohren und Ventilen erkennen konnte. Dann bog die André Malraux in den Hafen Port-de-Bouc ein. Hier lagen fünf weitere Tanker an Piers. Pipelines verbanden ihre Rümpfe mit der Raffinerie von Lavéra, die Schiffe sahen aus wie Wale, die auf einer Intensivstation an Kanülen angeschlossen waren. Es stank nach Öl, Teer und fauligen Abfällen.
Ein Kanal führte von Port-de-Bouc zum Étang de Berre, einem großen See, der vom Mittelmeer gespeist wurde und von der Durance, weshalb sich in ihm Salz- und Süßwasser mischten. Marius wohnte in Saint-César am gegenüberliegenden Ende des Étang de Berre. Blanc selbst hatte dort in seinem ersten Fall in der Provence ermittelt. Saint-César war ein Fischerstädtchen zwischen Pinien und einem schilfbestandenen Sumpf, zwanzig Kilometer und tausend Jahre von Port-de-Bouc entfernt.
Die André Malraux tuckerte unter einer stählernen Eisenbahnbrücke hindurch, dann unter den Betonstelzen einer absurd hohen Autobahnkonstruktion, der Wahn einer technokratischen Epoche, in der Ingenieure noch hofften, dass Wagen irgendwann fliegen würden, und in der man deshalb, solange das noch nicht möglich war, wenigstens schon einmal die Fahrbahn bis in den Himmel hob.
Blanc blickte sich um, nachdem sie den Schatten der Brücke passiert hatten. Er sah die Tankerterminals, die kastenförmige Eisenbahnbrücke, die Autobahn über seinem Kopf, am Horizont standen die Schornsteine einer Raffinerie. Aus einem Schlot loderten Flammen und schwarzer Rauch. Von dort, wo er stand, sah es aus, als würde der Brand aus dem Kamin die Autobahnbrücke von unten anzünden.
Und dann, ganz plötzlich, glitt Blanc aus den schrecklichen Siebzigerjahren ins mittelalterliche Venedig: Sie steuerten Martigues an. Schmale Kanäle durchzogen die Altstadt. Die Häuser standen Wand an Wand fast direkt am Wasser. Manche Fassaden leuchteten gelb, ockerrot und elfenbeinweiß, andere waren ausgebleicht wie Wäsche, die jemand zu lange in der Sonne hatte trocknen lassen: ausgewaschenes Blau, fleckiges Beige, ein Haus hatte die grüne Farbe von Algen angenommen, die an einem Felsen klebten. Über den Dächern wachten drei wuchtige Kirchtürme, einer am linken Ufer, einer am rechten und einer auf der Insel, um die Kanäle strichen.
An den steinernen Piers dümpelten offene, hölzerne Fischerboote, die Rümpfe weiß gestrichen, die Decks leuchteten türkisblau. Blanc sah alte, hölzerne Segler in bunten Farben, mit niedrigem Mast und langer, gebogener Gaffel – Boote, wie sie schon Vincent van Gogh auf seinen Bildern vom Strand von Saintes-Maries-de-la-Mer gemalt hatte. Neben ihnen dümpelten schnittige Motorboote aus weißem Plastik, Jachten aller Größen und ein altes Segelboot, dessen Rumpf lilafarben lackiert war. Ein würziger Duft nach Salz und Fischen und starkem Kaffee aus den Bars an den Piers strömte über das Wasser. Nargeolet steuerte das Forschungsschiff in ein schmales, lang gestrecktes Hafenbecken, das auf der einen Seite von der Altstadt, auf der anderen von modernen Vierteln gesäumt war.
Auf einem Pier aus Beton vor einem modernen Verwaltungsbau standen mehrere Gestalten. Hinter ihnen parkten ein Krankenwagen, ein Mégane der Gendarmerie, ein dunkelblauer Porsche 911 – und ein verbeulter, weißer Jeep Cherokee. »Unsere Gerichtsmedizinerin ist pünktlich«, sagte Blanc zu Marius.
Doktor Fontaine Thezan war Mitte dreißig und hatte eine Vorliebe für Brillen im Stil von Audrey Hepburn, Sichan-Tee und Zigaretten mit nicht ganz legalen Inhaltsstoffen. Sie stand neben ihrem Jeep, trug einen Arztkoffer in der Linken und gestikulierte mit der Rechten, während sie mit sechs Männern sprach – zwei Gendarmen in Uniform, zwei Rettungssanitätern, einem sportlichen Mann ihres Alters und einem jungen Kerl mit übergroßer Nerdbrille aus schwarzem Kunststoff.
»Ist das der Typ, mit dem sie im letzten Monat bei uns auf der Station aufgekreuzt ist?«, fragte Blanc und deutete auf den Brillenträger.
»Das ist ein Neuer«, antwortete Marius seufzend. »Wenn du jünger bist als fünfundzwanzig und noch nicht im Bett von Doktor Thezan gelegen hast, dann stimmt irgendetwas nicht mit dir. Sie schleppt ständig junge Kerle ab. Hat wahrscheinlich mit ihrem Beruf zu tun. Wenn ich jeden Tag Kadaver aufschneiden müsste, würde ich mich auch nach Frischfleisch sehnen.«
Sobald die Matrosen eine Planke von der André Malraux zum Pier geschoben hatten, betrat die Gerichtsmedizinerin das Schiff. Sie nickte Marius zu, küsste Blanc auf die Wangen und umhüllte ihn mit ihrem Hauch von Grüntee und Marihuana. »Ich habe die Herren gebeten, zunächst an Land zu bleiben. Ich sehe mich gerne ungestört um«, sagte sie zur Begrüßung.
»Wer sind die beiden Männer in Zivil?«, fragte Blanc.
Fontaine Thezan deutete mit einer lässigen Handbewegung auf die sportliche Gestalt. »Er ist vom Gemeinderat, seinen Namen habe ich schon wieder vergessen. Er ist für den Hafen zuständig und unglücklich, weil Sie ihm ein Totenschiff an den Pier schleppen.« Sie lächelte spöttisch und machte sich nicht die Mühe, den jüngeren Mann mit der Brille vorzustellen.
Blanc deutete auf die Matrosin. »Sie sollten sich ausnahmsweise zuerst um die Lebenden kümmern, Doktor.«
»Soll ich ihr ein Beruhigungsmittel geben?«
»Eins für den Magen wäre auch nicht schlecht.«
Fontaine Thezan nickte und ging zu der jungen Frau, die noch immer am Bug stand, als wäre sie auf Deck festgeschraubt. Sie redete kurz auf Dufour ein und führte sie zu den Kabinen unter der Brücke. Dann überquerte sie mit energischen Schritten das Achterdeck und schlug die Plane über dem leblosen Körper zurück.
Blanc ließ die Gerichtsmedizinerin ungestört arbeiten. Unauffällig musterte er den Mann vom Gemeinderat: athletisch und braun gebrannt – so tief gebräunt wie der tote Taucher. Er sah nicht gerade aus wie ein typischer Lokalpolitiker, eher wie jemand, der lieber auf dem Wasser als im Rathaus seine Zeit verbrachte. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass der hier aufgekreuzt ist, dachte er. Er würde ihm ein paar Fragen stellen. Später.
Nach einer halben Stunde kam Doktor Thezan auf ihn zu und streifte sich im Gehen die Gummihandschuhe ab. »Wollen wir uns den Toten nun gemeinsam ansehen, Messieurs?«
»Geh du mal. Ich halte hier die Stellung«, sagte Marius.
Blanc verzog das Gesicht und nickte der Gerichtsmedizinerin zu. »Haben Sie eine Überraschung für mich, Doktor?«
»Das glaube ich kaum.« Fontaine Thezan führte ihn zur Leiche und deutete auf das linke Auge, das aussah, als hätte es ein Boxer bearbeitet. »Das ist ein Brillenhämatom«, erklärte sie. »Hervorgerufen durch Einblutungen im Ober- und Unterlid. Typisch für ein schweres Schädelhirntrauma. Die Harpune ist durch das rechte Auge bis ins Gehirn gedrungen. Das Blut verursacht das Hämatom am linken Auge. Um Einzelheiten zu erkennen, werde ich ihn röntgen müssen. Und das Geschoss kann ich erst entfernen, wenn wir den Schädel öffnen, der Widerhaken ist zu stark.«
»Landen auf Ihrem Seziertisch häufiger Menschen mit einer Harpune im Körper?«
»Das bleiben meist Fälle für die Kollegen von der Notaufnahme. Die Schnorchler verletzen sich in der Regel an Armen oder Beinen mit ihren Harpunen. Tödliche Unfälle sind selten. Ich hatte zuletzt vor drei Jahren einen Mann mit einer Harpune in der Kehle.«
»Unfall oder Mord?«
»Sehen Sie eigentlich in jedem Toten ein Mordopfer?«
»Manchmal lasse ich mich vom Gegenteil überzeugen.« Blanc dachte nach. »Der Taucher sah aus wie ein Profi«, erklärte er. »Würde ein erfahrener Mann sich selbst eine Harpune ins Auge schießen?«
»Mon Capitaine, der Begriff ›erfahrener Mann‹ ist ein Widerspruch in sich.«
Blanc räusperte sich. »Wie lange, glauben Sie, hat er im Wasser gelegen?«
»Einige Stunden, vielleicht einen Tag. Nach der Leichenöffnung kann ich Ihnen wahrscheinlich Genaueres sagen. Er hat keine Algen am Körper, die Fäulnis hat noch nicht eingesetzt, die Meerestiere haben sich noch nicht an ihm zu schaffen gemacht.« Fontaine Thezan lächelte dünn. »Es gibt sonst nur wenig zu sehen. Das Opfer hat Schürfwunden an den Knien. Keine Unterblutungen im Gewebe, die Wunden sind ihm also erst nach dem Tod zugefügt worden, typisch für Wasserleichen, die von der Strömung gegen Felsen oder andere harte Gegenstände gedrückt werden. Eigentlich müsste man solche Schürfwunden auch an der Stirn sehen, doch wahrscheinlich hat ihn die Tauchermaske davor bewahrt.«
»Der Tote trieb nicht weit entfernt von seiner Jacht. Das Wasser war dort mehrere Meter tief. Wie soll er sich die Knie aufgeschürft haben?«
»Vielleicht hat ihn eine Welle gegen den Bootsrumpf gedrückt. Vielleicht hat ihn eine Strömung in einer Art Kreis zur Küste und zurück getragen.« Die Gerichtsmedizinerin winkte zum Pier hin. »Die Sanitäter werden ihn ins Krankenhaus bringen.«
»Warum haben Sie keinen Leichenwagen bestellt?«
»Die Fahrer streiken. Aus Protest gegen irgendeine Regierungsreform. Überall im Land müssen Beerdigungen verschoben werden. Die Leute kochen vor Wut. Hören Sie eigentlich kein Radio?«
Marius und Blanc warteten, bis Fontaine Thezan von Bord gegangen war und die Sanitäter den Toten in den Rettungswagen getragen hatten. Als Blanc endlich den Pier betreten konnte, grüßte er die beiden Uniformierten und schickte sie zurück nach Gadet. »Hier gibt es nichts mehr zu tun.«
»Das freut mich zu hören«, mischte sich der sportliche Mann ein, dessen Namen die Gerichtsmedizinerin vergessen hatte. »Claude Figaroli«, stellte er sich vor. »Ich sitze im Gemeinderat. Les Républicains, aber ich rede auch mit Ihnen, wenn Sie den Front wählen. Oder die Sozialisten. Aber welcher Flic ist schon Sozialist?« Er lachte und schüttelte Blanc und Marius die Hand.
»Sie sind für den Hafen zuständig?«, fragte Blanc.
»Und für alles, was mit Sport und Freizeit in Martigues zu tun hat.«
»Mit Sport und Freizeit hat das wenig zu tun.« Blanc deutete auf die Pytheas. »Diese Jacht gilt für einige Tage als Tatort. Niemand darf sie ohne unsere Erlaubnis betreten. Kann man sie irgendwo festmachen?«
»Das Boot kann vorerst hier bleiben. Der Pier gehört der Mairie. Was ist mit Luc geschehen? Ich habe einen Anruf von Ihrem Chef bekommen, aber die Sache ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ein Unfall?«
»Sie kannten Monsieur Mignaux?«
»Klar. Seine Jacht lag schon hier im Hafen, als ich noch Sperma auf dem Weg zur Eizelle war.« Figaroli lachte wieder.
Wer wählt so einen Kerl in den Gemeinderat?, dachte Blanc. Er erklärte knapp, wie sie den Toten gefunden hatten.
»Es wirkt wie ein außerordentlich unglücklicher Unfall«, ergänzte Marius.
Figaroli strich sich über seine blonden Haare. »Also, wenn ich die Leiche vorhin nicht mit eigenen Augen auf der Bahre gesehen hätte, würde ich es nicht glauben. Mignaux war nicht der Typ, der Fehler machte.« Figaroli schüttelte den Kopf. »Luc war professioneller Taucher«, fuhr er fort. »Kein Schönwetterschnorchler. Ein richtiger Profi. Einer, der im Tankerhafen unter die Schiffe gegangen ist oder bei Brückenbauarbeiten die Pfeilerfundamente überprüft hat. Jemand, der auf hundert Meter runtergehen konnte, der bei jedem Wetter draußen war und sich in Hafenbecken zurechtfand, die so trübe sind, dass man die Hand vor den Augen nicht sehen kann. Wenn Luc je leichtsinnig gewesen wäre, dann hätte es ihn längst erwischt.«
»Er war immer noch Profi?«, fragte Marius.
»Luc hat sich vor fünf Jahren in die Rente verabschiedet. Seitdem taucht er nur noch zum Vergnügen und pflügt die Calanques um!« Figaroli ließ sein amerikanisches Lachen hören.
»Umpflügen? Ein seltsamer Ausdruck fürs Tauchen«, sagte Blanc liebenswürdig.
Figaroli räusperte sich. Er wirkte, als bereute er schon, was er gesagt hatte. »Vergessen Sie’s«, murmelte er.
»Das sollte man einem Flic niemals sagen«, erklärte Marius.
Der Politiker seufzte. »Wissen Sie, was Calanques bedeutet?« Er wartete die Antwort gar nicht erst ab. »Es kommt vom provenzalischen Wort calanco: ›steil‹. Die Buchten sind nichts anderes als steile Täler, die Flüsse vor Urzeiten in die Kalksteinfelsen gegraben haben. Inzwischen ist der Meeresspiegel gestiegen, aus den Canyons sind Fjorde geworden. Aber sie haben unter Wasser ihre Form behalten: eng, steil, unübersichtlich. Was Sie und ich heute malerisch finden, das war für Seefahrer lange die Hölle. Hier sind unzählige Schiffe gesunken. In diesen Gewässern liegen Wracks herum wie sonst kaum irgendwo auf der Welt, von der antiken griechischen Galeere bis zum Flugzeug, mit dem Antoine de Saint-Exupéry im Zweiten Weltkrieg abgestürzt ist. Aber weil die Calanques so zerklüftet sind, ist es sehr schwer, diese Reste zu finden.«
Figaroli beugte sich näher zu Blanc. »Nur … wenn man einmal ein Wrack gefunden hat, dann ist das wie ein Lottogewinn«, flüsterte er. »Münzen, Amphoren, Goldbarren, Kanonen … Da unten liegen Schätze herum! Und das bloß ein paar Hundert Meter vom Land entfernt. Und in einem Meer, das so warm ist, dass man sogar im Januar dort tauchen kann.«
»Zumindest, wenn man ein Profi ist«, ergänzte Blanc. Er begann zu ahnen, womit der Rentner Mignaux seine Zeit verbracht hatte.
»Richtig!« Figaroli schlug ihm jovial auf die Schulter. »Luc, so munkelt man, hat da unten so viele Schiffe entdeckt, dass er damit den Hafen von Martigues hätte füllen können.«
»Munkelt man das bloß, oder weiß man das?«
»Ich weiß es nicht.«
»Wracktauchen ist illegal«, bemerkte Marius gelassen.
»Ich bin im Gemeinderat. Und hauptberuflich bin ich Segellehrer. Mir gehört Aventure Voilier hier in Martigues. Als Politiker und als Geschäftsmann stehe ich selbstverständlich auf der richtigen Seite des Gesetzes.«
»Die Welt wäre ein schönerer Ort, wenn alle Ihre Kollegen so denken würden wie Sie«, brummte Blanc.
»Und Sie wären dann arbeitslos, was, mon Capitaine?« Figaroli lachte wieder. »D’accord, ich verrate Ihnen, was man so munkelt. Der gute alte Jacques Cousteau hat 1952 vor den Frioul-Inseln das erste antike Wrack entdeckt. Es lag bloß vierzehn Meter tief. Mehr als vierhundert Amphoren hatte es geladen, manche liegen noch heute auf dem Grund! Eh bien. Seither suchen hier Taucher nach Wracks. Es sind nicht viele, denn die Sache ist nicht bloß illegal, sie ist auch gefährlich. Wenn du so gut tauchen kannst wie Cousteau, dann kannst du dich zwischen die Felsen wagen. Für alle anderen gilt: Bleib beim Schnorcheln und zähl die Fische!«
»Mignaux hat wohl keine Fische gezählt.«
»Vermutlich nicht. Wissen Sie, der Mann war ein Einzelgänger. Nicht unsympathisch, aber ein einsamer Wolf. Keine Ehefrau, keine Kinder, keine Freunde – außer Büchern. Er hat alles gelesen, was es über die alten Griechen und Römer in der Provence zu lesen gibt. Er blieb am liebsten für sich und war ständig auf dem Wasser. Er ist mit seiner Pytheas noch vor dem Morgengrauen ausgelaufen und erst nachts wiedergekommen. Oder erst nach zwei, drei Tagen. Niemand wusste, wo er sich herumtrieb. Manchmal hat man seine Jacht in irgendeiner Calanque vor Anker liegen gesehen. Aber von Luc selbst keine Spur, der war irgendwo unter Wasser.«
»Hat er nie jemanden auf seine Touren mitgenommen?«, fragte Blanc.
»Nie.«
»Hat Mignaux nie mit einem Fund geprahlt?«, wunderte sich Marius. »Hat er nie in einer Bar eine antike Münze herumgehen lassen? Hat er keinem Mädchen einen uralten Ring geschenkt? Solche Sachen?«
»Luc hat sich unter Fischen wohler gefühlt als unter Menschen.«
»Deshalb hat er auch in La Redonne gewohnt?«, wollte Blanc wissen. »Nahe am Meer?«
»Direkt am Fischerhafen«, erwiderte Figaroli und nickte. »Ich war nie bei ihm, ich kenne das Haus nur von außen. Drei Schritte von der Haustür, und er stand im Wasser.«
Blanc dachte nach. Solche Häuser waren Millionen wert, hatte Marius gesagt. Die Pytheas mochte weniger gekostet haben, aber geschenkt bekam man eine solche Jacht auch nicht. Was mochte ein Profitaucher als Rente bekommen, wenn er schon mit Mitte fünfzig aufhörte? Garantiert nicht genug für ein Haus in den Calanques und ein Segelboot aus Holz. »Was machen Wracktaucher mit ihren Funden?«, fragte er Figaroli. »Sind das Besessene, die zu Hause horten, was sie aus dem Meer holen? Oder verkaufen sie ihre Beute an Sammler?«
»Sie können nicht einfach eine Amphore auf dem Flohmarkt verscheuern. Der Handel mit Funden aus den Wracks ist genauso illegal wie das Tauchen nach ihnen.«
»Das treibt doch bloß die Preise in die Höhe.«
Figaroli seufzte, dann lächelte er. Es wirkte, als müsste er seine Gesichtsmuskeln dafür einem rigorosen Krafttraining unterwerfen. Er machte mit der Rechten eine unbestimmte Geste, die sowohl den Hafen als auch die Altstadt von Martigues umschloss. »Mon Capitaine«, sagte er in vertraulichem Tonfall, »Sie haben doch sicher von der André Malraux aus die Raffinerien gesehen?«
»Sie waren schwer zu übersehen.«
»Noch! Seit 2013 machen die Anlagen rund um den Étang de Berre nämlich dicht: Azur Chimie in Port-de-Bouc, LyondellBasell in Berre, Kem One bei Lavéra. Das Ölzeitalter ist vorbei, zumindest hier. Das Zeug ist zu billig geworden. Manche Fabriken sehen aus, als hätten dort die Amerikaner für den Irak geübt. Da steht nichts mehr! Nichts, verstehen Sie?« Figaroli blickte Blanc an. Er klang überhaupt nicht verzweifelt, sondern euphorisch. »Das ist unsere Chance«, fuhr er fort. »Die Raffinerien verschwinden, aber die Küste hier bleibt! Die Côte d’Azur ist unfassbar teuer geworden, aber die Côte Bleue kennt kaum jemand außerhalb von Marseille. Dabei sind die Calanques viel schöner als dieser Kieselstreifen vor Nizza! Die Häuser in den Calanques sind jetzt schon teuer, aber dann erst …« Figaroli rieb Zeigefinger und Daumen aneinander. »Und in Martigues sieht es aus wie in Venedig! Die Grundstücke neben den Raffinerien, die Sie heute für zehntausend Euro kaufen können, werden dann zehn Millionen kosten.«
»Schön und gut. Aber was hat das alles mit einem toten Wracktaucher zu tun?«, unterbrach ihn Blanc ungerührt.
»Wir brauchen einen Paukenschlag, der die Leute aufweckt«, erklärte der Politiker beschwörend. »Denn wir brauchen Investoren, die aus der alten Industriewüste ein modernes Freizeitparadies machen. Wenn es erst einmal einen ordentlichen Anschub gibt, dann fließt das Geld anschließend von allein weiter. Und dieser Paukenschlag, das sind die Olympischen Spiele.«
Blanc blickte ihn überrascht an. »Hier?«
»Paris bewirbt sich als Austragungsort für Olympia 2024. Sie können aber auf der Seine nicht segeln. Wo also werden die Segelwettkämpfe stattfinden?«
»Sie wollen die Calanques zur Rennstrecke umfunktionieren?« Marius lachte.
Figaroli blickte ihn nahezu flehend an. »Das Meer vor Marseille ist perfekt! Und auf dem Étang de Berre könnten die Athleten trainieren: Ruderer, Windsurfer, Jollen.« Figaroli atmete tief durch, seine Augen leuchteten. »Alors, bekommt Paris den Zuschlag, dann laufen die olympischen Segler bei uns ein. Und wenn das hier geschieht, was glauben Sie, was dann aus dieser Küste wird? Die Investoren werden uns anbetteln, ihr Geld bei uns anlegen zu können. Das ist das, was wir brauchen!«
Blanc lächelte. »Und das, was Sie auf keinen Fall brauchen, ist ein Skandal während der Bewerbungsphase.«
»Sie wissen selbst, welches Image Marseille hat! Sie wissen auch, dass man mit dem Étang de Berre vor allem die Raffinerien verbindet. Das sind schon zwei Dinge, die das Projekt belasten. Eine Riesengeschichte um einen harpunierten Taucher und illegalen Antikenhandel würde unsere Kandidatur versenken.«
»Ich kann Monsieur Mignaux nicht einfach in den Calanques versenken und die Sache vergessen.«
»Ermitteln Sie, mon Capitaine, ermitteln Sie selbstverständlich! Aber es muss ja nicht zu viel davon in die Zeitung kommen, oder?« Figaroli zwinkerte. »Denken Sie an Olympia. Denken Sie daran, wie schön diese Küste wird, wenn die Raffinerien fort sind. Das Paradies, mon Capitaine, liegt am Meer!« Er schüttelte ihnen die Hand und ging zu dem dunkelblauen Porsche 911.
Blanc blickte Figaroli hinterher, als er davonbrauste. »Sieht so aus, als hätten die Investoren den Startschuss längst gehört«, sagte er zu Marius.
Das Haus am Meer
»Warst du schon einmal in La Redonne?«, fragte Marius Blanc, nachdem sie sich von Nargeolet und seiner Crew verabschiedet hatten und auf ihren Wagen zuschlenderten.
»Ich wusste bis heute Morgen nicht einmal, dass es diesen Ort gibt.«
»Dann fahre ich.«
Blanc dachte an den »Kaffee«, den Marius während der Bootstour getrunken hatte. »Ich kann mich auch hinter das Steuer setzen.«
»Du wirst mir noch dankbar sein.«
Eine Viertelstunde später war Blanc geneigt, seinem Freund beizustimmen. Denn nachdem sie einige Kilometer über eine Schnellstraße gefahren waren, steuerte Marius den Mégane über immer engere Wege. Das Asphaltband schlängelte sich an felsigen Abhängen vorbei, über die eine Decke aus Buschwerk und Gräsern gebreitet war. Der Wagen quälte sich im zweiten Gang Serpentinen hinauf und hinunter, über die man früher wahrscheinlich Maultiere hatte prügeln müssen. Einmal führte die Route départementale steil auf den Kamm einer Anhöhe und knickte dahinter so abrupt in die Tiefe, dass sich Blanc unwillkürlich am Sitz festklammerte. »Das ist wie auf einer Achterbahn!«, keuchte er.
»Auf einer Achterbahn hast du keinen Gegenverkehr.« Marius hupte vor jeder Kurve. Auf seiner Stirn hatte sich ein feiner Schweißfilm gebildet.
Endlich weitete sich der Blick zum Mittelmeer, das im Sonnenlicht wie eine goldene Scheibe bis zur Unendlichkeit strahlte. Der Mégane bezwang die letzten Serpentinen und rollte unter einer Brücke hindurch, deren steinerne Bögen wirkten, als trügen sie ein Aquädukt aus römischer Zeit. Doch es rumpelte in diesem Augenblick bloß ein graffitibesprühter Zug vorbei.
Der Hafen von La Redonne war ein von Molen umfasstes, kleines Becken. Einige alte Fischerkähne aus Holz sowie Zodiacs und Kunststoffmotorboote waren an den Piers vertäut. Der felsige Boden schimmerte dicht unter ihren Kielen grünlich. Der Hafen, schätzte Blanc, war nicht einmal einen Meter tief.
Über der Bucht klebten ein paar Dutzend Häuser an den Felshängen, wie Zuschauer, die auf den Reihen eines Amphitheaters Platz genommen hatten. Auf dem winzigen Platz vor dem Hafen standen Tische und Stühle der einzigen Bar im Ort. Alle waren besetzt.
»Wo kommen die Leute her?«, wunderte sich Blanc. »Wir haben unterwegs doch kaum jemanden gesehen.«
»Die meisten fahren zum Abendessen aus Marseille hierher.«
»Und danach über die Serpentinen zurück? Da kotzt du doch das Essen aus dem Seitenfenster!«
Marius lachte und deutete auf den Hafen. »Du nimmst dein Boot! Ein kleiner Flitzer kostet nicht mehr als ein gebrauchter Fiat Panda. Damit bist du in einer halben Stunde vom Vieux Port aus in La Redonne, ganz ohne Serpentinen, Staus und Blitzgeräte. Nur Idioten fahren mit dem Auto in die Calanques.« Marius stellte den Mégane am Fundament eines Pfeilers ab. Blanc blickte auf ein winziges, beige gestrichenes Haus im Schatten der Eisenbahnbrücke. Er verglich dessen Nummer mit dem Eintrag in seinem Notizblock. »Das ist die Bleibe von Mignaux.«
Marius zog sich Gummihandschuhe über und machte sich nicht die Mühe zu klingeln, sondern drückte gleich die Klinke der Tür herunter. »Ist nicht einmal abgeschlossen«, verkündete er.
Sie traten in eine Art Wohnküche. In der Spüle stapelten sich schmutzige Teller, auf einem niedrigen Tisch lagen Dutzende schon angegilbte alte Ausgaben von La Provence. An einer Wand hing ein Ölbild, ein Hochformat, dessen schwerer, vergoldeter Rahmen fast so breit war wie das Bild selbst. Blanc, der sich ebenfalls Handschuhe übergestreift hatte, trat näher und betrachtete das Motiv: ein Segelschiff am Pier. »Vieux Port, Marseille«, las er, darunter eine nicht zu entziffernde Signatur. Was hätte seine Frau dazu gesagt? Geneviève war Kunsthistorikerin, sie hatte ihn gelegentlich auf Ausstellungen mitgenommen, später allerdings immer seltener. Für sein in dieser Hinsicht nur wenig trainiertes Auge sah das Bild nach neunzehntem Jahrhundert aus, und so schlecht war es nicht gemalt.
»Ein Erbstück?«, mutmaßte Marius, der neben ihn getreten war.
»Oder Mignaux hat sich ein bisschen Kunst gegönnt.« Blanc blickte sich um. Die anderen Wände verschwanden fast vollständig hinter Bücherregalen. Werke über antike Kunst. Die Geschichte der Griechen und Römer. Tauchen. Alte Segelboote.
»Kein Fernseher«, sagte Marius.
»Keine Familienfotos«, ergänzte Blanc.
»Kein Telefon.«
»Kein Computer.«
Eine Holztür, deren türkisfarbener Lack an vielen Stellen abgeplatzt war, öffnete sich in ein winziges Bad, in dem es nicht viel zu sehen gab. Eine enge Treppe führte zum Obergeschoss. Der hölzerne Dachstuhl war unverkleidet, Blanc strich mit den Fingern über seine alten, grob zugehauenen Balken und berührte die Innenseiten der Dachschindeln. Tuiles canal, wie in seiner Ölmühle, nur rau und verwittert. Eine große Matratze lag auf dem Fußboden, eine umgedrehte Obstkiste diente als Nachttisch. Neben dem einzigen Fenster standen ein Sekretär und ein lederbezogener Stuhl, zwei so fein gearbeitete Möbelstücke, dass sie nicht recht in das mönchisch anmutende Zimmer passten. Mit raschen Bewegungen durchforschte Blanc die Schubladen des Sekretärs: Rechnungen, Quittungen, der Karton eines Handys, alte Seekarten. Keine Briefe. Kein Tagebuch. »Nichts Illegales hier, nicht einmal etwas Persönliches, gar nichts«, murmelte Blanc.
Marius zuckte mit den Achseln. »Er wäre ja auch bescheuert, wenn er eine Seekarte hierlassen würde, in die er die Position jedes geplünderten Wracks eingetragen hätte.«
Blanc schüttelte misstrauisch den Kopf. »Ich war so viele Jahre Korruptionsermittler, und wenn ich eine Sache dabei gelernt habe, dann die: Die Leute sind bescheuert. Kontoauszüge Schweizer Banken, Briefe von Treuhändern auf den Cayman Islands, detaillierte Anweisungen an Notare in Liechtenstein – du glaubst nicht, was die Menschen alles in ihre Schubladen stopfen. Die Kerle, die Millionen einsacken, meinen immer, dass Geld eine Tarnkappe ist. Die rechnen im Leben nicht damit, dass mal jemand durch ihr Haus läuft und genau nachsieht.«
»Mignaux hat vielleicht schon damit gerechnet. Sieht ja auch nicht so aus, als hätte er so viel Geld verdient, dass es für eine Tarnkappe gereicht hätte.«
Blanc erwiderte nichts, sondern zog alle Schubladen ganz heraus, stapelte sie auf dem Boden und nahm sich noch einmal, und diesmal systematisch, ihre Inhalte vor. Blatt für Blatt ging er durch, entleerte einen Karton mit alten Buntstiften, öffnete verklebte Stempelkissen. Am Ende räumte er alles wieder zusammen und ließ nur drei Dinge auf der Schreibplatte zurück: den Karton des Handys, eine durchsichtige Schnellhefterhülle und eine mehrere Jahre alte Rechnung von einem Vercharterer für ein Zodiac.
»Ich will dich ja nicht entmutigen«, brummte Marius, »aber das sieht nicht wie bei einem Nummernkonto in der Schweiz aus.«
Blanc hob den Karton hoch. Es war die Verpackung eines ziemlich neuen Google-Nexus-Handys, ein Mobilfunkvertrag von Bouygues Telecom lag gefaltet darin.
»Wo ist das Handy?«, fragte Blanc.
Marius zuckte mit den Achseln. »Nicht auf seiner Jacht. Die habe ich gründlich durchsucht.«
Blanc nahm sein Nokia, gab die Nummer ein, die auf dem Bouygues-Vertrag angegeben war, und lauschte. Im Haus blieb es still. »Das Handy ist auch nicht hier.« Er blickte auf das Display: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden.
»Vielleicht hat der Taucher sein Gerät ausgeschaltet.«
»Wenn es ausgeschaltet ist, dann hat es Mignaux jedenfalls gut versteckt. Es liegt nicht im Sekretär, nicht auf seinem Nachttisch, nicht in seiner Wohnküche, nicht auf den Regalen.«
»Was hat ein verschwundenes Handy mit einer Harpune im Auge zu tun?«
Blanc reagierte nicht darauf und hob die Plastikhülle an. Darin befand sich ein älteres Foto, die Farben hatten schon einen Stich ins Grünlichgelbe bekommen. Man sah zwei Taucher auf dem Gummiwulst eines großen Schlauchbootes. Der eine war ein deutlich jüngerer Luc Mignaux. Darunter hatte jemand mit schwarzem Filzstift gekritzelt:»Zur Erinnerung an unser erstes Goldschiff – Lionel.«
»D’accord, der Typ neben Mignaux ist vielleicht ein Freund, der uns mehr über ihn sagen könnte. Aber willst du mithilfe eines verschlissenen Achtzigerjahre-Bildes eine Fahndung nach diesem Lionel ausschreiben? Nkoulou wird Herzrhythmusstörungen bekommen, falls er ein Herz hat. Du hast nicht einmal einen Nachnamen.«
Wortlos reichte Blanc die Rechnung des Vercharterers herüber. Auf dem Dokument wurden zwei Männer genannt, die das Zodiac ausgeliehen hatten: Luc Mignaux. Lionel Bonnot.
»Das muss nicht der Lionel auf dem Foto sein.«
»Wir werden das überprüfen. Vielleicht hatte unser tauchender Einzelgänger doch irgendwo auf dieser Welt einen Freund.«
Nachdem sie wieder im Erdgeschoss angelangt waren, suchte Blanc noch einmal die Regale ab. Eine feine Staubschicht lag auf den Brettern. Nur vor einem Buch war der Staub abgewischt, es war nicht ganz in die Reihe zurückgeschoben worden: J.-François Robert: En Provence Gallo-Romaine. Ein großformatiger Band mit Rekonstruktionszeichnungen antiker Städte.
Blanc blätterte durch die Seiten – und auf einmal fiel eine Münze aus dem Schutzumschlag heraus und rollte über den Fußboden. Er hob sie auf, sie war weder besonders groß noch besonders schwer. Ihr Metall schimmerte gräulich. Silber, vermutete Blanc, garantiert kein Gold. Auf der einen Seite erkannte er die Abbildung einer geflügelten Frau, deren Gewand antik wirkte. Sie schien einen Spiegel oder eine Schale an etwas zu befestigen, das aussah wie ein Baum. Eine Göttin? Eine Herrscherin? Die andere Seite zeigte einen Männerkopf im Profil, um ihn herum in Großbuchstaben einen Text: »DEC IUN BRU ALB«. »Klingt irgendwie lateinisch«, sagte Blanc.
»Deine Sprachkenntnisse treiben mir die Tränen in die Augen.«
»Kannst du das etwa übersetzen?«
»Ich habe Tränen in den Augen.«
Blanc lächelte und steckte das Geldstück in seine Brieftasche. »Ich habe keine Ahnung, was das für eine Münze ist. Aber sie scheint sehr alt zu sein. Und warum steckt eine antike Münze in den Seiten eines Buches?«
»Wahrscheinlich, um sie dort zu verbergen«, erwiderte Marius und nickte ergeben. »Also schön: Luc Mignaux war ein Wracktaucher. Er hat Schätze aus dem Meer geholt. Und er war tatsächlich bescheuert genug, eine Spur in seinem eigenen Haus zurückzulassen.«
Wracktaucher
Blanc war erst gegen ein Uhr zu seiner alten Ölmühle zurückgekehrt. Die Nächte gehörten schon dem Herbst. Das Thermometer war auf zehn Grad gefallen und die Luft so klar, dass die Sterne wie Millionen Leuchtdioden funkelten. Er streifte sich einen Fleecepullover über und setzte sich vor das Haus, drinnen hatte er keinen Handyempfang, weil die halbmeterdicken Steinmauern alle Funkwellen schluckten. Er googelte mit seinem Handy »Lionel Bonnot Taucher« und bekam ein paar Treffer: Eine Adresse in Saint-César. Eine mehrere Jahre alte Meldung aus dem Archiv von Var-matin über eine Trauerfeier in Toulon: Eine Marie Bonnot war nach einem »tragischen Verkehrsunfall« zu Grabe getragen worden. Sie hinterließ keine Kinder, aber den Witwer Lionel. Kein Foto im Netz von diesem Lionel Bonnot, keine Facebook-Seite, kein Twitter-Account. Blanc war sich trotzdem ziemlich sicher, dass es sich lohnte, Monsieur Bonnot einen Besuch abzustatten.
Er hörte Radio, während er im Dunkeln vor seinem Haus saß. Die meisten Stationen hatten nichts über den Toten in den Calanques gebracht. Radio Maritima meldete bloß einen »Badeunfall mit tödlichem Ausgang«. Für die Dienstagsausgabe der La Provence war die André Malraux