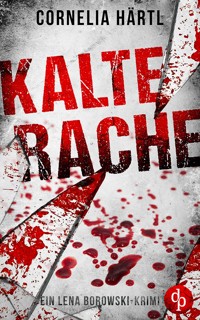5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Lena Borowski-Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein gefährliches Netz aus Lügen, Gewalt und Macht
Der atemberaubende Krimi für Fans von Mark Franley
Als Lena Borowski einen Anruf ihrer alten Schulfreundin bekommt, die sie bittet nach ihrer wie vom Erdboden verschwundenen Schwägerin zu suchen, kommt ihr die Abwechslung gerade recht. Seit Lena vom Jugendamt in einen sozialen Brennpunkt versetzt wurde, hat die Sozialarbeiterin das tägliche Leid von vernachlässigten Kindern und verprügelten Frauen unmittelbar und ständig vor Augen. Lena begibt sich auf Spurensuche nach der Verschwundenen. Im Laufe ihrer Nachforschungen wird sie dabei immer tiefer in die Rotlicht- und SM-Szene hineingezogen und lernt die dunklen Seiten Frankfurts kennen. Als die Leiche einer offenkundig bei SM-Spielen getöteten Frau auftaucht, befürchtet Lena das Schlimmste. Und plötzlich befindet sie sich in einem Netz aus Gewalt und Kontrolle, aus dem es für eine junge Frau scheinbar kein Entrinnen gibt …
Erste Leserstimmen
„Bedrohlich, aufwühlend, fesselnd – ein rundum gelungener Kriminalroman!“
„Das Rotlichtmilieu als ein Ort gefährlicher Machtspiele wurde von Cornelia Härtl sehr treffend und atmosphärisch beschrieben.“
„Lena Borowski ist eine tolle und starke Ermittlerin. Ich freue mich auf mehr von ihr!“
„Spannend bis zur letzten Seite! Ein Krimi der Extraklasse.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses E-Book
Als Lena Borowski einen Anruf ihrer alten Schulfreundin bekommt, die sie bittet nach ihrer wie vom Erdboden verschwundenen Schwägerin zu suchen, kommt ihr die Abwechslung gerade recht. Seit Lena vom Jugendamt in einen sozialen Brennpunkt versetzt wurde, hat die Sozialarbeiterin das tägliche Leid von vernachlässigten Kindern und verprügelten Frauen unmittelbar und ständig vor Augen. Lena begibt sich auf Spurensuche nach der Verschwundenen. Im Laufe ihrer Nachforschungen wird sie dabei immer tiefer in die Rotlicht- und SM-Szene hineingezogen und lernt die dunklen Seiten Frankfurts kennen. Als die Leiche einer offenkundig bei SM-Spielen getöteten Frau auftaucht, befürchtet Lena das Schlimmste. Und plötzlich befindet sie sich in einem Netz aus Gewalt und Kontrolle, aus dem es für eine junge Frau scheinbar kein Entrinnen gibt …
Impressum
Überarbeitete Neuausgabe Oktober 2020
Copyright © 2024 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-96817-124-1 Taschenbuch-ISBN: 978-3-96817-180-7
Copyright © 2014, Sutton Verlag Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits 2014 bei Sutton Verlag erschienenen Titels Böse Spiele (ISBN: 978-3-95400-322-8).
Covergestaltung: Buchgewand unter Verwendung von Motiven von depositphotos.com: © Ensuper, © Klanneke, © dimmitrius, © Pakhnyushchyy shutterstock.com: © Denis Gorlach Korrektorat: Lektorat Reim
E-Book-Version 13.08.2024, 14:17:24.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Handlung und Figuren dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt. Gelegentlich wurden mit künstlerischer Freiheit Gegebenheiten oder Schauplätze der Geschichte angepasst oder hinzugefügt.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Gefährliches Vertrauen
Kapitel 1
Laut klackerten ihre hohen Absätze auf dem Asphalt. Sie lief durch eine der kleinen Straßen, die vom Oeder Weg in Richtung Eckenheimer Landstraße führen. Für diese Uhrzeit war ungewöhnlich wenig los. Es nieselte seit Stunden. Die wenigen Menschen, die ihr begegneten, hasteten mit tief unter ihre aufgespannten Regenschirme gesenkten Köpfen durch die Dunkelheit. Sie trug ebenfalls einen Schirm, mit der anderen Hand hielt sie den Kragen ihres Trenchcoats geschlossen. Innerlich fluchte sie, denn das Wetter würde ihre teuren Strümpfe versauen. Um die Schuhe machte sie sich keine Sorgen. Für die hatte sie Ersatz. Ein wesentlich höheres Paar, in der Tasche, die an ihrem Arm hing.
„Ich hätte mir ein Taxi nehmen sollen“, murmelte sie leise vor sich hin. Doch wie üblich war sie mit der U-Bahn gefahren. Sie war sparsam, Taxifahrten strapazierten das Budget zu sehr.
Ihre Blicke wanderten an den Hausnummern entlang bis sie ihr Ziel erreicht hatte. Ein gesichtsloses Appartementhaus, das so gar nicht in diese Straße passte. Sie drückte die Klingel, zweimal kurz, einmal lang. Das verabredete Signal. Mit dem Lift fuhr sie in den fünften Stock. Als sich die automatischen Türen öffneten, wartete er bereits. Er musterte sie kalt.
Einen Moment lang standen sie sich stumm gegenüber. Plötzlich holte er aus und schlug ihr mit der flachen Hand brutal ins Gesicht.
***
„Ich bring die Schlampe um und dich gleich mit!“
Der Mann stand breitbeinig im Flur der kleinen Wohnung am Rohrbrunner Weg. Er hielt den rechten Arm wie zum Schlag erhoben. Mit seiner intensiven Bierfahne und den blutunterlaufenen Augen passte er in das gängige Klischee vom typischen Bewohner des östlichen Spessartviertels, eines Wohnquartiers in Dietzenbach, das über die Stadtgrenzen hinaus berüchtigt war.
„Beruhigen Sie sich!“ Lena Borowskis Stimme zitterte kein bisschen, obwohl innerlich ein Sturm vielfältiger Gefühle tobte. Wut und Zorn ebenso wie Angst vor der unberechenbaren Aggressivität, die ihr hier in Person des angetrunkenen Mannes gegenüberstand.
„Sie haben hier gar nichts zu melden!“, schrie er. „Wer sind Sie überhaupt? Was geht es Sie an, was ich mit meiner Frau mache?“
Sie zeigte auf die Frau, die hinter dem Mann im Flur wie ein Bündel Elend auf dem Boden kauerte.
„Lassen Sie Ihre Frau aus der Wohnung gehen. Sie braucht einen Arzt.“
Die Augen des Angesprochenen spiegelten kurz hintereinander völlig unterschiedliche Emotionen. Schmerz, Wut, Unsicherheit. Lena Borowski rührte sich nicht von der Stelle.
„Wir können alles regeln. Aber lassen Sie jetzt bitte Ihre Frau gehen!“
Alles regeln, daran glaubte Lena nicht. Dieser Mann hatte seine Frau schon früher misshandelt. Während sie äußerlich ruhig blieb, nicht zurückwich, den Mann zwar beobachtete, ihn aber nicht zusätzlich provozierte, überlegte sie fieberhaft, was sie tun sollte. Würde er, wenn sie jetzt von der Tür wegging, um die Polizei zu rufen, seine Frau vollends krankenhausreif prügeln, oder ihr gar Schlimmeres antun? Lena Borowski war seit über zehn Jahren im Jugendamt, hatte schon alles gesehen, was Familienmitglieder einander antun konnten.
In einer der oberen Etagen klappte eine Tür, eilige Schritte kamen über die Treppe nach unten. Eine Frau, sie mochte Anfang dreißig sein, in ihrem Alter. Als sie Lena bemerkte, hielt sie kurz inne und maß sie und den schwankenden Mann in der halb offenen Tür. Die Augen der Nachbarin weiteten sich, als sie das heftige Schluchzen aus der Wohnung hörte. Lautlos formte ihr Mund ein Wort. Lena signalisierte ihr mit einem Lidschlag ein „Ja“. Die Frau würde jetzt nach unten gehen und die Polizei anrufen, dessen war sie sich sicher.
Der Mann vor ihr hielt seine Fäuste geballt, er schien die Nachbarin nicht wahrgenommen zu haben.
„Ich lass mir das nicht bieten“, zischte er. „Erst hängt sie mir das Kind an, dann haut sie ab zu einem anderen Kerl und ich soll zahlen.“
„Wir werden das alles regeln“, wiederholte Lena. Sie verschob die Erörterung seiner Einkommenssituation lieber auf einen anderen Tag. Ihrer Erfahrung nach brachte es gar nichts, in solch einer aufgeheizten Situation auf Gesetze zu pochen. Das musste in einer beruhigten Atmosphäre stattfinden. Aber zunächst wollte sie die Frau herausholen, bevor ihr Schlimmeres zustieß. Das leise Weinen im Hintergrund stockte erschrocken, als der Mann sich einige Schritte in den Flur hineinbewegte und auf seine Noch-Ehefrau zuging.
„Du bist schuld an allem. Konntest den Hals nicht voll genug kriegen. Als ich noch Geld nach Hause gebracht habe, war ich gut genug für dich. Und jetzt …“ Wieder hob er die Faust. Die Frau schrie auf und hielt die Arme schützend über den Kopf, blieb jedoch am Boden hocken.
„Herr Jahnke, hören Sie auf!“ Lena spürte, wie das Adrenalin durch ihren Körper schoss. Sie würde nicht zusehen können, wenn der Mann auf seine Frau einschlug. Sie wägte ab, ob ihre Kenntnisse in Selbstverteidigung in dieser Situation ausreichen würden, um dazwischen gehen zu können, wenn es zum Äußersten käme. Der Mann war groß und schwer gebaut. Und er hatte getrunken, war also nur bedingt berechenbar.
„Herr Jahnke!“, rief Lena noch einmal. Sie wagte sich einen Schritt vor, übertrat die Schwelle zur Wohnung. Der Mann wirbelte herum und fauchte, mit Schaum vor dem Mund.
„Bleiben Sie, wo Sie sind!“
Die Entscheidung, ob und was sie tun konnte, wurde Lena in der nächsten Sekunde abgenommen, als zwei Polizisten, ein grauhaariger Mann und eine jüngere Frau mit einem wippenden roten Pferdeschwanz unter der Mütze, die Treppe heraufgerannt kamen. Lena trat sofort zur Seite und überließ es den beiden, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Erst jetzt merkte sie, dass ihre Knie zitterten. Der Dienstausweis, den sie noch in der Hand hielt, flatterte und sie steckte ihn entschlossen weg. Die Nachbarin tauchte am Treppenabsatz auf und schaute mit großen Augen herauf.
„Danke, dass Sie so schnell reagiert haben“, sagte Lena. „Keine Ursache, ich hatte Glück, die Streife war ganz in der Nähe. Da unten ging es seit dem Auszug der Frau regelmäßig laut zu.“
Lena konnte sich schon vorstellen, was das bedeutete. Eine Frau, die aus unerfindlichen Gründen immer wieder zu ihrem Ehemann zurückkehrte. Um ihn um Geld zu bitten? Wollte sie die Hoffnung auf Versöhnung nicht aufgeben, trotz der Prügel, die sie bezog? Oder spielten ganz andere Gründe eine Rolle? Lena war kaum etwas Menschliches fremd, und sie hatte erkannt, wie schwierig es war, die Beweggründe ihrer Klienten zu verstehen.
Wenig später verließen die Polizisten mit dem Mann die Wohnung, während ein Notarzt sich um die heftig weinende Ehefrau kümmerte.
Lenas Einsatz für heute war beendet. Sie ging zu ihrem Auto, das sie wie üblich ein ganzes Stück entfernt in einer Seitenstraße geparkt hatte. Sie kannte solche Diskussionen zur Genüge. Im Jugendamt hatten sie es alle naslang mit säumigen Zahlern zu tun. Wenn die Ehefrau ging, hielten es manche Männer für ihr Recht, auch den Unterhalt für die gemeinsamen Kinder zu verweigern. Besonders, wenn neue Partner oder Partnerinnen im Spiel waren oder das Einkommen ohnehin knapp war.
Was für Zustände, dachte Lena, als sie den Zündschlüssel drehte und davonfuhr.
***
Sieglinde Brohm kritzelte nervös auf dem Block herum, der vor ihr auf dem Tisch lag. Ihr Chef, Jugendamtsleiter Märkle, hatte an diesem Montagmorgen kurzfristig eine außerordentliche Sitzung mit allen Abteilungsleitern einberufen. Zu diesem Kreis zählte auch seit kurzer Zeit Sieglinde Brohm.
„Die Politik hat wieder Wünsche geäußert.“ Bei diesen Worten verdrehte Märkle die Augen nach oben. In die Richtung, in der sich, von dem kleinen Konferenzraum aus gesehen, die Büros des Landrats und der Dezernentin befanden. Es war kein Geheimnis, dass sich der Amtsleiter und die Sozialdezernentin – Märkles Vorgesetzte – nicht leiden konnten. Das lag nicht nur an den unterschiedlichen politischen Lagern, zu denen sie gehörten. Der Jugendamtsleiter war gebeten worden, zu prüfen, ob er einige Mitarbeiter für ein Spezialprojekt abstellen konnte.
„Querschnittsaufgaben“, schnaubte er, als handele es sich dabei um etwas Unanständiges.
„Wo und was genau?“, fragte sein Stellvertreter Mielke, ein engagierter und hungriger Sozialarbeiter, der schon viel zu lange darauf wartete, befördert zu werden, und gleichzeitig wusste, dass auf absehbare Zeit der Aufzug nach oben blockiert war. Wer heute im öffentlichen Dienst auf einer Amtsleiterstelle saß, ging nicht so schnell weg. Wohin auch? Die viel beschworene freie Wirtschaft bot trotz der besser verhandelbaren Gehälter nach den rasanten Talfahrten der Konjunktur kein sicheres und warmes Plätzchen mehr.
Märkle erklärte langatmig das Projekt. Personal verschiedener Ämter sollte im größten sozialen Brennpunkt der Stadt Dietzenbach, im Spessartviertel, ein Team bilden. Circa dreitausend Menschen der unterschiedlichsten Nationalitäten lebten dort in fünf Hochhausblocks. Mit vereinten Kräften bemühten sich die Stadt Dietzenbach, der zuständige Landkreis Offenbach und engagierte Bürger seit vielen Jahren, den Ruf des Viertels und das Zusammenleben der Bewohner zu verbessern.
Bei dem anstehenden Pilotprojekt ging es darum, vor Ort Präsenz zu zeigen und ämterübergreifend Präventivmaßnahmen zu entwickeln.
„Und an wie viele Leute aus unserem Amt wird gedacht?“ Mielke war gewohnt pragmatisch bis zur Gefühllosigkeit, vielleicht konnte er nur so den Gedanken an die vielen Stellvertreterjahre ertragen, die noch vor ihm lagen. Ein paar Kollegen scharrten schon mit den Füßen, es wurde leise gehüstelt. Auch Sieglinde war etwas tiefer in ihren Stuhl gerutscht und hatte kurz gedankenverloren aus dem Fenster geschaut. Das Projekt interessierte sie nicht die Bohne, sie hatte genug zu tun mit der Organisation ihrer Abteilung, nachdem drei Stellen bereits einen „K.w.-Vermerk“ im Personalplan trugen – die Abkürzung für „künftig wegfallend“. Das bedeutete, dass die Stellen nicht wieder besetzt werden würden, sollten die jetzigen Stelleninhaber, egal aus welchen Gründen, ausscheiden.
„Zwei Leute sollen wir abstellen“, hatte Märkle auf Mielkes Frage geantwortet und damit Sieglinde Brohms Gedankengänge unterbrochen. Man einigte sich darauf, dass der Stellvertreter die weitere Organisation des Projektes übernahm. Insbesondere auch die Verteilung der Tagesarbeit auf das restliche Personal. Keine angenehme Aufgabe, die Personaldecke war so dünn, dass man schon hindurchsehen konnte.
„Freiwillige vor“, hieß es jetzt. Doch zunächst hatte sich keine der fünf anwesenden Abteilungsleitungen gerührt.
„Es gibt sicher ein paar Jungs von der Suchtberatung, die ganz scharf darauf sind, von ihren verwaltungslastigen Schreibtischen wieder in die freie Wildbahn hinaus zu dürfen“, flüsterte Sieglinde Brohms Nachbarin ihr grinsend zu. Märkle hatte es wohl gehört, seine Augenbrauen zuckten, dennoch hob er nicht den Blick von seinen Notizen, als er fortfuhr.
„Die Suchtberatung ist schon mit im Boot, das Sozialamt ebenfalls. Wir kommen also nicht darum herum, bald unsere Vorschläge einzureichen. Sonst heißt es womöglich, wir würden innovative Sozialpolitik boykottieren.“
Sieglinde Brohm schoss ein Gedanke durch den Kopf. In letzter Zeit hatte sie einige unliebsame Diskussionen führen müssen. Es ging um die Frage der Eignung von Tagesmüttern und Pflegefamilien, über die sie mit einer bestimmten Person aus ihrem Team häufig in Auseinandersetzungen geriet, was ihr lästig war. Und ihre Stelle als Abteilungsleiterin konnte sie nur dann effizient ausfüllen, wenn solche Diskussionen nicht an der Tagesordnung waren. Neulich schon war sie von einer Kollegin auf die „leichte Unruhe“ in ihrer Abteilung angesprochen worden. Sicher war es nicht verkehrt, die betreffende Person befristet in die Querschnittsabteilung wechseln zu lassen. Dadurch würden wieder mehr Ruhe und Stringenz in ihren Laden zurückkehren, und sie wäre in der Lage, auch unliebsame Entscheidungen schneller durchzuboxen. Die Renitenz hatte einen Namen … Vorsichtig räusperte sie sich.
„Ja, Sieglinde?“ Märkles und Mielkes Augen ruhten in seltener Eintracht auf ihr.
„Also – ich wüsste da jemanden.“
Alle schauten sie erstaunt an, als sie den Namen nannte.
„Das ist eine deiner besten Sozialarbeiterinnen. Sie hat doch erst letzte Woche wieder bewiesen, wie gut sie auch schwierige Situationen im Außendienst meistern kann.“ Das war Märkles hohe Stimme.
„Eben, darum. Dieses Projekt braucht die besten Leute.“
Mielke schob seine Unterlippe nach vorn, nickte und machte sich einen entsprechenden Vermerk für das Besprechungsprotokoll.
„Gut, vielen Dank für diesen schnellen Vorschlag, Sieglinde. Die anderen bitte ich, mir bis übermorgen Bescheid zu geben.“
Gleich darauf zerstreute sich die kleine Gruppe und auch Sieglinde Brohm eilte mit zielstrebigen Schritten zurück in ihr Büro.
***
Das kleine Mädchen mit der rot-weiß geringelten Strickmütze und der für diese Jahreszeit viel zu schweren, steifen Jacke lief neugierig hinter dem bunt gescheckten, dreibeinigen Hund her. Er humpelte so schnell er konnte, um die Ratte zu erwischen, die indes uneinholbar davoneilte, bis sie schließlich unter einem Berg von Abfall, Schutt und Gerümpel verschwand. Vor ein paar Tagen waren hier, in Sichtweite des Spessartviertels, illegale Gartenhütten auf behördliche Anordnung abgerissen worden. Eine Menge Gerümpel wartete auf den Abtransport. Samantha hätte sich gar nicht so weit von zu Hause entfernen dürfen und schaute sich unsicher um. Mama hatte sie weggeschickt. „Nur bis zum Spielplatz, hörst du!“ Aber dort hatte sie ganz alleine gesessen und kühl war es auch, weil der Spielplatz nachmittags im Schatten der großen Hochhäuser lag. Und dann kam dieser kleine Hund. Die Kleine liebte Tiere, aber Mama hatte ihr nie erlaubt, eines zu haben. Er schaute sie so treuherzig an und sie hatte Mitleid mit ihm, weil ihm eine Pfote fehlte und er so unbeholfen wirkte. So wie sie selbst manchmal auch.
Nun standen Kind und Hund ratlos vor einem riesigen Berg von Schutt, zerborstenen Holzbrettern und Teilen verrosteter Maschendrahtzäune. Das Mädchen wollte gerade umdrehen und zum Spielplatz zurücklaufen, als irgendetwas erneut die Aufmerksamkeit des Hundes erregte. Er zitterte auf einmal am ganzen Leib und zog seinen braun-weiß gescheckten Schwanz ein. Ein heiseres Bellen, ein Blick zu ihr und dann sah sie es auch. Mitten aus dem Gerümpel ragte eine steife weiße Hand, sie gehörte zweifellos einer Frau! Und diese Frau, das sah Samantha sofort, konnte nicht mehr am Leben sein!
***
Während Sieglinde Brohm in ihrem Büro ein Fenster öffnete und frische, kühle Luft in das Zimmer strömen ließ, dachte sie noch einmal kurz an die Besprechung. Es war überdeutlich gewesen, wie wenig motiviert die meisten Kolleginnen und Kollegen momentan waren. Personalkürzungen, wiederholte Angriffe der Presse, sobald im sozialen Bereich etwas schieflief, dazu das Hin und Her der Politik in Fragen von sozialer Bedeutung. Geldbeutel wurden auf- und wieder zugemacht, je nachdem, wie es parteipolitisch gerade passte. Es ging auf die Landratswahlen zu, in einem Jahr würden sich der Amtsinhaber und die Sozialdezernentin vermutlich einen harten Wahlkampf liefern. Die Positionen waren verteilt, die Strategien kristallisierten sich langsam heraus, bereits jetzt wurden die Soldaten in Stellung gebracht. Nichts anderes waren die Beschäftigten des Landratsamtes in diesem Moment. Sie wusste genau, worauf dieses neue Projekt hinauslaufen würde. Ohne jemandem guten Willen absprechen zu wollen, sollte es vor allem dazu dienen, die aufgeschreckte Bevölkerung zu beruhigen. Zu viele Dinge waren in den vergangenen Monaten in einigen sozialen Brennpunkten in dem aus dreizehn Kommunen bestehenden Landkreis geschehen. Das größte Problemviertel lag hier, quasi direkt vor der Haustür. Dietzenbach war im Grunde eine schöne Kleinstadt, mitten im Landkreis gelegen. In der Altstadt standen schöne Fachwerkhäuser, es gab gute Einkaufsmöglichkeiten und mehrere ruhige und gutbürgerliche Wohnviertel, die durchaus Lebensqualität boten. Auch der in angrenzenden Kommunen allgegenwärtige Fluglärm, eine lästige Begleiterscheinung des nordwestlich liegenden Rhein-Main-Flughafens, war hier kein Thema. Trotz alledem machte die Stadt vorwiegend negative überregionale Schlagzeilen. Im Spessartviertel waren in den siebziger Jahren mehrere Wohnblöcke mit Eigentumswohnungen entstanden, ursprünglich gedacht für Menschen, die im nördlich gelegenen Frankfurt arbeiten. Nachdem bereits von Anfang an mehr und mehr sozial schwache Menschen dort eingezogen waren, war inzwischen ein Quartier daraus geworden, das für soziale Unruhe sorgte. Genau dort lebten offiziell ungefähr zehn Prozent der Einwohner der Stadt, inoffiziell vermutlich wesentlich mehr. Ein Thema also, an dem auch die Sozialpolitik sich seit Jahrzehnten abarbeitete. Man hatte hoffnungslos überbelegte Wohnungen gefunden. Unter der Hand vermietet an illegale Einwanderer, Tagelöhner aus Osteuropa, Kriminelle. Dazu kamen in letzter Zeit häufig Straßenschlachten zwischen der örtlichen Polizei und einer Jugendgang, eine extrem hohe Arbeitslosenquote, verwahrloste Kinder, Alkoholismus und Drogengeschäfte. Das waren die Schlagworte, an denen sich nicht nur die Presse ständig hochzog. Mit der geplanten Querschnittsabteilung sollte ein Signal gesetzt werden. Jeder von ihnen hatte heute früh jedoch nur an eines gedacht: dass nach der engagierten Anfangsphase stets das Damoklesschwert der Einstellung des Projektes nach der Landratswahl über ihnen schweben würde. Ein verlorenes Jahr hatte es jemand genannt. Zu lange für die Beteiligten, um wieder reibungslos an den eigenen Schreibtisch im jeweiligen Amt zurückkehren zu können. Zu kurz, um wirklich etwas zu bewegen. Augenwischerei zur politischen Profilierung der Dezernentin, so sah Sieglinde es auch.
***
Berthold Wagner stellte das Teleskop noch eine Spur schärfer. Die kleine Maus von Gegenüber, die vor ein paar Minuten nach Hause gekommen war und sich gerade umzog, präsentierte ihm wieder einmal das volle Programm. Seit sie in die Wohnung im benachbarten Hochhaus gezogen war, brauchte er sich kaum noch durch einen der vielen Schmuddelkanäle im Fernsehen zu zappen. Welch ein Segen, dass die jüngere Generation es uncool fand, Gardinen an den Fenstern anzubringen, die waren alle so gedankenlos. Die junge Frau hatte zwar offenbar keinen Kerl, aber so oft, wie die sich umzog, lechzte sie doch geradezu danach, Beachtung zu finden! Gierig fuhr er sich mit der Zunge über die trockene Unterlippe, als die junge Frau ihren Büstenhalter aufhakte und einen Moment lang barbusig zu sehen war. Gleich darauf schlüpfte sie sogar aus ihrem Höschen, warf es achtlos auf das breite, trotz der Nachmittagsstunde noch ungemachte Bett, stellte sich einen Moment lang vor den großen Spiegel ihres Kleiderschranks und präsentierte ihm ihren knackigen Hintern. Dort drehte und wendete sie sich kurz, um sich von allen Seiten zu betrachten. Berthold Wagners Hand glitt in seine graue schmuddelige Jogginghose, gleich darauf fing er an, schwer zu atmen. Die Frau legte einen Moment lang die rechte Hand auf ihren flachen Bauch, als wollte sie seine Festigkeit prüfen, und steckte sich danach die Haare auf. Gleich würde sie ins Badezimmer hinübergehen und damit aus seinem Sichtfeld verschwinden. Zu früh, er war noch nicht soweit.
„Komm, Kätzchen, dreh dich noch einmal um und lass mich deinen geilen Körper von vorne sehen“, murmelte er und als habe sie ihn gehört, ging sie noch einmal auf das Bett zu. Die Kleine war aber auch zu scharf! Vor ein paar Tagen waren sie sich zufällig im Supermarkt begegnet, wobei sie natürlich keine Ahnung hatte, wer da eine ganze Weile unauffällig hinter ihr hergeschlichen war. Bei dieser Gelegenheit konnte er sie genauer und aus der Nähe beobachten, ihre zarte Haut betrachten und ihren Duft riechen. Den Duft einer jungen Frau, der ihn schließlich dazu animierte, sich an der Kasse ganz dicht hinter sie zu stellen. Doch die blöde Kuh hatte nur in ihr Handy gequatscht und sich nicht einmal nach ihm umgedreht. Jetzt tastete sich sein Objektiv von ihren weichen Brüsten nach unten. Sie war teilrasiert, und als der heftig schnaufende Mann sein Objektiv genau auf ihren Schoß richtete, überflutete ihn die Erregung, und er ergoss sich grunzend in seine Jogginghose. Schwer atmend sank er auf einen alten Küchenhocker und stierte ein paar Minuten vor sich hin, während er die feuchte Hand am Hosenbein abwischte. Dann trat er erneut an sein Teleskop, das durch seine heftige Bewegung von eben verdreht stand und ein völlig neues Szenario zeigte.
Zwischen den Schutthaufen der abgerissenen Gartenhütten am Rande der Siedlung, hinter den rot-weißen Markierungsbändern, standen ein paar Jugendliche herum. Wagner wollte das Teleskop schon wieder zurückdrehen, um sich wieder seiner Nachbarin zu widmen, als er aus einem Impuls heraus sich anders entschied und die Szene noch ein bisschen näher heranzoomte. Es ging eine nervöse Energie von den Jugendlichen aus, die selbst er auf die Entfernung spürte. Die drei halbwüchsigen Jungen gestikulierten wild, während sie etwas diskutierten. Mit ihren uniformen Kapuzenshirts sahen sie für ihn alle gleich aus, er hätte noch nicht einmal sagen können, ob einer von ihnen im selben Hochhaus wohnte wie er. Am Rande des Geschehens stand ein kleines Mädchen mit einer rot-weiß gestrickten Mütze auf dem Kopf. Wagner erkannte in ihr die Kleine, die mit ihrer Mutter ein paar Häuser weiter wohnte. Ein dürres, schüchternes Ding, das so gar nicht nach seiner Mutter kam, die für ihren lockeren Unterleib und ihr Schlappmaul im ganzen Viertel bekannt war. Neben der Kleinen saß ein kleiner Hund, den Wagner noch nie gesehen hatte.
Die drei Jungs schienen über etwas uneins zu sein, das mit dem Abfallberg zu tun hatte. Einer deutete wiederholt darauf und dann auf die kleine Schrebergartensiedlung in Sichtweite. Dort standen die legalen Hütten. Einer seiner Begleiter holte nun ein Handy hervor und wollte telefonieren, wurde aber von seinen beiden Kumpels daran gehindert. Einen Moment lang glaubte Berthold Wagner, er würde gleich Zeuge einer Prügelei, doch dann beruhigten die Gemüter sich wieder. Nun schauten plötzlich alle drei zu dem Mädchen, dessen Anwesenheit sie anscheinend über ihre Diskussion ganz vergessen hatten. Einer der Drei redete nun eindringlich und aggressiv auf die Kleine ein. Danach schickten sie das Mädchen weg. Wagner beobachtete, wie sie mit dem Hund im Schlepptau davontrottete, zwei vom Leben Geschlagene. Einmal noch drehte sie sich um, nur um von den drei Jungs mit eindeutigen Handbewegungen davongejagt zu werden. Dann, als die Kleine außer Hörweite war, lachten die Drei und schlugen sich gegenseitig auf die Schultern. Das Mädchen verschwand aus Wagners Gesichtsfeld. Kurz darauf kam der kleine Hund alleine zurück. Er humpelte auf drei Beinen und schien nach etwas zu suchen. Einer der Jugendlichen warf einen Stein nach ihm und das Tier verschwand, sichtbar vor Schmerz aufjaulend.
„Blöde Töle“, knurrte Wagner, der in der einsetzenden Dämmerung nicht mehr so gut sehen konnte, was da hinten abging. Die hellen Sweatshirts der Jungs und ihre glühenden Zigaretten zeigten ihm noch eine ganze Weile ihre Anwesenheit an, doch er verlor das Interesse und setzte seine Beobachtungen im Haus gegenüber fort. Zwei Reihen neben der schnuckeligen Kleinen, deren Wohnung jetzt im Dunkeln lag, wohnte ein Paar, das gerne ausgefallene Spielchen im Schlafzimmer veranstaltete. Die Jalousie, die dort hing, war nur halb geschlossen, vermutlich dachten die beiden, das würde reichen, um ihre Intimsphäre zu wahren. Doch wenn im Zimmer Licht brannte, erkannte man mehr als genug. Als die Frau in einem hautengen schwarzen Latexkleidchen den Raum betrat und das Bett mit einem Gummituch abdeckte, ging Berthold Wagner schnell noch einmal zum Kühlschrank, um sich ein frisches Bier zu holen. Es sah so aus, als sollte dieser Abend noch lange interessant bleiben.
Kapitel 2
Lena Borowski drückte mit der Schulter die Haustür auf, während sie in der einen Hand eine Tüte mit Einkäufen balancierte und in der anderen den Wohnungsschlüssel hielt. Es war Samstag, sie hatte gerade ihre Einkäufe auf dem über die Grenzen Offenbachs hinaus beliebten Wochenmarkt am Wilhelmsplatz getätigt.
„Fräulein Borowski, Sie wissen schon, dass Sie diese Woche mit dem Treppenputz dran sind?“ Wie aus dem Nichts tauchte Frau Kasulke, die Hausmeisterin, vor ihr auf. Lena fluchte lautlos. Die Kasulke war schwatzhaft und krankhaft neugierig. Und sie hatte sie auf dem Kieker. Lena setzte ein übertriebenes Lächeln auf, sie verspürte heute keine Lust, dem Hausdrachen schön zu tun.
„Falls Sie mich meinen, dürfen Sie mich mit Frau Borowski ansprechen. Und die Treppe mache ich mit Vergnügen.“ Das war natürlich gelogen, Lena hasste Hausarbeit und sie hasste die soziale Kontrolle in Form von Frau Kasulke im Haus. Tausendmal schon hatte sie in solchen oder ähnlichen Situationen darüber nachgedacht, auszuziehen. Doch sobald sie einen Blick in den Immobilienteil der Zeitung warf, fiel ihr wieder ein, warum sie genau hier wohnte: Die Miete war für die heutigen Verhältnisse mehr als günstig. Der wunderschöne Altbau lag im unteren Teil des Buchrainwegs, in Laufnähe zum alten Offenbacher Bahnhof, der seit dem Ausbau der S-Bahn allerdings kaum noch eine Rolle spielte. Die Innenstadt erreichte man mit dem Fahrrad in zehn Minuten. Die Zimmer waren geräumig, mit hohen Fenstern und Decken. Doch das Haus hatte keinen Aufzug und ihre Wohnung keinen Balkon, und das war der Grund für die günstige Miete. Lena mochte den Charme des alten Jugendstilhauses. Sie wohnte hier schon über zehn Jahre, seit sie hierhergekommen war, um in Frankfurt Sozialarbeit zu studieren. Frau Kasulke, die vermutlich ihr gesamtes bisheriges Leben hier verbracht hatte, musste man eben in Kauf nehmen. Die murmelte gerade etwas, das sich verdammt anhörte wie: „Suchen Sie sich erst mal einen Mann, dann rede ich Sie auch mit Frau an.“
Lena verdrehte die Augen bei dieser unverhohlenen Unverschämtheit und stieg die leicht ächzende Holztreppe hinauf in den dritten Stock. Irgendwann würde sie es dieser Ziege schon heimzahlen!
***
„Lena? Hier ist Maja.“
Die Stimme am anderen Ende der Leitung löste in Lena eine heftige körperliche Reaktion aus. Sie atmete tief durch und musste sich setzen.
„Wo bist du? Etwa in Offenbach?“
Sie konnte sich keinen anderen Grund vorstellen, warum Maja sie anrief.
„Nein, zu Hause.“
Zu Hause, das war der kleine Ort bei Rendsburg, in dem sie beide aufgewachsen waren. In dem Maja seit ihrer Jugendzeit lebte.
„Vielleicht kommt dir mein Anruf jetzt komisch vor, aber ich wollte dich um einen Gefallen bitten, denn ich kenne sonst niemanden, der in der Nähe von Frankfurt wohnt“, fuhr sie fort.
„Um was geht es denn?“ Lenas Stimme klang ruhig, abwartend, während sich in ihrem Inneren die Empfindungen überschlugen.
„Es geht um Sabrina, meine Schwägerin.“
Für einen kurzen Moment tauchte aus Lenas Erinnerung das blasse Gesicht eines blonden Mädchens auf. Sabrina, die jüngere Schwester des Mannes, mit dem Maja inzwischen verheiratet war.
„Sie lebt schon lange in Frankfurt, jetzt ist sie irgendwie … in der Versenkung verschwunden. Oder zumindest nicht erreichbar und wir machen uns Sorgen.“
„Jürgen und du, also“, sagte Lena dumpf in den Hörer. Am anderen Ende war es einen Moment lang still. In ihre Erinnerung versunken brummte Lena etwas in den Hörer, während sie ein paar trockene Blätter von ihrem Basilikum, der einzigen Pflanze in ihrem Haushalt, zupfte.
„Sie geht weder ans Telefon noch ans Handy und reagiert auf keine unserer Nachrichten. Wir sind hier alle schon ganz konfus, und jetzt haben mich meine Schwiegereltern gebeten, dich anzurufen.“
„Soll ich mal bei ihr vorbeischauen?“ Lenas Interesse war eher höflich gespielt als wirklich vorhanden. Sabrina war eine erwachsene Frau. Vielleicht hatte sie jemanden kennengelernt oder war spontan verreist. Maja schien skeptisch. „Wir hören nicht oft von ihr, aber am Donnerstag hat sie sich nicht einmal zum Geburtstag ihres Vaters gemeldet, und das ist schon sehr merkwürdig.“
„Vielleicht ist sie krank geworden und musste ins Krankenhaus?“
„Jürgen hat bei allen Krankenhäusern in Frankfurt angerufen. Nichts.“
Wieder entstand eine kleine Pause. Ein beredtes und belastendes Schweigen. Schließlich seufzte Lena leise und ließ sich Sabrinas Adresse und Telefonnummer geben. Sie versprach Maja, noch am Wochenende vorbeizufahren.
Nach dem Gespräch fühlte Lena sich innerlich wie aufgerissen. Ausgerechnet Maja, die sie so tief in ihrer Erinnerung vergraben geglaubt hatte. Dabei genügte schon ein Wort von ihr, um Lena in ein Wechselbad der Gefühle zu stürzen. Kraftlos hockte sie auf dem Sofa, Erinnerungsfetzen zogen vorbei. Natürlich war es keine Frage, Sabrinas Familie einen Gefallen zu tun. Ein bisschen wunderte sie sich, dass Jürgen nicht selbst angerufen hatte. Denn wenn sie in jemandes Schuld stand, dann in der von Jürgen. Vielleicht war das aber auch genau der Grund, warum nicht er selbst sich gemeldet hatte. Er wusste, wie sie tickte, und wollte nicht, dass sie sich bedrängt fühlte. Wie konnte er auch ahnen, welche Wirkung gerade Maja auf sie hatte! Jürgen wusste nichts von der alten Geschichte, die in diesem Moment in Lenas Erinnerung höchst lebendig wurde. Sie schob die Gedanken weg, schaute auf das Stück Papier mit Sabrinas Adresse und ärgerte sich kurz über sich selbst. Hatte sie wirklich nichts Besseres zu tun, als nach einer Frau zu sehen, die sie nicht einmal wirklich kannte? Doch Jürgen zuliebe würde sie es tun, um der alten Zeiten willen. Sie konnte auch gut verstehen, dass er nicht gleich nach Frankfurt gebraust kam, nur weil seine jüngere Schwester ein paar Tage lang nicht ans Telefon ging. Schließlich hätte sie selbst es auch nicht anders gemacht und jemanden, der in der Nähe wohnte, gebeten, einmal vorbeizusehen.
Sie hatte nichts Besonderes vor an diesem Tag, wie sie sich etwas missmutig eingestehen musste. Außer dem Treppenputz natürlich. Aber der konnte warten! Grimmig schnitt sie eine Grimasse. Kurze Zeit später ging Lena erneut aus dem Haus. Sie hatte ein paar Mal versucht, Sabrina anzurufen. Als sich außer der Mailbox niemand meldete, beschloss sie, direkt vorbeizufahren. Schließlich konnte der jungen Frau auch in ihrer Wohnung etwas passiert sein.
***
Der Spätsommertag war noch einmal überraschend warm geworden und hatte etliche Spaziergänger ins Grüne gelockt. An der Uferpromenade des dunkel und schmutzig fließenden Mains tummelten sich Radfahrer, Hunde, Kinder und einige selbstvergessen knutschende Liebespaare.
Die angegebene Adresse lag im Stadtteil Schwanheim. Eigentlich eine gute Gegend. Hier lebten viele Familien und Rentner in überwiegend gepflegten Ein- oder Mehrfamilienhäusern. Besonders der alte Stadtkern mit seiner kleinen, lebendigen Einkaufsstraße war recht idyllisch. Lena ging mit einer ihrer Freundinnen gelegentlich in den nahe gelegenen Schwanheimer Dünen, einem Naturschutzgebiet, spazieren und anschließend in einem der gemütlichen Cafés etwas trinken. Hier war es ruhiger, familiärer als in den hippen und etwas hektischen Hangouts der Innenstadt. Doch dieses Mal fuhr sie in einen Straßenzug, den sie nicht kannte, der sie aber sehr an die sozialen Brennpunkte erinnerte, in denen sie normalerweise während ihrer Arbeit unterwegs war. Sabrinas Wohnung lag in einem zwölfgeschossigen Bauwerk, das wie ein großer Klotz zwischen anderen großen Klötzen in einer mäßig gepflegten Grünanlage stand. Vollgestellte Balkone, Satellitenschüsseln und ein ungemütlicher Bolzplatz kennzeichneten die Hochhäuser schon von Weitem als Domizile finanziell schlecht gestellter Bevölkerungsschichten. Gott sei Dank gab es hier wenigstens keine Schwierigkeit, einen Parkplatz zu finden.
Lena stieg aus und blickte an dem trostlosen Beton hoch. Im ersten Stock stand ein untersetzter Mann in einem schmutziggrauen Unterhemd auf seinem Balkon. Er rauchte eine Zigarette und beobachtete Lena völlig regungslos aus zusammengekniffenen Augen, als sie sich dem Haus näherte. Die Klingelknöpfe waren ein Sammelsurium von Namen unterschiedlichster Herkunft, teilweise in mehreren Schichten dick überklebt. Wie es aussah, wechselten hier die Mieter häufig. Als sie Sabrinas Namen entdeckte, drückte sie mehrmals kurz hintereinander auf den Klingelknopf. Es geschah nichts, und einen Moment stand sie ratlos vor der Tür, bis sich eine Gelegenheit bot, das Gebäude zu betreten. Ein jugendlicher Bewohner verließ das Haus und Lena schlüpfte durch die Tür, bevor sie wieder zufiel. Im Flur roch es intensiv nach angekokeltem Papier und Fritten, der Aufzug war über und über mit Graffiti besprüht. Wenigstens funktionierte er und beförderte Lena in das zehnte Stockwerk. Wo sie erneut vor verschlossener Tür stand.
Verdammt! Warum hatte sie sich überhaupt darauf eingelassen? Im Grunde konnte sie hier auch nicht sehr viel mehr ausrichten als Jürgen und seine Eltern in Norddeutschland. Wenn kein Kontakt zustande kam, was sollte sie dann tun? Ganz sicher weder die Polizei holen noch die Tür eintreten. Gerade, als sie wieder gehen wollte, öffnete sich die Tür der Wohnung gegenüber. Lena drehte sich um.
„Ups, hallo!“ Die Stimme der jungen Frau klang hoch und roch selbst auf die Entfernung nach Alkohol. Lena grüßte mit einer Handbewegung und wartete ab. Die Nachbarin war erschreckend dürr und trug eine rot-grün-weiß gestreifte Leggins, die vermutlich irgendwann in den Achtzigern modern gewesen war. Entsprechend ausgeleiert hing das Ding an ihren Beinen. Darüber hatte sie eine falsch geknöpfte dunkelbraune Strickweste gezogen. Ihr Haar war unter einem Handtuchturban von undefinierbarer Farbe verborgen, als habe sie es gerade gewaschen.
„Bissu ne Freundin von Sabrina?“ Die erstaunlich klaren und großen blauen Augen passten so gar nicht zu der leicht stolpernden Stimme und schauten Lena voll naiver Freundlichkeit an.
„So ähnlich. Weißt du, wo sie ist?“
Sie hatte beschlossen, ganz direkt zu sein.
„Neeee!“ Die Nachbarin schüttelte den Kopf, was den Turban beträchtlich ins Wanken brachte, dann kicherte sie plötzlich.
„Hab sie schon eine ganze Weile nicht gesehen.“ Die junge Frau richtete sich auf und gab damit anscheinend auch ihrer Stimme mehr Halt.
„Ihre Familie macht sich Sorgen und hat mich gebeten, einmal nach ihr zu sehen. Hoffentlich ist ihr nichts passiert.“
„Oh!“ Die Nachbarin schrumpfte wieder zusammen.
„Wollte gerade zu meinem Briefkasten gehen“, murmelte sie dann, scheinbar völlig zusammenhanglos. Erst als sie fortfuhr, begriff Lena ihren Gedankensprung.
„Komm mit runter, wir gehensum Hausmeister, vielleich’ weißer was.“
Schweigend marschierte Lena der leicht schwankenden jungen Frau hinterher. Im Lift roch sie den Alkohol wieder deutlicher und fragte sich, ob ihre Begleiterin am Vorabend einfach zu viel gefeiert hatte oder ob der Wodka ein Teil ihres heutigen Frühstücks gewesen war.
„Oksana!“, stellte die sich vor und streckte Lena eine schmale, raue Hand entgegen.
„Du bist Russin?“ Dem Akzent nach hätte sie eher auf Ruhrpott getippt.
Oksana kicherte und zog dabei die Nase kraus, was ihr das Aussehen eines ganz jungen Mädchens gab.
„Eigentlich heiß ich Edeltraud, aber das war mirsu langweilig.“
Der Lift hielt mit einem harten Ruck, was Oksana zu einem kräftigen Rülpser verhalf. Die beiden Frauen stiegen aus. Oksana-Edeltraud bedeutete Lena mit einer Handbewegung, ihr zu folgen. Kurz darauf standen sie einem großen, muskulösen und relativ jungen Mann gegenüber, der sich als Hausmeister vorstellte.
Lena erklärte ihm ihr Anliegen, während ihre junge Begleiterin auf einem Bein wippend an die Wand gelehnt zuhörte.
„Kannst du dich ausweisen?“
So wie es aussah, wurde man hier im Haus generell geduzt.
„Klar!“ Lena zog eine laminierte Karte aus ihrer Jacke und reichte sie dem Mann. Während er den Ausweis mit der übertriebenen Genauigkeit eines Leseschwachen studierte, betrachtete sie interessiert seine verschiedenen Tattoos und Piercings. Wenn er so weitermachte, würde er bald als Gesamtkunstwerk durchgehen.
„Aha, vom Amt“, murmelte der Mann, und Lena stutzte kurz. Nach einem irritierten Blick auf das Dokument in seiner Hand stellte sie verdutzt fest, dass sie ihm versehentlich ihren Dienstausweis gegeben hatte. Gewohnheit, sie wies sich bei ihrer Arbeit grundsätzlich damit aus, daher steckte der Ausweis auch in der Innentasche ihrer Lederjacke. Zum Glück schien sie das in seinen Augen vertrauenswürdig genug gemacht zu haben, denn der Hausmeister ging in seine Wohnung zurück, um kurz darauf mit einem Schlüssel für die Wohnung von Sabrina Marx zurückzukommen.
Als er ihr wenige Minuten später die Tür aufschloss, fühlte Lena sich unbehaglich. Es war stets ein merkwürdiges Gefühl, in die Wohnung eines anderen Menschen einzudringen. Ganz besonders, wenn die betreffende Person nicht die geringste Ahnung davon hatte. Obwohl die Familie der Wohnungsinhaberin sie ausdrücklich darum gebeten hatte. Beruflich musste sie viel zu oft in die Intimsphäre anderer Menschen vordringen, da hätte sie es vorgezogen, das nicht auch in ihrem Privatleben zu tun. Doch der Besuch selbst förderte keine unangenehmen Ergebnisse zutage.
Die Wohnung war unspektakulär. Hinter der Eingangstür lag ein kurzer Flur. Rechts davon ging es in ein kleines, extrem sauberes Bad. Dort stand außer einer leeren Seifenschale auf dem Waschbecken nichts herum. Es wirkte, als sei die Wohnungsmieterin verreist und habe all ihre Sachen mitgenommen. Doch ein Blick in den großen Spiegelschrank über dem Waschbecken zeigte Lena, dass Kosmetika und auch eine Zahnbürste vorhanden waren. Während der Hausmeister an der Tür wartete und Oksana-Edeltraud auf dem Flur herumlief, einen Reggaesong summte und zwischendurch laut mit einem Kaugummi knallte, inspizierte Lena das Wohnzimmer. Auch hier herrschten Ordnung und Sauberkeit. Die Fernbedienung lag, akkurat ausgerichtet, auf dem Fernseher, ein paar eingerollte Decken und aufgeschüttelte Kissen waren am unteren Ende der Couch platziert. Nirgendwo eine Pflanze, kein Stäubchen und noch nicht einmal eine herumliegende Zeitung. Im Schlafzimmer schützte eine faltenfreie Tagesdecke das Bett. Auf einem kleinen Schreibtisch befanden sich ein Computer und ein Kalender, daneben lag ein Notizbuch mit dunkelrotem Einband. Auf dem Nachttischchen tickte ein Funkwecker. Auch hier sonst nichts, was herumlag. Eine Kommode und zwei Kleiderschränke bildeten den Rest der Einrichtung, aber Lena sah keine Veranlassung, sich mit den jeweiligen Inhalten zu beschäftigen.
„Sieht fast so aus, als sei sie einfach für ein paar Tage weggefahren.“ Gab es einen anderen Grund, eine Wohnung derart penibel aufzuräumen? Lena, bei der es meistens ganz anders aussah als hier, fiel keiner ein.
Aber der Inhalt des Badezimmerschranks passte nicht dazu. Welche Frau fuhr schon in Urlaub, ohne ein Minimum an Kosmetika und Körperpflegeartikeln?
Sie könnte natürlich derartig spontan weggefahren sein, dass sie alles, was sie braucht, vor Ort kauft, überlegte Lena.
Noch etwas war seltsam. Für eine so schäbige Gegend war diese Wohnung bemerkenswert gut eingerichtet. Die Möbel und die gesamte Ausstattung hatten gehobenes Niveau. Dennoch, falls Sabrina Marx diese Wohnung als ein echtes Zuhause betrachtete, hatte sie es sehr gut verborgen.
Zu Lenas Erleichterung wies nichts auf ein Verbrechen oder Ähnliches hin. Sie bedankte sich bei dem Hausmeister für seine Kooperation. Der Nachbarin war es inzwischen wohl zu langweilig geworden, sie hatte sich bereits wieder in ihre Wohnung zurückgezogen, aus der jetzt ein leichter Haschischduft nach draußen zog.
***
„Tut mir leid, Jürgen. Ich wüsste nicht, was ich noch tun könnte.“ Bei Lenas Anruf war er direkt am Apparat gewesen, und sie war gleichzeitig erleichtert und enttäuscht, dieses Mal nicht Majas Stimme zu hören. Sie hatte es sich auf der Couch bequem gemacht, eine Tasse Tee in der Linken, das Telefon in der Rechten legte sie gerade so viel Mitgefühl in ihre Worte, dass Jürgen sich nicht womöglich gekränkt fühlte. Gleichzeitig hoffte sie, er und Maja würden sie nicht um weitere Gefallen dieser Art bitten. Doch da hatte sie sich getäuscht.
„Bevor sie nach Schwanheim gezogen ist, hat Sabrina in einer Wohngemeinschaft gelebt. Ich habe nur die Adresse und die Vornamen ihrer Mitbewohnerinnen, keine Telefonnummer, da ich nicht weiß, unter welchem Namen ein Anschluss eingetragen sein könnte, falls es überhaupt einen gibt. Mit Sabrina habe ich nur auf ihrem Handy gesprochen.“
„Hast du es schon bei ihrer Arbeitsstelle versucht?“
„Dort ist sie schon seit ein paar Monaten nicht mehr. Sie hat uns von ihrem Wechsel allerdings nichts erzählt“, antwortete Jürgen ratlos.
„Na gut, gib mir die Anschrift, ich schaue mal in der WG vorbei“, hörte Lena sich sagen und hätte sich direkt danach am liebsten auf die Zunge gebissen. Was ritt sie eigentlich? Aber zugesagt war zugesagt und Lena würde ihr Versprechen halten. Ob der alten Zeiten mit Maja willen oder wegen des Dienstes, den Jürgen ihr einmal erwiesen hatte, hätte sie in diesem Moment selbst nicht sagen können.
Kapitel 3
Samanthas Blase drückte so sehr, dass sie nicht einschlafen konnte. Mit offenen Augen lag sie in ihrem schmalen Zimmer im Bett, von wo aus sie durch das Fenster den Mond am Nachthimmel sehen konnte. Der Vorhang war nicht geschlossen, das hatte Mama vorhin vergessen. Im blassen Mondlicht blickte Samantha auf das ramponierte Mobile, das, seit sie sich erinnern konnte, über ihrem Bett hing und vermutlich noch aus ihrer Babyzeit stammte.
Vorsichtig verlagerte sie das Gewicht ihres Körpers, ein Versuch, den Blasendruck zu verringern. Ihr Blick fiel auf das zweite Bett im Zimmer. Kleiner als das ihre und schon eine ganze Weile leer. Dort hatte ihre kleine Schwester geschlafen, Jennifer, bevor sie … ja, was eigentlich? So genau wusste Samantha gar nicht, warum sie nicht mehr da war.
„Es geht ihr gut“, antwortete Mama lapidar, wenn sie nach Jennifer fragte. Samantha schloss daraus, dass ihre kleine Schwester bei den Großeltern war oder bei einer anderen Familie, so wie sie selbst auch einmal, als sie noch kleiner gewesen war. Ganz dunkel erinnerte sie sich an ein altes Haus inmitten eines großen Gartens. Dort gab es Hühner und Kaninchen. Und sie und die anderen drei Kinder, die dort lebten, hatten mit Jockel gespielt, dem großen Hund, der so weich aussah wie ein altes braunes Sofakissen und der gutmütig alles über sich ergehen ließ. Warum sie dort bei dieser anderen Familie gewesen war, wusste Samantha nicht mehr. Irgendwann kam ihre Mama zusammen mit einer anderen Frau und holte sie wieder ab. Seither wohnten sie hier, gemeinsam mit Jennifer und dem Papa, der aber gar nicht ihr richtiger Papa war. Also – Jennifers Papa schon, aber eben nicht ihrer. Hier gab es keine Tiere und auch keinen Garten. Sie wohnten dafür in einem großen Haus. Zumindest war es hoch, und in jedem Stockwerk gab es viele Wohnungen wie ihre. Nebenan zum Beispiel wohnte Ayshe, das kleine türkische Mädchen, mit dem Samantha früher ab und zu auf dem Spielplatz gespielt hatte, bevor es irgendwann nicht mehr gekommen war. Sie sah Ayshe noch manchmal, wenn sie mit ihrer Mutter die Wohnung verließ, um einkaufen zu gehen. Ayshes Mutter war ganz anders als ihre eigene Mama. Sie lief in so komischen Kleidern rum, vermummt von Kopf bis Fuß, man sah gar nichts von ihr außer dem Gesicht.
„Die machen das alle so, weil ihre Männer das wollen“, hatte Mama gleichgültig gesagt, als Samantha sie einmal danach gefragt hatte. Später hatte Samantha begriffen, dass „die“ die Türkinnen bedeutete. Warum das so war, sagte ihr niemand. Samanthas Mama zog sich ganz andere Kleider an als Ayshes Mutter. Sie trug meistens enge Jeans und kurze T-Shirts oder Pullover, die ihr Nabelpiercing zeigten, auf das sie so stolz war. Morgens schminkte sie sich, bevor sie wegging. Samantha musste alleine zu Hause bleiben. Sie saß oft im Wohnzimmer, trank den kälter werdenden Kakao, den Mama ihr morgens gemacht hatte, und schaute fern. Manchmal setzte sie sich auch ans Fenster und versuchte, in die Wohnung gegenüber zu sehen. Die Häuser standen so nah beieinander, dass man hin und wieder etwas erkennen konnte. Dort drüben wohnte ebenfalls eine Familie, aber die Kinder, zwei Jungs, waren schon älter. Manchmal, wenn die Eltern unterwegs waren, saßen sie auf dem Balkon und rauchten.
In der Wohnung darunter lebte eine alte Frau. Sie konnte sich nur noch mit einem Krückstock fortbewegen, und jeden Mittag kam jemand und brachte ihr ein Essen. Meistens war Samantha zu diesem Zeitpunkt ebenfalls hungrig. Wenn das Gefühl zu arg wurde, ging sie an Mamas Vorratsschrank. Dort waren Chips und Kekse. Auch wenn Mama hinterher heftig mit ihr schimpfte, aß sie hin und wieder etwas davon, um ihren knurrenden Magen zu beruhigen.
Abends gab es meistens Pizza oder Mama kochte etwas aus der Dose. Wenn Papa heimkam, der eigentlich Joachim hieß, setzten sie sich manchmal alle zusammen vor den Fernseher und aßen dort. Das war schön, denn dabei hatte Samantha das Gefühl, eine richtige Familie zu haben. Früher, als Jennifer noch da gewesen war, war es für Samantha nicht einfach gewesen, die Aufmerksamkeit von Mama und Joachim für sich zu haben, weil die beiden sich mehr um ihre kleine Schwester kümmerten. Jetzt fühlte sie sich an solchen Abenden als der Mittelpunkt. Aber nur so lange, wie Mama und Joachim nicht zu viel Bier tranken. Denn dann zankten sie sich meistens und Samantha wurde gleich ins Bett geschickt.
Heute gab es einen anderen Grund, warum sie früh schlafen gehen musste. Mama wollte in Ruhe telefonieren, wie immer, wenn Joachim nicht zu Hause war.
Der Blasendruck ließ nicht nach, und Samantha wusste, sie musste gleich aufstehen und zur Toilette gehen. Mama würde böse werden.
„Ich muss mich konzentrieren, und deshalb will ich von dir nichts hören und sehen, kapiert?!“, hatte sie ihrer Tochter klargemacht. Samantha hatte genickt, und bisher war auch alles gut gegangen. Vor einigen Tagen musste sie raus, weil sie starken Durst hatte. Mama saß im Wohnzimmer, der Fernseher lief, aber ohne Ton, und Mama murmelte ins Telefon. Sie lachte plötzlich und sagte Worte, die Samantha nicht verstand. Aber sie hatte ihre Tochter gehört, und darauf setzte es mächtig Prügel. Gott sei Dank erst, nachdem Samantha getrunken hatte, so war wenigstens der Durst gelöscht.
Was sollte sie jetzt machen, sie konnte ja schlecht ins Bett pinkeln. Haue war weniger schlimm als dieses Gefühl, entschied sie und schlich sich leise in den Flur. Die Wohnzimmertür war dieses Mal geschlossen, sie hörte Mamas Stimme nur undeutlich. Schnell lief sie ins Bad und fühlte sich unendlich erleichtert, als sie fertig war. Aber die Spülung würde Mama hören, deshalb ließ Samantha ihren rosa Zahnputzbecher mit dem lachenden Elefanten darauf am Waschbecken voll Wasser laufen und kippte es nach. Erleichtert huschte sie auf Zehenspitzen zurück in ihr Zimmer und schloss sachte die Tür. Aufatmend kroch sie wieder unter die Decke. Fünf Minuten später war das Mädchen endlich eingeschlafen.
***
Sie stand mitten in einem der großen Räume der Wohnung, während der Mann abschätzend um sie herumging. Ihre Wange brannte noch von der Ohrfeige und sie fror in den durchnässten Schuhen.
„Zieh deinen Mantel aus!“ Seine Stimme war schneidend, kalt. Hinter ihrem Rücken ließ er sich in einen Sessel fallen, sie hörte es an den Geräuschen. Langsam öffnete sie den Trenchcoat, sah sich suchend um und hängte ihn schließlich über einen Stuhl, der in der Nähe stand. Sofort war er bei ihr.
„Habe ich dir das erlaubt?“ Ihre Antwort wartete er nicht ab, sondern ohrfeigte sie erneut. Dieses Mal war die andere Seite dran. Er schlug erbarmungslos zu, und sie fragte sich mit Schaudern, ob sich das im Laufe des Abends noch steigern würde und ob ihr das dann noch gefiele. Jetzt riss er den Mantel vom Stuhl und warf ihn ihr vor die Füße. „Los, aufheben!“ Als sie sich bücken wollte, packte er sie und drückte sie nach unten, bis sie fast auf dem Boden lag.
„Hierher gehörst du, Schlampe“, brummte er dabei, und weil sie wusste, was sich gehörte, antwortete sie. Es waren die ersten Worte, die sie mit ihm sprach.
„Ja, Meister“, erwiderte sie.
***
Während Lena in ihrer kleinen Küche eine Tiefkühlpizza ins Rohr schob und sich danach ein Glas gut gekühlten Riesling einschenkte, wanderten ihre Gedanken von Maja, Jürgen und Sabrina weiter zu ihrem eigenen Leben. Ob sich Tamae heute noch melden würde? Lena hätte Lust, sie zu sehen, aber die Japanerin war eigenwillig und zog es vor, ihre Treffen selbst zu bestimmen. Tamae war eine von Lenas beiden Freundinnen. Die Art von Freundin, die sie Loverin oder Geliebte nannte.
Die Japanerin war eine zartgliedrige Schönheit mit langem, glattem schwarzem Haar und der zarten, hellen Haut der Asiatinnen. Sie hasste Männer wie die Pest. Warum, hatte sie Lena nie gesagt. Überhaupt sprach sie nicht viel und ganz besonders nicht über sich und ihr Innenleben. Tamae war eine außergewöhnliche Frau. Sie lachte oder lächelte privat so gut wie nie. Vielleicht tat sie es im Job, aber auch darauf würde Lena nicht wetten. Auf sie wirkte sie stets ernst, die Augen auf ein Ziel gerichtet, das allen anderen Menschen verborgen schien. Sie kokettierte nicht, flirtete nicht und sagte was sie wollte, aber niemals, was sie dachte. Im Bett war es mit ihr unkompliziert, sie war direkt, es gab wenig Drumherum und nichts dazwischen. Schnell und ohne jede überflüssige Zärtlichkeit holte sie sich oder gab sie Höhepunkte. Manchmal ging sie sogar direkt nach dem Liebesspiel, mit einem kühlen, nüchternen Abschied. An anderen Tagen verbrachten die beiden Frauen Zeit miteinander wie gute Freundinnen. Sie gingen ins Kino, zum Tanzen oder in Restaurants. An diesen Abenden redeten sie über Gott und die Welt, denn Tamae konnte, wenn sie wollte, auf ihre ernste und dunkle Art sehr unterhaltsam sein. Natürlich nicht, wenn es um sie selbst ging!
Lenas zweite Freundin hieß Karin und war das genaue Gegenteil. Sie war eine verheiratete, sehr weiblich gebaute Blondine, die gerne lachte und ständig laut über alle möglichen Dinge nachdachte. Sie war offen, neugierig und anschmiegsam. Sehr oft, wenn die beiden Frauen einen draufmachten, landeten sie anschließend bei Lena im Bett. Karin brauchte viele Streicheleinheiten, sie stöhnte ausgiebig und weinte sogar manchmal nach dem Orgasmus, der bei ihr anhaltend und lautstark war. Und sie gab dennoch mehr, als sie nahm, hüllte Lena ein in ihre helle, blonde Weichheit, ihren weiblichen Duft und ihre überströmende Lust. Doch häufig folgten auf die ausschweifenden Nächte Selbstvorwürfe und ein schlechtes Gewissen, und so ging sie meist noch in derselben Nacht nach Hause zu ihrem Mann. Lena konnte ihr deswegen nicht mal böse sein. Karin war eben so. Manchmal hatte auch Lena ein schlechtes Gewissen Karins Mann gegenüber, denn er war ein angenehmer Kerl und hatte keine Ahnung von dem sexuellen Doppelleben seiner Frau.
Doch an diesem Wochenende hatte sich bisher keine der beiden gemeldet. Lena hatte wenig Lust, sich mit jemand anderem zu treffen. Sie nutzte die Zeit, um endlich einmal ihre Wohnung aufzuräumen. Etwas, das sie nicht gerne tat. Aber es lenkte ab. Von Gedanken an Maja, an Jürgen und an die Zeit, als sie alle noch jung genug waren, um Träume zu spinnen. Für manche waren sie in Erfüllung gegangen. Für andere nicht …
Erst als sie am Montagmorgen das Haus verließ, um zur Arbeit zu gehen, fiel ihr die Putzwoche wieder ein.
„Pech gehabt“, knurrte sie mit einem bösen Blick auf die geschlossene Wohnungstür der Kasulke und ließ die Haustür besonders schwungvoll hinter sich zufallen.
***
„Das geht so nicht! Keinesfalls können wir alle diese Frauen als Tagesmütter einsetzen! Über meine Auswahl hinaus – und da habe ich schon manches Mal ein Auge zugedrückt – kann ich keine Empfehlung abgeben. Auch wenn du der Meinung bist, noch ein paar Namen hier draufsetzen zu müssen.“
Lena schlug mit der flachen Hand auf die mehrseitige Aktennotiz, die ihr Sieglinde Brohm, bis vor Kurzem eine Kollegin und inzwischen ihre direkte Vorgesetzte, gerade ausgehändigt hatte. Die beiden Frauen saßen im Büro der Abteilungsleiterin und besprachen die Ergebnisse ihrer Suche nach Tagesmüttern.
„Lena, jetzt halte mal die Luft an! Wir haben ein anspruchsvolles sozialpolitisches Projekt umzusetzen.“
Auf Sieglinde Brohms Stirn hatten sich zwei Zornesfalten eingegraben und sie machte keinen Hehl daraus, wie deplatziert sie Lenas Reaktion fand.
„Du weißt genau, welche Schwierigkeiten wir haben, überhaupt Interessentinnen zu finden. Da kann man nicht so pingelig sein und auch noch die meisten davon ablehnen. Die Frauen wachsen ja mit ihrer Aufgabe!“
Lena schnaubte. Sie dachte an die Kinder, die sie in den vergangenen Monaten bei ihren Besuchen gesehen hatte. Denen der Rotz aus der Nase lief und die mit Pizza und Pommes in Laufställen saßen, vor denen Tag und Nacht ein Fernseher plärrte. Sie dachte an Frauen, die nicht einmal genug Deutsch sprachen, um telefonisch einen Besuchstermin zu- oder absagen zu können, und die gleichzeitig den ganzen Tag lang Ansprechpartnerin sein sollten für die Kinder.
„Unser ganzheitliches Konzept sieht vor …“, wollte Sieglinde Brohm gerade fortfahren, als Lena abrupt aufstand.
„Nein, Sieglinde. Ich weiß, was du sagen willst, weil du es mir und allen anderen schon seit Monaten ununterbrochen eintrichterst. Aber es wird nicht besser dadurch. Wenn du mit meiner Auswahl nicht zufrieden bist und andere Kandidatinnen als ich auswählen würdest, dann tue das bitte. Aber ich werde meine Unterschrift nicht unter diese Empfehlungen setzen.“
Damit drehte sie sich um und verließ Türe schlagend das Büro der verärgerten Abteilungsleiterin.
„Lena, jetzt beruhige dich doch mal!“, rief die ihr noch hinterher, doch das hörte sie schon nicht mehr.
„Warum so echauffiert?“, wurde Lena kurz darauf von ihrer Kollegin und Büronachbarin Regina gefragt. Die hing gerade mit genervtem Gesicht über einem Bericht, einer Arbeit, die ihr gar nicht lag. Sie war mehr der praktische Typ, und jede Art von Verwaltungsarbeit machte sie krank oder zumindest unzufrieden. Lena erzählte ihr von der Auseinandersetzung mit Sieglinde.
Die Idee mit den Tagesmüttern klang im Grunde ganz gut. Qualifizierte, jedoch arbeitslose, alleinerziehende Hartz-IV-Empfängerinnen konnten wieder arbeiten gehen, wenn man andere arbeitslose Frauen dafür ausbildete, als Tagesmütter die Kinderbetreuung in der Zeit zu übernehmen.
„Was die einfach nicht verstehen, ist die Tatsache, dass wir eben nicht jede x-beliebige Frau dafür nehmen können. Es ist doch keine Empfehlung, arbeitslos zu sein. Einige der Frauen sind sicherlich geeignet, aber doch um Himmels willen nicht jede Hilfeempfängerin, die ‚Ich will etwas mit Kindern machen‘ auf ihren Profilingbogen für die Arbeitssuche schreibt. Wenn ich sehe, was schon bei einigen unserer bisherigen Betreuungsfälle abgeht – ne!“
Mit „die“ meinte Lena die Kombination aus Politik und leitenden Verwaltungsleuten. Man hatte einige sehr gute Konzepte auf den Weg gebracht, aber nicht alles, was sich in der Presse gut las – und damit die Chancen der Kandidaten erhöhten, im nächsten Jahr gewählt zu werden –, ließ sich in Wirklichkeit auch gut umsetzen.
Regina nickte. Sie hatte sich mit hinter dem Kopf verschränkten Armen auf ihrem Bürostuhl weit nach hinten gelehnt. „Vielleicht kannst du dir deinen Ärger ja sparen“, meinte sie dann.
„Wie meinst du das?“
„Ich hab läuten hören, du bist für das neue Querschnittsprojekt vorgesehen. Aber sag nicht, dass du es von mir hast. Die Sache ist zurzeit im Teeküchenstadium!“ Damit spielte Regina auf die altbekannte und unerfreuliche Tatsache an, dass viele Entscheidungen des Amtsleiters Märkle von dessen Sekretärin unter dem Siegel der Verschwiegenheit in der Teeküche unter die Leute gebracht wurde.
„Ich glaube, ich spinne! Eben noch war ich bei Sieglinde. Sie hat mir keinen Ton davon gesagt.“
Lena begriff, dass ihre Vorgesetzte sie für das neue Projekt vorgeschlagen hatte, ohne mit ihr vorher darüber zu sprechen. Sieglinde wollte sie loswerden, das wurde Lena in diesem Moment klar.
„Sie hat es nicht gerne, wenn man ihr widerspricht, das weißt du doch.“ Regina blies sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. „Und du hast eben eine eigene Meinung und lässt dir nicht die Butter vom Brot nehmen.“
„Soll ich mich so verhalten, wie die meisten im Kollegium hier? Mund halten und auf die nächste Beförderung warten, die umso sicherer kommt, je opportunistischer man sich verhält?“
„Wes Brot ich ess, des Lied ich sing …“ Regina grinste.
„Ich sing jetzt woanders!“ Lena sprang auf, und Regina ließ ihren Stuhl erschrocken wieder in die Normalposition springen.
„Mach keinen Mist, wahrscheinlich ist noch gar nichts entschieden. Wenn du jetzt Stunk machst, geht der Schuss womöglich nach hinten los!“
Lena stand einen Moment im Raum und nagte an ihrer Unterlippe. Es gab Tage, da schien sie den Ärger förmlich anzuziehen.
„Bleib cool. Ich renne nicht zum Märkle. Ich brauche jetzt frische Luft und habe sowieso noch einen Außendiensttermin.“
Damit schnappte sie sich einen Stapel Akten, ihre Tasche sowie ihre Lederjacke und verließ mit schnellen Schritten das Büro.
***
Der Mann war zu seinem Sessel zurückgekehrt, nachdem er sie lange Minuten betrachtet hatte, wie sie auf dem Boden vor ihm kniete. Ihre brennende rechte Wange wurde durch die glatten Fliesen gekühlt. Ihr Hintern schwebte in der Luft.
Ein Anblick, der ihm gefiel, wie sie wusste.
„Sehr schön, dass du an die halterlosen Strümpfe gedacht hast. Du weißt also doch noch, was du zu tun hast“, lobte er sie. „Aber du hast nicht aufgepasst, und so sind sie schmutzig geworden. Schmutzig wie du und die Fantasien in deinem kleinen Hirn. Du siehst doch ein, dass ich dich dafür bestrafen muss, oder?“
„Ja“, flüsterte sie, denn wenn er sie direkt fragte, durfte sie antworten. „Ja, das sehe ich ein.“
„Steh auf!“
Mühsam rappelte sie sich auf, die gebückte Haltung war anstrengend gewesen. Sie schaute ihn beim Aufstehen nicht an, wusste ja, dass er das nicht mochte, und blieb auch danach mit dem Rücken zu ihm stehen.
„Hast du deine schönen Schuhe mitgebracht?“, fragte er, und sie bejahte.
„Dann zieh sie für mich an!“ Langsam ging sie auf die große Tasche zu, die noch mehr Utensilien enthielt. Einige hatte er gefordert. Von anderen ahnte er nichts, und das war auch besser so. Er schätzte es nicht, wenn sie ihm in irgendeiner Form signalisierte, was sie wollte. Die Schuhe, die sie herausholte, waren aus einem Spezialgeschäft in der Kaiserstraße. Mit mörderisch hohen Absätzen und einer sehr starken Biegung zwängten sie die Füße in eine äußerst unbequeme, aber sehr anregende Stellung. Als sie sich aufrichtete, schwankte sie leicht, schaffte es aber, sich wieder gerade hinzustellen.