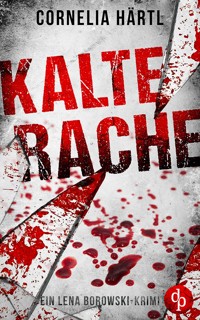5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Lena Borowski-Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine Tote, die zu viel wusste, und ein Mädchen, das zur Ware wurde
Der temporeiche Krimi für Fans von Gerlinde Friewald
Lena Borowski glaubt nicht an den Selbstmord ihrer Kollegin Emilia, die erhängt im Stadtwald gefunden wird. Sie macht sich zusammen mit Emilias Schwester auf die Suche nach Antworten. Dabei stoßen die beiden Frauen nicht nur auf einen Betrug, der kurz vor der Enthüllung stand, sondern auch auf einen brutalen Mädchenhandel. Als eine zweite Leiche auftaucht und Lena sich verfolgt fühlt, spitzt sich die Lage zu. Denn Lena weiß zu viel – und das muss mit allen Mitteln verhindert werden …
Weitere Titel dieser Reihe
Gefährliches Vertrauen (ISBN: 9783968171241)
Erste Leserstimmen
„Gesellschaftskritisch, aufrüttelnd, stark!“
„Fesselnder Krimi – geht unter die Haut und bleibt im Gedächtnis.“
„Spannender Krimi rund um die Themen Menschenhandel, Prostitution und Korruption.“
„Schlüssig aufgebaut und durchweg packend, kann ich nur empfehlen!“
„Authentischer und intelligenter Roman, der mich wirklich berührt hat.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses E-Book
Lena Borowski glaubt nicht an den Selbstmord ihrer Kollegin Emilia, die erhängt im Stadtwald gefunden wird. Sie macht sich zusammen mit Emilias Schwester auf die Suche nach Antworten. Dabei stoßen die beiden Frauen nicht nur auf einen Betrug, der kurz vor der Enthüllung stand, sondern auch auf einen brutalen Mädchenhandel. Als eine zweite Leiche auftaucht und Lena sich verfolgt fühlt, spitzt sich die Lage zu. Denn Lena weiß zu viel – und das muss mit allen Mitteln verhindert werden …
Impressum
Überarbeitete Neuausgabe Dezember 2020
Copyright © 2024 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-96817-127-2 Taschenbuch-ISBN: 978-3-96817-320-7
Copyright © 2015, Sutton Verlag, Erfurt Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits 2015 bei Sutton Verlag, Erfurt erschienenen Titels Finstere Geschäfte (ISBN: 978-3-95400-574-1).
Covergestaltung: Buchgewand unter Verwendung von Motiven von depositphotos.com: © Ensuper, © Klanneke, © dimmitrius, © Pakhnyushchyy, © designnatures stock.adobe.com: © Jakub Krechowicz Korrektorat: Lektorat Reim
E-Book-Version 12.07.2024, 11:50:52.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
TikTok
YouTube
Tödliche Enthüllung
Prolog
Es gibt Momente, in denen einem der Tod verführerischer erscheint als das Leben.
Sie versuchte vergeblich, die Geräusche auszublenden, die durch die dünne Wand aus dem Nebenzimmer zu ihr herüberdrangen. Doch die fest an die Ohren gepressten Hände nutzten nichts. Sie kauerte auf dem Boden, wiegte sich vor und zurück und begann, fast lautlos eine Melodie zu summen. Ein Lied aus der Kindheit, das ihr nur kurz eine scheinbare Sicherheit vermittelte. Solange, bis die Holzdielen unter ihren Füßen erzitterten.
Die junge Frau sprang auf und rannte quer durch den Raum auf das winzige Dachfenster zu. Es war die einzige Lichtquelle, unerreichbar hoch. Es gab nichts in dem Zimmer, auf das sie sich hätte stellen können. In ihrer Verzweiflung hüpfte sie auf und ab. Ihre Fingerspitzen glitten über das Metall, ohne Chance, an den Griff zu gelangen. Der im Übrigen mit einem Schloss gesichert war.
Sie spürte am kalten Luftzug, dass die Tür geöffnet wurde, noch bevor sie es hörte. Außer Atem drehte sie sich um. Ihr Hirn weigerte sich zu erfassen, was ihre Augen sahen, sie presste unwillkürlich beide Hände vor den Mund.
Kapitel 1
Lena Borowskis Arm schnellte nach vorn. Ihre Faust traf das Ziel mit einem satten Knall. Sie schwitzte vor Anstrengung, Rinnsale von Schweiß liefen zwischen ihren Brüsten und den Schulterblättern hinunter und durchnässten ihr dünnes Shirt. Sie stellte sich das Gesicht eines Mannes vor, dessen Ausdruck beim letzten Schlag von grenzenloser Arroganz zu schmerzhafter Verblüffung wechselte. Das reichte, um sämtliche noch schlafende Energien in ihr zu mobilisieren. Obwohl sie ihn nicht persönlich kannte, hatte sie eine Rechnung mit ihm offen. Die konnte sie zurzeit nur in der Fantasie begleichen.
»Drecksack«, murmelte sie, tänzelte zurück und schlug noch drei Mal zu. Rechts, links, rechts. Dann eine leichte Drehung des Körpers, ein wuchtiger Tritt mit dem Fuß von der Seite. Sie hatte all ihre Kraft hineingelegt. Das Gesicht verschwand vor ihren Augen. So, wie der Mann verschwunden war, nachdem er ihr Leben und das Leben ihr nahestehender Menschen schmerzhaft berührt hatte.
»Lena, pass auf deinen festen Stand auf«, rief jemand schräg hinter ihr. »Würdest du auf einen lebendigen Widersacher eindreschen statt auf einen Sandsack, lägst du jetzt am Boden.«
»Nur, wenn er so gut wäre wie du«, knurrte sie. Sie schlug noch ein paar Mal völlig unkontrolliert zu, um ihren Körper komplett auszupowern, bevor sie sich mit einem lauten Ächzen mit dem Rücken gegen die Wand fallen ließ. Der Schweiß lief ihr brennend in die Augen. Das Gesicht aus ihrer Vorstellung verschwamm. Leider nicht die Wut, die sie erfasste, sobald sie an den Kerl dachte.
Jochen, ihr Coach im Fitnessstudio, kam mit einem merkwürdigen Gesichtsausdruck näher.
»Alles okay bei dir?«
»Klar, warum nicht?« Sie wischte sich mit dem Handtuch über Stirn und Nacken.
»Du wirkst so … aggressiv in den letzten Wochen.«
»Ist einiges passiert«, murmelte sie. »Aber keine Angst, ich werde niemandem an den Karren fahren, ich baue nur Stress ab.«
»Okay. Dienstag Selbstverteidigung?« Jochen hob das Klemmbrett mit ihrem Trainingsplan und blickte sie fragend an.
»Wie gehabt. Um fünf.« Sie stieß sich von der Wand ab, um zu den Waschräumen hinüberzutrotten.
***
Das Leben der Sozialarbeiterin Lena Borowski war einige Monate zuvor aus dem Takt geraten. Genauer an dem Tag, an dem sie sich einer Jugendfreundin zuliebe auf die Suche nach einer verschwundenen Frau gemacht hatte. Niemals hätte sie gedacht, dass dieser Gefallen sie schmerzhaft mit der eigenen Vergangenheit konfrontieren würde. Noch weniger vorhersehbar waren die Auswirkungen auf die Gegenwart.
Als Lena ihre Wohnung im unteren Teil des Buchrainwegs in Offenbach betrat, fiel ihr als Erstes die Stille auf, die an diesem Abend herrschte. Das Haus schien wie ausgestorben. Auf einen Schlag fühlte sie sich einsam. Das Adrenalin, das kurze Zeit nach dem Training durch ihre Adern gerauscht war, war verflogen. Sie verspürte eine merkwürdig unkörperliche Müdigkeit.
Ein Blick zum Telefon zeigte, dass keine Nachricht für sie vorlag. Ihr Handy blieb ebenfalls stumm. Lena warf sich in einen Sessel, durch ihren Kopf zogen Bilder der jüngsten Vergangenheit. Ihre Beziehung zu einer Reihe von Personen hatte sich durch die Geschehnisse nachhaltig verändert.
Tamae, ihre japanische Geliebte. Sie war kürzlich in ihre Heimat zurückgekehrt. »Für ein Projekt, das über mehrere Monate läuft«, lautete ihre Erklärung. Lena und sie wussten beide, dass das eine Umschreibung dafür war, Zeit zu gewinnen. Zeit, um darüber nachzudenken, ob und wie ihre Beziehung noch eine Zukunft hatte.
Karin, ihre zweite Geliebte. Die Frau, die sie in den letzten Wochen und Monaten mit ihrer so fürsorglichen wie selbstlosen Liebe ummantelt hatte. Die nie ein Wort des Zweifels ausgesprochen hatte. Dennoch spürte Lena inzwischen auch bei ihr eine Tendenz, sich zurückzuziehen. Vielleicht, weil auch Karins Kräfte begrenzt waren und sie auftanken musste. Oder weil auch sie Lena die Möglichkeit geben wollte, eine wichtige Entscheidung zu treffen.
Gerd Rohloff. Der Mann, dem verschiedene Etablissements im Frankfurter Rotlichtviertel gehörten. Er hatte Lena aus dem Gleichgewicht gebracht, bereits bei ihrer ersten Begegnung. Sie war lesbisch, hatte bisher nie Interesse für einen Mann gezeigt. Bis sie Gerd Rohloff traf.
Diesen Gefühlen musste sie sich früher oder später stellen. Gleichzeitig bedeuteten genau diese Gefühle Gefahr.
Lieber später, signalisierte ihr Unterbewusstsein.
***
Sunita wusste nicht, wo sie war. Nach ihrer Ankunft am Flughafen hatte man sie in einem abgedunkelten, nach Zigarettenqualm stinkenden Lieferwagen scheinbar endlos herumgefahren und sie dann in dieses Haus gebracht. In der Diele stand eine Frau, die sich Mammy nannte. Sie musterte sie kalt. Ihre Blicke wanderten an Sunitas Körper auf und ab, bevor sie sie in einen kleinen, kühlen Raum zog. Dort tat sie einige Dinge, die Sunita bis ins Mark erschreckten, und sagte ihr eindringlich, was passieren würde, sollte sie nicht ab sofort aufs Wort gehorchen.
Man brachte sie in eine Dachkammer, wo sie auf einer Matratze hockte und über das nachdachte, was Mammy ihr gesagt hatte. Das Herz schlug ihr aus Angst bis zum Hals.
Die massige Frau war aus demselben Land wie sie, was sie nur kurz gefreut hatte. Schnell war diese Freude in Unbehagen umgeschlagen, dann in Furcht. Die Ältere hatte nichts Mütterliches. Sie würde keine der Fragen beantworten, die Sunita auf der Seele brannten. Genauso wenig wie die Fremde, die sie aus der Heimat hierher begleitet hatte. Den Flug über wechselten sie kaum ein Wort. Am Flughafen verschwand die andere, nachdem sie sie den Männern mit dem Lieferwagen übergeben hatte. Als wäre sie ein Paket.
Das Arrangement war erprobt und ging routiniert ab. Das spürte die junge Frau. Sie rollte sich zusammen, um die Wärme ihres eigenen Körpers zu fühlen.
Wo war sie? Was war es, was man von ihr wollte? Nichts von dem, was man ihren Eltern erzählt hatte, schien zu stimmen. Sunita dachte an ihr Heimatdorf, die fröhlich plappernden Stimmen ihrer Schwestern, das Mahnen ihrer Mutter, wenn sie alle mal wieder zu übermütig waren. Die harte Arbeit im Haus und auf dem Feld, die sie oft so gehasst hatte. Jetzt hätte sie wer weiß was gegeben, um wieder dort sein zu können. Sie presste die Lider fest zusammen. Redete sich ein, alles sei nur ein schlechter Traum. Als sie ihre Augen wieder öffnete, hatte sich nichts verändert. Es war Realität. Die Erkenntnis dröhnte in ihrem Kopf, als habe jemand einen Gong geschlagen.
Um sie herum war es absolut still. Sie ahnte, dass das nicht immer so war.
Sie starrte in das Halbdunkel um sie herum, bis sie endlich einschlief.
***
Gerd Rohloff unterbrach die Verbindung, als Lenas Mobilbox ansprang. Seit Wochen ging das so. Als ob sie sich von ihm entfernen würde. Er sah nachdenklich auf das Display. Entschied, keine SMS zu senden.
Lena beschäftigte ihn, seit sie sich das erste Mal begegnet waren. Wie eingebrannt in sein Gedächtnis war dieser Moment, als ihm die schlanke Frau mit den kurzen, fast schwarzen Haaren in einem seiner Läden, dem »Kinky-Klub«, gegenüberstand. Der intensive Blick ihrer grünen Augen. Als sich ihre Hände berührten und sie beide spürten, dass etwas zwischen ihnen vorging. Wie er ihr hinterherblickte, sich dabei ertappte, ihr auf den festen Hintern zu sehen, obwohl das nebensächlich war. Sie zog ihn an, auch erotisch, obwohl sie überhaupt nicht sein Typ war. Und er nicht ihrer. Lena war lesbisch und nicht darauf aus, mit ihm ins Bett zu gehen. Vielmehr fühlte er den Wunsch, ihr nahe zu sein, sie zu beschützen. Doch noch nicht einmal das würde sie annehmen wollen. Sie konnte gut auf sich selbst aufpassen, hatte sie ihm bereits vermittelt.
Er wusste, welch eine schwierige Zeit hinter ihr lag. Dass sie seinen Rat gesucht und seine Nähe angenommen hatte, hatte ihn glücklich gemacht. Es war diese Art von Glück, die Menschen nicht oft vergönnt war, weil sie an die Gegenwart von besonderen Menschen gebunden war, denen man im Leben nicht häufig begegnete. Weil er nach dem Tod seiner Frau nicht mehr geglaubt hatte, jemals wieder eine so starke Empfindung für jemand anderen haben zu können, hatte ihn Lena so umgehauen.
Wie es ihr wohl ging? Sie musste mit so vielem fertigwerden.
Sie würde nicht antworten. Nicht heute, nicht morgen. Aber irgendwann. Er hatte sie berührt, das wusste er, sie konnte nur noch nichts damit anfangen.
***
Dem Mann hing der Bauch über die schlechtsitzende Hose, er roch nach Bier und Schnaps.
»Komm her«, bedeutete er ihr.
Sunita schauderte bei der Vorstellung von körperlicher Nähe zu dem Fremden. Sie blieb an der Türschwelle stehen.
Ein Stoß zwischen die Schultern beförderte sie vorwärts, zu Boden, direkt vor die Beine des auf dem Bett sitzenden Dicken.
Er sagte etwas. Sie ahnte nur, was es bedeutete. Seine Stimme knarzte und das dreckige Lachen, das folgte, jagte ihr einen kalten Schauer über den Rücken.
»Los jetzt. Du bist nicht zum Faulenzen hier. Mach, wie ich es dir gezeigt habe!«
Mammy stand hinter ihr. Gnadenlos. Sunita drehte sich zu der Frau um. Ihre Augen flehten, ihr das zu ersparen, was sie verlangte.
»Bitte«, sagte sie leise. In der Sprache, die nur sie beide verstanden.
Als Antwort fiel die Tür krachend ins Schloss. Sie war allein mit dem Fremden.
Die Zunge des Mannes glitt über seine Lippen. Sunita fand den Anblick der nassen roten Haut ekelhaft. Mit einer Geste gab er ihr zu verstehen, was er von ihr erwartete. Sie dachte an das, was Mammy ihr beigebracht hatte, und griff nach dem Reißverschluss seiner Hose. Versuchte, ihn zu öffnen. Ihre Finger zitterten so sehr, dass sie es nicht schaffte. Der Mann schlug ihr auf den Kopf und fuhr sie an. Er hatte es eilig, daher öffnete er die Hose selbst.
Er stank.
Angewidert drehte sie den Kopf zur Seite. Sie musste schlucken, krampfhaft, immer und immer wieder. Ihr Mund hatte sich mit Speichel gefüllt, der nach Kotze schmeckte. Seine Hand krallte sich unnachgiebig in ihr Haar, er zog sie heran, drückte ihr Gesicht in den schmutzigen Schritt. Sunita würgte, sie wusste, sie würde nicht tun können, was man ihr befohlen hatte. Aus dem Würgen wurde ein hysterischer Schluckauf. Speichel lief ihr über die Unterlippe. Dann sperrte ihr Kiefer, als wäre er mit einem Schraubstock verschlossen. Sie hörte das Knirschen ihrer eigenen Zähne und spürte den Schmerz unter den Ohren.
Der Mann schlug sie ins Gesicht, ein harter Schlag traf ihr linkes Ohr, ein weiterer ihre Schläfe. Jetzt schrie er, mit hässlich verzerrtem Mund. Seine Augen glitzerten bösartig. Sunita robbte nach hinten weg, ein Fußtritt gegen die Rippen war die Antwort. Er stand auf und schaute auf sie herab. Zornerfüllt. Er glaubte, ein Recht auf das zu haben, was sie ihm nicht geben konnte und wollte. Ekel erfasste sie bei seinem Anblick.
Wütend zog er den Gürtel aus der Hose, ohne den Blick von ihr zu lassen. Sie kam mühsam auf die Beine, aber er hielt sie am Nacken gepackt, als wäre sie eine Katze, die er gleich ersäufen wollte. Sunita schrie, obwohl sie wusste, dass niemand kommen würde. Zu oft schon hatte sie das Schreien der anderen Mädchen mithören müssen. Würde auch ihr passieren, was ihnen passiert war?
Der Dicke holte aus, das harte Leder traf Sunita wie eine Peitsche. Knallte schmerzhaft auf ihre Arme, ihre Beine. Sunita weinte, sie hielt schützend die Hände vors Gesicht und wandte sich ab. Der Gürtel traf ihren Rücken. Die Schnalle riss ihr die Haut unter dem dünnen Hemd auf. Noch einmal traf sie das Metall, dieses Mal im Nacken. Sie heulte auf und stolperte, im Versuch, den Schlägen zu entkommen.
Die Tür flog auf. Ein Mann kam ins Zimmer, groß und schwarz. Der Dicke hörte auf zu traktieren, keuchend wandte er sich dem Neuankömmling zu.
»Genug!«, sagte der und fuhr mit schnell gesprochenen Worten fort, die Sunita nicht verstand. Seine Kopfbewegung hingegen konnte sie deuten, und sie huschte mit tränennassem Gesicht nach draußen. Vor der Tür wartete Mammy. Sie machte klackernde Geräusche mit der Zunge und schüttelte langsam den Kopf.
»Du hast uns enttäuscht«, sagte sie. Ihre Augen blickten mitleidslos auf die noch immer weinende Jüngere.
»Wir werden dich lehren, unsere Befehle zu befolgen.«
Damit griff sie Sunita am Arm und zog sie mit sich. Nicht dorthin, wo sie normalerweise schlief. Sondern in die andere Richtung. Nach unten. In den Keller. Sunita wollte schreien, aber ihr Unterkiefer war erneut so verkrampft, dass kein Ton über ihre Lippen kam.
Kapitel 2
Lena stand im ersten Stock am Fenster eines dreistöckigen, schmucklosen Bürogebäudes in der Pittlerstraße im Industriegebiet von Langen und sah in den grauen, diesigen Februarhimmel hinauf. Danach hinunter auf die Gruppe von Menschen, die das Haus verließen. Einzelne gingen eilig davon, während andere noch in Grüppchen stehen blieben, in Gespräche vertieft. Zigaretten wurden angezündet, jemand lachte so laut, dass es bis zu ihr nach oben schallte.
»Wie lief es?« Adelheid Wormser, die stellvertretende Geschäftsführerin der »Gemeinnützigen Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung«, kurz gGAB, betrat den Raum.
»Ganz okay«, murmelte Lena. Von den eingeladenen Hartz-IV-Empfängern waren nicht alle zum Bewerbungskurs erschienen. Lena hatte im Querschnittsteam, das inzwischen offiziell »Team für ämterübergreifende soziale Arbeit« hieß, die Aufgabe übernommen, die zentrale Ansprechpartnerin für alle Fragen bezüglich dieser Kurse zu sein. Normalerweise nahm sie daher seit Kurzem an den Einführungsveranstaltungen teil, die Emilia Hornauer hielt. Doch die war an diesem Morgen weder zur Arbeit erschienen, noch hatte sie sich gemeldet.
Lena und Emilia waren am Vortag gemeinsam im Kreishaus in Dietzenbach in einer Besprechung gewesen, die sich schier endlos hinzog. Zwei Teilnehmer der Arbeitsgruppe verspäteten sich, einer der beiden über zwanzig Minuten. Obwohl die Agenda wie üblich ziemlich vollgestopft war, ging es nur im Schneckentempo voran. Einer der Tagesordnungspunkte war die Zusammenarbeit einzelner Abteilungen. Konkret ging es an diesem Tag um die Abstimmung zwischen den Fallmanagern und Emilia. Erstere waren bei der »Komm-Job«, dem bei der Kreisverwaltung angesiedelten kommunalen Arbeitscenter, ständige Ansprechpartner der Bezieher von Hartz IV und schlugen arbeitslose Klienten für die Kurse bei der gGAB vor. Die bot auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze für schwer vermittelbare Jugendliche und Erwachsene an, mit entsprechender fachlicher und sozialpädagogischer Begleitung. Emilia, die ebenfalls beim »Komm-Job« arbeitete, kümmerte sich als Sozialarbeiterin vor Ort in Langen um den Ablauf. Lena vertrat in der Runde das ämterübergreifende Querschnittsteam, in dem sie seit einigen Monaten eingesetzt war.
Neben Lena rutschte Emilia nervös auf ihrem Stuhl herum.
Sie schien unter Termindruck zu sein. Lena konnte das nachvollziehen, die angesetzte Zeit war bereits um, und sie hatten bisher nur zwei Drittel der Tagesordnung abgearbeitet.
Als sie endlich mit allem durch waren, summte Emilias Handy, nicht zum ersten Mal an diesem Nachmittag. Sie sprang eilig auf. »Sorry, ich muss da mal drangehen«, murmelte sie und verließ den Besprechungsraum. Als sie zurückkehrte, waren die anderen bereits dabei, ihre Sachen zusammenzupacken.
»Ich mach mich vom Acker, tschüss!«, rief Emilia in die Runde, schnappte sich Handtasche und Jacke. Sie ging so hastig davon, dass sie dabei fast jemanden umrannte.
»Was ist denn mit der los?«, murmelte Renate Kloß, eine Abteilungsleiterin der »Komm-Job«.
Lena zuckte die Schultern. Sie wollte ebenfalls gehen, wurde aber noch in ein Gespräch verwickelt. Als sie danach nach ihrem Parka griff, fiel ihr die Aktentasche auf, die am Boden stand. Am Schloss waren die Initialen E.H. eingraviert. Sie gehörte Emilia, die sie in der Eile vergessen hatte.
Lena kannte die Kollegin privat und wusste, wo sie wohnte. Sie beschloss, Emilia anzurufen und ihr die Tasche später vorbeizubringen.
Doch daraus war nichts geworden, sie hatte Emilia am Vorabend nicht erreicht, und nun war sie auch nicht zur Arbeit erschienen.
Seufzend folgte Lena der großen, dünnen Gestalt von Adelheid Wormser, die sie zu Emilias Büro führte.
»Du bist ja heute ihre Vertretung. Wenn du willst, kannst du das Protokoll hier schreiben.«
Lena nickte. Emilias Einzelbüro war wesentlich ruhiger als ihr Arbeitsplatz in dem Container in Dietzenbach, in den man Lena und ihre Teamkollegen vor einiger Zeit verfrachtet hatte. Nein, sie hatte ganz und gar nichts dagegen, konzentriert arbeiten zu können.
Nur Emilias Abwesenheit gab ihr zu denken. Es passte überhaupt nicht zu der so akkuraten Person, sich nicht zu melden.
***
Henry Thompson spürte das Brennen in den Schenkeln. Noch ein paar Minuten, dann ging es querfeldein.
Er hatte sich Anfang des Jahres ein striktes Fitnessprogramm auferlegt und joggte bereits seit einer halben Stunde durch den Wald rund um den Buchrainweiher herum. Nach der dritten Runde lief er unter der Unterführung der A661 durch zurück in Richtung der Schrebergärten, bog jedoch vorher gleich wieder nach rechts ab. Entlang eines ziemlich vermüllten Wegs und vorbei an einigen verwahrlost aussehenden Grundstücken machte er ein paar Schritte quer durchs Unterholz. Dabei sprang er leichtfüßig über Äste und kleinere Büsche, machte zwischendrin ein paar Klimmzüge an einem tiefhängenden Ast. Der vom Regen der vergangenen Nacht feuchte Boden schmatzte unter seinen Füßen. Dort, wo er normalerweise den Haken schlug, um zu seinem am Rand des Kleingartengeländes geparkten Wagen zurückzulaufen, erhaschte er aus den Augenwinkeln heraus etwas, das nicht hierhergehörte. Henry blieb stehen, sein Atem ging schnell. Er beugte sich kurz nach vorne, stützte sich auf den Oberschenkeln ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er blickte auf und erfasste, was er da sah.
»Shit«, schrie er. Mit schnellen Schritten war er zu der Stelle gerannt, wo etwas an einem Baum hin. Etwas Großes, eindeutig Menschliches.
»Oh no«, stöhnte er. Fassungslos starrte er auf das Szenario. Ein schwarzer Klappstuhl aus Kunststoff lag umgekippt zwischen dem Grün und Braun des Waldbodens. Die Frau musste dort hinaufgestiegen sein, um sich den Strick um den Hals zu legen. Hatte sie gezögert oder ging es schnell? Niemand würde es je erfahren.
Der Schweiß auf seinem Körper wurde mit einem Schlag eiskalt.
»Lady, leben Sie noch?«, fragte er. Völlig irrational, so wie die Geste, mit der er an ihr Bein fasste. Er taumelte zurück, als die Leiche dadurch in Bewegung geriet. Alles, was er sah, sprach eine deutliche Sprache. Diese Frau war tot. Weswegen auch immer sie sich das Leben genommen hatte, sie hatte es gründlich getan.
Henry wurde übel, er musste ein paar Schritte weggehen von dem, was er sah und roch. Gallenbitter stieg ihm der Magensaft in die Kehle, er übergab sich in ein Gebüsch, bevor er nach seinem Mobiltelefon tastete und die 110 anrief.
Kapitel 3
Im Landratsamt in Dietzenbach war an diesem Mittwochmorgen einiges los. Im Foyer befanden sich mehrere Dutzend Menschen verschiedenster Nationalitäten. Es waren überwiegend Asylbewerber, die gerade mit zwei Bussen aus Gießen angekommen waren. Sie wurden nun von Sozialarbeiterinnen abgeholt und zu den für sie zuständigen Mitarbeitern in den ersten Stock des Gebäudes begleitet.
Lena Borowski hatte einen Termin bei der Personalabteilung. Während sie sich ihren Weg durch das Gewimmel im Foyer bahnte, zupfte sie jemand am Ärmel.
»Wir haben vermutlich denselben Weg«, meinte Andrea Geissler, die im Querschnittsteam normalerweise an dem Schreibtisch saß, der Lenas gegenüberstand.
»Echt? Weißt du denn, worum es geht?« Lena hatte auf ihrem Diensthandy lediglich eine SMS von Norbert Müller, ihrem Teamleiter, erhalten.
»Nö, Norbert tut mal wieder superwichtig, hat aber nichts rausgelassen.«
Kaum im vierten Stock angekommen, wurden die beiden Frauen vom Personalchef persönlich empfangen. Er wirkte nervös, und so etwas wie eine bange Vorahnung beschlich Lena.
»Es ist etwas Schlimmes passiert«, bestätigten die ersten Worte von Konrad Leiß ihre Befürchtung. »Frau Hornauer ist leider verstorben.«
Andrea schlug die Hand vor den Mund.
»Verstorben? Hatte sie einen Unfall?« Lena wurde übel. Deshalb hatte sie Emilia nicht erreicht.
Leiß bat um Diskretion. »Vermutlich werden wir es nicht geheim halten können. Dennoch bitte ich vorläufig um Stillschweigen.« Er sah die beiden Frauen eindringlich an, bevor er fortfuhr.
»Sie wurde im Wald gefunden. Erhängt. Selbstmord.«
»Nein!«, entfuhr es Lena. Gleichzeitig spürte sie einen Druck auf den Augen und wusste, dass sie gleich anfangen würde, zu heulen. »Aber, ich habe sie doch am Montag noch gesehen. Sie wirkte …«, abrupt brach sie ab. Wie hatte Emilia gewirkt? Fahrig, nervös. Allerdings – keineswegs lebensmüde.
»Man merkt es den Leuten nicht unbedingt an«, sagte Andrea leise und fasste beruhigend nach Lenas Arm.
»Frau Hornauer war beliebt im Haus«, nuschelte Leiß. So als wisse er nicht, was er sonst über die Tote sagen konnte.
Er hatte bedingt recht. Nicht alle, die mit Emilia zu tun hatten, schätzten sie. Vielleicht, weil sie manchmal zu verbissen war, wenn etwas ihrer Meinung nach nicht optimal lief. Das passte einigen ihrer Kollegen nicht in den Kram und hatte in der Vergangenheit diverse Male zu Auseinandersetzungen geführt. Lena hingegen war mit Emilia immer gut ausgekommen. Die diskutierte Sachen gerne aus, vertrat ihre Ansichten, konnte andererseits ganz pragmatisch Dinge abarbeiten, wenn man sich im Team einmal dafür entschieden hatte.
»Weswegen ich Sie beide hergebeten habe: Wir müssen die Vertretung organisieren. Frau Borowski, Sie haben in der jüngsten Vergangenheit als Kontaktperson des Querschnittsteams eng mit Frau Hornauer zusammengearbeitet. Daher wurde entschieden, dass Sie vorläufig die drängendsten Projekte in deren Aufgabengebiet übernehmen. Wir gehen da von weniger als vier Wochen aus, aber man weiß ja nie. Frau Geissler wiederum ist während Ihrer Abwesenheit Ansprechpartnerin für Ihren Bereich im Querschnittsteam, damit folgen wir der Vertretungsregelung.«
Lena und Andrea sahen sich an. Lena musste ein Seufzen unterdrücken. Sie hatte sich gerade in ihre neue Aufgabe im neu gebildeten Team in einem Brennpunktviertel von Dietzenbach eingearbeitet. Jetzt wurde sie wieder herausgerissen. Ohne straffe Organisation und etliche Überstunden würde es nicht abgehen.
»Oder haben Sie einen anderen Vorschlag?« Leiß sah ebenfalls nicht glücklich aus.
Lena schüttelte stumm den Kopf und drückte Daumen und Zeigefinger gegen die Augen. Vier Wochen, das würde schon gehen. Sie konnte den halben Tag in Dietzenbach die dringendsten Angelegenheiten erledigen und in der anderen Hälfte den unaufschiebbaren Teil von Emilias Arbeit übernehmen.
»Wir machen es so, das geht in Ordnung«, hörte sie Andrea sagen.
»Ihr Teamleiter, Herr Müller, weiß Bescheid über die neue Aufgabenverteilung, er kennt aber nicht den Grund dafür. Bitte bewahren Sie ihm gegenüber momentan Stillschweigen. Landrat Söder möchte sich mit der unerfreulichen Tatsache selbst an die Mitarbeiter wenden. Wir warten ein offizielles Statement der Kripo ab, bevor wir die Nachricht rausschicken.«
Vermutlich saß schon jemand in seinem Vorzimmer und bastelte eine Nachricht, die man über das Intranet verschicken würde, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen war.
»Frau Borowski, noch eine Sache. Uns stehen etliche Abgabetermine für Fördergelder ins Haus. Wir müssen uns auf Sie verlassen können. Sie werden selbstverständlich Zugriff auf alle Dateien und Unterlagen von Frau Hornauer erhalten.«
Damit waren sie entlassen.
»Gott, Lena, ich beneide dich nicht um den Job«, sagte Andrea, während sie das Kreishaus verließen. Die wusste genau, was ihre Kollegin meinte. Emilias Aufgaben beinhalteten auch Fördermittelanträge. Ohne das zusätzliche Geld von EU, Bund und Land konnte der Landkreis kaum etwas auf die Beine stellen.
»Emilia hatte einen Hang zu Verwaltungsarbeit, der machte der ganze Papierkram nichts aus«, brachte Andrea es auf den Punkt.
»Vielleicht macht er mir zurzeit auch weniger aus«, antwortete Lena leise. Sich bei der Arbeit nicht nur mit menschlichen Problemen herumzuschlagen, sondern teilweise auf Daten, Zahlen, Fakten zu konzentrieren, erschien ihr in diesem Augenblick jedenfalls gar nicht so unangenehm.
***
Sunita konnte nicht aufstehen, dazu war der Verschlag, in dem sie seit Stunden hockte, viel zu niedrig. Dunkel war es hier und kalt. Sie trug nur dünne Wäsche am Leib. Gut, um Männer aufzureizen. Gar nicht gut, um vor der klammen, eisigen Luft zu schützen.
Mammy hatte ihr bedeutet, sich still zu verhalten. Zunächst war sie wie erstarrt vor Angst. Was würde man ihr antun? Sie dachte an ihren ersten Tag in diesem Haus. An den Schnitt in ihren Arm, das Blut, die Phiole, in die Mammy es hatte laufen lassen. »Du gehörst nun dem Voodoogott. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, wird er dich strafen. Dich und deine Familie. Alle!« Natürlich fürchtete sie sich vor dem Dämon, den Mammy offensichtlich beschwören konnte. Kannte die Rituale aus ihrer Heimat. Sie hatte genügend Menschen gesehen, die gestraft worden waren. Ein Mann, gerade noch stark und groß wie ein Baum, war unter einen Bann geraten und bei lebendigem Leib verdorrt wie ein Halm ohne Wasser. Eine Frau hatte tagelang schreiend in ihrer Hütte gelegen, mit Schaum vor dem Mund. Erst, als sie still war, traute man sich hinein und fand sie tot.
Was würde Mammy mit ihr tun? Welchen Dämon, welche Krankheit würde sie herbeirufen? Je länger Sunita über ihre mögliche Strafe nachdachte, desto ängstlicher wurde sie.
Niemand kam, aber das war keine Beruhigung. Würde sie die ganze Nacht hier verbringen müssen? Die Wunde am Rücken, wo die Gürtelschnalle sie getroffen hatte, schmerzte. Ihre Beine schliefen ein, sie bewegte sie vorsichtig, um die Durchblutung anzuregen. Da hörte sie es! Ein kaum wahrnehmbares Scharren, ganz in ihrer Nähe.
Ihre Nackenhaare richteten sich auf. Ratten! Es konnte sich nur um Ratten handeln. Die Angst packte sie wie eine kalte Hand, ihr Herzschlag raste bei der Vorstellung, den Tieren ausgeliefert zu sein. War es das, was sie wollten? Sie noch mehr in Furcht versetzen, damit sie gefügig wurde?
Sie schloss die Augen und summte leise ein Lied, das sie aus ihrer Kindheit kannte. Weit weg von diesem Land hier war sie aufgewachsen, ihre Familie musste mit weniger als Nichts auskommen. Dennoch erschienen jetzt nur schöne Bilder in ihr. Erinnerungen an den Gesang ihrer Mutter, das weiche Licht ihrer Heimat, die Gerüche und Geschmäcker ihrer Kindheit. Und an Ebele, einen Jungen aus ihrem Dorf, ein paar Jahre älter als sie. Er hatte ihr den Hof gemacht, erst auf eine kindliche, später auf eine beschützende Weise. Zaghafte Blicke, seine Hand, die verstohlen die ihre suchte. Ein schüchterner Kuss auf die Wange. Wie weit entfernt schienen ihr diese unschuldigen Zärtlichkeiten.
»Ich komme zurück und heirate dich«, hatte er ihr versprochen, bevor er in die Stadt ging, um dort nach Arbeit zu suchen. Wenn er ins Dorf zurückkam, würde er sie nicht mehr finden. Würden ihre Eltern ihm sagen, wo sie war? Wussten sie es überhaupt?
»Er sucht mich«, suggerierte sie sich selbst ein. »Er wird mich nicht vergessen.« Dabei hätte sie genauso gut tot sein können. Hier eingesperrt zu sein war die Vorstufe zur Hölle, wie sollte er sie da jemals ausfindig machen?
Erneut ein Scharren – jetzt begleitet von unverständlichen Worten. Sunita zog die Beine dichter an den Körper. Das Blut rauschte in ihren Ohren.
Dann hörte sie es deutlicher. Jemand versuchte, etwas zu sagen. Ein Wort drang an ihr Ohr, als sei es durch Watte gesprochen. »Mama«. Das konnte man in jeder Sprache verstehen. Sunita wusste instinktiv, dass damit nicht die Mammy gemeint war, die sie hierhergebracht hatte.
»Hallo?«, flüsterte sie in die Dunkelheit. »Wer ist da?«
Es war wieder ruhig. Wer auch immer außer ihr im Keller war, hatte erst jetzt begriffen, dass eine zweite Person hier festgehalten wurde.
Bevor sie einen weiteren Ton von sich geben konnte, schlug krachend die Kellertür auf, Helligkeit drang durch die Schlitze der Holzbretter, hinter denen sie saß. Schwere Schritte näherten sich. Sunita blieb fast das Herz stehen, als sie direkt vor ihrem Verschlag stoppten. Ein Schatten zeichnete sich gegen das grelle Licht an der Decke da draußen ab. Sie zog den Kopf ein, legte ihn auf ihre Knie.
Bitte gib, dass sie weitergehen, betete sie lautlos.
Kapitel 4
»Irgendetwas stimmt nicht.«
Lena hockte im Schneidersitz auf dem abgewetzten Ledersessel in ihrem Wohnzimmer. In einer Hand hielt sie ihr Telefon, in der anderen eine Tasse Tee.
»Bitte Lena, fang jetzt nicht schon wieder an, Gespenster zu sehen.« Karins Stimme klang ruhig und ein bisschen resigniert. Bisher hatte sie einfach zugehört und Lena ihr Mitgefühl ausgesprochen.
Lena spürte ein ungutes Kribbeln im Bauch. Bereits am Vortag, sie hatten sich zu ihrem wöchentlichen Yogaabend getroffen, war ihre Freundin anschließend sofort nach Hause gefahren statt wie üblich, mir ihr gemeinsam noch eine Kleinigkeit beim Italiener zu essen. Karin hatte gesagt, sie sei zu kaputt und überhaupt … Was auch immer es bedeuten sollte, Lena hatte es so hingenommen.
»Nerve ich dich?« Lena stellte die Teetasse ab und massierte mit den Fingerspitzen ihre Stirn. Woher kam nur das blöde Gefühl, das sich schon die ganze Zeit in ihrer Magengrube breitmachte?
»Nein, du nervst nicht«, beeilte Karin sich, ihr zu versichern. Einen Moment lang hatte Lena den Eindruck, sie wolle noch etwas hinzufügen, doch es kam nichts mehr.
»Aber manchmal machen Leute eben Sachen …«, sie verstummte.
»Sachen machen? So nennst du es, wenn sich jemand umbringt?«
»Auch wenn sie auf dich nicht den Eindruck machte, hatte sie vielleicht doch Sorgen. Eine Trennung vielleicht. Eine Krankheit. Familiäre Probleme.«
Lena hörte angestrengt zu. Was hatte sie von Emilia eigentlich gewusst? Sie waren Kolleginnen gewesen, die gelegentlich zusammen etwas trinken gegangen waren und sich bei einigen wenigen Gelegenheiten auch gegenseitig besucht hatten. Ihre Wohnungen lagen nicht weit voneinander entfernt. So sehr sie jetzt versuchte, sich zu erinnern – ihr fiel dennoch nichts Persönliches ein, das Emilia ihr anvertraut hatte. War sie überhaupt mit jemandem liiert gewesen? Wie war das Verhältnis zu ihrer Familie gewesen? Hatte sie Sorgen und wenn ja, welche?
»Darüber weiß ich nichts«, gestand Lena denn auch. »Trotzdem – sie kam mir einfach nicht vor wie jemand, der gleich in den Wald gehen und sich aufhängen will.«
»Du hast ein schlechtes Gewissen«, konstatierte Karin. »Weil du unterbewusst denkst, du hättest es ihr anmerken müssen, so kurz vor dem, was passierte.«
In Lenas Kopf begann es zu pochen. Stimmte das, was Karin sagte?
»Wollen wir uns dieser Tage treffen? Vielleicht was trinken gehen?«, fragte sie, statt weiter über Emilia zu sprechen.
»Mal sehen. Ich melde mich. Okay?« Karin sprach leise. Vielleicht wollte sie nicht, dass ihr Mann Albrecht etwas von der Konversation mitbekam.
Als sie aufgelegt hatten, spürte Lena, wie sich ihre Kopfschmerzen über die gesamte Stirn ausbreiteten. Selten in ihrem Leben hatte sie sich so hohl und leer gefühlt. Zurzeit ging es ihr nur uneingeschränkt gut, wenn sie Sport trieb.
Sie ließ das Telefon in ihrer Hand auf und ab wippen und erschrak, als es klingelte.
Sie erkannte Rohloffs Nummer und zögerte. Sie spürte den Wunsch dranzugehen. Er war fast so stark wie das Verlangen, ihn zu sehen. Gleichzeitig hatte sie Angst, mit ihm reden zu müssen. Über sich, über ihn, über sie beide. Sie beschloss wieder einmal, das Thema noch hinauszuzögern. Dennoch war sie enttäuscht darüber, dass er auch dieses Mal wieder auflegte, als die Mobilbox ansprang. Keine Nachricht für Lena Borowski.
***
Sunita hielt die Luft an. Wenige Augenblicke lang passierte nichts, dann bewegten sich die zwei Personen seitlich von ihr weg. Eine Tür wurde knarzend geöffnet. Sunita hörte ein Keuchen, das sich beängstigend anhörte. Ihr Magen wurde zu einem harten, kalten Klumpen.
Eine Frau wimmerte in einer Sprache, die Sunita nicht verstand.
Es klatschte, zwei Mal, drei Mal, als Haut auf Haut traf. Das Wimmern erstarb, um gleich darauf lauter zu werden. Ein Mann sprach, seine Stimme klang kalt und mitleidslos. Weil Sunita nichts verstand von dem, was da draußen vor sich ging, nicht einordnen konnte, wirkte die Situation zunehmend bedrohlicher. Sie rutschte nach vorne und blickte durch die Ritzen in den erleuchteten Kellerraum. Ein Mann schlug eine junge Frau und warf sie auf den gekachelten Boden. Sunita hörte, wie Wasser an einem Schlauch aufgedreht wurde. Es zischte, als es mit Wucht herausströmte. Die Unglückliche schrie entsetzt auf, als der harte Strahl sie traf. Die wütenden Schreie der zwei Männer mischten sich mit den ängstlichen der Frau.
Das Wasser wurde abgedreht und lief glucksend in einen Abfluss. Weinen drang durch den Keller. Sie ließ sich zurückfallen und schloss kurz die Augen. Wieder schrie einer der Männer. Dann ging da draußen etwas vor, was Sunita nicht einordnen konnte. Die Geräusche waren derartig schrecklich, dass sich ihr sämtliche Härchen am Körper aufstellten. Durch die Holzplanken sah sie Schatten, die sich bewegten. Was sie hörte, machte ihr so wahnsinnige Angst, dass ihr Herz anfing, wie verrückt zu schlagen.
Sie musste alle Kraft aufbringen, sich der Tür ihres Verschlags erneut zu nähern. Die zwei Männer standen nun links und rechts der jungen Frau, die am Boden hockte. Ihr helles Kleid war völlig durchnässt. Keine der drei Personen hatte Sunita bisher gesehen, seit sie im Haus angekommen war. Der Größere der beiden Männer, ein muskelbepackter Hüne mit Pferdeschwanz, hatte die Frau an den langen dunklen Haaren gepackt und riss ihren Kopf immer wieder nach oben. Ihre schmerzverzerrte Miene sprach Bände. Der zweite Mann, untersetzt, mit schütterem hellblondem Haar, schlug der Frau wiederholt ins Gesicht, während er auf sie einschrie.
Tränen rollten der Gepeinigten über die Wangen, Rotz lief ihr aus der Nase und vermischte sich mit dem Blut, das aus der aufgeplatzten Unterlippe drang. Vergeblich versuchte sie, die Schläge mit den Händen abzuwehren. Sunita sah selbst auf diese Entfernung, wie ihr Gesicht begann anzuschwellen.
Ein Zittern lief durch ihren Körper. Sie ahnte, dass sie als Nächste dran sein würde und versuchte, sich auf die körperlichen Schmerzen einzustellen.
Dann geschah etwas Unerwartetes. Der Blonde öffnete seine Hose, und der Große stellte sich hinter die Frau, drehte ihr die Arme nach hinten und presste ihren Kopf zwischen seine Schenkel, während er ihr den Unterkiefer nach unten drückte. Der Blonde schob sich in sie hinein. So heftig und tief, dass seinem Opfer fast die Augen aus dem Kopf traten. Sunita wurde es übel, als sie die Bewegungen sah, die umgehend ein Würgen bei der Frau auslösten. Es passierte, was abzusehen war. Als der Blonde sich zurückzog, um erneut Schwung zu holen, wurde der Frau schlecht. Sie übergab sich, den Penis ihres Peinigers noch halb im Mund.
Sunita presste ihre Knöchel gegen die Lippen, um nicht entsetzt aufzuschreien. Der Blonde hatte wohl genug, er knöpfte sich die Hose wieder zu. Sein Kumpan drückte den Kopf der Frau in die Lache aus Erbrochenem vor ihr. Nur noch ein Wimmern war zu hören.
Sunita spürte, wie Tränen hinter ihren Augen aufstiegen. Vorsichtig kriechend zog sie sich von ihrem Beobachtungsposten zurück, bis sie mit dem Rücken an die Wand stieß. Sie zitterte am ganzen Leib, der Schrecken kroch über ihre Haut wie eine Schicht aus Eis.
Aus dem Kellerraum vor ihr drangen nun Geräusche, über deren Ursprung sie sich keine Gedanken mehr machen wollte. In hilflosem Entsetzen drückte sie beide Hände über die Ohren und presste die Augen fest zusammen. Sie konnte nicht verhindern, dass sie anfing zu weinen. Aber sie tat es lautlos. Diese Lektion hatte sie bereits gelernt.
Nach einer Weile bemerkte sie, dass sich etwas verändert hatte.
Vorsichtig blinzelte sie und nahm die Hände von den Ohren. Noch immer brannte draußen Licht. Von der anderen Frau war nichts mehr zu hören, aus den anderen Geräuschen schloss Sunita, dass die beiden Männer sie in ihr Gefängnis schleiften, wo sie sie liegen ließen. Die Tür wurde geschlossen, die Schritte kamen auf sie zu. Sunita wurde erneut übel, sie hielt die Hand vor den Mund, um nicht spucken zu müssen. Die Männer blieben stehen, direkt vor der Tür zu ihrem Verschlag.
***
Der Angriff kam völlig unerwartet. Lena war nach dem Telefonat mit Karin nervös, ihre Kopfschmerzen hämmerten und wollten nicht verschwinden. Daher hatte sie beschlossen, eine Runde spazieren zu gehen und anschließend ein Glas in der Weinstube in der Taunusstraße zu trinken.
Als sie ihr Rad auf dem Parkplatz am Mainufer unterhalb der Carl-Ulrich-Brücke festkettete, hörte sie in der Nähe eine Fahrradbremse quietschen. Unmittelbar darauf drückte sie jemand von hinten zu Boden und griff nach ihrer Tasche. Lena schrie erschrocken auf und brachte den rechten Arm nach vorn, um den Sturz abzufangen, gleichzeitig riss sie den linken Ellbogen nach hinten. Der Angreifer keuchte, als sie seinen Magen traf. Sie schlug hart auf dem Asphalt auf, rollte herum, zog die Beine an und kickte den Mann mit einem kräftigen Stoß weg. Er fiel, rappelte sich aber sofort wieder auf, bereit, sich erneut auf sie zu stürzen. Inzwischen waren zwei Jogger aufmerksam geworden. Sie kamen rufend auf sie zu gerannt. Lenas Angreifer drehte sich irritiert nach den schnell näher Kommenden um. Er machte angesichts dieser Situation keinen zweiten Versuch, Lena zu berauben, sondern rannte zu seinem am Boden liegenden Rad zurück, um zu flüchten.
»Sind Sie okay?«, fragte einer der Männer und beugte sich besorgt über sie. Derweil nahm sein Begleiter die Verfolgung auf.
»Alles klar. Mir ist nichts passiert«, keuchte Lena und erhob sich. »Er wollte meine Tasche.«
Der zweite Jogger kam zurück und schüttelte bedauernd den Kopf.
»Sorry, der Kerl ist mir entwischt. War zu schnell. Konnten Sie was erkennen?«
Lena überlegte kurz. »Kapuzenshirt, Sonnenbrille, Motorradmaske.«
»Sonnenbrille? Um diese Uhrzeit?« Die beiden Läufer schienen amüsiert. »Der muss an einer Abendlichtallergie leiden.«
»Oder nicht erkannt werden wollen«, setzte Lena trocken hinzu. Fakt war, dass sie den Mann nicht mal wiedererkannt hätte, wenn er direkt vor ihr gestanden hätte.
***
Sunita hatte vor Angst die Luft angehalten und zu allen ihr bekannten Göttern gebetet, sie vor dem Dämon zu beschützen. Tatsächlich schien ihr Hilferuf erhört worden zu sein, denn die beiden Männer vor dem Verschlag drehten ab. Das Licht erlosch, die Kellertür wurde zugeworfen.
Stoßweise atmete Sunita aus. Sie wusste jetzt definitiv, dass außer ihr noch eine andere Frau nur wenige Meter entfernt gefangen gehalten wurde. Wie es dieser jetzt ging, wagte sie sich nicht zu fragen. Sie hörte keine Geräusche mehr. Was hatte die Männer veranlasst zu gehen? Würden sie zurückkommen? Hatten sie genug oder machten sie lediglich eine Pause, um sie noch mehr zu ängstigen? Durch Sunitas Adern floss die Furcht vor einem Martyrium. Das hielt sie mehrere Stunden lang wach. Dann, urplötzlich, übermannte sie die Müdigkeit, sie schlief ein, den Rücken an die harte Mauer gepresst, den Kopf auf den Knien liegend.
Ein Geräusch, so beängstigend wie fremd, holte sie aus dem Schlaf. Ihr Herz raste. Sunita musste sich einen Moment lang orientieren. Wo war sie? Als sie die kalte Stille um sich herum wahrnahm, wusste sie es schlagartig wieder. Ihr Traum hatte sie in die warme, weiche Abendstimmung ihres Heimatdorfes geführt. Dort hatte sie zusammen mit Ebele am Feuer gesessen. Er hatte ihr Geschichten erzählt, und sie hatte sich nach der Berührung seiner vollen Lippen gesehnt. Umso erschreckender war es, in der Realität aufzuwachen.
Jemand stöhnte.
»Hallo! Kannst du mich hören?« Sunita kroch zur Tür ihres Verschlages. Ein schmerzvoller Laut war die einzige Antwort. »Ich bin neben dir«, versuchte sie es erneut, dieses Mal auf Englisch.
Die andere versuchte, etwas zu sagen. Es hörte sich an, als habe sie den Mund voll Sand.
»Ich heiße Sunita.« Sie fühlte sich hilflos. Was konnte sie ihrer Mitgefangenen denn schon groß anbieten? Die Frau musste sich nach allem, was sie durchlitten hatte, schrecklich fühlen. Es war so kalt im Keller, dass ihre Klamotten vermutlich immer noch nass waren.
»Wie ist dein Name?« Sie redete einfach immer weiter. Teils, um sich selbst zu beruhigen, teils aus Mitleid, um der Fremden zu helfen, mit der sie eine gewisse Solidarität fühlte.
Eine Weile blieb es still, dann zeigte ein raschelndes Geräusch an, dass sich drüben jemand bewegte. Ein unverständliches Wort drang schwach bis zu Sunita durch.
»Was ist passiert?«
Die Frau nebenan brauchte drei Anläufe für ein einziges Wort.
»Bestrafung«, verstand Sunita.
Dann hörte sie ein Schluchzen, das nicht mehr verebbte und jede weitere Konversation unmöglich machte.
Später, viel später, wurde es wieder ruhig in der Zelle nebenan. Doch jeder weitere Versuch von Sunita, Kontakt herzustellen, scheiterte. Die Frau war entweder eingeschlafen. Oder tot.
Kapitel 5
»Gott sei Dank, endlich Wochenende!« Adelheid Wormser stellte schwungvoll einen Becher mit Milchkaffee vor Lena auf den Schreibtisch und ließ sich ihr gegenüber auf einen Bürostuhl fallen.
»Machst du noch lange?«, wollte sie wissen.
Lena fuhr sich mit einer müden Geste durchs Haar. Die vergangenen Tage waren anstrengend gewesen. Die Gruppe hatte sich als angenehm motiviert herausgestellt, dennoch war die ungewohnte Tätigkeit für sie ermüdend.
Das Team für den Bewerbungskurs bestand aus vier Personen, die die Teilnehmer bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und der Suche nach Arbeitsplätzen unterstützten.
Sie waren mit allen die Lebensläufe durchgegangen, hatten Lücken gefüllt, sowie EDV- und weitere verwertbare Fachkenntnisse abgeklopft und Kompetenzprofile angelegt. Lenas Job war es, Einzelgespräche zu führen und den Kontakt zu dem jeweiligen Fallmanager zu halten. Einige Teilnehmer mussten zur Schuldnerberatung oder sollten Weiterbildungsangebote einholen.
Die erste Teambesprechung lief wegen Emilias Tod in gedämpfter Stimmung ab und war dennoch erfreulich ergiebig gewesen. Nach den Einstiegsgesprächen warteten in der kommenden Woche eher administrative Aufgaben auf Lena.
Am Vormittag war ein Polizist aufgetaucht, der Adelheid einige Fragen stellte. Er war bald wieder gegangen.
»Reine Routine. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Emilia Selbstmord begangen hat«, kommentierte Adelheid.
Lena nickte zerstreut. Ihre Finger trommelten gegen die Tasse. Sie betrachtete den vergilbten Aufdruck mit einer braun-weiß gefleckten Kuh, die an einem Strauch voller Kaffeebohnen nagte.
»Es will mir einfach nicht in den Kopf, dass Emilia solche Sorgen gehabt haben soll.«
Adelheid sah nachdenklich aus. »Sie war nicht immer ganz einfach.«
»Was meinst du damit? Ihre Hartnäckigkeit?«
Adelheid zuckte in einer hilflosen Geste die Schultern. »Nicht nur. Sie hatte, wenn sie sich im Recht glaubte, einen regelrechten Dickschädel. Da rennt man gelegentlich schon mal gegen die eine oder andere Wand. Und dann steht man alleine da. Damit kommt auch nicht jeder zurecht.«
»Du meinst hier? Bei euch?«
»Vermutlich nicht nur.« Adelheid blinzelte nervös. »Im Landratsamt doch sicher ebenfalls.«
Lena schüttelte langsam den Kopf. »Es gab immer mal wieder Diskussionen um fachliche Dinge. Aber mir ist nichts derartig Gravierendes bekannt, was der Auslöser für das sein könnte, was passiert ist.«
Einen Moment lang schwiegen die beiden Frauen, dann erhob sich Adelheid mit einem Seufzer. »Wir werden es wohl nie erfahren«, meinte sie mit einem Achselzucken.
Lena spürte, dass etwas Ungesagtes in der Luft lag. Die stellvertretende Einrichtungsleiterin wich ihrem Blick aus, als sie ihr nun ein schönes Wochenende wünschte und eilig davonging.
Es war bereits fünf Uhr vorbei, als Lena auf dem nahegelegenen Parkplatz eines Supermarktes zwei Tüten mit Einkäufen in den Kofferraum ihres Wagens stellen wollte. Dabei sah sie, dass Emilias Aktentasche noch immer darin lag.
»Die habe ich bei der ganzen Aufregung ja total vergessen«, murmelte sie. Einen Moment lang überlegte sie, ins Büro zurückzukehren, entschied sich aber dagegen. Sie würde die Tasche mit nach Hause nehmen und Adelheid am Montagmorgen übergeben.
Sie stieg in den Wagen und lenkte ihn zur Mörfelder Landstraße. Während sie darauf wartete, in den Kreisel dort einfahren zu können, wechselten die in der Mitte angebrachten Stelen mehrfach die Farbe. Sie schob eine CD ein und fuhr zur belebenden Musik von Chaka Khans »Foolish Fool« zur Auffahrt der A661 und von dort aus weiter nach Offenbach.
***
»Fräulein Borowski!«
Die Stimme der Kasulke schallte Lena entgegen, kaum dass sie die Haustür geöffnet hatte. Lena seufzte innerlich. Sie hatte es schon längst aufgegeben, der Hausmeisterin zu erklären, dass sie die Bezeichnung »Fräulein« nicht unbedingt schätzte.
»Frau Kasulke«, antwortete sie, so neutral wie möglich.
»Die Polizei war da«, erklärte ihr die kleine grauhaarige Frau. Ihre Augen huschten nervös und neugierig umher.
Lena erschrak. Wenn man sie zu ihrer Beziehung zu Emilia befragen wollte, hätte man das doch auch im Büro machen können. Warum kamen die Beamten zu ihr nach Hause?
»Ach ja?«, sagte sie und versuchte, ihrer Stimme einen unaufgeregten Klang zu verleihen.
»Was wollten sie denn?«
Die Kasulke sah sie jetzt direkt an, so etwas wie Mitleid im Blick.
»Bei Ihnen ist eingebrochen worden.«
»Was?« Lena spürte einen heftigen Stich im Magen. Viel zu holen war bei ihr nicht, aber das Gefühl, jemand könnte in ihre Privatsphäre eingedrungen sein, verursachte ihr Übelkeit.
»Ja. Zwei Männer. Ich habe sie ins Haus kommen sehen.« Die Kasulke deutete auf ihre halb offen stehende Wohnungstür, in der sich das riesige runde Glas eines Spions befand. »Schließlich muss ich doch aufpassen hier«, fügte sie noch hinzu.
»Sie haben die Einbrecher entdeckt?«
»Ich wusste natürlich nicht, was sie vorhaben, aber sie sahen merkwürdig aus. Als ich leise nach oben gegangen bin, hörte ich es. Sie waren an Ihrer Tür.«
Lena stellte sich vor, wie Frau Kasulke mit ihren weichen Filzpantoffeln lautlos durch den Treppenflur huschte, bis in den dritten Stock.
»Ich muss sofort nach oben«, stöhnte sie.
»Keine Panik. Die Mieter über ihnen haben es auch mitbekommen und die beiden verscheucht. Die Polizei erschien sofort, als ich sie gerufen habe. Leider sind die Verbrecher entwischt. Gott sei Dank ohne großen Schaden anzurichten. Aber – ein neues Schloss brauchen Sie schon.«
»Danke, dass Sie so aufmerksam waren.« Lena hätte nicht gedacht, dass sie die unstillbare Neugier dieser Frau einmal schätzen würde.
Als sie oben ankam, sah sie bereits, was passiert war. Die Einbrecher hatten versucht, das Türschloss aufzubohren, waren aber nicht in die Wohnung gekommen. Lena hatte ein Sicherheitsschloss und eine zusätzliche Verriegelung, was vermutlich der Grund dafür war, dass dieser Versuch glimpflich abgelaufen war. Sie rief den Schlüsseldienst, und weil sie selbst jetzt nicht in ihre Wohnung konnte, nahm sie unterdessen – widerstrebend – Frau Kasulkes Angebot an, bei ihr zu warten. In der kleinen Erdgeschosswohnung war alles blitzblank und ordentlich. Es roch allerdings durchdringend nach Erbsensuppe.
Die Hausmeisterin bugsierte Lena in ihre Wohnküche im Fünfzigerjahre-Look, wo Lena auf einer Eckbank Platz nahm.
»Trinken Sie einen!« Die Kasulke schob ihr ein Schnapsglas mit einer durchsichtigen Flüssigkeit zu. »Das ist gut für die Nerven, das brauchen Sie nach diesem Schreck.«
Lena zwang sich ein Lächeln ins Gesicht und schüttete den Hochprozentigen in sich hinein. Vielleicht würde er ihr helfen, dieses Beisammensein zu überstehen. Der Schnaps brannte, verteilte aber gleichzeitig kräftige Aromen nach Zwetschge und Mirabelle an Lenas Gaumen.
»Schmeckt gut«, sagte sie überrascht.
»Selbstgebrannt. Das habe ich schon als junge Frau von meinem späteren Ehemann gelernt«.
»Haben Sie denn einen Garten?«
»Hinten beim Buchraingebiet. Bei mir wachsen Zwetschgen, Mirabellen und Äpfel. Dazu alles, was man sonst so braucht. Für meinen kleinen Haushalt reicht es, ich wecke vieles selbst ein.« Ihr Knöchel klopfte gegen ein hohes Einmachglas voller Gemüse.
»Alle Achtung!«, entfuhr es Lena, bei der außer einem Topf Basilikum nichts überlebte.
»Solange die Knochen noch mitmachen.« Die Hausmeisterin ließ ihre Finger krachen.
»Sie sind doch fit«, meinte Lena höflich. Sie wusste, dass die Ältere viele Wege zu Fuß oder mit dem Rad erledigte.
Die Kasulke grinste und blickte ihr Gegenüber so aufmerksam an, als sähe sie sie zum ersten Mal. Lena fielen sämtliche Versäumnisse, die Putzwoche betreffend, ein. Doch ihre Gesprächspartnerin schien andere Gedanken im Kopf zu haben.
»Wissen Sie, was ich mich gefragt habe?« Die Worte wurden von einer zweiten Runde begleitet. Lena schüttelte den Kopf zu spät, das Glas war schon wieder voll. So trank sie dieses Mal nur in kleinen Schlucken von dem Obstwasser. Sie hatte noch nichts gegessen, und der Alkohol stieg ihr zu Kopf.
»Warum die schnurstracks in den dritten Stock gegangen sind. Die hätten mindestens zwei andere Türen in diesem Haus viel leichter knacken können.«
Lena verstand, was sie meinte. Eine der Wohnungstüren im ersten Stock erinnerte an Pappmaché, so dünn war sie. Jedes Geräusch drang von drinnen nach draußen, und das alte Schloss war recht einfach. In einer der Wohnungen in der zweiten Etage sah es ähnlich aus.
»Keine Ahnung. Ich habe nichts Wertvolles. Die wären vermutlich enttäuscht gewesen.« Das zweite Glas war auch schon leer. Frau Kasulke füllte trotz Lenas Protest noch einmal auf.
»Das waren finstere Gestalten, im wahrsten Sinne des Wortes.«
»Wie meinen Sie das?« Lenas Hirn bewölkte sich bereits.
»Einer war ein Neger«, verkündete Frau Kasulke mit tiefer gelegter Stimme.
Lena beschloss sofort, keine Diskussion über dieses Wort zu führen. Sie würde sich nicht in die Nesseln setzen. Die Hausmeisterin war politisch nicht korrekt, da war Hopfen und Malz verloren. Ausdrücke wie »Fräulein« und »Neger« sprachen Bände.
»Aha«, murmelte sie daher bloß.
»Gut, dass Sie so massive Schlösser haben«, befand die Kasulke unterdessen und nickte Lena zu, bevor sie das Glas ansetzte und kippte.
Was soll’s, dachte Lena und tat es ihr nach.
Die Kasulke setzte ihr Glas hart ab und schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. »Das hätte ich ja fast vergessen. Hier, das hat der Polizist für Sie dagelassen.« Sie kramte eine Visitenkarte aus ihrer Kittelschürze. »Sie sollen sich melden, wenn noch etwas ist oder Sie was für die Versicherung brauchen.«