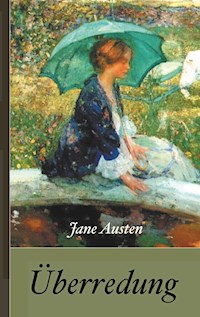8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Jane Austen gelang mit ihrem ersten großen Roman »Gefühl und Vernunft« ein Geniestreich – eine Geschichte, die die Leser bis heute nicht zur Ruhe kommen lässt. Die Anziehungskraft ihrer Charaktere ist ungebrochen. Elinor und Marianne sind so gegensätzlich wie Schwestern es nur sein können: Während Marianne ihr Herz auf der Zunge trägt, macht die vernünftige Elinor innere Konflikte mit sich alleine aus und scheint kühl, wenngleich es in ihr brodelt. Nach dem Tod ihres Vaters mittellos geworden, müssen sich die beiden ihren Weg durch eine Gesellschaft bahnen, in der vor lauter Pflichten kaum Platz für wahre Sehnsüchte bleibt. Der Wunsch nach einer ehrlichen Liebe treibt sie dabei immer wieder auf Irrpfade …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Jane Austen
Gefühl und Vernunft
Roman
Über dieses Buch
Die Geschichte der Schwestern Elinor und Marianne ist reich an großen Gefühlen und tiefgründigen Figuren, an strahlenden Bildern und verblüffenden Wendungen. Sie steckt voller Lebendigkeit, denn sie zeigt das pure Leben mit all seinen Facetten zwischen Gefühl und Vernunft: Elinor besticht mit ihrem klaren Verstand und bewahrt auch in den erschütternsten Momenten Ruhe und Weitsicht. Marianne trägt ihr Herz auf der Zunge und verbirgt nie, was sie bewegt. Beide vereint eine Sehnsucht, die stärker ist als jede gesellschaftliche Pflicht: Sie hoffen, am Ende des langen, kurvenreichen Weges eine ehrliche Liebesehe zu finden ...
»Austen verbindet in ’Gefühl und Vernunft’ elegant das scheinbar
Widersprüchliche: scharfe Beobachtung und zartes Verstehen, Farce und Drama, Wortwitz und Moral.«
Die Zeit
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Deutsche Erstausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englische Originalausgabe ›Sense and Sensibility‹ erschien erstmals 1811 (in überarbeiteter Fassung 1813)
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012
Covergestaltung: •••••
Coverabbildung: •••••
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402272-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Erstes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Zweites Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Drittes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Anhang
Zeittafel zum Leben Jane Austens
Virginia Woolf
Editorische Notiz
Biographische Notiz
Erstes Buch
1. Kapitel
Die Dashwoods waren seit langem in Sussex ansässig. Ihr Besitz war groß, und sie wohnten mitten darin auf Norland Park, wo sie schon seit vielen Generationen ein respektables Leben führten, wohlangesehen unter all ihren Nachbarn. Der letzte Gutsherr war ein unverheirateter Mann gewesen, der uralt geworden war und über viele Jahre seines Lebens seine Schwester zur Gefährtin und Haushälterin gehabt hatte. Deren Tod allerdings, zehn Jahre vor seinem eigenen, hatte in dem Haushalt zu großen Veränderungen geführt, denn als Ausgleich für den Verlust hatte er seinem Neffen, Mr Henry Dashwood, dem rechtmäßigen Erben des Besitzes, dem er ihn auch zu hinterlassen gedachte, angeboten, bei ihm zu wohnen, und ihn mit seiner Familie bei sich aufgenommen. In der Gesellschaft seines Neffen mit Frau und Kindern verbrachte der alte Herr behaglich seine Tage und schloss sie alle in sein Herz. Mr und Mrs Henry Dashwood lasen ihm jeden Wunsch von den Lippen ab, nicht aus Eigennutz, sondern aus echter Warmherzigkeit; er genoss alle Aufmerksamkeit, die ein Mann seines Alters sich wünschen konnte, und die Fröhlichkeit der Kinder war die Freude seiner alten Tage.
Aus einer früheren Ehe hatte Mr Henry Dashwood einen Sohn, von seiner jetzigen Frau drei Töchter. Der Sohn, ein ruhiger, verlässlicher junger Mann, war aus dem Erbe seiner Mutter wohlversorgt; es war beträchtlich, und die Hälfte davon war ihm mit seiner Volljährigkeit zugefallen. Bald darauf hatte er geheiratet und seinen Wohlstand damit noch weiter gemehrt. Für ihn war also das Erbe des Gutes Norland von nicht so großer Bedeutung wie für seine Schwestern, denn deren Vermögen, jenseits dessen, was ihnen durch den Vater in Aussicht stand, würde nicht groß ausfallen. Die Mutter besaß nichts, und ihr Vater verfügte selbst nur über siebentausend Pfund, denn die zweite Hälfte des Vermögens seiner ersten Frau war ebenfalls dem Sohn vermacht, und ihm standen lediglich auf Lebenszeit die Einkünfte daraus zu.
Der alte Herr starb; sein Testament wurde verlesen und bescherte, wie es zu sein pflegt, ebenso viel Verdruss wie Freude. Er war weder so ungerecht noch so undankbar gewesen, dass er seinem Neffen den Besitz vorenthalten hätte; aber er vermachte ihn ihm unter Bedingungen, die ihn zugleich wieder um den halben Nutzen der Erbschaft brachten. Mr Dashwood hatte auf das Erbe eher um seiner Frau und seiner Töchter willen als um seinet- und seines Sohnes willen gehofft – doch an den Sohn und an dessen Sohn, einen Jungen von gerade einmal vier Jahren, ging das Vermächtnis, und das in einer Form, die es ihm nicht gestattete, diejenigen, die ihm am meisten am Herzen lagen und die seiner Unterstützung am meisten bedurften, zu versorgen, indem er den Besitz belieh oder dessen wertvolle Wälder verkaufte. Alles war so eingerichtet, dass es nur diesem Jungen zugute kam, der bei gelegentlichen Besuchen mit Vater und Mutter auf Norland so sehr die Zuneigung seines Großonkels gewonnen hatte – mit Attraktionen, die bei Kindern von zwei oder drei Jahren keineswegs ungewöhnlich sind: närrischer Rede, Starrköpfigkeit, kleinen Streichen und einer großen Menge Lärm –, dass diese mehr wogen als all die Aufmerksamkeiten, die er über Jahre hinweg von seiner Nichte und deren Töchtern erfahren hatte. Aber er wollte nicht herzlos sein, und als Zeichen seiner Zuneigung zu den drei Mädchen hinterließ er jeder von ihnen eintausend Pfund.
Anfangs war Mr Dashwood tief enttäuscht; aber er war ein Mann von heiterem, zuversichtlichem Wesen, und er konnte damit rechnen, dass er noch viele Jahre zu leben hatte und von dem, was der ohnehin schon einträgliche Besitz, der sich zudem ohne großen Aufwand besser bewirtschaften ließ, einbrachte, ein gutes Stück beiseitelegen konnte, wenn er nur sparsam lebte. Doch das Glück, das sich so spät eingestellt hatte, sollte ihm nur ein Jahr lang beschieden sein. Um so weniges überlebte er seinen Onkel, und zehntausend Pfund, die jüngsten Erbschaften mit eingeschlossen, waren alles, was für Witwe und Töchter blieb.
Man schickte nach seinem Sohn, sofort als man sah, dass er nicht mehr lange zu leben hatte, und diesem befahl Mr Dashwood mit aller Kraft und Dringlichkeit, derer er in seiner Krankheit noch fähig war, das Wohl seiner Stiefmutter und seiner Schwestern an.
Anders als die übrige Familie war Mr John Dashwood kein Mann starker Gefühle, doch eine solche Ermahnung zu solch einer Zeit verfehlte ihre Wirkung nicht, und er versprach, alles, was in seinen Kräften stehe, zu tun, damit ihnen ein angenehmes Leben möglich werde. Die Zusicherung nahm seinem Vater die Last von der Seele, und Mr John Dashwood hatte nun Muße, sich zu überlegen, wie viel wohl vernünftigerweise in seinen Kräften stand.
Er war kein übelgesinnter junger Mann, es sei denn, man wollte ein reichlich kaltes Herz und ein reichlich selbstsüchtiges Wesen als übelgesinnt ansehen, und hatte alles in allem einen durchaus guten Ruf, denn er war stets anständig in alltäglichen Dingen. Hätte er eine liebenswertere Frau geheiratet, so hätte man wohl einen noch respektableren Menschen aus ihm machen können; womöglich wäre er sogar selbst liebenswert geworden, denn er war sehr jung, als er die Ehe einging, und sehr verliebt in seine Frau. Doch Mrs John Dashwood war das Zerrbild ihres Mannes – kaltherziger als er und selbstsüchtiger als er.
Als er seinem Vater das Versprechen gab, nahm er sich vor, den Wohlstand seiner Schwestern um ein Geschenk von je eintausend Pfund zu mehren. Dazu fühlte er sich in der Lage. Die Aussicht auf viertausend Pfund im Jahr zusätzlich zu seinem gegenwärtigen Einkommen, dazu noch die zweite Hälfte des mütterlichen Vermögens, das wärmte ihm das Herz, und er fand, dass er sich Großzügigkeit leisten konnte. – Ja, er würde ihnen dreitausend geben: das war vornehm, das war stattlich! Es reichte für ein Leben ohne alle Sorgen. Dreitausend Pfund! Eine so beträchtliche Summe konnte er erübrigen, und sie würde ihm kaum fehlen. – Den ganzen Tag lang dachte er darüber nach, und noch viele weitere Tage, und er bereute es nicht.
Kaum war der Vater unter der Erde, traf Mrs John Dashwood ein, ohne dass sie ihre Schwiegermutter von ihrer Absicht in Kenntnis gesetzt hätte, mit Kind und Dienerschaft. Niemand konnte bestreiten, dass sie ein Recht dazu hatte; nun, wo der Vater tot war, gehörte das Haus ihrem Mann; doch umso taktloser erschien ihr Benehmen, und für eine Frau in Mrs Dashwoods Lage wäre ein solches Betragen eine Zumutung gewesen, selbst wenn ihre Gefühle nur durchschnittlicher Natur gewesen wären; für sie hingegen, mit ihrem so unerschütterlichen Sinn für Ehre, ihrer so romantischen Großzügigkeit, konnte ein Verstoß von solchen Ausmaßen, ganz gleich wer ihn beging und wer darunter zu leiden hatte, nur Grund für einen grenzenlosen Abscheu sein. Mrs John Dashwood war in der Familie ihres Mannes nie gut angesehen gewesen; doch bisher hatte sie keine Gelegenheit gehabt, ihnen zu zeigen, wie wenig Sinn für das Wohl anderer sie an den Tag legen konnte, wenn die Umstände es geboten.
So sehr litt Mrs Dashwood unter dieser Taktlosigkeit, so tief verachtete sie ihre Schwiegertochter dafür, dass sie nach deren Eintreffen das Haus ein für allemal verlassen hätte, hätte nicht die Fürsprache ihrer ältesten Tochter sie bewogen, über die Verhältnismäßigkeit eines solchen Schrittes nachzudenken, und aus Liebe zu allen drei Mädchen war sie dann doch geblieben und hatte um ihretwillen den Bruch mit deren Bruder vermieden.
Elinor, diese älteste Tochter, die mit ihrem Rat so großen Einfluss hatte, war von scharfem Verstand und nüchternem Urteil, beides Dinge, die sie schon mit neunzehn zur Ratgeberin ihrer Mutter befähigten und mit denen sie zum Wohle aller stets dem unbedachten Sinn von Mrs Dashwood entgegentrat, der ungezähmt zu mancher Voreiligkeit geführt hätte. Sie war ein grundguter Mensch, empfindsam von Natur, mit starken Gefühlen; aber sie wusste diese Gefühle zu beherrschen: eine Kunst, die ihre Mutter erst noch erlernen musste und von der die eine ihrer beiden Schwestern bereits geschworen hatte, dass sie diese niemals erlernen werde.
Marianne war in vielem nicht minder begabt als Elinor. Sie war aufmerksam und klug, doch ungestüm in allem; ihr Kummer, ihre Freuden kannten kein Maß. Sie war großzügig, liebenswert, anziehend; nur vorsichtig war sie nicht. Die Ähnlichkeit zwischen ihr und ihrer Mutter war verblüffend.
Elinor sah mit Sorge die Übermacht des Gefühls bei ihrer Schwester, doch Mrs Dashwood schätzte sie und bestärkte sie darin noch. Nun trieben sich die beiden gegenseitig in ihrem Kummer an. Den Schmerz, der sie zunächst überwältigt hatte, durchlebten sie mit Genuss noch einmal, sehnten sich nach ihm, ja inszenierten ihn immer wieder neu. Sie gaben sich ganz ihrem Leid hin, fanden Gram in jedem Gedanken, in dem er sich finden ließ, und waren überzeugt, dass keine Zukunft, wie immer sie aussehen mochte, sie je trösten konnte. Auch Elinor war tief betrübt, aber sie konnte kämpfen, sie gab nicht auf. Sie konnte sich mit ihrem Bruder beraten, die Schwägerin begrüßen, als diese eintraf, und so aufmerksam sein, wie der Anstand es gebot; und sie konnte versuchen, ihre Mutter zu ähnlicher Anstrengung anzuhalten, ihr Mut zu ähnlicher Zähigkeit machen.
Margaret, die dritte Schwester, war ein freundliches, gutmütiges Mädchen; doch Marianne hatte sie bereits mit ihrer romantischen Art angesteckt, ohne dass sie deren Verstand gehabt hätte, und mit dreizehn war noch nicht abzusehen, ob sie es später im Leben einmal mit ihren Schwestern würde aufnehmen können.
2. Kapitel
Mrs John Dashwood richtete sich als neue Herrin auf Norland ein, und ihre Schwiegermutter und ihre Schwägerinnen waren nun Gäste im eigenen Haus. Als solche behandelte sie die vier allerdings mit einer dezenten Höflichkeit, und ihr Mann brachte ihnen so viel Freundlichkeit entgegen, wie er überhaupt jemand anderem als sich selbst, seiner Frau und ihrem gemeinsamen Kind entgegenbringen konnte. Er drängte sie tatsächlich, und das nicht ohne Aufrichtigkeit, Norland weiterhin als ihr Zuhause anzusehen; und da Mrs Dashwood sich nichts sehnlicher wünschte, als dort zu bleiben, bis sie ein passendes Haus in der Umgebung gefunden hatte, nahm sie sein Angebot an.
An einem Ort zu bleiben, wo jede Kleinigkeit sie an vormalige Freuden erinnerte, war ganz nach ihrem Geschmack. Wenn das Leben fröhlich war, konnte kein Mensch fröhlicher sein als sie und mit jener Gewissheit auf das Glück vertrauen, die schon selbst das Glück ist. Doch dasselbe Temperament betrübte sie umso mehr im Leid, und dann war sie genauso untröstlich wie ihr an guten Tagen nichts ihre gute Laune nehmen konnte.
Mrs John Dashwood behagte das, was ihr Mann für seine Schwestern zu tun gedachte, ganz und gar nicht. Das Vermögen ihres lieben Jungen um dreitausend Pfund zu schmälern, das hieße ja, ihn regelrecht in Armut zu stürzen. Sie drängte ihren Gatten, über die Angelegenheit noch einmal nachzudenken. Wie konnte er es mit seinem Gewissen vereinbaren, seinem Kind, seinem einzigen Kind dazu, eine so große Summe vorzuenthalten? Und welchen Anspruch sollten die Misses Dashwood, die ja schließlich nur seine Halbschwestern waren, was für ihre Begriffe überhaupt keine Verwandtschaft war, auf seine Großzügigkeit und einen dermaßen großen Betrag haben? Jedermann wisse, dass zwischen den Kindern aus verschiedenen Ehen eines Mannes niemals Zuneigung bestehe; und wieso wolle er sich und ihren armen kleinen Harry an den Bettelstab bringen, indem er sein sämtliches Geld seinen Halbschwestern gab?
»Es war der letzte Wille meines Vaters«, antwortete ihr Ehemann, »dass ich seiner Witwe und seinen Töchtern beistehen soll.«
»Er wusste doch gar nicht mehr, wovon er sprach; ich wette zehn zu eins, dass sein Verstand schon getrübt war. Wäre er bei Sinnen gewesen, wäre er gar nicht auf den Gedanken gekommen, von dir zu fordern, dass du das halbe Vermögen deines eigenen Kindes verschenkst.«
»Er hat keine bestimmte Summe genannt, meine liebe Fanny; er trug mir nur ganz allgemein auf, ihnen zur Seite zu stehen und ihnen ein angenehmeres Leben zu schaffen, als in seinen Kräften stand. Er hätte es ebenso gut ganz in mein Ermessen stellen können. Schließlich wird er sich ja wohl kaum vorgestellt haben, dass ich sie im Stich lasse. Doch da er das Versprechen von mir forderte, konnte ich es ihm natürlich nicht verweigern – so schien es mir jedenfalls zu der Zeit. Das Versprechen wurde also gegeben, und es muss gehalten werden. Sie brauchen meine Unterstützung, wenn sie Norland verlassen und in ein eigenes Haus ziehen.«
»Ja dann unterstütze sie; aber es müssen ja nicht gleich dreitausend Pfund sein. Du musst bedenken«, fügte sie hinzu, »dass du das Geld nie zurückbekommst, wenn du es einmal hergegeben hast. Deine Schwestern werden heiraten, und dann ist es ein für alle Mal fort. Ja, wenn die Aussicht bestünde, dass es unserem armen kleinen Jungen jemals zurückerstattet würde …«
»Allerdings«, sagte ihr Mann sehr nachdenklich, »das wäre etwas ganz anderes. Es mag eine Zeit kommen, zu der Harry es bedauern wird, dass eine so große Summe fortgegeben wurde. Etwa wenn er einmal eine große Familie hätte, da wäre es ein willkommenes Zubrot.«
»Allerdings.«
»Es wäre also vielleicht für alle Beteiligten besser, wenn die Summe halbiert würde. – Fünfhundert Pfund wären eine beträchtliche Aufbesserung ihres Vermögens!«
»Oh! Mehr als sie sich jemals träumen lassen könnten. Welcher Bruder auf Erden würde auch nur halb so viel für seine Schwestern tun, selbst wenn es wirklich seine Schwestern wären! Und hier in diesem Fall – gerade einmal Halbgeschwister! – Aber du bist ein so großzügiger Mann!«
»Ich würde nichts tun wollen, was kleinlich ist«, entgegnete er. »Bei solchen Gelegenheiten sollte man eher zu viel als zu wenig tun. Und keiner könnte sagen, ich hätte nicht genug für sie getan: auch sie selbst können wohl kaum mehr erwarten.«
»Niemand weiß, was sie erwarten«, erwiderte seine Frau, »aber an ihre Erwartungen sollten wir nicht denken: die Frage ist, was du dir leisten kannst.«
»Gewiss – und ich denke, fünfhundert Pfund für jede kann ich mir leisten. Selbst ohne dass ich etwas dazulege, kann ja jede von ihnen mit über dreihundert Pfund rechnen, wenn ihre Mutter stirbt – ein mehr als angenehmes Vermögen für eine junge Frau.«
»Allerdings. Und wenn ich das bedenke, dann scheint mir doch, sie brauchen nichts darüber hinaus. Sie bekommen zehntausend Pfund, die sie unter sich aufteilen. Wenn sie heiraten, können sie sicher sein, dass sie damit eine gute Partie machen, und wenn nicht, dann können sie alle zusammen von den Zinsen der zehntausend Pfund bequem leben.«
»Da hast du nur zu recht, und deshalb überlege ich, ob es nicht alles in allem vernünftiger wäre, etwas für ihre Mutter zu tun, solange sie am Leben ist, und nicht für sie – etwas in der Art einer Rente, meine ich. Die käme meinen Schwestern ebenso zugute wie ihr selbst. Einhundert im Jahr, und sie könnten allesamt sorglos leben.«
Doch seine Frau zögerte ein wenig bei ihrer Zustimmung zu diesem Plan.
»Es ist besser, als sich von fünfzehnhundert Pfund auf einen Schlag zu trennen, das steht fest. Doch wenn Mrs Dashwood noch fünfzehn Jahre lebt, dann ist es unser Ruin.«
»Fünfzehn Jahre! meine liebe Fanny; mit Sicherheit hat sie nicht einmal halb so viel zu erwarten.«
»Gewiss nicht; aber wenn du dich umsiehst – Leute leben ewig, wenn man ihnen erst einmal eine Rente aussetzt; und sie ist kräftig und gesund und noch nicht einmal vierzig. Eine Rente ist eine gefährliche Sache; Jahr für Jahr muss man zahlen, und hat man sich einmal verpflichtet, dann wird man sie nicht wieder los. Du siehst gar nicht, worauf du dich einlässt. Immer wieder habe ich erlebt, zu welchen Unannehmlichkeiten Renten führen; meine Mutter hatte sie, im Testament meines Vaters verfügt, an drei uralte Diener zu zahlen, und du kannst dir gar nicht vorstellen, was für eine Belastung es für sie war. Zweimal im Jahr musste sie zahlen; und dann wusste man nicht, wie man es ihnen zukommen lassen sollte; einmal hieß es, einer von ihnen sei gestorben, und später stellte sich heraus, dass es überhaupt nicht stimmte. Was war das für meine Mutter eine Last! Ihr Geld gehöre ihr ja überhaupt nicht, sagte sie, wenn so bis in alle Ewigkeit darüber verfügt würde; und das war umso rücksichtsloser von meinem Vater, als das Geld ihr ansonsten ganz zur Verfügung gestanden hätte, ohne alle Einschränkungen. Das hat in mir eine solche Abscheu gegen Renten hervorgebracht, dass ich mich um nichts in der Welt selbst festlegen möchte, so etwas zu zahlen.«
»Natürlich ist es keine schöne Sache«, erwiderte Mr Dashwood, »wenn man solcherart mitansehen muss, wie das eigene Vermögen Jahr für Jahr schrumpft. Das Geld, da hatte deine Mutter ganz recht, gehört einem im Grunde nicht. Dass man verpflichtet ist, an jedem Fälligkeitstag eine solche Summe herzugeben, ist alles andere als wünschenswert – man ist ja gar nicht mehr sein eigener Herr.«
»Unzweifelhaft; und Dank bekommt man am Ende keinen dafür. Sie fühlen sich in Sicherheit, in ihren Augen tut man nicht mehr, als sie von einem erwarten können, und deshalb gibt es auch keinen Dank. Ich an deiner Stelle würde nur etwas tun, was ganz in meinem Ermessen steht. Ich würde mich nicht binden und ihnen einen jährlichen Betrag aussetzen. In manchen Jahren könnte es sehr unangenehm sein, wenn wir uns hundert oder auch nur fünfzig Pfund von unseren eigenen Ausgaben absparen müssten.«
»Ich glaube, da hast du recht, meine Liebe; in dem Falle ist es wohl doch besser, wenn wir keine Rente aussetzen; was immer ich ihnen gelegentlich zustecke, wird ihnen eine viel größere Hilfe sein als ein jährliches Einkommen, denn wenn sie sich einer regelmäßigen Summe sicher sein könnten, würde sie das nur zu einem aufwendigeren Leben ermuntern, und am Ende des Jahres wären sie um keinen Penny reicher dadurch. Es ist mit Sicherheit besser so. Ein Geschenk von fünfzig Pfund dann und wann, das wird genügen, um dafür zu sorgen, dass sie niemals in Geldnot sind, und ich werde, denke ich, das Versprechen, das ich meinem Vater gegeben habe, immer noch großzügig erfüllen.«
»Das wirst du mit Sicherheit. Unter uns gesagt, ich bin mir sicher, dass dein Vater überhaupt nicht daran gedacht hat, dass du ihnen Geld geben sollst. Gewiss dachte er dabei an nicht mehr als das, was man mit Fug und Recht von dir erwarten kann; dass du ihnen zum Beispiel ein komfortables kleines Häuschen suchst, dass du ihnen hilfst, ihre Sachen dorthin zu bringen, ihnen ab und zu einen Fisch oder ein Stück Wild als Geschenk schickst und so weiter, je nach Saison. Ich würde mein Leben darauf wetten, dass er nicht mehr als das meinte; ja, es wäre unnatürlich und unvernünftig, wenn er mehr gefordert hätte. Überlege doch nur, mein lieber Dashwood, wie bequem, ja wie luxuriös deine Stiefmutter und ihre Töchter von den Zinsen von siebentausend Pfund leben können, zumal ja jedes der Mädchen selbst noch tausend Pfund hat, was jeder noch einmal fünfzig pro Jahr einbringt, und von diesem Geld werden sie ihrer Mutter natürlich Unterkunft und Verpflegung zahlen. Alles in allem werden sie zusammen fünfhundert Pfund im Jahr haben, ja und lieber Himmel, wozu brauchen vier Frauen denn mehr als das? – Sie können so günstig leben! Der Haushalt wird kaum zu Buche schlagen. Sie werden keine Kutsche haben, keine Pferde, so gut wie keine Dienstboten; sie werden keine Gäste bewirten und können ja eigentlich überhaupt keine Ausgaben haben! Stell dir doch nur vor, wie gut sie da leben können! Fünfhundert im Jahr! Ich muss sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie auch nur die Hälfte davon ausgeben sollen; da ist es doch eine aberwitzige Vorstellung, dass du ihnen noch mehr geben könntest. Eher könnten sie dir etwas geben.«
»Bei meiner Ehre«, sagte Mr Dashwood, »ich glaube, da hast du vollkommen recht. Mit Sicherheit hat mein Vater mit seiner Bitte an mich nicht mehr gemeint als das, was du sagst. Jetzt sehe ich es klar und deutlich, und ich werde meiner Verpflichtung mit genau den Hilfeleistungen und Freundlichkeiten nachkommen, die du mir genannt hast. Wenn meine Mutter von hier fortzieht, will ich ihr gern zur Hand gehen, soweit es in meinen Kräften steht. Zu dem Zeitpunkt könnte man auch daran denken, ihr ein kleines Möbelstück als Geschenk zu überlassen.«
»Gewiss«, erwiderte Mrs John Dashwood. »Eines darf man dabei allerdings nicht vergessen. Als deine Eltern nach Norland zogen, wurde zwar das Mobiliar von Stanhill verkauft, doch sämtliches Geschirr und alles Leinen kam mit hierher und geht jetzt an deine Mutter. Ihr Haus wird also vollständig ausgestattet sein, wenn sie dort einzieht.«
»Das ist ein Punkt, der wohlbedacht sein will. Ein Erbe von beträchtlichem Wert! Manches von dem Silber hätte ja das, was wir besitzen, durchaus bereichern können.«
»Ja; und das Frühstücksgeschirr ist doppelt so schön wie das, das hier zum Haus gehört. Viel zu prächtig, finde ich, für alles, was sie sich jemals leisten könnten. Aber so ist es. Dein Vater hat ja nur an sie gedacht. Und das will ich noch sagen: viel Dank bist du ihm nicht schuldig, auch keine große Treue gegenüber seinen Wünschen, denn wir wissen ja nur zu genau, dass er ihnen so gut wie alles hinterlassen hätte, wenn er nur gekonnt hätte.«
Dieses Argument war unwiderstehlich. Es verlieh seinen Entschlüssen alles an Entschiedenheit, was ihnen noch gefehlt haben mochte; und er war sich nun sicher, dass es vollkommen überflüssig, ja sogar unziemlich war, für die Witwe und Töchter seines Vaters mehr zu tun als genau jene nachbarschaftlichen Gefälligkeiten, die seine Frau ihm bezeichnet hatte.
3. Kapitel
Mrs Dashwood blieb noch mehrere Monate auf Norland; nicht dass sie, als erst einmal die Gefühlswallungen beim Anblick jedes wohlvertrauten Winkels verebbten, nicht gern fortgezogen wäre, denn als die Lebensgeister zurückkehrten und ihr Verstand wieder einer anderen Regung fähig war als des Kummers der schmerzlichen Erinnerungen, in den sie sich immer weiter hineingesteigert hatte, da konnte sie den Aufbruch gar nicht erwarten und war unermüdlich auf der Suche nach einer passenden Unterkunft in der Umgebung von Norland – weit von diesem geliebten Ort fortzuziehen war unvorstellbar. Doch sie hörte von nichts, was zum einen ihren Begriffen von Komfort und Bequemlichkeit, zum anderen aber auch der Umsicht ihrer ältesten Tochter gerecht geworden wäre, deren vernünftigerer Verstand manches Anwesen als zu groß für ihr Einkommen verwarf, das ihre Mutter gern genommen hätte.
Mrs Dashwood war von ihrem Gatten über das feierliche Versprechen, das er seinem Sohn abgenommen hatte und das ihm in seinen letzten irdischen Gedanken ein Trost gewesen war, unterrichtet worden. Sie zweifelte an der Aufrichtigkeit dieses Versprechens genauso wenig, wie er selbst daran gezweifelt hatte, und um ihrer Töchter willen dachte sie mit Befriedigung daran, obwohl sie, was sie persönlich anging, fand, dass sie mit weit weniger als siebentausend Pfund noch gut versorgt gewesen wäre. Auch für den Bruder der Mädchen, für dessen eigenes Herz, freute sie sich; und sie machte sich Vorwürfe, dass sie je schlecht von ihm gedacht und ihn für außerstande zu jeder Großzügigkeit gehalten hatte. Die Aufmerksamkeit, mit der er sie und ihre Töchter behandelte, überzeugte sie davon, dass ihm ihr Wohlergehen am Herzen lag, und lange Zeit vertraute sie fest auf seine großmütigen Absichten.
Die Verachtung, die sie beinahe vom ersten Tag an für ihre Schwiegertochter empfunden hatte, wurde noch um vieles stärker, als sie ihren Charakter näher kennenlernte, wozu ihr das halbe Jahr, das sie in ihrem Haushalt verbrachte, viel Gelegenheit bot; und selbst bei dem Maß an Höflichkeit und mütterlicher Zuneigung, über das sie gebot, hätten die beiden es wohl kaum so lange miteinander ausgehalten, hätte sich nicht ein Umstand dazugesellt, der es in den Augen von Mrs Dashwood mehr als wünschenswert machte, dass ihre Töchter weiter auf Norland blieben.
Bei diesem Umstand handelte es sich um eine immer größere Zuneigung zwischen ihrer Ältesten und dem Bruder von Mrs John Dashwood, einem vornehmen und angenehmen jungen Mann, den sie kennenlernten, kurz nachdem seine Schwester von Norland Besitz ergriffen hatte, und der seither den Großteil seiner Zeit dort verbracht hatte.
Manche Mütter hätten diese Beziehung aus Berechnung gefördert, denn Edward Ferrars war der älteste Sohn eines Mannes, der sehr reich gestorben war; manche hätten sie aber auch aus Vorsicht unterbunden, denn bis auf eine geringe Summe hing sein ganzer Wohlstand von der Willkür seiner Mutter ab. Doch Mrs Dashwood ließ sich weder von der einen noch von der anderen Erwägung beirren. Ihr genügte es, dass er, nach allem, was sie sah, ein liebenswerter Mann war, dass er ihrer Tochter zugetan war und dass Elinor diese Zuneigung erwiderte. Es widersprach all ihren Prinzipien, dass Vermögensunterschiede einem Paar im Wege stehen sollten, das sich durch Seelenverwandtschaft zueinander hingezogen fühlte; und dass nicht jeder, der sie kannte, Elinors Wert schätzte, war ihr ohnehin unvorstellbar.
Edward Ferrars hatte sich diese gute Meinung nicht durch eine eindrucksvolle Erscheinung oder die Eleganz seiner Manieren verdient. Er war nicht allzu stattlich, und man musste ihn gut kennen, bevor man seinen Umgang angenehm fand. Er war zu zaghaft, um zu zeigen, was in ihm steckte; doch war die Schüchternheit seines Wesens erst einmal überwunden, sprach sein ganzes Betragen von einem aufgeschlossenen, teilnehmenden Herzen. Er war ein intelligenter Mann, und Bildung hatte diese Begabung noch gefördert. Doch besaß er weder Fähigkeit noch Neigung, seiner Mutter und seiner Schwester gefällig zu sein, die ihn als Mann sehen wollten, der es zu etwas brachte – zu –, ja, sie wussten eigentlich gar nicht so recht zu was. Sie wollten, dass er irgendwie in der Welt zu Ansehen kam. Seine Mutter wünschte, dass er sich für Politik interessierte, dass er einen Sitz im Parlament bekam, sie wollte ihn zusammen mit den bedeutenden Männern seiner Zeit sehen. Mrs John Dashwood dachte ebenso; doch in der Zwischenzeit, bis dieser Ruhm sich einstellte, wäre sie schon zufrieden gewesen, wenn er sich einen Landauer zugelegt hätte. Doch Edward hatte für große Männer genauso wenig Sinn wie für Landauer. Sein ganzes Streben erschöpfte sich in dem Wunsch nach häuslicher Bequemlichkeit und dem Frieden eines zurückgezogenen Lebens. Zum Glück hatte er einen jüngeren Bruder, von dem mehr zu erhoffen war.
Edward hatte schon mehrere Wochen im Haus verbracht, ohne dass Mrs Dashwood ihm groß Beachtung geschenkt hatte, denn so angegriffen war ihr Zustand, dass sie die Dinge in ihrer Umgebung kaum noch wahrnahm. Ihr fiel nichts weiter auf, als dass er still und unaufdringlich war, und dafür mochte sie ihn. Er störte sie in ihrem Elend nicht mit unpassender Konversation. Das Erste, was ihre Aufmerksamkeit auf ihn lenkte, so dass sie ihn fortan mehr beachtete, war eine Bemerkung, die Elinor eines Tages machte; nämlich wie verschieden er und seine Schwester doch seien. Und dieser Unterschied empfahl ihn ihrer Mutter sehr.
»Das genügt«, sagte sie, »allein dass man sagt, er ist nicht wie Fanny, das genügt. Da weiß man, dass er ein liebenswerter Mann ist. Ich liebe ihn schon jetzt.«
»Ich denke, du wirst ihn mögen«, sagte Elinor, »wenn du mehr über ihn weißt.«
»Ihn mögen!«, erwiderte ihre Mutter lächelnd. »Ich kenne kein Gefühl der Zuneigung, das geringer ist als die Liebe.«
»Du könntest ihn schätzen.«
»Nie in meinem Leben habe ich zwischen lieben und schätzen unterschieden.«
Nun unternahm Mrs Dashwood Anstrengungen, ihn näher kennenzulernen. Mit ihrer gewinnenden Art hatte sie seine Abwehr bald durchbrochen. Binnen kurzem sah sie all seine guten Seiten; vielleicht erleichterte ihr die Überzeugung, dass er etwas für Elinor empfand, die Annäherung; aber sie war sich der Tatsache, dass er ein Mann von Wert war, sicher; und selbst seine stille Art, die all ihren sonstigen Vorstellungen davon, wie das Betragen eines jungen Mannes sein sollte, entgegenstand, sprach durchaus für ihn, als sie erst einmal sein warmes Herz und sein liebenswürdiges Wesen erkannt hatte.
Kaum hatte sie in seinem Verhalten Anzeichen von Liebe zu Elinor entdeckt, da stand für sie fest, dass die beiden ein Paar waren, und sie erwartete ihre Heirat binnen kurzem.
»In ein paar Wochen, meine liebe Marianne«, sagte sie, »ist Elinor wohl fürs Leben versorgt. Uns wird sie fehlen; aber sie selbst wird glücklich sein.«
»Ach, Mama! Wie sollen wir je ohne sie auskommen?«
»Meine Liebe, es wird ja kaum eine richtige Trennung sein. Wir werden nur ein paar Meilen voneinander entfernt wohnen und uns jeden Tag sehen. Du bekommst einen Bruder, einen echten, treusorgenden Bruder. Ich habe eine Meinung von Edward, die höher gar nicht sein könnte; aber du blickst finster, Marianne. Gefällt dir die Wahl deiner Schwester denn nicht?«
»Vielleicht«, sagte Marianne, »bin ich einfach nur überrascht. Edward ist ein guter Mensch, und ich liebe ihn von Herzen. Und doch – ist er nicht die Art von jungem Mann – es fehlt etwas – seine Erscheinung beeindruckt nicht; er hat nichts von der Anmut, die ich bei einem Mann erwartet hätte, der meine Schwester ernsthaft fesseln kann. In seinen Augen finde ich nichts von dem Geist, dem Feuer, die von Tugend und Klugheit gleichermaßen künden. Und außerdem fürchte ich, Mama, er hat keinen Geschmack. Musik scheint ihn so gut wie gar nicht zu interessieren, und auch wenn er Elinors Zeichnungen noch so sehr bewundert, ist es doch nicht die Bewunderung eines Menschen, der ihren wahren Wert erfasst. Sicher, er sieht ihr beim Zeichnen zu, aber man merkt sofort, dass er nichts davon versteht. Er bewundert als Liebender, nicht als Kenner. Wenn es mich zufriedenstellen soll, dann muss beides in einer Person vereint sein. Ich könnte nicht glücklich mit einem Mann sein, dessen Geschmack nicht in allen Punkten mit meinem eigenen übereinstimmt. Er muss all meine Gefühle teilen; dieselben Bücher, dieselbe Musik müssen uns beide bezaubern. Ach, Mama! wie seelenlos, wie langweilig war seine Art, als er uns gestern Abend vorgelesen hat! Meine Schwester hat mir so leidgetan. Und doch ertrug sie es mit so viel Fassung; sie schien es kaum zu bemerken. Mich hat es fast nicht auf meinem Platz gehalten. Diese wundervollen Zeilen, die mich oft schier zur Raserei getrieben haben, gelesen mit so unerschütterlicher Ruhe, solch entsetzlicher Gleichgültigkeit!«
»Bestimmt wäre er einfacher, eleganter Prosa besser gerecht geworden. So ist es mir gestern Abend schon vorgekommen; aber du musstest ihm ja Cowper geben.«
»Wenn Cowper nicht seine Lebensgeister weckt, Mama! – aber wir dürfen nicht erwarten, dass unser Geschmack derselbe ist. Elinor empfindet nicht mit der gleichen Tiefe wie ich, und vielleicht macht es ihr ja nichts aus, und sie wird glücklich mit ihm. Aber mir hätte es das Herz gebrochen, wäre ich diejenige, die ihn liebt, wenn ich ihn mit so wenig Gefühl hätte lesen hören. Mama, je mehr ich von der Welt kennenlerne, desto mehr bin ich überzeugt, dass mir niemals ein Mann begegnen wird, den ich lieben kann. Ich verlange so viel! Er muss alle Tugenden Edwards besitzen, und sein Äußeres und seine Manieren müssen seiner Güte den größten Reiz verleihen.«
»Vergiss nicht, meine Liebe, du bist noch nicht einmal siebzehn. Noch viel zu früh im Leben, um an der Möglichkeit eines solchen Glücks zu verzweifeln. Warum sollte es dir nicht ebenso gut ergehen wie deiner Mutter? Nur in einem wünsche ich dir, meine liebe Marianne, dass es dir anders ergeht als ihr!«
4. Kapitel
»Was für ein Jammer, Elinor«, sagte Marianne, »dass Edward keinen Sinn für die Zeichenkunst hat.«
»Keinen Sinn für die Zeichenkunst?«, entgegnete Elinor, »wieso denn das? Sicher, er zeichnet nicht selbst, aber es bereitet ihm großes Vergnügen, die Arbeiten anderer zu betrachten; glaube mir, von Natur aus mangelt es ihm keineswegs an Geschmack, er hat nur einfach bisher keine Gelegenheit gehabt, ihn auszubilden. Hätte er es je gelernt, ich bin sicher, dann würde er sehr gut zeichnen. Er misstraut in allem seinem eigenen Urteil so sehr, dass er immer nur mit Unwillen seine Meinung zu einem Bild preisgibt; aber er hat einen natürlichen Sinn für Harmonien und einen unverbildeten Geschmack, und meist findet er genau zum richtigen Urteil damit.«
Marianne wollte ihre Schwester nicht kränken und sagte nichts weiter zu dem Thema; doch die freundliche Anerkennung, die er nach Elinors Beschreibung den Werken anderer entgegenbrachte, war weit entfernt von jener verzückten Begeisterung, die nach ihren Begriffen allein den Namen Geschmack verdiente. In Gedanken lächelte sie über diesen Irrtum ihrer Schwester, und sie hielt ihr die blinde Zuneigung zu Edward zugute.
»Ich hoffe, Marianne«, fuhr Elinor fort, »du willst damit nicht sagen, er habe keinen Geschmack. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du das denkst, so herzlich, wie du immer mit ihm umgehst, und wenn du das dächtest, ich bin sicher, dann hättest du kein freundliches Wort für ihn.«
Marianne wusste nicht recht, was sie darauf sagen sollte. Sie wollte auf gar keinen Fall die Gefühle ihrer Schwester verletzen, und doch war es ihr unmöglich, etwas zu sagen, woran sie nicht glaubte. Nach einer ganzen Weile antwortete sie:
»Sei mir nicht böse, Elinor, wenn ich seine Verdienste nicht in allem so hoch schätze wie du. Anders als du hatte ich noch nicht so viel Gelegenheit, all die angenehmen Züge seines Verstandes, seiner Vorlieben und seines Geschmacks zu ergründen; aber ich bin vollkommen überzeugt, dass er ein guter und vernünftiger Mensch ist. Er scheint mir in jeder Hinsicht anständig und liebenswert.«
»Nicht einmal seine besten Freunde«, entgegnete Elinor lächelnd, »könnten mit so einem Lob unzufrieden sein. Freundlicher hättest du es gar nicht sagen können.«
Marianne war überglücklich, dass ihre Schwester so schnell zufrieden war.
»An seinem Verstand und seiner Güte«, fuhr Elinor fort, »kann wohl niemand mehr zweifeln, der erst einmal so weit mit ihm vertraut ist, dass er freimütig mit ihm redet. Dass er ein gebildeter Mann ist, ein Mann von Prinzipien, verbirgt nur die Zurückhaltung, die ihn so oft schweigen lässt. Du kennst ihn gut genug, du kennst seine Qualitäten. Und was die angenehmen Züge seines Verstandes, wie du sie nennst, angeht, so haben die Umstände dir weniger Gelegenheit gegeben, sie kennenzulernen, als mir. Er und ich haben viel Zeit miteinander verbracht, in der du dich ganz, und mit schönster Zuneigung, unserer Mutter gewidmet hast. Ich habe ihn oft gesehen, habe seine Gefühle studiert und seine Einstellungen kennengelernt, seine Meinung zu Fragen der Literatur und des Geschmacks gehört, und ich glaube, ich kann sagen, dass sein Geist wohlgebildet ist, dass er eine außerordentliche Freude an Büchern hat, eine lebendige Phantasie, dass seine Sicht der Dinge angemessen und vernünftig ist, sein Geschmack unverfälscht und feinsinnig. In allen seinen Eigenschaften gewinnt er an Wert, je besser man ihn kennt, nicht weniger als in seinen Manieren und in seiner Erscheinung. Auf den ersten Blick ist er nicht beeindruckend, das weiß ich; und man kann ihn auch nicht gerade schön nennen, jedenfalls nicht, bis man die Augen, die so außerordentlich freundlich blicken, überhaupt das Wohlwollende seiner ganzen Erscheinung, bemerkt. Ich kenne ihn mittlerweile so gut, dass er mir tatsächlich wie ein schöner Mann erscheint; oder doch beinahe. Was meinst du, Marianne?«
»Bald werde ich ihn schön finden, Elinor, auch wenn ich es jetzt noch nicht tue. Wenn du mir sagst, dass ich ihn als Schwager lieben soll, werde ich in seinem Antlitz ebenso wenig Unvollkommenheit sehen wie jetzt in seinem Herzen.«
Bei diesen Worten erschrak Elinor und bereute, dass sie sich hatte hinreißen lassen, mit solcher Wärme von ihm zu sprechen. Nach ihren Maßstäben mochte sie Edward sehr. Sie war überzeugt, dass diese Wertschätzung erwidert wurde; aber sie brauchte größere Gewissheit, bis sie Gefallen an Mariannes Überzeugung finden konnte, dass sie beide ein Paar seien. Sie kannte Marianne und ihre Mutter und wusste, dass für beide das, was sie im einen Augenblick vermuteten, im nächsten schon Tatsache war und dass bei ihnen der Wunsch Hoffnung und die Hoffnung Gewissheit war. Sie versuchte, ihrer Schwester den wahren Stand der Dinge zu erklären.
»Ich will gar nicht leugnen«, sagte sie, »dass ich große Stücke auf ihn halte – dass ich ihn sehr schätze; dass ich ihn mag.«
Marianne schnaubte vor Empörung.
»Du schätzt ihn! Magst ihn! Kaltherzige Elinor! Ach! schlimmer als kaltherzig! Zu allem anderen fehlt dir der Mut. Sag noch einmal diese Worte, und ich verlasse auf der Stelle das Zimmer.«
Elinor musste lachen. »Entschuldige«, sagte sie, »und glaube mir, ich meine es nicht böse, wenn ich in so leisen Tönen von meinen eigenen Gefühlen rede. Stelle sie dir stärker vor, als sie klingen; ja stelle dir vor, dass es genau die sind, die seinem Wert und der Vermutung – der Hoffnung –, dass er etwas für mich empfindet, angemessen sind, nur ohne Übertreibung und ohne Leichtsinn. Aber mehr als das sollst du dir nicht vorstellen. Ich habe keinen Beweis, dass er mehr für mich empfindet. Es gibt Momente, da zweifle ich am Maß seiner Zuneigung; und solange die Dinge nicht klarer sind, kannst du mir nicht verübeln, dass ich nicht will, dass man mir Hoffungen macht und mehr hineinliest, als es ist. In meinem Herzen spüre ich kaum einen – ja eigentlich gar keinen Zweifel an dem, was er für mich empfindet. Aber andere Dinge müssen bedacht sein, nicht nur seine Neigung. Er ist alles andere als unabhängig. Was für ein Mensch seine Mutter wirklich ist, wissen wir nicht; aber nach dem, was Fanny über ihre Ansichten und ihr Betragen sagt, haben wir keinen Grund, sie für liebenswürdig zu halten; und ich müsste mich sehr täuschen, wenn es Edward nicht selbst bewusst wäre, dass er viele Schwierigkeiten zu überwinden hätte, wollte er eine Frau heiraten, die weder ein großes Vermögen vorzuweisen hat noch einen hohen Rang.«
Marianne konnte nur staunen, wie weit ihre Phantasie und die ihrer Mutter der Wahrheit vorausgeeilt waren.
»Dann bist du also gar nicht verlobt!«, rief sie. »Aber bestimmt kommt das bald. Und wenn es länger dauert, hat es immerhin zweierlei Vorteil. Ich muss dich nicht so schnell hergeben, und Edward hat mehr Zeit, etwas über deine liebste Beschäftigung zu lernen, und das ist wichtig für euer zukünftiges Glück. Ach! wenn dein Talent ihn doch anregen könnte, selbst zu zeichnen! Das wäre wunderschön!«
Was Elinor zu ihrer Schwester gesagt hatte, entsprach in allem ihrer Überzeugung. Sie hatte keinen Grund, ihre Zuneigung zu Edward als so stark ausgeprägt anzusehen, wie Marianne geglaubt hatte. Bisweilen zeigte sich an ihm ein Mangel an Lebensfreude, der, wenn man ihn nicht als Zeichen von Gleichgültigkeit auffassen wollte, von etwas beinahe ebenso Unerfreulichem sprach. Ein Zweifel an dem, was sie für ihn empfand – wenn man sich einmal vorstellte, dass er solche Zweifel hegte –, hätte sich in nicht mehr als einer gewissen Unruhe geäußert. Das allein hätte wohl kaum jene Niedergeschlagenheit hervorgebracht, in der man ihn oft antraf. Wahrscheinlicher war, dass seine Abhängigkeit, die es ihm nicht gestattete, seiner Zuneigung freien Lauf zu lassen, der Grund dafür war. Sie wusste, dass seine Mutter ihm dieser Tage weder bei sich ein angenehmes Zuhause bot, noch ihn darin unterstützte, ein eigenes zu erlangen, wenn dies nicht eindeutig zu jenem höheren Rang führte, den sie für ihn erstrebte. Und da sie dies wusste, war das Thema für Elinor ein ewiger Quell des Missvergnügens. Sie war weit davon entfernt, auf jenes Ergebnis seiner Zuneigung zu bauen, das ihre Mutter und ihre Schwester weiterhin als Gewissheit ansahen. Nein, je länger sie ihn kannte, desto größer wurden ihre Zweifel, ob er wirklich etwas für sie empfand; und manchmal kam es ihr ein paar schmerzliche Minuten lang vor, als ob es nichts weiter als Freundschaft sei.
Doch so unscheinbar diese Zuneigung auch sein mochte, war sie doch groß genug, dass seine Schwester, als sie sie bemerkte, sich beunruhigte; und das stimmte sie unhöflicher denn je. Sie nutzte die erste Gelegenheit, ihre Schwiegermutter wegen der Angelegenheit vor den Kopf zu stoßen, und sprach so ausdrücklich von den Aussichten ihres Bruders, von Mrs Ferrars’ entschiedener Absicht, dafür zu sorgen, dass beide Söhne gute Partien machten, und von der Gefahr, die jede junge Frau einging, die auf den Gedanken kam, ihn sich zu angeln, dass Mrs Dashwood weder so tun konnte, als habe sie die Absicht nicht verstanden, noch die Ruhe bewahren konnte. Sie gab ihr eine Antwort, aus der die Verachtung sprach, welche sie empfand, und verließ sofort darauf den Raum. Egal wie unbequem oder kostspielig ein so plötzlicher Aufbruch sein mochte, beschloss sie auf der Stelle, dass ihre geliebte Elinor nicht eine einzige Woche mehr solchen Anspielungen ausgesetzt sein sollte.
In dieser Verfassung war sie, als die Post einen Brief für sie brachte, und darin fand sie einen Vorschlag, der gelegener gar nicht kommen konnte. Man bot ihr ein kleines Haus an, zu äußerst günstigen Bedingungen; ein Haus, das einem Verwandten von ihr gehörte, einem wohlhabenden und angesehenen Gentleman in Devonshire. Den Brief hatte dieser Herr selbst geschrieben, und er war beseelt vom Geiste wahrer Gastfreundschaft. Er habe gehört, dass sie eine Unterkunft suche, und das Haus, das er hiermit anbiete, sei zwar nur ein Cottage, doch er versichere ihr, dass alles getan werden solle, was sie für notwendig halte, sofern ihr das Angebot zusage. Nachdem er Haus und Garten beschrieben hatte, bat er sie inständig, mit ihren Töchtern nach Barton Park zu kommen, seinem eigenen Wohnsitz, dann könne sie selbst entscheiden, ob Barton Cottage – beide Häuser gehörten zur selben Gemeinde – sich mit ein paar Umbauten für sie herrichten lasse. Er schien geradezu begierig, sie als Gäste zu begrüßen, und der ganze Brief war in einem so freundlichen Ton gehalten, dass seine entfernte Cousine nur hocherfreut sein konnte, gerade zu einem Zeitpunkt, wo sie unter dem kalten und gefühllosen Betragen näherer Verwandter so sehr zu leiden hatte. Sie brauchte keine Bedenkzeit, sie holte keine Erkundigungen ein. Ihr Entschluss fiel schon beim Lesen. Die Lage von Barton, in einem Landstrich so weit von Sussex entfernt wie Devonshire – ein Umstand, der noch wenige Stunden zuvor alles, was dieses Haus eventuell an Vorzügen aufzuweisen hatte, aufgewogen hätte –, war nun seine größte Empfehlung. Aus der Gegend von Norland fortzuziehen war kein Übel mehr, es war ein wünschenswertes Ziel; es war ein Segen im Vergleich zu dem Elend, in dem sie als Gäste ihrer Schwiegertochter lebten: und das geliebte Haus für immer zu verlassen, würde weniger schmerzlich sein, als dort zu bleiben oder zu Besuch zu kommen, solange eine solche Frau dort herrschte. Sie schrieb sogleich an Sir John Middleton, dankte ihm für sein Angebot und nahm es an; dann eilte sie zu ihren Töchtern und zeigte ihnen beide Briefe, um sich ihrer Zustimmung zu versichern, bevor sie die Antwort zur Post gab.
Elinor war von Anfang an der Ansicht gewesen, dass es vernünftiger wäre, wenn sie sich in etwas größerer Entfernung von Norland niederließen und nicht in unmittelbarer Nähe derer, bei denen sie jetzt lebten. So hatte sie keinen Grund, ihrer Mutter bei ihren Umzugsplänen nach Devonshire zu widersprechen. Und das Haus, so wie Sir John es beschrieb, war von so einfacher Art, und die Pacht war so außerordentlich niedrig, dass sie auch in diesen beiden Punkten nichts einzuwenden hatte; und auch wenn die Aussicht ihre Gedanken nicht gerade beflügelte und sie weiter von Norland fortzogen, als sie sich gewünscht hätte, versuchte sie nicht, ihrer Mutter den Plan auszureden, und ließ sie den Antwortbrief schicken.
5. Kapitel
Kaum war die Antwort abgeschickt, gönnte Mrs Dashwood sich das Vergnügen, ihrem Stiefsohn und dessen Frau mitzuteilen, dass sie ein Haus gefunden habe und ihnen nur noch so lange zur Last fallen werde, bis alles für den Einzug bereit sei. Sie staunten beide, als sie das hörten. Mrs John Dashwood sagte nichts; ihr Ehemann antwortete höflich, er hoffe, das neue Heim liege nicht gar zu weit von Norland. Zu ihrer großen Genugtuung konnte sie ihm antworten, sie ziehe nach Devonshire. Als er das vernahm, drehte sich Edward mit einem Ruck nach ihr um und rief mit einer Überraschung und Betroffenheit, die für ihre Begriffe keine Erklärung brauchten: »Devonshire! Dorthin wollen Sie ziehen! So weit fort von hier! Und in welche Gegend dort?« Sie beschrieb ihm die Lage, vier Meilen nördlich von Exeter.
»Es ist nur ein Cottage«, fuhr sie fort, »aber ich hoffe trotzdem, dass mich viele meiner Freunde dort besuchen kommen. Ein oder zwei Zimmer lassen sich leicht anbauen, und wenn meinen Freunden die weite Reise nicht zu beschwerlich ist, dann wird es gewiss auch mir nicht zu viel sein, sie unterzubringen.«
Sie schloss mit einer ausgesprochen freundlichen Einladung an Mr und Mrs Dashwood, sie doch in Barton zu besuchen; und Edward gegenüber wiederholte sie diese Einladung mit umso größerer Herzlichkeit. Nach ihrer letzten Unterhaltung mit ihrer Schwiegertochter war sie zwar fest entschlossen, nicht länger als unbedingt nötig auf Norland zu bleiben, aber in der Sache, um die es dabei gegangen war, hielt sie an ihren Ansichten fest. Edward und Elinor zu trennen lag so wenig in ihrer Absicht wie eh und je, und sie wollte Mrs John Dashwood mit dieser Einladung an ihren Bruder auch beweisen, wie wenig sie auf ihre Missbilligung dieser Verbindung gab.
Mr John Dashwood wurde nicht müde, seiner Mutter zu versichern, wie außerordentlich leid es ihm tue, dass sie ein Haus in so großer Entfernung von Norland gewählt hatte, dass es ihm nicht möglich sein werde, ihr beim Transport ihres Hausrats behilflich zu sein. Es war ein Umstand, der ihn tatsächlich quälte; denn gerade das, worauf er die Auslegung seines Versprechens an den Vater beschränkt hatte, war durch diese Wahl unmöglich geworden. – Der Hausrat wurde per Lastkahn verschickt. Er bestand im Wesentlichen aus Wäsche, Silber, Geschirr und Büchern, dazu kam Mariannes prachtvolles Pianoforte. Mrs John Dashwood begleitete den Abtransport mit einem Seufzer; sie fand es schlichtweg empörend, dass Mrs Dashwood, deren Einkommen im Vergleich zu dem ihren so gering war, überhaupt so etwas wie Hausrat besaß.
Mrs Dashwood mietete das Haus zunächst für ein Jahr; es war vollständig möbliert, und sie konnte sofort einziehen. Sie und ihr Verwandter waren sich rasch einig, und sie wartete nur, bis ihre Sachen aus Norland verschickt waren und alles für den neuen Haushalt bereit war, dann machte sie sich in Richtung Westen auf den Weg; und da alles, wozu sie sich einmal entschieden hatte, ihr stets außerordentlich schnell von der Hand ging, war es bald getan. – Die Pferde, die ihr Mann ihr vermacht hatte, waren gleich nach seinem Tod verkauft worden, und als sich nun ein Interessent für die Kutsche fand, verkaufte sie auf Anraten ihrer ältesten Tochter auch diese. Wäre es nur nach ihren eigenen Wünschen gegangen, so hätte sie sie zur Bequemlichkeit ihrer Töchter behalten; doch Elinors Vernunft setzte sich durch. Dieselbe Vernunft befand auch, dass sie sich nicht mehr als drei Dienstboten leisten konnten; zwei Mädchen und einen Hausdiener, die sich sogleich unter denen fanden, die zu ihrem Haushalt auf Norland gehört hatten.
Der Diener und eins der Dienstmädchen wurden unverzüglich nach Devonshire geschickt, um das Haus für die Ankunft ihrer Herrschaft herzurichten; denn Mrs Dashwood kannte Lady Middleton noch nicht persönlich und wollte lieber gleich in das Cottage einziehen, statt zunächst als Gast nach Barton Park zu kommen; und da sie keinerlei Zweifel hegte, dass Sir John ihr alles korrekt beschrieben hatte, wollte sie es auch nicht vorab inspizieren, sondern es erst beim Einzug zum ersten Mal sehen. Dass der Wunsch, Norland zu verlassen, nicht nachließ, dafür sorgte die offensichtliche Befriedigung ihrer Schwiegertochter bei der Aussicht auf diesen Auszug, und die kühl vorgebrachte Bitte, doch noch länger zu bleiben, konnte die wahre Gesinnung nicht verbergen. Dies war der Zeitpunkt, zu dem es sich mehr denn je angeboten hätte, dass ihr Stiefsohn nun das Versprechen, das er seinem Vater gegeben hatte, mit Anstand erfüllte. Da er es bei seinem Eintreffen auf dem Besitz versäumt hatte, hätte man den Tag, an dem sie sein Haus verließen, als den passenden angesehen, um seiner Verpflichtung nachzukommen. Doch es dauerte nicht lange, bis Mrs Dashwood alle Hoffnung aufgegeben hatte und nun überzeugt war, dass sie keine weitere Unterstützung von ihm zu erwarten hatten als die sechs Monate Kost und Logis auf Norland. Immer wieder kam er darauf, dass die Lebenshaltungskosten weiter stiegen, und auf die Ansprüche, die alle Welt an seine Börse stelle und denen ein Mann von einem gewissen Wohlstand über die Maßen ausgesetzt sei, so dass er schließlich eher als jemand dastand, der selbst Geld brauchte, denn als jemand, der es verschenkte.
Nur wenige Wochen nach dem Eintreffen von Sir John Middletons Brief auf Norland war in ihrem zukünftigen Heim alles so weit geregelt, dass Mrs Dashwood und ihre Töchter sich auf die Reise machen konnten.
Viele Tränen flossen, als sie dem Ort Lebewohl sagen mussten, den sie so sehr geliebt hatten. »Du liebes, liebes Norland!«, seufzte Marianne, als sie am letzten Abend allein vor dem Haus spazieren ging, »wann werde ich dich wohl nicht mehr vermissen? – wann lernen, mich anderswo zu Hause zu fühlen? Ach! glückliches Haus, wenn du wüsstest, was ich leide, wenn ich dich jetzt von diesem Platz hier sehe, von dem ich dich vielleicht nie wieder sehen werde! Und ihr, ihr wohlbekannten Bäume! – doch ihr ändert euch nicht. – Kein Blatt wird welken, nur weil wir nicht mehr da sind, kein Zweiglein stillstehen, nur weil wir nicht mehr sehen können, wie ihr euch regt! – Nein, ihr bleibt, wie ihr seid; ihr wisst nichts von dem Kummer oder der Freude, die ihr bewirkt, ihr spürt nicht, wie es denen, die in eurem Schatten wandeln, ums Herz ist! – Aber wer ist jetzt noch da, der sich über euch freuen kann?«
6. Kapitel
Der erste Teil der Reise verlief in so melancholischer Stimmung, dass sie nur mühsam und unbequem sein konnte. Doch als sie sich dem Ziel näherten, gewann die Neugier, mit der sie die Landschaft betrachteten, in der sie nun leben sollten, die Oberhand, und als sie ins Tal von Barton einbogen, waren sie bereits guter Dinge. Es war ein lieblicher, fruchtbarer Ort, mit viel Wald und üppigen Weiden. Eine gute Meile folgten sie seinem gewundenen Lauf, dann langten sie bei ihrem Haus an. Ein kleiner grüner Vorgarten war alles, was vorn zum Häuschen gehörte, und ein schmuckes Törchen gewährte Einlass dazu.
Das Haus selbst, Barton Cottage, war zwar klein, doch praktisch und komfortabel; allerdings war es nicht ganz das, was man sich unter einem Cottage vorstellte, denn die Wände waren gerade, das Dach war mit Schindeln gedeckt, die Fensterläden waren nicht grün, und an den Mauern rankte kein Geißblatt. Ein schmaler Flur führte durch das ganze Haus in den Garten dahinter. Beiderseits des Eingangs gab es je ein Wohnzimmer, an die sechzehn Fuß im Quadrat, und dahinter lagen die Wirtschaftsräume und die Treppe. Vier Schlafzimmer und zwei Dachkammern bildeten den Rest des Hauses. Es stand noch nicht lange, und sein Zustand war gut. Doch wie klein und armselig es im Vergleich zu Norland war! Die Tränen der Erinnerung, die beim Eintreten flossen, waren allerdings bald getrocknet. Es tröstete sie, dass die Dienstboten sich so über ihre Ankunft freuten, und jeder nahm sich dem anderen zuliebe vor, glückliche Miene zu machen. Es war Anfang September; das Wetter war heiter, und dass sie ihre erste Bekanntschaft mit Haus und Umgebung bei schönem Wetter machten, sorgte für einen günstigen Eindruck, der viel dazu beitrug, dass sie sich gern auf Dauer einrichteten.
Die Lage des Hauses war gut. Unmittelbar dahinter erhoben sich die Berge und in nicht allzu großer Entfernung auch zu beiden Seiten; einiges davon war offenes Heideland, anderes war bebaut und waldig. Das Dorf Barton lag hauptsächlich auf einem dieser Hügel und war von den Fenstern des Häuschens schön anzusehen; zu Füßen erstreckten sich die Ausläufer des Tals, und der Blick ging weit ins Land hinaus. Die Hügel rings um das Cottage bildeten in dieser Richtung den Abschluss des Tals; unter anderem Namen und in anderer Richtung führte es jedoch zwischen zweien der steilsten Erhebungen noch weiter hinauf.
Mit Größe und Ausstattung des Hauses war Mrs Dashwood alles in allem zufrieden; zwar mussten sie, damit sie weiterhin leben konnten wie zuvor, zu letzterer noch manches hinzufügen, doch das Haus zu verschönern war ihr ein Vergnügen, und sie hatte zu der Zeit genügend Bargeld, um zu kaufen, was in den Zimmern noch fehlte. »Das Haus selbst«, sagte sie, »ist mit Sicherheit zu klein für uns, aber wir werden es uns bequem machen, so gut es geht, denn für Umbauten ist es schon zu spät im Jahr. Im Frühling vielleicht, wenn ich genug Geld beisammen habe – und ich denke, das habe ich –, können wir ans Bauen denken. Die Wohnzimmer sind beide zu klein für die Gesellschaft unserer Freunde, die ich gern oft hier versammelt sähe; und ich überlege, ob wir nicht den Durchgang und vielleicht noch einen Teil des anderen zu einem der beiden hinzufügen können, und aus dem Rest des zweiten könnten wir einen Eingang machen; zusammen mit einem neuen Wohnzimmer, das sich leicht anbauen lässt, mit einem weiteren Schlafzimmer und der Dachkammer darüber hätten wir ein schmuckes kleines Häuschen. Ich wünschte, die Treppe wäre großzügiger. Aber man darf nicht alles erwarten; allerdings wäre es wohl auch kein großer Aufwand, sie zu verbreitern. Ich werde sehen, was ich im Frühjahr übrig habe, und dann planen wir unseren Umbau.«
In der Zwischenzeit, bis all diese Verschönerungen Wirklichkeit wurden, finanziert aus den Überschüssen eines Einkommens von fünfhundert Pfund im Jahr und von einer Frau, die noch nie im Leben etwas gespart hatte, waren sie so klug und gaben sich mit dem Haus zufrieden, wie es war; jede von ihnen war ganz damit beschäftigt, das einzurichten, was ihr persönlich am wichtigsten war, und indem sie um sich ihre Bücher und anderen Besitztümer ausbreiteten, schufen sie sich ein neues Zuhause. Mariannes Pianoforte wurde ausgepackt und fand einen Platz; Elinors Zeichnungen kamen an die Wände des Wohnzimmers.
In diesen Beschäftigungen wurden sie am folgenden Tag schon kurz nach dem Frühstück durch den Besuch ihres Hauswirts unterbrochen, der sie in Barton willkommen heißen und ihnen alles an Annehmlichkeiten aus seinem eigenen Haus und Garten anbieten wollte, woran es den ihren im Augenblick mangeln mochte. Sir John Middleton war ein schmucker Mann um die vierzig. Er war früher auf Stanhill zu Besuch gewesen, doch das war schon so lange her, dass seine jüngeren Verwandten sich nicht mehr erinnerten. Er war ein durch und durch gutmütiger Mann und im persönlichen Umgang genauso wohlwollend wie im Ton seines Briefes. Ihre Ankunft bereitete ihm offenbar ehrliches Vergnügen, und er war aufrichtig um ihr Wohlergehen besorgt. Immer wieder beteuerte er, wie sehr er sich wünsche, dass sie sich mit seiner Familie gut verstehen mögen, und lud sie so herzlich ein, jeden Tag zum Essen nach Barton Park zu kommen, bis in ihrem neuen Heim alles an Ort und Stelle sei, dass sie, auch wenn er in seinem Drängen schon über die Grenzen des Höflichen hinausging, nicht nein sagen konnten. Und seine Freundlichkeit beschränkte sich nicht auf Worte; denn binnen einer Stunde, nachdem er sie wieder verlassen hatte, wurde aus dem Herrenhaus ein großer Korb mit Obst und Gemüse gebracht, und bevor der Tag um war, kam noch Wildbret dazu. Außerdem bestand er darauf, ihre Briefe zur Post zu bringen und von dort zu holen, und ließ sich auch nicht das Vergnügen verbieten, ihnen täglich seine Zeitung weiterzureichen.
Von Lady Middleton überbrachte er eine ausgesprochen zuvorkommende Notiz, dass sie Mrs Dashwood ihre Aufwartung machen werde, sobald sie versichert sei, dass ihr Besuch keine Umstände mehr bereite; und da zur Antwort eine nicht minder höfliche Einladung gesandt wurde, lernten sie am folgenden Tag auch die Gattin ihres Hausherrn kennen.
Natürlich waren sie sehr gespannt darauf, mit einer Frau bekannt zu werden, von der so viel von ihrem Wohlergehen in Barton abhängen musste, und die Eleganz ihrer Erscheinung versprach das Beste. Lady Middleton war nicht älter als sechs- oder siebenundzwanzig; ihr Gesicht war anmutig, ihre Gestalt hochgewachsen und stattlich, ihre Umgangsformen elegant. Ihre Manieren hatten genau die Vornehmheit, die man bei ihrem Gatten vermisste. Allerdings hätte ihnen ein wenig von dessen Offenheit und Wärme gutgetan; und sie blieb lang genug, dass einiges von der anfänglichen Bewunderung bereits wieder schwand, denn zwar erwies sie sich als durch und durch formvollendet, aber auch als reserviert und kühl, und sie hatte aus eigenem Antrieb außer den oberflächlichsten Fragen und langweiligsten Gemeinplätzen nichts zu sagen.
An Gesprächsstoff mangelte es jedoch nicht, denn Sir John war ausgesprochen mitteilsam, und Lady Middleton hatte in weiser Voraussicht ihr ältestes Kind mitgebracht, einen hübschen kleinen Jungen von etwa sechs Jahren, und so hatten die Damen ein Thema, auf das sie im Notfall stets zurückkommen konnten, denn sie mussten sich nach Namen und Alter erkundigen, seine Schönheit bewundern und ihm Fragen stellen, die seine Mutter beantwortete, denn zum großen Erstaunen von Lady Middleton, die sich fragte, warum er jetzt so schüchtern war, wo er doch zu Hause Lärm genug machen konnte, drückte er sich nur gesenkten Hauptes an sie. Man sollte es sich zur Regel machen, bei jedem Höflichkeitsbesuch ein Kind dabeizuhaben, damit man Gesprächsstoff hat. In diesem speziellen Falle wurden zehn Minuten mit der Frage ausgefüllt, ob der Junge denn der Mutter oder dem Vater ähnlicher sehe und in welchem seiner Züge dem einen oder dem anderen, denn natürlich waren alle verschiedener Ansicht, und alle waren verblüfft über die Ansichten der anderen.
Bald sollten die Dashwoods auch die anderen Kinder begutachten können, denn Sir John verließ das Haus erst, als er ihnen das Versprechen abgerungen hatte, am folgenden Tag im Herrenhaus zu essen.




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)