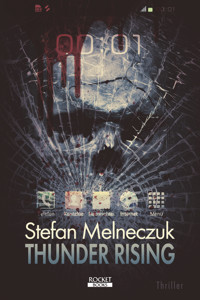4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Phantastische Stories
- Sprache: Deutsch
GEISTERSTUNDEN!31 Tage im Oktober.31 unheimliche Kurzgeschichten. Versammelt in einem Band.Ein literarischer Kalender zwischen wohligem Schauer und purem Schrecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Stefan MelneczukGEISTERSTUNDEN
In dieser Reihe bisher erschienen
01 Geisterstunden vor Halloween von Stefan Melneczuk
02 Drachen! Drachen! von Frank G. Gerigk & Petra Hartmann (Hrsg.) 03 Hunger von David Grashoff & Pascal Kamp (Hrsg.)
04 Schattenland von Stefan Melneczuk
05 Der Struwwelpeter-Code von Markus K. Korb06 Bio Punk‘d von Andreas Zwengel
07 Xenophobia von Markus K. Korb08 Nachtprotokolle von Anke Laufer09 Reiche Ernte von Matthias Bauer
10 Das Tor von Matthias Bauer
11 Fantastic Pulp 1 von Michael Schmidt & Matthias Käther (Hrsg.)
12 Wenn die Welt klein wird und bedrohlich von Felix Woitkowski (Hrsg.)
13 Geisterstunden von Stefan Melneczuk
14 Fantastic Pulp 2 von Michael Schmidt & Matthias Käther (Hrsg.)
Stefan Melneczuk
Geisterstunden
Unheimliche Geschichten zu Halloween
Stefan Melneczuk glaubt an Gespenster, lebt in Hattingen an der Ruhr und kam dort am 31. Oktober 1970 zur Welt. Zu Halloween geboren, hat er früh sein Faible für das Unheimliche entdeckt: 1985 nahm er mit ersten eigenen Erzählungen und Romanentwürfen seine literarische Arbeit auf, für die er in den folgenden Jahren mehrfach ausgezeichnet wurde. Unter anderem beim Treffen Junger Autoren in Berlin (1987), bei den Hattinger Literaturtagen (1993) und an der Ruhruniversität Bochum (1997). Dort hat er Geschichte, Germanistik und Politik studiert und sich in seiner Magisterarbeit mit der Propaganda des Ersten Weltkriegs befasst. Parallel zu seiner schriftstellerischen Laufbahn hat er nach einem Volontariat bei einer großen Tageszeitung 20 Jahre lang journalistisch gearbeitet – im Bergischen Land und im Ruhrgebiet, unter anderem als Reporter, Kolumnist, Kommentator und Fotograf. Im Anschluss daran wechselte er als Redakteur in den Marketingbereich und in die Unternehmenskommunikation.
Mit MARTERPFAHL – SOMMER DER INDIANER erschien im Herbst 2007 sein erster Thriller. Der Roman findet nach wie vor bundesweit Beachtung, erlebte aus dem Stand heraus mehrere Auflagen und ist wie seine Nachfolger RABENSTADT (2011), WALLENSTEIN (2014) und THUNDER RISING (2017) beim BLITZ Verlag erhältlich. Im Herbst 2009 sind hier erstmals auch die GEISTERSTUNDEN veröffentlicht worden – mit 31 unheimlichen Kurzgeschichten für den Monat Oktober in einer limitierten Hardcover-Ausgabe. Nach dem daran anschließenden Short-Story-Band SCHATTENLAND, der 2013 bei BLITZ als Taschenbuch herausgegeben wurde, gibt es nun auch den vergriffenen Erstling im kompakten Format – exklusiv in einer erweiterten Fassung.
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Jens WeberUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-612-5Dieses Buch ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Inhaltsverzeichnis
Vorwort: Von Gespenstern und Schreibmaschinen
Glauben Sie an Geister? Auf der Suche nach einer Antwort liegen mehr als dreißig Jahre zwischen mir und meinen ersten dunklen Short Storys. Entstanden sind sie damals auf einer elektrischen Schreibmaschine, die mein Vater mir bei einem Arbeitskollegen in Wuppertal besorgt hatte. Dass sein Sohn zu dieser Zeit schon seit Monaten wie besessen an Kurzgeschichten arbeitete und sein Taschengeld in Bücher von Stephen King investierte, erfüllte nicht nur ihn mit einer Mischung aus Sorge und Stolz.
Mit der Schreibmaschine aus zweiter Hand habe ich fortan viel Zeit verbracht. Bei gutem Wetter besorgte ich mir eine Kabeltrommel mit Wackelkontakt, einen alten Gartentisch und einen standfesten Stuhl aus Holz, um draußen unter freiem Himmel zu schreiben. Mit und auch unter Strom, gleich hinter unserem Haus im Hattinger Hügelland, am Rosenbeet meiner Oma, während im Wohnzimmer nebenan der Fernseher lief und ein junger Mann namens Boris Becker in Wimbledon gerade Tennisgeschichte schrieb. Ich höre ihn noch heute durch das auf Kipp stehende Fenster, den Jubel meiner Mutter beim Finale. Und ich weiß, dass ich mir Beifall dieser Art insgeheim auch für meine literarische Arbeit gewünscht habe – damals, als ich noch ganz sicher war, dass einem ambitionierten jungen Schriftsteller mit unheimlichen Geschichten im Reisegepäck die Welt da draußen offen steht.
Mittlerweile arbeite ich an einem Computer, dessen Leistung der eines Großrechners der 80er Jahre entspricht. Und ich schreibe in einer Zeit, in der Kinder mit USB-Anschluss, Smartphone-Schnittstelle und Facebook-Account zur Welt zu kommen scheinen. Eine Kabeltrommel brauche ich schon lange nicht mehr, um in Ruhe draußen schreiben zu können. Boris Becker? Den gibt es nach wie vor. Nur spielt er kaum noch Tennis. Und meine elektrische Schreibmaschine ruht schon seit vielen Jahren gut verwahrt in einem alten Schrank, der auf dem Dachboden meines Elternhauses steht – immer noch funktionstüchtig, wie ich hoffe. Mein Lehrgeld als Schriftsteller habe ich längst bezahlt: Heute weiß ich, wie lang, steinig und zuweilen auch einsam der Weg zum Ziel sein kann. Nach wie vor schreibe ich wie besessen und investiere mein Geld in Bücher von Stephen King. Nur mit dem Unterschied, dass das meinem Vater und all den anderen keine Sorgen mehr macht. Einige der Short Storys, die in den ersten Jahren entstanden sind, haben den Weg in dieses Buch hier gefunden. Bei der Arbeit daran sind viele Geschichten und Erinnerungen von damals heimgekehrt – wie alte Freunde, die man eine Zeit lang aus den Augen verloren hat, ohne sich jemals wirklich von ihnen zu entfernen.
Draußen ist es inzwischen dunkel, und ich schreibe diese Zeilen im Licht einer 40-Watt-Schreibtischlampe. Ihr Schein fällt auf meinen Textcomputer. Und gleich daneben auf eine kleine Halloween-Schneekugel auf einem schwarzen Sockel, in der ein Nachtgespenst unter schneeweißen Bettlaken seine Arme nach mir ausstreckt. Und ob Sie es glauben oder nicht: Mir ist einen Moment lang, als säße ich wieder an meiner alten Schreibmaschine. Noch einmal ein Teenager, der hofft, dass das Farbband darin wenigstens noch etwas durchhält, weil das Taschengeld mal wieder zur Neige geht und es deshalb schwer wird mit schnellem Nachschub für acht Mark fünfundneunzig aus der Abteilung für Bürobedarf bei Karstadt in Hattingen.
Und das ist noch nicht alles. Seit einer Stunde höre ich auf dem Dachboden im Geschoss über mir seltsame Geräusche. Das Klicken meiner alten Schreibmaschine im Schrank, Anschlag um Anschlag, Zeile für Zeile. Ich höre durch die dünne Zimmerdecke, dass jemand das Gerät mit dem Blatt Papier auf der Andruckrolle an sich nimmt und sich zu mir auf den Weg nach unten macht, mit schweren Schritten. Das Gespenst vom Dachboden steigt langsam aber sicher die Treppe hinab. Es kommt näher und näher. Nur ich kann es hören. Jetzt steht es auch schon auf der anderen Seite der Zimmertür. Und klopft an. Zögernd erhebe ich mich und mache auf. Zunächst nur einen Spalt breit – man kann ja nie wissen. Das 40-Watt-Licht fällt zuerst auf meine alte, elektrische Schreibmaschine. Sie steht, wie von Geisterhand vom Speicher herbeigeschafft, vor mir auf dem Dielenboden. Sie ist staubig und hat ein vergilbtes Manuskriptblatt im Rachen, dessen Überschrift ich kenne: Von Gespenstern und Schreibmaschinen ist da zu lesen. Und dann nehme ich allen Mut zusammen, öffne die Tür ganz und bitte meinen unheimlichen Besuch vom Dachboden hinein.
Bevor es aber soweit ist, entlasse ich Sie, liebe Leser, hinaus in die Nacht. Damit wenigstens Sie noch eine Zeit lang sicher sind vor dem, was zur Geisterstunde nach unten kommt, die Treppe hinab. Zu Ihrem Schutz stelle ich Ihnen Geschichten aus drei Jahrzehnten zur Seite. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich Zeit für Sie nehmen. Ihnen überlasse ich dieses Buch hier, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt, sobald daheim das Licht erlischt und die Turmuhr Mitternacht schlägt. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie beim Lesen immer den Heimweg finden, ohne ein Klopfen an der Zimmertür zu hören. Sollte das eines Nachts dennoch geschehen, dann hoffen wir gemeinsam, dass auf der anderen Seite der Tür wirklich nur eine alte Schreibmaschine auf dem Dielenboden steht – und nicht das, wonach es hier bei mir gerade aussieht: Die Halloween-Schneekugel auf meinem Schreibtisch ist leer, das Nachtgespenst daraus verschwunden. Und jetzt kann ich es hören, dicht hinter mir – das Rauschen schwerer, alter Bettlaken, die nach vergangener Zeit und nach Unheil riechen. Glauben Sie an Geister?
1. Oktober: Hungry Hill
Im Jahr des großen Hungers war der Prediger ihre letzte Hoffnung. Die Menschen lauschten seinen Worten, als draußen auf den Feldern die Ernte im Boden verfaulte und das Schicksal an der Bantry Bay seinen Lauf nahm, weil nun auch die Netze der Fischer leer blieben. Der Tod kam ohne Warnung. Bald schon starben die ersten Dorfleute, weil es nichts mehr zu essen gab. Jene, die kräftig genug waren, suchten Tag um Tag Zuflucht im Gebet. Die Kapelle des Predigers füllte sich mit Menschen und Verzweiflung. Als die Not größer und größer wurde, fasste der Mann im Talar einen folgenschweren Entschluss: Er rief seine Gemeinde in einer stürmischen Oktobernacht zu sich. Gott werde ein Zeichen geben, hoch oben, auf dem Berg jenseits der Bucht. Dort, so versprach es der Prediger, werde der Vater aller Dinge das Flehen der Menschen erhören und Brot vom Himmel regnen lassen. Ein Wunder werde sich ereignen, jetzt, im Angesicht des größten Hungers, den Irland jemals erlitten hat. 50 Männer, 40 Frauen und 15 Kinder folgten dem Prediger auf seinem Weg zum Gipfel, 684 Meter über dem Spiegel des Meeres, in der Hoffnung, dass Gott sie alle retten wird.
Am Ziel, mit Blick auf die Bucht, faltete die Gemeinde ihre Hände und betete, solange im Sturm die Kraft dazu blieb. Doch der Vater aller Dinge schwieg. Es gab kein Brot. Nur Regen, Wind und die Gewissheit, dass niemand diesen Berg hier verlassen wird. Sie starben mit Blick zum Himmel. Sie starben mit Blick auf den Atlantik. Die einen an Fieber. Die anderen an Hunger und Schwermut. Die Kinder holte sich der Tod zuerst, hoch oben über der Bucht, und zu den Letzten, die auf dem Berg ausharrten, gehörte der Prediger selbst. Kein Gebet konnte die Menschen retten, kein Vaterunser sie vor ihrem Schicksal bewahren. Nicht einer kehrte in das Dorf zurück – so geschehen im Herbst des Jahres 1845, als die Braunfäule das Land mit harter Hand regierte und Tausende dem Tod überließ.
Selbst heute noch, Jahrzehnte später, erzählt man sich diese Geschichte im Süden der Grünen Insel. In Herbst- und Winternächten, so sagt man, wenn der Wind landeinwärts zieht, kann man die Todgeweihten auf dem Hungerberg hören. 50 Männer, 40 Frauen und 15 Kinder, die keinen Frieden finden. Der Wind trägt ihre Gebete und Lieder hinab in die Stadt. Sie dringen durch Türen und Fenster, wie ein Fluss, der kein Ende nimmt und die Torffeuer von Geisterhand erstickt. Der Gesang der Toten verstummt erst bei Sonnenaufgang, wenn in der Kapelle am Hungry Hill die Glocke läutet. Sie alle sind immer noch da oben, an der Seite des Predigers, und warten auf ein Wunder. Gott hat Geduld mit ihnen.
2. Oktober: Schacht der Toten
Für kein Geld der Welt! Ich kann mich noch an jedes meiner Worte erinnern. Sie haben mir damals das Leben gerettet. Für kein Geld der Welt gehe ich da runter! Hast du mich verstanden? Der Steiger, sein Name war Paul, starrte mich sprachlos an. Dann wandte er sich ab und suchte sein Glück woanders. Am Ende jenes unheilvollen Tages, es war der 2. Oktober 1938, sollte Paul exakt das bekommen, was er brauchte, um weiterhin gut da zu stehen: Zehn Namen standen auf der Liste, die er hinauf in die Büros trug. Hinauf zu jenen hohen Herren, die ihre Tage vorzugsweise in schweren Ledersesseln verbringen, tonnenweise Geld machen und sich nur selten zu uns verirren. Zu jenen hohen Herren, denen wir hier unten seit je her egal sind, es sei denn, einer von uns wird bei der Arbeit verschüttet oder verletzt und verlangt damit eine Zahlung an seine Familie. Zehn Namen, zehn Bergleute. Die Erfahrensten von uns haben jeden der Freiwilligen noch einmal ins Gebet genommen. Und bis zuletzt versucht, sie davon abzubringen, auch nur einen Fuß in Schacht 23 zu setzen. Ohne Erfolg.
Das Unheil nahm seinen Lauf, als die hohen Herren einen englischen Ingenieur zu uns nach unten schickten. Thomson hieß er, und die Denkfalten auf seiner Stirn schienen noch tiefer zu sein als viele der Stollen, aus denen man uns damals das schwarze Gold holen ließ. Thomson hatte die Herren in den Ledersesseln von der Notwendigkeit einer schnellen Instandsetzung unter Tage überzeugt, um den Ertrag ihrer Grube auf Dauer zu sichern. Sein technischer Ehrgeiz richtete sich dabei vor allem auf Schacht 23, benannt nach jenem Jahr, in dem man ihn im Berg tief unter uns aufgegeben hatte. Glaubte man den alten Karten, war der Stollen fast achtzig Meter lang. Doch es war ein offenes Geheimnis, dass er viel tiefer in den Berg reichte und älter war als dokumentiert. Wir haben den verlassenen Schacht immer gemieden, weil er uns nicht geheuer war. Und es gab keinen Anlass, etwas daran zu ändern – bis der Engländer kam. Thomson wusste ebenso wie wir, dass man Schacht 23 vor langer Zeit nur schlecht gesichert hatte. Und dass die Stützkonstruktion da unten ersetzt werden musste, sollte sie den Berg darüber weiterhin zähmen.
Wenn wir das nicht in Ordnung bringen, verlieren wir entweder unsere Arbeit. Oder unser Leben. Mein Kamerad Wilhelm war einer der Ersten, die sich damals beim Steiger gemeldet haben, um freiwillig da runter zu gehen – für eine stattliche Gefahrenzulage, versteht sich. Wer konnte ihm und den anderen das übel nehmen? Sie brauchten das Geld für ihre Familien. Und niemand von uns hat an jenen Tagen geahnt, welchen Preis sie alle dafür zahlen sollten.
Die genaue Zahl der Bergleute, die in Schacht 23 verunglückt sind, ist bis heute nicht bekannt. Jeder Zwischenfall da unten blieb unter Verschluss. Der mit Abstand größte wird sich aber im Dezember 1925 ereignet haben: Ein Schlagwetter hat damals fünf Kameraden da unten erwischt. Nur zwei der Toten hat man bergen können. Die drei anderen blieben im Stollen zurück, weil alles andere viel zu gefährlich war. Sie liegen unter Tonnen von Gestein, hinter einer Holzverschalung, die den eingestürzten Abschnitt des Schachts verschließt. Wenig später hat man ein geweihtes Kreuz aus Eisen auf den Verschlag nageln lassen, um den Toten dahinter Frieden zu geben. Angesichts dieser Geschichte wurde der Steiger nicht müde, zwei Dinge zu beteuern: Ich gehe mit euch da runter. Das war richtig. In zehn Tagen ist unsere Arbeit getan. Das war falsch. Für die neun Freiwilligen, die es am 4. Oktober 1938 gemeinsam mit Paul in die Tiefe verschlug, sollte der Einsatz niemals enden.
Ob auch ich glaube, dass im Schacht der Toten jede Uhr nach spätestens fünf Minuten stehen bleibt? Ob auch ich etwas auf das Gerücht gebe, dass es da unten immer etwas dunkler ist als anderswo im Berg? Ob auch ich mir sicher bin, dass man tief im Stollen manchmal ein kleines Kind weinen hört und dass hinter dem Holzverschlag das Stöhnen und Rufen der Verschütteten zu vernehmen ist, wenn man nur lange genug lauscht? Ob auch ich meine, dass man in Schacht 23 das Gefühl hat, auf Schritt und Tritt beobachtet zu werden, weil es dort spukt?
Ich weiß nur, was ich gesehen habe, als unsere Kameraden nach ihrer letzten Schicht da unten zurück zu uns nach oben gekommen sind – schreiend und weinend und ohne Verstand: Das einzige, was Paul bis heute von sich gibt, sind wirre Kinderlieder. Der Steiger singt sie in einer Stimmlage, bei der sich allen in der Nervenheilanstalt die Haare sträuben. Mein Freund Wilhelm dagegen läuft seit seiner Rückkehr nur noch im Kreis. Seine Frau hat er am Krankenbett ebenso wenig wiedererkannt wie seine Söhne. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Die Männer aus Schacht 23 sind weit vor der Zeit ergraut und drei der Unglücklichen in ihren Betten gestorben. Sie wachten morgens nicht mehr auf, weil ihre Herzen im Schlaf einfach stehen geblieben sind wie ein Uhrwerk, das seinen Dienst versagt.
Bis heute wissen wir nicht, ob es Paul und den anderen damals wirklich gelungen ist, die maroden Stützen in Schacht 23 auszutauschen, den Plänen des Engländers folgend. Wir wissen nur, dass ihnen an ihrem letzten Tag im Stollen etwas Furchtbares zugestoßen ist. In Pauls Taschen hat man Knochen gefunden. Und der arme Wilhelm hat auf seinem Weg hinaus ein rostiges Kreuz aus Eisen umarmt, in dem vier Nägel steckten. Hat er gemeinsam mit den anderen da unten wirklich noch hinter das Holz geblickt?
Zwei Wochen nach dieser Tragödie wurde das Grubenfeld geschlossen. Der Ingenieur aus England starb am Tag darauf bei einem Eisenbahnunglück auf dem Heimweg nach London. Der Zug ist – so berichteten es Augenzeugen – auf gerader Strecke entgleist und hat 23 Menschen mit sich ins Verderben gerissen. Thomsons Pläne, Skizzen und Aufzeichnungen aus dem Schacht der Toten sollen zur selben Stunde in Flammen aufgegangen sein, ein paar hundert Meilen entfernt, im Panzerschrank jener hohen Herren, die ihn einst beauftragt hatten. Wir haben damals mit eigenen Augen gesehen, dass der Engländer immer wieder nach unten in den Berg gefahren ist, zu Paul und den anderen, um sich ein Bild von der Arbeit in Schacht 23 zu machen. Warum nicht auch bei ihrer letzten Schicht? Man hat uns stattdessen nur etwas von Grubengas und von großer Gefahr im Berg erzählt, sollte Schacht 23 eines Tages doch noch einstürzen. Und so beließ man es dabei, den Schacht der Toten für immer zu verschließen und das Grubenfeld darüber aufzugeben. Die Herren von ganz oben sollen viel Geld dafür gezahlt haben, dass die Zeitungen nichts mehr darüber schrieben. Und uns Bergleute verteilte man ohne großes Aufsehen auf andere Zechen.
Ich selbst gehöre zu denen, die nach diesem Unglück niemals wieder unter Tage gearbeitet haben. Weil wir nicht vergessen können. Und weil wir Fragen stellen. Wir versuchen bis heute, an den Fotoapparat zu gelangen, den Paul im Schacht der Toten bei sich getragen hat. Wo sind seine Bilder geblieben? Und was ist auf ihnen zu sehen? Warum verrät man uns nicht, was den Kameraden da unten im Berg wirklich widerfahren ist? Die wenigen, die heute noch leben, können wir nicht fragen. Sie hocken nach wie vor in Gummizellen oder sind im Sanatorium an ihre Betten geschnallt, damit sie nicht länger versuchen, sich die Augen aus dem Kopf zu reißen. Der Teufel alleine scheint zu wissen, was es mit Schacht 23 auf sich hat. Und bis er mir sein Geheimnis am Ende der Schicht verrät, bleiben mir nur diese Worte: Für kein Geld der Welt!
3. Oktober: Geisternacht
Es gibt gute Ideen, und es gibt weniger gute Ideen. Das hier war eine weniger gute Idee, fand Frederic. Vor ihm auf dem Boden lag ein abgetrennter Kopf, so groß wie zwei Fußbälle. Mit dreieckigen Augen, die ihn durch die Dunkelheit hasserfüllt anstarrten. In ihren Höhlen flackerte Kerzenlicht. Sein Schein kroch durch einen gezackten Mund, vorbei an steilen, scharfen Zahnreihen. Die Nase im Zentrum der Fratze war ein tiefes Loch, mit einem Taschenmesser mitten ins Gesicht geschnitten. Die Haut des Schädels war orangerot, verblichen und faul.
„Alte Kürbisse sind die besten“, hörte Frederic seinen Bruder Kai sagen. Und Kai musste es wissen mit seinen fast dreizehn Jahren. Der Bitte ihrer Eltern, in diesem Jahr auch den kleinen Frederic am Halloween-Fest teilhaben zu lassen, war er nur murrend gefolgt. „Wenn es sein muss. Fred macht sich ja doch nur in die Hosen, wenn es ernst wird.“
„Mach’ ich nicht“, rief Frederic in das Halbdunkel – nur sein Bruder nannte ihn abfällig bei seinen ersten vier Buchstaben. Er fragte sich, was ihre Eltern dazu sagen würden, dass man ihn auf dem Dachboden eingesperrt hatte, kurz nachdem sie zum Cousinen- und Vetternabend gegangen waren. So kam es, dass Frederic an jenem 31. Oktober alleine in der Dachkammer hockte, umgeben von alten Schränken, Kisten und besagtem Kürbiskopf, der vor seinen Füßen lag und ihn wild angrinste.
Und da war sie wieder, die Stimme seines Bruders: „Hey Fred“, hörte er sie durch das Flackern der Kerze sagen, „wenn du heute Nacht mit uns kommen willst, musst du eine Mutprobe ablegen. Zwei Stunden lang wirst du mit dem Kürbis da alleine auf dem Dachboden sitzen und abwarten, bis das Licht ausgeht. Wenn die Gespenster dich dann immer noch nicht geholt haben, darfst du mitkommen, okay?“
Nur durch eine schmale Luke war der Dachboden zu erreichen. Auf der anderen Seite hing eine Treppe, und genau die hatten Kai und seine Freunde mit Gelächter eingezogen, nachdem sie den Einstieg mit dem schweren Messingschloss verriegelt hatten.
„Zwei Stunden“, hörte er seinen Bruder noch rufen. Das war jetzt drei Stunden her. „Dann holen wir dich raus. Ehrenwort. Vorausgesetzt, die Gespenster haben dich nicht mitgenommen. Das machen sie gerne mit Kindern, wenn es dunkel wird. Deswegen solltest du hoffen, dass diese Kerze hier lange brennt. Gib Acht, dass sie nicht ausgeht.“
Das Teelicht, das die Jungs in den ausgehöhlten Kürbis gesteckt hatten, brannte immer noch.
Kai und die anderen waren dann ohne ihn losgezogen, um mit Bettlaken auf ihren Köpfen von Haus zu Haus zu gehen und kistenweise Schokolade einzukassieren.
„Pass gut auf dich auf“, hatte einer von Kais Freunden vergnügt durch die Luke gerufen. „Heute ist die Nacht der bösen Geister.“
Frederic lauschte dem Pfeifen des Herbstwindes, der entschlossen um das Haus schlich. Hin und wieder kratzten Laub und Äste über die andere Seite der Dachziegel. Es klang so, als würde ein Tier darüber hinweg laufen. Eine Maus vielleicht, oder sogar eine Ratte. Es war für diese Jahreszeit ungewöhnlich kalt, und das sprach für einen strengen Winter. Eigentlich mochte Frederic den Herbst. Er liebte es, in Bergen aus goldgelben Blättern zu spielen, und die schönsten, die er draußen fand, benutzte er als Lesezeichen für seine Comics. Mit ihrer Hilfe hatte Frederic schneller lesen gelernt als manche seiner Schulkameraden. Ab und zu brachte seine Mutter ihm auch GESPENSTERGESCHICHTEN mit. Seltsam? Aber so steht es geschrieben. Mit diesem Satz endeten sie alle. Viele Storys erzählten von Vampiren, von Werwölfen und von anderen Seelen, die keinen Frieden finden. Wie kam sein Bruder also dazu, dass er sich vor Geistern fürchtete?
Frederic konzentrierte sich auf den Kürbis. Er wagte es nicht, sich umzusehen. Hin und wieder glaubte er jenseits der Kisten, in denen seine Eltern viele alte Sachen lagerten, Schritte zu hören. Sie ließen den staubigen Holzfußboden knirschen wie das Deck eines alten Schiffs auf hoher See.
Die Geister sind längst hier, flüsterte es von allen Seiten, doch Frederic wusste, dass er sich das nur einbildete. Sie haben dich umzingelt und warten nur auf ihre Gelegenheit. Je schwächer das Licht im Hals des Kürbisses schien, umso länger wurden die Schatten, die ihre Umrisse auf die Schrägen des Dachbodens warfen. Manche sahen aus wie tanzende Phantome, mit ausgestreckten Händen und gekrümmten Fingern, die nur ein Ziel hatten. Pass auf, dass sie dich nicht erwischen. Die Würgegeister sind die Schlimmsten.
Frederic hatte Angst. Wenn es sie wirklich gab, dann hatten die Geister hier oben ein leichtes Spiel mit ihm. Er war ganz allein heute Nacht. Natürlich hatte Frederic den Dachboden nach Kerzen abgesucht. Selbst Kartons hatte er geöffnet, in der Hoffnung, etwas Brennbares zu finden, mit dem er nicht gleich das ganze Haus anstecken würde.
Unter die Kommode zu blicken, die einst seiner Großmutter gehört hatte – sie war seit zwei Jahren im Himmel – vergaß Frederic. Dort lief ein verstecktes Tonbandgerät, das auf Aufnahme gestellt war, um seinen Bruder und dessen Freunde morgen ein wenig zu erheitern, wenn sie in ihrem Baumhaus über Playboy-Heften hockten, die sie aus Containern für Altpapier gezogen hatten. Das Schluchzen, das Frederic über die Lippen gekommen war, hatte das Gerät bereits aufgezeichnet. Ebenso wie andere Dinge, die der Junge auf dem Holzfußboden nicht hören konnte.
Keine Kerze, kein Feuerzeug und keine Lampe. Frederic dachte an seine Eltern, als das Kerzenlicht mit einem Mal erlosch und den Kürbis in der Dunkelheit verschwinden ließ. Es roch nach Kerzenrauch, und das Herz des Jungen begann noch aufgeregter zu schlagen als ohnehin schon.
„Die Würgegeister kommen alle zwanzig Jahre für eine Nacht zurück auf die Erde, um sich Kinder zu holen. Am liebsten zu Halloween, weil sie dann niemandem auffallen. Jeder hält ihre Leichentücher für Verkleidungen. Sie mischen sich unters Volk und spionieren Siedlungen aus, in denen Kinder zu Hause sind. Erwachsene interessieren sie nicht. Es geht ihnen um frische Seelen, unverbraucht und sauber, ohne den Ballast, den große Menschen mit sich herumtragen. Sie lieben Kinder, die sich aus Angst in die Hosen machen. Zuletzt waren sie 1984 in unserer Stadt. Damals holten sie sich den kleinen Benjamin aus dem Eulenweg. Seine Eltern haben wochenlang nach ihm gesucht. Würgegeister kennen keine Angst. Liebe ist ihnen ebenso fremd wie Mitleid. Ihnen reicht die Kraft ihrer eiskalten Hände.“
Die Stimme in Frederics Kopf wollte nicht verstummen. Sein Bruder war schon immer ein großer Erzähler gewesen, doch dieses Mal hatte er sein Meisterstück abgeliefert. Kai hatte sich viel Zeit genommen, um Fred das alles zu erzählen, und die anderen Jungs hatten voller Ehrfurcht genickt. Sie ließen Kai reden, ohne zu wissen, dass sie damit sein Schicksal besiegelten.
„Würgegeister können durch Wände gehen, Fred. Und sie riechen ein Kind, das sich vor Angst in die Hosen macht, schon aus tausend Metern Entfernung. Sie können dich wittern, wenn du nicht vorsichtig bist. Dein Duft lässt ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Sie wissen, wie man an Dachrinnen entlang klettert und durch Schornsteine in Wohnzimmer steigt. Auf Dachböden schlagen sie am liebsten zu, denn dort ist ihre Beute in der Regel allein. Sie lieben es, kleine Jungs aus dem Hinterhalt zu überraschen, wenn sie heimlich nach Gerümpel suchen oder nach Comic-Heften, die irgendjemand weggesteckt hat, weil sie im Kinderzimmer doch nur in der Ecke herumliegen. Hin und wieder erwischen sie auch Kinder, die gerade eine Mutprobe ablegen und sich einreden, dass es keine Würgegeister gibt. Sie warten, bis die Kerze erloschen ist. Zuerst holen sie sich den Kürbis. Sie verschlingen ihn und hoffen, auf Kerzenwachs zu stoßen. Wenn sie könnten, würden sie kiloweise Kerzen essen. Du wirst ihr Schmatzen hören. Und wenn sie mit dem Kürbis fertig sind, dann holen sie dich.“
Frederic hoffte, dass Kai ein Lügner war. Er streckte die Arme aus und ließ seine Finger über den Holzfußboden wandern. Er wollte sich vergewissern, dass der Kürbis immer noch an seinem Platz lag. Er wollte einfach nur die raue Haut berühren, die Augen ertasten und durch den Mundschlitz das Teelicht zu fassen bekommen. Vielleicht brannte der Docht ja noch. Aber der Kürbis war nicht mehr da.
Anstatt noch größere Angst zu bekommen, bemühte Frederic sich um Ruhe. Es gab zwei Möglichkeiten: Entweder hatten Kai und seine Freunde es geschafft, sich auf den Dachboden zu schleichen, um ihn zu erschrecken.
Oder es gab die Würgegeister wirklich.
„Es ist ihnen gestattet, bei jeder Wiederkunft zehn Kinder zu holen. Fünf Jungen, fünf Mädchen. Das ist abgemacht nach zähen Verhandlungen zwischen Gott und dem Teufel. Die Würger bevorzugen Jagdreviere in Amerika und Europa.“
„Ist da jemand?“
Diese Frage erübrigte sich angesichts der furchtbaren Geräusche auf dem Dachboden. Jetzt machte Frederic sich wirklich in die Hosen, ganz so, wie sein Bruder es vorausgesehen hatte. Panik und Scham machten sich in ihm breit, und er schnappte nach Luft. Vielleicht sollte er um Hilfe rufen. Aber wer würde ihn hören? Der Junge starrte auf das Dachfenster, hinter dem der fahle Mond schien. Irgendwo weiter hinten glaubte er ein leises Lachen zu hören.
„Ist da jemand?“, fragte Frederic noch einmal, obwohl er nur zu gut wusste, dass das sinnlos war. Er rutschte ein Stück rückwärts, bis seine Schultern gegen etwas Hartes stießen. Das Lachen verwandelte sich in ein Kichern, und jetzt kam es von allen Seiten auf ihn zu. Der Junge spürte, wie sich sein Hals zuschnürte vor lauter Verzweiflung. Das hässliche Kichern ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Es sollte das Letzte sein, was Frederic in seinem Leben zu hören bekam.
Ihm blieben nur noch Sekunden.
Drei Monate später stellte die Polizei ihre Suche nach Frederic als ergebnislos ein, und die Ermittlungsakte wurde geschlossen. Selbst unter den Dielenbrettern des Dachbodens hatte man nach dem Jungen gesucht. In der Kammer wurden DNA-Spuren gesichert: Ein paar Haare, die mit denen aus Frederics Kamm verglichen wurden, etwas Urin auf dem Parkett, und das war alles. Der Umstand, dass die Luke des Dachbodens ebenso fest verschlossen vorgefunden wurde wie das Fenster, machte das Verschwinden des Jungen noch rätselhafter. Es dauerte nicht lange, bis ein Sensationsreporter Parallelen zu einem ähnlichen Fall herstellte, der sich auf den Tag genau vor zwanzig Jahren nur ein paar Straßen weiter ereignet hatte. Auf den Gedanken, in den Archiven vierzig, sechzig und achtzig Jahre zurück zu blättern, kam niemand – auch wenn sich dabei eine erschütternde Lektüre ergeben hätte.
In zwei Gottesdiensten, einer evangelisch und einer katholisch, wurde an den verschwundenen Jungen erinnert. Freunde und Bekannte legten vor dem Haus am Finkenweg Blumen nieder. Vernehmungen brachten die Ermittler ebenso wenig weiter wie das Eingeständnis des Bruders, Frederic in der Tatnacht auf dem Dachboden allein gelassen zu haben. Kai konnte nicht erklären, wer da oben den Spiegel der Kommode zerschlagen hatte. Und er verschwieg den Beamten, dass er an das Tonbandgerät gelangt war und sich die Aufnahmen gemeinsam mit seinen Freunden angehört hatte. Keiner der Jungs sollte diese vierzig Minuten jemals wieder vergessen.
Kai war angesichts der entsetzlichen Geräusche, die auf dem Band zu hören waren, bis die Aufnahme aussetzte, in Tränen ausgebrochen.
„Macht das aus! Macht das sofort aus!“
Die Jungs beschlossen, den Inhalt des Tonbands für sich zu behalten, und sie sollten sich bis ans Ende ihrer Tage vor jedem 31. Oktober fürchten. Noch am selben Abend verbrannten sie die Kassette auf einer Lichtung und vergruben die verkohlten Überreste im Wald. Dann eilten die Jungs nach Hause, als sei der Leibhaftige hinter ihnen her. Das Tonband vom Dachboden wurde zu ihrem Alptraum, ein Würgegeist, der ihnen keine Ruhe mehr ließ. Ihre Freundschaft zerbrach ebenso daran wie ihre Fähigkeit, ruhig zu schlafen oder unbefangen in einen Spiegel zu sehen. Fest stand nur eines: Frederic blieb wie vom Erdboden verschluckt, ebenso der Gespensterkürbis, der ihm in den letzten Minuten seines Lebens Licht gegeben hatte. Seltsam? Aber so steht es geschrieben.
4. Oktober: Loch Ness
Wir ahnten damals nicht, dass die beiden jungen Männer, die uns im Schankraum gegenüber saßen, dem Tod geweiht waren. Dreißig Jahre liegt die unheilvolle Begegnung inzwischen zurück. Sie ereignete sich an einem stürmischen Abend Anfang Oktober, und mir ist, als sei das erst gestern gewesen. Ich sehe sie noch immer vor mir, in ihren teuren Maßanzügen, ein Bier nach dem anderen kippend und altklug daher schwatzend – geistreich und arrogant zugleich. John Lethbridge hieß ihr Wortführer. Eine Erscheinung wie in Stein gemeißelt, hellwach, distinguiert, weit gereist und felsenfest davon überzeugt, sich mit Geld alles kaufen zu können. Einer seiner Vorfahren hatte mit der „Diving Engine“ das Tauchen in großen Tiefen überhaupt erst ermöglicht, irgendwann zu Beginn des 18. Jahrhunderts, und nun war es an ihm, die Tradition seiner Familie mit Anstand fortzusetzen, wie er betonte. Seine britischen Wurzeln lägen ihm am Herzen, dozierte Lethbridge, sein Bier in einer Art und Weise trinkend, wie es nur Amerikaner zu tun vermögen. Als Mitglied der Historical Diving Society verstand er sich als Abenteurer. Er benutze, und das wiederholte Lethbridge an diesem Abend gleich mehrfach, ausschließlich historische Ausrüstungsstücke – sofern es ihre Technik zuließ. Durch eine Erbschaft war er zu unglaublich viel Geld gekommen, und als Teilhaber wild sprudelnder Erdölfelder in Texas konnte sich der junge Mann jede Form von Extravaganz leisten. Der Amerikaner ließ mich nicht eine Sekunde daran zweifeln, dass er meinem alten Freund Scott und mir in allen Belangen überlegen war.
Sein Partner hieß Jankins. John Lethbridge vermied es geflissentlich, den Mann beim Vornamen zu nennen. An seinem Geldgeber gemessen war Jankins geradezu zurückhaltend. Er begleitete den unerträglichen Amerikaner bereits seit einigen Jahren. Jankins stammte aus Bristol, trug stets eine Kamera bei sich und hatte sein Talent einst in den Dienst britischer und französischer Hochglanzmagazine gestellt. Bis er eines Tages einen extravaganten Multimillionär aus den Staaten abzulichten hatte. Als persönlicher Haus- und Hoffotograf von John Lethbridge erfüllte ihn seitdem die Hoffnung, sich in absehbarer Zeit mit einem Haufen Geld zur Ruhe setzen zu können. Jankins verbrachte den Abend damit, Scott und mich reserviert zu beobachten und hin und wieder seine hohe, braungebrannte Stirn zu runzeln, wenn wir etwas sagten. John Lethbridge offenbarte uns, dass sich sein persönlicher Assistent bestens darauf verstand, die Fotos, die er bei ihren gemeinsamen Expeditionen rund um den Erdball schoss, gegen Höchstgebote zu versilbern. Jankins war unberechenbar. Wortkarg trank er sein Bier und sah sich dabei immer mal wieder nach der hübschen Bedienung um, die uns bald schon mit Malt Whisky versorgte und nicht einen Blick erwiderte.
So saßen uns John Lethbridge und Jankins in einem verrauchten Pub in Inverness gegenüber und besiegelten ihr Schicksal. Ein Mittelsmann, sein Name war Rowlins, hatte sich ein paar Tage zuvor mit uns in Verbindung gesetzt – über den Hafenmeister aus Aberdeen, den wir gut kannten. Lethbridge suchte zwei für sein nächstes Vorhaben erfahrene Seeleute, die Geld verdienen wollten, ohne daraus eine große Sache zu machen. Zwei Tage sollte der Job in Anspruch nehmen. Unsere einzige Verpflichtung bestand in Stillschweigen. Kein Wort zu unseren Familien, kein Wort zu unseren Freunden und vor allen Dingen kein Wort zur Presse. Andernfalls drohte uns die Rückzahlung des Zehnfachen der vereinbarten Summe.
Nach Unterzeichnung eines entsprechend geharnischten Vertrages bei einem Notar wurden wir mit einem stattlichen Vorschuss und mit einem Boot bedacht. Der Kahn, den Lethbridge über den Hafenmeister hatte chartern lassen, hieß „Maid of Moray“, war gut in Schuss und lag startbereit an einem Ausleger am Loch Ness. Das roch nach leicht verdientem Geld. Scott und ich sollten die „Maid“ nur hinaus auf den See steuern und den beiden Abenteurern beim Tauchgang zur Hand gehen.
John Lethbridge war mit Blick auf das bevorstehende Spektakel kaum noch zu bremsen, was Jankins sichtlich unangenehm war. So erzählte uns der Amerikaner nach seinem dritten Bier von einer Himalaya-Expedition auf den Spuren des Yeti. Und von den wirklich wundervollen Fotos, die Jankins von den Überresten eines solchen geschossen hatte. Hinter den verschwiegenen Mauern eines Klosters in Tibet, immer darauf bedacht, die jahrhundertealten Fundstücke bloß nicht durch Blitzlicht zu beschädigen. An der Echtheit des Fundes bestehe kein Zweifel, erklärte uns Lethbridge. Ähnliches gab es von Bigfoot zu berichten. Ihm waren die beiden Männer vor zwei Jahren über den Weg gelaufen. In den Rocky Mountains. Das behaupteten sie zumindest.
Das Ungeheuer von Loch Ness fehle ihm noch in der Sammlung, ließ Lethbridge uns wissen. Er hoffe, das Untier beim Tauchgang mit Jankins vor die Linse zu bekommen – ein Relikt aus der Urzeit, das tief unten im See die Jahrtausende überdauert hatte. Ich fragte mich, wann der Amerikaner uns wohl von seinem Besuch in der Area 51 berichten würde. Und von den Fotos der vier außerirdischen Leichen, die seit dem Absturz von Roswell in New Mexico im Sommer 1947 dort aufbewahrt wurden. Möglicherweise war John Lethbridge ja auch im Besitz des Heiligen Grals und der Bundeslade, die er in einer extra dazu gebauten Frachthalle in seiner texanischen Heimat bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufbewahren ließ, um sie eines Tages doch noch der staunenden Welt zu präsentieren.
Unser Auftrag: Mit Seilwinden und Galgen am Heck der „Maid“ sollten wir Lethbridge und Jankins in die Tiefe befördern. Die Männer verfügten über beheizbare Helmtauch-Ausrüstungen, von der Sorte, wie man sie aus alten Schatzsucher-Geschichten kennt. Dreißig Meter tief, das sollte reichen, um einen aufschlussreichen Blick in den See zu werfen. John Lethbridge legte Wert auf einen stilechten Tauchgang. Eigens für dieses Unternehmen hatte er deshalb zwei Tiefseetauchanzüge aus den 40er Jahren generalüberholen und auf den neuesten Stand der Technik bringen lassen. Die Unterwasser-Scheinwerfer und die Kameras, welche die Männer mit nach unten zu nehmen gedachten, waren hochmodern und das Beste, was es auf dem Markt zu kaufen gab.
Der Zeitpunkt war ideal: Vor drei Wochen hatte es glaubhafte Meldungen über Sichtungen an der Westseite des Loch Ness gegeben. Diesen wollten Lethbridge und Jankins nachgehen, gegebenenfalls mit Tauchgängen an verschiedenen Stellen im See. Augenzeugen hatten – pünktlich zu Beginn der Saison – von riesenhaften Umrissen im Wasser berichtet, einer Schlange gleich, fast zehn Meter lang und sehr, sehr schnell.
In der Überzeugung, den ersten echten Beweis für die Existenz des Ungeheuers von Loch Ness zu liefern, waren Lethbridge und Jankins nach Schottland gekommen. Das berühmte Nessie-Foto aus dem Jahr 1934 sei nichts anderes als eine Fälschung, behauptete der Amerikaner, und wir könnten gerade auch deshalb stolz sein, den Tauchgang hier gemeinsam mit ihm zum Erfolg zu führen, um der Welt da draußen endlich handfeste Aufnahmen zu liefern. Nach dem Loch Ness werde man bald schon im Lake Okanagan in Kanada tauchen, auf gleiche Weise, ebenfalls auf den Spuren eines Seeungeheuers, das an Land immer mal wieder für Schlagzeilen sorgte. Der Amerikaner entspannte sich etwas, als die Bedienung – eine gälische Schönheit mit feuerroter Mähne – Nachschub auf seinen Bierdeckel stellte.
Mit Kähnen wie der „Maid“ aus früheren Zeiten vertraut, ließen wir uns auf das Abenteuer ein. John Lethbridge hatte es sich – unter Zuhilfenahme monetärer Mittel, wie er es nannte – abschließend auch bei den schottischen Behörden absegnen lassen. Mit der Maßgabe, bei einer Sichtung und eindeutigen Fotos umgehend die Regierung zu informieren. Um den Reiz seiner Mission zu vergrößern, hatte es sich der Amerikaner auch noch in den Kopf gesetzt, nachts zu tauchen. Und er war durch nichts davon abzubringen. Auf Aufnahmen unter solchen Bedingungen sei er spezialisiert, sekundierte Jankins. Außerdem sei die Chance, unter Wasser tatsächlich auf das Ungeheuer zu treffen, in den Nachtstunden am größten: Nach allem, was wir wissen, verlässt es vor allem bei Dunkelheit sein Versteck tief unten im See, um weiter oben auf die Jagd nach Fischen und Seevögeln zu gehen.
Am Abend darauf machten wir uns auf den Weg. Der Himmel war sternenklar, als wir mit der „Maid of Moray“ auf Loch Ness hinaus fuhren. Lediglich ein paar japanische Touristen schauten uns nach, als wir ablegten. Jankins und Lethbridge winkten den Leuten feixend zu. Die Beiden waren auch noch in bester Laune, als sie wenig später in ihre Helmtauch-Anzüge stiegen. Nach einer kurzen Einweisung wussten Scott und ich, was beim Einkleiden unserer Helden zu beachten war: Wir reichten dem Amerikaner und seinem Tauchpartner schwere Drei-Bolzen-Helme und arretierten sie auf nicht minder schweren Schulteraufsätzen. Dann prüften wir die Zufuhr der Luftschläuche, kontrollierten die Auslassventile an den Anzügen ebenso wie die Pumpsysteme, die Lethbridge und Jankins unten im See mit Atemluft versorgen sollten. Die Männer sprachen über ihre Helm-Mikrophone mit uns. Zur Vorsicht waren beide auch noch über ein Zugseil als Signalgeber mit der „Maid“ verbunden. Am Ende der beiden Seile hing jeweils eine Glocke aus Messing. Sobald sie läutete, galt es, die Taucher so schnell wie möglich aus dem See zu ziehen.
Bleischuhe und Gewichtsgürtel sollten den Abstieg am Stahlseil sicherstellen und einen unerwarteten Auftrieb verhindern. Das größte Risiko bestand darin, dass sich die Luftschläuche an den Zugseilen ineinander verwickelten. Für diesen Fall trug jeder der Männer eine Pressluftflasche bei sich, auf die er bei Gefahr zurückgreifen konnte. Abschließend checkten wir die beiden Motorwinden. Fielen sie aus, bestand zur Not immer noch die Möglichkeit, die Taucher per Handkurbel aus dem Wasser zu holen. Doch darauf wollten wir es nicht ankommen lassen, zumal die Ausrüstungen, in denen die beiden Männer steckten, unglaublich schwer waren.
Zehn Minuten später, es war gegen 22 Uhr, ließen wir Lethbridge und Jankins in den Loch Ness hinab. Sie nickten uns zum Abschied zu und hoben ihre Daumen wie die Gewinner eines Straßenrennens. So hingen die beiden Männer im Sicherungsgeschirr und schauten uns durch die dicken Glasscheiben ihrer Helme an, Kamera und Scheinwerfer im Anschlag. Dann tauchten sie ab in die Tiefen des Sees, während die Winden über ihnen gehorsam surrten und sich der Pumpengenerator hinter uns ebenso ergeben an die Arbeit machte.
Wir hörten Lethbridge die Melodie von Fly me to the moon summen, jetzt schon fünf Meter unter dem pechschwarzen Wasserspiegel, der sich langsam aber sicher beruhigte. Hin und wieder stiegen dicke Luftblasen aus den Auslassventilen der Taucheranzüge auf und zerplatzten an der Oberfläche. Das Scheinwerferlicht, das fahl zu uns nach oben schien, wurde von Sekunde zu Sekunde schwächer. Die Farbmarkierungen an den Stahlseilen zeigten uns im Licht des Bordscheinwerfers, dass Lethbridge und Jankins bereits zehn Meter tief tauchten. Wir benutzten die Funksprechanlage und ließen die beiden Winden nicht einen Moment lang aus den Augen.
„Alles in Ordnung!“, ließ John Lethbridge uns nach einer Kunstpause wissen. „Alles ganz wunderbar hier unten.“
Die Lichter der Uferhäuser waren jetzt so weit weg wie die Sterne hoch über uns. Bei Meter zwanzig war nichts mehr vom Schein der Unterwasserlampen zu sehen. Scott nickte mir angespannt zu. Zehn Meter noch, und die beiden Verrückten waren am Ziel. Ein schlechter Scherz, wenn man bedenkt, dass Loch Ness bis zu 230 Meter in die Tiefe führt – aber das hier war alles, was die beiden Abenteurer verlangten: Sie waren fest davon überzeugt, dass dreißig Meter genügten, um dem Ungeheuer zu begegnen. Ich glaube nicht, dass die Männer auch nur entfernt daran gedacht hatten, sich auf ihrem Tauchgang zu bewaffnen. Mut kennt keine Kompromisse. Meine größte Sorge galt nach wie vor den beiden Auslegern der Seilwinde, die knapp drei Meter voneinander entfernt standen und das Heck unseres Bootes nach unten zogen. Was würde geschehen, sollten sich die Stahlseile, an denen Jankins und Lethbridge fast 180 Kilogramm schwer hingen, ineinander verfangen? Oder die Luftschläuche? Ich hoffte, dass sich die Beiden wirklich auf ihr Handwerk verstanden. Wind kam auf und ließ mich erschauern.
Bei Meter 25 hörten wir mit einem Mal ein Raunen durch den Lautsprecher der Funkanlage dringen. Ich weiß bis heute nicht, ob es von Lethbridge oder Jankins kam. Niemals vergessen werde ich den Schrei bei Meter 27, der uns dazu trieb, die Winden zu stoppen. Die Wasseroberfläche entlang der Seile und Schläuche kam in Bewegung, und die „Maid“ begann zu schaukeln, ganz so, als sei sie in einen Sturm geraten. Das Hin und Her wurde stärker und stärker, so dass wir Probleme hatten, uns auf den Beinen zu halten. Bei Meter 28 war der Tauchgang der Abenteurer beendet, und ich entschied, sie sofort nach oben zu holen, während Scott vergeblich versuchte, sie über die Funksprechanlage zu erreichen. Die Geräusche, die jetzt aus der Tiefe zu uns drangen, waren nicht länger beunruhigend. Sie waren grauenvoll. Plötzlich riss die Verbindung ab. Wellen peitschten gegen das Boot und ließen keinen Zweifel daran, dass sich da unten im See etwas sehr Großes bewegte.
Bei Meter 15 hörten wir einen weiteren Schrei, diesmal eindeutig von Jankins. Dann ging ein harter Ruck durch sein Seil. Die Alarmglocken über unseren Köpfen dröhnten in die Nacht hinaus, bevor sie aus der Verankerung rissen, dicht an uns vorbeischossen, zwei oder drei Meter von der „Maid“ entfernt ins Wasser schlugen und versanken.
Scott bemühte sich, seine Panik in den Griff zu bekommen. Zunächst mit Flüchen. Dann mit Stoßgebeten. Beides zeigte keine Wirkung. Ich glaubte, unter Wasser das schwirrende Licht eines Scheinwerfers zu erkennen. Vermutlich war es der von John Lethbridge. Und dann schob sich etwas Riesenhaftes zwischen das Schimmern und die Oberfläche des Sees. Scott und ich starrten fassungslos in die Tiefe. Und wir wünschten uns, dass die Seilwinden schneller arbeiteten.
Meter zehn, Meter neun, Meter acht, Meter sieben – dann war das Scheinwerferlicht mit einem Mal wieder zu sehen und der gewaltige Umriss verschwunden. Sekunden später brach Lethbridges Drei-Bolzen-Helm durch die Wasseroberfläche, dicht über dem Riemengeschirr, an dem der Amerikaner baumelte wie ein Hochseefang. Wir zogen den leblosen Körper des Tauchers mit vereinten Kräften zu uns ins Boot und ließen einen Moment lang die zweite Winde aus den Augen, die mit protestierendem Heulen Jankins an die Oberfläche zurückholte. Wir hatten John Lethbridge geborgen, als ein Schlag durch das Boot ging und die zweite Seilwinde in Stücke gerissen wurde. Etwas Großes, etwas überaus Kräftiges zog am anderen Ende, und alles, was von Jankins auftauchte, war ein leeres Geschirr. Zerrissen, verbogen und blutverschmiert.
Niemals in meinem Leben werde ich den Moment vergessen, als wir John Lethbridge von seinem eiskalten Helm befreiten und in die weit aufgerissenen Augen eines Mannes blickten, der eben erst dem Tod begegnet war. Er atmete in Stößen, außer sich, und als wir nach ihm griffen, schlug er wild um sich. Dann blieb das Herz des Amerikaners stehen, einfach so. Er starb in meinen Armen – triefend nass, zusammengekauert, zitternd, verausgabt, wirres Zeug stammelnd, immer noch voller Angst. Ganz gleich, was Lethbridge in den Tiefen von Loch Ness auch erblickt hat – es muss etwas Furchtbares gewesen sein. Scott hatte sich als erster von uns beiden wieder im Griff. Er eilte zum Funkgerät und schickte einen Notruf in die Nacht hinaus. Vom Rauschen der Lautsprecher abgesehen, war es auf dem See mit einem Mal totenstill.
Wieder an Land, schlug die Stunde der Notärzte und Polizisten. Und es schlug die Stunde der Marinetaucher, die am Tag nach dem tödlichen Tauchgang genau jene Kamera aus den Tiefen bargen, die Jankins bei sich getragen hatte. Von ihm selbst fehlt bis heute jede Spur. Abgesehen von seiner abgetrennten rechten Hand, die das Objektiv auf dem Grund des Sees immer noch umschlossen hielt.
Die Aufnahmen, die Jankins unter Wasser gemacht hat, liegen seit fast dreißig Jahren in einem Londoner Panzerschrank, heißt es. Scotland Yard wird sie uns niemals zeigen. Man hält die Bilder warum auch immer unter Verschluss. Zwei Tage lang wurden Scott und ich in Aberdeen vernommen, während die Pressemeldung über einen tragischen Tauchunfall im ganzen Land die Runde machte: Ein reicher Tourist aus den Vereinigten Staaten, der seit seiner Kindheit an einem nicht erkannten Herzfehler litt, war bei einem Tauchgang im Loch Ness auf tragische Weise ums Leben gekommen. Von einem zweiten Taucher war in den Zeitungen nichts zu lesen. Und auch nichts von den beiden Helfern an Bord der „Maid of Moray“, die John Lethbridge und seinen Assistenten bei der Expedition auf den Spuren des Ungeheuers von Loch Ness begleitet hatten. Der mit dem Fall befasste Inspektor, seinen Namen verriet er uns nicht, verdonnerte Scott und mich zu Stillschweigen.
Bis heute halten wir uns daran, auch wenn die Alpträume mir nach wie vor zusetzen. Wieder sehe ich die beiden Abenteurer vor uns, fest davon überzeugt, dass man sich mit Geld alles kaufen kann. Und ganz gleich, was man mir eines Tages dafür bieten wird, sollten die Polizeiakten doch noch geöffnet werden: Scott und ich werden niemals verraten, was wir damals im Loch Ness erblickt haben, bei Meter zehn, als die Scheinwerfer der beiden Taucher genau das anstrahlten, was ihnen in den Tiefen des Sees zum Verhängnis werden sollte. Ich habe das Ungeheuer nur ein paar Sekunden lang gesehen, verschwommen und verzerrt. Aber ich bin mir sicher, dass es mich durch die Fluten beobachtet hat – mit Augen, die furchterregender nicht sein können. Nur eines weiß ich seit jener Nacht genau: Niemals wieder werde ich in ein Boot wie die „Maid of Moray“ steigen und auf Loch Ness hinaus fahren. So wahr mir Gott helfe.
5. Oktober: Sand
Nevada! Fay beobachtete ihren Liebsten schon eine ganze Zeit lang. Neil hatte seine eigene Art, in die Ferne zu blicken – die eine Hand lässig am Lenkrad, die andere verwegen am Türflügel des Cabrios. So könnte man ihn malen. Der Fahrtwind rauschte Fay durchs Haar, als sie die Interstate westwärts nahmen. Die Sonne hoch über ihnen hatte das Land hier schon vor Ewigkeiten verbrannt – bis auf das karge Strauchwerk, das vom Rand der Straße aus gierig in die Steppe griff. Entlang der Meilensteine ragten gestorbene Bäume in die Weiten und streckten ihre hölzernen Arme in den Nachmittag. Fay lehnte sich zurück. Die viel zu große und viel zu teure Sonnenbrille auf ihrer Nase ließ keinen Blick auf ihre Augen zu. Sie betrachtete sich abermals im Spiegel der Sonnenblende. Ihre Fahrt ins Glück schien kein Ende zu nehmen – immer geradeaus, mit der Tacho-Nadel am Anschlag. Die Lederbezüge des Mustangs kochten. Fay befürchtete, sich ihre Schultern daran zu verbrennen. Und Neil hatte sie gerade auch noch wissen lassen, dass er Sonnenbrillen genauso hasste wie schlechtes Essen und schlechten Sex.
„Ohne Brille wirst du noch blind werden“, rief Fay in das Tosen des Windes.
„In Ordnung.“ Neil grinste schief. „Wenn es sein muss.“
„Ich meine das ernst.“ Fay bemühte sich, möglichst verletzt zu klingen. „Du trägst jetzt Verantwortung.“
„Ach Fay“, sagte Neil. „Mir macht viel größere Sorgen, dass wir auf Reserve fahren, Süße. Schau mal auf die Landkarte.“ Mit diesen Worten deutete er auf das Relikt aus vergangenen Zeiten, das ausgebreitet auf dem Schoß seiner Frau lag, gedruckt auf festem, altem Papier.
„Wir haben vorhin erst getankt.“
„Du wolltest, dass wir diesen Flitzer hier mieten. Hatte noch nie einen Wagen mit solchem Durst und einem dermaßen kleinen Tank.“
Dann war es still. Nur das Schnurren des Motors war zu hören. Fay studierte gehorsam die Karte, ganz so, als betrachte sie Mamas Rezeptbuch. Neil konzentrierte sich derweil auf die Straße und hoffte, dass seine Frau zurechtkam. Fays Smartphone fand hier draußen seit Stunden KEIN NETZ, zu ihrem größten Bedauern, und einen elektronischen Navigator suchte man in diesem Traum von Auto ebenfalls vergeblich.
„Da haben wir es.“ Fay zog ihre Sonnenbrille etwas tiefer, wie eine Lehrerin, die damit beschäftigt war, auf der Veranda daheim furchtbar schlechte Klassenarbeiten zu korrigieren. „Wir sind ungefähr hier.“ Sie deutete auf einen Punkt vor sich.
Neil verzichtete auf einen Kommentar. Zumindest auf einen, den seine Süße hören konnte. Als Gott die Menschen schuf, da wollte er nicht, dass Frauen Krieg führen. Und er wollte scheinbar ebenso wenig, dass Frauen wissen, wo Norden und wo Süden ist. Neil liebte sich für seinen Chauvinismus. Er war die einzige Konstante, auf die man sich hier draußen verlassen konnte. Vom Staub auf der Motorhaube einmal abgesehen.
„Mir ist egal, wo wir sind. Sag mir einfach, wie die nächste Stadt heißt.“
„Saltpoint. Scheint aber ein Kaff zu sein.“ Sie schnitt ihrem Liebsten eine Grimasse und griff ihm dann ins Lenkrad.
„Lass das!“, rief Neil böse. Fay lachte und fuhr ihm über das unrasierte Gesicht.
„Wollte nur sehen, wie gut deine Reflexe sind.“
„Ich habe keine Lust, wegen dir in Schwierigkeiten zu geraten.“
„Ich habe keine Lust, wegen dir in Schwierigkeiten zu geraten“, äffte sie ihn nach. „Suchen wir uns ein Motel und gehen ins Bett!“ Bei diesen Worten griff Fay genau dorthin, wo Neil es seit je her am liebsten hatte. „Okay?“
„Okay“, rief er mit Motoröl in der Stimme. „Wie du willst. Süße.“
Das Biest kann zwar keine Landkarten lesen, weiß aber ziemlich genau, worauf es im Leben ankommt. Neil bemühte sich um klare Gedanken und erblickte einen rostbraunen Wegweiser auf einem Pfahl aus Eisen.
SALTPOINT ZWEI MEILEN
„Da gibt es sicher ein Motel. Es wird bald dunkel.“
Der Wagen brauste von der Interstate und wechselte auf eine marode Landstraße. Ihre Schlaglöcher waren über und über mit Sand gefüllt. Die Sonne hatte den Asphalt an manchen Stellen weich werden lassen, so dass der Mustang selbstbewusst das Profil seiner Reifen wie Schriftzeichen in ihn drückte. Senken ließen den Wagen sachte hin und her schaukeln. Fay hielt sich fest und achtete penibel auf den korrekten Sitz ihrer Sonnenbrille.
„Bist du sicher, dass es hier nach Saltpoint geht?“, fragte sie in das Ächzen der Stoßdämpfer hinein.
„Schilder lügen nicht.“ Neil sah seine Frau an und hoffte, dass es in Saltpoint ein Motel mit wirklich dicken Wänden gab. „Wir brauchen Sprit und ein gutes Bett.“ Fay machte sich abermals daran, genau dorthin zu greifen, wo es ihm seit je her am liebsten war, doch jetzt schob Neil ihre Hände zur Seite. „Später.“
In der Ferne erblickten sie ein weiteres Schild.
Fay las pflichtbewusst vor.
SALTPOINT
(378 EINWOHNER)
HEISST SEINE BESUCHER HERZLICH WILLKOMMEN
Und dann noch etwas – in blutroter Farbe windschief hinzugefügt:
ALLE TOT!
„Okay“, knurrte Neil und ließ das Schild nicht aus den Augen. Das Ausrufezeichen begann zu verlaufen und tropfte in den harten Sand. „Die Leute hier scheinen Humor zu haben.“
„Wir drehen um.“, sagte Fay. „Zehn Meilen, und wir sind in ...“
„Wir fahren weiter.“
„Wir drehen um! Auf der Stelle!“
„Einen Teufel werde ich. Wir müssen tanken.“
Fay schwieg beleidigt. Sie hatte ihren Liebsten vor noch nicht einmal zwei Wochen kennengelernt – in einem Kasino für Marineleute. Nach einer wilden Nacht hatte Neil ihr versprochen, sie möglichst bald in Las Vegas zu heiraten. Zum ersten Mal zog Fay das alles in Zweifel.
Saltpoint war in der Tat ein Kaff und jedes seiner Häuser von Staub, Sand und Zeit ergraut. Schmucklose Bauten reihten sich an der einzigen Straße auf, die durch den Ort führte. An der Wand einer verlassenen Absteige hing eine verblichene Coca-Cola-Tafel, die ein nicht minder blasses Mädchen mit Zahnpasta-Lächeln zeigte.
„Da vorne ist die Tankstelle“, sagte Neil in das Schweigen hinein. „Alles okay.“
Verwahrlosung zog sich über alle Fassaden. Neil suchte Worte. Als er welche in seinen Gedanken fand, hatten sie die Tankstelle fast erreicht.
Trostlos. Das hier ist so trostlos.
„Wo sind die Leute hin?“ Fay schaute sich um. „Nicht eine Seele hier draußen.“
„Was hast du erwartet? Einen Empfang mit Bigband?“ Neil griff nach Fays Hand, doch sie zog sie zurück, ganz so, als habe sie sich an ihrem Lover verbrannt wie an einer heißen Herdplatte.
„Alle tot!“ Fay sah ihren Mann nachdenklich an. „Schilder lügen nicht. Das hast du selbst gesagt.“
„Und du hast zu viel Stephen King gelesen.“
„Sieh doch! Die Häuser da vorne haben keine Türen mehr!“
Neil sah, dass seine Frau Recht hatte. Auch an der blassen Prärie-Villa, die sie jetzt hinter sich ließen, fehlte die Außentür samt Veranda. Stattdessen klaffte ein gezacktes Loch in der Hauswand – wie von einer gewaltigen Faust ins Holz gerammt. Neil dachte an Handgranaten und Panzerfäuste mit großer Wucht. Und er dachte an seine Zeit im Irak.
„Wo sind die Leute hin?“, wollte Fay immer noch wissen. Und sie begann damit, die Vorgärten zu zählen, in denen zerbrochene Haustüren lagen.
Dreizehn, vierzehn, fünfzehn.
Die Tankstelle hatte nur zwei Zapfsäulen. Gleich dahinter lag ein Verkaufsraum mit kleinem Supermarkt. Die Kasse war nicht besetzt und auch der Laden menschenleer. Scheinbar zumindest.
INHABER: DEAN MARELLI
Fay las das Schild am Eingang vor, um sich zu beruhigen, als Neil nebenan den Zapfhahn in den Tank stieß und in den Verkaufsraum spähte. Nur ein paar Gallonen Sprit tanken und dann nichts wie weg. Wir fahren so weit, bis unsere Handys wieder ein Netz finden. Die Glastür des Ladens lag zerplatzt vor einem Regal. Neil betrachtete das Meer aus Scherben. Und Dean Marelli, der am Ufer lag.
MOTORÖL IM ANGEBOT
GREIFEN SIE ZU, SOLANGE DER VORRAT REICHT!
Neil starrte auf die Fensterfront des Supermarktes. Fliegen krochen von innen über das Glas. Die meisten bewegten sich aber in Höhe der Ladentheke, vor der sich ein Anblick bot, den er niemals wieder vergessen sollte.
Weiß der Teufel, was hier passiert ist. Weiß der Teufel, was das hier angerichtet hat. Es ist aus der Wüste gekommen und hat sie alle erwischt. Einen nach dem anderen. Es hat all die Jahre über im Sand gelauert – irgendwo da draußen, wo sie in den 50ern und 60ern Atombomben getestet haben. Es hat geduldig gewartet und sich irgendwann auf den Weg hierher gemacht, um sich auszutoben. Es ist schnell. Es ist kräftig. Und es kann schreiben. Der Mann in der Tankstelle hat bis zuletzt gehofft, dass es seine Frau und ihn verschont.