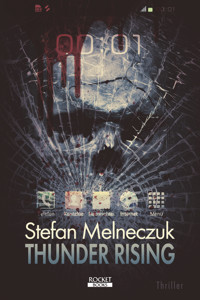Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thriler, Krimi und Mystery
- Sprache: Deutsch
Gefangen! Klebeband, Dunkelheit, Erinnerungen und Angst. Ein Kellerverlies im Briller Viertel. Ein Mädchen, seit Jahren vermisst, dem Tod überlassen. Gibt es einen Weg nach draußen? Die Antwort lauert am anderen Ende der Treppe. Und sie hat Zähne. Ein Thriller aus dem Bergischen Land. Zusätzlich mit drei Short Stories vom Kreuz Wuppertal-Mord und einem Nachwort zum 11. September.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Melneczuk
RABENSTADT
Bereits in dieser Reihe erschienen:
7001 Stefan Melneczuk, Marterpfahl
7002 Frank W. Haubold, Die Kinder der Schattenstadt
7003 Jens Lossau, Dunkle Nordsee
7004 Alfred Wallon, Endstation
7005 Angelika Schröder, Böses Karma
7006 Guido Billig, Der Plan Gottes
7007 Olaf Kemmler, Die Stimme einer Toten
7008 Martin Barkawitz, Kehrwieder
7009 Stefan Melneczuk, Rabenstadt
Stefan Melneczuk
RABENSTADT
(Das andere Ende)
eBook © 2014 by BLITZ-Verlag
Vom Autor neu überarbeitete und erweiterte Ausgabe des im BLITZ-Verlag erschienenen gleichnamigen Titels.
Redaktion: Jörg Kaegelmann
Titelbildgestaltung: Mark Freier
Satz: Winfried Brand
All rights reserved
Print ISBN: 978-3-89840-313-9 E-Book ISBN: 978-3-95719-305-6
lonesome
VORWORT
Diese Erinnerungen werden wahrheitsgemäß wiedergegeben. Sie beruhen auf Tonbandaufzeichnungen, die sich als Kopie im Besitz des Verfassers befinden. Der Abdruck in diesem Buch erfolgt auf Anweisung des Urhebers, der namentlich nicht genannt werden möchte und dem es ein Anliegen ist, auf diesem Weg seine Sicht der Dinge darzustellen. Kontakt zum Urheber der Aufnahmen ist ausgeschlossen, um dessen Privatsphäre zu schützen. Von Anfragen sowohl an den Verfasser als auch an den Herausgeber dieses Buches, die in diese Richtung gehen, ist abzusehen.
Stefan Melneczuk,
Wuppertal, Sprockhövel und Hattingen,
ERSTER TEIL H I G H W A Y T O H E L L
(TONBAND 1 BIS TONBAND 3)
Eins
Bin ich ein Held? Meine Damen, meine Herren, diese Frage werden Sie beantworten, wenn Sie mein Buch gelesen haben. Auf dem Weg dorthin lassen Sie alles hinter sich, was die Zeitungen, das Radio und das Fernsehen über meine Geschichte und das Mädchen vom anderen Ende berichtet haben. Was ich Ihnen anbieten kann, ist Wahrheit ohne Filter. Nicht mehr, nicht weniger. Ich schließe nicht aus, dass Sie mich für verrückt erklären. Dass Sie beim Lesen dieser Zeilen denken, ich hätte angesichts der Dinge, die mir am anderen Ende der Kellertreppe widerfahren sind, den Verstand verloren. Möglich, dass ich da unten tatsächlich Schaden genommen habe.
Sie werden wissen, für welche Seite Sie sich entscheiden, wenn Sie dieses Buch hier ins Regal stellen. Das alles ist verstörend. Selbst heute noch. Ich kann nur eines mit Bestimmtheit sagen: Der Mann, der die vielen Tonbänder mit meinen Erinnerungen niederschreibt, hilft mir sehr. Alles Weitere sage ich nur der Polizei. Ich bin mir sicher, sie wird sich für einige Dinge, die in diesem Buch zur Sprache kommen und zum ersten Mal verraten werden, brennend interessieren.
Mit dem Mist, der über das Mädchen vom anderen Ende und mich verbreitet wurde, lassen sich Güterzüge füllen. Auf einer Gleisstrecke, die in etwa der Entfernung zwischen der Erde und dem Mond entspricht. Bei Erscheinen dieses Buches halte ich mich an einem geheimen Ort auf. Aus gutem Grund. Ich gebe keine Interviews und verkaufe keine Informationen. An keinen Sender und an kein Magazin. Ganz gleich, wie viel Geld man mir auch bietet. Ich passe nicht ins Bild. Mein Leben ist kein Videoclip, in dem junge Damen mit wohlgeformten Hintern durchs Bild wackeln, hübsch im Rhythmus der Musik, die jeder aus zehntausend Endlosschleifen kennt. Ich habe auch keine tausend Freunde auf Facebook. Natürlich wird man mir vorwerfen, mit diesem Buch Kasse zu machen. Und wissen Sie was? Selbst damit kann ich leben. Mir geht es darum, Bilder gerade zu rücken, die seit dem Durchmarsch der Meute im Wohnzimmer meiner Seele schief hängen.
Nicht einer der Reporter hat ein Wort mit mir gesprochen. Das Mädchen vom anderen Ende und ich, wir beide sind seit der ersten Schlagzeile zum Abschuss freigegeben. Und daran wird mein Buch nichts ändern, befürchte ich. Im Gegenteil. Der Schriftsteller, der das hier – meiner Tonbandstimme folgend – aufschreibt und sortiert, trägt seinen Teil dazu bei, dass Sie mich verstehen werden. Ich bin kein Feingeist. Ich bin eine kleine Nummer, die großes Pech im Leben hatte und die bei einem Paketdienst Geld verdient hat, um in Zeiten wie diesen über die Runden zu kommen. Ich brauche kein Mitleid. Ich brauche kein Mitgefühl. Ich will nur, dass man das Mädchen vom anderen Ende und mich endlich in Ruhe lässt. Wir zwei sind durch die Hölle gegangen und wieder zurück. Das reicht.
Zwei
Eine Bitte habe ich noch: Halten Sie dieses Buch von Kindern fern. Halten Sie es auch von Jugendlichen fern, die noch keine Charakterlinie gefunden haben. Und halten Sie es bitte, bitte von allen Erwachsenen fern, die instabil sind und nicht mindestens so fest im Leben stehen wie eine Ölplattform im Nordatlantik. Das müssen Sie mir versprechen. Ich bin mir sicher, dass Bücher wie dieses hier Schaden anrichten, wenn sie in die falschen Hände gelangen. Ich will kein Unheil heraufbeschwören. Wer immer sich zu einer der genannten Gruppen zählt und es bis hierhin geschafft hat, den bitte ich inständig, dieses Buch SOFORT zu schließen und so weit wie möglich wegzulegen. Je öfter ich dieses Tonband zurückspule, und je öfter ich meiner Stimme lausche, umso deutlicher wird mir das.
Unheil ohne Ende. Für nichts anderes steht der klare, kalte Wintertag vor ein paar Jahren, mit dem das alles hier seinen Anfang nahm. Zur falschen Zeit am falschen Ort, zum ersten Mal im Leben, an einem Morgen im Februar, so weit weg und doch so nah. Ich werde Ihnen bald davon erzählen.
Zur falschen Zeit am falschen Ort, das sind im Moment eine Menge Leute. Zum Beispiel in Afghanistan, um im Ernstfall in Kisten nach Hause geflogen zu werden, während man ihren Familien bei Trauerfeiern mit Flaggen auf Halbmast erklärt, warum es so wichtig ist, am anderen Ende der Welt Frieden und Freiheit zu verteidigen. Zu dumm, dass sich die beiden immer noch versteckt halten. Frieden und Freiheit lassen sich einfach nicht blicken, wie laut die Damen und Herren aus den Regierungsmaschinen die beiden auch beim Namen rufen mögen, auf Truppenbesuch live in fernen Weiten, mit Fotografen, der adretten Gattin und dem Talkshow-Hofstaat im Handgepäck und mit festem Schuhwerk in Sandfarbe an den Füßen. Adel verpflichtet. Kriegsähnlich – keiner wie ihr. Mit neuen Orden für unsere neuen Helden. Mit eingeäscherten Zivilisten an Tankwagen. Mit Lügen, bis sich die Balken biegen. Und mit der Hoffnung, dass man das Feuer nicht nach Deutschland trägt. Zur falschen Zeit am falschen Ort, bis es auch zu Hause knallt, an der Heimatfront, im Bahnhof um die Ecke, mit dem Rücken zur Wand, der Maschinenpistole im Anschlag und der Terrorwarnung auf dem Handy, nur für den Fall, dass doch noch etwas schiefgeht und man auch bei uns die Toten zählt. Und schiefgehen wird es. Früher oder später.
Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu hohen Damen und Herren. Ich meide sie, obwohl sie nach dem Schicksalstag im vergangenen Herbst, der mich auf einen Schlag berühmt gemacht hat, mit Einladungen um sich warfen. Immer in der Hoffnung, sich vor laufenden Kameras einmal an meiner Seite zeigen zu können. Zur falschen Zeit am falschen Ort, wieder einmal. Tapferkeit ist mein zweiter Vorname. Wenn Helden überhaupt Vornamen brauchen.
Mit meiner Ruhe ist es vorbei, seitdem man mein Gesicht kennt. Ich war auf mehr als zwanzig Titelblättern. Jetzt ist es an der Zeit, dass alle erfahren, was sich zugetragen hat, bevor das Blitzlichtgewitter über uns beide niederging und andere das Wort für uns ergriffen. Wie sagt man so schön? Ein Mann wächst mit seinen Aufgaben. Demnach müsste mein Kopf bald durch die Wolkendecke brechen und wie Vulkanasche reihenweise Maschinen der Lufthansa zu einer Kurskorrektur zwingen. Hochziehen, Leute! Hochziehen! Riese voraus!
Eine Zeit lang habe ich geglaubt, dass mit falschen Fährten und Geheimnummern alles erledigt wäre. Drei Mal habe ich bislang meine Adresse gewechselt, und erst jetzt sieht es danach aus, dass ich endlich zur Ruhe komme. Im Zeugenschutzprogramm. Zumindest so lange, bis der letzte Waffengang hinter uns liegt. Doch das kann dauern, sagt mein Anwalt. Keine Ahnung, wie oft ich bei der Polizei vernommen wurde. Keine Ahnung, was jetzt noch alles auf mich zukommt. Blitzlicht ist mir zuwider. Ich habe keine Lust, mir noch länger eine Jacke über den Kopf zu ziehen, wenn ich auf dem Weg zum Auto von Fotografen belagert werde wie ein schlecht gesichertes Fort im Land der Indianer. Sind Sie nicht der Typ aus dem Fernsehen? Ich habe keine Lust auf Plaudereien, bei denen ich frisch geduscht, rasiert und geschminkt vor einer Kamera Platz nehmen muss, um wahlweise zu erzählen, wie es ist, ein Held zu sein, oder wie es ist, dem Teufel zu begegnen. Ich bin kein Held, und ich habe auch kein Faible für den Idioten mit Hörnern. Ich will einfach nur, dass Sie erfahren, was in Wuppertal damals wirklich passiert ist, an jenem Regentag im Briller Viertel, der mein Leben verändert hat. Und nicht nur das.
Drei
Waren Sie schon mal mit Klebeband gefesselt? Meines saß unglaublich stramm. Es war so breit wie eine ausgestreckte Hand und zog sich um meinen geschundenen Körper. Etliche Streifen über den Füßen, etliche Streifen an den Handgelenken. Der Streifen, der sich über meinen Mund spannte, reichte dicht unter die Nasenlöcher und lenkte die Luft beim Ausatmen am Kinn vorbei. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, hätte ich damals einen Schnupfen gehabt. Ich wäre in meinen Fesseln erstickt. Einfach erstickt, da unten am Ende der Kellertreppe.
Klebeband war das Erste, das ich zu spüren bekam, als ich wach wurde. Gefolgt von unglaublichen Schmerzen und dem Gefühl, in Glasscherben zu liegen. Allem Anschein nach hatte ich mir auf dem Beton den Arsch gebrochen. Das verdammte Klebeband verfolgt mich bis heute. In meinem Gesicht hat es Spuren hinterlassen, die lange zu sehen waren. Auf meiner Seele auch. Jedem, der noch nicht mit Klebeband gefesselt war, sei versichert: Das Zeug ist hartnäckig. Es reißt nicht, wie sehr man auch daran zerrt und zieht. Wenn überhaupt, dann lässt es sich durchschneiden. Vorausgesetzt, man hat eine Schere oder ein Messer zur Hand – und eben diese frei. Beides war damals nicht der Fall.
So lag ich da, auf dem Rücken, in der Dunkelheit, mit meinem vermutlich gebrochenen Hintern, und fragte mich, wie um Himmels willen ich hierhergekommen war. Die Erinnerung kehrte nur widerwillig zurück. Genau genommen ist sie der Anfang meiner Geschichte. Sieht man mal vom Klebeband ab, dessen Aroma mir wieder auf der Zunge liegt, jetzt, wo ich alles hinter mir habe. Ja, ich hätte schon beim ersten Versuch, mich auf den Bauch zu drehen, ersticken können. Ich hätte mir auf dem Kellerboden das zertrümmerte Nasenbein verschieben und damit den einzigen Luftschacht blockieren können, der mir über dem Klebeband geblieben war. Ich überlegte jenseits aller Panik, ob es wirklich klug war, mich auf den Bauch zu legen. Und selbst wenn mir das Kunststück gelungen wäre: Zu welchem Zweck? Um aufzustehen? Unmöglich! Um davonzukriechen? Wohin denn? Um dem schwarzen Mann zu entkommen, der mich in diese missliche Lage gebracht hatte und der mir hier unten bald noch viel Schlimmeres antun würde?
Nicht allein das Klebeband machte mir zu schaffen. Nur in Stößen atmen zu können und wie ein Paket verschnürt auf dem Boden eines Kellers zu liegen, ist alles andere als eine erhebende Erfahrung. Das versichere ich Ihnen. Nach einer gefühlten halben Stunde schickte ich meine Zunge auf Wanderschaft. Zentimeter für Zentimeter, irgendwo in meinem Mund. Und ich bemühte mich, gleichmäßiger zu atmen. Meine Lippen waren versiegelt. Zu fest saß das Klebeband. Zu stramm war es um meinen Kopf gezogen. So sehr ich meine Zunge auch gegen die Lippen stieß, ich vermochte sie nicht zu teilen. Stattdessen schmeckte es noch intensiver, das Klebeband aus Satans Baumarkt, nur dazu von der Rolle gelaufen, mich auf den letzten Metern meines Lebens davon abzuhalten, so laut es geht zu schreien.
Aber selbst wenn mich irgendjemand draußen auf der Straße gehört hätte: Wären sie wirklich so weit gegangen, die Polizei zu rufen? Zwecklos! Ich befahl meine Zunge zurück. Auf dem Weg dorthin streifte sie einen meiner Zähne rechts außen. Oder zumindest die Stelle, wo er hätte sein müssen. Die Zungenspitze glitt durch eine Lücke, wachsam wie ein Spion, der keinen Feierabend macht, so müde und abgekämpft er auch ist. Ein Canyon in meinem Mund, gut abzutasten. Erinnern Sie sich noch an Ihre Kindertage und an jene Zeiten, als die Milchzähne Sie verließen, um etwas Hochwertigerem Platz zu machen? Haben Sie damals auch voller Ehrfurcht die ersten Lücken in den eigenen Reihen erkundet und zum ersten Mal in Ihrem Leben eigenes Blut geschmeckt? So erging es mir, stramm gefesselt auf dem Kellerboden, schnaufend wie eine Lokomotive mit Altersschwäche, die verzweifelt versucht, wieder auf Touren zu kommen. Die Zahnlücke verhieß nicht Gutes. Sie zeigte mir, wie fest der Teufel, dem dieser Keller gehörte, zugeschlagen hatte.
Meine Suche nach dem Zahn blieb erfolglos. Wahrscheinlich verschluckt.
Vier
Nach draußen! Raus ans Tageslicht! Raus an die frische Luft! Raus in den Regen, der das Briller Viertel fest im Griff hatte. Kennen Sie Wuppertal? Na klar, werden einige jetzt sagen: Wuppertal, das ist doch die Stadt der Schwebebahn. Klassiker und einst gefallener Engel, made by Eugen Langen. Heavy Metal für Millionen. Einmal von Oberbarmen nach Vohwinkel und zurück. Vom Sonnborner Ufer aus ein Abstecher in den Wuppertaler Zoo. Elefantenkinder gehen immer. Sie kennen sicher das ebenso berühmte wie zusammenmontierte Foto von Tuffis Sprung aus der Schwebebahn in die Wupper, ein Heidenspaß im Juli 1950. Rüssel voraus! Beim nächsten Besuch geht es ins Historische Zentrum oder raus zu den Fledermäusen auf der Nordbahntrasse, die im Tunnel am Engelnberg Radfahrer fressen. Dann ins Opernhaus oder ins Von der Heydt-Museum, vorausgesetzt, man steht auf falsche Van Goghs und alte Schinken.
Wuppertal, das ist die Stadt der zehntausend Politessen. Hier verpasst man selbst den Reitern der Apokalypse an der Berliner Straße ein Knöllchen. Danach werden die Herren beim Durchritt auf der B7 geblitzt. Wuppertal, das ist die Stadt der zehntausend Radarwagen, Starenkästen und Einbahnstraßen. Eine nicht unerhebliche Erkenntnis für jemanden, den das Schicksal dazu verdammt hat, als schlecht bezahlter Bote zu arbeiten, der Pakete ins Bergische Land liefert. Wuppertal, das sind Pina Bausch, Johannes Rau, Friedrich Engels und Stefan Derrick. Hier eröffnete Loriot gemeinsam mit Herrn Erwin Lindemann und dem Papst im Herbst eine Herrenboutique. Hier spielt der WSV im Stadion am Zoo in etwa so konstant wie das Wetter im April. Und hier trauert man seit mehr als fünfzig Jahren der Barmer Bergbahn nach. Wie auch dem Thalia-Theater in Elberfeld.
Seitdem auch noch das Schauspielhaus geschlossen wird, fallen Edelfedern aus dem ganzen Land in diese Stadt ein, um an Bergischen Kaffeetafeln das Klischee gepflegter Verwahrlosung zu feiern – im Schatten fehlender Solidarbeiträge und immer schön im Einrichtungsverkehr, während im Tal die Wupperbrücken weiter um die Wette rosten. Verdreckte Ermittlungen gewissermaßen. Hier traf Udo Lindenberg einst Erich Honecker und schenkte ihm eine E-Gitarre. Hier wurden selbst die Kanaldeckel versiegelt, als Jassir Arafat 1997 die Stadt besuchte. Hier kamen der Kobold, die Raufasertapete, etliches Werkzeug und Else Lasker-Schüler zur Welt. Und hier hat Gary Cooper einst die Deutschlandpremiere von ZWÖLF UHR MITTAGS gefeiert und gleich noch mit einem Zoobesuch verbunden.
Wuppertal, das ist die Stadt der Schwimmoper und der Historischen Stadthalle auf dem Johannisberg. Die Stadt des Dauerregens, des Skulpturenparks, der Bergischen Synagoge, des Kriegers und der Kaiserin, des Barmer Brauhauses und des Rex-Theaters. Wuppertal ist Free Jazz und Manta, Manta. Die Stadt der ewigen Nörgler und der schlechten Laune. Von hier kommt das Aspirin, das ich beim Diktat dieser Zeilen schlucke. Wuppertal, die Stadt des Heiligen Bergs, der Bekennenden Kirche und der Barmer Erklärung. Und hier lief einst alles wie geschmiert, als sich ein Abteilungsleiter der Bauverwaltung in den wilden 90ern im Dienstzimmer von Barmer Handwerkern einen Baldachin aufhängen ließ. Tausendundeine Nacht in Elberfeld, mit einer Pistole im Schreibtisch und einem Draht zum Geheimdienst im Nahen Osten. Mehr als hundert Jahre Knast und sechshundert Beschuldigte kamen Jahre später zusammen, als das alles verhandelt wurde – auf der Suche nach verschwundenen Millionen. Noch drei Fragezeichen, Euer Ehren?
Für mich ist Wuppertal die Stadt der Raben.
An jenem Regentag im September führte mich mein Job als Paketbote ins Briller Viertel mit seinen erhabenen Villen aus der Gründerzeit, den hohen Baumdächern und dem frisch gemähten Rasen. Seit es Navigationsgeräte gibt, die diesen Namen verdienen, haben selbst Wuppertals Einbahnstraßen ihren Schrecken verloren. Gut möglich, dass GPS-Satelliten beim Militär nur dazu entwickelt wurden, um Metropolen wie diese hier vor dem Untergang zu bewahren. Was Stadtpläne und Verkehrsschilder nicht schaffen, erledigt Technik.
Liebe und Hass wohnen in Wuppertal Tür an Tür – das kann ich nur unterstreichen. Manchmal glaube ich, das liegt am Trinkwasser, das zwischen Oberbarmen und Vohwinkel durch die Leitungen und Kanäle strömt. Wissenschaftliche Beweise stehen nach wie vor aus. Bevor mir nun der geballte Unmut aus dem Tal der Wehklagen entgegenschlägt: Ein paar meiner besten Freunde wohnen in Wuppertal. Fünfzig in Barmen und fünfzig in Elberfeld, wie es sich gehört.
Fest steht, dass ich an jenem Septembertag die A46 an der Abfahrt Katernberg verlassen habe, um ins Briller Viertel zu kommen. Zuvor hatte ich noch ein Buchclub-Paket in Ronsdorf ausgeliefert und nach dem Stau auf der A1 und der Parkstraße auf Lichtscheid den Burgholztunnel und das Sonnborner Kreuz hinter mir gelassen. Im Kofferraum meines Autos – ich fuhr seit meinem Absturz aus der Mittelklasse einen altersschwachen Opel Astra mit dreifach geschweißtem Unterboden und roter Feinstaub-Plakette, der auf Schlagloch-Pisten in etwa so laut klapperte wie ein ausgemusterter Nato-Panzer – lag ein Paket, das so schwer war wie ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. An den Adressaten kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich bin niemals bei ihm angekommen. Weiß der Teufel, wer den Job später für mich erledigt hat.
Bonbons für alle, die das hier mit einem Stadtplan an ihrer Seite lesen: runter von der A46 auf die Briller Straße, bergab durch eine lange Häuserschlucht, dann rechts auf die Katernberger Straße Richtung Kaiserhöhe, von nun an immer bergauf, die Dame vom Navigationsgerät im Ohr. Sie wissen schon, die junge Frau, die nach Feierabend zur strengen Lehrerin mit hochgeschlossener Bluse im engen Rock wird und sofort den Rohrstock rausholt, wenn man ungezogen ist und zur Bruchrechnung partout nicht an die Tafel kommen will. An der nächsten Kreuzung links abbiegen in die Viktoriastraße. Jetzt rechts abbiegen und dem Verlauf der Straße folgen.
Was für ein Fest! Drei weitere Ansagen, dann verstummte die strenge Lehrerin. Akku leer. Nichts zu machen. Mir blieben vier Alternativen: das Ladekabel für den Zigaretten-Anzünder finden oder aber ein Blindflug auf den letzten Metern. Vielleicht auch weiter zu Fuß. Oder einen Passanten beziehungsweise Anwohner nach dem Weg fragen. Das ist in Wuppertal allerdings so gut wie aussichtslos: Entweder Sie treffen niemanden (jedes Jahr verliert die Stadt statistisch gesehen zweitausend Einwohner), oder aber derjenige, der Ihnen über den Weg läuft, wohnt zwar schon seit mehr als hundert Jahren in der Gegend, weiß aber immer noch nicht, wie die Straße vor seiner Haustür verdammt noch mal heißt. Das ist mir in Wuppertal schon häufiger passiert. Ich frage mich, wie die Leute den Weg nach Hause finden, wenn sie nicht die gewohnte Strecke nehmen können, weil wieder einmal eine Straße für einen der zehntausend Regenwasserkanäle aufgerissen wird.
Gedanken ändern nichts am Ladezustand eines Akkus: Die Navigatorin mit dem Rohrstock schwieg beharrlich. In der Hoffnung, fast am Ziel zu sein, ließ ich meinen Wagen an einen hohen Bordstein rutschen, stellte fluchend den Motor ab und entschied mich für einen hoffentlich kurzen Streifzug durch das Briller Viertel – mit dem Paket unter dem Arm. Ich schaltete das Radio aus, in dem gerade über Stuttgart 21, Gorleben und mit Demokratie gefüllte Wasserwerfer gestritten wurde. Danach ein Song von Sascha Gutzeit. Ich bin die Vorgruppe. So stieg ich aus, und mein Irrlauf durch das Villenviertel nahm seinen Anfang. Ich parkte hinter einem orangefarbenen VW Bully aus den 70ern – verbeult, verrostet und am Heck mit einem kreisrunden Aufkleber versehen, dessen Schriftzug schon vor langer Zeit verblasst war: WENN DEIN GOTT TOT IST, DANN NIMM DOCH MEINEN! Diese Worte gingen mir wie ein Echo durch den Kopf, als ich den Bus des Missionars mit seinen abgefahrenen und fast schon platten Reifen hinter mir ließ. Ich verfranste mich mit jeder Straße nur noch schlimmer, lief mal wieder gegen die Uhr und war nach fünf Minuten außer Atem.
Achtung! Das Briller Viertel gehört zum Stadtbezirk Elberfeld-West. Mehr als zweihundert Häuser unter Denkmalschutz, etliche aus der Gründerzeit, so viele, wie kaum woanders in Deutschland. Immer eine gute Adresse. Hier ruht altes Geld hinter hohen Mauern, und selbst die Bürgersteige sind breiter als anderswo. Einst war die Briller Straße die Demarkationslinie zwischen Arm und Reich: auf der einen Seite der Ölberg mit seinen Arbeiterquartieren, auf der anderen Seite die Ottenbrucher und Briller Höhen mit ihren Anwesen.
Als in Zeiten der Industrialisierung im Tal der Wupper noch die Post abging, suchten Fabrikanten nach geeigneter Erde für ihre neuen Residenzen jenseits der Talachse – und fanden diese ab 1880 am Briller Bach: viel Grün, viel Land, fast immer am Berg, wie es sich gehört in Wuppertal, mit einem Ausblick bis in den Barmer Wald. Gut viertausend Menschen leben hier auf etwas mehr als einem Quadratkilometer Fläche, alle mit Regenschirm in der Hand geboren. Frei stehende Villen gibt es ebenso wie monumentale Häuserzeilen in Parklandschaften, abgeschirmt hinter Mauern und Zäunen, im Schatten riesiger Eichen, Buchen und Kastanien, die mindestens so alt sind wie die Häuser mit Fassaden-Ornamenten und hohen Schornsteinen. Die reichen weit über den Dachfirst, inspiriert von britischer Architektur im Landhausstil, schätzen gelernt auf Geschäftsreisen industrieller Bauherren durch das Vereinigte Königreich. Viele Garagen, die dem Berg abgerungen wurden, sind mit schweren Toren aus Eichenholz versehen und säumen Straßenschluchten, die mindestens so steil sind wie die in San Francisco. Nur mit dem Unterschied, dass Mike Stone und Steve Keller sich niemals hier haben blicken lassen.
Manche Villen sind mit Kuppelbauten versehen und künden von Herrenzimmern, aus denen man einst in betuchter Runde die Sterne über der Stadt zu betrachten pflegte. Mieter ließ man erst in Zeiten der Inflation einziehen, zähneknirschend. Glaubt man der Geschichte, blieben die Villen des Viertels von den verheerenden Bombennächten im Mai und Juni 1943 weitestgehend verschont. Hier wohnten Menschen von Bedeutung, mit besten Kontakten ins europäische Ausland. Mit Dynastien verscherzt man es sich selbst im Weltkrieg nicht. Einige Straßen tragen die Namen preußischer Militärs. Und auch hier gibt es Treppen. Viele Treppen. Türme, Zinnen, Laternen und Fenster – so groß wie Plakatwände. Auf dem Berg pflegten Kutscher und Chauffeure einst eigene Häuser an den Anwesen ihrer Dienstherren zu bewohnen. Die Sonne scheint durch lange Salonscheiben, so weit das Auge reicht. Einen Katzensprung vom Deweerthschen Garten und vom Luisenviertel mit seinen Kneipen entfernt. Else Lasker-Schüler war auf den Briller Höhen einst ebenso zu Hause wie Armin T. Wegner.
Im Briller Viertel mit seinen Efeu-Mauern wohnt seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Menge Geld – wenn man nur die richtige Adresse erwischt. Weitgehend frei von Lärm und Abgasen. Das haben schon die Industriellen, die einst neben ihren Fabriken im Tal gewohnt hatten, zu schätzen gewusst. Ich hoffe, mein kleiner Ausflug reicht zur Erklärung der Ehrfurcht. Wer mir immer noch nicht glaubt, der sollte selbst nach Wuppertal kommen und von der Sadowastraße aus durch das Briller Viertel laufen. Und vielleicht hören auch Sie beim Bergsteigen in der Ferne dann den Kaiserwagen der Schwebebahn durch das Tal heulen wie ein Ungetüm aus Stahl.
Fünf
Sie glauben ja nicht, wie viele Leute sich ihren Einkauf im Online-Sexshop von jenem Paketdienst liefern lassen, für den ich damals gearbeitet habe. Die Herrschaften wollen nicht, dass der Briefträger, dem man täglich über den Weg läuft, auch noch jenes Spielzeug bringt, das immer dann zum Einsatz kommt, wenn die Kinder um halb neun ins Bett geschickt werden. Sie wissen, was für Spielsachen ich meine. Alle anderen, die jetzt rätseln, verweise ich an die Lehrerin mit dem Rohrstock. Und noch ein Tipp: Das Spielzeug, um das es hier geht, gibt es nicht bei Toys R Us.
Als Paketbote kannte ich die meisten Firmen für solche Sortimente, so unauffällig sie sich auch aus Rücksicht auf ihre Kundschaft nennen. Keine Ahnung, was ich damals alles an Haustüren abgeliefert habe. Faustformel aus jahrelanger Erfahrung: Je größer die Scham ist, umso größer fällt das Trinkgeld für den Mann vom Paketdienst aus. Etliche Sorten von Geiz habe ich auf meinen Touren erlebt. Sie wissen schon, die gute alte Sie-freuen-sich-doch-ganz-bestimmt-auch-über-30-Cent-Nummer, wahlweise mit einem anderen Betrag, aber stets unter der magischen Ein-Euro-Grenze.
Und auch sonst wurde ich als Paketbote freundlich bedacht. Besonders vor Ostern (ganz okay) und vor Weihnachten (je nach Konjunkturlage und dem Stand der Preise für Rohöl auf dem Weltmarkt phänomenal). Natürlich bin ich im Dienst auch einigen Damen begegnet, die mir an der Haustür ihre Lebensgeschichte erzählten und zumindest mit dem Gedanken spielten, mich dafür mit einem frisch gebügelten Fünf-Euro-Schein oder einer Tasse Kaffee zu belohnen. Und natürlich erfüllten manche Begegnungen an der Haustür die gängigen Klischees vom Zustelldienst, auch wenn die einzige Frau, die mich wirklich in Versuchung führen wollte, damals sturzbetrunken war. Ich erinnere mich noch gut an jenen Morgen im Mai, draußen am Stadtrand, in einer dieser Reihenhaussiedlungen auf der grünen Wiese, in denen es von einsamen Hausfrauen (und solchen, die es ab Mitte dreißig noch werden wollen) nur so wimmelt. Die Ortschaft und die Adresse (mit Blick auf den Kemnader Stausee und die Burgen der Ruhr-Universität Bochum) nenne ich nicht. Diskretion ist alles. Ich habe damals zwei Mal an der Reihenhaustür geklingelt und dem Summen eines elektrischen Rasenmähers gelauscht, der einem sehr entspannten und sehr ausgeschlafenen Frührentner zwei Häuser weiter gehörte.
Die Fassade war in Bruchstein-Optik gehalten, ansprechend und gepflegt. Gleiches galt für die groß gewachsene Dame mit pechschwarzem Haar, die kurz darauf die Haustür öffnete, den Mann vom Paketdienst musterte und ihn zu sich in den Flur zog. Gut zehn Jahre lagen zwischen uns beiden. Und die faltigen Landschaften eines Morgenmantels aus Seide – durchschaubar wie ein Wahlversprechen am Ende einer Legislaturperiode. Um eindeutig zweideutige Spekulationen gar nicht erst aufflammen zu lassen: Nein, ich habe mich im Ruhrtal damals nicht verführen lassen. Ich wollte sie nicht, so sehr sie auch versucht hat, mich mit bloßen Händen vom Gegenteil zu überzeugen. Eine verlorene Schlacht ist noch lange kein verlorener Krieg.
Die Dame trug unter ihrem Morgenmantel Unterwäsche aus schwarzer Spitze. Ziemlich teuer und ziemlich exklusiv, soweit ich das im Nahkampf überblicken konnte. Keine Ahnung, ob sie auf mich gewartet hatte oder ob das eine spontane Nummer war, die sie immer dann wählte, wenn sie wieder mal allein zu Hause war. Umso beherzter griff sie abwärts. Ich entkam ihr nur in letzter Sekunde, das Paket in den Händen wie ein Ausdruckstänzer der späten 20er-Jahre. Mit einem Satz zur Tür brachte ich mich aus der unmittelbaren Gefahrenzone und starrte in einen endlos tiefen Ausschnitt. Solche Panoramen erleben sonst nur Tour-de-France-Fahrer auf Berg-Etappen – in Aussicht auf die nächste Blutwäsche.
Warum ich mich damals nicht gehen ließ? Die Antwort ist einfach: So beherzt die Frau auch zugriff, so wenig konnte sie verhindern, dass mir auf einen Schlag jener grauenhafte Wintertag in den Sinn kam, der mich zum Mann vom Paketdienst gemacht hatte. Jener Wintertag vor ein paar Jahren, der mich in den Abgrund gerissen hat. Jener Wintertag, an dem ich mir die Seele aus dem Leib geschrien und Gott verflucht habe. Jener Wintertag, vor dem ich immer noch davonlief. Diesmal in einem Hausflur mit cremefarbener Tapete, als Abgesandter einer anderen Welt, ein himmelblaues Quelle-Paket in den Händen und eine Dienstuniform mit Schirmmütze am Leib, während sich eine fremde Frau an meinem Gürtel zu schaffen machte und eindeutig zweideutige Sachen raunte. Wohin des Weges, junger Mann? Wahrscheinlich hat sie nur auf den Paketdienst gewartet. Viel zu dünn angezogen, mit präzise lackierten Fingernägeln, schick gemacht zum Scharmützel – und bereit für einen Dokumentarporno, der in weich gezeichneten Nahaufnahmen den Leidensweg unausgeglichener Hausfrauen im ausgehenden Mittelalter zum Thema macht.
Da stand sie also, die Hausherrin, die ihre besten Jahre hinter sich und es augenscheinlich auf den Kurier des Zaren abgesehen hatte. So nannte sie mich im Eifer des Gefechts und stieß mich auf dem Weg ins Wohnzimmer in einen Kleiderständer. Das bescherte Michael Strogoff einen Fleck an der Hüfte, mindestens so blau wie das auszuliefernde Quelle-Paket. Aber selbst das war mir egal. Irgendwo habe ich diese Erkenntnis einmal gelesen und zitiere sie aus gegebenem Anlass: Auch auf alten Geigen lassen sich schöne Melodien spielen.
Schlank war sie. Als mir das Paket aus den Händen rutschte, wäre es ihr lieb gewesen, meine zitternden Finger in jener Löwenmähne zu spüren, die über ihre nunmehr nackten Schultern fiel. Ein in die Jahre gekommenes Gesamtkunstwerk, unter dem Morgenmantel versehen mit BH und Slip, übergestreift nur für den Kurier des Zaren, während ihr Ehemann im Außendienst Versicherungen verkauft. Oder Bausparverträge. Komm her, mein Kleiner, hat sie mir zugerufen, dem Mann vom Paketdienst. Schön, dass du da bist. Ich rieche noch heute ihr Parfum. Süß und schwer. Aufgetragen für einen Schusswechsel um kurz nach elf, als ihr Nachbar immer noch damit beschäftigt war, den Mai-Rasen zu mähen, während Heerscharen junger Leute – gefangen in Steuerklasse I – genau jenes Geld verdienten, mit dem der alte Herr da hinten zwei Mal im Jahr für acht Wochen nach Teneriffa flog, um in den Armen tabuloser Nachtklub-Tänzerinnen die Sau rauszulassen.
Ich glaube, ich hätte damals alles mit dieser Frau anstellen können. Wie in einem dieser schlechten Fernsehsketche, bevor es nur in Socken hastig in den Kleiderschrank geht, weil ihr Mann ausgerechnet heute eine Stunde früher von der Arbeit kommt, nachdem er genug teure Versicherungen (oder Bausparverträge) verkauft hat und selbst einmal Kurier des Zaren sein möchte.
Stattdessen habe ich es wieder aufgehoben und der Lady in Black auf die Füße fallen lassen, das gut zwei Kilogramm schwere Quelle-Paket. Die Frau in Schwarz hat geheult wie am Spieß. Mistkerl! Du willst es auf die harte Tour, was? Sie zeigte mir nun ihr wahres Gesicht, über Brüsten so handlich wie Braeburn-Äpfel, mit letzter Kraft im Zaum gehalten unter pechschwarzer Spitze, gespickt mit harten Knospen. Gott allein weiß, wie ich es damals geschafft habe, durch den Flur zurück nach draußen zu stolpern, ohne mir die Beine zu brechen. Die Luft im Mai hat etwas Befreiendes, finden Sie nicht auch?
Mag sein, dass manche Herren der Schöpfung jetzt den Kopf schütteln und sich fragen, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Mag sein, dass der eine oder andere gerne der Kurier des Zaren gewesen wäre. Mir reicht es zu wissen, damals alles richtig gemacht zu haben: Ich war mit meinen Gedanken überall, nur nicht im Hier und Jetzt. Ich war wieder einmal an jenem Ort, an den es mich immer dann verschlägt, wenn ich unter Stress stehe. Ich durchlebte wieder einmal den gottlosen Wintertag vor ein paar Jahren – und schrie mir die Seele aus dem Leib. Immer in der Hoffnung, mein Schicksal im letzten Moment zu wenden und den Zug in die Dunkelheit aufzuhalten. Irgendwie.
Das Allerletzte, woran ich dachte, waren alte Geigen und schöne Melodien in Kombination mit einem Büstenhalter aus französischer Spitze, der sich vorne zwischen den Körbchen bequem mit einem Bügelverschluss öffnen lässt, als letztes Hindernis auf dem Weg zu Miss Braeburn. So stand Michael Strogoff wieder draußen im Vorgarten, gerade noch einmal dem Sex-Inferno entkommen, vor der Haustür, mitten im Wonnemonat. Ich zog meinen Dienstgürtel zurecht, suchte nach Atem und war augenscheinlich erregt.
Sechs
Ich sehe sie immer noch vor mir. Als wir Blickkontakt hatten, lagen keine zehn Meter zwischen uns. Ich stand, wie vom Blitz getroffen, weiter unten auf der Straße auf dem Gehsteig, gerade eben eingebogen mit dem Paket in den Händen. Schnaufend und verzweifelt nach einem Straßenschild suchend, das mir nach der Kapitulation der GPS-Lehrerin zu helfen vermochte. Für den Fall der Fälle trug ich einen alten Stadtplan in der Hosentasche. Am Hintern links, durch häufigen Gebrauch zerfasert wie die Qumran-Rollen, nur nicht ganz so wertvoll. Gemeint ist der Stadtplan. Nicht der Hintern.
In diesem Moment sah ich wirklich nicht aus wie ein Held. Zumal Nieselregen fiel und ich einfach nur zurück ins Auto wollte, sobald das verdammte Paket ausgeliefert war. Mein nächstes Ziel lag am Dönberg, siebzig Schlaglöcher nordwärts. Den mühsam erkämpften Feierabend vor Augen, hatte ich mit allem gerechnet, nur nicht mit diesem Mädchen da. Als ich die Kleine sah, stockte mir der Atem. Ihr Anblick verschlug mir die Sprache. So läuft das sonst nur bei Liebe auf den ersten Blick. Sie wissen schon, in magischen Momenten, wenn sich die Erde auf einmal nicht mehr um die Sonne dreht. Einen Augenblick lang zumindest, weil das kosmische Sinfonieorchester aus dem Takt kommt und in allen Konzertsälen zur gleichen Zeit die Sicherungen durchbrennen. Der Dirigent hat seine Musiker nicht mehr im Griff und sucht verzweifelt nach passenden Noten, obwohl er ahnt, dass er sie nicht finden wird. Selbst Toshiyuki Kamioka kann da nichts machen. Auch in meinem Orchester ging es damals drunter und drüber, als ich wie versteinert dastand und das Mädchen vom anderen Ende anstarrte.
Angst und Entsetzen. Das Mädchen, das vor mir auf dem nassen Asphalt hockte, glich einer Karikatur oder einem Alien, das es hierher verschlagen hat und das sich seiner Fremdheit bewusst wird, weil ein Erdling es anglotzt. Das erste Detail, das mir ins Auge fiel, waren die kurzen, schwarzen Handschuhe, die das Mädchen auf dem Boden trug. Fahrradhandschuhe, die an den Fingerkuppen endeten. Mit ausgestreckten Armen kroch sie auf den Bürgersteig. Bist du hingefallen? Sie trug ein dunkles T-Shirt, das sich über ihre Oberarme und ihre Brust spannte, dazu Jeans. Als sie ein Stück zur Seite rutschte, immer noch auf dem Boden, erblickte ich Knieschoner. Ihre Kunststoffkuppen kratzten über den Gehsteig. Hingefallen?
Fehlanzeige. Weit und breit kein Skateboard, kein Fahrrad zu sehen. Ihre Füße steckten in hellen Sneakers. Ihr Gesicht war nichts als eine Andeutung. Langes Haar bis über die Wangen, pechschwarz und unordentlich.
„Kann ich dir helfen?“, rief ich dem Mädchen am Boden zu. Ich hatte den Abstand zwischen uns beiden verkürzt, das Paket immer noch in den Händen. Ihre Augen waren nicht mehr zu sehen. Ein Königreich für einen Kamm oder eine Bürste!
Auf dem ersten Meter bestand die Hundeleine aus einer dünnen, aber äußerst stabilen Kette und mündete in nicht minder stabilen, schwarzen Kunststoff. Als das Mädchen seinen Kopf hob und ich wieder in sein blasses Gesicht sah, hatte ich freien Blick auf das Halsband. Es war breit, schwarz und mit einer Doppelreihe spitz zulaufender, schimmernder Nieten versehen. Das Ding sah unglaublich gefährlich aus, martialisch, und zeichnete sich auf schneeweißer Haut ab. Tausend Gedanken prasselten auf mich ein wie ein Regenschauer. Und nicht einer ließ sich abtrocknen.
Versteckte Kamera, raunte es tief in mir, das hier ist die versteckte Kamera! Gleich kommt der Moderator um die Ecke, und das Mädchen mit dem Halsband steht laut lachend auf, um sich den Bauch zu halten und die Handschuhe nach mir zu werfen. Erwischt, die versteckte Kamera hat nun auch dich erwischt, und du ziehst dazu ein selten blödes Gesicht! Sie werden dich bitten, schriftlich dein Einverständnis zu geben, damit sie dieses Filmchen hier am Samstagabend zeigen können. Zur besten Sendezeit. Und gleich danach begrüßt der smarte Moderator die Jungs von Spandau Ballet, die ihre zehnte Comeback-Single vorstellen, wieder einmal zurück in die Charts wollen und sich darauf verlassen, dass am Schluss der Sendung wie vereinbart ihre Tournee-Termine als Lauftext eingeblendet werden.