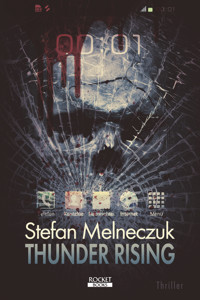Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thriler, Krimi und Mystery
- Sprache: Deutsch
Eine unheimliche Mordserie erschüttert das Ruhrgebiet und das Bergische Land. Das Nachtgespenst hält die Polizei in Atem, tötet wahllos und weckt dunkle Erinnerungen an den Kirmesmörder Jürgen Bartsch. Der Kreis schließt sich viele Jahre später. Und er ist rot wie Blut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Melneczuk
WALLENSTEIN
Bereits in dieser Reihe erschienen:
7001 Stefan Melneczuk, Marterpfahl
7002 Frank W. Haubold, Die Kinder der Schattenstadt
7003 Jens Lossau, Dunkle Nordsee
7004 Alfred Wallon, Endstation
7005 Angelika Schröder, Böses Karma
7006 Guido Billig, Der Plan Gottes
7007 Olaf Kemmler, Die Stimme einer Toten
7008 Martin Barkawitz, Kehrwieder
7009 Stefan Melneczuk, Rabenstadt
7010 Wayne Allen Sallee, Der Erlöser von Chicago
7011 Uwe Schwartzer, Das Konzept
7012 Stefan Melneczuk,
Stefan Melneczuk
WALLENSTEIN
© 2014 by BLITZ-Verlag
Redaktion: Jörg Kaegelmann
Titelbildgestaltung: Mark Freier
Satz: Winfried Brand
www.BLITZ-Verlag.de
ISBN 978-3-95719-314-8
Für meinen Bruder Michael und meine Schwester Susanne.
If you want blood – you’ve got it.
Mir kommt das Leben vor, als wenn wir in unserer eigenen Falle gefangen sind. Glauben Sie wirklich, dass es so einfach ist, verrückt zu werden?
Wallenstein, mit eigentlichem Namen Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein (1583 bis 1634), entstammte einem altböhmischen Adelsgeschlecht, konvertierte um das Jahr 1600 zum Katholizismus, war Feldherr im Dreißigjährigen Krieg und Oberbefehlshaber der kaiserlichen Streitkräfte, auf Seiten der Katholischen Liga im Kampf gegen protestantische Mächte in Deutschland sowie gegen Dänemark und Schweden. Der Kaiser ächtete ihn, als ihm von langer Hand geplanter Hochverrat unterstellt wurde. Wallenstein starb der Überlieferung nach, gemeinsam mit seinen engsten Vertrauten, am 25. Februar 1634 durch die Hand kaisertreuer Offiziere.
PROLOG
Gott sieht dich. Daran gibt es keinen Zweifel, hier oben, im Dachzimmer. Er behält dich im Blick. In jeder Minute. In jeder Sekunde. Und genau deswegen ist der kleine Junge auch so tapfer. Seit fast einer Stunde hält er seine Arme oben, die Heilige Schrift in den zitternden Händen, weit von sich gestreckt, im Halblicht. Obwohl er kaum etwas sehen kann. Obwohl er kaum noch Luft bekommt unter dem Bettlaken, das er sich über den Kopf ziehen musste, wieder einmal, zur Strafe. Von Westen schiebt sich ein schweres Gewitter heran. Das letzte Gewitter des Sommers. Sein Grollen ist durch das Dachfenster zu hören. In der trockenen Luft, die zwischen diesen Wänden hier nach altem Holz riecht. Das Haus schwitzt vor Erwartung. Das Unwetter kommt näher, langsam, aber sicher. Mit grimmigem Wind im Nacken. Es beeilt sich nicht. Warum auch? Die Zeit ist auf seiner Seite. Niemand entkommt dem aufziehenden Sturm. Das Gewitter ist die Ruhe selbst.
Die Engel folgen dem Licht der Blitze. Sie wissen, dass nur sie dich heute Nacht vor dem Teufel retten können. Wenn sie nicht zu spät kommen. Wenn sie nur nicht zu spät kommen. Draußen riecht es nach Heu, eilig in die Scheunen gefahren unter dem pechschwarzen Himmel. Die Engel werden immer lauter. In der Ferne lärmt ein Traktor, mit keuchendem Motor, angestrengt einen Anhänger durch die Felder schleppend. Das Schlagen der Ladeklappe ist selbst hier oben zu hören. Keine Zeit mehr. Die Sanduhr läuft. Das Gewitter naht. Auf den Feldern zieht sich alles zurück. Die Bauern treiben ihr Vieh in die Ställe, um zu verhindern, dass Gott in seinem Zorn es da draußen erschlägt.
Der Junge mit der schweren Bibel in den Händen wünscht sich, jetzt irgendwo da unten zu sein. Bei den Menschen. Bei denen, die ihn beschützen können vor dem, was gleich kommt. Er würde alles dafür geben, jetzt bei ihnen zu sein. Weit weg, ganz weit weg. Nur nicht in diesem Zimmer hier. Lange hält er nicht mehr durch. Die Heilige Schrift wiegt jetzt hundert Kilo. Mindestens. Und es ist heiß, so heiß hier drunter. Der Junge, der in seiner Not das Beten verlernt hat, bekommt kaum Luft. Und da ist sie wieder, die Stimme von der anderen Seite, gut zu hören, alles durchdringend, obwohl er im Dachzimmer alleine ist: Gott sieht dich, kleiner Sünder. Er liest jeden deiner Gedanken. Egal, wo du bist. Egal, was du machst. Enttäusche ihn nicht. Enttäusche ihn nicht noch einmal, hörst du? OB DU MICH GEHÖRT HAST, WILL ICH WISSEN! Und dann ist es wieder still in der Kammer.
Die Engel sind jetzt hoch oben über dem Haus. Sie kreisen verzweifelt über den Feldern und tauchen durch Wolken aus Zorn. Die Engel hoffen, dass sie nicht zu spät kommen. Sie rufen den Jungen mit der Bibel in den Händen und dem Bettlaken auf dem Kopf. Sie sind zu hören, im ersten schweren Regen, der mit Hagelkörnern vermählt auf die Dachziegel des alten Hauses trommelt wie eine Kriegserklärung.
„Gehört und verstanden!“, ruft der Junge. So laut er nur kann. „Gehört und verstanden!“ Er kreischt fast. Dann beißt er wieder die Zähne zusammen, denn die Heilige Schrift in seinen Händen wird schwerer und schwerer. Stummes Diktat. Gott füllt die Seiten mit mehr und mehr Buchstaben, und jeder wiegt ein Kilogramm. Mindestens. Gott der Herr diktiert den Sündern auf der Erde sein neues Evangelium. Gott der Herr diktiert es ihnen Wort für Wort, Satz für Satz. Enttäusche ihn nicht noch einmal. Seine Geduld ist aufgebraucht. Alle Anzeigen stehen auf null. Du hast kaum noch Zeit. Der Junge mit der Bibel in den Händen ist tapfer, so tapfer. Aber selbst das verhindert nicht, dass der Teufel kommt. Er ist jetzt unten im Haus. Er steigt die Treppe zum Dachzimmer hinauf, im Schutz des Gewitters, langsam, aber sicher. Und er bringt Schmerzen mit.
Nun laufen dem Jungen Tränen über das Gesicht, das Buch der Bücher immer noch in den Händen. Wenn er nur etwas sehen könnte. Ein Stück Himmel vielleicht. Einen der Engel im Sturzflug vielleicht, aus pechschwarzen Wolken niedergekommen, nach dem Dachfenster greifend, um ihn hier rauszuholen, um ihn auf weiten Schwingen fortzutragen und zu retten in letzter Sekunde. Aber die Engel helfen nicht. Sie wissen, dass sie zu spät kommen. Sie sehen zu, unter schweren Flügeln, über die immer mehr Regenwasser läuft. Es mischt sich mit Tränen und Federn.
Dann fliegen die Engel davon, schweren Herzens. Einer nach dem anderen. Das Gewitter kommt mit Macht über das Land. Der Junge im Dachzimmer beginnt zu zählen. Es fällt ihm schwerer und schwerer, seine Arme oben zu halten. Alles tut weh. Von den Händen bis in die Schulter, ganz so, als habe jemand Stacheldraht durch seine Finger gezogen und danach alles wieder zugenäht. Lange wird er Gottes Wort nicht mehr oben halten können, so zwingend das auch ist. Wenn er nur etwas sehen könnte. Wenn das Bettlaken doch nur zwei Löcher hätte für die Augen. Kreisrunde Löcher, herausgeschnitten mit einer Schere. Oder mit einem Messer, lang und scharf.
Der Teufel steht jetzt auf der anderen Seite der Tür. Und er ist böse wie niemals zuvor. Zehn, elf, zwölf. Der Junge, der immer noch nicht aufhört zu zählen, weiß, dass ihm keine Zeit mehr bleibt. Gott sieht dich. Gott hört dich. Und jetzt überlässt er dich dem Teufel.
Die Tür der Dachkammer fliegt auf, schlägt gegen die Wand, so hart, dass der Putz bröckelt und auf den Holzboden fällt. Die Steine aus dem Mauerwerk klingen wie Murmeln, nur mit dem Unterschied, dass sie nicht rollen. Dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Der Junge hält den Kopf gesenkt und seine Arme weiter oben. Ein kleiner, schmutziger Sünder, in Stößen atmend, außer sich. Der Teufel schweigt und riecht nach Regen. Der Teufel steht einfach nur da, nass, im Türrahmen, und betrachtet die Tapferkeit. Aber sie nutzt dem Jungen nichts. Er hat sich schmutzig gemacht, er ist unrein, er riecht nach Versagen, wieder einmal, und das gilt es, in den Griff zu bekommen. Der Junge mag sie nicht länger hören, und doch ist sie da, die strafende Stimme, so laut wie der Donner.
Kleiner Mann! Als die Römer Jesus Christus ans Kreuz geschlagen haben, da hast du ihnen die Nägel gereicht. Einen nach dem anderen. Du hast ihnen bei der Arbeit zugesehen. Du hast sie begafft, am Karfreitag. Du hast sie ermutigt. Du hast ihnen gesagt, wie sie zuschlagen müssen, und du hast dich selbst nicht schmutzig gemacht. Die Soldaten haben dich ausgelacht, so wie sie Gottes Sohn ausgelacht haben, als er für deine Sünden an einem Stück Holz gestorben ist. Du hast ihnen zugesehen, als sie ihm die Lanze in die Seite stießen, mit deinen Nägeln aus Eisen in den Händen. Die du hast schmieden lassen für diesen Tag allein.
Du hast Jesus Christus angesehen, feige, schmutzig und dumm, und du hast ihm nicht geholfen. Du hast ihm eine Dornenkrone geflochten. Du hast ihn angestarrt in Einfalt. Du hast den Römern angeboten, selbst einmal den Hammer zu führen, die Nägel anzusetzen, an der linken und an der rechten Hand. Du hast die Römer Christi Blut kosten lassen. Nur, um ihnen zu gefallen. Nur, um ihnen zu zeigen, dass sie es sind, die auf diesem Berg hier über Leben und Tod entscheiden.
Du hast den Heiland verraten und Judas die Füße geküsst. Er hat dich fürstlich bezahlt für deinen Dienst. Du hast gelacht, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und nach seinem Vater rief. Du hattest Tränen der Freude in den Augen im Moment seines Todes. Du hast das Kreuz hoch über der Stadt betrachtet, blutverschmiert, von allen Seiten. Hast Gottes Sohn geblendet mit dem Schein deiner Münzen. Du hast ihn verkauft für ein paar Silberlinge und den Hammer der Römer liebkost nach getaner Arbeit. Und jetzt bekommst du die gerechte Strafe. Jetzt bekommst du, was du verdient hast nach deinem Tag in Jerusalem. Gott sieht alles. Und er vergisst nichts.
„Mama?“, ruft der Junge mit der Bibel in den Händen. Seine Stimme ist unter dem schweren Stoff kaum zu hören. Angstschweiß läuft über die Heilige Schrift. Gott hat das Diktat beendet und das neue Evangelium für gut befunden. Auf der anderen Seite hört der Junge den Teufel Luft holen. Er steht dicht vor ihm und holt zum letzten Schlag aus. Die Engel, weit weg, sind außer sich. Sie ahnen, dass sie sich getäuscht haben. Sie halten einen Moment lang den Atem an, denken nach und nehmen sich ein Herz. Dann kehren sie um, flatternd. Sie wollen den Jungen unter dem Bettlaken retten. Aber sie kommen zu spät.
Sie trommeln draußen mit nassen Fäusten gegen die Fensterscheibe. Sie hocken auf dem Dach des Hauses und reißen einen Ziegel nach dem anderen heraus, um doch noch ins Haus zu kommen. Sie sehen machtlos zu, wie der Teufel im Dachzimmer Anlauf nimmt, und das Gewitter überzieht sie alle mit Hagel. Keine Chance. Die Engel draußen haben keine Chance. Der Sturm nimmt sie mit. Und jetzt gibt es nur noch den Teufel und den Sünder mit der Bibel in den Händen. Zitternd, horchend, auf Vergebung hoffend, bis zuletzt. Seine Stimme ist dünn und im Sturm kaum zu hören.
„Mama? Bist du das?“
Die Antwort des Teufels lässt nicht lange auf sich warten. Sie ist voll von Schmerz. Und voll von Dunkelheit.
E R S T E R T E I L N A C H T G E S P E N S T
Ist da jemand?
Und ich sah den Himmel aufgetan;
und siehe, ein weißes Pferd.
Und der darauf saß, hieß:
Treu und wahrhaftig,
und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit.
(Offenbarung 19, Vers 11)
Eins
Viele Jahre später, im Juli 1987. Rot! Alles rot! Die Welt da draußen ist eine Windschutzscheibe. Ein schmutziges Stück Glas im letzten Abendlicht, mit Blut überzogen. Es läuft träge hinab, in Tropfen und Schlieren. Es läuft der Motorhaube entgegen, der Schwerkraft folgend. Noch einmal ein Krachen, zwischen den Scheinwerfern, am Kühlergrill, auf dem Blech, verbeult, zerkratzt, auf der Windschutzscheibe, rissig. Die Frau auf dem Beifahrersitz schreit so laut wie nie zuvor. Sie ist angeschnallt, sie ist außer sich, und sie sitzt, so sieht es aus, in des Teufels Waschanlage. Wieder sucht sich ein Schwall aus Blut seinen Weg nach unten, vermischt mit anderem. Im Kassettenradio singt ein Mann mit Schlafzimmerstimme davon, wie schwer es ihm fällt, die passenden Worte für seine Liebste zu finden. Unbeeindruckt vom Grauen jenseits der Scheibe. Ein schreckliches Lied, heute Abend ist das hier einfach nur ein schreckliches Lied. Words don‘t come easy to me. Vermengt mit Schlägen und Schreien, bis es ein Ende nimmt. Draußen stöhnt jemand, schnappt nach Luft.
Ein gekrümmter Rücken rutscht auf der anderen Seite über das Glas. Die Schultern hängen. Die Arme bewegen sich nicht mehr. Das Hemd? Zerrissen! Die Knopfleiste tickt auf die Scheibe. Einer der Knöpfe ist abgerissen und schlingert davon wie ein Diskus, den ein Fluss aus Blut mit sich nimmt. Der Knopf bleibt am Scheibenwischer hängen. Der auf der Beifahrerseite ist verbogen und ragt steil nach oben. Das Ding tanzt bei jedem neuen Schlag, bei jedem neuen Stich mit dem Messer. Die Klinge ist lang und scharf und schimmert. Die Frau im Auto schreit, die Frau im Auto kreischt, und jetzt sucht sie endlich, endlich nach dem Gurtschloss. Verzweifelt, ihre Füße immer noch auf das Armaturenbrett gestemmt. Sie trommeln in ihren Segeltuchschuhen. Links, rechts, links, rechts. Und immer dann, wenn die Gummisohlen über den Kunststoff des Autos rutschen, quietscht es wie verrückt. Die Frau stampft, sie strampelt wie ein Kind. Dann schlägt draußen ein Kopf gegen die Scheibe. Hart wie Stein. Kim Wilde löst FR David ab. Das Tonband leiert, als bitte es um Erbarmen. Die Kassette ist alt und lag tagsüber zu lange in der Sonne. Neunzig Minuten Laufzeit. Der Zündschlüssel steckt immer noch.
Das Messer zerkratzt das Glas, wenn es sein Ziel verfehlt, aber das passiert immer seltener. Der Mann auf der Motorhaube, er heißt Chris, wehrt sich bis zuletzt. Sein Gesicht rutscht draußen über das Glas, durch das Blut, durch das viele, viele Blut. So fremd, so vertraut. Der Wagen schaukelt, auf und ab, auf und ab. Wellengang. Mitten im Wald. Das Gurtschloss ist so weit weg. Draußen, jenseits der Scheibe, wird es dunkel. Kurz nach neun, an einem Abend im Juli, weit draußen.
Ein Riss zieht sich durch die Windschutzscheibe. Lang und gezackt. Kim Wilde verstummt. Das Tonband ist zu Ende. Caro, die Frau auf dem Beifahrersitz, hofft immer noch, dass das hier nur ein Albtraum ist, dass sie bald wieder die Augen öffnet und endlich, endlich wach wird. Ihr Liebster auf der anderen Seite hat seinen Mund geöffnet, aber er atmet nicht. Seine Finger zucken wie verrückt. Chris kann nichts mehr sehen, er kann nichts mehr hören, er kann ihr nicht mehr helfen. Caro ist heiser. Ihre Schreie sind nur noch ein Krächzen. Nun ist sie auf sich allein gestellt. Ihre einzige Versicherung sind ein paar Millimeter Glas, hauchdünn angesichts dessen, was jetzt siegreich von der Motorhaube steigt, festen Boden unter die Füße bekommt und sie beobachtet.
Zwei
Die Welt ist eine Windschutzscheibe. Im Autoradio, das nun die andere Seite der Kassette abspielt, singt Elvis Presley. Love me tender. Endlich erreicht Caro das Gurtschloss, drückt es nach unten. Der Sicherheitsgurt rutscht zaudernd zur Seite. Über ihre Brust. Über ihre Arme. Er wehrt sich, bleibt hängen, bevor er sein Ziel erreicht. Erst, als sie ihn zur Seite schleudert, rollt der Gurt sich auf. Sein Eisen schlägt beleidigt gegen das Blech der Mittelsäule. Caro dreht sich zur Seite, um die Türknöpfe nach unten zu drücken. Doch sie verfehlt sie. Stattdessen geht ein Donnern durch die Seitenscheibe. Schatten rechts! Da ist ein Schatten rechts! Caro rutscht zum Lenkrad. Die Beifahrertür fliegt auf und macht die Welt auf einmal groß. Finger schießen auf Caro zu, auf dem Weg ans Steuer, auf dem Weg zum Zündschlüssel. Gierige Hände und zwei lange, kräftige Arme unter blutverschmierten Bettlaken. Der Sturm erfasst sie, packt sie, zieht sie fort. Jetzt geht es in den Wald hinaus, in den dunklen, dunklen Wald. Caro steht Kopf. So ist ihr zumute, als sie auf den Asphalt des Parkplatzes schlägt. Ihr rechter Fuß verhakt sich im Türsteg. Der Segeltuchschuh gibt nach und löst sich. Der Schuh bleibt mit offenen Schnürsenkeln liegen. Caros Hände finden keinen Halt. Im Mund schmeckt alles nach Blut. Im Radio laufen mit einem Mal Nachrichten. Sie drehen sich um Richard von Weizsäcker, auf Staatsbesuch in der UdSSR. Von drei weiteren Kosmonauten ist dann die Rede. Die Frau im Radio spricht ihre Namen perfekt aus: Andrei Gromyko, Michael Gorbatschow, Andrei Sacharow. So viel ist hier draußen auf dem Parkplatz zu hören. Dann zum Sport: Steffi Graf. Boris Becker. John McEnroe. Jetzt sind sie alle an Bord. Alle auf dem Heimflug zur Erde. Zur kalten, kalten Erde.
Caro schreit wieder. Aus den Baumwipfeln hoch oben fliegen Raben davon. Der Asphalt zerkratzt Caros Arme. Der Asphalt zerkratzt ihr die Unterschenkel. Er zerkratzt ihr den Rücken, als sie sich dreht und windet, im Schlepptau, weg vom Auto, immer tiefer in den Wald. Zweige. Tannennadeln. Blätter. Alles schmutzig. Caroline spuckt Laub und Erde. Dunkel, dunkel, dunkel! Ein Sog, der das letzte Licht des Tages verschluckt und nichts übrig lässt, bevor Gott ein Einsehen hat und Caro das Bewusstsein nimmt. Bis die Schmerzen über sie kommen. Schlimmer als jemals zuvor.
Mit einem Mal ist Caroline wieder hellwach. Sie liegt auf dem Boden, im Laub, und fasst sich an den Kopf. Sie spürt, dass ihr etwas fehlt. Wellen aus Schmerz, sie fasst wieder hin, und ihre Finger werden warm, so warm. Sie richtet sich auf und fragt sich, wo der Teufel geblieben ist, der sie verschleppt hat. Pochender Schmerz, vom Kopf aus, immer nur vom Kopf aus, an dem etwas Wichtiges fehlt. Dann: zwei Stimmen, weit weg, irgendwo im Unterholz. Woher kommen sie? Caro denkt nicht länger nach. Sie hastet nach vorne, sie stößt durch die Büsche, den Stimmen entgegen, immer nur den Stimmen entgegen. Einen Moment lang glaubt sie, sich die Augen auszustechen an den vielen Ästen, spitz, an den Dornen, lang, aber sie kommt durch, irgendwie, in voller Fahrt. Sie kämpft um jeden Meter, um jede Sekunde. Jeder Atemzug ist ein Stich in die Brust. Mund. Weit. Aufgerissen. Dicht hinter ihr knackt es, zerbrechen Äste, viele, viele Äste, laut und schnell. Der Lärm holt auf.
Caro taumelt vorwärts. Sie verlässt mit einem Mal den Boden, eilt aber immer noch weiter, rudert in der Luft, und eine Sekunde lang ist es so, als fliege sie. Bis sie abstürzt, die Böschung hinab. Freier Fall. Steil, so steil. Caro schlägt auf, mit voller Wucht. Sie liegt auf dem Boden, wieder einmal, ihr Gesicht im Laub, in weichen Blättern. Jetzt sind die Stimmen ganz nah. Werden lauter, immer lauter. Und hektischer, immer hektischer, als sie aufblickt und weint und schreit und heult und ruft und hustet, weil ihr auf den letzten Metern die Luft wegbleibt, auf dem Boden, endlich wieder auf dem Boden! Blutig und schmutzig, gerade eben dem Tod entkommen.
Caro steht auf, so gut es geht, wie in Zeitlupe. Sie schüttelt den Kopf. Dann ein neuer Schmerz. Fuß verstaucht! Rechts! Es brennt. Es zieht. Sie kann nur noch humpeln, weiter, immer weiter. Sie schaut hinter sich, den Abhang hinauf. Sie ist allein hierhergeflogen, ganz allein. Das Gespenst ist fort. Da vorne sind zwei Menschen. Wanderer, mit Rucksäcken auf den Schultern. Ein Mann. Eine Frau. Sie halten inne, als sie Caro sehen. Dann eilen sie los und kommen näher. Der Frau stockt der Atem, als sie sieht, was Caroline fehlt.
Drei
Gegenwart, viele Jahre später
Die Gespenster warten schon. Auf der anderen Seite. Sie kommen, wenn es dunkel wird. Richard Wagner hielt den Haustürschlüssel fest umschlossen. Er kämpfte den Anflug von Panik nieder, so gut es eben ging. Seine Hände zitterten. Fortlaufen?Wohin? Einer der letzten Alliierten stand dicht hinter ihm, Baujahr 2005, in der Auffahrt. Unter der Motorhaube knackte es leise. Der Mazda kam zur Ruhe, nach Stunden auf der Autobahn. Die Maschine schien zu seufzen, als sie abkühlte. Dem Gefühl nach wog er einen Zentner, der verdammte Schlüssel. Er hatte etwas von einer Waffe, entsichert, aufs Ziel gerichtet. Wovor hast du Angst?
Neben Richard stand Hemingways Tragebox. Das Gitter an der Frontseite schimmerte im Licht. Die Einkäufe und das Gepäck würde er später aus dem Auto holen. Spätestens, wenn der Hunger kam und Hemingway Futter forderte. Alt, müde und missmutig spähte der Kater bis dahin durch das Gitter nach draußen. Richard fasste sich ein Herz. Es war tröstend, dass er nicht alleine vor der Haustür stand und sich fragte, was ihn dahinter erwartete. Er stieß den Schlüssel ins Schloss und hoffte, dass er nicht passte. Herr im Himmel, lass den Schlüssel falsch sein. Erspare mir die Gespenster. Richard hielt sich daran fest, in einer Steilwand stehend, die Hände am Felsen, die Beine gespreizt, den Kopf an den Berg gepresst, mit klammen Fingern nach dem Seil weiter oben suchend. Als er die Augen wieder öffnete, war der Berg verschwunden und nur noch eine Haustür. Der Schlüssel passte nach wie vor. Gehorsam tauchte er in die Tiefe und ließ sich im Schloss drehen. Hemingway quittierte das mit einem Schnurren. Kein Zurück mehr. Trautes Heim, Glück allein. Richard stieß die Haustür auf, holte tief Luft, nahm Hemingways Box und trat ein. Die Geister warten schon.
Er zog den Schlüssel ab und betrachtete dessen Anhänger aus Eisen, der zu einem Herzen geformt war und an einer Kette hing, wuchtig und schwer.Im Flur war es still. Ist da jemand? Keine Antwort. Hemingway meldete sich mit einem dünnen Miau! und holte Richard ins Leben zurück. Kein Echo mehr. Gott sei Dank.
„Schon gut, schon gut“, rief er in die Stille des dunklen Flurs. „Gleich kannst du raus.“
Hinter ihnen fiel die Tür ins Schloss. Richard wartete damit, Licht zu machen. In der Dunkelheit war Hemingways Ungeduld fast zu greifen. Mit ausgefahrenen Krallen nahm der Kater sich der Rechnung an, die Richard aus der Tierpension mitgenommen und auf dem Weg zum Auto zwischen die Gitterstäbe geschoben hatte. Hemingway war es nun ein Leichtes, sich nach seinem Ermessen um das Schriftstück zu kümmern. Er schredderte das Papier mit seinen Krallen, während er darauf wartete, dass endlich die verdammten Gitterstäbe vor seiner Nase verschwanden und stattdessen ein bis an den Rand gefüllter Napf mit Fleisch in Reichweite kam. Alles andere spielte in Hemingways Kosmos keine Rolle. Vorerst zumindest.
So stand Richard an der Haustür, im Mantel. Ist da jemand? Keine Antwort. Das Haus schweigt.Und daran wird sich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren auch nichts ändern, solltest du nicht endlich deinen verdammten Mantel an deine verdammte Garderobe hängen und deinem verdammten Kater endlich sein verdammtes Futter geben.
Im Flur flammten die Lampen auf, so müde, wie Richard sich fühlte. Keine Gespenster. Nicht heute. Nicht morgen. Er nahm die Box und trug sie die Treppe hoch. Die Stufen waren kalt. Richard fror. Die Tür zum Wohnzimmer kam in Sicht. Daneben die zur Küche. Hemingway befasste sich noch immer mit der Rechnung, und als Richard sah, womit der Hauskater gerade zu tun hatte, war es schon zu spät. So ließ er den alten Herrn gewähren und gab Acht, die Box so behutsam wie möglich auf den Boden zu stellen. Dann zog Richard das Sperrgitter aufwärts. Wie ein geölter Blitz verschwand Hemingway, der Große, durch einen Spalt der Schiebetür ins Wohnzimmer, um sich vor die Fensterfront zu hocken und zu warten, dass sein Herr und Meister die Rollos zum Garten hin hochfahren ließ. Wie er das immer getan hatte, als die Welt hier noch in Ordnung war.
Richard ging in die Küche, schaltete auch hier das Licht ein und drückte den Schalter für das Rollo. Gehorsam schoben sich die Rippen aus Kunststoff nach oben und ließen das letzte Tageslicht ein. Dann sah Richard, was er in der Stunde seiner überstürzten Abreise vor Wochen vergessen hatte: Auf der Fensterbank stand eine Vase mit einem Strauß Rosen. Verdurstet.Martin und Melanie hatten sie ihm gebracht, am Tag nach der Beisetzung, vor einer Ewigkeit. Richard zog die Grußkarte hervor, betrachtete das Meer und den Sonnenuntergang auf der Vorderseite, klappte sie auf und las noch einmal, obwohl er wusste, dass damit nur ein unheilvolles Echo verbunden war.
Richard!
Das Leben geht weiter.
Wir denken an Dich.
Wohin damit? Richard zog eine der Schubladen auf, wahllos, und ließ die Karte mit dem sandfarbenen Umschlag zwischen Servietten und Geschirrtüchern verschwinden. Fast schon fürchtete er, im Flur das Telefon klingeln zu hören. Aber es schwieg in einem Akt der Gnade. Gut angekommen? Wir wollten nur fragen, wie es dir geht. Und denken an Dich.
„Ich weiß“, sagte Richard ins Schweigen hinein. Seine Stimme im Haus zu hören, war verstörend und tröstend zugleich. „Ich weiß das.“
Richard ging ins Wohnzimmer, kümmerte sich um die Netzstecker und schaltete das Radio auf der Fensterbank ein. Nachrichten um sechs. Hemingway saß in der Tat am Fenster, dachte sich seinen Teil und beobachtete ihn aus aufmerksamen Augen. Richard suchte den Raum ab, ohne zu wissen, wonach. Er lauschte der routinierten Sprecherin auf WDR 2 auf ihrer Reise durch das Weltgeschehen, hörte mit halbem Ohr, dass es um den Krieg im Persischen Golf und um den immer noch brennenden Flugzeugträger ging. Terrorwarnung. Richard schlich zurück in die Küche, um sich einen möglichst starken Kaffee zu machen. Niemand hier außer mir.
Vier
Juli 1987
„Finden Sie den Scheißkerl, der meiner Tochter das angetan hat!“ Der Mann, der Richard und Thomas Decker auf dem frisch gewischten Flur des Krankenhauses gegenüber steht, lässt keinen Zweifel daran, dass es ihm ernst ist. Absolut ernst. Die Luft zwischen ihnen riecht nach Desinfektion. Scharf und durchdringend. Einen Moment lang ballt der vom Zorn erfüllte Mann seine Fäuste, bis die Knöchel schneeweiß anlaufen. Und er lässt erst locker, als seine Frau ihn zur Seite zieht. Ein Stück weit zumindest, um eine Krankenschwester auf Gummisohlen vorbeieilen zu lassen. Das Mädchen, Anfang zwanzig, beiläufig grüßend, außer Atem und bildhübsch, trägt ein Tablett, auf dem sich kleine, gelbe Messbecher für Schmerztropfen stapeln. Quietschend lässt sie die Männer und die Frau hinter sich, ohne weiter Notiz von ihnen zu nehmen. Ihr rostbrauner Pferdeschwanz wippt auf dem Rücken hin und her, immer im Takt, wie ein Pendel. „Finden Sie den Scheißkerl!“
„Bernd!“, ruft die Frau, sie wirkt klein und zerbrechlich, neben ihrem Mann. Beschwörend. Sie kämpft jedoch auf verlorenem Posten. Auf der einen Seite schämt sie sich für ihre bessere Hälfte. Auf der anderen Seite spricht er ihr aus der Seele. Zunächst aber kommt sie zu dem Schluss, dass es klüger ist, ihren Mann zu bremsen, bevor er Schaden anrichtet. Sie zieht ihn noch fester zu sich. „Bernd! Hör doch auf damit! Bitte! Das bringt nichts!“
„Und ob das was bringt!“
„Bitte!“
„Nein! Ich höre erst auf, wenn es mir passt! Und mir passt es nicht! Noch einmal: Finden Sie den Scheißkerl, der Caro das angetan hat. Finden Sie den Scheißkerl. Jetzt!“ Das letzte Wort zieht der Mann, unglaublich müde und unglaublich erledigt, in die Länge. Er hebt den rechten Zeigefinger, holt Luft, macht einen Schritt nach vorne und tippt dem Kommissar, der so heißt wie der berühmte Komponist, aber nicht länger daran erinnert werden will, fest auf die Brust. Mit einer Bestimmtheit, die Thomas Decker an Harrison Ford erinnert.
„Finden Sie den Scheißkerl, und ich beruhige mich wieder. Versprochen.“
„Aus keinem anderen Grund sind wir hier“, sagt Richard. Er weist Thomas mit gesenkten Händen an, sich weiterhin zurückzuhalten. „Gestatten Sie uns bitte, fünf Minuten mit Ihrer Tochter zu sprechen. Das ist wichtig.“
„Alles ist wichtig“, faucht der Mann. Wieder versucht seine Frau, ihn zu beruhigen. Wieder vergeblich. Er ist außer sich und nicht zu bremsen. Sein Gesicht ist fast so rot wie eine Ampel. Wenn er spricht, schwellen seine Halsschlagadern an. „Alles hier ist ja so wichtig!“
„Ist der Arzt denn damit einverstanden?“, fragt die Frau weitaus diplomatischer, in der Hoffnung, das Gespräch im letzten Moment zu wenden. „Haben Sie das mit dem Arzt besprochen?“
„Selbstverständlich“, sagt Richard. „Wir fassen uns kurz. Wir wissen, was Ihre Tochter durchmacht, und hoffen, dass sie uns einen Hinweis geben kann. Wir setzen alles daran, den Täter zu fassen. Das versichere ich Ihnen.“
Im nächsten Moment bereut Richard, sich damit so lange aufgehalten zu haben. Der zornige Mann geht noch einmal auf sie los. Diesmal mit gezogenem Säbel. „Nur damit wir uns verstehen, Herr Wagner: Wenn ich das richtig sehe, stochern Sie seit Tagen im Nebel, haben den Scheißkerl immer noch nicht, und langsam, aber sicher sitzen Ihnen Ihre Chefs im Nacken. Alle sehen, dass Sie nicht vorankommen. Wie auch? Anstatt draußen zu sein, löchern Sie meine Familie und mich mit Fragen, die wir nicht beantworten können. Noch einmal: Von uns hat niemand was mit dieser Schweinerei zu tun. Niemand!“
„Bernd!“ Jetzt laufen Tränen über das Gesicht der kleinen Frau. Sie sieht aus, als werde sie gleich ohnmächtig oder wolle zumindest im Boden versinken. „Um Gottes Willen! Bernd!“
„Schon gut“, sagt Richard. „Ich kann nachvollziehen, dass Sie wütend sind. Ich kann selbst Ihren Zorn verstehen und nehme Ihnen auch das nicht übel. Aber Sie gehen auf die Falschen los. Es sei denn, Sie wollen, dass der Mann, der Ihrer Tochter das angetan hat, davonkommt. Und das wird er, wenn Sie unsere Ermittlungen noch länger aufhalten.“
Das sitzt. Der Mann schnappt mit hochrotem Kopf empört nach Luft. Dann laufen auch ihm Tränen über das Gesicht. Endlich. „Sehen Sie sich unsere Kleine nur an“, heult er in einem Ton, der selbst die hübsche Krankenschwester am anderen Ende des Korridors einen Moment lang innehalten lässt. „Sehen Sie sich Caro nur mal an, und dann sagen Sie mir noch einmal, dass ich Geduld haben muss.“
„Tut mir leid.“ Richard geht zur Tür. „Wir werden den Mann finden, der Ihrer Tochter und ihrem Freund das angetan hat. Das verspreche ich Ihnen. Und jetzt arbeiten wir weiter.“
Der übermüdete Mann hält inne und tauscht einen langen Blick mit seiner Frau. Sie nickt und weint weiter. Hastig sucht sie nach einem Taschentuch und schnieft vor sich hin. Thomas Decker reicht ihr eines aus den Tiefen seiner Lederjacke. Das lenkt ihren Mann ab, holt ihn auf den Boden der Tatsachen zurück und beansprucht den letzten Rest Konzentration, der ihm nach den vergangenen Stunden geblieben ist. Seine Tränen trocknen schnell. Er zittert. Er bebt. Widerwillig gibt er den Weg frei, wie ein Wachtposten, dem das soeben befohlen worden ist.
Fünf
Das Bett ist riesig, gemessen an der zierlichen Frau, die in ihm liegt. Beide Arme ruhen auf den Laken, lang und dünn. Ihre Handrücken sind leichenblass. Caro hat die Augen geschlossen. Neben ihr steht ein Automat, der leise durch den Nachmittag summt und die Leitung der Infusion beharrlich mit Nachschub versorgt. Draußen trommelt Regen gegen das Fenster des Einzelzimmers. Die Luft ist warm und abgestanden, das Licht neben dem Bett viel zu kräftig für diese Stille hier. Über Caros Stirn zieht sich ein breiter Verband, der Kompressen in Höhe ihres linken Ohrs fixiert. Über Wangen und Kinn erstrecken sich Blutergüsse, dunkel wie Gewitterwolken. Sie heben sich in stummer Dramatik von der schneeweißen Nachbarschaft ab. Als Richard die Tür hinter sich schließt, öffnet Caroline die Augen. Sie sind dunkel, fast schon schwarz, aufmerksam, und füllen sich im nächsten Moment mit Tränen. Ein beunruhigendes Schauspiel. Eine Sekunde lang sieht es so aus, als starre ein Augenpaar die beiden Polizisten an, das in einem mit Gift gefüllten Tümpel schwimmt. Ein Windstoß treibt draußen noch mehr Regen über die Scheiben. Auch der Himmel weint.
„Polizei?“, fragt die junge Frau leise. Sie wischt sich Tränen aus den Augen, entschlossen, die Schläuche der Infusion hinter sich herziehend. „Polizei?“
„Mein Name ist Richard Wagner.“ Er nickt ihr zu und deutet auf seinen Nebenmann. „Das ist mein Kollege Thomas Decker. Wir führen die Ermittlungen und hoffen, dass Sie uns helfen können. Wir fassen uns kurz. Dürfen wir mit Ihnen sprechen?“
„Habe ich eine andere Wahl?“, erwidert Caro. Sie ist noch nicht lange wach und klingt benommen, immer noch. Die Schmerzmittel setzen ihr zu. Das sieht man ihr an. Ihr Kopf sinkt tiefer ins Kissen. „Ermittlungen. Klingt gut. Gibt nichts zu sagen. Ich habe da draußen kaum was gesehen. Ging alles schnell.“
Richard nimmt auf einem Schemel Platz, der neben Caros Bett steht. Der Lack über den Füßen aus Eisen ist abgeplatzt. Thomas geht ans Fenster und hält sich im Hintergrund. Richard weiß nicht, wie er das anstellt, aber irgendwie schafft es der Mann, sich in Momenten wie diesen unsichtbar zu machen und in Luft aufzulösen wie ein Geist aus der Flasche.
„Wie geht es Ihnen?“
„Blendend“, sagt Caro. Durch ihre Stimme zieht sich ein Beben, kaum zu messen auf der Richterskala. Ganz der Vater. „Sieht man das nicht? Ich habe heute früh nur zu viel Rouge benutzt. Nicht böse sein.“
Richard blickt zur Decke. Er sucht nach Worten, findet aber nur zwei Lampen und weiße Farbe. „Wir wissen, dass das nicht leicht für Sie ist.“
„Sie wissen gar nichts.“ Caroline schluckt, hustet tief, beginnt zu zittern und lässt den Tränen freien Lauf. Sie fließen über die Hämatome. „Sie wollen wissen, was wir zwei im Wald zu suchen hatten, oder?“
„Um ehrlich zu sein“, sagt Richard und sieht dabei noch einmal zur Decke, als könne er da oben doch noch passende Worte finden, „ist das für uns nicht von Belang. Waren Sie und Ihr Freund zum ersten Mal da draußen auf dem Parkplatz?“
„Von Belang.“ Diese Worte spuckt Caro aufs Bettlaken. „Schön gesagt, Herr Kommissar. Wir haben immer mal wieder da draußen geparkt. Weil wir da unsere Ruhe hatten. Meistens donnerstags nach neun, nach dem Tanzkurs. Für eine Stunde. Sie wissen schon.“
Richard spürt, wie Thomas am anderen Ende der Milchstraße tief Luft holt und sich fragt, ob es nicht besser ist, sofort zurück zur Mondbasis zu fliegen. „Ich sagte ja schon: Für uns ist das, was Sie da draußen getan oder gelassen haben, nicht von Belang. Wir wollen nur herausfinden, wer Ihnen das angetan hat.“
„Fein“, sagt Caroline und schürzt ihre giftgrünen und immer noch geschwollenen Lippen. „Dann sind wir ja schon zu dritt.“
„Ist Ihnen etwas Besonderes …“, fragt Richard, aber Caro fällt ihm ins Wort.
„Aufgefallen? Nichts. Gar nichts ist uns aufgefallen. Wir haben nie jemanden da draußen gesehen. In der ganzen Zeit nicht. Deswegen haben wir da auch geparkt.“ Das letzte Wort zieht Caroline in die Länge, ganz so, wie es ihr Vater Minuten zuvor getan hat. „Der Parkplatz war immer verlassen. Wir hatten ihn für uns. Kein Auto, kein Mensch weit und breit. Bis zuletzt.“
„Erinnern Sie sich an Details? Was haben Sie gesehen?“
„Ich weiß nicht, wie lange wir schon im Auto saßen. Vielleicht eine Viertelstunde. Ich habe das Gespenst zuerst entdeckt. Stand auf einmal da. Weit weg, zwischen den Bäumen, und schaute uns zu. Ich dachte zuerst, der Spanner hat ein Fernglas.“
„Und? Hatte er eines?“
„Nein. Sah nur so aus. Ich glaube, er trägt eine Brille. Eine starke Brille mit dicken Gläsern.“
„Sind Sie sicher?“
„Ja. Obwohl er weit weg stand, konnte ich das klar und deutlich sehen. Es sah, nun ja, es sah irgendwie lustig aus.“
„Lustig?“
„Was glauben Sie? Da steht auf einmal ein Typ vor Ihnen, der ein Bettlaken über dem Kopf trägt, mit einer Brille wie im Karneval. Die Gläser sahen aus wie Lupen und machten ihm große Augen. Dann ging alles schnell. Ich habe Chris gesagt, dass da draußen jemand am Auto steht, und er stieg sofort aus, um den Kerl zu verjagen.“
„Warum sind Sie nicht einfach weggefahren? Ich meine, Sie wussten doch nicht, was der Mann, der Sie beobachtet, im Schilde führt.“
„Dachte ich auch.“
„Sie haben es aber nicht geschafft, dass Ihr Freund einfach wegfährt.“
„Das ist“, ruft Caroline, kämpft wieder mit Tränen und korrigiert sich noch im Landeanflug. „Das war nicht seine Art. Chris war extrem sauer und wollte sich den Spanner kaufen. Und dann war er auch schon draußen, um ihm eine Lektion zu erteilen.“
„Was dann?“
„Nichts zunächst. Ich sah nur, dass der Kerl aus dem Wald irre verkleidet war.“
„Mit Bettlaken.“
„Mit Bettlaken. Habe ich Ihren Kollegen schon gesagt. Ich dachte zuerst, der Typ ist irre, der meint das nicht ernst.“ Caroline sucht nach Worten. „Aber er meinte das ernst. Völlig ernst. Er kam näher, als sei nichts dabei. Als sei gar nichts dabei. Der Typ ging auf Chris los, hielt was Spitzes in den Händen, stach zu, schob Chris zum Wagen, und plötzlich waren die beiden auf der Motorhaube.“
„Was haben Sie dann gesehen?“
„Zuerst gar nichts.“ Die Frau zittert. Ihre Arme rutschen über das Laken, und einen Moment lang schaukelt die Infusion in der Flasche. Thomas macht einen Schritt nach vorne, hält dann aber inne. „Dann war da Blut. Jede Menge Blut. Der Kerl hat Chris nicht mehr losgelassen, nicht eine Sekunde lang. Hat auf ihn eingestochen. Mit einem Messer. Zuerst hat Chris versucht, sich zu wehren, aber er war schon schwer verletzt. Er hatte gegen diesen Irren keine Chance.“
Richard zieht zwei Fotos vom Tatort aus seiner Jacke und lässt sich auf den Bildern zeigen, wo Caroline den Fremden zuerst gesehen hat. Thomas kommt hinzu und macht sich Notizen. Dann herrscht betretenes Schweigen. Draußen ist eine weit entfernte Durchsage und das Schlagen von Fahrstuhltüren zu hören.
„Ich konnte Chris nicht helfen. Das war das Schlimmste. Ich saß einfach nur da, im Auto, und habe zugesehen, wie mein Freund umgebracht wird. Ich musste zusehen, die ganze Zeit, und ich glaube, das hat dem Scheißkerl gefallen. Hat ihn angemacht. Als er mit Chris fertig war, hat er das Blut zur Seite gewischt und mich durch die Scheibe angeglotzt. Dann hat er mich aus dem Auto geholt.“
„Haben Sie sein Gesicht gesehen?“
„Er hatte kein Gesicht.“
„Kein Gesicht?“
„Nein! Er trug immer das verdammte Laken über dem Kopf. Zwei Löcher für die Augen, ein breites für den Mund. Und diese irren Lupengläser. Sonst nichts. Ich glaube, der Kerl trug eine Spezialbrille. Sah ein bisschen aus wie der Frosch mit der Maske in diesem Edgar-Wallace-Film.“
„Eine Spezialbrille?“ Richard beobachtet, dass Thomas sich immer noch Notizen macht.
„So ein Ding, das man sich beim Schwimmen überzieht, damit kein Wasser in die Augen kommt. Der Typ sah aus wie ein Gespenst. Und er war kräftig. Sehr kräftig. Er konnte sich unter all dem Zeug sehr gut bewegen. Es sah aus …“
„Wie sah es aus?“, will Thomas wissen.
„Es sah als, als hätte er das schon oft gemacht“, sagt Caro mit fester Stimme, ganz so, als nehme sie Anlauf. „Für ihn waren die Laken nichts Besonderes.“
„Trug er Handschuhe?“
„Ja. Aus Gummi.“ Caroline nickt misstrauisch. „Ich glaube, sie waren grün.“
„Konnten Sie seine Schuhe sehen?“
„Dazu waren die Laken zu weit. Und ich hatte andere Sorgen.“
Die Frage, welche Sorgen das waren, erübrigt sich mit einem Blick in ihr Gesicht. Caroline fehlt das linke Ohr. An dessen Stelle sitzt ein wuchtiger Verband.
„Das Schwein hat mich wie einen Teppich in den Wald gezogen. Ich weiß nicht, wie weit. Zwischendurch war ich weg. Dann kam der Schmerz, und ich wurde wach, als er mit dem Messer loslegte. Schauen Sie sich an, was der Dreckskerl getan hat. Schauen Sie sich das mal an.“ Caroline greift sich mit beiden Händen an den Kopf, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Leitungen der Infusion rutschen nach oben, schlingern aufgeregt über das Bett, und dann macht sie sich am Verband zu schaffen. Sie versucht es zumindest, hektisch, aber die Bandagen sitzen zu fest. Die Pflaster am Hinterkopf sind nicht zu erreichen, so sehr Caro sich auch anstrengt und die Polizisten neben ihrem Bett das Schlimmste befürchten lässt. Sie will ihnen den blutigen Stumpf zeigen, an der Stelle, an der einmal ihr linkes Ohr war.
Bitte nicht! Richard versucht, die Frau zu beruhigen. Er greift nach ihren Armen, und Thomas ist kurz davor, den Alarmknopf neben dem Bett zu drücken.
„Bitte“, ruft Richard im Handgemenge. „Tun Sie das nicht! Wir wissen, was los ist.“
Erst da lässt Caroline von sich ab. „Gar nichts wissen Sie!“ Sie schnauft. Sie zittert. „Ich dachte, das hört nie mehr auf. Und dann waren da Stimmen, ganz weit weg.“
„Sie haben sich befreit und sind hingelaufen.“
Caro schüttelt den Kopf, so gut es eben geht. „Hingelaufen ist richtig. Befreien musste ich mich nicht. Das Gespenst war mit einem Mal verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Hat Schiss gehabt, was weiß ich? So bin ich losgerannt, einfach los, und dann war er auf einmal wieder hinter mir.“
„Er hat sie verfolgt?“
„Wollte mich einholen. Auf den letzten Metern. Aber ich war zu schnell. Zu weit weg, um mich zu fassen. Mein Glück. Sonst wäre ich jetzt nicht hier.“
„Das haben Sie gut gemacht.“
„Keine Ahnung, warum er mich in den Wald mitgenommen hat. Hätte sich sofort alles nehmen können. Oder mich abstechen.“ Caroline schließt die Augen und holt Luft, bevor sie weiterspricht. „Gute Leute. Das da unten auf dem Wanderweg waren gute Leute. Die beiden hatten eine Heidenangst, als ich ihnen vor die Füße fiel. Habe ihnen einen Schrecken eingejagt. Ich muss mit ihnen reden, hören Sie? Ich muss mich bei ihnen bedanken. Die haben mir das Leben gerettet.“
„Später.“ Richard nickt Thomas zu. „Jetzt brauchen Sie Ruhe, Frau Schmitz, wir lassen Sie wieder allein.“
„Ich muss mich bei ihnen bedanken.“
„Das werden Sie.“
„Jetzt.“ Caroline starrt Thomas auf dem Weg zur Tür wütend nach. „Sofort!“
„Tut mir leid.“ Richard spielt mit dem Gedanken, Caro die Hand zu drücken. Er lässt es bleiben.
„Finden Sie den Dreckskerl!“
Sechs
Gegenwart
Zwanzig Minuten lagen zwischen Richard und dem ersten großen Bombardement seit Wochen. Mit einer Tasse Kaffee ging er ins Wohnzimmer. Die Hitze kroch durchs Porzellan in seine Finger. Hemingway schlürfte vor der Fensterfront Konservenmilch aus einem Unterteller. Richard hockte sich neben den Kater und beobachtete ihn. Egal, ob das hier gesund ist oder nicht, der alte Herr liebt das Zeug. Auf dem Tisch vor der Couch lag ein Stapel Zeitschriften. Daneben siebzehn Briefe, die Melanie und Martin in den vergangenen Wochen gesammelt hatten, als sie im Haus nach dem Rechten sahen. Die Post hatten sie in zwei riesige Kuverts gesteckt und mit einer Botschaft versehen. Die beiden liebten Botschaften.
Das ist alles an Briefen, lieber Richard. Komm erst mal nach Hause und melde Dich, wenn Du Hilfe brauchst.
Martins Schrift. Dazu eine Schachtel Pralinen, von Melanie ausgesucht. Mit Sicherheit. Ein Engel ohne Flügel. Richard trank Kaffee und sah die Umschläge durch. Das meiste Werbung, dazwischen hin und wieder eine Rechnung, das war alles. Richard sah zu, wie es draußen dunkel wurde. Er fuhr die Rollos nach unten und holte seinen Koffer und die Tragetaschen aus dem Auto.Hunger hatte er immer noch nicht. Hemingway sah das naturgemäß anders. Er ließ der Konservenmilch eine Dose Pastete folgen und legte sich neben dem Kaminofen schlafen, in seinem abgewetzten Korb, ohne noch weiter Notiz von der Welt da draußen zu nehmen. Die Zeitschriften warf Richard fort und füllte den Kühlschrank. Er hatte ihn leer zurückgelassen, als er an die Nordsee gefahren war, Hals über Kopf, weil er es hier nicht länger ausgehalten hatte, im Kriegsgebiet, wo immer neue Armeen aus Erinnerungen aufmarschierten und ihre Posten bis zur letzten Patrone hielten. In Windeseile hatte er einen Koffer gepackt, den Wagen vollgetankt und seine Freunde gebeten, im Haus alles im Blick zu halten, solange er auf der Flucht war. Jetzt war er wieder da, und die Schlacht nach der Beerdigung war geschlagen. Christinas Foto stand auf dem Fenstersims am anderen Ende des Wohnzimmers. Es dauerte lange, bis Richard die Kraft fand, aufzustehen und das Bild im Schrank verschwinden zu lassen. Für die nächsten Tage. Erst einmal. Dann packte er den Koffer aus und schlug den Sand aus seinen Schuhen.
Im Kaminofen knackte Holz und ließ Hemingway in seinem Korb zusammenfahren, mit geschlossenen Augen. Erst jetzt waren die Wellen stark genug, um Richard aus dem Tritt zu bringen, immer noch auf dem Weg nach Hause, auch wenn er längst angekommen war. Alles fremd und doch vertraut. Aus den Wellen wurden Brecher. Ihm kamen wieder die Blumen in der Küche in den Sinn, verwelkt. Und er dachte an die Gespenster, die den Rosen beim Sterben zugesehen hatten in den vergangenen Wochen, als es totenstill im Haus war. Richard hörte noch einmal den Pfarrer sprechen. Diese Erinnerung ließ ihn erst los, als er sich nicht länger der Trauer widersetzte, immer noch am Fenster. Die Wellenbrecher waren nicht hoch genug, und die Gischt traf ihn mit voller Wucht. Dabei hatte er noch nicht einmal das Dachzimmer betreten. Das gefürchtete Dachzimmer, dem Himmel am nächsten, wo es von Wellen und Echos nur so wimmelte. Das Dachzimmer wartete nach wie vor auf ihn, am anderen Ende der Treppe, die heute Nacht zwei Kilometer lang war. Mindestens.
Sieben
August 1987
Schauen Sie sich an, was der Dreckskerl getan hat. Schauen Sie sich das mal an!