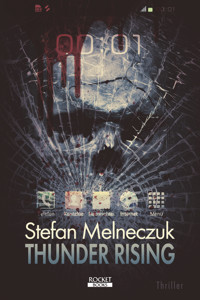Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thriler, Krimi und Mystery
- Sprache: Deutsch
Roland, David und Thomas verbindet seit mehr als zwanzig Jahren ein dunkles Geheimnis. Im Zeichen unheimlicher Ereignisse versuchen sie, sich ihrer Schuld zu stellen. Um Frieden zu finden, müssen die Freunde ihre Angst bezwingen und in den Hattinger Wäldern noch einmal an den Ort ihrer schlimmsten Alpträume zurückkehren. Auf dem Weg in die Vergangenheit beginnt für die Freunde ein unerbittlicher Wettlauf gegen die Zeit und die Geister, die ihnen folgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BÜCHER DIESER REIHE
MARTERPFAHL
SOMMER DER INDIANER
ALLGEMEINE REIHE
BUCH 1
STEFAN MELNECZUK
INHALT
Prolog
Erster Teil
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Zweiter Teil
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Dritter Teil
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Dreiundvierzig
Vierundvierzig
Fünfundvierzig
Sechsundvierzig
Siebenundvierzig
Achtundvierzig
Neunundvierzig
Fünfzig
Epilog
Zugabe
Frühling Des Schreckens
Nachwort
Danke
Über den Autor
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
© 2014 Blitz Verlag
Ein Unternehmen der SilberScore Beteiligungs GmbH
Mühlsteig 10 • A-6633 Biberwier
Redaktion: Jörg Kaegelmann
Vom Autor neu überarbeitete und erweiterte Ausgabe des im VirPriv-Verlag erschienenen gleichnamigen Titels.
Umschlaggestaltung: Mark Freier, München
Alle Rechte vorbehalten
eBook Satz: Gero Reimer
www.BLITZ-Verlag.de
ISBN 978-3-95719-310-0
7001 vom 19.07.2024
Die Hoffnung stirbt zuletzt
PROLOG
In den Sekunden, die über Leben und Tod entschieden, eilten fünf Männer im Schein von Taschenlampen einen Abhang hinab. Lichtkegel schnitten sich in Baumwipfel hoch über ihren Köpfen. Einen Augenblick später erfasste die Läufer das Licht eines Scheinwerfers, das von einem Kastenwagen aus in die Tiefe geschickt wurde. Ein gleißend heller Strahl überholte die Männer in Feuerwehruniform und traf ein Autowrack, das aussah, als habe es eine Faust zerschmettert. Das Dach war eingedrückt. An jeder Seite fehlten die Fenster.
„Da vorne ist es“, rief einer der Männer außer Atem. Sein Helm reflektierte den Schein über ihnen, als sie den Renault erreichten.
„Großer Gott!“
Der Motorraum des Wagens war einem Baumstamm gewichen. Beißender Geruch von ausgelaufenem Benzin und verbranntem Kunststoff empfing die Männer wie ein böses Omen. Doch da war noch etwas anderes, das ihnen den Atem nahm. Am Steuer des Renaults hockte eine Frau. Ihr Kopf war zur Seite gedreht. Sie lag in den Splittern der Windschutzscheibe. Scherben in ihrem Rücken funkelten im Schein der Lampen wie Kristalle – obszöner Schmuck, glänzend, vermischt mit Blut und Holz. Weiter oben, auf der Landstraße, reihten sich mehr und mehr Blaulichter auf.
„Wo ist der Notarzt?“, rief einer der Feuerwehrmänner, als seine Kameraden begannen, die Beifahrertür aufzustemmen. „Wo zum Teufel bleibt der Notarzt?“
Sekunden später kroch der größte der Retter, sein Name war Jan Seifert, ins Innere des Wagens und öffnete die Fahrertür. Er schnitt sich an einer der Glasscherben, die mit scharfen Kanten aus der Fensterschiene ragten wie Reißzähne. Mit einem Mal legten sich zwei Arme um Seiferts Rücken. Für den Bruchteil einer Sekunde arbeitete sich ein Schrei durch seinen Hals nach oben, doch der Feuerwehrmann unterdrückte ihn.
Eiskalte Finger wischten durch sein Gesicht. Dann gab die Frau hinter dem Lenkrad einen Laut von sich, den er niemals wieder vergessen sollte. Es war eine Mischung aus Schreien und Stöhnen, durchsetzt mit Schmerz.
„Sie lebt!“
Die Frau strich mit blutigen Fingern über Seiferts Helm, hinterließ Schlangenlinien und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Dann sank sie nach vorne, in die Arme des Feuerwehrmannes, der kurz davor war, seine Hosen zu nässen wie ein kleiner Junge. Erst die Stimmen seiner Kameraden, die ihn mit Macht zu sich zogen, holten ihn ins Leben zurück. Widerwillig ließ er die tote Frau los.
ERSTER TEIL
– T O D –
EINS
Der Sturm tobte mit unnachgiebiger Härte. Welche Kraft das Unwetter jenseits der Fensterscheiben hatte, ließ sich in dieser Nacht nur erahnen. Vor fünf Tagen hatte es die ersten Warnmeldungen gegeben, danach war an der Ostküste nicht ein Nagel und Hammer mehr zu bekommen. Gestern hatte der Jahrhundertsturm Landstriche in Maine verwüstet. Jetzt bewegte sich die Walze nordwärts über kanadisches Gebiet – kräftig, stur und kein Ende findend. Dass David Bauer um kurz nach drei nicht in seinem Bett lag, hatte allerdings weniger mit dem Unwetter als vielmehr mit Erinnerungen zu tun. Kathleen war es neben ihm gelungen, sich still und leise ins Land der Träume zu verabschieden.
Bevor David aus dem Schlafzimmer ins Erdgeschoss schlich, warf er einen Blick in das Kinderzimmer, in dem sein Sohn Philip schlief. Der Junge atmete unruhig. Am Abend vor dem Sturm hatte er seinen Vater gefragt, ob sie bald auch in einer der Turnhallen schlafen mussten, die in aller Eile für die Evakuierten hergerichtet worden waren.
Im Lichtschein, der über die Türschwelle bis auf das Kinderbett huschte, war kaum etwas zu sehen. Der Junge hatte sich ins Oberbett gedreht und lag auf dem Bauch. Die Haare auf seinem Hinterkopf sahen aus, als habe er in eine Steckdose gefasst. Jenseits der Fenster heulte es unheilvoll.
Vor die meisten Scheiben hatte David Bretter genagelt, an der Seite seiner Frau, im Wind frierend, draußen auf dem Vordach. Zuletzt hatten sie das Fenster des Kinderzimmers gesichert und sorgenvolle Blicke zum Himmel geworfen.
„David, das bringt nichts. Lass uns reingehen und schauen, was sie in den Nachrichten sagen. Vielleicht zieht der Sturm an uns vorbei.“
Dann hatten sie beängstigende Wetterkarten betrachtet, die in immer kürzeren Intervallen gezeigt wurden. Schließlich war David wieder aufs Vordach gestiegen, um noch mehr Fenster zu vernageln.
Jetzt trat er einen Schritt zurück und zog die Tür des Kinderzimmers leise hinter sich zu. Der Flur zur Treppe war mit Teppich ausgelegt, der jeden Schritt verschluckte. Er schlich abwärts. Draußen donnerte es zum tausendsten Mal.
Eine Nacht wie geschaffen für schlechte Neuigkeiten, kam es ihm in den Sinn, als er den Treppenabsatz erreichte. In der Küche summte der Kühlschrank eine verführerische Melodie. Mit einer Dose Fosters in den Händen und Gänsehaut unter den Pyjamaärmeln ging David ins Arbeitszimmer. Er wagte nicht, das Licht einzuschalten, denn genau dann würde Kathleen oben im Schlafzimmer aufwachen, den zusätzlichen Stromverbrauch im Haus spürend, wie das nur Ehefrauen zu tun vermögen. Und schlimmer noch: Sie würde Fragen stellen. Unbequeme Fragen. So blieb es dunkel – vom Widerschein der Gewitterblitze über Prince Edward Island einmal abgesehen.
Das Notebook auf dem Schreibtisch schien nur auf David zu warten. Er schaute dem Rechner beim Hochfahren zu. Die einzigen Nachrichten in seinem E-Mail-Ordner, die er regelmäßig las, waren die seines Lektors und seiner Agentin in Washington. Flora setzte sich seit fast zwei Jahren für seine Arbeit ein – mit der Hartnäckigkeit eines Diamantbohrkopfes. Mit etwas Glück hatte sie bald einen Vertrag in der Tasche, der David und Kathleen für die nächste Zeit von allen finanziellen Sorgen befreite.
In den letzten Wochen hatte Flora sich beinahe täglich bei ihm gemeldet. Derzeit klapperte sie mit seinen Manuskripten Verlage in Nordamerika ab und kam allmählich in den Genuss, den Männern auf der anderen Seite der Konferenztische Bedingungen stellen zu können. Die Korrespondenz zwischen Flora Johnson und David Bauer erstreckte sich auf mehr als vierzig Textdateien. Sie tauchten auf dem Bildschirm auf.
Und da war sie wieder, die quälende, innere Stimme.
David, noch ist Zeit, den Rechner abzuschalten, bevor Kathleen auftaucht. Noch ist Zeit, das Knöpfchen zu drücken, den Bildschirm zu schließen und zu hoffen, dass niemand es hört. Noch ist Zeit, zurück ins Schlafzimmer zu schleichen, mit einer Flasche Wasser, die sich notfalls zum Alibi machen lässt. Noch ist Zeit, sich wieder ins Bett zu legen und die Vergangenheit ruhen zu lassen wie einen bösen Traum, den man besser vergisst.
Der Computer widersprach mit einem Signalton, der in dieser Nacht so laut erschien wie das Nebelhorn eines Tankers. David biss die Zähne zusammen und lauschte seinen Gedanken, als er sich in den Posteingang vertiefte. Für einen Moment schloss er die Augen – das hier ist mein Untergang! – und klickte auf die Mail, die ihn vor Stunden erreicht hatte. In der Betreffzeile stand ein Satz, der ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ.
Indianer kennen keinen Schmerz
David holte Luft, als er ihn las.
Sie haben mich gefunden. Sie haben mich ausfindig gemacht. Warum auch immer.
Ohne diese Betreffzeile hätte die E-Mail aus Deutschland genau jenes Schicksal ereilt, das in den Wochen zuvor zig anderen zuteil geworden war. Mittlerweile gab es überall in Nordamerika Menschen, die auf einen neuen Thriller von David Bauer warteten, ganz gleich, wie die Kritiken auch mit ihm umgingen. Einige seiner Leser nutzten das Internet, um ihn nach signierten Büchern oder Autogrammen zu fragen. Hin und wieder erreichten David auf diesem Weg auch Rezensionen. Seiner Aufforderung, ihm selbst Verrisse zu schicken, kam Flora jedoch bis heute nicht nach.
„Es reicht, wenn ich die Dinger lese, David“, hörte er seine Agentin sagen und öffnete die E-Mail.
Lieber David.
Hier geschehen beunruhigende Dinge.
Bitte antworte mir.
Roland
David rieb sich die Stirn. Vom Schreibtisch nahm er eine seiner fünf Lesebrillen – er war in dieser Hinsicht sehr vergesslich und hatte sie strategisch im Haus verteilt –, setzte sie auf und bemühte sich um klare Gedanken. Der Bildschirm flackerte einen Moment lang, als tosender Donner über die Insel zog. Noch einmal las David Satz für Satz der seltsamen Botschaft, um dann den Postausgang zu öffnen.
Roland, was ist los?
Hat das gereicht?
David klickte auf Senden und Empfangen. Der Computer meldete: Empfang der Nachricht 1 von 5.
Er blickte über seine Schulter. Manchmal, wenn er nachts an einer neuen Story schrieb oder an einem Manuskript feilte, beschlich ihn das Gefühl, dass jemand hinter ihm stand und heimlich mitlas.
David, wer ist groß genug, dir über die Schulter zu schauen und seinen Atem in deinen Nacken zu hauchen? Wer ist der ungebetene Gast?
Und was will er?
Die Betreffzeilen der ersten beiden Mails beruhigten ihn. Penisvergrößerung!, verhieß die oberste. Bei der zweiten Mail handelte es sich um die Bestätigung, dass man ihm in Halifax Karten für die Stones reserviert hatte. Die dritte und vierte Mail hatten irgendwelche Buchclubs an ihn geschickt.
Die fünfte Nachricht traf mitten ins Herz.
Indianer kennen keinen Schmerz
David zählte ohne einen Laut bis zehn, bevor seine rechte Hand zur Maus glitt, sie nach vorne schob und der Signalpfeil die Betreffzeile erreicht hatte. Sollte er sich das wirklich antun? Es ist so lange her.
Es waren nur wenige Zentimeter bis zur Löschmarkierung. Wenn er danach den Papierkorb leerte, wäre er für alle Zeiten erlöst. Das schlug ihm sein Verstand vor, bereit, einen teuflischen Pakt zu schmieden.
Lösch die Nachricht, vergiss sie, schalte den Rechner aus und gib acht, dass du dich niemals wieder an dieses Ding hier setzt, okay?
David öffnete Rolands Mail.
Sonja ist tot.
Er traute seinen Augen nicht. Er schloss sie, er öffnete sie, in der Hoffnung, die Kombination aus Buchstaben möge verschwinden wie ein böser Traum. Und auf einmal war er sich sicher, dass wirklich jemand hinter ihm stand. Fehlte ihm der Mut, sich umzudrehen? Oder fehlte ihm schlicht und einfach die Kraft? Noch immer zogen sich die Worte über den Bildschirm, brannten sich wie glühendes Eisen in Davids Seele. Buchstaben mit verheerender Wirkung. Es dauerte nicht lange, bis ihn die erste Welle aus Schmerz erfasste. Seine Augen füllten sich mit Tränen. In ihnen schwammen Trauer, Wut, Ohnmacht, Angst, Fassungslosigkeit und andere Dinge, die nicht zu greifen waren.
Er las die Mail zu Ende und fuhr den Rechner herunter. Seine Hände zitterten. Kurz vor vier. Er ahnte, dass er in den kommenden Tagen kein Auge zumachen würde. David stand auf, ging hinaus auf den Flur und erwartete, seine Frau zu erblicken, die im Nachthemd auf ihn zueilte wie ein ruheloses Gespenst. Doch das einzige Herz, das in jenen Sekunden im Erdgeschoss schlug, war sein eigenes.
David schlich ins Schlafzimmer zurück, sah, dass Kathleen schlief, legte sich neben sie und betete zum ersten Mal seit mehr als zwanzig Jahren.
Er hatte allen Grund dazu.
ZWEI
Als Thomas Wagner seine Augen öffnete, lösten sich die Zahlen des Weckers in Alkohol auf. Die Flasche Malt Whisky, die sich über Nacht zwischen ihn und die Digitalanzeige geschoben hatte, war so hoch wie ein Wolkenkratzer. Eine uneinnehmbare Festung aus Glas, gefüllt mit einer Flüssigkeit, die jeden Belagerer sofort in seine Bestandteile auflösen würde, sollte er auch nur einen Schluck davon trinken. Durst war von Natur aus ein unerbittlicher Gegner. Thomas schob den Kopf zurück aufs Kissen und hielt sich die Augen zu. Er zählte. Zunächst bis zwanzig, dann bis dreißig, und als er zum vierten Mal die Augen aufschlug, stand die Flaschenfestung noch immer an ihrem Platz. Erst als er den Verschluss abschraubte und sie an seine Lippen setzte, ließ das beunruhigende Gefühl, bald sterben zu müssen, nach. Er trank und spürte, wie der Whisky auf dem Weg in seinen Magen Flächenbrände entfachte. Das Zeug schmeckte nach Verstand. Thomas warf die leere Flasche an die Wand. Scherben flogen durchs Schlafzimmer.
Jetzt war die Uhr am Bett klar und deutlich zu erkennen. Die Zeiten, in denen er betrunken doppelt sah, waren vorbei. Wie lange hatte er geschlafen? War heute Dienstag oder Mittwoch? Er kam zu keinem Ergebnis und hatte immer noch Durst. Großen Durst. Um ihn zu stillen, musste er aufstehen und hoffen, dass er eingekauft hatte. Thomas nahm sich ein Herz, sofern in ihm überhaupt noch eines schlug, warf das Oberbett zur Seite und versuchte, sich auf die Bettkante zu setzen, was ihm erst beim zweiten Anlauf gelang.
Zumindest das Zeug aus Schottland, das ihm ein Kollege von einer Pressereise mitgebracht hatte – du kannst das hier besser brauchen als ich –, konnte ihm nicht mehr gefährlich werden. Er gähnte, bis er auf die Scherben weiterer Flaschen, die im Flur lagen, blickte. Die Tage, an denen es in seiner Wohnung aussah wie in einem Altglascontainer, häuften sich immer dann, wenn er wieder einmal einen Job verloren hatte. Im Flur erwarteten Thomas zwanzig leere Flaschen.
Der Geschmack der Weckerzahlen, der mit Whisky angereichert auf seiner Zunge lag, verlangte nach etwas anderem als Alkohol.
Vielleicht sollte ich mir nach vierzehn Tagen einfach mal wieder die Zähne putzen, fuhr es ihm durch den Kopf. Er schaffte es bis an den Kühlschrank, in dem ein Malzbier schlummerte, öffnete es auf der Kante des Küchentisches und leerte die Flasche in fünf Zügen. Nebenan klingelte das Telefon.
Nicht jetzt! Nicht hier! Versuchen Sie es bitte in zwei oder drei Jahren noch einmal. Aber nicht vor vierzehn Uhr.
Wieder öffnete Thomas den Kühlschrank auf der Suche nach etwas Essbarem. Die Joghurts neben der Milch waren acht Wochen alt. Ihre Metalldeckel wölbten sich verdächtig nach oben.
Nur eine Frage der Zeit, bis die Becher aufplatzen und Kreaturen ihre Köpfe hinausstrecken, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Ähnliches galt auch für die Packung alter Salamihappen, an der jeder Lebensmittelchemiker seine Freude gehabt hätte. Thomas zog den Küchenmülleimer zu sich heran und ließ die Joghurts und die Wurst hineinfallen. Einen Moment lang glaubte er ihn zu hören, den wütenden Aufschrei der Joghurt-Monster, bevor der Deckel des Mülleimers sich über ihnen schloss. Das Telefon klingelte immer noch wie von Sinnen, als er das Gefrierfach öffnete. Leer.
So kramte er sich durch den Kühlschrank, sortierte das eine oder andere aus und wünschte sich, dies auch mit seinen Gedanken tun zu können. Im Eisfach lag Geld. Zwanzig Euro. Das reichte für einen Einkauf.
In den vergangenen Tagen hatte sich das Telefon immer wieder gemeldet, mal lauter, mal leiser. Je nachdem, wie es gerade um seine Blutalkoholwerte bestellt war. Er glaubte sich daran zu erinnern, dass das Telefon sogar in der Nacht nach ihm gerufen hatte, auf dem Weg zur Kühlschranktür, um dahinter nach Dingen zu suchen, von denen er dachte, sie gekauft zu haben, als er noch bei Verstand war. Das war jetzt vier oder fünf Wochen her. Oder sechs oder sieben. Oder acht oder neun. Schwer zu sagen.
Beim zehnten Klingeln hatte Thomas den Quälgeist erreicht.
Ohne abzuheben riss er den Stecker aus der Telefondose, öffnete das Gehäuse und ließ die Akkus auf den Teppich fallen. Ihr Poltern verursachte Kopfschmerzen. Doch die waren allemal besser, als mit schlechten Nachrichten konfrontiert zu werden. Und dass dies hier schlechte Nachrichten waren, dessen war Thomas sich sicher. Nach zehn Jahren in Zeitungsredaktionen erkannte er bereits am Ton eines Klingelzeichens, welcher Art die Botschaft war, die es überbrachte.
Nachdem er das Telefon außer Gefecht gesetzt hatte, ging er ins Schlafzimmer zurück und dachte über einen Sprung aus dem Fenster nach.
Außerdem hatte er Hunger.
Einmal noch ein Grillhähnchen, knusprig, und dazu ein kaltes Bier. Einmal noch eine große Portion Pommes frites. Einmal noch ein Teller unter heißer Alufolie und ein Duft, der sinnlicher ist als jeder Sex der Welt. Krosse Haut, gut gewürzt, und darunter weiches Fleisch. Grillhähnchen sind der Beweis dafür, dass alle Atheisten lügen.
Okay, er musste den Sprung aus dem Fenster aufschieben. Jetzt galt es, sich anzuziehen und das Telefon zu vergessen. Beim Gedanken an seinen Hunger kam ihm ein unrühmlicher Fototermin vor Jahren in den Sinn, als er mit dem Werbewagen eines Hähnchengrills zur Ausstellung eines Geflügelzüchtervereins gefahren war, weil sein verfluchter Passat wieder mal den Geist aufgegeben hatte. Am Steuer des Leihwagens, den er vom Grillmeister seines Vertrauens geborgt hatte, war ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit jedes Hühnerfreundes aus Münster und Umgebung sicher.
Sorry. War nicht so gemeint. Ich koche auch nur mit Wasser. Bei dieser Erinnerung huschte ein Grinsen über seine Lippen. So muss es klingen, wenn man verrückt wird und sich dessen bewusst ist.
Thomas hasste sich für Gedanken dieser Art. Vor Ewigkeiten hatte er sich davon verabschiedet, das Fehlen sozialer Kontrolle in seinem Leben dafür verantwortlich zu machen. Mit Jeans und einem T-Shirt bekleidet, das auch schon bessere Tage gesehen hatte, schlurfte er in den Flur zur Garderobe. Die Stadtwerke hatten den Strom immer noch nicht abgestellt, und er schaltete die mit Spinnweben überzogene Deckenlampe ein. Er spähte zur Wohnungstür.
Der Briefschlitz quoll über.
Einige Kuverts – Persönlicher Gewinn für Sie, Herr Wagner! Zertifikat liegt bei! Bitte sofort öffnen! – lagen auf dem Parkettboden verteilt wie Spielkarten. Die anderen hatte er am Türrahmen gestapelt, ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen.
Er zog einen Berg neuer Post aus dem Briefschlitz. Umschläge fielen ihm aus den Händen. Einer der Briefe rutschte unter die Kommode neben der Tür, und ausgerechnet dieser war von Bedeutung. Thomas wusste zunächst nicht, warum er das spürte. Und er wusste auch nicht, wie es diesem Gedanken gelungen war, bis zu seinem Verstand vorzudringen.
Mit der inneren Stimme korrespondierend, knurrte sein Magen in einer Lautstärke, die er selbst nicht für möglich gehalten hätte. Ich bin erst tot, wenn das nicht mehr passiert. Ich bin erst tot, wenn ein Grillhähnchen mich so interessiert wie eine Talkrunde mit Sabine Christiansen. Der Brief, der in den Staub unter der Kommode gerutscht ist, wird mein Leben verändern.
Als Thomas sich danach bückte, schoss ihm das Blut in den Kopf. Einen Moment lang glaubte er, Sterne zu sehen wie ein Boxer, der einen Schlag ins Gesicht verkraften muss. Stöhnend ließ er den linken Arm unter die Kommode gleiten, wo seine Finger gegen ein staubiges Geldstück stießen, und dann das Kuvert erreichten. Als er das Papier zurück ins Licht zog, durchfuhr ihn ein Schauer.
Indianer kennen keinen Schmerz war auf der Rückseite des Briefumschlags zu lesen. Mit einem Mal war das Hähnchen vergessen. Von einer Sekunde auf die andere fühlte Thomas sich so nüchtern, wie schon seit Jahren nicht mehr.
„Gott im Himmel“, stöhnte er und fragte sich, wann er zuletzt seine Stimme gehört hatte. Noch immer starrte er auf das Kuvert. Wie lange hatte er diesen Satz nicht mehr gelesen? Wie lange hatte er sich eingeredet, ihn vergessen zu haben? Eine 55-Cent-Briefmarke aus dem Automaten hatte ihn zurück ins Leben katapultiert. Er spürte, dass sein Herz schneller schlug, immer dann, wenn der Blick auf den Brief in seinen Händen fiel. Es erübrigte sich die Frage, wer ihm das hier geschickt hatte. Das wusste er, noch bevor er das Kuvert mit seinen viel zu langen Fingernägeln auftrennte, Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter, als sei sein Inhalt vergiftet.
Gott im Himmel, lass das nicht wahr sein.
Aber der Brief lag immer noch da. Thomas war es hundeelend, und das hatte ausnahmsweise nichts mit Whisky, Schnaps, Weinbrand oder Bier zu tun. Das hier war der Garant für einen schlechten Tag und eine noch schlechtere Nacht.
Das hier war das Ende eines langen Weges.
Aber warum rief Roland ihn ausgerechnet auf diese Weise?
Weil er es bereits per Telefon versucht hat, fuhr es Thomas durch den Kopf. Weil du nicht abgenommen hast. Er hat es zigmal versucht, sogar nachts, als du deinen Dauerrausch ausschlafen musstest. Er hat nicht lockergelassen und sich gefragt, ob du gestorben bist in deiner stinkenden, kleinen Säuferbude, die du demnächst räumen musst, wenn du keine Reserven mehr auf dem Sparbuch hast. Das hier ist sein letzter Versuch.
Thomas setzte sich auf den Boden.
Seine Adresse war in Druckschrift geschrieben, auf 80-Gramm-Papier, chlorfrei gebleicht. Wie erwartet gab es schlechte Nachrichten. Das Gefühl, in die Tiefe zu stürzen, durchfuhr seinen Magen. Wann hatte er zum letzten Mal so etwas erlebt? Bei der Nachricht vom Tod seines Vaters? Thomas legte den Kopf zurück, sodass er gegen die Wohnungstür stieß, und in diesem Moment beschlich ihn das Gefühl, beobachtet zu werden. Streckte da nicht jemand seinen Kopf vom Schlafzimmer aus in den Flur? Nur für eine Sekunde, um zu sehen, ob er noch da war? Stand da nicht jemand auf der anderen Seite der Haustür, ein Auge gegen den Spion gedrückt, in der Hoffnung, die Gesetze der Optik überlisten zu können?
Thomas las Rolands Botschaft noch einmal.
Warum Sonja?
Er wünschte sich, eine Antwort parat zu haben, wie einen Wagenheber bei einer Reifenpanne im Regen. Gänsehaut schlich über seine Arme.
Thomas, da ist vorhin noch etwas durch den Briefschlitz gekommen. Es ist auf den Fußboden gefallen, hat sich aufgerichtet und sich den Staub vom Mantel geklopft. Es ist unsichtbar und überall: deine Vergangenheit. Das schmutzige Geheimnis, das du vergessen glaubtest. Es hat sich im Postzentrum über Förderbänder gekämpft und in Transportsäcke fallen lassen, den Brief nicht aus den Augen lassend. Zuletzt brauchte es nur noch dem Briefträger zu folgen. Der Rest war ein Kinderspiel.
Thomas rang nach Atem. Er hatte in den vergangenen Tagen immer wieder Probleme dieser Art gehabt, verbunden mit einem Ziehen im Brustkorb.
Als wir Indianer waren, da haben wir geglaubt, dass wir ewig leben. Wir dachten, dass niemand auf der Welt uns verletzen kann. Die Tage waren endlos, draußen im Wald. Kindern sind Kalender und Uhren egal. Nun wird es Zeit, dass wir zum Stamm zurückkehren. Es wird Zeit, dass wir uns stellen.
Ob auch David einen solchen Brief bekommen hatte?
Und wenn, wo las er ihn? Bei sich zu Hause? Oder in der Lounge irgendeines Großstadtflughafens, umgeben von wichtigen Männern mit Notebooks und Maßanzügen? David war vor zig Jahren von der Bildfläche verschwunden. Ein paar Magazine hatten darüber berichtet, als sein erster Krimi in Kanada erschien. Irgendwann hatte Thomas aufgehört, sich dafür zu interessieren. Irgendwann hatte er aufgehört, sich für alles zu interessieren, was auch nur entfernt mit der Indianerzeit zu tun hatte. Das fiel in jene Jahre, in denen ihn immer größerer Durst quälte.
Mühsam kehrten die Gedanken zum Brief in seinen Händen zurück. Er legte ihn zur Seite, vergaß seinen Hunger, vergaß seinen Durst, stand auf, ging ins Badezimmer, wusch sich, kehrte ins Wohnzimmer zurück, nahm das Telefon, legte die Batterien ein, schloss das Kabel an und hoffte, dass es noch nicht zu spät war. Noch einmal schaute er hinter jede Tür und auch unter sein Bett, um sicherzustellen, dass niemand ihn überraschte mit einem Todesstoß von hinten. Lächelnd bis ans Ende aller Tage, gekommen aus den ewigen Jagdgründen, um sich das zu holen, wonach es sich schon seit langer Zeit und von ganzem Herzen sehnte.
DREI
„Gott atmet ein, Gott atmet aus. Dabei vergeht noch nicht einmal eine Sekunde. Für uns dauert dieser Moment ein Menschenleben. Es ist unerheblich, ob wir von siebzig oder achtzig Jahren sprechen, von sechzig oder fünfzig. Gott war sich dessen bewusst, als er diese Frau hier zu sich holte. Und nur er allein weiß, warum so früh.“
Die Worte des Pfarrers brauchten lange, bis sie zu Roland vordrangen, angesichts der Gedanken, die der Trauerandacht Konkurrenz machten. Eine diffuse Mischung aus Schmerz, Angst und Ohnmacht beherrschte ihn. Unruhe drang in sein Herz, einem Flüstern gleich. Und Bilder aus der Erinnerung, die einen vergilbt, die anderen nicht. Je häufiger Roland Krafft versuchte, klare Gedanken zu fassen, umso drastischer überkam ihn das Gefühl der Schuld. Noch immer stand er in der kleinen, kalten Kapelle, in der viele Menschen weinten. Roland hatte es vermieden, sich einen der Sitzplätze zu sichern. Er harrte neben der schweren Holztür aus, durch die der Wind zog. Vor ihm lauschte ein dicker Mann den Worten des Pfarrers, hustend, mit einem Gesicht so rot wie der Kopf eines Streichholzes. Er trug Aftershave und einen Mantel aus Leder. Etwa fünfzig schwarz gekleidete Menschen drängten sich auf den Bänken. Roland ließ seinen Blick unauffällig durch die Reihen schweifen.
Seinen Wagen hatte er weit weg im Wald abgestellt, um zu Fuß zum Berger Friedhof zu gehen. Nur wenigen Autos war er auf dem Weg über die Landstraße begegnet. Von den Gesichtern hinter den Scheiben erkannte er nicht eines. Menschentrauben bewegten sich durch den Morgennebel zur Kapelle. Bei ihrem Anblick fiel jeder Meter schwerer und schwerer. Als er den Vorplatz erreicht hatte, fühlte Roland sich wie ein ungebetener Gast, der von hundert Augen beobachtet wurde. Er nutzte die Menge, um darin unterzutauchen und in die Kapelle zu gelangen. Er ließ sich hineindrängen und fand den richtigen Moment, den Strom aus Menschen zu verlassen.
Jetzt war er hier, war am Ziel, und er hoffte nichts sehnlicher, als unerkannt zu bleiben. Alle Aufmerksamkeit richtete sich auf den Pfarrer, der mit seiner warmen Stimme Worte suchte.
„Bleibt die Frage, warum Gott Sonja Valentin weit vor ihrer Zeit zu sich geholt hat durch einen tragischen Unfall. Wir sind hier, um von ihr Abschied zu nehmen. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie. Ein Leben nach so wenigen Jahren als erfüllt zu bezeichnen, fällt schwer. Doch wer Sonja Valentin kannte, der weiß, dass sie jeden ihrer Tage genutzt hat. Sie kann sich der Liebe ihrer Familie sicher sein. Sie ist stärker als das, was wir als Tod bezeichnen. Sie ist ein Fenster, das Gott aufstößt, damit wir Frieden finden. Sonja blickt hindurch, wenn wir an sie denken.“
Der Kopf des Pfarrers – ein untersetzter Mann mit kurzen roten Haaren und einem gepflegten Bart, der ihn britisch wirken ließ – schien in Styropor verpackt zu sein. Die Worte der Andacht drangen in Fragmenten bis zu Roland vor, vermischt mit einem Schluchzen, das durch die Kapelle schlich, untermalt von Schniefen, das mit Taschentüchern niedergekämpft wurde. Der Pfarrer ließ sich nicht beirren. Jedes Geräusch der Trauer war ihm vertraut. Dennoch gelang es ihm, sich die Routine nicht anmerken zu lassen.
„Nicht nur ihr Mann Rolf und ihr Sohn Tobias werden sie vermissen. Sie wird uns begleiten an jedem neuen Tag, wie das auch für Gottes Gnade gilt. Selbst wenn wir nicht jede seiner Entscheidungen nachvollziehen können im Schmerz, den uns ein Verlust wie dieser hier auferlegt. Wir werden sie nicht vergessen, und wir werden für sie beten. So wahr uns Gott helfe.“
Mit diesen Sätzen traf der Mann den Nerv der Trauergemeinde. Hin und wieder nickte der eine oder andere. Der Pfarrer wählte jedes seiner Worte mit Bedacht, wenn man davon absah, dass er Teile der Andacht von einem Blatt ablas, das neben dem Altar auf einen Notenständer gesteckt war. Sein Blick schweifte durch die Reihen, als er die Gemeinde bat, aufzustehen, um zu beten. Roland stimmte in das Vaterunser ein. Eine blasse junge Frau drängte nach draußen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Als sie die Tür hinter sich schloss, fuhr ein Luftzug über Rolands Schultern. Ein Hauch von Parfum umspielte seine Nase. Er hätte schwören können, es schon einmal gerochen zu haben.
Es war falsch, hierherzukommen. Was ist, wenn mich jemand erkennt? Was ist, wenn die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind?
Das Vaterunser lag in seinen letzten Zügen.
„Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen.“ Die Gemeinde setzte sich wieder.
Eine weitere Frau verließ die Reihen. Sie war um einiges älter. Die Trauer in der Kapelle war nicht nur zu hören, sie war auch zu riechen. Eine Mixtur aus Hustenbonbons und Mottengift. Durchmischt mit dem Aroma von Blumen, die angehäuft waren wie beim Begräbnis einer Prinzessin. Die Menschen, die hierhergekommen waren, um Sonja Valentin das letzte Geleit zu geben, hatten ein Vermögen in Trauerschmuck investiert. Es duftete nach Tannengrün und Deodorant unter selten benutzter Kleidung.
Roland starrte auf den Sarg, der neben dem Notenständer aufgebahrt war. Der Anblick schnürte ihm die Kehle zu wie eine Schlinge aus Draht. Er rang um Fassung, er rang um Unauffälligkeit. Gleich nach dem Gottesdienst würde er sich einen abgelegenen Platz an der Friedhofsmauer suchen. Die Beisetzung wollte er auf keinen Fall aus der Nähe erleben. Roland ertappte sich dabei, wie er abermals die Sitzreihen absuchte in der Erwartung, vertraute Gesichter in der Menge zu erkennen.
Beunruhigend viele Menschen bewegten sich Richtung Ausgang, vor allem aus den hinteren Reihen der Kapelle, während der Pfarrer weitersprach.
Ich bin nicht der Einzige, der das hier so schnell wie möglich hinter sich bringen will, dachte Roland. Einen Moment lang spürte er, dass im Gemisch aus Trauer, Argwohn und Bestürzung noch etwas anderes schwamm, das er gerne aus seinem Kopf gespült hätte wie benutztes Waschwasser: Furcht.
Roland warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Kurz vor zwölf.
Der Dicke neben ihm hustete lauter denn je. Was war, wenn der Kerl zusammenbrach? Was war, wenn sich mit einem Mal mehr als hundert Augen auf ihn richteten? Der Mann hielt sich eine Hand vor den Mund, als ihn die nächste Hustenattacke schüttelte. Ein Kettenraucher? Ein Asthmatiker? Roland beobachtete seinen Nachbarn aus den Augenwinkeln. Jeder Atemzug des Mannes ging in ein Pfeifen über. Das Leder seiner Handschuhe knirschte, als er sie zu Fäusten ballte.
Wie wäre es, wenn Sie einfach nach draußen gehen und den Pfarrer das erledigen lassen, wofür er bezahlt wird? Der Hustenmann schien Rolands Gedanken gehört zu haben. Er griff verschämt hinter sich, drückte die Türklinke Zentimeter für Zentimeter nach unten, um nach draußen zu verschwinden. Selbst durch die Mauern der Kapelle war sein Keuchen zu hören.
Roland richtete seine Aufmerksamkeit auf den Pfarrer und das eingerahmte Foto, das neben dem Sarg stand. Es zeigte eine Frau, bildhübsch, porträtiert vor einer dunklen Leinwand. Die Anspielung eines Lächelns war auf Sonjas Bild festgehalten, flankiert von blauen Augen und einer hochgesteckten Frisur, die ihr etwas Mädchenhaftes gab. Roland bemühte sich, die Fotos aus dem Polizeibericht zu verdrängen, die am Unfallort gemacht worden waren.
Auf ihnen lächelte Sonja nicht.
Der Sarg aus weinrotem Holz – seine Beschläge stachen aus den Blumenbouquets hervor wie Goldstücke – ließ die Kraft des Fotos verblassen. Er spürte, dass viele Blicke darauf ruhten und sich fragten, wie es unter dem Deckel aussehen mochte. In der Dunkelheit.
Alle hoffen, dass Sonja immer noch lächelt, friedlich eingeschlafen, ohne Schmerzen. Erst das lässt es sie ertragen. Sie wollen nicht wissen, was sich wirklich ereignet hat in jener Nacht, draußen im Wald an der Schulenburg, als Sonjas Schicksal in den Trümmern ihres Autos besiegelt wurde. Sie wollen nicht wissen, ob sie unter Schmerzen litt. Und sie wollen auch nicht wissen, ob sie eine Chance gehabt hätte, wäre der Wagen in einem anderen Winkel gegen den Stamm gerast. Sie wollen nicht wissen, warum sie von der Straße abkam. Und sie wollen auch nicht wissen, wohin sie fuhr. Ihnen geht es nur um die Gewissheit, dass Sonja es jetzt besser hat.
Noch immer versuchte Roland, an den Feuerwehrmann zu kommen, der in den letzten Sekunden bei ihr war. Das brauchte Zeit. Die vielen Menschen, die hierhergekommen waren, um Sonja zu betrauern, gaben seiner Vorsicht recht. Er durfte kein Aufsehen erregen.
Eine alte Orgelmelodie, die Roland zu kennen glaubte, schleppte sich durch die Trauergemeinde. Es war an der Zeit, die Kapelle zu verlassen. In seinen Gedanken schrieb er noch einmal die Briefe an David und Thomas. Wort für Wort, Zeile für Zeile. Und er hoffte, beide bald zu sehen.
Welcher seiner Freunde würde länger brauchen auf dem Weg hierher? David hatte einen Ozean zu überwinden, Thomas seinen Suff. Und sie hatten etwas zu erledigen, das keinen Aufschub duldete.
Da war es wieder, das seltsame Gefühl, beobachtet zu werden. Roland nahm allen Mut zusammen, schaute auf und hoffte, dass sein Blick sich mit keinem anderen traf. Drei Kinder saßen auf den Bänken. Sie blickten abwechselnd zum Pfarrer und auf den Sarg, der ihnen zum ersten Mal in ihrem Leben vor Augen führte, was das Wort Tod wirklich bedeutet.
Raus hier! Er brauchte frische Luft, andere Gedanken. Er brauchte Distanz. Und er brauchte einen Freund, der ihn wachrüttelte, um ihm zu sagen, dass er das alles nur träumte. Roland drückte den Türgriff. Im selben Moment fiel hinter dem Pfarrer, der den Gottesdienst beendet hatte, das schwere Eisenkreuz von der Wand. Es rutschte vom Mauerwerk – kreischend – und hinterließ einen langen Kratzer. Donnernd schlug es auf den Fliesenboden. Die Orgelmusik verstummte. Der Kopf des Pfarrers war jetzt mindestens ebenso rot wie der des Kerls, der draußen immer noch hustete. Ein Raunen ging durch die Menge, als der Mann im Talar hinter den Altar schritt und das Kreuz vom Boden hob.
Es war in der Mitte zerbrochen.
VIER
„Was ist los?“
David vernahm Kathleens Frage erst Sekunden später. Noch immer saß er am Küchenfenster. Regen trommelte gegen die Scheibe, vermischt mit abgerissenen Zweigen und Laub. Überall im Haus knirschte es. Jeder Holzbalken stemmte sich gegen den Sturm. Anstrengung lag in der Luft.
„Was ist los?“ Kathleen holte Atem, als sammele sie Reserven für einen Sprint. David kannte dieses Geräusch. Es verhieß nichts Gutes.
„Schläft Philip?“, fragte er.
„Tief und fest“, erwiderte sie und zog die Kühlschranktür auf. „Was man von dir nicht behaupten kann.“ Vor ihr klirrten Flaschen in verschiedenen Tonlagen. Mit einem Glas Milch kehrte sie ins Halbdunkel zurück und ließ die Tür mit einem Schmatzen zuschlagen. Sie sah ihn an. „David, was ist los?“
„Was soll los sein? Das Dach macht nicht lange mit, wenn es so weitergeht.“
„Das ist nichts gegen den Sturm vor vier Jahren“, sagte Kathleen.
David starrte weiter hinaus in den Regen. „Vielleicht solltest du mit Philip zur Sammelstelle fahren und abwarten, bis das Schlimmste vorbei ist.“
„Ich kann wieder nach oben gehen, wenn es dir lieber ist“, erwiderte Kathleen gereizt. „Ich glaube dir alles. Aber dass dir nur das Unwetter Sorgen macht, nehme ich dir nicht ab.“
„Warum?“, fragte David. Diesmal bemühte er sich, gereizt zu klingen. Es gelang ihm nicht. „Was meinst du damit?“
„Dir geht etwas anderes durch den Kopf“, sagte sie leise. „Glaubst du, ich merke das nicht?“
Er spürte, dass alles aus dem Ruder lief. Seine Frau ließ sich nicht täuschen. Das brachte ihn noch mehr in Schwierigkeiten.
„Warum sagst du mir nicht einfach, was los ist?“
„Weil ich das nicht kann“, sagte David. „Noch nicht.“
„Noch nicht?“
David beobachtete seine Frau und ging in die Offensive. „Für uns ist es nicht von Bedeutung.“
„Das glaubst du doch selbst nicht“, rief sie.
„Wie du meinst.“ Ihm blieb nicht mehr viel Zeit, nachdem er seine Deckung verlassen hatte. „Ich muss für ein paar Tage nach Deutschland.“
Sekundenlang herrschte Stille.
Kathleen stellte ihr Glas ab. „Wie lange?“
„Vielleicht eine Woche“, sagte David. „Das wird sich zeigen.“
„Was wird sich zeigen?“ Kathleen nahm an der anderen Seite des Tisches Platz. „Du sprichst in Rätseln.“
„Ich wünschte, ich könnte das ändern. Aber ich kann es nicht. Ich habe etwas Wichtiges zu erledigen.“
In seinen Gedanken formten sich Worte.
Eine gute Freundin ist ums Leben gekommen. Und weißt du was, Kathleen? Ich bin mir sicher, dass ich etwas mit ihrem Tod zu tun habe.
„Und damit soll ich mich zufriedengeben?“
„Das wäre ein Anfang.“ Er beobachtete die Reaktion im Gesicht seiner Frau. „Würde die Sache leichter machen.“
„Wie stellst du dir das vor? In zwei Wochen kommt der Auftrag aus Vancouver, und in der Agentur brauchen sie jeden, der auch nur seinen Namen buchstabieren kann. Ich stehe bei Harold im Wort.“
„Deine Mutter wird sich um Philip kümmern“, sagte David.
„Du hast schon mit ihr gesprochen? Ohne mich zu fragen?“
„Es ging nicht anders.“ David nickte. „Ich will nicht, dass du wegen mir den Job schmeißt. Becky war sofort einverstanden.“
„Ich hoffe, das ist es wert, David.“ Kathleen trommelte mit ihren Fingernägeln auf der Tischplatte.
„Es reicht, wenn ich mir das Hirn zermartere.“ Er beugte sich vor und berührte ihre Hand. „Ich wünschte mir, ich hätte eine andere Wahl.“
Kathleen zog ihre Hand zurück. „Das klingt so, als sei es gefährlich.“
David erhob sich und schaute aus dem Fenster. „Du musst mir vertrauen.“
Dieser Satz war kaum beendet, als ihm beim Blick nach draußen der Atem stockte. Einen Moment lang glaubte er am Waldrand die Umrisse eines kleinen Jungen zu sehen. Sie verschwanden im Gewitter. Als seine Frau hinter ihn trat und ihn auf den Halsansatz küsste, fuhr er zusammen. David starrte aus dem Fenster, als könne das den Lauf der Dinge aufhalten.
FÜNF
Thomas Wagner hockte ebenfalls in der Küche, Stunden versetzt und mehrere Tausend Kilometer entfernt. Vier Säcke Müll und Flaschen hatte er nach draußen befördert – zur Verwunderung seiner neugierigen Nachbarin aus der Wohnung nebenan, die ihren Fernseher so laut gestellt hatte, dass die 500-Euro-Frage bei Wer wird Millionär? selbst zwei Räume weiter zu hören war. Zehn Minuten vor dem Rasierspiegel lagen hinter Thomas. Und zwanzig in der Badewanne. Er schüttete sich die dritte Tasse Kaffee ein, den Schmerz im Magen ignorierend wie einen schlechten Witz. Um sich zu beruhigen, hatte er im Wohnzimmer das Radio eingeschaltet und im Bad die Waschmaschine, die er zuletzt vor drei Monaten benutzt hatte. Das Donnern im Schleudergang gaukelte ihm vor, nicht alleine zu sein. In den Nachrichten liefen Kriegsmeldungen aus Afghanistan und dem Irak.
Vor ihm lagen eine Schachtel Kopfschmerztabletten und ein Schuhkarton in blauer Farbe, den er unter seinem Bett hervorgezogen hatte. Das Ding stammte aus den 80er-Jahren. Der Karton hatte Thomas schon gehört, als er ein Junge war. Turnschuhe hatte er beherbergt, einst schwer in Mode, vorausgesetzt, auf ihnen waren drei Streifen zu sehen. Damals hatte Thomas nicht geahnt, dass er die Kiste mehr als zwei Jahrzehnte später noch immer besitzen würde. Der Karton war mit Packband verklebt, und er brauchte eine Schere, um ihn zu öffnen. Das Telefon schwieg nach wie vor. Thomas ahnte, dass Roland ihm nicht den Gefallen tun würde, noch einmal anzurufen.
Wie würde Sonja entscheiden?
Haben wir uns nicht darauf geeinigt, es hinter uns zu lassen?
Thomas beobachtete über den Rand seiner Tasse eine Stubenfliege. Sie kreiste durch die Küche, bis sie an jene Schreibtischlampe stieß, die er geholt hatte, um besser sehen zu können, wenn er den Karton öffnete. Eine winzige Staubwolke wirbelte auf, als die Fliege sich über die heiße Glühbirne kämpfte und das Weite suchte. Thomas versuchte nicht, nach ihr zu schlagen. Das hatte er sich schon vor langer Zeit abgewöhnt. Ihn interessierte nur der Inhalt der Schachtel. Vom Dröhnen des Fernsehers nebenan abgesehen, war er wieder allein mit sich, seiner Angst und dem Schuhkarton. Thomas sehnte sich nach einer Zigarette. Es gab Zeiten, da hatte er Kette geraucht, damals in der Redaktion, als alles noch zu seinen Gunsten lief. Was hatte er in jenen Jahren nicht alles zu Qualm gemacht? Wie viel Geld hatte er in dieser Zeit verbrannt?
Er beantwortete sein Verlangen mit Kaugummi. Abgestandener Geschmack breitete sich in seinem Mund aus.
Vielleicht war es besser, den Karton wieder unter das Bett zu schieben, ihn für die nächsten zweihundert Jahre zu vergessen und lieber einen Liter Weinbrand zu trinken. Vielleicht war es besser, sich dem Suff hinzugeben, wie er es früher oder später ohnehin tun würde.
Alles nur eine Frage der Zeit.
Nur ein Schluck, nur ein winzig kleiner Schluck, und du machst dir keine Sorgen mehr.