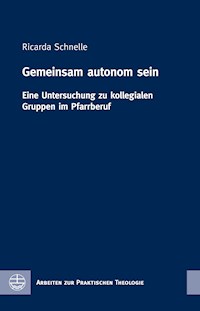
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Arbeiten zur Praktischen Theologie (APrTh)
- Sprache: Deutsch
Die Studie untersucht die Bedeutung kollegialer Gruppen für den Pfarrberuf. Dabei wird erstmals die in der pastoraltheologischen Forschung vorherrschende Fokussierung auf einzelne Pfarrer und ihre individuelle Praxis überwunden. Vor dem Hintergrund professionstheoretischer Ansätze untersucht die Autorin die gemeinsame Praxis von Pfarrerinnen und Pfarrern in Pfarrkonferenzen und selbstorganisierten Treffen mithilfe einer empirisch-qualitativen Erhebung. Kollegiale Gruppen dienen der gegenseitigen Vergewisserung, der Sicherung professionellen Handelns und der Wahrung der Autonomie einzelner Pfarrer sowie der gesamten Berufsgruppe. Die Arbeit in diesen Gruppen wird erstmalig als ein eigenständiger Tätigkeitsbereich pastoralen Handelns beschrieben und gewürdigt. Davon ausgehend entwickelt die Autorin die pastoraltheologische These, dass dem Pfarrberuf eine kollektive Dimension innewohnt, und eröffnet eine neue Perspektive für die Reflexion der gemeinsamen Arbeit innerhalb der Berufsgruppe. Being Autonomous Together. A Study on Collegial Groups in the Parish Ministry This study examines the importance of collegial groups for the parish ministry. For the first time, the prevailing focus in pastoral theological research on individual pastors and their individual practice is overcome. Against the background of professional theoretical approaches, the author examines the common practice of pastors in parish conferences and self-organized meetings with the help of an empirical-qualitative survey. Collegial groups provide mutual assurance, ensure professional action and preserve the autonomy of individual pastors and the entire professional group. The work in these groups is for the first time described and appreciated as an independent field of pastoral activity. On this basis, the author develops the pastoral theological thesis that the parish profession has a collective dimension and opens a new perspective for the reflection of common work within the professional group. The author received her doctorate in 2018 with this thesis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arbeiten zur Praktischen Theologie
Herausgegeben von Jan Hermelink, Wilfried Engemann, Christian Grethlein, Marcel Saß und Alexander Deeg
Band 76
Ricarda Schnelle
GEMEINSAMAUTONOM SEIN
Eine Untersuchung zu kollegialen Gruppen im Pfarrberuf
Ricarda Schnelle, Dr. theol., Jahrgang 1985, studierte in Erlangen und Münster ev. Theologie und arbeitete nach dem Vikariat als Pfarrerin im Braunschweiger Umland. Von 2014 bis 2018 war sie Wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Praktische Theologie und Pastoraltheologie an der Theologischen Fakultät in Göttingen, wo sie mit der vorliegenden Arbeit promoviert wurde. Seit Mai 2018 arbeitet sie als Pastorin in den Kirchengemeinden Haimar, Rethmar und Sehnde (Ev.-luth. Landeskirche Hannovers).
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2019 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Cover: Zacharias Bähring, Leipzig
Satz: makena plangrafik, Leipzig
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2019
ISBN 978-3-374-06115-0
www.eva-leipzig.de
VORWORT
Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2018/2019 von der Theologischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen als Dissertation angenommen. Für den Druck wurde sie leicht überarbeitet.
Prof. Dr. Jan Hermelink hat das Forschungsprojekt vom ersten Gedanken bis zum letzten Wort engagiert begleitet und unterstützt. Ich danke ihm für sein Vertrauen und für die Freiheit, einen neuen pastoraltheologischen Weg zu gehen. Prof. Dr. Bernd Schröder danke ich für die Anfertigung des Zweitgutachtens, Prof. Dr. Martin Laube für die Bereitschaft, an der Disputation als Drittprüfer mitzuwirken.
Die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) und der Arbeitskreis für Empirische Religionsforschung e. V. haben den Druck des Buches dankenswerterweise finanziell unterstützt. Den Herausgebern der Arbeiten zur Praktischen Theologie ist zu danken für die Aufnahme des Buches in die Reihe und der Evangelischen Verlagsanstalt in Leipzig für die zuverlässige Zusammenarbeit.
Besonderer Dank gilt: Pfarrer Dierk Glitzenhirn, Miriam Schäfer, Pastorin PD Dr. Julia Koll, Pfarrerin Angela Hahnfeldt sowie dem UvH e. V. in Göttingen.
Die Transkriptionen der Gruppendiskussionen haben Angela Hinkel, Lina Hantel, Jonathan Hiller und Saskia Morié angefertigt: Danke für eure Mühe!
Ermöglicht wurde das Forschungsprojekt in dieser Form erst durch die Pfarrerinnen und Pfarrer, die vor dem Aufnahmegerät miteinander gesprochen haben. Für ihre Zeit und ihre Offenheit bin ich sehr dankbar.
Sehnde, im März 2019
Ricarda Schnelle
INHALT
Cover
Titel
Über die Autorin
Impressum
Vorwort
1EINLEITUNG
2ALLEIN PFARRER SEIN.EINE PASTORALTHEOLOGISCHE THEORIELINIE
2.1Aktuelle pastoraltheologische Entwürfe
2.1.1Manfred Josuttis: Im Gegenüber anders sein
2.1.2Isolde Karle: Allein als Generalist vor Ort
2.1.3Ulrike Wagner-Rau: Allein auf der Schwelle
2.1.4Christian Grethlein: Die Vermittlungsaufgabe des Einzelnen
2.1.5Michael Klessmann: Mit anderen ein individuelles Berufsbild entwickeln
2.1.6Zusammenfassung
2.2Empirische Forschung in der Pastoraltheologie
2.2.1Die fünfte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft (V. KMU): Vis-à-vis zum Pfarrer
2.2.2Befragungen von Pfarrerinnen/Pfarrern: Der Fragebogen als Spiegel für die Selbstbetrachtung
2.2.3Empirische Forschungsarbeiten: Die Sicht des Einzelnen auf seine Arbeit vor Ort
2.2.4Zusammenfassung
2.3Das (pastoral-)theologische Paradigma des Einzelnen
3DIE BEDEUTUNG DER BERUFSGRUPPE IN DER PROFESSIONSSOZIOLOGIE
3.1Aktuelle Forschungsperspektiven in der Professionssoziologie
3.2Die Funktion der Berufsgruppe für Professionsberufe
3.2.1Die Erscheinungsform professioneller Ethik: Ethische Kodizes
3.2.2Begründungslinien für die Ausbildung und Notwendigkeit von Professionsethik
3.2.2.1Autonomie führt zu kollegialer Binnenkontrolle: Der strukturfunktionalistische Ansatz
3.2.2.2Die innere Handlungslogik der Professionen führt zur Institutionalisierung kollegialer Formen: Die revidierte Professionstheorie nach Ulrich Oevermann
3.2.2.3Professionsethik kontrolliert das professionelle Handeln: Der systemtheoretische Ansatz nach Rudolf Stichweh
3.2.2.4Die Paradoxie professionellen Handelns macht Kontrolle erforderlich: Der interaktionistische Ansatz nach Fritz Schütze
3.2.3Zusammenfassung
3.3Kollegiale Gruppen im Fokus professionssoziologischer Überlegungen zum Pfarrberuf: Das Forschungsdesiderat
3.3.1Professionsethik schützt das Vertrauen in der professionellen Interaktion: Isolde Karles professionstheoretische Überlegungen zum Pfarrberuf
3.3.2Professionssoziologische Überlegungen zur Berufsgruppe als Chance der Erweiterung pastoraltheologischer Forschungs- und Theorielinien
3.3.3Forschungsfrage und Forschungsgegenstand
4METHODIK
4.1Die Theorie des Gruppendiskussionsverfahrens
4.2Auswahl der Gruppen
4.3Konzeption und Durchführung der Gruppendiskussionen
4.3.1Rahmenbedingungen der empirischen Erhebung
4.3.2Durchführung der Gruppendiskussionen
4.4Auswertung anhand der dokumentarischen Methode
4.5Anonymisierung und Sensibilität der Daten
5EMPIRISCHE ERGEBNISSE DER GRUPPENDISKUSSIONEN
5.1Zur Darstellung der Analyse
5.2Abgrenzungen nach außen und Vergewisserung nach innen: Das Reden in Abgrenzungen
5.2.1Die Gruppen und ihre Leitabgrenzungen
5.2.1.1»Aus einer Zeit autoritärer Führung […] sind wir hervorgegangen«: Pfarrkonferenz I
5.2.1.2»Vor der Fusion und nach der Fusion«: Pfarrkonferenz II
5.2.1.3»Wir wollen uns nicht zerlegen lassen«: ›Oasentage‹
5.2.1.4»Eindeutig Position beziehen«: Wissenschaftlicher Arbeitskreis
5.2.1.5»Dass wir nur Frauen sind«: Supervisionsgruppe
5.2.1.6Zusammenfassung: In der Abgrenzung das Eigene zeigen
5.2.2Das Thema Gruppenzugehörigkeit: Wer soll dazugehören?
5.2.2.1»Also dass immer irgendwelche Nichtordinierten da rumhängen«: Abgrenzung von Nichtordinierten in den Pfarrkonferenzgruppen
5.2.2.2»Das is deins und hier is meins« Abgrenzungen von nichtanwesenden Gruppenmitgliedern in den selbstorganisierten Gruppen
5.2.2.3Zusammenfassung: Einander in der Abgrenzung vergewissern
5.2.3Die Praxis der Gruppen im Verhältnis zu anderen Gruppen
5.2.3.1»Da gabs (nur) Kekse«: Abgrenzungen von anderen Pfarrkonferenzgruppen
5.2.3.2»Wir haben einen niedrigeren Krankenstand als andere Leute«: Abgrenzungen von Kolleginnen/Kollegen
5.2.3.3Zusammenfassung: Durch die Hervorhebung des Besonderen die eigene Praxis legitimieren
5.2.4Zwischenfazit: In der Abgrenzung liegt die Vergewisserung
5.3Autonom den Zweck bestimmen: Das Verhältnis von individueller Berufspraxis und Gruppenpraxis
5.3.1Die Struktur der Gruppentreffen
5.3.1.1Zusammenfassung: Autonom über die Struktur entscheiden
5.3.2Das Verhältnis von individueller Berufspraxis und den Treffen der Gruppe
5.3.2.1»Uns mal in die Augen zu sehen«: Leibliche und interaktiv geprägte Ko-Präsenz
5.3.2.2»Lehnt man sich zurück kriegt n schönes Frühstück«: Nehmen und Geben
5.3.2.3»Der kann sich doch nicht wehren«: Autonom den Zweck bestimmen
5.3.2.4»Aber stimmt; ich hab=s auch verwurstet«: Die wechselseitige Bedingtheit der Ko-Präsenz, der autonomen Zweckbestimmung und des Nehmens für sich
5.3.2.5Zusammenfassung: Autonom über die individuelle und gemeinsame Praxis entscheiden können
5.3.3Sichtbar und zugleich verborgen: Zugehörigkeit und Solidarität jenseits der Gruppentreffen
5.3.3.1»Auch wenn wir uns gar=nich sehn«: Verborgene Verbundenheit und Solidarität in der individuellen Berufspraxis
5.3.3.2»Da hab ich mich von dem Konvent richtig aufgefangen gefühlt«: Sichtbare Zugehörigkeit und Solidarität in der individuellen Berufspraxis
5.3.3.3Zusammenfassung: Sichtbar werden und zugleich verborgen bleiben
5.3.4Zwischenfazit: Allein und zusammen – unterschieden und dennoch aufeinander bezogen
5.4Normativ und zugleich vage: Der Austausch in den kollegialen (Interview-)Gruppen
5.4.1Austausch an den Übergängen
5.4.1.1»Einfach nebenbei auch mal zu sprechen«: Austausch am Rande als Thema in den Gruppendiskussionen
5.4.1.2»Das is °wirklich so° gerad mein Fa:zit«: Austausch am Rande im Rahmen der Gruppendiskussionen
5.4.1.3Zusammenfassung: Im Übergang von der aktuellen Situation erzählen
5.4.2Die strukturellen Muster des Austauschs im Rahmen der Gruppendiskussionen
5.4.2.1»Aber das kann sich immer (.) wie ihr wisst, schnell ändern«: Das Muster ›einerseits und andererseits‹
5.4.2.2»Aber damit kannst=e ja am Sonntag nicht auf die Kanzel gehen«: Das Muster ›Ideal und Wirklichkeit‹
5.4.2.3Zusammenfassung: Selbstbestimmt die Ideale umsetzen
5.4.3Zwischenfazit: Die Norm, selbstbestimmt vage zu bleiben
5.5Kontrollieren und sich zugleich der Kontrolle entziehen: Die Funktionen von Normen innerhalb der Gruppenpraxis
5.5.1Kontrolle der Teilnahmedisziplin
5.5.1.1»Ach die waren gar nicht bei der Andacht?«: Kontrolle der Teilnahmedisziplin als Thema in den Gruppendiskussionen
5.5.1.2»Ich habe auch viel zu tun«: Kontrolle der Teilnahmedisziplin im Rahmen der Erhebung der Gruppendiskussionen
5.5.1.3»Dass man eben n Anruf kriegte weil man nicht da war«: Kontrolle der Teilnahmedisziplin durch die Leitungsinstanz und wie man sich ihr entzieht
5.5.1.4Zusammenfassung: Die Norm einer selbstbestimmten Teilnahme als Strategie, sich der Kontrolle zu entziehen
5.5.2Kontrolle der individuellen Berufspraxis
5.5.2.1»Auch so=n Eindruck kriegt wo arbeiten die eigentlich«: Gemeinsam gefeierte Andachten als Orientierung und Kontrolle
5.5.2.2»Ach Gott der Superintendent sitzt da«: Die Kontrolle der individuellen Berufspraxis jenseits der Gruppentreffen
5.5.2.3Zusammenfassung: Vermeidung von Kontrolle als Strategie, die Autonomie gegenseitig zu wahren
5.5.3Zwischenfazit: Die Entwicklung und Kontrolle von Normen als Strategie, die gegenseitige Autonomie zu wahren
5.6Geschützter und zugleich ungeschützter Raum: Das Sprechen in räumlichen Perspektiven
5.6.1Reale Räume
5.6.1.1»So wie hier und dann wirklich rundum bis an die Decke nur Regale«: Die Räume der individuellen und kollektiven Berufspraxis
5.6.1.2»Jedenfalls kommen wir irgendwann an dieser Tür an«: Wechsel zwischen den Räumen
5.6.2Symbolische Räume
5.6.2.1»Wer kommt denn gleich um die Ecke und hört es mit«: In geschützten Räumen der Kontrolle entgehen
5.6.2.2»Sie bleiben aber noch zum Essen!«: Die Aufnahme der Interviewerin in den geschützten Raum
5.6.3Zwischenfazit: Räume und Raumwechsel als Symbol und Ausdruck für Autonomie
5.7»Dass man da so über den Tellerrand gucken kann und so«: Kontrastgruppe Studiensemester
5.7.1»Spannend wie verschieden das ist«: Würdigung der Vielfalt
5.7.2»Dass man da so über den Tellerrand gucken kann«: Auffächerung des Feldes der kollegialen Gruppen
5.7.3»Da liegt Segen drin«: Gemeinsames Essen
5.7.4»Der muss früher gehen oder kommt später«: Teilnahmedisziplin und deren Kontrolle
5.7.5»soll ich sozusagen oasentagsmäßig irgendwie nichts tun«: Die Verpflichtung zur Pause
5.7.6Zwischenfazit: In der Weite liegt Autonomie
5.8Fazit: Die Struktur des autonomen Wechsels
6FUNKTIONEN KOLLEGIALER GRUPPEN FÜR DEN PFARRBERUF IN PROFESSIONSSOZIOLOGISCHER PERSPEKTIVE
6.1Unsicherheit und Vergewisserung
6.1.1Unsicherheit
6.1.2Vergewisserung
6.2Sicherung des professionellen Handelns
6.2.1Informationen und Absprachen
6.2.2Fortbildung
6.2.3Die Entwicklung von Normen und deren Kontrolle
6.3Wahrung der Autonomie
6.3.1Die selbstbestimmte Praxis der kollegialen Gruppen
6.3.2Monopolerhalt – im Gegenüber zu Gegenakteuren
6.3.3Monopol- und Machterhalt – im Gegenüber zur Organisation Kirche
6.4Fazit: Kollegiale Gruppen als Orte der Autonomiewahrung für die Berufsgruppe der Pfarrerinnen/Pfarrer
7GEMEINSAM PFARRERINNEN/PFARRER SEIN.DIE INTEGRATION EINER KOLLEKTIVEN DIMENSION IN DIE THEORIE DES PFARRBERUFS
7.1Kollegiale Gruppen und ihre Funktionen für den Pfarrberuf: Eine Zusammenfassung
7.2Die Arbeit in kollegialen Gruppen als eigenständiger Teil des Pfarrberufs
7.3Kirchentheoretische Einordnung: An den Rändern der Organisation
7.4Hinter verschlossenen Türen: Pfarrberuf und kirchlicher Reformprozess
7.5(Forschungs-)Perspektiven für eine kollektive Pastoraltheologie
7.5.1Aus- und Fortbildung
7.5.2Kollegiale Gruppen als Ressource
7.5.3Orte und Räume als Dimension kollegialer Gruppen im Pfarrberuf
7.5.4Die religiöse Dimension kollegialer Praktiken im Pfarrberuf
8LITERATURVERZEICHNIS
9ANHANG
9.1Transkriptionsregeln
9.2Übersicht Interviewausschnitte
ENDNOTEN
1EINLEITUNG
Hätte die vorliegende Arbeit ein Titelbild, würde es Folgendes zeigen: Eine Gruppe von Pfarrerinnen/Pfarrern1 sitzt um einen großen Tisch. Er ist reich gedeckt, das Foto wurde bei einem gemeinsamen Essen aufgenommen. An den Gesten ist zu erkennen, dass die Männer und Frauen miteinander diskutieren, eine Pfarrerin lacht. Im Hintergrund sieht man einen Pfarrer, der gerade zur Tür hereinkommt. Er scheint sich verspätet zu haben. Bei dieser Gruppe – so würde es der Leser in einer Erklärung erfahren – handelt es sich um eine selbstorganisierte kollegiale Gruppe von Pfarrerinnen/Pfarrern, die sich seit vielen Jahren regelmäßig reihum in den Pfarrhäusern trifft. Sie kommen zusammen, um miteinander ein Thema zu bearbeiten oder einen Text zu lesen, um sich auszutauschen und gemeinsam zu essen.
Was zeigen andere pastoraltheologische Bücher auf ihren Titelbildern – sofern sie welche haben? Auf dem Bändchen von Christian Grethlein aus dem Jahr 2009 ist ein Kleiderständer zu sehen.2 An ihm hängen sowohl ein Talar als auch ein Anzug für einen Mann. Stefan Bölts und Wolfgang Nethöfel zeigen auf ihrem Sammelband zu empirischen Studien zum Pfarrberuf eine als Pfarrer verkleidete männliche Puppe.3 Die Zeichnung auf Anke Wiedekinds Dissertation »Wertewandel im Pfarramt« lässt eine männliche Person im ›Bürooutfit‹ erkennen.4 Die Figur wirft einen Schatten an die Wand, die die vermeintliche Pfarrperson mit Heiligenschein und Flügeln zeigt.
Alle drei Bücher haben eines gemeinsam: Sie zeigen eine einzelne männliche Pfarrperson.5 Diese Bilder decken sich auch mit dem Inhalt dieser und vieler weiterer pastoraltheologischer Entwürfe (vgl. Kap. 2). Sie haben die einzelne Pfarrperson und ihre individuelle Praxis zum Gegenstand, die primär in der parochialen Kirchengemeinde verortet wird. Diese Tendenzen scheinen u. a. durch das methodische Vorgehen der empirischen Forschung bedingt zu sein, die primär Einzelne hinsichtlich ihrer individuellen Praxis befragt (vgl. 2.2).
Wie verhält es sich mit der kollegialen Gruppe, die sich zu Beginn dieser Einleitung im Pfarrhaus trifft und deren Bild das Cover der vorliegenden Arbeit schmücken könnte? Inwiefern wird sie in der pastoraltheologischen Forschung berücksichtigt? Kollegiale Gruppen bzw. die Bedeutung anderer Pfarrerinnen/Pfarrer für die Berufsausübung werden zwar in der Forschung thematisiert, aber entweder auf direkte Kooperation von Pfarrerinnen/Pfarrern bezogen, etwa im Teampfarramt; oder ihre Bedeutung wird lediglich für die Selbstleitung6 bedacht und für die davon abgeleitete Berufsbewältigung des Einzelnen.
Die vorliegende Arbeit geht hingegen einen anderen Weg. Sie entwickelt die These, dass dem Pfarrberuf eine kollektive Dimension innewohnt: Der Pfarrberuf wird zu einem beträchtlichen Anteil von Tätigkeiten bestimmt, die mit anderen Kolleginnen/Kollegen ausgeführt werden, etwa in Form direkter Zusammenarbeit in Kirchengemeinden oder Projektgruppen. Darüber hinaus gibt es aber auch Begegnungen in Fortbildungsgruppen oder Pfarrkonferenzen,7 also in kollegialen Zusammenkünften, die der Fortbildung, der Informationsweitergabe und dem kollegialen Austausch dienen.8 Die Arbeit in kollegialen Gruppen ist im Pfarrberuf nicht nur quantitativ wichtig. Auch berufstheoretisch kommt ihnen eine elementare Bedeutung zu: Hier wird nicht nur der Einzelne in seiner Selbstleitung gestärkt, sondern auch – sozial fassbar in der kollegialen Gruppe – die Berufsgruppe als eigenständige Größe.
Kollegiale Gruppen, die der Fortbildung und der gemeinsamen Reflexion im Pfarrberuf dienen, sind der Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit.9 An ihrem Beispiel wird die Forschungsfrage untersucht (vgl. 3.3.3): Welche Funktionen haben kollegiale Gruppen10 für den Pfarrberuf?11
Im Verlauf des Forschungsprojektes hat es sich als sinnvoll erwiesen, unterschiedliche Formen kollegialer Gruppen zu differenzieren (vgl. 3.3.3): Erstens Gruppen, die von Pfarrerinnen/Pfarrern selbst initiiert und organisiert werden, etwa Predigtvorbereitungsgruppen. Zweitens Gruppen, die von anderen, meist der Kirchenleitung organisiert werden, z. B. die Pfarrkonferenz. Drittens institutionalisierte Gruppen auf Zeit, etwa Fortbildungsgruppen, die für eine Woche in einer Fortbildungseinrichtung zusammenkommen und anschließend wieder auseinandergehen. Und viertens kooperative Formen, z. B. das Pfarrteam in einer größeren Kirchengemeinde.
Im Zentrum der folgenden Ausarbeitung steht eine umfassende qualitativ-empirische Erhebung in Form von Gruppendiskussionen mit selbst- und fremdorganisierten kollegialen Gruppen von Pfarrerinnen/Pfarrern (vgl. Kap. 5).12 Die Interviews wurden methodisch mithilfe des Gruppendiskussionsverfahrens geführt, ein offenes Konzept, das den Interviewten die Möglichkeit gibt, ihr Relevanzsystem zu entfalten (vgl. Kap. 4). Durch dieses Vorgehen orientiert sich die Studie bereits auf methodischer Ebene am Kollektiv und nicht am Individuum. Thematisch stand in den Interviews die Handlungspraxis der jeweiligen Gruppe im Mittelpunkt. Die Auswertung der Gruppendiskussionen erfolgt anhand der dokumentarischen Methode, die eng an das Gruppendiskussionsverfahren gekoppelt ist und sich vor allem für die Erforschung kollektiver Wissensbestände eignet. Der methodologische Hintergrund dieses Erhebungs- und Auswertungsverfahrens wird in Kapitel 4 entfaltet. Anschließend stellt Kapitel 5 die Ergebnisse der Auswertung dar. Es handelt sich bei diesem umfangreichen Kapitel um das Herzstück der Arbeit: Die gesamte Ausarbeitung gründet im empirischen Material.
Die Auswertung der Gruppendiskussionen mündet in die Ausarbeitung der ›Struktur des autonomen Wechsels‹ (vgl. 5.8): Sie besagt u. a., dass Pfarrerinnen/Pfarrer in ihrer Berufsausübung nach Autonomie streben, die sich in den Gesprächen in einer strukturellen und thematischen Wechselstruktur zeigt. Die Befragten legen sich in den Gruppendiskussionen sprachlich nicht fest, wechseln sprachlich hin und her und erzählen gleichzeitig von Wechselsituationen in ihrer Berufspraxis, etwa dem Übergang von einem Raum in den anderen. Genau in diesen Wechseln zeigt sich in den Gruppendiskussionen das Streben nach Autonomie und wird eine Praxis der Autonomiewahrung dokumentiert, die in den ›Wechselzonen‹ der Berufspraxis verortet ist.13
Die Ergebnisse der Auswertung des empirischen Materials werden in Kapitel 6 mit grundlegenden Gedanken professionssoziologischer Ansätze (vgl. Kap. 3) verbunden. Der Grundgedanke dabei: Der Berufsgruppe kommt im berufstheoretischen Sinn eine eigene Funktion zu. In institutionalisierten Formen, z. B. in kollegialen Gruppen, legt die Berufsgruppe Handlungsregeln fest und sichert dadurch ihre Autonomie – sowohl die der Berufsgruppe, als auch die jeder Einzelnen. Durch die Berücksichtigung der Ebene der Berufsgruppe kann der professionstheoretische Entwurf von Isolde Karle14 erweitert werden, die den Pfarrberuf als Profession lediglich auf der Ebene individueller Handlungspraxis bedenkt (vgl. 3.3.2 und Kap. 6). Kapitel 6 differenziert die unterschiedlichen Funktionen kollegialer Gruppen im Pfarrberuf in professionssoziologischer Perspektive und kann als ein in sich geschlossenes Forschungsergebnis gelesen werden.
Kapitel 7 geht noch einen Schritt darüber hinaus und macht die Ergebnisse für die Pastoraltheologie fruchtbar: Der Pfarrberuf hat eine kollektive Dimension. Wie kann sie pastoraltheologisch noch umfassender erforscht werden? Dazu bietet das abschließende Kapitel Perspektiven für die pastoraltheologische Forschung.
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es ausdrücklich nicht, die strukturell in der Kirche benötigte bzw. erwartete Zunahme kollegialer Kooperation zu fordern.15 Dahingegen wird die pastorale Arbeit in kollegialen Gruppen als ein Beispiel kollegialer Zusammenarbeit beschrieben und als eigenständiger wertvoller Tätigkeitsbereich pastoralen Handelns dargestellt.16 Diese berufliche Praxis, die vor allem von Gesprächsaustausch, Reflexion sowie Fortbildung geprägt wird, gilt es von kooperativen Formen zu unterscheiden. Die Erarbeitung der Funktionen kollegialer Gruppen für den Pfarrberuf kann darüber hinaus den kollektiven Kern der Berufsausübung deutlich machen: die gemeinsame Wahrung von Autonomie.
Der Aufbau der vorliegenden Arbeit in Kürze zusammengefasst: Kapitel 2 (›Allein Pfarrer sein‹) arbeitet das gegenwärtig in der Pastoraltheologie vorherrschende ›Paradigma des Einzelnen‹ aus. Es schließen sich in Kapitel 3 professionssoziologische Überlegungen zur Berufsgruppe an, die in die Darstellung des Forschungsgegenstandes sowie der Forschungsfrage münden. Kapitel 2 und 3 bieten die theoretische Grundlage der Studie. Kapitel 4 bereitet auf die Darstellung der Gruppendiskussionen in Kapitel 5 vor, indem Erhebungs- und Auswertungsmethoden (Gruppendiskussionsverfahren und dokumentarische Methode) präsentiert werden. Die Ergebnisse der Auswertung der Gruppendiskussionen folgen in Kapitel 5, das dem Leser gedanklich ermöglichen will, anhand ausgewählter Interviewausschnitte den sich zuspitzenden Weg bis zur ›Struktur des autonomen Wechsels‹ (vgl. 5.8) mitzugehen. Kapitel 6 greift auf die Ergebnisse aus Kapitel 3 zurück und erarbeitet auf der Basis von Kapitel 5 die Funktionen kollegialer Gruppen im Pfarrberuf in professionssoziologischer Perspektive. Kapitel 2 und Kapitel 7 bilden den pastoraltheologischen Rahmen der Arbeit: Die Erarbeitung der kollektiven Dimension des Pfarrberufs ›Gemeinsam Pfarrerinnen/Pfarrer sein‹ in Kapitel 7 antwortet auf das ›Paradigma des Einzelnen‹ in Kapitel 2.
Es handelt sich um eine qualitativ-empirische Forschungsarbeit, die das Phänomen kollegialer Gruppen im Pfarrberuf aus professionssoziologischer Sicht betrachtet und damit einen Beitrag zur Theorie des Pfarrberufs leistet.
Gunther Schendel hat 2017 im Auftrag des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD eine Aufsatzsammlung herausgegeben, in der u. a. auf der Basis empirischer Ergebnisse die Veränderungen im Pfarrberuf beleuchtet werden.17 Auf dem Cover des Buches ist eine Karikatur von Sisam Ben abgebildet. Sie zeigt zwei Pfarrer im Talar, die an einen Stehtisch gelehnt ein Glas Wein trinken. Vielleicht, so vermutet die Leserin, im Rahmen eines Empfangs, z. B. bei der Einführung einer Kollegin. Der ältere Pfarrer sagt zum Jüngeren (Sprechblase): »Pass auf, Junge: Was wir alleine nicht schaffen, machen wir trotzdem.« Eigentlich, so schreibt Schendel in seiner Einleitung, müsste die Liedzeile, die der Pfarrer nach Xavier Naidoo zitiert, heißen: »Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen.«18
Was nimmt die Zeichnung ›aufs Korn‹? Überspitzt gesagt: Pfarrerinnen/ Pfarrer stöhnen über zu viel Arbeit, wollen aber nicht miteinander kooperieren.
Die Karikatur zeigt – im Sinn der vorliegenden Arbeit – eine wesentliche Tätigkeit von Pfarrerinnen/Pfarrern und dokumentiert einen grundlegenden Wesenszug dieses Berufs: Zwei Pfarrer tauschen sich am Rand einer Veranstaltung über ihren Beruf aus. Dabei geht es nicht unbedingt um die Lösung eines Problems (etwa, dass die berufliche Belastung zu groß ist und was man dagegen tun könnte), sondern das Reden über den Beruf, das ›zum Ausdruck bringen‹ dieser beruflichen Erfahrung steht im Mittelpunkt. In dem, was der Pfarrer inhaltlich sagt, drückt sich sein Autonomiestreben aus: Auch wenn es eigentlich nicht zu schaffen ist, er macht es trotzdem. Es ist seine Entscheidung. Darüber hinaus setzt die ganze Szene der Karikatur die Autonomie im Pfarrberuf ins Bild: Indem Pfarrerinnen/Pfarrer miteinander über ihren Beruf sprechen, stellen sie gegenseitig ihre Autonomie her bzw. wahren sie; nicht nur die eigene, sondern auch die ihrer Berufsgruppe. Sie brauchen einander, um selbstbestimmt arbeiten zu können, sind gemeinsam autonom.
2ALLEIN PFARRER SEIN
Eine pastoraltheologische Theorielinie
In welcher Weise berücksichtigt die gegenwärtige pastoraltheologische Forschung den Gegenstand der vorliegenden Arbeit? Inwiefern werden Kollegialität, genauer kollegiale Gruppen als die soziale Verfasstheit kollegialer Zusammenarbeit im Pfarrberuf thematisiert? Wie wird dabei ihre Funktion für den Beruf bestimmt? Diesen Fragen gehen die folgenden Überlegungen nach. Sie stehen im Horizont der These, dass sich die gegenwärtige Pastoraltheologie auf die Beschreibung der Berufspraxis Einzelner fokussiert und die Funktionen kollegialer Zusammenarbeit nur am Rande thematisiert bzw. eindimensional auf die Unterstützung individueller Tätigkeit in der parochialen Kirchengemeinde reduziert. Da die vorliegende Arbeit nicht Formen der direkten Kooperation berücksichtigt, sondern besonders kollegiale Formen der Reflexion und Fortbildung in den Blick nimmt, liegt im Folgenden ein weiteres Augenmerk auf ebendiesen Arbeitsformen.
Methodisch werden unter 2.1 zunächst fünf aktuelle pastoraltheologische Entwürfe auf kollegiale Gruppen bzw. kollegiale Arbeitsformen hin untersucht. Es sind dies die Ansätze von Manfred Josuttis, Isolde Karle, Ulrike Wagner-Rau, Christian Grethlein und Michael Klessmann.19 Die Auswahl zielt nicht auf Vollständigkeit, sondern orientiert sich – aus Sicht der Autorin – an der Relevanz der Theorien für den pastoraltheologischen Diskurs, hier im Sinne des akademisch praktisch-theologischen.20 Leitend ist zudem der Erkenntnisgewinn für die vorliegende Arbeit.
In einem zweiten Schritt sollen unter 2.2 empirische Studien analysiert werden, die sich entweder dezidiert auf den Pfarrberuf beziehen, etwa die Pfarrerbefragungen (vgl. 2.2.2), oder auf die in pastoraltheologischen Veröffentlichungen häufig Bezug genommen wird, z. B. die sog. fünfte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der Evangelischen Kirche in Deutschland (V. KMU, vgl. 2.2.1).21 Neben diesen primär quantitativ orientierten Studien werden – wiederum exemplarisch – empirische Forschungsarbeiten (vgl. 2.2.3) untersucht, die sich mit dem Pfarrberuf beschäftigen. Welches Bild entwerfen sie von diesem Beruf, welche Themen und welches methodische Vorgehen werden gewählt? Die Darstellung mündet unter 2.3 in Überlegungen zu den Gründen für die thematisch und methodisch überwiegend einseitige pastoraltheologische Forschung der Gegenwart: das Paradigma des Einzelnen.
2.1AKTUELLE PASTORALTHEOLOGISCHE ENTWÜRFE
In aktuellen pastoraltheologischen Entwürfen werden Pfarrerinnen/Pfarrer zumeist im Singular betrachtet. Es geht um die einzelne Pfarrperson und ihre konkrete Berufspraxis, die vorwiegend in der parochial verfassten Kirchengemeinde verortet wird. Die exemplarische Analyse der Argumentationsmuster ausgewählter pastoraltheologischer Entwürfe soll im Folgenden zeigen, dass es sich dabei um eine überwiegend einseitige pastoraltheologische Forschungs- und Darstellungsweise handelt. Die Reihenfolge der Darstellung orientiert sich am jeweiligen Jahr der Erstpublikation der jeweiligen Entwürfe.
2.1.1Manfred Josuttis: Im Gegenüber anders sein
»Der Pfarrer ist anders.«22 Die Formulierung des Titels im Singular begünstigt die Eingängigkeit des ersten pastoraltheologischen Entwurfs von Manfred Josuttis aus dem Jahr 1982, von der die gesamte Konzeption lebt. Der Pfarrer ist anders – das ist mittlerweile eine feststehende und vertraute pastoraltheologische Formulierung. Der Singular im Titel spiegelt gleichsam die Grundzüge dieses Ansatzes: Der Pfarrer wird hier als männliche Einzelperson betrachtet, die stets im Gegenüber zu anderen steht.23 Die Andersartigkeit pastoraler Existenz hat nach Josuttis ihren Ursprung im Gegenüber des Pfarrers zur Gemeinde und ebenfalls in seinem Gegenüber zu Gott.24 Der Pastoraltheologie kommt demnach die Aufgabe zu, »die Konfliktzonen, die an den Schnittpunkten zwischen der beruflichen, der religiösen und der personalen Dimension pastoraler Existenz lokalisiert sind, wissenschaftlich zu reflektieren«25. Der Pfarrer stehe zwischen seinem Auftrag, in dem er als ein Berufener im Gegenüber zu Gott steht, und den Erwartungen seiner Gemeinde, der er ebenfalls als der andere gegenübersteht. Als Beispiele für die darin liegende Spannung in der Berufspraxis nennt Josuttis die Kasual- und Predigtpraxis.26 Die Gemeinde wird hier stets im Kollektiv gedacht, die dem Pfarrer in ihrer Gesamtheit und damit quasi wiederum als eine Person gegenübersteht. Zugleich ist der Pfarrer dem Auftrag Gottes verpflichtet, der theologisch in seiner Berufung begründet liegt. Hier rekurriert Josuttis auf die Berufungserzählungen der Propheten im Alten Testament. Die Berufung gilt immer einem einzelnen Propheten bzw. Pfarrer und begründet einen individuellen Auftrag im Eins-zu-eins gegenüber Gott.
Das letzte Kapitel seines frühen pastoraltheologischen Entwurfes trägt die Überschrift »Zur Ausbildung des Pfarrers«27. Josuttis widmet sich hier den Aus- und Fortbildungszusammenhängen im Pfarrberuf. Darin bildet die erste Ausbildungsphase, das Universitätsstudium der Theologie, seinen primären Bezugspunkt. Der Autor orientiert sich an der Leitfrage, wer der Pfarrer sein, was er wissen und können muss: In seiner beruflichen Praxis – gemeint ist hier28 wie im gesamten Buch die Praxis in der Kirchengemeinde – müsse der Pfarrer vor allem mit Texten, Menschen und sozialen Strukturen umgehen können. Die Praxis in der Gemeinde steht hier wiederum im Gegenüber zu den Erwartungen der Gemeinde, weshalb Josuttis im Zusammenhang der Ausbildung auf die Bedeutung der – mit einem heutigen Begriff ausgedrückt – personalen Kompetenz eingeht, die dazu befähige, adäquat mit eben diesen Erwartungen umzugehen. Die Voraussetzung für das Erlernen der personalen Kompetenz sieht er in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis. Im Vikariat erfüllt das Mentorat (Vikar – Mentor) diese Aufgabe. Die Hochschule könne hingegen in der ersten Ausbildungsphase diesem Anspruch aufgrund des Betreuungsschlüssels (in den 1980er Jahren) nicht genügen. Auch in dieser Hinsicht begegnet bei Josuttis das Motiv des Gegenübers, in diesem Fall das von Schüler und Lehrer. Welche Rolle hingegen die Lerngruppe sowohl in der ersten als auch in der zweiten Ausbildungsphase für die Entwicklung personaler Kompetenzen spielt, bleibt unberücksichtigt. Für das Studium betont Josuttis hingegen die Aufgabe, ein Verhältnis zur Bibel zu entwickeln. In diesem Zusammenhang kommt die kollektive Dimension des Lernens in den Blick, wenn er schreibt: »Es wäre schon viel wert, wenn wir unsere persönlichen Erfahrungen im Umgang mit der Bibel wahrnehmen und miteinander austauschen und uns wechselseitig dazu anregen lernten.«29
Dass die Andersartigkeit alle Pfarrerinnen/Pfarrer betrifft, berücksichtigt Josuttis in seinem Beitrag von 1982 noch nicht. Anders dann im Folgeband »Der Traum des Theologen«30, den er sechs Jahre später »Den Pfarrerinnen und Pfarrern, die ihre Träume nicht vergessen«31 zueignet. Die Grundstruktur des Bandes orientiert sich am Traum eines einzelnen Pfarrers, von dem dieser auf einem Pfarrkonvent erzählt.32 Sodann überschreibt Josuttis ein ganzes Kapitel seines Entwurfs mit »Die Brüder (und Schwestern)«.33 Hier ist nun der Plural bereits im Titel vorausgesetzt und bezieht sich von seinem Anspruch her auch auf die Pfarrerinnen.34 Allerdings spricht das Kapitel dann doch lediglich von der Bruderschaft. Die Zulassung von Frauen zur vollwertigen Ausübung des Berufes wird lediglich als Verschärfung der diskutierten pastoraltheologischen Grundprobleme analysiert.35 Josuttis beschäftigt sich im genannten Kapitel mit der pastoralen Anrede bzw. dem Verständnis als Brüder und Schwestern und der Diskrepanz zwischen dem damit verbundenen Anspruch und der Realität.36 Letztere setzt er mit der gemeinsamen Arbeit im Pfarrkonvent und im Teampfarramt gleich und sieht sie durch Konflikte und Konkurrenz geprägt.37 Seine Beobachtungen zu den Ambivalenzen, die mit der pastoralen Geschwisterschaft verbunden sind, benennen zwar wesentliche Aspekte, die Vermutungen zu deren Ursachen können aber nur schwerlich überzeugen. Josuttis zieht für seine Argumentation zeitgebundene psychologisch orientierte Modelle heran38 – empirisch-soziologische Begründungszusammenhänge fehlen hingegen. Die Vorstellung einer brüderlichen/schwesterlichen Gemeinschaft beziehe sich im Neuen Testament nicht exklusiv auf einen Berufsstand, sondern auf alle getauften Christinnen/Christen.39 Diesem Ausgangspunkt folgend, koppelt Josuttis die konkrete Zusammenarbeit von Pfarrerinnen/Pfarrern im Teampfarramt (und – wenn auch nicht explizit gesagt – in anderen Gruppen) teilweise von einem dogmatischen Verständnis einer Geschwisterschaft aller Christen ab. »Die Brüder und Schwestern im Herrn sind durch ihre gemeinsame Arbeit, die auf Absprachen beruht und der organisatorischen Regelungen bedarf, verbunden. Aber die Grundlage für ihre Kommunikation und Kooperation bildet jene Zusammengehörigkeit, die sich aus der gemeinsamen Zugehörigkeit zum Leib Christi ergibt.«40 Josuttis versucht, diese Verbundenheit in Christus positiv zu transformieren, indem sie »einen Spielraum für Kommunikation«41 eröffne. Josuttis untermauert die Gemeinschaft zwischen Pfarrerinnen/Pfarrern mit einem neutestamentlich-dogmatischen Begründungszusammenhang, kann damit aber nicht den empirisch wahrnehmbaren Ambivalenzen begegnen und relativiert selbst: »Trotz allem darf man aber die Schwierigkeit nicht übersehen, daß die vorgegebene Gemeinschaft des Leibes Christi für die Brüder und Schwestern empirisch nur in besonderen Augenblicken erfahrbar wird. In der Regel ist die Gemeinde keine Lebensgemeinschaft und die Bruderschaft/Geschwisterschaft unter den Theologen kaum mehr als ein Standesprivileg.«42
In seinem späten pastoraltheologischen Band »Die Einführung in das Leben«43 aus dem Jahr 1996 fällt Josuttis wieder hinter seine kollektiven Ansätze zurück. Obwohl er mit der Verarbeitung eines religionsphänomenologischen Ansatzes konzeptionell neue Wege geht, schließt Josuttis wieder an das Motiv des Gegenübers an, in dem der Pfarrer zu Gott und zur Gemeinde steht. Der Pfarrer vermittele zwischen beiden Seiten und führe den Einzelnen in der Gemeinde in die Zone des Heiligen. Dies tue er, indem er – selbst Repräsentant des Heiligen – durch die liturgische Arbeit in und mit Symbolen und Ritualen helfe, die andere Wirklichkeit des Heiligen performativ erfahrbar werden zu lassen. 44 Michael Klessmann weist bei Josuttis zu Recht auf die problematische Trennung zwischen Profanem und Sakralem hin.45 Dieses Weltbild unterfüttert das bereits erwähnte Motiv des Gegenübers und reduziert den Pfarrer unter Aufnahme des Führerbegriffes auf seine liturgische Rolle. Die gesamte Konzeption geht von einem Pfarrer aus, der sowohl theoretisch als auch praktisch allein agiert. Dieses Verständnis des Pfarrberufs wird durch Josuttis’ Forderungen hinsichtlich der spirituellen Praxis von Pfarrerinnen/Pfarrern verstärkt: »Pastorale Praxis benötigt die spirituelle Basis. Wer auf das Leben anderer Menschen im Namen Gottes Einfluß zu nehmen versucht, muß selbst von der Macht Gottes ergriffen werden.«46 Dies könne vor allem im Gebet, im Umgang mit der Bibel und in der Meditation gelingen.47 Diese Formen der Spiritualität zielen alle auf eine innerliche Begegnung mit dem Heiligen und werden – so legt es jedenfalls Josuttis’ Argumentation nahe – allein und im Gegenüber zu Gott bzw. der Heiligen Schrift praktiziert.
2.1.2Isolde Karle: Allein als Generalist vor Ort48
Im Mittelpunkt des vielrezipierten pastoraltheologischen Beitrags von Isolde Karle steht das Idealbild eines pastoralen Generalisten vor Ort. Dieses fußt – und darin liegt das weiterhin Innovative ihrer Habilitationsschrift – auf der soziologischen Bestimmung des Pfarrberufs durch die Aufnahme der Professionstheorie.
Der Pfarrberuf zählt neben dem des Arztes und des Richters zu den klassischen Professionen. Sie beziehen sich auf eine spezifische Sachthematik, im Fall des evangelischen Pfarrberufs auf die Verkündigung des Wortes Gottes.49 Da die Sachthematik den Menschen existentiell betrifft, ist die Form ihrer Vermittlung besonders wichtig.50 Entsprechend arbeitet Karle die Bedeutung der Interaktion – im soziologischen Sinne eine »Kommunikation unter Anwesenden«51 – aus, was sie am Beispiel des Hausbesuches anlässlich eines Geburtstages illustriert.52 Die persönliche Kommunikation bildet auch die Voraussetzung für eine Vertrauensbildung, ohne die die Ausübung eines Professionsberufes nicht möglich ist.
»Professionslaien sind auf die Verläßlichkeit und Vertrauenswürdigkeit von Professionellen in besonders hohem Maße angewiesen, weil Professionelle außeralltägliche und existentielle Erfahrungen von Individuen bearbeiten.«53
Eine weitere Voraussetzung für die Vertrauensbildung liegt in der grundsätzlichen Ansprechbarkeit und generellen Zuständigkeit der Pfarrerin, die sie nur im Gemeindepfarramt vor Ort garantieren kann. Im Generalisten vor Ort sieht Karle die Kernrolle der pastoralen Profession und spricht sich explizit gegen Professionalisierungstendenzen in Form von speziellen Weiterbildungen oder Funktionspfarrämtern aus, die ihrer Meinung nach in Wahrheit zu einer Deprofessionalisierung führten.54
»Sie [die Pfarrer] sind spezifische Generalisten im Hinblick auf ihre theologischen und pastoralen Kompetenzen, die sich auf die professionelle und profilierte Vermittlung christlicher Inhalte in Predigt, Unterricht und Seelsorge beziehen und darüber hinaus auf die für eine zusammenstimmende Gemeindeleitung unabdingbaren interaktiven Verhaltens- und Gesprächsführungsregeln der Vertrauensbildung, der Kontinuität und Verläßlichkeit.«55
Die pastorale Handlungsebene, auf die Karle die Kernaufgaben bezieht, ist damit immer die Ortsgemeinde.56 Das Subjekt ihrer Untersuchung ist die einzelne Pfarrerin in ihrer professionsspezifischen Handlungspraxis vor Ort. Obwohl diese Arbeitsbereiche in der Ortsgemeinde potenziell auf den Plural der Gemeinde bezogen sind, illustriert Karle ihre Theorie an Beispielen der Interaktion des Pfarrers mit einem bzw. wenigen Gesprächspartnern, wie es in der Vorbereitung von Kasualien und in Seelsorgegesprächen üblich ist. Hier finden sich für Karle professionstypische Situationen, die ein hohes Maß an Vertrauen erfordern und damit ideal zu ihrer Berufstheorie passen.57
In der Auseinandersetzung mit der pastoraltheologischen Forschung der vergangenen 40 Jahre kritisiert Karle eine Engführung auf die Subjektivität der einzelnen Pfarrerin. Diese Forschungslinie versuche den Verlust der Amtsautorität der vergangenen Jahrzehnte zu kompensieren, weshalb Karle es nachvollziehen kann, »daß man sich in der Folgezeit sowohl im Hinblick auf das berufsethische Verhalten als auch im Hinblick auf die zu vermittelnden Inhalte ganz am Individuum und an der Subjektivität des Einzelnen orientierte. Als allgemeiner Konsens galt dabei, daß nun nicht mehr das Amt die Person trage, sondern umgekehrt die Person das Amt tragen müsse.«58 Mit ihrem professionstheoretischen Ansatz grenzt sie sich von dieser subjektorientierten Ausrichtung ab, indem sie die soziale Situation des Pfarrberufs in seinem sozialen Kontext als Ausgangspunkt wählt.59 Dennoch bleibt sie am Einzelnen orientiert, wenn auch nicht am Subjekt, sondern an seiner allein ausgeführten Berufspraxis. Kolleginnen/Kollegen im Pfarrberuf kommen in ihrem Entwurf quasi nicht vor. Nur am Rande erwähnt sie, dass sich eine Profession dadurch auszeichnet, dass sie einen ganzen Berufsstand repräsentiert.60 Auch ihr Bezug auf die Ordination, in der die Pfarrerinnen/ Pfarrer auf die »evangelische Sachthematik verpflichtet werden«,61 lässt keinen Gedanken an ein Berufskollektiv zu.
Besonders greifbar wird die Diskrepanz in Karles Ausführungen in ihrer Kritik an der pastoralpsychologischen Ausrichtung der pastoralen Aus- und Fortbildung.62 Sie fördere Deprofessionalisierungstendenzen im Pfarrberuf und die Fokussierung des individualistischen Subjektes. Wie sich diese Formen pastoraler Handlungspraxis vollziehen – und zwar vornehmlich und zunehmend in Gruppen – und dass sie noch weitere Funktionen für den Beruf erfüllen als lediglich eine fachliche Spezialisierung, lässt sie außer Acht.
Ein weiterer wichtiger Argumentationsstrang, der sich durch Karles Pastoraltheologie zieht, ist das Verhältnis zwischen pastoraler Handlungsautonomie und kirchenleitender Aufsicht. Die Autorin betont die Bedeutung pastoraler Autonomie, die sie in der Sachthematik, also »in ihrer Bindung an Schrift und Bekenntnis begründet«63 sieht. Diese Freiheit in der Amtsausführung dürfe von der Kirchenleitung nicht wesentlich eingeschränkt werden. Andernfalls gefährde sie die intrinsisch motivierte Leistungsbereitschaft ihrer Pfarrerinnen/Pfarrer64 und höhle das Vertrauensverhältnis aus, dessen es für eine autonome Handlungspraxis bedarf. Sosehr Karle die professionelle Autonomie betont, schränkt sie sie gleichzeitig durch den stetigen Verweis auf den möglichen und tatsächlichen Missbrauch dieser Freiheit wieder ein. Das Mitarbeitergespräch und insbesondere die Visitation sieht sie als ein geeignetes und zu intensivierendes Mittel, durch das die Kirchenleitung mit ihren Pfarrerinnen/Pfarrern auf Augenhöhe ins Gespräch kommen kann, um die Qualität pastoraler Arbeit im Sinne des Kirchenreformprozesses zu verbessern.65 Karle betont die Bedeutung des Respektes und der Wertschätzung in solchen Gesprächen und setzt eine generelle Offenheit voraus.66 Dabei nimmt sie eine eindeutig kirchenleitende Perspektive ein. Inwiefern dem offenen Gespräch zwischen einem Dienstvorgesetzten und einem Pfarrer Grenzen gesetzt sein könnten, wird nicht thematisiert. Schließlich benennt sie selbst, welche Konsequenzen u. a. kirchenleitendes Handeln haben kann: die Versetzung eines Pfarrers bei ungedeihlicher Zusammenarbeit in einer Gemeinde.67
Auch im Hinblick auf Fortbildungen betont Karle die Autonomie pastoraler Berufsgestaltung, wenn sie schreibt, »dass Pfarrerinnen und Pfarrer selbst Verantwortung für ihre regelmäßige Fortbildung übernehmen, für eine Supervision, die sie individuell weiterbringt, für eine gezielte Beratung im Konfliktfall«.68 Auch hier kommt aus ihrer Sicht der Kirchenleitung die Aufgabe zu, Erwartungen und Kritik klar zu formulieren, und Karle befürwortet eine Fortbildungsverpflichtung:
»Sind alle angehalten, in bestimmten Zeitrhythmen ein Pastoralkolleg zu besuchen und über sich selbst zu reflektieren, verliert die Fortbildung ihr Stigma und wird sie selbstverständlicher Teil der notwendigen Selbstreflexion des pastoralen Berufes.«69
In diesen Beispielen wird deutlich, dass Karle die Kontrolle und Qualitätssteigerung pastoraler Arbeit vorwiegend in der Verantwortung der Kirchenleitung sieht und dabei ausschließlich verpflichtende und regulierte Formen berücksichtigt.
2.1.3Ulrike Wagner-Rau: Allein auf der Schwelle
Ulrike Wagner-Rau beschreibt den Pfarrberuf inmitten gesellschaftlicher und kirchlicher Veränderungen der Gegenwart. In der Konfrontation mit den »komplexen Anforderungen des Berufes«,70 die sich vor allem in einem diffusen Bild von Erwartungen und konkreten Tätigkeiten zeigen, ist es die Aufgabe jedes einzelnen Pfarrers, den Berufsalltag konkret und individuell zu gestalten. Im Horizont des kirchlichen Reformprozesses entwickelt Wagner-Rau mit Hilfe des Schwellenbegriffs das »Profil der pfarramtlichen Tätigkeit in der Gegenwart«71. Dieses Profil ist in erster Linie von Aufgaben in der Kommunikation des Evangeliums geprägt, die sie in verschiedenste Vermittlungskompetenzen aufschlüsselt. Den Bezugspunkt ihrer Ausführungen bieten dabei immer wieder konkrete Arbeitsbereiche in der Ortsgemeinde, etwa die Kasualpraxis, deren Aufgabe Wagner-Rau u. a. in der Vermittlung zwischen der je individuellen Lebenssituation und der Tradition des christlichen Glaubens sieht.72
Für die Autorin gehört auch die Reflexion zu einer immanenten Tätigkeit pastoraler Berufspraxis: Um die individuellen Handlungsmöglichkeiten und -grenzen im unübersichtlichen Arbeitsfeld der Ortsgemeinde zu erkennen und zu gestalten, ist sowohl die Selbstreflexion als auch das Gespräch mit anderen notwendig. »Jeder Pfarrer und jede Pfarrerin braucht kollegiale Beratung und Austausch, Supervision, differenzierte Rückmeldungen durch Gemeindeglieder und Vorgesetzte, die als eine Qualitätskontrolle der eigenen Arbeit und ihrer Perspektiven fungieren.«73 Vor allem in der spannungsreichen leitenden Dimension des Pfarramtes sieht Wagner-Rau die Notwendigkeit, so immer wieder aus der Distanz auf die Veränderungen innerhalb der Kirche und der Gemeinde zu blicken.74 Darüber hinaus verweist sie auf bewusste Pausen, Zeiten des Innehaltens und der Pflege der eigenen Spiritualität. Diese verschiedenen Formen der bewussten und unbewussten Reflexion zählt sie unverzichtbar zur pastoralen Berufstätigkeit.75
Wagner-Rau benennt zwar explizit die Bedeutung von Reflexion als selbstverständlichen Bestandteil des Pfarrberufs, begrenzt deren Funktion jedoch auf die Ermöglichung individueller Handlungspraxis, die in der parochial verfassten Kirchengemeinde verortet wird. Neben dieser Funktionszuschreibung nimmt Wagner-Rau in Ansätzen auch Formen der Reflexion in den Blick: Sie sind nicht nur auf die Auseinandersetzung des Einzelnen mit sich selbst beschränkt, sondern machen das Gespräch mit anderen erforderlich. Ob sich die kollegiale Beratung und der Austausch in Zweiergesprächen oder auch Gruppen vollziehen und welcher Unterschied eventuell zwischen diesen Formen besteht, wird nicht benannt. Ob kollegiale Praktiken darüber hinaus noch weitere Funktionen für den Beruf haben, als lediglich individuelle Handlungsorientierung und -praxis zu ermöglichen, bleibt unklar.
Wagner-Rau ordnet die kollektive der individuellen Praxis nach. So steht – zugespitzt gesagt – die Pfarrerin ›allein auf der Schwelle‹: Wenngleich kollegialer Austausch für Wagner-Rau zum Beruf dazugehört, scheint sie ihn nicht als eigenständigen Bereich pastoraler Arbeit zu definieren. Das Wesentliche findet für sie in der Kirchengemeinde statt, wo wiederum jeder Pfarrer für sich allein arbeitet.
2.1.4Christian Grethlein: Die Vermittlungsaufgabe des Einzelnen
Christian Grethleins Überlegungen nehmen ihren Ausgangspunkt ebenfalls bei den gegenwärtigen Verhältnissen in der Gesellschaft, die von den Phänomenen der Pluralisierung und Individualisierung geprägt sind. Dadurch gehe die Bedeutung der Kirche zurück, was sich wiederum auch auf die Ausübung des Pfarrberufs auswirke. Nicht das Amt, sondern die Person des Pfarrers ist entscheidend für eine gelingende Ausübung des Berufes, die Grethlein verstärkt in der Gestaltung persönlicher Kontakte zu Einzelnen sieht.76 Diese zunehmend personenbezogene Kommunikation des Evangeliums als Reaktion auf die Vereinzelung der Menschen in der Gesellschaft begründet er mit der Vermittlungsaufgabe der Theologie, das Evangelium »in die konkrete Lebenspraxis der Einzelnen und Familien sowie in die Öffentlichkeit in ihren unterschiedlichen Abstufungen«77 zu kommunizieren. Diese Aufgabe komme primär dem Pfarrberuf zu.78
Da die Vermittlungsaufgabe integraler Bestandteil der Theologie – im Sinne einer Berufswissenschaft – ist, müsse die Fähigkeit ihrer praktischen Umsetzung bereits im universitären Studium gefördert werden. Voraussetzung dafür sei die persönliche Aneignung des Evangeliums, die wiederum erst eine personenbezogene Kommunikation des Evangeliums ermögliche. Entsprechend müsse die Ausbildung einer personalen Kompetenz im Studium vermehrt ermöglicht und lebenslang z. B. in Fortbildungen gepflegt werden.79 Durch die – mit der Vermittlungsaufgabe der Theologie begründete – Personalisierung des Berufs postuliert Grethlein ein Berufsbild, das sich auf die einzelne Pfarrperson konzentriert. Das Ideal pastoraler Tätigkeit sieht er im Kontakt der Pfarrerin zu einzelnen Menschen in spezifischen Lebenssituationen. Grethlein kritisiert die Tendenz, dass ein Pfarrer für immer mehr Gemeindemitglieder zuständig ist und somit weniger Zeit für den Einzelnen bleibt: »Die zunehmenden personalen Anforderungen an die Kommunikation des Evangeliums in einer individualisierten Optionsgesellschaft weisen einen anderen Weg.«80
Neben der Personalisierung beobachtet Grethlein weitere Veränderungen im Pfarrberuf auf der Ebene der pastoralen Praxis vor Ort, die für ihn die Referenzgröße berufstheoretischer Überlegungen darstellt.81 Er nennt im Sinne einer Binnenorientierung die »Verkirchlichung« der pastoralen Tätigkeiten sowie eine Verdrängung der verkündigenden und lehrenden Aufgaben zugunsten der Seelsorge.82 Daneben hält Grethlein Veränderungen in den Rahmenbedingungen der Berufsausübung für evident, insbesondere Teildienststellen, Funktionspfarrstellen und die Möglichkeit der Ordination ins Ehrenamt.83 Die drei Letztgenannten beziehen sich lediglich auf Veränderungen im Hinblick auf den Ort der Tätigkeit, die Gesamtarbeitszeit, die Bezahlung und das Anstellungsverhältnis und damit wiederum auf die Praxis des Einzelnen in der Gemeinde bzw. im Feld des Funktionspfarramtes.
Hinter der Profilierung der Theologie als Berufswissenschaft verbirgt sich bei Grethlein die Stärkung des Bildes von der allein agierenden Pfarrerin. Die universitäre Theologie vermittelt das Wissen für die Ausübung des Berufes, das sich jeder Student allein und individuell aneignen muss. Hinzu kommt die persönliche Aneignung des Evangeliums – ebenfalls als Bestandteil des Studiums. Wie sich diese Aneignung jeweils vollzieht, lässt Grethlein offen. Die mögliche Bedeutung anderer Theologinnen/Theologen für diesen Prozess wird nicht thematisiert, woraus sich schließen lässt, dass Grethlein hier jeweils nicht nur einen sich individuell vollziehenden Prozess, sondern auch eine allein durchzuführende Praxis vor Augen hat. Gleiches gilt dann auch im Hinblick auf die Ausübung des Berufes. Auch hier wirbt Grethlein für die Bezugswissenschaft der Theologie, wenn er den Pfarrberuf als einen theologischen tituliert und entsprechende Zeit für theologische Tätigkeiten fordert: »Denn theologische Arbeit benötigt Zeit für Lesen, Nachdenken, Meditation und Gebet sowie kollegiales Gespräch.«84 Lediglich an dieser Stelle wird die Bedeutung anderer Pfarrerinnen/Pfarrer für den Beruf explizit benannt, wenn auch nicht erkennbar wird, worin ihre besondere Funktion besteht.
2.1.5Michael Klessmann: Mit anderen ein individuelles Berufsbild entwickeln
Michael Klessmann publizierte 2012 ein Lehrbuch, dem kein eigener pastoraltheologischer Ansatz zugrunde liegt, das vielmehr eine Einführung und Zusammenschau der Grundfragen historischer und aktueller Pastoraltheologie bietet. Klessmann bezieht sich in seinen Ausführungen nicht primär auf die pastorale Praxis des Einzelnen vor Ort, sondern stellt die pastoraltheologische Diskussion auf dem Hintergrund der Transformationskrise der Kirche dar.85 Im Anschluss an Uta Pohl-Patalong versteht er die Pastoraltheologie als Krisenwissenschaft.86
In seinen Überlegungen setzt sich Klessmann in zweierlei Hinsicht mit einer von ihm postulierten Pfarrerzentriertheit der Kirche auseinander. Zum einen kritisiert er an den aktuellen Reformbemühungen der Kirche, dass den Pfarrerinnen/Pfarrern eine Schlüsselrolle in der Bewältigung der Krise zugesprochen wird, indem u. a. behauptet würde, die Qualität pastoraler Arbeit ließe sich durch Fortbildungen steigern.87 Zum anderen wendet er sich im Anschluss an Gedanken über die Vielgestaltigkeit der Ämter gegen die »Pastorenzentriertheit der Volkskirche«88 und weitet den Amtsbegriff auf andere kirchliche Mitarbeitende aus, indem er das Modell des Gemeinsamen Pastoralen Amtes in der Evangelischen Kirche im Rheinland als positives Beispiel skizziert:89 Pfarrerinnen/Pfarrer, Diakoninnen/Diakone, Gemeindehelferinnen/Gemeindehelfer und Gemeindepädagoginnen/Gemeindepädagogen füllen das gemeinsame Amt aus, sind ohne Ausnahme ordiniert und für unterschiedliche Aufgaben beauftragt. Klessmann führt dieses Modell aber lediglich als eine Möglichkeit an, sein Buch trägt weiterhin den Titel »Das Pfarramt« und nicht »Das gemeinsame pastorale Amt«. Trotzdem wohnt diesem Ansatz eine kollektive Vorstellung von der pastoralen Berufsausübung inne, der sich auch auf ein gemeinsames Amt aller Pfarrerinnen/Pfarrer bezieht und durch die anderen Berufsgruppen erweitert wird. Allerdings bezieht sich diese gemeinsame Ausübung des Amtes in der Rheinischen Kirche wiederum auf die Praxis vor Ort, indem es sich auf eine konkrete parochiale Einheit bezieht; im Sinne eines Teampfarramtes, das alle Berufsgruppen miteinschließt.
Auch in anderer Hinsicht spielen die Kolleginnen/Kollegen für Klessmann eine besondere Rolle: Aus der Zusammenschau unterschiedlichster Pfarrbilder folgert Klessmann, »dass Pfarrerinnen und Pfarrer ihr Berufsbild selbst entwickeln müssen«90 und führt dazu – in Anlehnung an Klaus Winkler91 – den Begriff des ›persönlichkeitsspezifischen Berufsbildes‹ ein. »Persönlichkeitsspezifisch soll das Berufsbild in dem Sinne sein, dass sich darin die persönlich-biographischen Lebenserfahrungen sowie die theologisch-spirituellen Schwerpunkte und Vorlieben dieses Menschen widerspiegeln.«92 In der Entwicklung, Pflege und ggf. Veränderung dieses persönlichen Berufsbildes komme den Kolleginnen/Kollegen eine besondere Bedeutung zu,93 und Klessmann widmet dem Themenfeld Ausbildung, Fort- und Weiterbildung sowie Supervision sein letztes ausführliches Kapitel.94 Allerdings – und da schreibt der Pastoralpsychologe Klessmann – dienen all diese Formen jeweils der individuellen Ausbildung und Entwicklung und werden damit für den Einzelnen funktionalisiert. Wie in diesen Bereichen gearbeitet wird und ob diese Arbeit einen Eigenwert für den Pfarrberuf hat, wird wiederum nicht thematisiert.
2.1.6Zusammenfassung
Wenn auch alle fünf dargestellten pastoraltheologischen Ansätze unterschiedliche Ausgangspunkte und entsprechende Darstellungsweisen wählen, lassen sich doch Gemeinsamkeiten feststellen: Sie verengen ihren pastoraltheologischen Blick auf den einzelnen Pfarrer und verorten die Berufspraxis lediglich in der individuellen Arbeit in der Kirchengemeinde vor Ort.
Manfred Josuttis ist der einzige Autor der hier behandelten Ansätze, der sein berufliches Schaffen bereits beendet hat.95 Sein pastoraltheologisches Werk erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte, was sich auch in der Entwicklung seiner Perspektiven widerspiegelt: Zunächst betrachtet er den einzelnen Pfarrer im Gegenüber zur Gemeinde und zu Gott und fokussiert lediglich die Kompetenzen, über die ein Pfarrer verfügen muss. Die Formen, in denen er diese lernt und pflegt, spielen dabei keine Rolle. Obwohl Josuttis im späteren Verlauf seiner pastoraltheologischen Arbeit die Ambivalenz thematisiert, die der pastoralen Geschwisterschaft strukturell und theologisch innewohnt, nimmt diese Perspektive keine evidente Bedeutung in seinen Überlegungen ein. Leitend bleibt das Bild des Pfarrers, der im Gegenüber anders ist.
Isolde Karle konzentriert sich in ihrer Verarbeitung der Professionstheorie auf die berufsspezifischen Interaktionsformen zwischen dem Professionellen und Professionslaien. Folgerichtig beschränkt sie ihre Darstellung auf die einzelne Pfarrerin und ihre Berufspraxis als Generalistin vor Ort.
Ulrike Wagner-Rau sieht – ähnlich wie Christian Grethlein – die primäre Aufgabe des Pfarrberufs in der Vermittlung des Evangeliums in spezifische Lebenssituationen und verortet das berufliche Handeln auf der ›Schwelle‹. Um diese Aufgabe und damit den Beruf in Anbetracht der gegenwärtigen Komplexität der Verhältnisse vor Ort individuell ausüben zu können, muss der Pfarrer sich selbst und seine Arbeit reflektieren.
Christian Grethlein berücksichtigt zwar neben dem Gemeindepfarramt auch pastorale Tätigkeiten in Spezialbereichen, konzentriert sich dabei aber dennoch auf die einzelne Pfarrerin. Er definiert die Vermittlungsaufgabe jedes einzelnen Pfarrers als eine personenbezogene Kommunikation des Evangeliums, deren Voraussetzung in der persönlichen Aneignung des Evangeliums liegt. Die Theologie als pastorale Berufswissenschaft müsse deshalb bereits im Studium die Ausbildung einer individuellen personalen Kompetenz ermöglichen.
Michael Klessmann verfolgt ein ähnliches Ziel, wenn er die Entwicklung und Pflege eines je individuellen persönlichkeitsspezifischen Berufsbildes fordert. Im Gegensatz zu Grethlein sieht er dessen Ort aber nicht so sehr in der Universität, sondern in kollegialen Formen im Beruf.
Obwohl alle Ansätze betonen, wie wichtig Fortbildung und Supervision, Coaching, kollegialer Austausch und die Pflege der eigenen Spiritualität sind, verorten sie den Ertrag dieser Formen in der individuellen Entwicklung der Pfarrerin, der Erweiterung ihrer Kompetenzen oder der damit verbundenen Unterstützung ihrer Arbeit vor Ort. Josuttis betont die Bedeutung der Aus- und Fortbildung für den Kompetenzerwerb – besonders im Blick auf die eigene Person. Karle spricht sich dafür aus, Supervision oder Beratung vor allem bei konkretem Bedarf in der Berufspraxis in Anspruch zu nehmen. Wagner-Rau integriert Fortbildung, Supervision (etc.) zwar in ihr Bild vom Pfarrberuf, funktionalisiert sie aber insofern, als sie eine bessere Bewältigung der individuellen pastoralen Handlungspraxis vor Ort ermöglichen sollen. Grethlein versteht das Lesen, Nachdenken und Beten als berufstypische Tätigkeiten. Auch das kollegiale Gespräch zählt er dazu – allerdings eindeutig nachgeordnet. Hier wird die Orientierung am Idealbild eines allein denkenden Pfarrers – im Sinne eines wissenschaftlichen Theologen – am deutlichsten. Auch wenn das Themenfeld Aus- und Fortbildung, Supervision (etc.) in seinem Lehrbuch einen größeren Platz einnimmt, wird bei Klessmann die individuelle Funktionalisierung besonders greifbar: Fortbildung (etc.) braucht es, um das persönlichkeitsspezifische Berufsbild entwickeln zu können.
In allen fünf pastoraltheologischen Ansätzen werden die Formen und Arbeitsweisen, in denen sich Fortbildung, Supervision, kollegialer Austausch und die Pflege der eigenen Spiritualität vollziehen, nicht genannt. Dass die Mehrheit dieser Formen mit Kolleginnen/Kollegen praktiziert werden, häufig zeitlich einen großen Raum einnehmen, dass die Teilnahme einerseits freiwillig, andererseits verpflichtend geschieht, dass damit spezifische Probleme verbunden sind, das alles kommt – wenn überhaupt – nur am äußersten Rand in den Blick. Und dort, wo explizit von Kolleginnen/Kollegen die Rede ist, wird deren Rolle funktionalisiert.
2.2EMPIRISCHE FORSCHUNG IN DER PASTORALTHEOLOGIE
Die einschlägigen pastoraltheologischen Entwürfe der Gegenwart rezipieren in unterschiedlicher Weise und Umfang empirisches Material, das Aussagen über den Pfarrberuf trifft. Die Erhebungsinstrumente, die Forschungsintentionen sowie die Darstellungsweisen dieser empirischen Studien geben Aufschluss über die pastoraltheologische Forschungspraxis der Gegenwart.
Auffällig ist, dass keiner der unter 2.1 erörterten Ansätze auf einer eigenständigen empirischen Erhebung fußt. Wenngleich alle Autorinnen/Autoren die Bedeutung empirischer Ergebnisse betonen, wird lediglich in pastoraltheologischen Qualifikationsarbeiten empirisches Datenmaterial generiert. Deren Ergebnisse finden aber wiederum in den Berufstheorien Niederschlag. Darüber hinaus werden in den pastoraltheologischen Entwürfen vor allem die Ergebnisse großer eher quantitativer Studien berücksichtigt, etwa die der EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft (KMU) sowie Befragungen von Pfarrerinnen/Pfarrern.96 Deshalb sollen im Folgenden unter 2.2.1 exemplarisch die letzte sog. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (V. KMU), deren Daten 2012 erhoben wurden, sowie unter 2.2.2 die Befragung von Pfarrerinnen/Pfarrern auf dem Gebiet der jetzigen Nordkirche aus dem Jahr 2011 untersucht werden. Beide quantitativen Studien werden in der pastoraltheologischen und kirchentheoretischen Literatur breit rezipiert. Unter 2.2.3 stehen anschließend fünf Qualifikationsarbeiten im Mittelpunkt, für die die Autorinnen/Autoren eigenständige empirische Erhebungen durchgeführt haben. Anhand der V. KMU, der Befragung von Pfarrerinnen/Pfarrern der Nordkirche sowie empirischer Forschungsarbeiten zum Pfarrberuf soll die These überprüft werden, dass auch die empirische Forschung in der Pastoraltheologie den Beruf aus einem spezifischen Blickwinkel betrachtet. Wird auch in den empirischen Studien – ähnlich wie in den pastoraltheologischen Entwürfen – inhaltlich und methodisch lediglich auf den einzelnen Pfarrer in der Kirchengemeinde geschaut? Und wie wird hier Kollegialität im Pfarrberuf – sofern sie thematisiert wird – verstanden?
2.2.1Die fünfte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft (V. KMU): Vis-à-vis zum Pfarrer
Im Rahmen ihrer quantitativen Repräsentativerhebung untersucht die V. KMU die Bedeutung eines Pfarrers für das individuelle Verhältnis von Mitgliedern zu ihrer Kirche. Mitglieder der Evangelischen Kirche wurden – wie auch schon in den vorangegangenen Erhebungen – nach ihrer Kenntnis von und ihrem Kontakt zu Pfarrerinnen/Pfarrern befragt. Die Auswertungen sehen die These unterstützt, den Pfarrberuf als Schlüsselberuf der evangelischen Kirche zu betrachten, da die Kirchenbindung in einem Zusammenhang mit der persönlichen Kenntnis einer Pfarrerin steht.97 Der Begriff »Kenntnis« wird hier gebraucht im Sinne von namentlich bekannt sein oder vom Sehen, gemeint ist nicht unbedingt ein direkter persönlicher Sprechkontakt. Die Auswertung der Untersuchung macht zudem deutlich, dass die Face-to-Face-Kommunikation etwa in der Seelsorge eine untergeordnete Rolle spielt, vielmehr die öffentlichen Auftritte, wozu auch Gottesdienste und Kasualien zählen, von Bedeutung sind.98 Dieser Befund wird im ausführlichen Auswertungsband von 2015 noch einmal etwas relativiert, wenn – unter dem Auswertungsaspekt der religiös-kirchlichen Interaktion99 – geschrieben wird, dass beide Pole bestätigt würden: »zum einen eine Praxis thematischer und/ oder personaler Interaktion face to face und zum anderen medial vermittelte Praxis (thematisch und/oder personal) als wirksame Beziehung zur Kirche«.100
Wenn auch die Fragerichtung aufgrund der Anlage einer Mitgliedschaftsuntersuchung einleuchtet, steht aus pastoraltheologischer Sicht die Handlungspraxis der Pfarrerinnen/Pfarrer in der Ortsgemeinde zu sehr im Fokus. Hier vollzieht sich primär der Kontakt zu Kirchenmitgliedern – in jedweder Form – und wird in der Auswertung entsprechend analysiert. Auch wenn die Bedeutung des Eins-zu-Eins-Kontaktes in der V. KMU relativiert und die öffentliche Funktion des Pfarrberufs unterstrichen wird,101 beinhaltet die Fragerichtung dennoch eine gewisse Tendenz: Einzelne Kirchenmitglieder werden zu ihrem individuellen Kontakt zu einem Pfarrer, einer Pfarrerin befragt.
Die V. KMU fokussiert sich in Anlage und Auswertung auf ein Verständnis von Kirchenmitgliedschaft als sozialer Praxis.102 Davon ausgehend wurde die Repräsentativbefragung u. a. um drei offen formulierte Fragen ergänzt, die zu Beginn der Befragung der Interviewpartner gestellt wurden. Zunächst:
»›Was fällt Ihnen ein, wenn Sie evangelische Kirche hören?‹ Sodann wurde nach Einfällen zu ›Personen‹ gefragt, ›die Sie mit der Evangelischen Kirche in Verbindung bringen‹, und ebenso nach ›Orten‹.«103
Interessanterweise nennen auf die erste Frage nur 4 % Pfarrerinnen/Pfarrer, in der Kategorie Personen fällt hingegen etwa einem Drittel der Befragten das Pfarrpersonal ein. 8 % sprechen dabei von den Pfarrerinnen/Pfarrern als Berufsgruppe.104
Die V. KMU hat ihrem netzwerktheoretischen Schwerpunkt in der Forschungsanlage sodann in zwei weiteren methodischen Variationen Ausdruck verliehen: zum einen durch zusätzliche Fragen, die den Zusammenhang zwischen der individuellen religiösen Praxis und anderen Mitgliedern in den Blick nehmen.105 Zum anderen wurde diese »Akteursperspektive«106 in einer zweiten Erhebung, der Gesamtnetzwerkerhebung einer Kirchengemeinde, nochmals vertieft.107 Mit Hilfe von Namensgeneratoren wurden die wechselseitigen Verbindungen zwischen den Mitgliedern ermittelt und als Netzwerke sichtbar gemacht, u. a. im Hinblick auf den Gottesdienstbesuch sowie religiöse und soziale Beziehungen vor Ort.
Unabhängig von den Ergebnissen sind in der Forschungsperspektive der erweiterten Fragen in der Repräsentativerhebung sowie der Netzwerkerhebung pastoraltheologisch drei Aspekte interessant: Zunächst lassen die offenen Fragen Assoziationen in Bezug auf das Pfarrpersonal zu, die auch jenseits der Ortsgemeinde liegen können. Zweitens löst die Netzwerkperspektive das in der pastoraltheologischen Forschung vorherrschende Gegenüber zwischen Pfarrerinnen/Pfarrern und Gemeinde auf und integriert diese in das jeweils andere Feld. Drittens nimmt die Netzwerkerhebung auch dezidiert Orte und Gelegenheiten auf, die sich außerhalb des binnenkirchlichen Bereiches bewegen, und wirkt so einer verengten Sicht auf die Kirchengemeinde als pastoralem Handlungsfeld entgegen.108
Dennoch reproduziert auch die Netzwerkerhebung einer Gemeinde die Fokussierung auf die individuelle Berufspraxis vor Ort. Dies liegt primär in der Ausrichtung der Untersuchung begründet, die sich auf die Mitglieder und nicht auf die hauptamtlichen Akteure konzentriert. Entsprechend kann die Studie einer pastoralen Binnensicht bzw. einer vermeintlich neutralen Sicht auf den Beruf nicht gerecht werden, zumal die Arbeitsbereiche, die für Mitglieder unsichtbar sind, nicht erfasst werden können. Dazu zählen alle Tätigkeitsbereiche, die außerhalb der Parochie liegen oder sich im Verborgenen vollziehen, z. B. auch der überwiegende Teil der kollegialen Arbeit im Pfarrberuf. Dennoch hat die Konzeption und ihre Fokussierung auf die Arbeit vor Ort auch Auswirkungen auf die klassische pastoraltheologische Forschung, da die KMU mittlerweile als eines der Leitmedien kirchlicher und pastoraltheologischer Reflexionen gelten kann und entsprechend rezipiert wird.
Die abschließenden Überlegungen des wissenschaftlichen Beirats der V. KMU bedenken die Ergebnisse der Studie lediglich im Hinblick auf die organisationalen Interessen der Kirchenleitung. Leitend ist dabei die Idee, Pfarrerinnen/Pfarrer darin zu unterstützen, die Kirche öffentlich zu repräsentieren – was als eine ihrer Schlüssel-Kompetenzen verstanden wird.109 Hier stellt sich die Frage, ob es möglich wäre, aus der Studie dezidierte pastoraltheologische Konsequenzen zu ziehen, die nicht kirchenleitende sondern z. B. pastorale Interessen vertreten und – so wäre zu vermuten – sich von den erstgenannten unterscheiden.110
2.2.2Befragungen von Pfarrerinnen/Pfarrern: Der Fragebogen als Spiegel für die Selbstbetrachtung
Eine andere Perspektive als die Erhebungen über Kirchenmitgliedschaft nehmen Befragungen von Pfarrerinnen/Pfarrern ein, die in den vergangenen rund 15 Jahren in verschiedenen Landeskirchen durchgeführt wurden111: Sie sind am Selbstbild der Pfarrerinnen/Pfarrer interessiert, nicht an einer Sicht auf den Beruf von außen, wie er den Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen und kirchlichen Reformpapieren zugrunde liegt. Am Beispiel der Befragung der Pfarrerinnen/Pfarrer der mittlerweile fusionierten Nordkirche aus dem Jahr 2011112 soll deutlich werden, welche pastoraltheologischen Grundannahmen diese Befragungen leiten.
Als Ziel der Befragung innerhalb der heutigen Nordkirche nennen Uta Pohl-Patalong und Martin Vetter »den beruflichen Alltag der Befragten sowie deren Vorstellungen vom Pfarrberuf und von der Zukunft der Kirche klarer erfassen zu können und so einen Diskurs zu eröffnen über Chancen und Herausforderungen im Pfarrberuf heute«.113
Die Pfarrerinnen/Pfarrer wurden zu ihrem konkreten Berufsalltag und dem Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit befragt. Weitere Themenblöcke widmeten sich dem Berufs- und Selbstverständnis und fragten danach, was die Pfarrerinnen/Pfarrer als Anerkennung und Unterstützung erleben (bzw. sich wünschen), woran sie sich orientieren und welche Kompetenzen sie bei Führungskräften für wichtig erachten. Fragen zum Thema »Pfarrberuf und Gesellschaft« und zur Zukunft der Kirche sowie des Pfarrberufs ergänzten den Fragebogen.
Die Mehrheit der Fragen zielt auf die individuelle Berufspraxis, das persönliche Berufsverständnis sowie auf persönliche Einschätzungen zu unterschiedlichen Themen. Gleichzeitig kommen aber an verschiedenen Stellen Kolleginnen/Kollegen direkt und indirekt vor, allerdings immer mit der Fragestellung, welche Bedeutung sie für die einzelne Pfarrerin haben.
Unter der Kategorie »Berufsalltag« werden die Pfarrerinnen/Pfarrer u. a. gefragt, wieviel Zeit sie pro Arbeitsfeld verwenden und wie sie dies bewerten. Neben Seelsorge, Konfirmandenunterricht, Gottesdienst und vielen weiteren Arbeitsfeldern wird hier auch nach der Pflege des eigenen geistlichen Lebens sowie nach Fortbildung/Supervision/Coaching gefragt. 25 %114 der Befragten verwenden sehr wenig, 41 % wenig Zeit für die Pflege ihres geistlichen Lebens. 74 % hätten dafür gerne mehr Zeit. Für Fortbildung/Supervision/Coaching nehmen sich nur etwa 10 % viel oder sehr viel Zeit. Die restlichen 90 % geben etwa zu gleichen Teilen an, sehr wenig, wenig oder im mittleren Maß Zeit aufzuwenden. 50 % halten dabei ihre Zeitinvestition für angemessen, 47 % hätten gerne mehr Zeit. In der Anlage der Frage ist besonders interessant, dass hier das eigene geistliche Leben – wie auch immer man es pflegt – als Arbeitsfeld bezeichnet wird, ebenso Fortbildung, Supervision und Coaching. Der kollegiale Austausch, der in weiteren Fragen durchaus vorkommt, bleibt hier außen vor und wird nicht als eigenes Arbeitsfeld gewertet. Unterstützt wird diese These durch eine Frage im Themenbereich »Arbeit und Freizeit«: »Genügend Zeit für Besinnung und Reflexion« werden u. a. als Antwortmöglichkeit auf die Frage »Welche der folgenden Freizeitrahmen halten Sie normalerweise ein?« angeboten. 28 % der Befragten wählen diese Antwortmöglichkeit.115 Der Fragebogen suggeriert also, Besinnung und Reflexion gehöre zur Freizeit und damit im Umkehrschluss nicht zur beruflichen Tätigkeit.
Auf die Frage »Was hilft Ihnen bzw. würde Ihnen helfen bei der Gewichtung Ihrer Aufgaben?« gibt es unter anderem die Antwortmöglichkeiten »Supervision/Coaching«, »kollegialer Austausch« und »Fort- und Weiterbildung«.116 Ob bei der Antwortmöglichkeit »Fort- und Weiterbildung« die Bedeutung von Kolleginnen/Kollegen mitgedacht wird, oder ob es sich um den Erwerb von Kompetenzen handelt, bleibt offen. Gleiches gilt für die Kategorie »Supervision«: Es wird nicht zwischen Einzelsupervision oder Gruppensupervision unterschieden. Insgesamt führt die Frage sehr in die Enge, gibt sie doch die Funktion – Hilfe bei der Gewichtung von Aufgaben – bereits vor. Auffällig ist allerdings, dass die empfundene Unterstützung in diesen drei Feldern als besonders hoch eingestuft wird: Sehr hilfreich erleben 40 % der Befragten den kollegialen Austausch – was unter allen Antwortmöglichkeiten den höchsten Zustimmungsgrad erreicht –, gefolgt von Supervision/ Coaching mit 39 %. Die Fort- und Weiterbildung stufen 30 % als sehr hilfreich ein. Ebenfalls unter dem großen Themenfeld »Anerkennung und Unterstützung« wird nach den Wünschen zur Förderung des Dienstes gefragt: Hier erreicht die Antwortmöglichkeit »regelmäßigen kollegialen Austausch« mit 72 % wiederum die höchste Zustimmung.117 Aber auch hier wird aus der Art der Fragestellung nicht deutlich, ob dieser kollegiale Austausch bereits regelmäßig gepflegt wird und in welchen Formen er sich vollzieht.
Ein eigenes Themenfeld der quantitativen Erhebung widmet sich der Fort- und Weiterbildung.118 Die einzelnen Fragen in diesem Bereich lassen vermuten, dass unter Fort- und Weiterbildung thematische Fortbildungswochen,





























