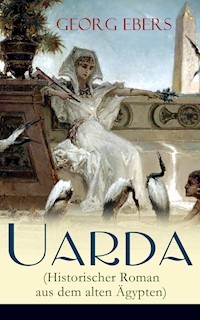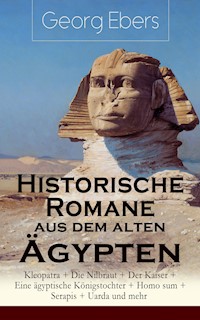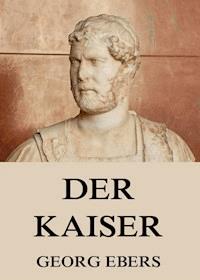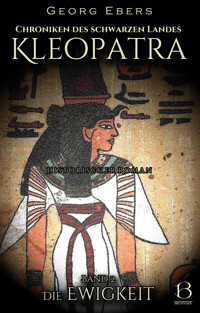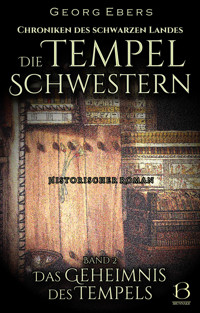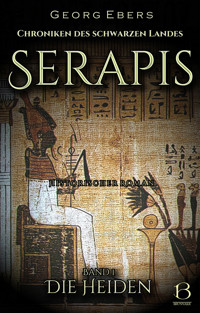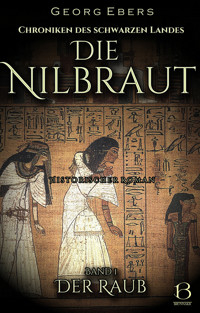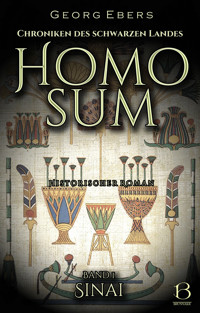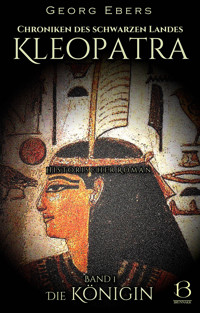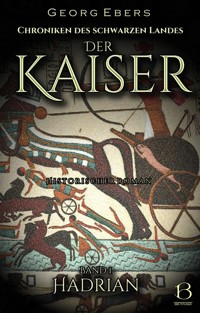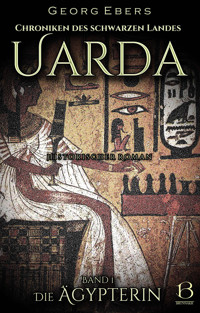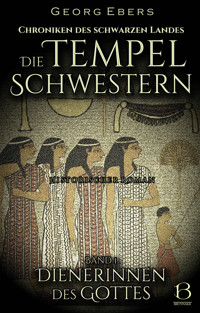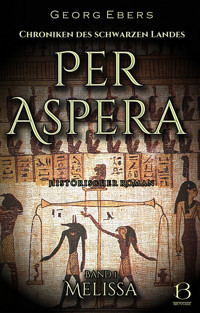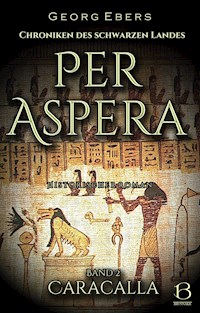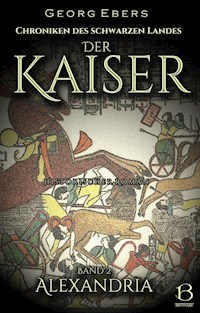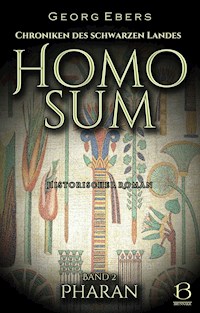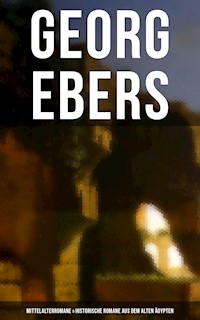
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Georg Ebers, ein renommierter deutscher Ägyptologe und Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, präsentiert uns in 'Mittelalterromane & Historische Romane aus dem alten Ägypten' eine faszinierende Sammlung seiner Werke. Die Bücher entführen den Leser in vergangene Epochen voller Geheimnisse und Abenteuer. Ebers kombiniert historische Fakten mit fiktionalen Elementen, um eine lebendige und authentische Darstellung des mittelalterlichen und antiken Ägyptens zu schaffen. Sein präziser Schreibstil und die liebevoll gestalteten Charaktere machen seine Romane zu einer wahren Freude für Geschichtsinteressierte und Romantikliebhaber gleichermaßen. Georg Ebers' tiefe Leidenschaft für die ägyptische Geschichte und Kultur spiegelt sich in seinen Werken wider. Als Ägyptologe und Forscher verfügte er über ein fundiertes Wissen, das er geschickt mit seiner literarischen Begabung kombinierte. Durch seine detaillierten Beschreibungen von historischen Ereignissen, Orten und Bräuchen gelingt es ihm, den Leser in die Welt des alten Ägypten eintauchen zu lassen und das Leben zur Zeit der Pharaonen lebendig werden zu lassen. 'Mittelalterromane & Historische Romane aus dem alten Ägypten' ist ein Muss für all diejenigen, die sich für die Geschichte des antiken Ägypten und fesselnde historische Romane begeistern. Georg Ebers' Werke sind nicht nur spannend und unterhaltsam, sondern bieten auch einen einzigartigen Einblick in eine längst vergangene Welt, die auch nach Jahrhunderten noch fasziniert und begeistert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 9463
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Ebers: Mittelalterromane & Historische Romane aus dem alten Ägypten
Inhaltsverzeichnis
Eine ägyptische Königstochter
Vorreden
Vorrede zur zweiten Auflage
Aut prodesse volunt aut delectare poëtae, Aut simul et jucunda et idonea dicere vitae.
Horat. De arte poetica v. 333.
Seit dem ersten Erscheinen dieses Buches sind vier Jahre vergangen. Nun sich die zweite Auflage desselben in die Welt zu gehen anschickt, liegt es mir ob, ihr einige begleitende Worte mit auf den Weg zu geben. Daß ich mich bemüht habe, den folgenden Blättern den Namen einer »verbesserten Ausgabe« zu erwerben, bedarf kaum einer Versicherung. Der Autor steht ja seinem Werke gegenüber in einem väterlichen Verhältnisse, und welcher Vater wäre nicht bestrebt, sein Kind, selbst wenn er es schon zu wiederholten Malen auf Reisen schickte, sobald es sich zu einem neuen, gefahrvollen Wege rüstet, mit allem Guten auszustatten, das ihm zu Gebote steht, und es von allen Fehlern zu befreien, die ihm in den Augen der Menschen schaden könnten? So erscheint nur die Versicherung überflüssig, daß ich auf die Verbesserung des Textes der ersten Auflage meiner Königstochter alle mögliche Sorgfalt wiederholt verwendet habe; ich halte es aber doch für gerathen, in der Kürze anzudeuten, wo und wie ich eine bessernde Hand an die erste Auflage meines Buches legen zu müssen glaubte. Die Anmerkungen sind revidirt, geändert und mit Allem bereichert worden, was sich von dem seit 1864 durch die Altertumswissenschaft (namentlich auf dem Gebiete der altägyptischen Sprach- und Denkmälerkunde) neu Erforschten auf dem mir gewährten knappen Raume, auch für den Laien verständlich, darstellen ließ. An die Veränderung des Textes bin ich nur mit vorsichtiger, ja beinahe schüchterner Hand gegangen, denn in vier Jahren einer angestrengten Thätigkeit als akademischer Lehrer, als Forscher und Schriftsteller auf rein gelehrten, das freie Walten der schöpferischen Phantasie ausschließenden Gebieten, büßt die dichterische Seite in uns so viel ein, als die kritische gewinnt. Mit einer gänzlichen Umarbeitung meiner Erzählung mußte ich sie aus dem Gebiete der heitern Kunst herauszudrängen fürchten, dem sie doch entschieden angehören soll. So habe ich mich denn mit einer sorgfältigen Ausfeilung des Stiles, der Tilgung von Längen, die das Interesse weniger wißbegieriger Leser zu beeinträchtigen drohten, mit einigen dem Verständnisse oder der Charakteristik förderlichen Einfügungen und der Aenderung der Eigennamen begnügt. Diese letzteren gebe ich statt in der griechischen, in der lateinischen Form, denn mehr als eine meiner schönen Leserinnen hat mich versichert, daß sie Ibykus und Cyrus als bekannte Namen begrüßen würde, während die »Ibykos« und »Kyros« der ersten Auflage ihr fremd, gelehrt, und deßwegen abschreckend erschienen. Das k habe ich dem c überall vorgezogen, wo dem römischen c der Werth des deutschen k zukommt. Bei den ägyptischen und den durch die Keilschrift bekannt gewordenen Namen habe ich die unsrer Sprechweise angemessensten Formen gewählt. Solche Definitionen, die für das Verständniß des Textes unerläßlich erschienen (es sind deren wenige), stehen in der zweiten Auflage, statt in den schwerer zugänglichen Anmerkungen, unter dem Texte.
Noch weniger wie damals, wo ich mit diesem Werke zum ersten Male in die Oeffentlichkeit trat, kann ich mir jetzt verhehlen, daß es eine große Zahl von zünftigen Gelehrten gibt, die es einem Jünger der Wissenschaft übel deuten, wenn er die Errungenschaften ernster Studien in ein von der Phantasie gewebtes Gewand kleidet. In einigen Stücken geb’ ich ihnen Recht; daß es aber doch freundlich aufgenommen wird, wenn ein Gelehrter es einmal, sich selbst und anderen zur Lust, nicht verschmäht, die Resultate seiner Forschungen einer möglichst großen Anzahl von Gebildeten in der das allgemeine Interesse am meisten ansprechenden Form zugänglich zu machen, das beweist schon der schnelle Absatz der ersten starken Auflage dieses Buches. Jedenfalls gibt es wenige bessere Mittel, in weiten Kreisen belehrend und anregend zu wirken, als das von mir erwählte. Wer ein gelehrtes Werk zur Hand nimmt, der hat eben schon ein ausgesprochenes Interesse an der Wissenschaft, aber leicht kann es geschehen, daß Jemand, der in diesen Blättern nur Unterhaltung sucht, wenn er sie aus der Hand legt, angeregt durch das Gelesene, nach einem gelehrten Werke greift, vielleicht sogar für das Studium des Alterthums gewonnen ist.
Bei den spärlichen Nachrichten, die wir über das häusliche Leben der Griechen und Iranier vor den Perserkriegen besitzen (von den Aegyptern wissen wir mehr), könnte übrigens auch der streng gelehrte Darsteller eines Privatlebens der Kulturvölker des sechsten Jahrhunderts v. Chr. der Mitwirkung solcher Kräfte nicht entrathen, die in das Gebiet der Phantasie gehören. Freilich wäre der letztere im Stande, den Anachronismus durchaus zu vermeiden, dem der Autor eines Werkes, wie das von mir unternommene, an gewissen Stellen rettungslos anheimfällt. Irrthümer äußerer Art lassen sich mit Fleiß und Aufmerksamkeit wohl umgehen, dagegen mochte und durfte ich mich nicht ganz frei machen von den Grundanschauungen der Zeit und des Landes, in denen meine Leser und ich geboren wurden; denn hätte ich rein antike Menschen und Zustände schildern wollen, so würde ich für den modernen Leser theils unverständlich, theils ungenießbar geworden sein und also meinen Zweck von vornherein verfehlt haben. Die handelnden Personen werden demnach zwar Persern, Aegyptern u. s. w. ähnlich sehen können, man wird aber doch ihren Worten mehr noch als ihren Handlungen den deutschen Darsteller, den nicht immer über der Sentimentalität seiner Zeit stehenden Erzähler anmerken müssen, der im 19. Jahrhundert nach der Geburt Jesu Christi geboren wurde, des hohen Lehrers, dessen Wort so mächtig eingriff in die Empfindungswelt und die Denkweise der Menschheit.
Die Perser und Griechen, welche ihrer Herkunft nach mit uns verwandt sind, bieten in dieser Beziehung weniger Schwierigkeiten, als die auf ihrer vom Nile der Wüste abgerungenen Fruchtinsel isolirt dastehenden Aegypter.
Ich weiß Herrn Professor Lepsius, der mich darauf aufmerksam machte, daß eine ausschließlich auf ägyptischem Boden stehende Kunstdarstellung den Leser ermüden würde, großen Dank. Seinem Winke folgend, habe ich schon in der ersten Auflage meinen dem Herodot entnommenen Stoff so disponirt, daß ich den Leser zunächst, gleichsam einleitend, in einen griechischen Kreis führe, dessen Wesen ihm nicht ganz fremd zu sein pflegt, mit dem er sogar ein wichtiges Gemeinsames besitzt: die Empfindungen im Gebiete des Schönen und der Kunst. Durch diesen hellenischen Vorhof gelangt er vorbereitet nach Aegypten, von dort nach Persien und endlich wieder zum Nile zurück. Er soll sein Interesse gleichmäßig an die genannten Völker vertheilen. Darum ruht die ganze Schwere der Handlung nicht auf einem einzigen Helden; ich bin vielmehr bemüht gewesen, alle drei Nationen durch geeignete Repräsentanten zu individualisiren. Wenn ich meinem Romane trotzdem den Namen der »ägyptischen Königstochter« gegeben habe, so geschah es, weil durch das Schicksal der Nitetis das Wohl und Wehe aller andern handelnden Personen bedingt wird, und diese also als der Mittelpunkt des Ganzen betrachtet werden darf.
Bei der Charakteristik des Amasis bin ich der meisterhaften Schilderung des Herodot gefolgt, welche durch das auf einem alten Denkmale gefundene Bild dieses Königs bestätigt wird. Auch die Grundzüge zu meinem Kambyses hab’ ich dem Herodot entnommen, wie denn dem ganzen Romane die Mittheilungen dieses großen Historikers, der nur wenige Jahrzehente nach den geschilderten Ereignissen geboren ward, zu Grunde liegen. Dennoch bin ich dem »Vater der Geschichte« nicht blindlings gefolgt, bin namentlich bei der Entwickelung der Charaktere meine eignen von den Grundsätzen der Psychologie vorgezeichneten Wege gewandelt und habe die Resultate der Hieroglyphen und Keilschriftentzifferung überall zu Rathe gezogen. Diese bestätigen freilich vielfach die von dem Halikarnassier aufgezeichneten Mittheilungen.
Wenn ich mit Herodot den Bartja erst nach der Eroberung von Aegypten tödten lasse, so geschieht es, weil ich gerade an dieser Stelle nicht mit der gewöhnlichen Uebersetzung der Inschrift von Behistan übereinzustimmen vermag. Es heißt daselbst: »Ein Kambujiya mit Namen, Sohn des Kuru, von unsrer Familie, der war vorher hier König und hatte einen Bruder Bartiya mit Namen, von gleichem Vater und gleicher Mutter mit Kambujiya. Darauf tödtete Kambujiya jenen Bartiya.« Ich kann mich in diesem für das große Publikum bestimmten Buche nicht in sprachliche Erörterungen einlassen, aber selbst der Laie wird es einleuchtend finden, daß das obige »darauf« in diesem Zusammenhange keinen Sinn gibt. Die Inschrift stimmt sonst überall mit dem Berichte des Herodot, und ich glaube auch an dieser Stelle die Relation des Halikarnassiers mit der des Darius in Uebereinstimmung bringen zu können, doch muß ich mir die Begründung für einen anderen Ort aufsparen.
Woher Herodot den Namen Smerdes für Bartja und Gaumata genommen, läßt sich nicht nachweisen. Letzteren finden wir bei Justin, wenn auch in verstümmelter Form, wieder.
Warum ich den Halikarnassier Phanes zu einem Athener gemacht habe, findet sich angedeutet in der 90. Anmerkung des ersten Bandes. Dieser Zwang, den ich einer verbürgten Thatsache anthue, hätte sich in der ersten Auflage vermeiden lassen, war aber jetzt ohne große Umwälzungen im Texte nicht zu vermeiden. Einer ernsteren Entschuldigung bedürfte die Kombination, durch welche ich versucht habe, Nitetis möglichst jung zu machen; denn es ist, trotz der von Herodot gerühmten Milde des Amasis, ziemlich unwahrscheinlich, daß König Hophra noch zwanzig Jahre nach seinem Sturze gelebt haben sollte.
Uebrigens stehen wir auch hier vor keiner Unmöglichkeit, denn es läßt sich nachweisen, daß Amasis die Nachkommen seiner Vorgänger nicht verfolgte. Ein gewisser Psamtik, welcher der gestürzten Dynastie angehörte, lebte wenigstens, wie ich auf einer Stele im leydener Museum gefunden habe, bis in’s 17. Jahr der Regierung des Amasis und starb 75 Jahr alt.
Endlich sei es mir gestattet, einige Worte über Rhodopis zu sagen. Daß sie ein ganz außergewöhnliches Weib gewesen sein muß, beweisen die in Anmerkung 10 und 14 des ersten Theils angeführten Stellen des Herodot und die Mittheilungen vieler anderer Schriftsteller. Daß sie schön gewesen sei, geht schon aus ihrem Namen hervor, der zu deutsch »Rosenwange« bedeutet. Auch ihre Liebenswürdigkeit wird ausdrücklich von dem Halikarnassier hervorgehoben. In welchem Grade sie mit allen Vorzügen ausgestattet gewesen sein muß, läßt sich am besten daraus entnehmen, daß die Sage und das Märchen bemüht gewesen sind, ihren Namen unsterblich zu machen. Rhodopis soll »wie viele behaupten« die schönste der Pyramiden (die des Mycerinus oder Menkera) erbaut haben; eine Erzählung von ihr, welche Strabo und Aelian bringen, bildet vielleicht die Grundlage zu einem unserer ältesten und schönsten Volksmärchen, dem Aschenbrödel, ja eine Sage von Rhodopis ist nahe verwandt mit unserer Loreleymähre. Nach Aelian raubte ein Adler, nach Strabo der Wind die Schuhe der zu Naukratis im Nile badenden Rhodopis, und legte sie zu Füßen des auf dem Markte Gericht haltenden Königs nieder. Dieser war entzückt über die Zierlichkeit der Sandalen und ruhte nicht eher, bis er die Besitzerin derselben aufgefunden und zu seiner Gemahlin gemacht hatte.
Die Sage erzählt, daß auf einer der Pyramiden ein wunderholdes, nacktes Weib throne, das durch seine Schönheit die Wüstenwandrer um den Verstand bringe (homines insanire faciat). Ihr Name sei Rhodopis. Th. Moore, welcher diese Sage dem Zoega’schen Werke entlehnt hat, benutzt sie zu folgenden Versen:
«Fair Rhodope, as story tells The bright unearthly numph, who dwells ’Mid sunless gold and jewels hid, The lady of the Pyramid.»
So fabelhaft all’ diese Mittheilungen klingen, so schlagend beweisen sie, daß Rhodopis ein Weib von ganz außergewöhnlicher Art gewesen sein muß. Wenn einige Gelehrte die Thracierin mit der schönen und heldenmüthigen Königin Nitokris gleichsetzen, von der Manetho bei Africanus, Eusebius u. A. redet, und deren Namen sich in der That (er bedeutet »siegreiche Neith«) als der einer der sechsten Dynastie angehörenden Königin auf den Denkmälern wiedergefunden hat, so conjiciren sie zu kühn, geben aber neue Belege für die Bedeutsamkeit unserer Heldin. Zweifelsohne sind die auf die Eine bezüglichen Sagen auf die Andere übertragen worden und umgekehrt. Herodot lebte viel zu kurze Zeit nach ihr und erzählt viel zu genaue und realistische Dinge aus ihrem Privatleben, als daß sie eine bloße Sagengestalt gewesen sein könnte. Das Schreiben des Darius am Ende des dritten Bandes soll die hellenische Rhodopis mit der Pyramidenerbauerin der Sage vermitteln. Ich will hier noch erwähnen, daß die erstere von Sappho »Doricha« genannt wurde. So mag man sie gerufen haben, ehe sie den Beinamen der Rosenwangigen erhielt.
Endlich muß ich des Jambenflusses, der sich in der Liebesscene zwischen Sappho und Bartja im ersten und dritten Bande geltend macht, entschuldigend gedenken; auch liegt es mir ob, einige Worte über die Liebesscenen selbst zu sagen, welche ich in der neuen Auflage nur wenig verändert habe, obgleich mir gerade in Bezug auf sie die meisten Bedenken zu Ohren gekommen sind.
Zunächst will ich gestehen, daß mir die Jamben bei der Schilderung des seligen Liebesglückes eines schönen jungen Menschenpaares, das mir selbst lieb geworden war, und das ich in die stille Nacht, an den ewigen Nil, zu Palmen und Rosen hinausbegleitete, unwillkürlich, sogar gegen meinen Willen (ich wollte ja einen Roman in Prosa schreiben), in die Feder gekommen sind. Die erste Liebesscene hat für mich eine Geschichte. Ich schrieb sie, ohne zu wissen, daß ich schrieb, in einer halben Stunde nieder. In meinem Buche ist zu lesen, daß die Perser das, was sie Abends im Rausche beschlossen hatten, am nächsten Morgen in der Nüchternheit von Neuem überlegten. Als ich im Sonnenscheine prüfte, was da beim Lampenlichte geworden war, wurde ich bedenklich und wollte schon die Liebesscenen vernichten, als mein theurer, zu früh verdorbener Freund Julius Hammer, der Dichter von »Schau’ in Dich und schau’ um Dich!« meine zum Ausstreichen erhobene Hand zurückhielt. Auch von anderer Seite wurde die Form der Liebesscenen gebilligt, und ich sage mir selbst, daß der poetische Ausdruck des Gefühles der Liebe sich in allen Ländern und Zeiten sehr ähnlich darstellt, während die Gespräche und Umgangsformen liebender Paare in der Realität, je nach Ort und Zeit, verschieden sein werden. Ich stehe hier dem übrigens nicht zu seltenen Falle gegenüber, daß die Dichtung der Wahrheit näher zu kommen ermöglicht, als die besonnene, beobachtende Prosa. Manche meiner verehrten Kritiker haben diese Scenen getadelt, andere, und unter ihnen solche, an deren Urtheil mir besonders viel gelegen ist, ihnen das freundlichste Lob zukommen lassen. Von diesen nenn’ ich A. Stahr, C. v. Holtey, M. Hartmann, E. Hoefer, W. Wolfsohn, C. Leemans, Professor Veth in Amsterdam u. a. m. Dennoch kann ich nicht verschweigen, daß von gewichtigen Seiten her die Frage an mich herangetreten ist: Kannte denn das Alterthum überhaupt die Liebe in unserem Sinne, oder ist diese erst ein Produkt des Christentums, wie die Romantik, auf der ja schon dem Namen nach der Roman beruht? Daß ich mich, als ich mein Buch begann, ähnlichen Bedenken nicht verschlossen habe, das mag das Motto beweisen, welches ich über die Vorrede zur ersten Auflage setzte:
»Man hat mehrfach bemerkt, daß in den Briefen Cicero’s und des jüngeren Plinius Anklänge moderner Sentimentalität nicht zu verkennen seien. Ich finde in denselben nur Anklänge tiefer Gemüthlichkeit, die in jedem Zeitalter, bei jedem Volksstamme aus dem schmerzlich beklommenen Busen emporsteigen.« A. v. Humboldt, Kosmos II. S. 19.
Und ich stimme unserem großen Gelehrten freudig bei und weise darauf hin, daß wir in heidnischen Kreisen entstandene Liebesromane haben. Ich erinnere nur an des Apulejus’ Amor und Psyche. Die Liebe war auch dem Alterthume nicht fremd. Gibt es schönere Proben heißer Leidenschaft als die, welche uns aus Sappho’s Liedern entgegenflammen, haben wir ein herrlicheres Bild gehuldigen Ausharrens in treuer Liebe als das, welches uns Homer in der edlen Penelopeia vorzeigt, gibt es schönere Beispiele des treuen Verbundenseins zweier Herzen selbst über den Tod hinaus, als die, welche uns Xenophon in der Erzählung von der Panthea und dem Abradat und die Geschichte Vespasian’s durch die Kunde von dem Geschicke des Galliers Sabinus und seiner Gattin aufbewahrt haben? Kennen wir etwas Zarteres, als die Sage von den Halkyonen (Eisvögeln), die einander so zärtlich lieben, daß das Weibchen sein Männchen, wenn es vom Alter gelähmt wird, auf die Flügel nimmt und dahin trägt, wohin es verlangt? Solche Liebe belohnen die Götter, und wenn das Pärchen sein Nest baut und brütet, dann ruhen Wogen und Wind, und lieblicher scheint die Sonne vom Himmel in diesen »Halkyonen-Tagen«. Fehlt es an Liebesromantik da, wo ein Wüstling, Antonius, in seinem Testamente verlangen konnte, daß seine Leiche, er möge sterben wo er wolle, neben der seiner geliebten Kleopatra beizusetzen sei; ist selbst die Galanterie der Liebe da als unbekannt vorauszusetzen, wo man einer Königin, Berenice’s, schönes Haar als Sternenbild an den Himmel versetzte, darf Hingabe für die Liebe bezweifelt werden bei Völkern, die um eines schönen Weibes willen furchtbare Kriege mit bitterer Hartnäckigkeit führen? Die Griechen hatten eine Schmach zu rächen, die Trojaner aber kämpften für den Besitz der Helena, denn die Greise von Ilion sind bereit, »um solchen Weibes willen lange Zeit Leiden zu tragen«1. Und wird nicht endlich die ganze Frage erledigt durch das einzige Gedicht des Theokrit, die Zauberin, welches Rückert uns Deutschen durch seine herrliche Uebersetzung ganz zu eigen machte? Da hockt das arme verlassene Mädchen mit ihrer alten Magd Thestylis am Feuer, über dem in seinem Rade der Wendehalsvogel sitzt, dem die Kraft beiwohnen soll, den treulosen Delphis zurückzuführen. Ein Assyrer hat die Simaitha genug der Zaubermittel gelehrt, und sie versucht sie alle und vergißt keines. Das ferne Brausen des Meeres. das rauchende Feuer, die in der Gasse heulenden Hunde, der gequälte, unruhige Vogel, die alte Magd, das in sich zerrissene Mädchen, die schauervollen Zaubermittel gesellen sich zu einem finsteren Nachtstücke, dessen Wirkung erhöht wird durch den ruhig und kalt vom Himmel glänzenden Mondschein. Nun verläßt die Alte das Mädchen, und Simaitha hält sogleich mit dem Zauber inne und läßt ihre Thränen fließen und hebt ihre Blicke zu Selene, der stillen Vertrauten der Liebenden, dem Monde empor und vertraut ihr Alles, was geschehen: wie sie den schönen Delphis zuerst gesehen, und wie ihr Herz in Liebe für ihn erglühte. Nichts mehr sah sie vom Auszuge der Jünglinge, »noch«, so läßt sie der Dichter klagen:
»noch wie ich nach Hause gekommen,
. . . Wußt’ ich, aber ein Fieber, ein hitziges setzte mir heftig
Zu; zehen Tage nun lag ich zu Bett und zehen der Nächte.
Merke, woher mir die Liebe gekommen ist, hohe Selene!«
Und als Delphis endlich zum ersten Male über ihre Schwelle trat, da überzog sie Frost und Hitze:
»Aber zu reden vermocht’ ich nicht, nicht auch nur so viel als
Lallend reden im Schlaf aufwimmernde Kinder zur Mutter;
Sondern starr wie die Puppe von Wachs war der blühende Leib mir.
Merke, woher mir die Liebe gekommen ist, hohe Selene.«
Woher sie gekommen ist? Daher, woher sie uns heute kommt! Die Liebe der Kreatur zu ihrem Schöpfer, der Menschheit zur Gottheit sind die erhabenen und doch holden Geschenke des Christenthums. Mit seinem Gebote, den Nächsten zu lieben, schuf es den Begriff der Menschenliebe und der Menschheit überhaupt, der den heidnischen Nationen fremd war, die als fernstes Lebensziel nur ihre Heimathstadt und ihr Vaterland kannten. Freilich hat das Christenthum auch auf die Liebe von Mann und Weib verklärend eingewirkt; aber es ist wohl denkbar, daß ein griechisches Herz ebenso zart empfunden und sehnsüchtig geschlagen habe, als ein christliches. Die tiefere Glut der Leidenschaft ist ohnehin den Alten nicht abzusprechen. Fand die Liebe bei den letzteren aber auch ähnlichen Ausdruck wie bei uns? Wer kennt nicht den schönen Rundgesang:
»Liebe, scherze, trink’ und schwärme Und bekränze Dich mit mir, Härme Dich, wenn ich mich härme Und sei wieder froh mit mir!«
Aber kein Dichter unserer Zeit hat ihn gesungen, er entstammt vielmehr der Dichterin Praxilla, die im fünften Jahrhunderte v. Chr. lebte. Hört man es dem folgenden Rückert’schen Liedchen an, daß es eine Nachbildung von Versen ist, die schon vor der Zeit unsrer Erzählung gesungen worden sind:
»O süße Mutter Ich kann nicht spinnen, Ich kann nicht sitzen Im Stübchen innen Im engen Haus; Es stockt das Rädchen, Es reißt das Fädchen: O, süße Mutter Ich muß hinaus!«
Ich könnte, wäre mir der Raum nicht so knapp zugemessen, vieles Aehnliche mittheilen. Nur Eins sei mir noch zu sagen gestattet. Bei den Alten wie bei uns gab sich das in sehnsüchtiger Liebe schlagende Herz zu gleicher Zeit wärmer und inniger der Natur hin. Der Mond war und ist der Vertraute der Liebenden, und ich möchte gern eine moderne Dichtung kennen lernen, in der der geheimnißvolle Reiz der Sommernacht und die Zauber, die den quellenerfüllten Garten in der Schlummerzeit umwehen, herrlicher geschildert würde, als in folgenden Versen, wiederum der Sappho, von denen Eichendorff gelernt zu haben scheint, und die uns zwingen langsamer zu athmen »kühl bis an’s Herz hinan«.
»Vor der hellen Scheibe des Mondes bergen
Wieder ihren leuchtenden Glanz die Sterne,
Wenn er voll im silbernen Lichte strahlet
Ueber den Erdenkreis.«
und:
»Es plätschert
Durch die Quittenzweige das heil’ge kühle
Wasser, und beim Beben der Blätter fließet
Schlummer hernieder«2.
Diese Worte glaubte ich denen schuldig zu sein, die eine Liebe wie die der Sappho und des Bartja im Alterthume für unmöglich erklärt halben. Daß so zarte Empfindungen in vorchristlicher Zeit noch weit entschiedener als heute zu den Ausnahmen gezählt werden müssen, ist selbstverständlich. Schließlich gesteh’ ich ein, daß ich doch wohl für das besprochene Paar zu warme Farben verwendet habe. Aber warum durfte ich nicht, als ich poetisch gestaltete, die Freiheit des Dichters für mich in Anspruch nehmen?
Wie wenig ich mir diese Freiheit sonst zu Nutzen machte, das sollen die Anmerkungen am Ende eines jeden Bandes beweisen3. Auch erschienen diese nöthig, theils um dem Leser weniger bekannte Namen und Zustände zu erläutern, theils um den Verfasser, den Gelehrten gegenüber, zu rechtfertigen. Möge sich der Laie nicht von ihnen abschrecken lassen. Der Text ist auch ohne Erklärungen für jeden Gebildeten leicht lesbar.
Jena, den 28. November 1888.
Dr. Georg Ebers.
Vorrede zur vierten Auflage
Zwei und ein halbes Jahr nach dem Erscheinen der dritten ist diese vierte Auflage der ägyptischen Königstochter nothwendig geworden. Hinter mir liegt längst die neue Reise an den Nil, zu der ich mich während der Correctur der dritten Edition vorbereitete, und auf die ich wohl mit besonderer Befriedigung zurücksehen darf. Denn während meines Aufenthaltes in Aegypten 1872–73 ließ mich ein freundliches Ungefähr mancherlei Neues finden und darunter einen Schatz von unvergleichlichem Werthe, das große hieratische Manuscript, welches nunmehr in der Leipziger Universitäts-Bibliothek conservirt wird, das meinen Namen trägt und dessen Veröffentlichung jetzt schon vollendet vorliegt.
Der Papyrus Ebers, die zweitgrößte und am besten erhaltene von allen aus dem gesammten ägyptischen Alterthum bis auf uns gekommenen Handschriften, ist im 16. Jahrhundert v. Chr. geschrieben worden und enthält auf 110 Seiten das auch den alexandrinischen Griechen bekannte hermetische Buch über die Arzneimittel der alten Aegypter. Der Gott Toth (Hermes) wird »der Führer« des Arztes genannt und die verschiedenen Schriften und Traktate, aus denen das Buch zusammengesetzt ist, sind von ihm ausgehende Offenbarungen. Es werden in der ehrwürdigen Rolle Diagnosen gestellt, und Heilmittel gegen die inneren und äußeren Krankheiten der meisten Theile des menschlichen Körpers vorgeschlagen. Neben den verordneten Droguen stehen die Zahlen, nach denen sie mit Gewichten zu wägen und mit Hohlmaßen zu messen sind, und als Begleiter der Recepte finden sich die frommen Sprüche verzeichnet, welche der Arzt bei ihrer Bereitung, und während er sie dem Patienten reichte, herzusagen hatte. In der zweiten Zeile der ersten Seite unserer Handschrift heißt es von ihr, sie sei hervorgegangen aus Sais. Ein großer Abschnitt dieses Werkes ist dem Sehorgan gewidmet. Seite 55 Zeile 20 beginnt das Buch von den Augen, welches acht große Seiten füllt. Was wir bisher von der Augenheilkunde des Pharaonenvolks wußten, das waren wir griechischen und römischen Autoren zu entnehmen gezwungen; der erwähnte Abschnitt des Papyrus Ebers ist nun die einzige bis jetzt bekannte ägyptische Quelle, aus der wir über diesen wichtigen Zweig der alten Medicin Belehrung zu schöpfen vermögen.
Alles dies scheint kaum in die Vorrede zu einem historischen Roman zu gehören, und dennoch ist es gerade an dieser Stelle der Erwähnung werth; hat es doch etwas beinahe »Providentielles«, daß es gerade dem Autor der Königstochter, daß es gerade mir vorbehalten blieb, meine Wissenschaft mit dieser Schrift zu beschenken. Der Leser wird unter den in diesem Romane auftretenden Personen einem Augenarzte aus Sais begegnen, der ein Buch über die Krankheiten des Sehorgans verfaßte. Das Schicksal dieser kostbaren Arbeit wirkt bestimmend auf den Verlauf der gesammten Handlung ein. Diese Papyrusrolle des Augenarztes aus Sais, die noch vor Kurzem nur in der Vorstellung des Verfassers und der Leser der Königstochter existirte, ist nunmehr als reales Ding vorhanden. Es ist mir, als es mir diese Rolle heimzubringen gelang, ergangen wie dem Manne, welcher von einem Schatze geträumt hatte, und der ihn am Wege fand, da er ausritt.
An zweiter Stelle würde in dieser Vorrede eine Entgegnung auf die in der Revue des deux mondes Tome VII, 1875 Janvier erschienene Besprechung der ägyptischen Königstochter durch Mr. Jules Soury am Platze sein; aber eine solche ist nicht wohl möglich ohne ein tieferes Eingehen auf die an einer anderen Stelle zu beantwortende, immerhin strittige Frage, ob das Genre des historischen Romans überhaupt berechtigt sei oder nicht. Und doch kann ich nicht umhin, Mr. Soury schon hier mitzutheilen, daß mich die Abfassung der Königstochter von keiner anderen Arbeit abgehalten hat; daß ich sie vielmehr, bevor ich meine akademische Thätigkeit angetreten, im Krankenzimmer geschrieben und durch ihre Schöpfung nicht nur Trost und Freude, sondern auch Gelegenheit gefunden habe, todtes Wissensmaterial für mich und Andere »lebig« zu machen.
Herr Soury sagt, der Roman sei der Todfeind der Geschichte; aber dieser Satz darf ebensowenig zutreffend genannt werden als der andere, den ich dem seinen gegenüber zu stellen berechtigt zu sein glaube: Die Landschaftsmalerei ist die tödtliche Feindin der Botanik. Der historische Roman soll wie jedes andere Kunstwerk zunächst genossen werden. Niemand nehme ihn in die Hand, um aus ihm Geschichte zu erlernen; aber viele Leser, das ist der Wunsch des Autors, mögen sich durch sein Werk zu eigener Forschung, der die Anmerkungen den Weg weisen sollen, anregen lassen; wie denn auch bereits mehrere vortreffliche Kräfte durch die Lektüre der Königstochter ernsten ägyptologischen Studien zugeführt worden sind. Solchen Erfahrungen gegenüber brauch’ ich, obgleich mir Mr. Soury’s geistreiche Ausführungen manches Wahre zu enthalten scheinen, seinen Ausspruch, der historische Roman beeinträchtige die Wissenschaft, nicht auf das vorliegende Werk zu beziehen. –
Leipzig, den 19. April 1875.
Georg Ebers.
Vorrede zur fünften Auflage
Es ist wiederum eine neue Auflage der »Aegyptischen Königstochter« nothwendig geworden und ich widme auch ihr ein eigenes Vorwort, weil der schnelle Fortgang des Drucks es mir leider unmöglich gemacht hat, einige Versehen zu beseitigen, auf welche ich durch die Güte des bekannten Botanikers Professor Paul Ascherson in Berlin, der Aegypten und die Oasen bereiste, aufmerksam gemacht worden bin.
Ich lasse im Garten der Rhodopis Bd. I. S. 5 unter anderen Gewächsen »Mimosen« wachsen; hatte ich sie doch in allen Beschreibungen des Nilthals erwähnt gefunden, war ich doch später oft genug in den Gärten von Alexandria und Kairo durch den lieblichen Duft ihrer goldgelben Blüten erfreut worden. Nun höre ich, daß gerade diese Mimose (Acacia farnesiana) aus dem tropischen Amerika stamme und dem alten Aegypten gewiß fremd gewesen sei. Die Bananen, die ich Bd. I. S. 53 unter anderen ägyptischen Gewächsen erwähne, sind erst durch die Araber aus Indien in das Nilthal eingeführt worden. Die im dritten Bande vorkommenden botanischen Irrthümer war es mir noch zu berichtigen möglich. Schon Hehn’s vortreffliches Buch »Kulturpflanzen und Hausthiere« hatte mich gelehrt, auf solche Dinge zu achten. Theophrast, ein Kleinasiat, gibt die erste Beschreibung eines Citrus und diese beweist, daß er wohl den sogenannten Paradiesapfel, aber nicht unsere Citrone gekannt hat, die ich also unter den im alten Lydien kultivirten Pflanzen nicht nennen darf. Palmen und Birken sind beide in Kleinasien gefunden worden; ich ließ sie aber neben einander wachsen und beging damit einen Verstoß gegen die pflanzengeographische Möglichkeit. Die Birke grünt hier auf dem Hochgebirge, die Palme kommt nach Griesebach (Vegetation der Erde I. S. 319) nur an der Südküste der Halbinsel vor. Die letztgenannten Irrthümer konnten, wie gesagt, in der neuen Auflage verbessert werden.
Natürlich werde ich einem Jeden, der mich auf ähnliche Versehen aufmerksam macht, zu besonderem Danke verpflichtet sein.
Leipzig, den 5 März 1877.
Georg Ebers.
Erster Band
Erstes Kapitel
Der Nil hatte sein Bett verlassen. Weit und breit dehnte sich da, wo sonst üppige Saatfelder und blühende Beete zu sehen waren, eine unermeßliche Wasserfläche. Nur die von Dämmen beschützten Städte mit ihren Riesentempeln und Palästen, die Dächer der Dörfer so wie die Kronen der hochstämmigen Palmen und Akazien überragten den Spiegel der Fluth. Die Zweige der Sykomoren und Platanen hingen in den Wellen, während die hohen Silberpappeln mit aufwärts strebenden Aesten das feuchte Element meiden zu wollen schienen. Der volle Mond war aufgegangen und goß sein mildes Licht über den mit dem westlichen Horizonte verschwimmenden libyschen Höhenzug. Auf dem Spiegel des Wassers schwammen blaue und weiße Lotusblumen. Fledermäuse verschiedener Art schwangen und schnellten sich durch die stille, von dem Dufte der Akazien und Jasminblüthen erfüllte Nachtluft. In den Kronen der Bäume schlummerten wilde Tauben und andere Vögel, während, beschützt von dem Papyrusschilfe und den Nilbohnen, die am Ufer grünten, Pelikane, Störche und Kraniche hockten. Erstere verbargen im Schlafe die langgeschnäbelten Köpfe unter die Flügel und regten sich nicht; die Kraniche aber schraken zusammen, sobald sich ein Ruderschlag oder der Gesang arbeitender Schiffer hören ließ, und spähten, die schlanken Hälse ängstlich wendend, in die Ferne. Kein Lüftchen wehte, und das Spiegelbild des Mondes, welches wie ein silberner Schild auf der Wasserfläche schwamm, bewies, daß der Nil, der die Katarrhakten wild überspringt und an den Riesentempeln von Ober-Aegypten schnell vorbeijagt, da, wo er sich dem Meere in verschiedenen Armen nähert, sein ungestümes Treiben aufgegeben und sich gemessener Ruhe überlassen habe.
In dieser Mondnacht durchschnitt 528 Jahre vor der Geburt des Heilandes eine Barke die beinahe strömungslose kanopische Mündung des Nils. Ein ägyptischer Mann saß auf dem hohen Dache des Hinterdecks und lenkte von dort aus den langen Stab des Steuerruders4. In dem Kahne selbst versahen halbnackte Ruderknechte singend ihren Dienst. Unter dem offenen, einer hölzernen Laube gleichenden Kajütenhause lagen zwei Männer auf niedrigen Polstern. Beide waren augenscheinlich keine Aegypter. Selbst das Mondlicht ließ ihre griechische Herkunft erkennen. Der Aeltere, ein ungewöhnlich großer und kräftiger Mann im Beginn der sechziger Jahre, dessen dichte graue Locken bis auf den gedrungenen Hals ohne sonderliche Ordnung herniederfielen, war mit einem schlichten Mantel bekleidet und schaute düster in den Strom, während sein etwa zwanzig Jahre jüngerer Gefährte, ein schlanker und zierlich gebauter Mann, bald zum Himmel hinaufblickte, bald dem Steuermann ein Wort zurief, bald seine schöne purpurblaue Chlamis5 in neue Falten warf, bald sich mit seinen duftenden braunen Locken oder dem zart gekräuselten Barte zu schaffen machte.
Das Fahrzeug war vor etwa einer halben Stunde aus Naukratis6, dem einzigen hellenischen Hafenplatze im damaligen Aegypten, abgesegelt. Der graue, düstere Mann hatte auf der ganzen Fahrt kein Wort gesprochen, und der andere, jüngere, ihn seinen Gedanken überlassen. Als sich jetzt die Barke dem Ufer näherte, richtete sich der unruhige Fahrgast auf und rief seinem Genossen zu: »Gleich werden wir am Ziele sein, Aristomachus. Dort drüben, links, das freundliche Haus in dem Garten voller Palmen, der die überschwemmten Fluren überragt7, ist die Wohnung meiner Freundin Rhodopis. Ihr verstorbener Gatte Charaxus hat es bauen lassen, und all’ ihre Freunde, ja selbst der König, beeifern sich, es in jedem Jahre mit neuen Verschönerungen zu versehen. Unnöthige Mühe! Dieses Hauses beste Zierde wird, und wenn sie alle Schätze der Welt hineintragen wollten, seine herrliche Bewohnerin bleiben!«
Der Alte richtete sich auf, warf einen flüchtigen Blick auf das Gebäude, ordnete mit der Hand seinen dichten grauen Bart, der Kinn und Wangen, aber nicht die Lippen8 umgab, und fragte kurz: »Welches Wesen, Phanes, machst Du von dieser Rhodopis? Seit wann preisen die Athener alte Weiber?« Der also Angeredete lächelte und erwiederte selbstgefällig: »Ich glaube, daß ich mich auf die Menschen, und ganz besonders auf die Frauen wohl verstehe, versichere Dich aber nochmals, daß ich nichts Edleres in ganz Aegypten kenne, wie diese Greisin. Wenn Du sie und ihre holde Enkelin gesehen und Deine Lieblingsweisen von einem Chor vortrefflich eingeübter Sklavinnen9 gehört haben wirst, so dankst Du mir sicher für meine Führung!« – »Dennoch,« antwortete mit ernster Stimme der Spartaner, »wäre ich Dir nicht gefolgt, wenn ich nicht den Delphier Phryxus allhier zu treffen hoffte.«
»Du findest ihn. Auch erwarte ich, daß Dir der Gesang wohlthun und Dich Deinem düsteren Sinnen entreißen wird.« Aristomachus schüttelte verneinend das Haupt und sagte: »Dich, leichtblütigen Athener, mag der Gesang der Heimath ermuntern; mir aber wird es, wenn ich die Lieder des Alkman10 vernehme, ergehen, wie in meinen wachend durchträumten Nächten. Mein Sehnen wird nicht gestillt, es wird verdoppelt werden.«
»Glaubst Du denn,« fragte Phanes, »daß ich mich nicht nach meinem geliebten Athen, den Spielplätzen meiner Jugend und dem lebendigen Treiben des Marktes zurücksehne? Wahrlich, das Brod der Verbannung will auch mir nicht munden, doch wird es durch Umgang wie den, welchen dieses Haus bietet, schmackhafter, und wenn meine theuren hellenischen Lieder, so wunderbar schön gesungen, zu meinem Ohre dringen, dann baut sich in meinem Geiste die Heimath auf; ich sehe ihre Oel- und Fichtenhaine, ihre kalten, smaragdnen Flüsse, ihr blaues Meer, ihre schimmernden Städte, ihre schneeigen Gipfel und Marmorhallen, und eine bittersüße Thräne rinnt mir in den Bart, wenn die Töne schweigen und ich mir sagen muß, daß ich in Aegypten verweile, diesem einförmigen, heißen, wunderlichen Lande, welches ich, Dank sei den Göttern, bald verlassen werde. Aber, Aristomachus, wirst Du die Oasen der Wüste umgehen, weil Du Dich doch später wieder durch Sand und Wassermangel winden mußt? Willst Du das Glück einer Stunde fliehen, weil trübe Tage Deiner warten? – Halt, da wären wir! Mach’ ein fröhliches Gesicht, mein Freund, denn es ziemt sich nicht, in den Tempel der Charitinnen11 traurigen Muthes zu treten.«
Die Barke landete bei diesen Worten an der vom Nil bespülten Mauer des Gartens. Leichten Sprunges verließ der Athener, schweren aber festen Schrittes der Spartaner das Fahrzeug. Aristomachus trug einen Stelzfuß; dennoch wanderte er so kräftigen Schrittes neben dem leichtfüßigen Phanes dahin, daß man denken konnte, er sei mit dem hölzernen Beine zur Welt gekommen.
Im Garten der Rhodopis duftete, blühte und schwirrte es wie in einer Mährchennacht. Akanthus, gelbe Mimosen, Hecken von Schneeballen, Jasmin und Flieder, Rosen und Goldregenbüsche drängten sich aneinander, hohe Palmen, Akazien und Balsambäume überragten die Sträucher, große Fledermäuse mit zarten Flügeln wiegten sich über dem Ganzen, und auf dem Strome tönte Gesang und Gelächter.
Ein Aegypter hatte diesen Garten angelegt, und die Erbauer der Pyramiden waren von Alters her als Gartenkünstler hoch berühmt12. Sie verstanden es, die Beete sauber abzustecken, regelmäßige Baum- und Sträuchergruppen zu pflanzen, Wasserleitungen und Springbrunnen, Lauben und Lusthäuschen anzulegen, ja sogar die Wege mit künstlich beschnittenen Hecken zu umzäunen, und Goldfischzucht in steinernen Becken zu treiben.
Phanes blieb an der Pforte der Gartenmauer stehen, schaute sich aufmerksam um und horchte in die Luft hinaus, dann schüttelte er den Kopf und sagte. »Ich begreife nicht, was dieß zu bedeuten hat. Ich höre keine Stimmen, sehe kein Licht, alle Barken sind fort, und dennoch flattert die Fahne auf der bunten Stange neben den Obelisken zu beiden Seiten der Pforte13. Rhodopis muß abwesend sein. Sollte man vergessen haben? . . . . .« Er hatte nicht ausgeredet, als er von einer tiefen Stimme unterbrochen wurde: »Ach, der Oberst der Leibwache!«
»Fröhlichen Abend, Knakias!« rief Phanes, den auf ihn zutretenden Greis mit Freundlichkeit begrüßend. »Wie kommt es, daß dieser Garten so still ist wie eine ägyptische Grabkammer, während ich doch die Fahne des Empfanges flattern sehe? Seit wann weht das weiße Tuch vergeblich nach Gästen?«
»Seit wann?« erwiederte lächelnd der alte Sklave der Rhodopis. »So lange die Parcen meine Herrin gnädig verschonen, ist auch die alte Fahne sicher, so viele Gäste herbei zu wehen, als dieses Haus zu fassen vermag. Rhodopis ist nicht daheim; muß aber bald wiederkommen. Der Abend war so schön, daß sie sich mit allen Gästen zu einer Lustfahrt auf dem Nil entschlossen hat. Vor zwei Stunden, beim Sonnenuntergange, sind sie abgesegelt, und die Mahlzeit steht schon bereit14. Sie können nicht mehr lange ausbleiben. Ich bitte Dich, Phanes, sei nicht ungeduldig, und folge mir in’s Haus. Rhodopis würde mir nicht verzeihen, wenn ich einen so lieben Gast nicht zum Verweilen nöthigen wollte. Dich aber, Fremdling,« fuhr er, den Spartaner anredend, fort, »bitte ich herzlich zu verweilen, denn als Freund ihres Freundes wirst auch Du meiner Herrin hoch willkommen sein.«
Die beiden Griechen folgten dem Diener und ließen sich in einer Laube nieder.
Aristomachus betrachtete seine vom Monde hell erleuchtete Umgebung und sprach: »Erkläre mir, Phanes, welchem Glücke diese Rhodopis, eine frühere Sklavin und Hetäre15, es verdankt, daß sie wie eine Königin wohnt und ihre Gäste fürstlich zu empfangen vermag?«
»Diese Frage erwartete ich längst,« erwiederte der Athener, »es freut mich, daß ich Dich, ehe Du in das Haus dieses Weibes trittst, mit ihrer Vergangenheit bekannt machen darf. Während der Nilfahrt wollte ich Dir keine Erzählung aufdrängen. Dieser alte Strom zwingt mit unbegreiflicher Macht zum Schweigen und zur stillen Beschaulichkeit. Als ich, wie Du soeben, zum erstenmal eine nächtliche Nilfahrt machte, war auch mir die sonst so schnelle Zunge wie gelähmt.«
»Ich danke Dir,« antwortete der Spartaner. »Als ich den hundertfünfzig Jahre alten Priester Epimenides16 von Knossus auf Kreta zum erstenmale sah, überkam mich ein seltsamer Schauder, seines Alters und seiner Heiligkeit wegen; wie viel älter, wie viel heiliger aber ist dieser greisenhafte Strom ›Aigyptos‹17. Wer möchte sich seinem Zauber entziehen? Doch bitte ich Dich, mir von Rhodopis zu erzählen!«
»Rhodopis,« begann Phanes, »ward als kleines Kind, da sie eben am thracischen Strande mit ihren Gefährtinnen spielte, von phönizischen Seefahrern geraubt und nach Samos gebracht, woselbst sie Iadmon, ein Geomore18 kaufte. Das Mägdlein ward täglich schöner, anmuthiger und klüger, und bald von Allen, die es kannten, geliebt und bewundert.
»Aesop19, der Thierfabeldichter, welcher damals gleichfalls im Sklavendienste des Iadmon verweilte, freute sich ganz besonders an der Liebenswürdigkeit und dem Geiste des Kindes. Er belehrte es in allen Dingen und sorgte für Rhodopis wie ein Pädonomus20, den wir Athener den Knaben halten. Der gute Lehrer fand eine lenksame, schnell begreifende Schülerin, und die kleine Sklavin redete, sang und musicirte in kurzer Zeit besser und anmuthiger, als die Söhne des Iadmon, welche auf’s Sorgfältigste erzogen wurden. In ihrem vierzehnten Jahre war Rhodopis so schön und vollendet, daß die eifersüchtige Gattin des Iadmon das Mädchen nicht länger in ihrem Hause duldete und der Samier seinen Liebling schweren Herzens an einen gewissen Xanthus verkaufen mußte. Zu Samos herrschte damals noch der wenig bemittelte Adel. Wäre Polykrates schon am Ruder gewesen, so hätte sich Xanthus um keinen Käufer zu grämen brauchen. Diese Tyrannen füllen ihre Schatzkammern, wie die Elstern ihre Nester! So zog er denn mit seinem Kleinode nach Naukratis, und gewann hier durch die Reize seiner Sklavin große Summen. Damals erlebte Rhodopis drei Jahre der tiefsten Erniedrigung, deren sie mit Schauder gedenkt.
»Als endlich der Ruf ihrer Schönheit in ganz Hellas bekannt geworden war, und Fremde aus weiter Ferne nur um ihretwillen nach Naukratis kamen21, geschah es, daß das Volk von Lesbos seinen Adel vertrieb und den weisen Pittakus zum Herrscher wählte. Die vornehmsten Familien mußten Lesbos verlassen, und flohen theils nach Sizilien, theils nach dem griechischen Italien, theils nach Aegypten. Alcaeus22, der größeste Dichter seiner Zeit, und Charaxus, der Bruder jener Sappho23, deren Oden zu erlernen der letzte Wunsch unseres Solon war, kamen hierher nach Naukratis, welches schon lange als Stapelplatz des ägyptischen Verkehrs mit der ganzen übrigen Welt blühte. Charaxus sah Rhodopis, und liebte sie bald so glühend, daß er eine ungeheure Summe hingab, um sie dem feilschenden Xanthus, welcher in die Heimath zurückzukehren wünschte, abzukaufen. Sappho verspottete den Bruder dieses Kaufes wegen mit beißenden Versen; Alcaeus aber gab dem Charaxus Recht, und besang Rhodopis in glühenden Liedern.
»Der Bruder der Dichterin, der sich früher unter den Fremden in Naukratis verloren hatte, ward plötzlich durch Rhodopis berühmt. In seinem Hause versammelten sich um ihretwillen alle Fremden, und überhäuften sie mit Geschenken. Der König Hophra26, welcher viel von ihrer Schönheit und Klugheit gehört hatte, ließ sie nach Memphis kommen, und wollte sie dem Charaxus abkaufen; dieser aber hatte ihr längst im Geheimen die Freiheit geschenkt und liebte sie zu sehr, um sich von ihr trennen zu mögen. Andererseits liebte auch Rhodopis den schönen Lesbier, und verblieb gerne bei ihm, trotz der glänzenden Anerbietungen, welche ihr von allen Seiten gemacht wurden. Endlich machte Charaxus das wunderbare Weib zu seiner rechtmäßigen Gattin, und blieb mit ihr und ihrem Töchterchen Klëis in Naukratis, bis Pittakus die Verbannten in die Heimath zurück berief.
»Nun begab er sich mit seiner Gemahlin nach Lesbos. Auf der Reise dorthin erkrankte er und starb bald nach seiner Ankunft in Mitylene. Sappho, welche ihren Bruder wegen seiner Mißheirath verspottet hatte, wurde schnell zur begeisterten Bewundererin der schönen Wittwe, welche sie, mit ihrem Freunde Alcaeus wetteifernd, in leidenschaftlichen Liedern besang.
»Nach dem Tode der Dichterin zog Rhodopis mit ihrem Töchterlein nach Naukratis zurück, und wurde hier gleich einer Göttin empfangen. Amasis27, der jetzige König von Aegypten, hatte sich unterdessen des Thrones der Pharaonen bemächtigt, und behauptete ihn mit Hülfe der Soldaten, aus deren Kaste er stammte. Da sein Vorgänger Hophra durch seine Vorliebe für die Griechen und den Verkehr mit den allen Aegyptern verhaßten Fremden seinen Sturz beschleunigt und namentlich die Priester und Krieger zu offener Empörung veranlaßt hatte, so hoffte man mit Sicherheit, daß Amasis, wie in alten Zeiten, das Land den Fremden absperren28, die hellenischen Söldner entlassen und statt auf griechische Rathschläge, auf die Befehle der Priester hören werde. Nun, Du siehst ja selbst, daß sich die klugen Aegypter in ihrer Königswahl betrogen haben und aus der Scylla in die Charybdis gefallen sind. Wenn Hophra ein Freund der Griechen war, so können wir Amasis unsern Liebhaber nennen. Die Aegypter, und vor allen die Priester und Krieger, speien Feuer und Flamme und möchten uns am liebsten sammt und sonders hinschlachten, wie Odysseus die Freier, die sein Gut verpraßten. Um die Krieger bekümmert sich der König nicht viel, weil er weiß, was jene und was wir ihm leisten; auf die Priester muß er jedoch immerhin Rücksicht nehmen, denn von einer Seite haben sie unbegrenzten Einfluß auf das Volk, dann aber hängt der König auch mehr, als er uns gegenüber eingesteht, an jener abgeschmackten Religion29, welche in diesem seltsamen30 Lande seit Jahrtausenden unverändert fortbesteht, und deßhalb ihren Bekennern doppelt heilig erscheint. Diese Priester machen dem Amasis das Leben schwer, verfolgen und schaden uns wie und wo sie können, ja ich wäre längst ein todter Mann, wenn der König nicht seine schützende Hand über mich ausgebreitet hätte. Doch wohin gerathe ich! Rhodopis ward also zu Naukratis mit offenen Armen empfangen und von Amasis, der sie kennen lernte, mit Gunstbezeugungen überhäuft. Ihre Tochter Klëis, welche, wie jetzt Sappho, niemals die allabendlichen Zusammenkünfte in ihrem Hause theilen durfte, und beinahe noch strenger als die anderen Jungfrauen von Naukratis erzogen wurde, heirathete Glaukus, einen reichen phocäischen Handelsherrn aus edlem Hause, der seine Vaterstadt gegen die Perser tapfer vertheidigt hatte, und folgte demselben nach dem neu gegründeten Massalia31, an der celtischen Küste. Die jungen Leute erlagen dem dortigen Klima, nachdem ihnen eine Tochter, Sappho, geboren war. Rhodopis unternahm selbst die lange Fahrt gen Westen, holte die junge Waise ab, nahm sie zu sich in’s Haus, ließ sie auf’s Sorgfältigste erziehen, und verbietet ihr jetzt, da sie erwachsen ist, die Gesellschaft der Männer, denn sie fühlt die Flecken ihrer frühesten Jugend so tief, daß sie ihre Enkelin, und das ist bei Sappho keine schwere Aufgabe, entfernter von jeder Berührung mit unserem Geschlecht hält, als es die ägyptische Sitte gestatten würde. Meine Freundin selbst bedarf des geselligen Verkehrs so nothwendig, wie ein Fisch des Wassers, wie ein Vogel der Luft. Alle Fremden besuchen sie, und wer ihre Gastfreundschaft einmal gekostet hat, der wird, wenn es ihm seine Zeit erlaubt, niemals fehlen, so oft die Fahne einen Empfangsabend verkündet. Jeder Hellene von irgend welcher Bedeutung besucht dieses Haus, denn hier wird berathen, wie man dem Hasse der Priester begegnen könne, und wie der König zu dem oder jenem zu bereden sei. Hier trifft man stets die neuesten Nachrichten aus der Heimath und der ganzen übrigen Welt, hier findet der Verfolgte ein unantastbares Asyl, denn der König hat seiner Freundin einen Freibrief gegen alle Belästigungen der Sicherheitsbehörde32 gegeben hier hört man die Sprache und Lieder der Heimath, hier wird berathen, wie Hellas von der wachsenden Alleinherrschaft33 befreit werden kann; dieses Haus ist mit einem Worte der Knotenpunkt aller hellenischen Interessen in Aegypten und von höherer politischer Bedeutung, als selbst das Hellenion, die hiesige Tempel- und Handelsgemeinschaft34. In wenigen Minuten wirst Du die seltene Großmutter, und vielleicht auch, wenn wir allein bleiben, die Enkelin sehen, und schnell begreifen, daß diese Menschen keinem Glücke, sondern ihrer Trefflichkeit Alles verdanken. Ha, da sind sie! Jetzt gehen sie dem Hause zu. – Hörst du die Sklavinnen singen? Jetzt treten sie ein. Laß sie sich erst niederlassen, dann folge mir, und beim Abschiede will ich Dich fragen, ob Du bereust, mit mir gegangen zu sein, und ob Rhodopis nicht eher einer Königin gleicht, als einer freigelassenen Sklavin.«
Das Haus der Rhodopis35 war im griechischen Stil erbaut. Die Außenseite des einstöckigen länglichen Gebäudes mußte nach unseren Begriffen durchaus einfach genannt werden, während die innere Einrichtung hellenische Formenschönheit mit ägyptischer Farbenpracht vereinte. Durch die weite Hauptthüre kam man in die Hausflur36, an deren linker Seite ein großer Speisesaal seine Fensteröffnungen dem Strome zukehrte. Diesem gegenüber lag die Küche, ein Raum, welcher sich nur in den Häusern reicher Hellenen vorfand, während die ärmeren ihre Speisen an dem Herde im Vorzimmer zu bereiten pflegten. Die Empfangshalle lag an der Mündung der Hausflur, hatte die Gestalt eines Quadrats und war rings von einem Säulengange umgeben, von welchem viele Gemächer37 ausgingen. Inmitten dieser Halle, dem Aufenthaltsorte für die Männer38, brannte auf einem altarartigen Herde von reicher äginetischer Metallarbeit39 das Feuer des Hauses.
Bei Tage erhielt dieser Raum sein Licht mittels der Oeffnungen im Dache, durch welche zu gleicher Zeit der Rauch des Herdfeuers seinen Ausgang fand. Ein der Hausflur gegenüber liegender Gang, der durch eine feste Thür40 verschlossen war, führte in das große, nur von drei Seiten mit Säulen umgebene Frauengemach41, in welchem sich die weiblichen Hausbewohner aufzuhalten pflegten, wenn sie nicht in den bei der sogenannten Garten- oder Hinterthüre42 gelegenen Zimmern beim Spinnrocken oder Webestuhle saßen. Zwischen diesen und den Gemächern, welche das Frauengemach zur Linken und Rechten als Wirthschaftsräume umgaben, lagen die Schlafzimmer43, in denen zu gleicher Zeit die Schätze des Hauses aufbewahrt wurden. Die Wände des Männersaales waren mit röthlich brauner Farbe bemalt, von der sich weiße Marmorbildwerke, Geschenke eines Künstlers von Chios44, in scharfen Linien abhoben. Den Fußboden bedeckten schwere Teppiche aus Sardes. Den Säulen entlang zogen sich niedrige, mit Pardelfell überzogene Polster, während in der Nähe des kunstreichen Herdes seltsam geformte ägyptische Lehnsessel und fein geschnitzte Tischchen von Thyaholz45 standen, auf denen allerlei musikalische Instrumente, Flöten, Kithara und Phormix lagen. An den Wänden hingen zahlreiche, mit Kikiöl46 gefüllte Lampen in verschiedenen Formen. Diese stellten einen feuerspeienden Delphin, jene ein seltsam geflügeltes Ungeheuer, dessen Rachen eine Flamme ausströmte, dar. Das von ihnen ausgehende Licht verschmolz sich zu schöner Wirkung mit dem Feuer des Herdes.
In dieser Halle standen einige Männer von verschiedenem Aussehen und in verschiedenen Trachten. Ein Syrer aus Tyrus in langem rosinfarbenem Gewande unterhielt sich lebhaft mit einem Manne, dessen scharf geschnittene Züge und krauses schwarzes Haar den Israeliten erkennen ließen. Er war aus seiner Heimath nach Aegypten gekommen, um für den König von Juda, Serubabel, ägyptische Pferde und Wagen, die berühmtesten in jener Zeit, einzukaufen47. Drei Griechen aus Kleinasien in den kostbaren faltenreichen Gewändern ihrer Heimath Milet, standen neben ihm und führten ernste Gespräche mit Phryxus, dem schlichtgekleideten Abgesandten der Stadt Delphi, welcher Aegypten besuchte, um Gelder für den Apollotempel zu sammeln. Das alte Pythische Heiligthum war vor zehn Jahren ein Raub der Flammen geworden; jetzt galt es ein neues, schöneres aufzuführen48.
Die Milesier, Schüler des Anaximander und Anaximenes49, befanden sich am Nil, um zu Heliopolis Astronomie und ägyptische Weisheit zu studiren.
Der Dritte war ein reicher Kaufmann und Schiffsherr, Namens Theopompus, welcher sich zu Naukratis niedergelassen hatte. Rhodopis selbst unterhielt sich lebhaft mit zwei Griechen aus Samos, dem vielberühmten Baumeister, Metallgießer, Bildhauer und Goldschmied Theodorus50 und dem Jambendichter Ibykus aus Rhegium51, welche den Hof des Polykrates auf einige Wochen verlassen hatten, um Aegypten kennen zu lernen und dem Könige Geschenke ihres Herrn zu überbringen. Dicht neben dem Herde lag ein wohlbeleibter Mann mit starken sinnlichen Zügen, Philoinus aus Sybaris52, lang ausgestreckt auf dem bunten Pelzüberzuge eines zweisitzigen Stuhls, und spielte mit seinen duftenden, golddurchflochtenen Locken und den goldenen Ketten, die von seinem Halse auf das saffrangelbe Gewand hernieder fielen, welches bis an seine Füße reichte.
Rhodopis hatte für Jeden ein freundliches Wort: jetzt aber sprach sie ausschließlich zu den berühmten Samiern. Sie unterhielt sich mit ihnen über Kunst und Poesie.
Die Augen der Thracierin glühten im Feuer der Jugend, ihre hohe Gestalt war voll und ungebeugt, das graue Haar schlang sich noch immer in vollen Wogen um das schön geformte Haupt, und schmiegte sich am Hinterkopf in ein Netz von zartem Goldgeflechte. Die hohe Stirn war mit einem leuchtenden Diademe geschmückt.
Das edle griechische Angesicht erschien bleich, aber schön und faltenlos, trotz seines hohen Alters; ja der kleine, immer noch wohlgeformte Mund, die großen, sinnigen und milden Augen, die edle Stirn und Nase dieses Weibes konnten einer Jungfrau zur Zier gereichen.
Man mußte Rhodopis für jünger halten, als sie wirklich war, und dennoch verläugnete sie die Greisin keineswegs. Aus jeder ihrer Bewegungen sprach matronenhafte Würde, und ihre Anmuth war nicht die der Jugend, welche zu gefallen sucht, sondern die des Alters, die sich gefällig erweisen will, welche Rücksichten nimmt und Rücksichten verlangt.
Jetzt zeigten sich die uns bekannten Männer in der Halle. Jedes Auge wandte sich ihnen zu, und als Phanes, seinen Freund an der Hand führend, eintrat, bewillkommnete man ihn auf’s Herzlichste; einer der Milesier aber rief:
»Wußt’ ich doch nicht, was uns fehlte! Jetzt ist mir’s auf einmal klar; ohne Phanes gibt es keine Fröhlichkeit!«
Philoinus der Sybarit erhob jetzt seine tiefe Stimme und rief, ohne sich in seiner Ruhe stören zu lassen: »Die Fröhlichkeit ist ein schönes Ding, und wenn Du sie mitbringst, so sei auch mir willkommen, Athener!«
»Mir aber,« sprach Rhodopis, auf die neuen Gäste zutretend, »seid herzlich gegrüßt, wenn ihr fröhlich seid, und nicht minder willkommen, wenn euch ein Kummer drückt; kenne ich doch keine größere Freude, als die Falten auf der Stirn eines Freundes zu glätten. Auch Dich, Spartaner, nenne ich ›Freund‹, denn also heiß’ ich Jeden, der meinen Freunden lieb ist.«
Aristomachus verneigte sich schweigend; der Athener aber rief, sich halb an Rhodopis, halb an den Sybariten wendend: »Wohl denn, meine Lieben, so kann ich euch beide befriedigen. Du, Rhodopis, sollst Gelegenheit haben, mich, Deinen Freund, zu trösten, denn gar bald werde ich Dich und Dein liebes Hans verlassen müssen; Du aber, Sybarit, wirst Dich an meiner Fröhlichkeit ergötzen, denn endlich werde ich mein Hellas wiedersehen, und diese goldne Mäusefalle von einem Lande, wenn auch unfreiwillig, verlassen!«
»Du gehst fort? Du bist entlassen worden? Wohin gedenkst Du zu reisen?« fragte man von allen Seiten.
»Geduld! Geduld! Ihr Freunde,« rief Phanes, »ich muß euch eine lange Geschichte erzählen, die ich bis zum Schmause aufbewahren will. – Nebenbei gesagt, liebste Freundin, ist mein Hunger fast eben so groß, wie mein Kummer, euch verlassen zu müssen.«
»Hunger ist ein schönes Ding,« philosophirte der Sybarit, »wenn man einer guten Mahlzeit entgegensieht.«
»Sei unbesorgt, Philoinus,« antwortete Rhodopis; »ich habe dem Koche befohlen, sein Möglichstes zu thun, und ihm mitgetheilt, daß der größeste Feinschmecker aus der üppigsten Stadt in der ganzen Welt, daß ein Sybarit, daß Philoinus über seine zarten Gerichte strenges Gericht halten werde. Geh’, Knakias, und sage, man solle anrichten! Seid ihr jetzt zufrieden, ihr ungeduldigen Herren? Arger Phanes; mir hast Du mit Deiner Trauerkunde die Mahlzeit verdorben!«
Der Athener verneigte sich; der Sybarit aber philosophirte abermals: »Zufriedenheit ist ein schönes Ding, wenn man die Mittel hat, all’ seine Wünsche zu befriedigen; auch danke ich Dir, Rhodopis, für die Würdigung, welche Du meiner unvergleichlichen Heimath angedeihen läßt. Was sagt Anakreon?53
›Der heutige Tag liegt mir am Herzen,
Wer weiß, was uns der nächste bringt,
Drum flieht den Gram, verbannt die Schmerzen,
Und spielt das Würfelspiel und trinkt! – –‹
»He! Ibykus, hab’ ich Deinen Freund, der mit Dir an der Tafel des Polykrates schmaust, richtig citirt? Ich sage Dir, daß, wenn Anakreon auch bessere Verse macht als ich, meine Wenigkeit sich dafür doch nicht schlechter auf’s Leben versteht, wie der große Lebenskünstler. Er hat in allen seinen Liedern kein Lob auf’s Essen, und ist denn das Essen nicht wichtiger, als das Spielen und Lieben, obgleich diese beiden Tätigkeiten – ich meine Spielen und Lieben – mir auch recht theuer sind? Ohne Essen müßt’ ich sterben, ohne Spiel und Liebe kann ich schon, wenn auch nur kümmerlich, fortbestehen.«
Der Sybarit brach, zufrieden mit seinem schalen Witze, in ein lautes Gelächter aus; der Spartaner aber wandte sich, während man in ähnlicher Weise fortplauderte, an den Delphier Phryxus, zog ihn in eine Ecke und fragte ihn, seiner gemessenen Art vergessend, in großer Aufregung, ob er ihm die lang ersehnte Antwort des Orakels mitbringe? Das ernste Gesicht des Delphiers ward freundlicher; er griff in die Brustfalten seines Chiton54 und holte ein kleines Röllchen von pergamentartigem Schafleder hervor, auf dem mehrere Zeilen geschrieben waren.
Die Hände des starken und tapferen Spartaners zitterten, als er nach dem Röllchen griff, und nachdem er es geöffnet, saugten sich seine Blicke an die Schriftzüge an, die es bedeckten. So stand er kurze Zeit; dann schüttelte er mißmuthig die grauen Locken, gab Phryxus die Rolle zurück und sagte:
»Wir Spartaner lernen andere Künste, als Lesen und Schreiben. Wenn Du kannst, so lies mir vor, was Pythia sagt.«
Der Delphier überflog die Schrift und erwiederte: »Freue Dich! Loxias55 verheißt Dir eine glückliche Heimkehr; höre, was Dir die Priesterin verkündet:
›Wenn einst die reisige Schaar von schneeigen Bergen herabsteigt
Zu den Gefilden des Stroms, welcher die Ebne benetzt,
Führt Dich der zaudernde Kahn herab zu jenem Gefilde,
Welches dem irrenden Fuß heimischen Frieden gewährt;
Wenn einst die reisige Schaar von schneeigen Bergen herabsteigt,
Schenkt Dir die richtende Fünf, was sie Dir lange versagt.‹«
Gespannten Ohres lauschte der Spartaner diesen Worten. Zum zweiten Male ließ er sich den Spruch des Orakels vorlesen, dann wiederholte er ihn aus dem Gedächtnisse, dankte Phryxus, und steckte das Röllchen zu sich.
Der Delphier mischte sich in das allgemeine Gespräch; der Spartaner aber murmelte den Spruch des Orakels unaufhörlich vor sich hin, um ihn ja nicht zu vergessen, und bemühte sich, die rätselhaften Worte zu deuten.
Zweites Kapitel
Die Flügelthüren des Speisesaales öffneten sich. An jeder Seite des Eingangs stand ein schöner, blondgelockter Knabe, mit Myrtenkränzen in der Hand; in der Mitte des Saales erhob sich ein großer, niedriger, glänzend polirter Tisch, an dessen Seiten purpurrothe Polster die Gäste zu bequemer Rast einluden56.
Auf der Tafel prangten reiche Blumensträuße. Große Braten, Gläser und Schalen voller Datteln, Feigen, Granatäpfel, Melonen und Weintrauben standen neben kleinen silbernen Bienenkörben voller Honig; zarter Käse von der Insel Trinakria57 lag auf getriebenen kupfernen Tellern, und in der Mitte des Tisches stand ein silberner, einem Altar gleichender Tafelaufsatz, der rings mit Myrten und Rosenkränzen umwunden war, und von dessen Spitze süße Räucherungsdüfte aufstiegen.
Am äußersten Ende des Tisches glänzte das silberne Mischgefäß58, ein herrliches äginetisches Werk, dessen gekrümmte Henkel zwei Giganten darstellten, die unter der Last der Schale, welche sie trugen, zusammenzubrechen schienen. Dieser Mischkrug war, wie der Altar in der Mitte des Tisches, mit Blumen umwunden, und auch um jeden Becher59 schlang sich ein Rosen- oder Myrtenkranz.
Rosenblätter waren in dem ganzen Zimmer umhergestreut60, an dessen glatten Wänden von weißem Stuck viele Lampen hingen.
Kaum hatte man sich auf die Polster niedergelegt, so erschienen die blonden Knaben, umwanden die Häupter und Schultern der Schmausenden mit Myrten- und Epheukränzen, und wuschen ihre Füße in silbernen Becken61. Als der Vorschneider schon die ersten Braten, um sie zu zerlegen, vom Tische genommen hatte, machte sich der Sybarit noch immer mit den Knaben zu schaffen, und ließ sich, obgleich er schon nach allen Wohlgerüchen Arabiens duftete, förmlich in Rosen und Myrten einwickeln; nachdem jedoch das erste Gericht, Thunfische mit Senfbrühe62, aufgetragen worden war, vergaß er aller Nebendinge und beschäftigte sich ausschließlich mit dem Genusse der trefflichen Speisen. Rhodopis saß auf einem Armstuhle an der Spitze der Tafel neben dem Mischkruge, und leitete sowohl die Unterhaltung, als auch die aufwartenden Sklaven63.
Mit einem gewissen Stolze sah sie auf ihre fröhlichen Gäste, und schien sich mit jedem ausschließlich zu beschäftigen, indem sie sich bald bei dem Delphier nach dem Erfolge seiner Sammlungen erkundigte, bald den Sybariten fragte, ob ihm die Werke ihres Koches behagten, bald dem Ibykus lauschte, welcher erzählte, daß Phrynichus von Athen die religiösen Schauspiele des Thespis von Ikaria in’s bürgerliche Leben gezogen habe, und mit Chören, Sprechern und Gegensprechern ganze Geschichten aus der Vorzeit aufführen64 lasse.
Dann wandte sie sich an den Spartaner und sagte ihm, daß er der Einzige sei, bei dem sie sich nicht wegen der Einfachheit ihres Gastmahls, wohl aber wegen der Ueppigkeit desselben zu entschuldigen habe. Wenn er nächstens wiederkomme, solle ihm ihr Sklave Knakias, der sich rühme, als entwichener spartanischer Helot65, eine köstliche Blutsuppe kochen zu können (bei diesen Worten schauderte der Sybarit), eine echt lacedämonische Mahlzeit bereiten.
Als die Gäste gesättigt waren, wuschen sie sich von Neuem die Hände. Dann wurde das Speisegeschirr abgeräumt, der Fußboden gesäubert, und Wein und Wasser in den Mischkessel gegossen. Endlich66 wandte sich Rhodopis, nachdem sie sich überzeugt hatte, daß Alles im besten Gange sei, an den mit den Milesiern streitenden Phanes und sagte:
»Edler Freund! Wir haben jetzt unsere Ungeduld so lange bemeistert, daß es wohl Deine Pflicht wäre, uns mitzutheilen, welches schlimme Ungefähr Dich aus Aegypten und unserem Kreise zu entreißen droht. Mit leichtem Sinne, den die Götter euch Ioniern allen als köstliches Geschenk bei der Geburt zu spenden pflegen, magst Du Dich von uns und diesem Lande trennen; – wir aber werden Deiner lange schmerzlich gedenken, denn ich kenne keinen größeren Verlust, als den eines seit Jahren treu bewährten Freundes. Einige von uns haben auch zu lange am Nil gelebt, um nicht ein wenig von dem unwandelbar beständigen Sinne der Aegypter angenommen zu haben! Du lächelst; und dennoch glaube ich zu wissen, daß Du, obgleich Du Dich schon lange nach Hellas sehnest, nicht ohne alles Bedauern von uns scheiden wirst. Du gibst mir Recht? Wohl, so erzähle uns denn, warum Du Aegypten verlassen mußt oder willst, damit wir überlegen können, ob es nicht möglich sei, Deine Verweisung vom Hofe rückgängig zu machen, und Dich für uns zu erhalten.«