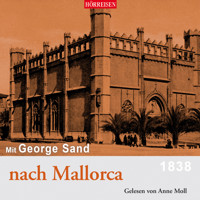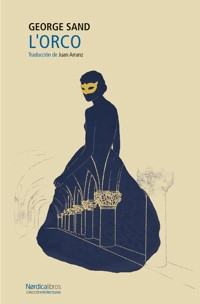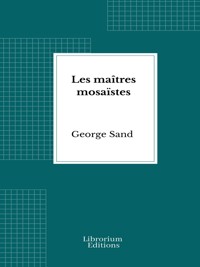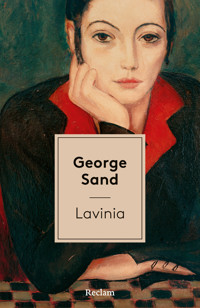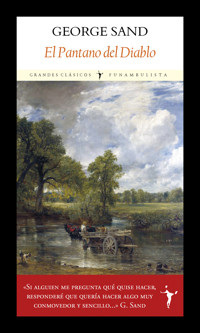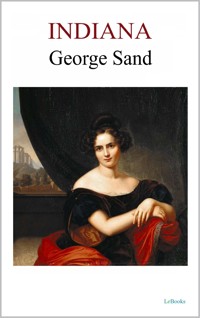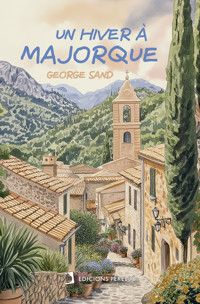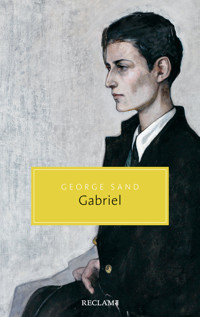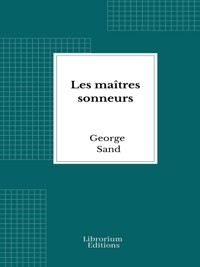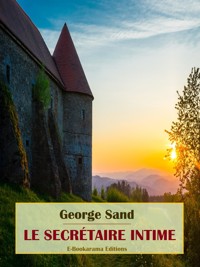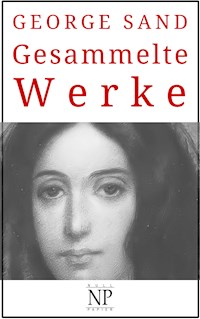
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gesammelte Werke bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
George Sand (1.7.1804–8.6.1876), eigentlich Amantine Aurore Lucile Dupin de Francueil, war eine französische Schriftstellerin, die neben Romanen auch zahlreiche gesellschaftskritische Beiträge veröffentlichte. Sie setzte sich durch ihre Lebensweise und mit ihren Werken sowohl für feministische als auch für sozialkritische Ziele ein. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 3946
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
George Sand
Gesammelte Werke
Romane und Geschichten
George Sand
Gesammelte Werke
Romane und Geschichten
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962816-14-8
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Consuelo
I. Band
II. Band
Die Gräfin von Rudolstadt
Erster Teil.
Zweiter Teil.
Dritter Teil.
Vierter Teil.
Fünfter Teil.
Sechster Teil.
Siebter Teil.
Achter Teil.
Die Grille oder die kleine Fadette
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebtes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel.
Sechzehntes Kapitel.
Siebzehntes Kapitel.
Achtzehntes Kapitel.
Neunzehntes Kapitel.
Zwanzigstes Kapitel.
Einundzwanzigstes Kapitel.
Zweiundzwanzigstes Kapitel.
Dreiundzwanzigstes Kapitel.
Vierundzwanzigstes Kapitel.
Fünfundzwanzigstes Kapitel.
Sechsundzwanzigstes Kapitel.
Siebenundzwanzigstes Kapitel.
Achtundzwanzigstes Kapitel.
Neunundzwanzigstes Kapitel.
Dreißigstes Kapitel.
Einunddreißigstes Kapitel.
Zweiunddreißigstes Kapitel.
Dreiunddreißigstes Kapitel.
Vierunddreißigstes Kapitel.
Fünfunddreißigstes Kapitel.
Sechsunddreißigstes Kapitel.
Siebenunddreißigstes Kapitel.
Achtunddreißigstes Kapitel.
Neununddreißigstes Kapitel.
Die Marquise
I
II
III
Indiana
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebtes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel.
Sechzehntes Kapitel.
Siebzehntes Kapitel.
Achtzehntes Kapitel.
Neunzehntes Kapitel.
Zwanzigstes Kapitel.
Einundzwanzigstes Kapitel.
Zweiundzwanzigstes Kapitel.
Dreiundzwanzigstes Kapitel.
Vierundzwanzigstes Kapitel.
Fünfundzwanzigstes Kapitel.
Sechsundzwanzigstes Kapitel.
Siebenundzwanzigstes Kapitel.
Achtundzwanzigstes Kapitel.
Schluss.
Lavinia - Pauline - Kora
Vorrede
Lavinia
Pauline
Kora
Literaturverzeichnis
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Gesammelte Werke bei Null Papier
Edgar Allan Poe - Gesammelte Werke
Franz Kafka - Gesammelte Werke
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
E. T. A. Hoffmann - Gesammelte Werke
Georg Büchner - Gesammelte Werke
Joseph Roth - Gesammelte Werke
Mark Twain - Gesammelte Werke
Kurt Tucholsky - Gesammelte Werke
Rudyard Kipling - Gesammelte Werke
Rilke - Gesammelte Werke
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Consuelo
I. Band
Erster Teil.
1.
Ja, ja, Mesdemoiselles, schütteln Sie die Köpfe so viel es Ihnen beliebt; die beste und folgsamste von allen ist – doch nein! ich nenne sie nicht; denn sie ist in meiner Klasse das einzige bescheidene Kind, und ich will sie nicht an eine so seltene Tugend bringen, welche ich Ihnen eben wünsche …
– In nomine Patris er Filii et Spiritus sancti sang die Costanza mit trotziger Miene.
– Amen, antworteten im Chore die übrigen jungen Mädchen.
– Bösewicht! sagte die Clorinda, indem sie dem Singmeister ein hübsches böses Gesicht machte und ihm mit dem Stiele ihres Fächers einen leisen Schlag auf die knochigen und gerunzelten Finger gab, welche noch ausgestreckt auf der Claviatur der Orgel ruheten.
– Kommt mit! sagte der alte Professore mit dem erfahrenen und ruhigen Wesen eines Mannes, welcher seit vierzig Jahren sechs Stunden täglich alle Launen und Schelmereien verschiedener Generationen von weiblichen Zöglingen zu bestehen hat. Er steckte seine Brille in das Futteral und seine Tabaksdose in die Tasche, ohne nach dem eifernden und spottenden Schwarme aufzublicken. Wahr ist es dennoch, setzte er hinzu, jenes wohlgesittete, lernbegierige, fleißige, gute Kind, von dem ich sagte, das sind Sie nicht, Signora Clorinda; und Sie nicht, Signora Costanza; Sie auch nicht, Signora Zulietta; die Rosina eben so wenig; und die Michela noch weniger …
– Dann bin ich’s … Nein, ich!… – Gar nicht, ich! … – Ich! – Ich! – riefen mit ihren flötenden oder schneidenden Stimmen fünfzig Blondinen und Brünetten und warfen sich wie ein Flug Möven auf eine arme Muschel, die das ebbende Meer auf dem Strande im Trocknen zurückgelassen hat.
Die Muschel, nämlich der Maestro (und fürwahr, kein treffenderes Gleichnis ließe sich für ihn erdenken, mit seinen eckigen Bewegungen, seinen schillernden Augen, seinen rotgefleckten Backen und besonders seiner weißen, sich in tausend steifen, spitzigen Löckchen kräuselnden Perrücke), der Maestro, sag’ ich, dreimal wieder auf die Orgelbank zurückgedrückt, so oft er sich erhob um hinwegzugehen, aber immer ruhig und unerschüttert, ganz wie eine von den Stürmen gewiegte und abgehärtete Muschel, ließ sich lange bitten; dass er diejenige seiner Schülerinnen nennen möchte, welche er, mit seinen Lobsprüchen sonst so karg, diesmal damit überhäuft hatte. Endlich, indem er tat, als ob er den Bitten, die seine Schlauheit hervorgerufen, nur mit Widerstreben wiche, griff er nach dem Magisterstabe, der ihm zum Taktschlagen diente, und trennte und teilte mittels desselben seinen undisziplinierten Haufen in zwei Reihen ab. Endlich schritt er zwischen diesem doppelten Spaliere leichter Köpfchen hindurch und blieb am Ende des Orgelchores vor einem kleinen Wesen stehen, das, die Ellenbogen auf die Knie gestützt, die Finger in den Ohren, um nicht von dem Lärm gestört zu werden, seine Aufgabe halblaut, um niemanden zu stören, lernend, und zusammengebückt wie ein Äffchen, auf einer Stufe saß; mit feierlicher und triumphierender Miene blieb er stehen, den Fuß und den Arm vorgestreckt, wie Paris der den Apfel reicht, hier nicht der Schönsten, aber der Folgsamsten.
– Consuelo? die Spanierin? riefen in der ersten Überraschung die jungen Choristinnen wie aus einem Munde, dann brach ein allgemeines, homerisches Gelächter aus und lockte die Röte des Verdrusses und des Zornes auf die majestätische Stirn des Lehrers. Die kleine Consuelo, deren verstopfte Ohren von der ganzen Unterredung nichts gehört hatten, und deren zerstreute Augen aufs Geratewohl umherblickten ohne etwas zu sehen, so vertieft war sie in ihre Arbeit, – Consuelo merkte Anfangs nicht im geringsten auf all den Tumult, und als sie endlich die Aufmerksamkeit wahrnahm, welche sie erregt hatte, ließ sie ihre Hände aus den Ohren auf ihren Schoß und ihr Heft von ihrem Schoße auf die Erde fallen; starr vor Erstaunen saß sie da, verwirrt nicht, doch ein wenig erschreckt, und zuletzt stand sie auf und blickte hinter sich, um zu sehen, ob etwa dort irgend etwas Sonderbares oder Lächerliches wäre, das statt ihrer zu einer so lärmenden Lustigkeit Anlass geben mochte.
– Consuelo, sagte der Maestro, indem er sie ohne weitere Erklärung bei der Hand nahm, komm her, mein gutes Kind, und singe mir das Salve Regina von Pergolese, das du seit vierzehn Tagen übst und woran die Clorinde schon ein Jahr lernt.
Consuelo ging, ohne zu antworten, ohne Furcht, ohne Stolz, ohne Verlegenheit, mit dem Singlehrer an die Orgel; dieser setzte sich und gab mit triumphierenden Blicken seiner jungen Schülerin den Ton an. Rein, einfach, ohne Anstrengung sang Consuelo und es klangen unter den tiefen Wölbungen der Kathedrale hin die Töne der schönsten Stimme, die jemals dort erschollen war. Sie sang das Salve Regina ohne sich des kleinsten Gedächtnisfehlers schuldig zu machen und ohne einen Ton zu wagen, der nicht untadelhaft rein und voll geriet und immer am rechten Orte ausgehalten oder losgelassen; sie folgte nur ganz willenlos, aber mit der größten Pünktlichkeit den Anweisungen, welche der einsichtige Lehrer ihr gegeben hatte, und führte mit ihren gewaltigen Mitteln die wohlbedachten und richtigen Intentionen des trefflichen Mannes aus; so leistete sie mit der Unerfahrenheit und Unbewusstheit eines Kindes was wohl Kenntnis, Fertigkeit und Begeisterung einer vollendeten Sängerin nicht vollbracht hätten: sie sang mit Vollkommenheit.
Recht gut, mein Kind, sagte der alte Meister, der mit seinem Lobe stets sparsam war. Du hast mit Aufmerksamkeit studiert und du hast mit Bewusstsein gesungen. Das nächste Mal sollst du mir die Cantate von Scarlatti wiederholen, die ich dir eingeübt habe.
– Si, Signor Professore, antwortete Consuelo. Kann ich nun gehen?
– Ja, mein Kind. Mesdemoiselles, die Stunde ist aus.
Consuelo nahm ihre Hefte, ihren Bleistift und ihren kleinen Fächer von schwarzem Papier, den steten Begleiter der Spanierin wie der Venezianerin, den sie zwar fast niemals brauchte, aber immer bei sich hatte, und tat das alles in einen kleinen Kober. Dann verschwand sie hinter den Orgelpfeifen, schlüpfte behänd wie ein Mäuschen über die dunkle Treppe, die in die Kirche hinabführt, kniete an dem Mittelschiff vorübereilend einen Augenblick nieder, und eben als sie die Kirche verlassen wollte, traf sie bei dem Weihwasser einen schönen Herrn, welcher ihr lächelnd den Wedel reichte. Während sie nahm, schaute sie ihm gerad’ ins Gesicht mit der Unbefangenheit eines kleinen Mädchens, das seine Weiblichkeit noch nicht weiß und fühlt, und mischte so komisch ihre Bekreuzigung mit ihrem Dank, dass der junge Herr zu lachen anhob. Consuelo lachte ebenfalls; aber auf einmal, als ob es ihr einfiele, dass sie erwartet werde, fing sie an zu laufen und hatte im Augenblicke Türschwelle, Stufen und Vorhalle der Kirche hinter sich gelassen.
Unterdessen steckte der Professor seine Brille zum zweiten Male in seine große Westentasche, und sprach dabei zu den Schülerinnen, welche ihn schweigend umgaben:
– Schämen Sie sich, meine schönen Demoiselles! sagte er. Dieses kleine Mädchen, die jüngste unter Ihnen, die jüngste meiner Klasse, ist die einzige, die ein Solo ordentlich singen kann, und in den Chören lässt sie sich durch alle Dummheiten, welche Sie rechts und links machen, nicht irreführen, sondern ich höre sie immer richtig und sicher wie einen Klavierton. Eifer und Ausdauer besitzt sie, und außerdem was Sie alle, wie Sie da sind, nicht haben und niemals haben werden: Bewusstsein!
– Aha! hat er sein Schlagwort noch losgelassen! rief Costanza, als er hinaus war. Er hat es bloß neun und dreißigmal während der Stunde angebracht, und er wäre wahrhaftig krank geworden, wenn ihm das vierzigste entgangen wäre.
– Ein rechtes Wunder, wenn die Consuelo Fortschritte macht, sagte Zulietta. Sie ist so arm. Sie hat an weiter nichts zu denken als wie sie nur geschwind etwas lerne, um ihr Brot zu verdienen.
– Ihre Mutter soll eine Zigeunerin gewesen sein, setzte Michelina hinzu, und die Kleine hör’ ich, hat auf Gassen und Landstraßen gesungen, ehe sie hierher kam. Eine schöne Stimme hat sie, das kann man nicht bestreiten; aber sie hat nicht ein Fünkchen Geist, das arme Ding. Sie lernt auswendig, sie folgt sklavisch den Anweisungen des Professors, und dann tut ihre gute Lunge das Übrige.
– Mag ihre Lunge noch so gut sein, und hätte sie noch so viel Geist obenein, sagte die schöne Clorinda, so möchte ich doch nicht mit ihr tauschen, wenn ich meine Gestalt für die ihrige hingeben müsste.
– Da würdest Du auch nicht so gar viel verlieren, entgegnete die Costanza, welche niemals große Lust hatte, Clorindens Schönheit anzuerkennen.
– Nein! schön ist sie nicht, sagte eine andere, sie ist gelb wie eine Osterkerze und ihre großen Augen sind so nichtssagend, auch ist sie immer so schlecht angezogen: gewiss, ganz garstig ist sie. – Armes Mädchen! o, es ist ein recht großes Unglück für sie, das alles. Kein Vermögen, keine Reize!
So endete Consuelo’s Lob; durch dieses Bedauern hielten sich die anderen für die Bewunderung schadlos, welche ihnen der Gesang des Mädchens abgenötigt hatte.
2.
Es trug sich dieses in Venedig zu, vor etwa hundert Jahren und zwar in der Kirche der Mendicanti, als eben der berühmte Maestro Porpora daselbst die Proben der großen Vespermusik beschloss, welche er zu Mariä Himmelfahrt nächsten Sonntag auszuführen hatte. Die jungen Choristinnen, die so wacker von ihm ausgescholten wurden, waren Freischülerinnen jener Scuola, welche die Republik unterhielt, um junge Mädchen darin auszubilden und später auszustatten – soit pour le mariage, soit pour le cloître, sagt Jean Jacques Rousseau, der ihren herrlichen Gesang gerade auch um jene Zeit und in derselben Kirche bewundert hat. Gewiss erinnerst du dich, lieber Leser! seiner Schilderung und der reizenden Episode im 7. Buche der Confessions. Ich werde mich wohl hüten, diese Paar Seiten, die entzückend sind, dir hier abzuschreiben, denn die meinigen würdest du danach nicht wieder in die Hand nehmen mögen; und ich an deiner Stelle, lieber Leser, würde es eben so machen. Ich will nun hoffen, dass du die Confessions nicht gerade bei der Hand hast, und in meiner Geschichte fortfahren.
Nicht alle diese jungen Mädchen waren gleich arm, und es ist kein Zweifel, dass der äußerst gewissenhaften Verwaltung ungeachtet manche mit einschlüpften, für welche es weit mehr eine Spekulation als ein Bedürfnis war, auf Kosten der Republik ihren Unterricht in der Kunst und eine Ausstattung zu erhalten. Daher erlaubten es sich manche die heiligen Gesetze der Gleichheit zu vergessen, unter deren Anrufung es ihnen gelungen war, sich auf dieselben Bänke mit ihren wirklich armen Schwestern zu stehlen. Manche entzogen sich dann wohl wieder der ernsten Bestimmung, welche die Republik ihnen zugedacht hatte, und verzichteten, nachdem sie den Vorteil des unentgeldlichen Unterrichts genossen hatten, auf die Mitgift, um anderweitig sich ein glänzenderes Loos zu bereiten. Die Verwaltung hatte es nicht vermeiden können, zu den Lehrstunden bisweilen auch die Kinder armer Künstler zuzulassen, denen ihr unstätes Leben keinen längeren Aufenthalt in Venedig gestattete. Zu dieser Klasse gehörte die kleine Consuelo. Sie war in Spanien geboren und von dort nach Italien gekommen, ich weiß nicht ob über St. Petersburg oder Constantinopel, Mexiko, Archangel oder auf einem Wege, noch direkter, nach Zigeunerart, als die genannten.
Zigeunerin war sie nur durch Lebensweise und nach dem Redegebrauch, von Abkunft war sie weder irgendwie Gitana, noch Hindu, noch Israelitin; sie war von reinem spanischem Blute, von maurischem Ursprung ohne Zweifel, denn sie war so ziemlich braun und ihr ganzes Wesen war von einer Ruhe, wie solche nicht den umherschweifenden Stämmen eigen ist. Ich will hiermit von diesen Stämmen nichts Übles gesagt haben. Hätte ich mir Consuelo’s Gestalt erdacht, so weiß ich nicht, ob ich sie nicht von Israel hätte ausgehen lassen: so aber war sie von der Rippe Ismaels entstammt, ihr ganzes Wesen verriet das. Ich habe sie nicht gesehen, denn hundert Jahre bin ich noch nicht alt, aber man hat es mir versichert, und ich wüsste nicht, was sich dawider sagen ließe. Jener Wechsel von fiebrischem Ungestüm und stumpfer Abspannung, welcher die Zingarelle bezeichnet, war ihr fremd. Sie hatte nichts von der geschmeidigen Neugier und der unermüdlichen Zudringlichkeit einer bettelnden Ebbrea. Sie war so still wie das Wasser der Lagunen und zugleich so ämsig wie die leichten Gondeln, welche die Fläche desselben unablässig durchfurchen.
Da sie schnell wuchs und da sich ihre Mutter in großer Dürftigkeit befand, so trug sie Kleider, welche ihr immer um ein Jahr zu kurz waren: ihren langen vierzehnjährigen Beinen gab dies eine solche Art von wilder Grazie und Dreistigkeit des Schreitens, dass es zugleich lustig und traurig anzusehen war. Ihr Fuß ließ nicht erkennen, ob er klein sei, so plump war er bekleidet. Ihr Wuchs dagegen, umspannt von dem zu eng gewordenen und an allen Nähten durchbrochenen Leibchen, zeigte sich schlank und biegsam wie eine Palme, aber formlos, nicht gerundet, nicht verführerisch. Das arme Mädchen dachte daran nicht. Sie war es gewohnt, sich »Affe«, »Citrone«, »Mulattin« von den blonden, weißen und völligen Töchtern der Adria schelten zu hören. Ihr rundes, bleiches, unbedeutendes Gesicht würde niemanden aufgefallen sein, wenn nicht ihr kurzes, dichtes, hinter den Ohren zurückgeworfenes Haar und ihr ernsthafter, auf keinem Gegenstande verweilender Blick diesem Gesichte eine eigene, nicht gerade angenehme Sonderbarkeit gegeben hätten.
Ein Äußeres, das nie missfällt, verliert mehr und mehr die Fähigkeit, zu gefallen. Wer ein solches hat, wird durch die Gleichgültigkeit anderer gleichgültig gegen sich selbst gemacht und nimmt eine Vernachlässigung der Haltung an, welche immer mehr die Aufmerksamkeit von ihm abwendet. Die Schönheit nimmt sich in Acht, richtet sich ein, hält auf sich, betrachtet sich und stellt sich gleichsam stets sich selbst in einem eingebildeten Spiegel vor Augen. Die Hässlichkeit vergisst sich und lässt sich gehen. Doch gibt es zwei verschiedene Arten: die eine fühlt sich von Allen verworfen und sträubt sich dawider in steter Regung von Wut und Neid – das ist die wahre, die unbedingte Hässlichkeit; die andere ist unbefangen, sorglos, hat sich beschieden, scheuet nicht das Urteil und sucht es nicht, gewinnt aber die Herzen, indem sie den Augen wehe tut – so war Consuelo’s Hässlichkeit. Wohltäter, die sich ihrer annahmen, meinten wohl zuerst: wie Schade, dass sie nicht hübsch ist! besannen sich dann und nahmen den Kopf des Kindes so vertraulich, wie man der Schönheit nicht begegnet, in die Höhe.
»Man sieht dir’s am Gesicht an, Kleine!« sagten sie nun, »du bist ein gutes Geschöpf.«
Darüber freute sich Consuelo, obgleich sie recht gut wusste, dass dies hieß: »und bist eben weiter nichts.«
Indessen blieb der schöne, junge Herr, welcher ihr Weihwasser gereicht hatte, bei dem Weihkessel stehen und ließ die jungen »Scolari« eine nach der anderen an sich vorübergehen. Er betrachtete eine jede mit Aufmerksamkeit, und als die schönste von ihnen, die Clorinda, herbeikam, teilte er ihr das geweihte Wasser mit den Fingern mit, um des Vergnügens willen, die ihrigen zu berühren. Das junge Mädchen wurde rot vor Stolz und warf im Weitergehen ihm jenen halb scheuen halb dreisten Blick zu, welcher der Ausdruck weder des Selbstvertrauens noch der Scham ist.
Nachdem sie alle in das Innere des Klosters eingetreten waren, wendete sich der galante Patrizier wieder dem Schiffe zu und redete den Professor an, der inzwischen langsamer von der Empore herabgestiegen war.
– Beim Leib des Bacchus, rief er, lieber Meister! ihr müsst mir sagen, welche von euren Eleven das Salve Regina gesungen hat.
– Und weswegen begehrt ihr das zu wissen, Graf Zustiniani? entgegnete der Professor, während sie miteinander aus der Kirche traten.
– Um euch mein Kompliment zu machen, antwortete der Patrizier. Seit langer Zeit verfolge ich eure Vespermusiken, und bis in die Proben sogar, denn es ist euch bekannt, wie sehr ich dilettante der heiligen Musik bin – aber heut zum ersten male habe ich ein Stück vom Pergolese mit solcher Vollkommenheit singen hören; und die Stimme anlangend, so ist es wahrhaftig die schönste, die ich Zeit meines Lebens gehört habe.
– Glaub’s wohl, beim Christ! versetzte der Professor und nahm mit Behagen und mit Würde eine große Prise Tabak.
– Sagt mir also den Namen dieses himmlischen Wesens, das mich so hoch entzückt hat. Wie barsch ihr auch seid, und wiewohl ihr ewig klagt, so muss man doch gestehen, dass ihr aus eurer Schule eine der besten in ganz Italien gemacht habt; vortrefflich sind euere Chöre und euere Soli wirklich sehr schätzbar; jedoch sind die Musikstücke, welche ihr aufführen lasset, von so großem und strengem Stil, dass es den jungen Mädchen nur selten gelingt alle Schönheiten derselben zur Empfindung zu bringen.
– Sie bringen sie nicht zur Empfindung, sagte der Professor traurig, weil sie selber nichts davon empfinden! An frischen umfangreichen und metallreichen Stimmen haben wir, Gott sei Dank, keinen Mangel; aber die innere musikalische Anlage, hilf Himmel! wie selten ist die und wie unzulänglich!
– Wenigstens besitzet ihr doch eine von bewundernswürdigen Gaben. Ein herrliches Instrument, vollkommenes Gefühl und bemerkliche Schule! Sagt mir doch, wer es ist.
– Nicht wahr, entgegnete der Professor, indem er die Frage des Grafen überging, ihr habt euere Freude daran gehabt?
– Sie hat mir an’s Herz gegriffen, sie hat mir Tränen entlockt; und mit so einfachen Mitteln, mit so ungesuchten Effekten, dass ich bis heute keine Ahnung von der Möglichkeit hatte. Übrigens habe ich mich der Worte erinnert, die ihr mir beim Unterrichte in euerer göttlichen Kunst so oft wiederholt habt, teurer Meister! und zum ersten male habe ich deren Wahrheit begriffen.
– Was habe ich euch denn gesagt? versetzte der Maestro, indem sein Gesicht glänzte.
– Ihr habt gesagt, erwiderte der Graf, das Große, Wahre und Schöne in den Künsten ist das Einfache.
– Ich sagte euch aber auch, dass wir das Brillante, das Gewählte, das Kunstreiche haben, Eigenschaften denen man unter Umständen ebenfalls die Achtung und den Beifall nicht versagen kann?
– Ohne Zweifel. Jedoch zwischen diesen untergeordneten Eigenschaften und den wahrhaften Offenbarungen des Genius ist ein Abgrund, sagtet ihr. Wohlan, teurer Meister! euere Sängerin steht auf der einen Seite, sie ganz allein, und alle die anderen stehen drüben.
– Wahr, bemerkte der Professor sich die Hände reibend, wahr und gut gesagt!
– Sie heißt? nahm wieder der Graf das Wort.
– Wer? fragte boshaft der Professor.
– O, per Dio Santo, jene Sirene, oder vielmehr der Erzengel dessen Gesang ich hörte.
– Und was liegt denn an ihrem Namen, Herr Graf? sagte Porpora mit strengem Tone.
– Und warum wollt ihr aus diesem Namen ein Geheimnis machen, Herr Professor?
– Ich werde euch sagen: warum, sobald ihr mir gesagt haben werdet, weswegen ihr so hitzig seid, ihn zu erfahren.
– Ist es nicht ein sehr natürliches und in der Tat unwiderstehliches Gefühl, welches uns antreibt das zu kennen, zu nennen, zu erblicken, was unsere Bewunderung erregt?
– Sehr wohl, das ist aber nicht euer einziger Beweggrund; erlaubt mir, teuerer Graf, euch hierin Lügen zu strafen. Ich weiß wohl, ihr seid ein großer Musikfreund und ein Kenner, aber ihr seid daneben auch der Eigentümer des Theaters San Samuel. Es ist euer Interesse und noch mehr der Ruhm, den ihr darein setzet, die besten Talente und die schönsten Stimmen Italiens heranzuziehen. Ihr wisset wohl, dass bei uns die gute Schule ist, dass nur bei uns die strengen Studien gemacht und die großen Sängerinnen gebildet werden. Die Corilla habt ihr uns schon weggefischt, und da sie euch vielleicht nächstens durch ein anderweitiges Engagement wieder weggenommen wird, so streicht ihr um unsere Schule herum und spüret, ob wir nicht wieder so eine Corilla haben, die ihr dann auf dem Sprunge steht, uns wegzuschnappen. Dieses ist die Wahrheit, mein Herr Graf! bekennen Sie, dass ich die Wahrheit gesagt habe.
– Und wenn auch, teurer Maestro, entgegnete der Graf lächelnd, was tut das und was für Übles findet ihr darin?
– Was für Übeles? Ei, ein sehr großes, Herr Graf! Ihr verführt, ihr verderbt diese armen Geschöpfe.
– Holla, wie meint ihr das, toller Professor? Seit wann habt ihr euch denn zum Pater Guardian dieser brechlichen Tugenden gemacht?
– Ich meine das, wie es recht ist, Herr Graf, und ich kümmere mich nicht um ihre Tugend und nicht um ihre Brechlichkeit: aber ich kümmere mich um ihr Talent, das ihr auf eueren Theatern verbildet und zu Grunde richtet, indem ihr sie gemeines und geschmackloses Zeug singen lasset. Ist es nicht ein Jammer und eine Schande, diese Corilla, die auf dem besten Wege war, die ernste Kunst großartig zu erfassen, diese Corilla von dem Heiligen zum Profanen, vom Gebet zu den Possen, vom Altare zu den Brettern, vom Erhabenen zum Lächerlichen, von Allegri und Palestrina zu einem Albinoni und dem Bartscherer Apollini herabsteigen zu sehen?
– Somit schlagt ihr es mir aus Rigorismus ab, dieses Mädchen zu nennen, auf welches ich gar nicht einmal Absichten haben kann, da ich ja nicht weiß ob sie die übrigen für das Theater notwendigen Eigenschaften besitzt?
– Ich schlage es euch rund ab.
– Und ihr meint wirklich, dass ich sie nicht entdecken werde?
– Leider! entdecken werdet ihr sie, wenn ihr es euch vorsetztet: aber ich werde mein Möglichstes tun, um zu verhüten, dass ihr sie uns entreißet.
– Wohlan, Meister, halb seid ihr schon besiegt: denn euere geheimnisvolle Göttin habe ich gesehen, habe ich erraten, habe ich erkannt.
– So? sagte der Maestro mit einer zweifelnden und zurückhaltenden Miene, seid ihr euerer Sache auch gewiss?
– Meine Augen und mein Herz haben sie mir verraten, und um euch zu überzeugen, will ich euch ihr Bild entwerfen. Sie ist groß gewachsen: sie ist, glaub’ ich, die größte von allen euern Schülerinnen; sie ist weiß wie der Schnee von Friaul und rosenwangig wie der Morgenhimmel eines heiteren Tages. Sie hat Haare von Gold, Augen von Azur, eine liebliche Körperfülle und am Finger trägt sie einen kleinen Rubin, der meine Hand streifend mich in Flammen gesetzt hat wie ein magischer Funke.
– Bravo, rief Porpora, spöttisch lächelnd. In diesem Falle habe ich euch nichts zu verheimlichen. Euere Schönheit ist – die Clorinde. Geht doch hin und macht ihr euere verlockenden Anträge. Bietet ihr Gold, Diamanten, Putz. Ihr werdet sie ohne Mühe für euere Truppe gewinnen, und sie wird euch auch wohl die Corilla ersetzen können. Denn euer heutiges Theaterpublikum zieht ja ein paar schöne Schultern einer schönen Stimme, und ein paar herausfordernde Augen einem gebildeten Geiste vor.
– Sollte ich mich getäuscht haben, lieber Meister? fragte der Graf ein wenig irre geworden: wäre die Clorinde nichts weiter als eine gemeine Schönheit?
– Und wenn nun meine Sirene, meine Göttin, mein Erzengel, wie ihr sie zu nennen beliebt, nichts weniger als schön wäre? versetzte der Maestro boshaft.
– Wenn sie missgestaltet wäre, so will ich euch bitten, sie mir niemals zu zeigen; denn mein schöner Traum wäre zu grausam zerstört. Wäre sie aber bloß hässlich, so wäre ich imstande, sie immer noch anzubeten; nur für das Theater würde ich sie dann nicht engagieren, denn Talent ohne Schönheit ist nicht selten für ein Weib ein Unglück, ein Kampf, eine Marter. Wonach seht ihr, Maestro, und weshalb bleibt ihr stehen?
– Hier ist der Platz, wo die Gondeln halten, und es ist keine da. Aber ihr, Graf, worauf heftet ihr euere Blicke?
– Ich sehe nur, ob nicht der Bengel da, der auf den Stufen der Anlände neben einem kleinen, ziemlich hässlichen Mädchen sitzt, mein Schützling Anzoleto ist, wahrhaftig der aufgeweckteste und hübscheste von allen unseren Gassenbuben. Seht ihn euch an, lieber Meister; das ist etwas für euch so gut wie für mich. Dieser Junge hat die schönste Tenorstimme, die in Venedig zu finden ist, und eine verzweifelte Liebe zur Musik und ganz unglaubliche Fähigkeiten. Ich wollte euch schon lange von ihm erzählen und euch bitten, ihm Stunden zu geben. Dieser ist es, auf den ich wahrhaftig die Hoffnung meines Theaters baue und er wird mich, denke ich, in einigen Jahren für das was ich auf ihn wende, reich belohnen. Heda, Zoto! komm her, mein Kind, ich will dich dem berühmten Meister Porpora vorstellen.
Anzoleto’s nackte Füße spielten im Wasser, während er damit beschäftigt war, Muscheln von jener zierlichen Ar, die der Venetianer poetisch fiori de mare nennt, vermittelst einer großen Nadel zu durchbohren. Als ihn der Graf rief, sprang er auf. Er trug nichts auf dem Leibe als ein recht abgenutztes Beinkleid und ein ziemlich feines, aber sehr zerrissenes Hemd, welches seine weißen und gleich denen eines antiken Bacchusknaben modelierten Schultern durchblicken ließ. Seine Schönheit war in der Tat diejenige, mit welcher der griechische Künstler einen jungen Faun ausgestattet haben würde, und seine Gesichtsbildung zeigte das an jenen Schöpfungen der heidnischen Plastik so häufig uns begegnende, ganz eigentümliche Gemisch von träumerischer Schwermut und spöttischer Unbesorgtheit. Sein krauses aber weiches Haar, hellblond und von der Sonne nur ein wenig gebräunt, umgab in tausend dichten, kurzen Ringellöckchen seinen Alabasterhals. Alle seine Züge waren vollkommen schön; aber etwas allzu Keckes lag in dem durchdringenden Blick seiner pechschwarzen Augen, was dem Professor nicht gefiel. Er warf alle seine Muscheln in den Schoß des Mädchens welches neben ihm saß, und während dieses, ohne sich stören zu lassen, fortfuhr sie mit kleinen Goldperlen gemischt aufzureihen, trat er zu Zustiniani, dem er nach Landessitte die Hand küsste.
– In der Tat ein hübscher Junge, sagte der Professor, ihm die Backe klopfend; aber er scheint sich mit Spielen zu belustigen, die doch zu kindisch für sein Alter sind; denn er ist wohl ein achtzehn Jahre alt, nicht so?
– Neunzehn, Sior Profesor! entgegnete Anzoleto in seinem venetianischen Dialekte; wenn ich mich aber mit den Muscheln belustige, so tu’ ich das nur um der kleinen Consuelo zu helfen, welche Halsketten macht.
– Consuelo, sagte der Meister, indem er mit dem Grafen und Anzoleto zu seiner Schülerin trat, ich hätte nicht gedacht, dass du so putzsüchtig wärest.
– O nein, ich mache das nicht für mich, Herr Professor! entgegnete Consuelo, indem sie sich nur halb erhob, aus Vorsicht, damit die Muscheln, die sie in der Schürze hatte, nicht ins Wasser fielen; ich mache das zum Handel, und um Reis und Mais einzukaufen.
– Sie ist arm, und sie ernährt ihre Mutter, sagte Porpora. Höre, Consuelo, wenn ihr in Verlegenheit seid, deine Mutter und du, so musst du zu mir kommen, aber zu betteln verbiete ich dir, hörst du wohl?
– O Sie brauchen ihr das nicht zu verbieten, Sior Profesor, fiel ihm Anzoleto lebhaft in die Rede, sie würde es auch von selbst nicht tun, und ich, ich würde es nicht leiden.
– Du! du hast ja auch nichts, sagte der Graf.
– Nichts, als Ihre Wohltaten, gnädigster Herr! aber wir teilen, die Kleine und ich.
– Sie ist also eine Verwandte; von dir?
– Nein, eine Fremde, es ist Consuelo.
– Consuelo? Wunderlicher Name! sagte der Graf.
– Ein schöner Name, Ew. Gnaden, fiel Anzoleto ein; er bedeutet Trost.
– Gut; sie ist, wie es scheint, deine Freundin?
– Meine Braut ist sie, Herr!
– Schon? Sehet da, diese Kinder denken schon an die Hochzeit.
– Ja wir machen an dem Tage Hochzeit wo Sie mein Engagement beim Theater San Samuel ausfertigen werden, gnädiger Herr!
– In diesem Falle werdet ihr noch lange warten, Kinderchen!
– Oh, wir wollen schon warten, sagte Consuelo mit der heiteren Ruhe der Unschuld.
Der Graf und der Maestro ergötzten sich einige Augenblicke an der Einfalt und an den Antworten dieses jungen Paares; nachdem sie alsdann noch dem Anzoleto die Zeit bestimmt hatten, wann er nächsten Tages zu dem Professor kommen sollte; um seine Stimme prüfen zu lassen, entfernten sie sich und überließen die Kinder ihrem wichtigen Geschäfte.
– Wie gefällt euch dieses kleine Mädchen? sagte der Professor zu Zustiniani.
– Ich hatte sie vor einem Weilchen schon gesehen, und ich finde sie hässlich genug, um das Sprichwort zu rechtfertigen: Einem achtzehnjährigen Blute dünkt jedes Weib schön.
– Recht so, antwortete der Professor, nunmehr kann ich euch sagen, wer eure göttliche Sängerin, eure Sirene, eure geheimnisvolle Schönheit ist – Consuelo!
– Dieses dieses unsaubere Ding, dieser schwarze, magere Sprengsel? Nicht möglich, Maestro.
– Nichts desto weniger wahr, Herr Graf! Sagt, würde sie nicht eine höchst verführerische Prima Donna abgeben?
Der Graf stand still, schaute sich um, betrachtete Consuelo noch einmal von fern, und schlug dann in komischer Verzweiflung die Hände zusammen. Gerechter Himmel! rief er aus, kannst du dich so vergreifen, und das Feuer des Genius in ein so schlecht gemeißeltes Gefäße gießen!
– Also ihr verzichtet auf eure strafbaren Pläne? sagte der Professor.
– Ganz gewiss.
– Versprecht ihr mir das? fügte Porpora hinzu.
– Noch mehr, ich schwöre es euch, entgegnete der Graf.
3.
Aufgeschossen unter dem italienischen Himmel, erzogen von dem Zufall wie ein Vogel am Strande, arm, verwaist, verlassen, und doch glücklich in der Gegenwart, und voll Vertrauen in seine Zukunft, wie ein Kind der Liebe, was er ohne Zweifel war, hatte Anzoleto, dieser hübsche Junge von neunzehn Jahren, an der kleinen Consuelo, der zur Seite er auf dem Pflaster Venedigs in vollster Freiheit seine Tage verbrachte, wohl schwerlich seine erste Liebschaft. In die leichten Freuden eingeweiht, die sich ihm mehr als einmal dargeboten, würde er vielleicht schon entkräftet und verderbt gewesen sein, hätte er in unserem traurigen Klima gelebt, oder wäre er minder reich von der Natur begabt gewesen. Allein bei früher Entwicklung und einer kräftigen Anlage zu einer ausdauernden Männlichkeit, hatte er sein Herz rein und seine Sinnlichkeit unter der Herrschaft seines Willens erhalten. Der Zufall hatte ihn mit der kleinen Spanierin zusammengeführt, vor den Madonnenbildern, wo sie ihre Andacht absang; aus Lust, seine Stimme zu üben, hatte er mit ihr beim Sternenlichte ganze Abende hindurch gesungen. Dann trafen sie einander auf dem Sande des Lido wo sie Muscheln auflasen, er um sie zu essen, sie um Rosenkränze und Schmuck daraus zu machen. Dann wieder fanden sie sich in der Kirche, wo sie von Herzen zu dem guten Gotte betete, er mit allen Augen nach den schönen Damen schaute. Und bei allen diesen Begegnungen war ihm Consuelo so gut, so lieb, so freundlich, so fröhlich vorgekommen, dass er ihr Freund und ihr unzertrennlicher Gefährte geworden war, er wusste selbst nicht recht, warum und wie. Anzoleto kannte von der Liebe noch nichts als das Vergnügen. Er empfand Freundschaft für Consuelo, und einem Volke und Lande angehörend, wo mehr die Leidenschaften als die Zuneigungen herrschen, wusste er dieser Freundschaft keinen anderen Namen als den der Liebe zu geben. Consuelo ließ sich diese Redensart gefallen, nachdem sie dem Anzoleto folgenden Einwand gemacht hatte: »Wenn du sagst, dass du mein Liebhaber bist, so wirst du mich also heiraten?« worauf er ihr geantwortet hatte: »Ei freilich, wenn dir’s recht ist, so heiraten wir einander.« Dies war demnach von Augenblick an eine abgemachte Sache. Vielleicht war es von Seiten Anzoleto’s nur ein Spiel, während Consuelo mit allem Vertrauen der Welt daran glaubte. Gewiss ist soviel, dass sein junges Herz schon jene streitenden Gefühle und jene verworrenen Regungen in sich spürte, die übersättigten Menschen das Innere bestürmen und zerreißen.
Heftigen Begierden Preis gegeben, vergnügungssüchtig, nur das liebend was ihn glücklich machte, aber alles was sich seinen Freuden entgegenstellte hassend und fliehend, durch und durch eine Künstlernatur d. h. die das Leben mit einer erschreckenden Heftigkeit sucht und schmeckt, fand er, dass seine Liebsten ihm von Passionen die ihn in der Tat nicht tief ergriffen hatten, alle Leiden und Gefahren dennoch auferlegten. Er besuchte sie nun wohl von Zeit zu Zeit, wann ihn sein Verlangen trieb, ward aber immer wieder abgestoßen durch Sättigung und Unlust. Und als dieser seltsame Knabe so seine Seelenkraft ideallos und unwürdig vergeudet hatte, empfand er das Bedürfnis eines sanften Umgangs und eines keuschen, heiteren Ergusses. Er hätte schon wie Jean Jacques sagen können: »So wahr ist es, dass das was uns am meisten an die Frauen fesselt, weniger die Wollust ist, als eine gewisse Anmutigkeit des Lebens an ihrer Seite.«
Ohne nun sich Rechenschaft zu geben über das was ihn zu Consuelo hinzog, – für das Schöne hatte er noch keinen Sinn und unterschied nicht, ob sie hässlich oder hübsch war, – Kind genug um sich mit ihr an Spielereien unter seinem Alter zu vergnügen, Mann genug, um ihre vierzehn Jahre aufs gewissenhafteste zu achten, führte er mit ihr, auf offener Gasse, auf den Marmorfliesen und den Kanälen Venedigs, ein ebenso glückliches, ebenso reines, ebenso verborgenes und fast ebenso poetisches Leben wie Paul und Virginie unter den Pompelmusen ihrer Wildnis. Sie hatten eine größere und gefährlichere Freiheit als diese Kinder, keine Familie, keine wachsamen, zärtlichen Mütter die sie zur Tugend erziehen konnten, keinen treuen Diener der sie abends gesucht und heimgeleitet hätte, nicht einmal einen Hund, um sie vor Gefahr zu warnen; aber sie taten dennoch keinerlei Fall.
Sie kreuzten auf den Lagunen in offener Barke, zu jeder Stunde und bei jedem Wetter, ohne Ruder, ohne Steuermann; sie streiften auf den Morästen ohne Führer, ohne Uhr und unbesorgt um die kehrende Flut; sie sangen vor den geschmückten Kapellen unter der Vigne an den Straßenecken, ohne an die späte Tagesstunde zu denken und brauchten bis an den Morgen kein anderes Bett als die weißen Steinplatten die von der Tageshitze noch warm waren. Sie standen vor dem Pulcinell-Theater still und folgten mit gieriger Aufmerksamkeit dem fantastischen Schauspiele von der schönen Corisanda, der Marionettenkönigin; es fiel ihnen nicht ein, dass sie kein Frühstück gehabt hatten, und wie wenig Aussicht war, ein Abendessen zu erhalten. Sie überließen sich den ungezügelten Freuden des Carneval, nicht weiter verkleidet und geputzt, als er mit seiner umgekehrten Jacke und sie mit einer großen alten Bandschleife über dem Ohre. Auf dem Geländer einer Brücke oder auf den Stufen eines Pallastes, hielten sie köstliche Mahlzeiten von frutti di mare,1 rohen Fenchelstümpfen oder Citronenschalen.
Genug, sie führten ein fröhliches und freies Leben und ihre Liebkosungen waren nicht gefährlicher, ihre Gefühle nicht verliebter als es zwischen gesitteten Kindern gleichen Alters und Geschlechtes der Fall gewesen wäre. Tage, Jahre flossen hin; Anzoleto hatte andere Liebsten, Consuelo ahnte nicht einmal dass es noch eine andere Art Liebe gäbe als diese, deren Gegenstand sie war. Sie trat in die Mädchenjahre und empfand keine Nötigung, sich zurückhaltender gegen ihren Bräutigam zu betragen; er sah sie größer werden und sich verwandeln und empfand keine Ungeduld und wünschte keinen Wechsel dieser unbewölkten, offenen, unsträflichen Vertraulichkeit.
Vier Jahre waren vergangen, seitdem der Professor Porpora und der Graf Zustiniani einander ihre »kleinen Musiker« vorgestellt hatten. Der Graf hatte seitdem nicht mehr an die junge Kirchensängerin gedacht und der Professor hatte nicht minder den schönen Anzoleto vergessen, an dem er damals bei einer ersten Prüfung nichts von dem gefunden hatte, was er bei seinen Zöglingen voraussetzte, nämlich vor allem eine ernste und geduldige Auffassungsgabe, sodann eine an Selbstvernichtung gränzende Demut des Schülers vor dem Lehrer, und endlich den völligen Mangel jeder vorgängigen musikalischen Unterweisung.
»Redet mir niemals«, sagte er, »von einem Schüler, dessen Kopf sich meinem Willen nicht wie eine unbeschriebene Tafel darbietet, wie ein reines Wachs, das von mir den ersten Eindruck zu empfangen hat. Ich habe nicht Zeit, meinem Schüler ein Jahr zum Verlernen zu schenken, bevor ich zu lehren anfangen kann. Soll ich auf eine Schieferplatte schreiben, so bringet sie mir rein; und damit nicht genug, bringet sie mir auch gut. Ist sie zu stark, so wird sie nicht empfänglich sein, ist sie zu schwach, so wird sie mir unter der Hand zerbrechen.«
Kurz, er gestand zwar dem jungen Anzoleto ausgezeichnete Mittel zu, erklärte aber beim Schlusse der ersten Stunde dem Grafen etwas verdrießlich, und mit einer ironischen Anspruchslosigkeit, sein Unterricht sei nicht für einen bereits so weit vorgerückten Schüler, und um – »die natürlichen Fortschritte und die unwiderstehliche Entwicklung dieser magnifiquen Anlage zu erschweren und zu hemmen« sei der erste beste Lehrer gut genug.
Der Graf schickte seinen Schützling zu dem Professor Mellifiore, welcher von der Roulade bis zur Kadenz und von dem Triller bis zum Gruppetto seinen glänzenden Fähigkeiten die vollständigste Entwicklung gab und ihn so weit brachte, dass, als er 23 Jahre alt sich in dem Salon des Grafen hören ließ, jedermann ihn fähig sprach, im Theater San Samuel mit großem Erfolg in den ersten Partien aufzutreten.
Eines Abends wurde nämlich die ganze kunstliebende Noblesse und was nur von Künstlern in Venedig einiges Renommé genoss, zu einer letzten und entscheidenden Probe eingeladen. Zum ersten Male in seinem Leben schälte sich Anzoleto aus seiner gemeinen Tracht, zog eine Atlasweste und ein schwarzes Staatskleid an, ließ seine schönen Haare frisieren und pudern, steckte seine Füße in Schnallenschuhe, gab sich eine feierliche Miene und schlich auf den Zehenspitzen an ein Klavier, wo er, bei dem Scheine von tausend Wachskerzen und angegafft von zwei- bis dreihundert Personen, erst mit den Augen dem Ritornelle folgte, sodann seine Lungen aufblies und sich mit seiner Dreistigkeit, mit seinem Ehrgeiz und mit seinem hohen Brust-C in die gefährliche Laufbahn schwang, auf welcher keine Jury, kein Kampfrichter, sondern ein ganzes Publikum in der einen Hand die Siegespalme, in der anderen das Pfeifchen hält.
Ob Anzoleto innerlich bewegt war, ist keine Frage; er ließ jedoch sehr wenig davon blicken, und nicht sobald hatten seine schwarzen Augen, welche verstohlen die der Frauen befragten, den geheimen Beifall, der sich einem so schönen Jünglinge selten versagt, erraten, nicht sobald hatten die Kunstliebhaber umher, überrascht von der Gewalt seiner klangreichen Stimme und von der Leichtigkeit seiner Vokalisation, ein beifälliges Gemurmel hören lassen, als Freude und Hoffnung sein ganzes Wesen durchglüheten. Jetzt zum ersten Male in seinem Leben fühlte Anzoleto, der bis dahin nur eine gewöhnliche Behandlung und gewöhnlichen Unterricht erfahren hatte, dass er kein gewöhnlicher Mensch sei und, von dem Triumphe, nach dem er dürstete und den er empfand, hingerissen, sang er mit einer Kraft, einer Eigentümlichkeit und einem Feuer zum Erstaunen.
Sein Geschmack war allerdings nicht immer rein und sein Vortrag nicht in allen Teilen des Stückes tadellos: aber er wusste sich stets durch kühne Würfe, durch Blitze der Auffassung und Schwung der Begeisterung wieder zu heben. Er verfehlte manche Effecte, welche der Komponist beabsichtigt hatte, aber er fand andere, an welche noch niemand gedacht, weder der Komponist, der sie vorgezeichnet, noch der Lehrer, der sie erläutert, noch einer der Virtuosen, die sie früher ausgeführt hatten. Diese Kühnheiten ergriffen und entzückten alle Welt. Zehn Ungeschicklichkeiten verzieh man ihm für eine Neuheit, zehn Verstöße gegen die Methode für eine eigen gefühlte Stelle. So wahr ist es, dass in der Kunst das kleinste Aufleuchten des Genies, der kleinste Anlauf zu neuen Eroberungen die Menschen mehr blendet als alle Hilfsmittel und alle Klarheit der Einsicht, die sich in den Schranken des Gewohnten hält.
Niemand gab sich vielleicht Rechenschaft von den Ursachen und niemand entzog sich den Wirkungen dieses Enthusiasmus. Die Corilla hatte die Unterhaltung mit einer großen Arie eröffnet, welche sie trefflich sang und welche lebhaft beklatscht wurde; der Erfolg des jungen Debütanten löschte nun aber den ihrigen so ganz aus, dass sie darüber im Innern wütend war. Jedoch als Anzoleto, mit Lobsprüchen und Liebkosungen überhäuft, wieder an das Klavier trat, wo sie saß, und zu ihr niedergebeugt mit einer Mischung von Unterwürfigkeit und Kühnheit sagte: »Und Sie, Königin des Gesanges, Königin der Schönheit, haben Sie nicht einen Blick der Aufmunterung für den armen Unglücklichem der Sie fürchtet und Sie anbetet?« da betrachtete die Prima Donna, erstaunt über eine solche Dreistigkeit, dieses schöne Gesicht in der Nähe, welches sie zuvor keines Blickes gewürdigt hatte; denn welche eitle und sieggewohnte Frau würde ein dunkles armes Kind ihrer Aufmerksamkeit wert halten? Jetzt endlich beachtete sie ihn; seine Schönheit überraschte sie, sein feuriges Auge drang in sie ein und ihrerseits besiegt, bezaubert, ließ sie auf ihn einen langen Glutblick fallen, gleichsam ein Siegel auf das Diplom seiner Berühmtheit gedrückt.
An diesem merkwürdigen Abend hatte Anzoleto sein Publikum beherrscht und seinen gefährlichsten Feind entwaffnet; denn die schöne Sängerin war nicht bloß Königin auf den Bretern, sondern auch in der Administration und in dem Kabinet des Grafen Zustiniani.
4.
Ein einziger Zuhörer, welcher auf dem Rande seines Stuhles mit gekreuzten Beinen und unbeweglich auf die Knie gestützten Händen gleich einer ägyptischen Gottheit saß, war mitten unter den einstimmigen und sogar ein wenig unsinnigen Beifallsbezeugungen, welche die Stimme und Manier des Debütanten hervorgerufen hatte, stumm geblieben wie eine Sphinx und geheimnisvoll wie eine Hieroglyphe: es war dies der gelehrte Professor und berühmte Komponist Porpora. Während sein galanter Kollege, der Professor Mellifiore, welcher die Ehre von Anzoleto’s Erfolg ganz sich allein aneignete, umherging, sich vor den Frauen in die Brust werfend und sich gegen alle Männer mit Geschmeidigkeit verneigend, um sich sogar für ihre Blicke zu bedanken, saß der Lehrer der heiligen Musik still da, die Augen auf dem Boden, die Brauen emporgezogen, den Mund geschlossen und wie verloren in seine Betrachtungen. Nachdem die ganze Gesellschaft, welche diesen Abend zu einem großen Balle bei der Dogeresse gebeten war, sich nach und nach verlaufen hatte und nur die wärmsten Dilettanten mit einigen Damen und den vornehmsten Musikern am Klaviere zurückgeblieben waren, näherte sich Zustiniani dem strengen Maestro.
– Das heißt doch zu sehr gegen die Neueren schmollen, mein lieber Professor, sagte er zu ihm, und euer Schweigen täuscht mich nicht. Ihr wollt vor dieser weltlichen Musik und dieser neuen Gattung, an denen wir uns entzücken, euere Sinne bis aufs Äußerste verschlossen halten. Euer Herz hat sich nun euch zum Trotze geöffnet und eure Ohren haben das Gift der Verführung aufgenommen.
– Wissen Sie, Sior Profesor, sagte im Dialekte die reizende Corilla, indem sie gegen ihren alten Lehrer den Kindesbrauch der Scuola wiederaufnahm, Sie müssen mir einen rechten Gefallen tun …
– Fort von mir, Unselige! rief der Meister halb lachend und halb noch verdrießlich die Liebkosung seiner abtrünnigen Schülerin abwehrend. Was für Gemeinschaft ist noch zwischen dir und mir? Ich kenne dich nicht mehr. Bringe bei anderen dein liebliches Lächeln und dein treuloses Gezwitscher an.
– Er fängt schon an gut zu werden, sagte die Corilla, indem sie mit der einen Hand den Arm des Debütanten ergriff, während sie mit der anderen nicht abließ, die langen Zipfel an des Professors weißer Krawatte zu zerknittern. Komm her, Zoto,2 und beuge dein Knie vor dem geschicktesten Gesanglehrer Italiens. Demütige dich mein Kind und entwaffne seine Strenge. Ein einziges Wort von ihm, welches du erlangen kannst, muss größern Wert in deinen Augen haben als alle Trompeten des Ruhmes.
– Sie sind sehr strenge gegen mich gewesen, Herr Professor, sagte Anzoleto, sich mit einer etwas spöttischen Bescheidenheit verbeugend; indessen ist es seit vier Jahren mein einziger Gedanke, Ihnen die Zurücknahme eines sehr harten Urteilsspruches abzunötigen; und wenn es mir heut Abend nicht geglückt ist, so weiß ich nicht, ob ich den Mut haben werde, wieder vor dem Publikum aufzutreten, beladen wie ich bin mit ihrem Anathema.
– Knabe, sagte der Professor, indem er mit einer Lebhaftigkeit sich erhob und mit einer Kraft der Überzeugung sprach, welche ihn edel und groß erscheinen ließen, während er sonst gekrümmt und ungeschickt aussah, überlasse den Weibern die honigsüßen und treulosen Worte. Niemals erniedrige dich zu der Sprache der Schmeichelei, selbst nicht vor deinem Vorgesetzten, wie viel weniger vor dem, dessen Beifall du in deinem Innern verachtest. Es war eine Zeit, wo du dort unten in deinem Winkel lagst, arm, ungekannt, voll Furcht; deine ganze Zukunft hing an einem Haare, an einem Tone deiner Kehle, an einem augenblicklichen Versagen deiner Mittel, an einer Grille deiner Zuhörer. Ein Ungefähr, ein Kraftaufwand, ein Augenblick haben dich reich, berühmt, unverschämt gemacht. Deine Bahn ist offen, du darfst auf ihr nur laufen, soweit dich deine Kräfte tragen werden. Höre mich an, denn du wirst zum ersten und vielleicht zum letzten male die Wahrheit hören. Du bist auf einem schlechten Wege, du singst schlecht und du gefällst dir in der schlechten Musik. Du kannst nichts, und hast nichts gründliches gelernt, du besitzest nichts als Übung und Fertigkeit. Du setzest dich um nichts in Feuer; du kannst nur girren und zwitschern gleich den niedlichen, koketten Dämchen, denen man ihr Geziere nachsieht, weil sie vom Singen nichts verstehen. Aber du verstehst nicht mit dem Atem umzugehen, du sprichst schlecht aus, hast einen unedlen Ausdruck und einen falschen, gemeinen Styl. Verliere den Mut deswegen nicht; du hast alle diese Fehler, aber du hast das Zeug, sie zu bemeistern: denn du besitzest Eigenschaften, welche man durch Unterricht und Anstrengung nicht erwerben kann; du hast was man durch schlechte Ratschläge und schlechte Muster nicht verliert, du hast das heilige Feuer … du hast Genie! … leider, ein Feuer, welches nichts Großem leuchten wird, ein Genie, welches unfruchtbar bleiben wird … denn, in deinen Augen lese ich es, wie ich es in deiner Brust gespürt habe, du hast nicht den Cultus der Kunst, nicht den Glauben an die großen Meister, nicht die Ehrfurcht vor ihren gewaltigen Schöpfungen; du liebst den Ruhm, und nur den Ruhm und nur um dein selbst willen … Du hättest können … du könntest … aber nein! es ist zu spät! dein Loos wird die Laufbahn eines Meteors sein, gerade so wie die der …
Der Professor setzte ungestüm seinen Hut auf, drehte sich um und ging hinaus, ohne jemanden zu grüßen, ganz darin vertieft, seine abgebrochene Rede innerlich fortzuspinnen.
Alle Welt gab sich zwar Mühe, über die »bizarren« Äußerungen des Professors zu lachen, aber diese hinterließen dennoch für einige Augenblicke einen peinlichen Eindruck und eine gewisse Zweifelhaftigkeit und Verstimmung. Anzoleto war der erste, der sie zu vergessen schien, wiewohl sie sein Wesen in eine solche Erschütterung von Freude, Stolz, Zorn und Eifer gesetzt hatten, dass es für sein ganzes künftiges Leben entscheidend wurde. Er schien für nichts Sinn zu haben, als dass er der Corilla gefalle, und er wusste sie so davon zu überzeugen, dass sie sich bei diesem ersten Zusammentreffen alles Ernstes in ihn verliebte.
Graf Zustiniani war ihretwegen nicht besonders eifersüchtig und vielleicht hatte er seine Gründe, sie nicht sehr zu beengen. Außerdem lag ihm der Ruhm und Glanz seines Theaters mehr am Herzen als irgend etwas auf der Welt, nicht weil er geldbegierig gewesen wäre, sondern weil er wirklich für die sogenannten »schönen Künste« schwärmte. Dieser Ausdruck bezeichnet, wie mich dünkt, einen gewissen niedern Hang, der echt italienisch ist, und also eine so ziemlich geistlose Leidenschaft. Unter dem »Cultus der Kunst« – ein neuerer Ausdruck, der vor hundert Jahren noch nicht üblich war, – ist etwas ganz anderes zu verstehen als das, was man »Geschmack für die schönen Künste« nannte. Der Graf war in der Tat ein »Mann von Geschmack« im damaligen Verstande, ein amateur, nichts weiter. Allein die Befriedigung dieses Geschmackes war die größte Angelegenheit seines Lebens. Er liebte es, sich mit dem Publikum zu beschäftigen und das Publikum mit sich, die Künstler zu besuchen, die Mode zu beherrschen, von seinem Theater, seiner Pracht, seiner Liebenswürdigkeit, seinem verschwenderischen Aufwand reden zu machen. Er hatte, mit einem Worte, die gewöhnliche Passion der vornehmen Herren in der Provinz – zu glänzen. Besitz und Direktion eines Theaters war das beste Mittel, um die ganze Stadt zufrieden und vergnügt zu machen. Noch glücklicher hätte er sich gefühlt, wenn er einmal die gesamte Republik an seiner Tafel hätte bewirten können! Wenn Fremde sich bei dem Professor Porpora nach dem Grafen Zustiniani erkundigten, so pflegte dieser zu antworten: Es ist ein Mann, der gerne den Wirt macht und Musik auf seinem Theater, wie Fasanen auf seiner Tafel auftischt.
Es war Ein Uhr morgens, als man sich trennte.
– Anzolo, sagte Corilla, die sich mit ihm allein in einer Nische des Balkons befand, wo wohnst du?
Bei dieser unerwarteten Frage fühlte Anzoleto, dass er rot und bleich fast in einem Zuge wurde; denn wie sollte er dieser prächtigen und reichen Schönen es bekennen, dass er ohne Dach und Fach war, wie die Vögel unter dem Himmel? Und leichter noch wäre dies letztere Bekenntnis gewesen, als die Erwähnung jener jämmerlichen Höhle, wo er Zuflucht fand, so oft er seine Nächte aus Neigung oder Not nicht unter dem freien Himmel zubringen wollte.
– Nun! was hat meine Frage so Außerordentliches? rief die Corilla über seine Verwirrung lachend.
– Ich fragte mich selbst, entgegnete Anzoleto mit vieler Geistesgegenwart, welcher Königs- oder Feenpallast wohl würdig wäre, den stolzen Sterblichen zu beherbergen, der mit hinein nähme die Erinnerung eines Liebesblickes von Corilla.
– Und was will diese Schmeichelei sagen? entgegnete sie, indem sie ihm den glühendsten Blick zuwarf, den sie nur aus dem Zeughause ihrer Teufelskünste hervorholen konnte.
– Dass ich dieser Glückliche nicht bin, versetzte der Jüngling; dass ich jedoch, wenn ich es wäre, mich stolz genug dünken würde, um nur zwischen Himmel und Meer wie die Sterne zu wohnen.
– Oder wie die Cucculi! rief die Sängerin, indem sie laut auflachte. (Die ungeschickte Schwerfälligkeit dieser Mövenart ist nämlich in Venedig sprichwörtlich geworden, wie in Frankreich die der Maikäfer: étourdi comme un hanneton.)
– Spotten Sie über mich, verachten Sie mich, erwiderte Anzoleto, ich glaube, dass ich das eher leiden mag, als wenn Sie sich gar nicht mit mir beschäftigten.
– Gut, da du mir nur in Metaphern antworten willst, entgegnete sie, so will ich dich in meiner Gondel mitnehmen, auf die Gefahr, dich von deiner Wohnung zu entfernen, statt dich in ihre Nähe zu bringen. Wenn ich dir diesen Streich spielen sollte, so ist es deine eigene Schuld.
– war dies die Absicht, als Sie mich fragten, Signora? In diesem Falle ist meine Antwort sehr kurz und klar: ich wohne auf den Stufen Ihres Pallastes.
– So erwarte mich denn an den Stufen desjenigen, in welchem wir uns befinden, sagte Corilla mit leiserer Stimme, denn Zustiniani könnte böse werden, dass ich deine Fadaisen so geduldig anhöre.
Auf den ersten Antrieb seiner Eitelkeit stahl sich Anzoleto hinaus und sprang von der Anlände des Pallastes auf das Vorderteil von Corilla’s Gondel: er zählte die Sekunden nach den raschen Schlägen seines berauschten Herzens. Aber noch ehe sie auf den Stufen des Pallastes erschien, drängten sich mancherlei Betrachtungen in dem arbeitenden und ehrgeizigen Kopfe des Debütanten. Die Corilla ist allmächtig, sagte er zu sich; aber wenn ich, gerade weil ich ihr gefiele, das Missfallen des Grafen erregte? Oder wenn ich durch meinen allzu leichten Sieg ihm eine so flatterhafte Geliebte ganz verleidete und sie so um die Macht brächte, welche sie nur von ihm hat?
In dieser Verlegenheit maß Anzoleto mit den Augen die Treppe, welche er noch wieder hinaufsteigen konnte, und war im Begriff, sein Entkommen zu bewerkstelligen, als die Kerzen unter dem Torwege hervorleuchteten, und die schöne Corilla, in ihre Hermelinmantille gehüllt, auf der obersten Stufe erschien, in der Mitte einer Gruppe von Herren, welche sich beeiferten ihren runden Ellbogen mit der hohlen Hand zu stützen und ihr beim Hinabsteigen behilflich zu sein, wie es in Venedig Sitte ist.
– He! rief der Gondolier der Prima Donna dem bestürzten Anzoleto zu, was macht ihr da? Geschwind in die Gondel, wenn ihr dazu Erlaubnis habt, oder fort, und laufet an der Riva hin, denn der Herr Graf ist bei der Signora.
Anzoleto warf sich in die Gondel, ohne zu wissen was er tat. Er hatte den Kopf verloren. Kaum war er drinnen, als ihm das Staunen und der Zorn des Grafen vor die Seele trat, wenn dieser etwa seine Maitresse bis in die Gondel geleitete und dort seinen unverschämten Schützling fände. Die Angst peinigte ihn umso schrecklicher, da sie um mehr als fünf Minuten verlängert wurde. Die Signora war mitten auf der Treppe stehen geblieben. Sie schwatzte und lachte laut mit ihren Begleitern, und da von einer Passage die Rede war, sang sie diese mehrmals mit voller Stimme und in verschiedener Manier. Ihre klare und schmetternde Stimme, verklang an den Palästen und Kuppeln des Kanales, wie sich der Ruf des vor dem Morgenrot erwachenden Hahnes in dem Schweigen der Felder verliert.
Anzoleto, der sich nicht länger halten konnte, war entschlossen, durch diejenige Öffnung der Gondel, welche von der Treppe abgekehrt war, in das Wasser zu springen. Schon hatte er die Glasscheibe in ihr schwarzes Sammetfutter hinabgleiten lassen, schon hatte er ein Bein hinausgestreckt, als der zweite Ruderer der Prima Donna, der welcher am Hinterteile arbeitete, sich an der Seite des Gondelzeltes herüberbeugend, ihm zuflüsterte: Wenn man singt, so bedeutet das, ihr sollt euch still verhalten und ohne Furcht warten.
– Ich kannte den Brauch nicht, dachte Anzoleto und wartete, aber nicht ohne einen Rest von schmerzlicher Angst. Corilla machte sich das Vergnügen, den Grafen bis an den Schnabel ihrer Gondel mit sich zu ziehen, und dort noch indem sie ihm felicissima notte wünschte, stehen zu bleiben, bis man abgestoßen war; hierauf setzte sie sich mit einer solchen Unbefangenheit und Ruhe an die Seite ihres neuen Liebhabers, als ob sie nicht dessen Leben und ihr eigenes Glück bei diesem frechen Spiele gewagt hätte.
– Seht ihr die Corilla? sagte währenddessen Zustiniani zu dem Grafen Barberigo; nun, ich wollte meinen Kopf verwerten, dass sie nicht allein in ihrer Gondel ist.
– Und wie kommt ihr auf einen solchen Gedanken? erwiderte Barberigo.
– Weil sie mir tausend Vorstellungen gemacht hat, dass ich sie nach Hause begleiten möchte.
– Und ihr seid nicht eifersüchtiger?
– Von dieser Schwachheit bin ich schon lange geheilt. Ich würde vieles darum geben, wenn unsere erste Sängerin sich ernstlich in irgendjemanden verliebte, damit ihr der Aufenthalt in Venedig angenehmer würde als die Reiseträume, mit denen sie mich ängstiget. Über ihre Untreue kann ich mich leicht trösten, aber ihre Stimme und ihr Talent und die Wut des Publicums, welches sie mir an San Samuel fesselt, ersetzt mir keine.
– Ich verstehe; aber wer könnte denn der glückliche Liebhaber dieser tollen Prinzessin sein?
Der Graf und sein Freund gingen alle die Personen der Reihe nach durch, welche Corilla während dieses Abends ausgezeichnet und aufgemuntert haben mochte. Anzoleto war der einzige, an den sie durchaus nicht dachten.
5.
Inzwischen brach ein heftiger Kampf aus in der Seele dieses glücklichen Liebsten, welchen Woge und Nacht in ihrem dunkeln Schoße hinwegtrugen. Bang und zitternd saß er neben der berühmtesten Schönheit Venedigs. Wohl fühlte Anzoleto wie das Feuer eines Verlangens in ihm brauste, das von der Freude befriedigten Stolzes noch heftiger angefacht wurde; aber die Furcht, bald zu missfallen, verspottet, weggeworfen, verräterisch bei dem Grafen angeklagt zu werden, erkältete sein Entzücken. Klug und schlau, ein echter Venetianer, hatte er nicht sechs Jahre lang nach dem Theater gestrebt, ohne Erkundigung einzuziehen über die schwärmerische und gebieterische Frau, welche dort an der Spitze aller Intriguen stand. Er hatte Ursache zu vermuten, dass sein Reich bei ihr nur von kurzer Dauer sein würde; und wenn er dieser gefährlichen Ehre nicht zu entgehen gesucht, so kam dies daher, dass er dieselbe nicht so nahe erwartet hatte: er war durch Überraschung unterjocht und fortgerissen. Er hatte nur gemeint, durch seine Galanterie sich gern gelitten zu machen, und siehe da, sogleich geliebt ward er, um seiner Jugend, seiner Schönheit, seines aufblühenden Ruhmes willen.
Jetzt, sagte sich Anzoleto mit jener Raschheit des Durchschauens und Schließens, welche einigen wundersam organisierten Köpfen von Natur beiwohnt, jetzt bleibt nichts mehr übrig als mich gefürchtet zu machen, wenn ich mir nicht ein bitteres und lächerliches Erwachen von meinem Triumphe bereiten will. Aber was kann ich, solch ein armer Teufel, tun, dass sie, die Fürstin der Hölle in Person, mich fürchten müsse?
Seine Partie war bald ergriffen. Er entwickelte ein System von Bedenklichkeiten, Eifersüchteleien, Bitterkeiten, deren leidenschaftliches, coquettes Spiel die Prima Donna in Erstaunen setzte. Kurz zusammengefasst lautete ihr brünstiges und loses Liebesgeschwätz etwa so:
Anzoleto. – Ich weiß wohl, dass Sie mich nicht lieben, dass Sie mich nie lieben werden: das ist es was mich an Ihrer Seite traurig und befangen macht.
Corilla. – Und wenn ich dich liebte?
Anzoleto. – Dann würde ich völlig in Verzweiflung sein. Das hieße, mich aus dem Himmel nieder stürzen in einen Abgrund: ich müsste Sie verlieren vielleicht in der nächsten Stunde, nachdem ich Sie auf Kosten meines ganzen künftigen Glückes mir gewonnen hätte.
Corilla. – Und warum fürchtest du von mir eine solche Unbeständigkeit?
Anzoleto. – Zuerst, weil mein Verdienst gering ist, und sodann, weil man Ihnen so viel Schlechtes nachsagt.
Corilla. – Wer sagt mir denn Schlechtes nach?
Anzoleto. – Ach, alle Leute; denn alle Leute beten Sie an.
Corilla. – So würdest du, wenn ich Törin genug wäre, dich liebzugewinnen und es dir zu sagen, mich dann zurückstoßen?
Anzoleto. – Ich weiß nicht, ob ich Kraft genug haben würde, zu entfliehen: wenn ich sie aber hätte, wahrhaftig, nie im Leben würde ich Sie wiedersehen.
– Wohlan! rief die Corilla, mich reizt die Neugier eine Probe zu machen … Anzoleto, ich glaube in der Tat, dass ich dich liebe.
– Und ich, ich glaube es nicht, erwiderte er. Ich bleibe; denn ich sehe nur zu gut, dass Sie mich höhnen. Mit diesem Spiele können Sie mich nicht kirren, und noch viel weniger empfindlich machen.
– Du willst dich auf Finessen legen, scheint mir?
– Warum nicht? Ich bin nicht sehr zu fürchten, da ich Ihnen das Mittel biete, mich zu besiegen.
– Welches?
– Mich starr zu machen vor Schrecken und mich in die Flucht zu jagen durch dasselbe Wort im Ernste, das Sie mir jetzt im Spotte zugeworfen.
– Du bist ein abgefeimter Schelm! Ich sehe wohl dass man sich mit dir in Acht nehmen muss. Du bist einer von denen, welche sich nicht begnügen, den Duft der Rose zu atmen, sondern sie pflücken und unter Glas bringen wollen. Ich hätte dich in deinem Alter weder für so keck noch für so eigenwillig gehalten!
– Sind Sie mir deshalb gram?
– Im Gegenteile, du gefällst mir desto mehr. Gute Nacht, Anzoleto, wir sehen uns wieder.
Sie reichte ihm ihre schöne Hand, welche er mit Inbrunst küsste. Ich habe mich nicht übel herausgezogen, sagte er zu sich, während er unter den Galerien am Borde des Canaletto entschlüpfte.
Er glaubte nicht, dass man ihm noch zu dieser Stunde den Verschlag, wo er zu übernachten gewohnt war, öffnen würde und beschloss, sich auf der ersten, besten Türschwelle, auszustrecken, um jenes englischen Schlafes zu genießen, welcher nur den Kindern und den Armen vorbehalten ist. Aber zum ersten Male in seinem Leben fand er keine Fliese reinlich genug für sein Lager. Obschon das Straßenpflaster in Venedig sauberer und weißer ist als in irgend einer anderen Stadt auf Erden, so war doch solch ein ziemlich staubiges Bett nicht eben passend für einen schwarzen Anzug von dem feinsten Tuche und dem elegantesten Schnitte. Und dann der Anstand! Dieselben Schiffer, die am frühen Morgen vorsichtig über die Stiegen schritten, ohne die Lumpen des armen Jungen zu berühren, hätten ihn aus seinem Schlummer ausgeschimpft und die Prachtstücke seines geborgten Luxus vielleicht absichtlich besudelt, welche sie unter ihren Füßen fanden. Was hätten sie von einem Menschen denken sollen, der in seidenen Strümpfen, in feiner Wäsche, in Manchetten und Spitzenhalstuch unter freiem Himmel schlief?
Anzoleto vermisste in diesem Augenblicke recht empfindlich seine gute rotbraune Wollenkappe, die sehr schäbig und abgetragen, aber doch noch immer zwei Finger dick und äußerst dienlich war, um dem ungesunden Morgennebel, der aus der Wassermasse Venedigs aufsteigt, Trotz zu bieten. Es war in den letzten Tagen des Februar, und obwohl die Sonne um diese Jahreszeit unter dem dortigen Himmel schon recht stark leuchtet und wärmt, so sind die Nächte doch noch sehr kalt.
Es fiel ihm ein, sich in eine der Gondeln zu ducken, welche am Ufer lagen: er fand sie aber alle fest verschlossen. Endlich kam er an eine, deren Türe seinem Drucke wich; doch als er eindrang, stieß er an die Füße des Barcarolen, der sich dort zu seiner Nachtruhe zurückgezogen hatte und fiel über ihn hin.
– Beim Leib des Teufels! schrie ihn eine raue Stimme aus dem Innern dieser Höhle an, wer seid ihr? was wollt ihr?
– Bist du’s, Zanetto? erwiderte Anzoleto, da er die Stimme des Gondoliers erkannte, der ihm immer viel Freundlichkeit bewiesen hatte. Lass mich neben dir niederliegen und einen Schlaf unter Dach tun in deinem Hüttchen.
– Wer bist du denn? fragte Zanetto.
– Anzoleto; kennst du mich denn nicht?