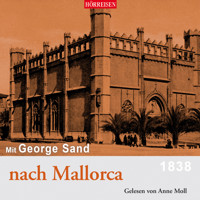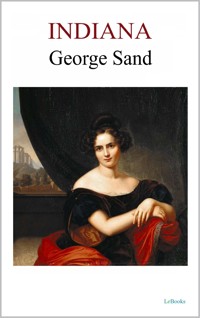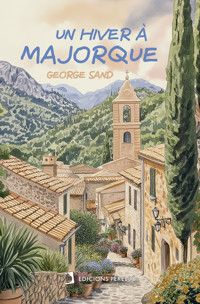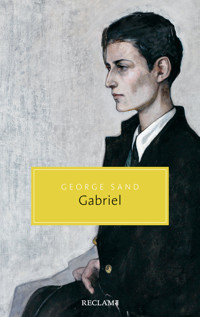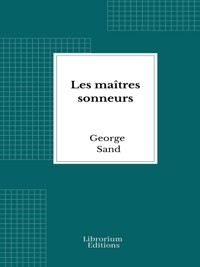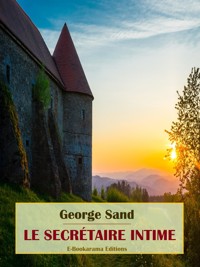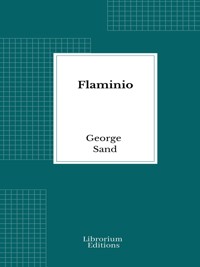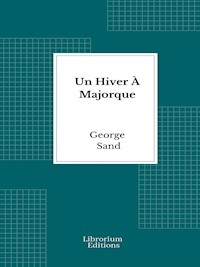Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
George Sands 'Geschichte meines Lebens' ist ein faszinierendes autobiografisches Werk, das die Leser*innen durch die turbulenten Zeiten des 19. Jahrhunderts führt. Sands Schreibstil ist persönlich und leidenschaftlich, was es leicht macht, sich mit ihren Erfahrungen und Emotionen zu identifizieren. Als eine der einflussreichsten Schriftstellerinnen ihrer Zeit liefert Sand einen einzigartigen Einblick in die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen ihrer Ära. Ihr Werk steht im Kontext der Romantik und des Realismus, was zu einer facettenreichen Darstellung ihrer Lebensgeschichte führt. Die Beschreibung von Liebe, Freiheit und ihrer kreativen Leidenschaft macht dieses Buch zu einem zeitlosen Klassiker.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2484
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
George Sand: Geschichte meines Lebens
Inhaltsverzeichnis
Erste Abtheilung
Erstes Kapitel
Ich glaube nicht, daß es hochmüthig und unbescheiden ist die Geschichte des eignen Lebens zu schreiben; besonders wenn wir aus den Erinnerungen, welche dies Leben in uns zurückgelassen hat, nur die auswählen, die uns der Erhaltung werth scheinen. Ich glaube damit sogar eine Pflicht, eine ziemlich schwere Pflicht zu erfüllen, denn ich kenne nichts Unbequemeres, als die eigne Persönlichkeit zu erklären und darzustellen.
Je mehr wir uns in die Ergründung des menschlichen Herzens vertiefen, um so unsichrer wird unser Blick, und für gewisse regsame Geister wird das Studium der Selbsterkenntniß immer ein langweiliges und unvollständiges sein. Und doch will ich diese Pflicht erfüllen; ich habe sie immer vor Augen gehabt und habe mir gelobt nicht zu sterben ohne vollbracht zu haben, was ich Andern anrieth: eine aufrichtige Erforschung des eignen Wesens und eine aufmerksame Prüfung des eignen Daseins.
Eine unüberwindliche Trägheit, — die Krankheit zu viel beschäftigter Geister und darum vor allem die der Jugend — hat mich bis heute an der Erfüllung dieser Aufgabe gehindert. Und vielleicht habe ich mich gegen mich selbst versündigt, indem ich das Erscheinen zahlreicher Biographien ruhig ansah, die voll Irrthümern aller Art waren, im Lob wie im Tadel. Es geht soweit, daß in einigen dieser Biographien, die erst im Auslande erschienen, dann in Frankreich mit allerhand phantastischen Ausschmückungen wiederholt wurden, selbst mein Name eine Fabel ist. Wenn ich durch diese Berichterstatter befragt oder aufgefordert wurde, nach Belieben einige Nachrichten über mein Leben zu geben, habe ich die Gleichgültigkeit so weit getrieben, daß ich selbst wohlwollenden Personen die kleinste Erklärung verweigerte. Ich muß gestehen, daß ich einen tödtlichen Widerwillen empfand, das Publikum mit meiner Persönlichkeit zu beschäftigen, die nichts Hervorragendes hat, während mir Wesen, die stärker, klarer, vollendeter, idealischer und mir weit überlegen sind — mit einem Worte Romanfiguren — Kopf und Herz erfüllten. Ich fühlte, daß man nur einmal im Leben sehr ernsthaft mit dem Publikum von sich selbst sprechen darf, um nie mehr darauf zurückzukommen.
Gewöhnen wir uns, von uns selbst zu sprechen, so kommen wir leicht und unwillkürlich dazu uns selbst zu loben, was eine natürliche Folge der Neigung des Menschen ist, den Gegenstand seiner Betrachtung zu verschönen und zu erheben. Es giebt sogar ein unbefangenes Selbstlob, vor dem wir nicht erschrecken dürfen, wenn es, wie das der Dichter, welche in dieser Beziehung ein besonderes geheiligtes Vorrecht haben, in die Formen der Lyrik gehüllt ist. Aber die Selbstbewunderung, die uns zu diesem kühnen Flug gen Himmel begeistert, ist der Mittelpunkt nicht, in den sich die Seele stellen kann, um lange von sich selbst mit den Menschen zu sprechen. In dieser Erregung geht ihr das Bewußtsein der eignen Schwächen verloren; sie identificirt sich mit der Gottheit, mit dem Ideale, dem sie nachstrebt. Die Regungen der Sehnsucht und der Reue, die sie in sich findet, dehnt sie bis zur Poesie der Verzweiflung und der Gewissensqual aus: sie wird Werther, oder Faust, oder Manfred, oder Zamba — erhabne Gestalten vom Gesichtspunkte der Kunst, die aber, ohne Hülfe philosophischer Erkenntnisse, zuweilen verderbliche Beispiele, oder unfaßbare Vorbilder geworden sind.
Und doch müssen diese großen Gemälde der mächtigsten Erregungen der Dichterseele auf ewig verehrt werden — wir müssen es den großen Künstlern verzeihen, wenn sie sich in Gewitterwolken oder Ruhmesstrahlen hüllen. Es ist ihr Recht — und indem sie uns das Ergebniß ihrer erhabensten Gefühle geben, haben sie ihre Sendung vollständig erfüllt. Aber auch in demüthigern Verhältnissen, unter gewöhnlichern Formen können wir eine ernste, unmittelbar nützliche Pflicht gegen unsere Nächsten erfüllen, indem wir uns ohne Symbol, ohne Heiligenschein und ohne Piedestal darstellen.
Gewiß ist es unmöglich, von der Fähigkeit der Dichter, ihr eignes Dasein zu idealisiren und zu etwas Abstractem, Unfaßbarem zu machen, eine vollständige Belehrung zu erwarten. Ohne Zweifel ist diese Fähigkeit Nutzen bringend und belebend, denn jeder Geist erhebt sich mit dem der begeisterten Träumer, jedes Gefühl reinigt oder erhöht sich, indem es ihnen in höhere Sphären folgt, — aber es fehlt dem flüchtigen Balsam, den sie über unsre Wunden ausgießen, etwas sehr Wichtiges: die Wirklichkeit.
Aber es wird dem Künstler schwer, diese Wirklichkeit zu berühren und nur großherzige Naturen können es mit Freuden thun. Ich muß gestehen, daß meine Liebe zur Pflicht nicht so weit reicht, und daß ich nicht ohne große Anstrengung zur Prosa meines Gegenstandes herabsteige.
Ich hatte immer gefunden, daß es ebenso viel schlechten Geschmack verräth, sich lange mit sich selbst zu unterhalten, als lange von sich selbst zu sprechen. Es giebt im Leben der gewöhnlichen Wesen wenige Tage, wenige Augenblicke, wo es interessant oder nützlich wäre sie zu beobachten. Aber zuweilen habe ich solche Tage und Augenblicke gehabt; dann habe ich gefühlt, wie Andre fühlen, und habe die Feder ergriffen, um einen lebhaften Schmerz, der mich bedrängte, oder eine heftige Angst, die mich durchwühlte, ausströmen zu lassen. Die Mehrzahl dieser Fragmente ist nicht veröffentlicht und sie werden mir, bei der Uebersicht meines Lebens, als Merkzeichen dienen. Nur einige derselben haben in Briefen, die zu verschiedenen Zeiten erschienen und von verschiedenen Orten datirt sind, eine halb vertrauliche, halb literarische Gestalt angenommen und sind unter dem Titel „Briefe eines Reisenden“ zusammengestellt. Zur Zeit als ich diese Briefe schrieb, war mir der Gedanke, von mir selbst zu sprechen, um so weniger peinlich, da ich, buchstäblich genommen, nicht mich selbst darstellte. Dieser „Reisende“ war eine Fiction, ein gedachtes Wesen; männlich wie mein Pseudonym; alt, obwohl ich noch jung war — und diesem traurigen Pilger, der eigentlich auch nur ein Romanheld ist, legte ich subjectivere Empfindungen und Reflexionen in den Mund, als ich im Roman, der strengern Kunstgesetzen unterworfen ist, gewagt haben würde. Ich fühlte damals das Bedürfniß gewissen Gemüthsbewegungen einen Ausdruck zu geben, aber nicht das Verlangen, den Leser mit mir selbst zu beschäftigen. Dieses Verlangen, das bei Allen ein kindisches und, beim Künstler wenigstens, ein gefährliches ist, fühle ich jetzt vielleicht noch weniger als sonst. Ich werde sagen, warum ich es nicht fühle und warum ich doch schreiben werde, als ob ich's hätte — wie man ißt aus Vernunft, ohne den geringsten Appetit zu spüren.
Ich habe es nicht, weil ich in das Alter der Ruhe gelangt bin, wo meine Persönlichkeit durch Hervortreten nichts zu gewinnen hat, und wenn ich nur meinen Trieben folgte, nur meine Wünsche um Rath fragte, würde ich mich bestreben mein Ich vollständig zu vergessen und vergessen zu machen. Ich suche nicht mehr die Lösung der Räthsel, die meine Jugend gepeinigt haben und ich habe in mir manche Streitfrage entschieden, die meinen Schlummer störte. Man hat mir geholfen dabei, denn für mich allein wäre ich schwerlich zur Klarheit gelangt.
Mein Zeitalter hat Funken der Wahrheiten, die es in sicht trägt, aufleuchten lassen. Ich habe sie gesehen, ich weiß, wo ihre Brennpunkte liegen und das genügt mir. Früher habe ich das Licht in psychologischen Resultaten gesucht, das war widersinnig; seit ich begriffen habe, daß dies Licht in Principien liegt und daß diese Principien in mir sind, ohne in mir entstanden zu sein, habe ich ohne viel Anstrengung und ohne Verdienst die Ruhe des Geistes gefunden. Die des Herzens habe ich nicht erlangt, und werde sie nie erlangen; denn Alle, die mitfühlend geboren sind, werden immer auf Erden etwas zu lieben, zu beklagen, zu unterstützen und zu leiden haben. Wir dürfen also in keinem Alter des Lebens das Aufhören des Schmerzes, der Anstrengung und des Schreckens suchen, denn das wäre Gefühllosigkeit, Ohnmacht, frühzeitiger Tod. Wir werden die Uebel des Lebens leichter ertragen, wenn wir sie als unheilbar hinnehmen.
In dieser Ruhe der Gedanken und in dieser Ergebung des Gefühls kann ich ebensowenig Bitterkeit gegen das Menschengeschlecht empfinden, das so häufig irrt, als Enthusiasmus für mich selbst, die ich so lange geirrt habe. Es ist also weder der Reiz des Kampfes, noch das Bedürfniß der Mittheilung, das mich veranlaßt von meiner Vergangenheit oder von meiner Gegenwart zu sprechen.
Aber ich habe gesagt, daß ich es für Pflicht halte, davon zu reden und meine Gründe sind folgende:
Viele menschliche Wesen leben, ohne sich von ihrem Dasein ernsthaft Rechenschaft zu geben, ohne zu verstehen und fast ohne zu fragen, welche Absichten die Vorsehung mit ihnen hat, sowohl in Bezug auf ihre Individualität, wie in Bezug auf die Gesellschaft, zu der sie gehören. Sie gehen an uns vorüber, ohne sich uns zu erschließen, weil sie vegetiren, ohne sich selbst zu erkennen. Und wenn auch ihr Dasein, mag es noch so mangelhaft entwickelt sein, immer einen gewissen Nutzen, eine gewisse Nothwendigkeit nach den Gesetzen der Vorsehung erfüllt, so ist es doch leider gewiß, daß die Offenbarung ihres Lebens unvollkommen und für die übrige Menschheit moralisch unfruchtbar bleibt.
Die lebendigste und ergiebigste Quelle der Entwicklung des Menschengeistes ist — um die Sprache meiner Zeit zu sprechen — der Begriff der Solidarität [Im vergangenen Jahrhundert hätte man Empfindsamkeit gesagt, in frühern Zeiten christliche Liebe, vor fünfzig Jahren Brüderlichkeit.]. Den Menschen aller Zeiten ist er deutlich oder undeutlich zum Bewußtsein gekommen und so oft einer unter ihnen mit der mehr oder minder entwickelten Fähigkeit begabt gewesen ist, das eigne Dasein zu offenbaren, ist er zu dieser Offenbarung durch den Wunsch seiner Umgebung oder durch eine innere, mächtige Stimme getrieben. Es war ihm dann, als ob es sich um die Erfüllung einer Verpflichtung handelte — und so war es in der That; mochten nun historische Ereignisse zu erzählen sein, deren Zeuge er gewesen war; mochte er mit einflußreichen Persönlichkeiten verkehrt oder als Reisender Menschen und Dinge von neuen Gesichtspunkten aufgefaßt haben.
Es giebt noch eine Art subjectiver Arbeit, welche seltener vollbracht wird, und welche meiner Meinung nach von ebenso großem Nutzen ist: ich meine die Arbeit, das innere, seelische Leben zu erzählen, das heißt, eine Geschichte des eignen Geistes und eignen Herzens, zur Belehrung für die Brüder. Wenn diese subjectiven Eindrücke, diese Reisen oder Reiseversuche in die abstracte Welt des Gedankens oder des Gefühls von einem aufrichtigen, ernsten Geiste mitgetheilt werden, können sie eine Anregung, eine Ermuthigung und selbst ein Rath für andere Geister sein, die noch im Labyrinth des Lebens irren. Es ist gleichsam ein Austausch des Vertrauens und der Sympathie, welcher gleichzeitig die Seele des Erzählers und des Hörers erhebt. Im gewöhnlichen Leben veranlaßt uns ein natürlicher Trieb zu diesen ebenso demüthigen als stolzen Mittheilungen — denn wenn ein Freund, ein Bruder uns die Qualen und Verwirrungen seiner Lage gesteht, haben wir keine bessern Beweisgründe, um ihn zu stärken und zu überzeugen, als diejenigen, die wir aus unserer Erfahrung schöpfen; so sehr fühlen wir dann, daß das Leben eines Freundes unser eignes ist, wie das Leben des Einzelnen dem Ganzen gehört. „Ich habe dieselben Uebel ertragen, ich habe dieselben Klippen durchschifft und ich habe das überwunden, also kannst auch Du genesen und siegen“ — das ist's, was der Freund dem Freunde, der Mensch dem Menschen sagt. Und wer von uns hätte nicht, in den Augenblicken der Niedergeschlagenheit und der Verzweiflung, wenn die Liebe und Hülfe eines andern Wesens unentbehrlich sind, einen mächtigen Eindruck durch die Ergießungen der Seele empfangen, der wir eben unsere Schmerzen vertrauten?
So ist es also die geprüfteste Seele, die am meisten Gewalt über Andere hat. In Gemüthsbewegungen suchen wir nicht leicht die Unterstützung des Zweiflers, des Spötters oder des Stolzen; nach einem, der unglücklich ist wie wir, oder noch unglücklicher, wenden wir die Blicke und strecken wir die Hände aus. Ueberraschen wir ihn im Augenblick der Noth, so wird er das Mitleid kennen und mit uns weinen; rufen wir ihn an, wenn er im vollen Besitz der Kraft und Klarheit ist, so wird er uns leiten und retten vielleicht — aber jedenfalls wird er nur insoweit von Einfluß auf uns sein, als er uns versteht; und damit er uns verstehe, muß er unser Vertrauen mit etwas Aehnlichem zu erwiedern haben.
Die Erzählung der Leiden und Kämpfe aus dem Leben des Einzelnen ist also Belehrung für Alle; es würde auch Hülfe für Alle sein, wenn Jeder wüßte, wodurch er gelitten und was ihn gerettet hat. Von diesem erhabenen Gesichtspunkte aus und beherrscht von einem glühenden Glaubenseifer, schrieb der heilige Augustin seine Bekenntnisse, welche zugleich die seines Jahrhunderts waren und mehrern christlichen Generationen wirksame Hülfe gewährten.
Eine weite Kluft trennt die Bekenntnisse J. J. Rousseau's von denen des Kirchenvaters. Das Ziel des Philosophen aus dem 18. Jahrhundert erscheint subjectiver, also weniger ernst und weniger nützlich. Er beschuldigt sich, um Gelegenheit zu Entschuldigungen zu haben; er enthüllt verborgene Fehler, um öffentliche Verleumdungen zurückzuweisen. So ist das Ganze ein Gemisch von Hochmuth und Demuth, das uns zuweilen durch seine Affectation empört, oft durch seine Aufrichtigkeit entzückt und hinreißt. Darum enthält die berühmte Schrift, so fehlerhaft und strafbar sie auch sein mag, die ernstesten Lehren und je mehr sich der Märtyrer, in der Verfolgung seines Ideals, erniedrigt und verirrt, um so mehr werden wir von diesem Ideale ergriffen und angezogen.
Man hat die Bekenntnisse Jean Jacques' zu lange als rein persönliche Apologie betrachtet. Er hat sich zum Mitschuldigen dieses schlechten Erfolges gemacht, denn er hat ihn durch die Vorurtheile herbeigeführt, die in sein Werk verwebt sind. Aber heutigen Tages, da seine persönlichen Freunde und Feinde nicht mehr leben, beurtheilen wir das Buch von einem höhern Gesichtspunkte. Es kommt uns nicht mehr darauf an zu wissen, bis zu welchem Grade der Verfasser der Bekenntnisse ungerecht oder krank war und bis zu welchem Grade seine Verleumder sich ruchlos oder grausam bewiesen. Was uns interessirt, uns erleuchtet und Einfluß auf uns übt, ist der Anblick dieser begeisterten Seele im Kampfe mit den Irrthümern seiner Zeit und den Hindernissen seiner philosophischen Bestimmung. Es ist das Ringen dieses Genius, der für Sittenstrenge, Unabhängigkeit und Würde glüht, mit der leichtsinnigen, ungläubigen und verderbten Gesellschaft, in der er sich bewegt — die zu jeder Stunde, bald durch Verführung, bald durch Bedrückung auf ihn einwirkt und ihn bald in den Abgrund der Verzweiflung wirft, bald zu erhabnen Widersprüchen aufruft.
Wenn die Grundidee der Bekenntnisse gut wäre, wenn eine Pflichterfüllung darin läge, unsere kindischen Vergehen aufzusuchen und unsre unvermeidlichen Fehler zu erzählen, würde auch ich vor dieser öffentlichen Buße nicht zurückweichen. Aber nach meiner Ansicht ist diese Art sich anzuklagen durchaus nicht demüthig, auch hat sich das allgemeine Gefühl nicht täuschen lassen. Es ist weder nützlich noch erbaulich zu wissen, daß Jean Jacques Rousseau meinem Großvater drei Francs zehn Sous gestohlen hat, um so mehr, da die Thatsache nicht erwiesen ist. [Dies ist der Tatbestand, wie ich ihn in den Papieren meiner Großmutter gefunden habe: „Francueil, mein Mann, sagte eines Tages zu Jean Jacques, laßt uns in's Theater français gehen. Ja wohl, sagte Rousseau, das wird uns wenigstens für eine oder zwei Stunden zu gähnen geben. — Dies ist vielleicht die einzige witzige Antwort, die er in seinem Leben gegeben hat und noch dazu ist sie nicht sehr geistreich. Vielleicht war es an diesem Abend, daß Rousseau meinem Manne drei Francs zehn Sous entwendete. Uns ist die Erzählung dieser Spitzbüberei immer wie eine Affectation erschienen. Francueil hatte keine Erinnerung daran bewahrt, er dachte sogar, daß Rousseau sie erfunden hätte, um die Zartheit seines Gewissens zu beweisen und um zu verhindern, daß man an Sünden glaubte, die er nicht bekannte. — Und überdies, wenn es wahr wäre, guter Jean Jacques! Ihr müßtet heute Eure Peitsche ganz anders knallen lassen, wenn wir nur die Ohren danach spitzen sollten.“] Auch ich erinnere mich, in meiner Kindheit heimlich und mit Vergnügen zehn Sous aus dem Geldbeutel meiner Großmutter genommen zu haben, um sie einem Armen zu geben. Ich finde, daß darin kein Grund liegt, mich zu loben oder anzuklagen; es war ganz einfach ein dummer Streich, denn um das Geld zu bekommen, brauchte ich es nur zu verlangen.
So sind die meisten Fehler von uns ehrlichen Leuten auch weiter nichts, als dumme Streiche, und wir wären sehr thöricht, uns deshalb vor den Unredlichen zu beschuldigen, die das Böse mit Kunst und Vorbedacht ausüben. Das Publikum besteht aus den Einen und Andern, und es ist ihm wahrlich zu viel Aufmerksamkeit bewiesen, wenn wir uns schlechter darstellen, als wir sind, um es zu rühren oder ihm zu gefallen.
Ich leide unendlich, wenn ich den großen Rousseau sich so erniedrigen und sich einbilden sehe, daß er durch Uebertreibung oder wohl gar Erfindung dieser Sünden sich von den Herzensfehlern reinigt, die seine Feinde ihm zuschreiben. Durch seine Bekenntnisse hat er sie sicherlich nicht entwaffnet; aber genügt es nicht, um ihn rein und gut zu glauben, die Theile seines Lebens zu lesen, in denen er sich anzuklagen vergißt? nur in diesen ist er unbefangen; das fühlt sich leicht.
Darum, mögen wir rein oder unrein, klein oder groß sein, es bleibt immer Eitelkeit, kindische, unglückliche Eitelkeit, die eigne Rechtfertigung unternehmen zu wollen. Ich habe nie begriffen, wie ein Angeklagter auf der Bank des Verbrechens irgend etwas zu erwiedern vermag. Ist er schuldig, so wird er es noch mehr durch die Lüge, und die entdeckte Unwahrheit fügt zu der Härte der Strafe Demüthigung und Schande. Ist er aber unschuldig, wie mag er sich so weit erniedrigen, dies beweisen zu wollen?
Und hier handelt es sich doch um Ehre und Leben — aber wenn wir uns im gewöhnlichen Verlauf des Daseins so leidenschaftlich bemühen, die Verleumdung zurückzuweisen, die Jeden, auch den Besten erreicht, und die Vortrefflichkeit unseres Ich zu beweisen, müssen wir entweder in uns selbst verliebt sein, oder ein wichtiges Unternehmen zu vollführen haben. Mag eine Rechtfertigung im öffentlichen Leben zuweilen nothwendig sein — im Privatleben wird Niemand durch Reden seine Rechtschaffenheit beweisen, noch uns von seiner Vollkommenheit überzeugen. Wir müssen denen, die uns kennen, die Sorge überlassen, uns von unsern Mängeln freizusprechen und unsre Eigenschaften zu schätzen.
Endlich, da wir für einander verantwortlich sind, giebt es kein für sich allein stehendes Vergehen. Es giebt keine Verirrung, von der nicht irgend Jemand Ursache oder Mitschuldiger wäre, und es ist unmöglich, sich selbst anzuklagen, ohne den Nächsten zu beschuldigen — nicht allein den Feind, der uns angreift, sondern häufig auch den Freund, der uns vertheidigt. Das hat Rousseau gethan und das ist schlecht. Wer kann ihm verzeihen, mit seinen eigenen Bekenntnissen auch die der Frau von Warrens abgelegt zu haben?
Verzeih' mir Jean Jacques, daß ich Dich tadle, indem ich das herrliche Buch Deiner Bekenntnisse schließe! Ich tadle Dich, aber auch das ist eine Huldigung, denn dieser Tadel zerstört weder meine Achtung noch meine Begeisterung für den Kern Deines Werkes.
Ich meinestheils will hier kein Kunstwerk schaffen; ich verwahre mich sogar dagegen; Mittheilungen wie diese haben nur Werth durch Natürlichkeit und Unbefangenheit — auch möchte ich mein Leben nicht wie einen Roman erzählen, denn der Inhalt würde in der Form verschwinden.
Ich werde also ohne Ordnung und Zusammenhang reden und selbst in viele Widersprüche verfallen dürfen. Die menschliche Natur ist nur ein Gewebe von Inconsequenzen und ich glaube gar nicht — aber auch gar nicht — an diejenigen, die behaupten, daß sie sich mit dem Ich von gestern immer im Einklang befunden haben.
Meine Arbeit wird demnach auch in der Form Spuren des Sichgehenlassens meines Geistes tragen; und um damit den Anfang zu machen, werde ich die Darlegung meiner Ansicht von der Nützlichkeit dieser Memoiren hier beschließen, und sie in der fortschreitenden Entwicklung der Geschichte, die ich jetzt beginne, durch Beispiele zu vervollständigen suchen.
Möge keiner von denen, die mir Böses gethan haben, erschrecken, ich erinnere mich ihrer nicht; und möge kein Freund des Skandales sich freuen — ich schreibe nicht für ihn.
Ich bin geboren im Jahre der Krönung Napoleon's, dem XII. Jahre der französischen Republik (1804). Mein Name ist nicht Maria Aurora von Sachsen, Marquise von Dudevant, wie einige meiner Biographen entdeckt haben, sondern Amantine Lucile Aurore Dupin und mein Mann, Franz Dudevant, legt sich keine Würden bei. Er ist nie mehr gewesen, als Secondelieutenant der Infanterie und war siebenundzwanzig Jahr alt, als ich ihn heirathete. Wer ihn zu einem alten Obersten des Kaiserreichs macht, verwechselt ihn mit Herrn Delmare, einer meiner Romanfiguren. Es ist wirklich nur zu leicht und erfordert keinen Aufwand von Erfindungskraft, die Lebensgeschichte eines Schriftstellers zu entwerfen, indem man die Fictionen seiner Erzählungen in die Wirklichkeit seines Daseins überträgt.
Vielleicht hat man auch ihn und mich mit unsern Vorfahren verwechselt. Maria Aurora von Sachsen war meine Großmutter; und der Vater meines Mannes war Cavalerie-Oberst zur Kaiserzeit. Aber er war weder roh noch mürrisch, sondern der beste und sanfteste der Männer.
Bei dieser Gelegenheit muß ich bemerken — auf die Gefahr hin mich mit meinen Biographen zu veruneinigen und ihr Wohlwollen durch Undank zu vergelten — daß ich es weder zart, noch schicklich, noch redlich finde, wenn sie, um mich zu entschuldigen, weil ich in meinen ehelichen Verhältnissen nicht ausdauern konnte und auf Scheidung geklagt habe, meinem Gatten ein Unrecht aufbürden, über das ich, seit Wiedererlangung meiner Unabhängigkeit, vollständig geschwiegen habe. Es ist nicht zu verhindern, daß sich das Publikum in müßigen Stunden mit der Erinnerung solcher Processe beschäftigt, und daß es bald für die eine, bald für die andere Partei ein günstiges Urtheil festhält. Wer die Oeffentlichkeit solcher Verhandlungen nicht gescheut und überwunden hat, wird auch dies ertragen. Aber Schriftsteller, die das Leben eines Andern erzählen; die besonders, welche zu seinen Gunsten gestimmt sind und ihn vor der öffentlichen Meinung erhöhen oder rechtfertigen wollen, sollten nicht gegen sein Gefühl und seinen Willen handeln, indem sie ihn mit Stoß und Hieb zu vertheidigen suchen. Die Aufgabe eines Schriftstellers ist in solchem Falle gleich der eines Freundes und unsre Freunde dürfen es nie an Rücksichten fehlen lassen, auf denen, streng genommen, die öffentliche Moral beruht. Mein Gatte lebt; er liest weder meine Schriften noch das, was über mich geschrieben wird — das ist eine Ursache mehr für mich, die Angriffe zurückzuweisen, deren Gegenstand er meinetwegen ist. Ich habe nicht mit ihm leben können, weil unsere Charaktere und Meinungen wesentlich verschieden waren. Thörichte Nachschläge haben ihn veranlaßt, sich in öffentliche Verhandlungen einzulassen, die uns gegenseitig nöthigten, uns zu beschuldigen — traurige Folgen einer unvollkommenen Gesetzgebung, welche die Zukunft verbessern wird. Seit meine Scheidung ausgesprochen und anerkannt ist, habe ich bereits meine Beschwerden vergessen, und darum muß mir jeder öffentliche Vorwurf gegen ihn unpassend erscheinen, da er an die Fortdauer eines Grolles glauben läßt, an dem ich keinen Theil mehr habe.
Nachdem dies festgestellt ist, wird man errathen, daß ich die Akten meines Processes nicht in diese Memoiren übertragen werde. Ich würde meine Aufgabe zu sehr erschweren, wenn ich kindischer Rachsucht und bitteren Erinnerungen Platz gewährte. Ich habe viel gelitten durch diese Verhältnisse, aber ich schreibe nicht, um zu klagen und um mich trösten zu lassen. Die Schmerzen, von denen ich auf Anlaß rein persönlicher Erlebnisse erzählen könnte, würden nicht von allgemeinem Nutzen sein, also werde ich nur die mittheilen, denen alle Menschen ausgesetzt sind. Darum noch einmal, Freunde des Skandals, schließt mein Buch bei der ersten Seite, es ist nicht für Euch geschrieben.
Dies ist wahrscheinlich Alles, was ich über meine Ehe zu sagen haben werde, und ich habe es gleich gesagt, um einem Gebote meines Gewissens zu gehorchen. Ich weiß, daß es nicht vorsichtig ist, Biographen zu widerlegen, die zu unsern Gunsten gestimmt sind, und die uns mit einer Durchsicht und Ergänzung unserer Mittheilungen bedrohen können; aber ich bin nie in irgend welcher Art vorsichtig gewesen und ich habe auch nicht gesehen, daß Andere, die sich Mühe gaben, es zu sein, mehr geschont wären, als ich — mit der Aussicht auf gleichen Erfolg wird es aber wohl gestattet sein, den Impulsen unseres Wesens zu folgen.
Und nun verlasse ich bis auf Weiteres das Kapitel meiner Heirath und kehre zu dem meiner Geburt zurück.
Diese Geburt, die in Bezug auf beide Zweige meiner Familie so oft und in so eigenthümlicher Weise besprochen wurde, hat in der That etwas Sonderbares und hat mich zu häufigem Nachdenken über die Frage der Abstammungen veranlaßt.
Ich habe besonders meine ausländischen Biographen im Verdacht, sehr aristokratisch zu sein, denn sie Alle haben mich mit einer vornehmen Herkunft beschenkt, ohne, wie sie als wohlunterrichtete Leute gethan haben müßten, auf einen sehr sichtbaren Fleck in meinem Wappen Rücksicht zu nehmen.
Man ist nicht allein das Kind seines Vaters, man ist, wie ich glaube, auch ein wenig das seiner Mutter — es scheint mir sogar, als wären wir dies am meisten; als wären wir auf das Unmittelbarste, Mächtigste, Heiligste mit dem Wesen verbunden, das uns unter seinem Herzen getragen hat. Wenn also mein Vater der Ur-Enkel Augusts II., Königs von Polen ist, so daß ich mich von dieser Seite, zwar auf illegitime, aber unzweifelhafte Weise mit Karl X. und Ludwig XVIII. nahe verwandt fühle, ist es nicht weniger wahr, daß ich durch mein Blut dem Volke ebenso nahe stehe — und auf dieser Seite ist noch dazu kein Bastardthum.
Meine Mutter war ein armes Kind der alten Stadt Paris; ihr Vater Anton Delaborde war Ballspielhaus-Aufseher und Meister Vogler, das heißt, er verkaufte Kanarienvögel und Stieglitze auf dem Quai aux oiseaux, nachdem er in irgend einem Winkel von Paris ein kleines Estaminet mit Billard besessen hatte, wobei er jedoch schlechte Geschäfte machte. Der Pathe meiner Mutter hatte überdies einen berühmten Namen im Vogelgeschäft; er hieß Barra und sein Name steht noch jetzt auf dem Boulevard du temple über einem Bauwerk aus Käfigen von allen Größen, in welchen immer eine Menge gefiederter Wesen fröhlich singen, die ich wie ebenso viele Pathen und Pathinnen zu betrachten pflege; wie geheimnißvolle Beschützer, mit denen mich immer eine besondere Sympathie verbunden hat.
Wer vermag die Wahlverwandtschaft zu erklären, die zwischen dem Menschen und gewissen untergeordneten Wesen der Schöpfung stattfindet? sie besteht ebenso gewiß, wie die Antipathie und die unüberwindliche Angst, die uns einige ganz unschädliche Thiere einflößen. Mir ist die Sympathie der Thiere so zugewendet, daß meine Freunde davon oft, wie von einem Wunder überrascht sind. Ich habe in dieser Weise die außerordentlichsten Erziehungen vollendet, aber besonders bei Vögeln. Sie sind die einzigen Geschöpfe, auf die ich jemals eine Art Zauber geübt habe — und wenn es eitel ist, mich dessen zu rühmen, muß ich bei ihnen um Verzeihung bitten.
Ich habe diese Gabe von meiner Mutter, der sie in noch höherem Grade eigen war, als mir, so daß sie in unserm Garten immer von kecken Sperlingen, beweglichen Grasmücken und muntern Finken begleitet wurde, die in Freiheit auf den Bäumen lebten, aber zutraulich die Hände pickten, die sie fütterten. Ich möchte wetten, daß sie diesen Einfluß von ihrem Vater geerbt hatte, und daß dieser nicht durch einen Zufall der Verhältnisse veranlaßt war, Vogelhändler zu werden, sondern durch den natürlichen Hang, sich den Wesen zu nähern, mit denen er durch Instinkt verbunden war. Niemand hat Martin, Carter und van Amburgh eine besondere Macht über die Natur der wilden Thiere abgesprochen, und ich hoffe, daß man auch mir mein savoir-faire und savoir-vivre mit den geflügelten Zweifüßlern nicht abstreiten wird, die vielleicht in meinem frühern Dasein eine wichtige Rolle spielten.
Doch Scherz bei Seite; es ist gewiß, daß jeder von uns ein bestimmtes, oft sogar leidenschaftliches Vorurtheil für oder gegen gewisse Thiere empfindet. Der Hund spielt eine außerordentliche Rolle im Menschenleben und das beruht auf einem Geheimnisse, das noch nicht vollständig ergründet ist. Ich habe eine Magd gehabt, die von der Leidenschaft für Schweine erfüllt war und vor Schmerz ohnmächtig wurde, wenn sie dieselben in die Hände des Schlächters übergehen sah; ich dagegen, obwohl ich auf dem Lande fast bäuerisch erzogen bin, wo ich mich an den Anblick dieser Thiere gewöhnt haben sollte, die bei uns in Menge gehalten wurden, habe immer eine kindische, unüberwindliche Furcht davor gehabt, so daß ich den Kopf verliere, wenn ich mich von diesen unsaubern Geschöpfen umgeben sehe; ich möchte mich hundertmal lieber zwischen Löwen und Tigern befinden.
Vielleicht kommt es daher, weil alle die Typen, die einzeln den verschiedenen Thier-Geschlechtern zugetheilt sind, sich im Menschen wiederfinden. Die Physiognomiker haben körperliche Aehnlichkeiten nachgewiesen — wer vermöchte die geistigen zu leugnen? Giebt es nicht unter uns Füchse, Wölfe, Löwen, Adler, Maikäfer und Fliegen? Die menschliche Rohheit ist oft niedrig und wild, wie die Gier des Schweines, und auch im Menschen erfüllt mich dies am meisten mit Schrecken und Ekel. Ich liebe den Hund, aber nicht alle Hunde; ich habe sogar eine entschiedene Abneigung gegen gewisse Individualitäten dieses Geschlechts. Ich liebe sie, wenn sie ungehorsam, kühn, mürrisch und unabhängig sind, aber die Gier, die allen eigen ist, thut mir weh. Sie sind vortreffliche, in mancher Beziehung wunderbar begabte Wesen: aber in einzelnen Punkten, in denen die Rohheit des Thieres zu sehr ihr Recht behauptet, sind sie unverbesserlich. Der Hunde-Mensch ist kein schöner Typus.
Aber vom Vogel behaupte ich, daß er das höchste Wesen der Schöpfung ist. Seine Organisation ist ganz bewunderungswürdig; sein Flug stellt ihn in materieller Hinsicht über den Menschen und schafft ihm eine Macht, die unsere Erfindungskraft noch nicht errungen hat. Sein Schnabel und seine Krallen besitzen eine unglaubliche Geschicklichkeit. Er hat den Instinkt der ehelichen Liebe, der Vorsorglichkeit, des häuslichen Fleißes. Sein Nest ist ein Meisterstück von Kunstfertigkeit, Sorgsamkeit und zierlicher Schönheit. Die Hauptart ist diejenige, in welcher das Männchen dem Weibchen in Erfüllung der Familienpflichten beisteht; in welcher der Vater, wie bei den Menschen, das Haus baut, die Kinder schützt und nährt. Der Vogel ist Sänger; er ist schön; er besitzt Grazie, Leichtigkeit, Lebhaftigkeit, Anhänglichkeit, Sittenreinheit, und man hat sehr unrecht gethan, ihn oft zum Vorbilde der Unbeständigkeit zu machen. Soweit der Instinkt der Treue den Thieren gegeben ist, ist er das treueste unter ihnen. Im oft gepriesenen Hundegeschlecht hat das Weibchen allein die Liebe der Nachkommenschaft, wodurch es über dem Männchen steht; aber bei den Vögeln stellen beide Geschlechter, die mit gleichen Tugenden begabt sind, das Ideal der Ehe dar. Man rede also nicht verächtlich von den Vögeln. Es fehlt wenig daran, daß sie uns gleichständen — und als Sänger wie als Dichter sind sie besser begabt als wir. Der Vogel-Mensch ist der Künstler.
Da ich einmal beim Kapitel der Vögel bin — und warum sollte ich es nicht erschöpfen, da ich mir einmal unendliche Abschweifungen gestattet habe — werde ich einen Vorfall erzählen, dessen Zeuge ich gewesen bin, und den ich Büffon, diesem sanften Dichter der Natur, mitgetheilt haben möchte. Ich erzog zwei Grasmücken aus verschiedenen Nestern und von verschiedener Art: die eine mit gelber Brust, die andere mit grauem Mieder. Die Gelb--Brust, die Jonquille hieß, war um vierzehn Tage älter, als die Grau-Brust, die Agathe genannt wurde. Vierzehn Tage für eine Grasmücke — die Grasmücke ist unter unseren kleinern Vögeln am klügsten und gelangt am frühsten zur Reife — kommen zehn Jahren eines jungen Mädchens gleich. Jonquille war also ein nettes Jüngferchen, zwar noch mager und schlecht befiedert, unfähig weiter zu fliegen, als von einem Zweige zum andern, und selbst nicht im Stande allein zu fressen; denn die Vögel, die der Mensch erzieht, entwickeln sich später, als die in der Wildniß aufwachsenden. Die Grasmücken-Mütter sind viel strenger als wir, und Jonquille würde vierzehn Tage früher allein gefressen haben, wenn ich so klug gewesen wäre, sie dazu zu zwingen, indem ich sie sich selbst überließ und ihre Zudringlichkeit nicht beachtete.
Agathe war ein unausstehliches kleines Kind; sie konnte nichts als Unruhe stiften, schreien, ihre sprießenden Federn schütteln und Jonquille quälen, die bereits anfing ernsthaft zu werden und sich in Gedanken zu vertiefen, indem sie die eine Kralle in die Federn ihres Kleides steckte, den Kopf zwischen die Schultern zog und die Augen zur Hälfte schloß.
Indessen war auch sie noch sehr kindisch und sehr naschhaft. Und so oft ich die Unvorsichtigkeit beging, sie anzusehen, bemühte sie sich bis zu mir zu fliegen, um sich satt zu fressen.
Eines Tages schrieb ich an einem Roman, der mich etwas erregte. Ich hatte den grünen Zweig, auf welchem meine beiden Zöglinge in Eintracht zusammen saßen und lebten, in einiger Entfernung aufgestellt. Es war etwas kühl; Agathe, die noch halb nackt war, hatte sich unter Jonquille zusammengekauert, und diese erfüllte ihre Mutter-Rolle mit großmüthiger Gefälligkeit. So saßen beide eine halbe Stunde ruhig neben einander, und ich benutzte die Zeit zum Schreiben, denn es war selten, daß sie mir am Tage so viel Muße ließen.
Aber endlich erwachte der Hunger; Jonquille sprang auf einen Stuhl, dann auf den Tisch und löschte das Wort aus, das mir eben aus der Feder floß, während Agathe, die ihren Zweig nicht zu verlassen wagte, mit den Flügeln schlug und mir den offenen Schnabel mit verzweiflungsvollem Geschrei entgegenstreckte.
Ich war in der Mitte meiner Entwicklung und wurde zum ersten Male etwas ärgerlich gegen Jonquille. Ich stellte ihr vor, daß sie alt genug wäre, um allein zu fressen, daß sie vor ihrem Schnabel ein vortreffliches Futter in einer hübschen Tassenschale fände, und daß ich entschlossen wäre, ihrer Faulheit nicht länger nachzugeben. Die empfindliche und eigensinnige Jonquille zog sich trotzend auf ihren Zweig zurück; aber Agathe fügte sich nicht, wendete sich zu ihrer Gefährtin und bat sie um Nahrung mit unglaublicher Beharrlichkeit. Wahrscheinlich bat sie auf sehr beredtsame Weise, oder wenn sie sich noch nicht gut auszudrücken vermochte, lag etwas in dem Ton ihrer Stimme, das ein gefühlvolles Herz zerreißen mußte. Ich Grausame sah und hörte ruhig zu und beobachtete Jonquille's sichtliche Bewegung; sie schien unschlüssig zu sein und innerlich einen außerordentlichen Kampf zu kämpfen.
Endlich waffnet sie sich mit Entschlossenheit, fliegt mit einem Schwung bis zur Tassenschale, schreit einen Augenblick, als hoffte sie, das Futter sollte allein in ihren Schnabel kommen, doch zuletzt entschließt sie sich es selber anzugreifen. Aber o Wunder der Liebe! sie vergißt den eigenen Hunger zu stillen, füllt ihren Schnabel und kehrt auf den Zweig zurück, wo sie Agathe so geschickt und reinlich füttert, als wenn sie selbst schon Mutter wäre.
Seit diesem Augenblicke belästigten mich Agathe und Jonquille nicht mehr. Die Kleinere wurde durch die Aeltere aufgezogen und diese erfüllte ihre Aufgabe weit besser als ich, denn Agathe wurde reinlich, glänzend und fett und lernte viel schneller sich selbst bedienen, als unter meiner Leitung. So hatte diese arme Kleine ihre Gefährtin zu ihrer Pflegetochter gemacht, obwohl sie selbst noch ein Kind war und hatte nur gelernt sich selbst zu ernähren, weil ein Gefühl mütterlicher Liebe sie bezwang und antrieb.
Einen Monat später lebten Jonquille und Agathe — die immer unzertrennlich blieben, obwohl sie von gleichem Geschlecht und verschiedener Abstammung waren — in voller Freiheit auf den großen Bäumen meines Gartens, sie entfernten sich nicht weit vom Hause und wählten besonders den Gipfel einer hohen Tanne zu ihrem Aufenthalt. Sie waren schlank, glatt und munter, und da es in der schönen Jahreszeit war, kamen sie täglich, wenn wir im Freien saßen, auf den Tisch geflogen und blieben bei uns wie liebenswürdige Gäste. Bald saßen sie auf unserer Schulter, bald flogen sie dem Diener entgegen, um die Früchte, die er brachte, noch vor uns zu kosten. [Es scheint, daß diese wunderbare Geschichte etwas sehr Alltägliches ist, denn seitdem ich dies geschrieben habe, haben wir ähnliche Beispiele gesehen: eine Brut Nachtigallen, die wir in einem Käfige aufzogen, fütterte, als sie kaum zu fressen vermochte, alle kleinen Vögel ihrer Art, die wir in denselben Käfig sperrten.]
Obwohl sie zu uns Allen das größte Zutrauen hatten, ließen sie sich nur von mir greifen und halten, und zu jeder Tageszeit kamen sie auf meinen Ruf — den sie niemals mit dem der Andern verwechselten — von ihrem Baume herunter. Einer meiner Freunde, der aus Paris kam, war sehr erstaunt, als er hörte, daß ich Vögel rief, die in den Zweigen versteckt waren und nun gleich herbei eilten. Ich hatte gewettet, daß sie mir gehorchen würden, und da er ihre Erziehung nicht gesehen hatte, war er für einen Augenblick geneigt an Hexerei zu glauben.
Ich habe auch ein Rothkehlchen gehabt, das in Betreff des Verstandes und des Gedächtnisses ein wunderbares Geschöpf war; dann einen Königsgeier, der für Alle ein wildes Thier blieb, aber mit mir so vertraulich lebte, daß er auf dem Wiegenrande meines Sohnes saß und leise mit seinem großen Schnabel, der scharf war wie ein Rasirmesser, die Fliegen fing, die sich auf das Gesicht des Kindes setzten. Er stieß dabei einen zarten, liebevollen Ton aus, und ging so geschickt und vorsichtig zu Werke, daß er den Kleinen niemals geweckt hat. Und doch war dieser Bursche von solcher Kraft und Willensstärke, daß er eines Tages fortflog, nachdem er einen ungeheuren Käfig umgeworfen und zerbrochen hatte, in den er eingesperrt war, weil er für Personen, die er nicht leiden konnte, gefährlich war. Es gab keine Kette, deren Ringe er nicht leicht zerrissen hätte, und die größten Hunde fühlten eine unüberwindliche Furcht vor ihm.
Mit der Geschichte der Vögel, die ich zu Freunden und Gefährten gehabt habe, würde ich niemals fertig. In Venedig habe ich mit einem reizenden Staar zusammengelebt, der zu meiner Verzweiflung im Kanal ertrank; dann mit einer Drossel, die ich dort lassen mußte und von der ich mich nicht ohne Schmerz getrennt habe. Die Venetianer besitzen ein großes Talent zur Erziehung der Vögel, und es gab in einer Straßenecke einen jungen Burschen, der in dieser Hinsicht Wunder vollbrachte. Eines Tages setzte er in die Lotterie und gewann, ich weiß nicht wie viel Zechinen. Er verzehrte sie im Laufe des Tages bei einem großen Gastmahl, das er allen seinen zerlumpten Freunden gab. Am folgenden Tage kehrte er dann in seinen Winkel, auf die Stufen eines Landungsplatzes zurück, wo er den Vorübergehenden abgerichtete Staare und Elstern verkaufte, mit denen er sich vom Morgen bis zum Abend auf das Liebevollste unterhielt. Er fühlte weder Schmerz noch Reue, das Geld mit seinen Freunden verzehrt zu haben; denn er hatte zu lange mit den Vögeln gelebt, um nicht Künstler zu sein. An diesem Tage verkaufte er mir meine Drossel für fünf Sous. Für fünf Sous eine schöne, gute, fröhliche und unterrichtete Gefährtin zu haben, die nur einen Tag mit uns zu leben braucht, um uns für das ganze Leben zu lieben — das ist wahrhaftig zu wohlfeil. Ach, wie werden die Vögel so wenig geschätzt und so schlecht erkannt!
Ich habe mir die Laune gestattet, einen Roman zu schreiben, in welchem die Vögel eine ziemlich wichtige Rolle spielen, und in welchem ich versucht habe etwas über Wahlverwandtschaften und verborgene Einwirkungen zu sagen. Es ist Teverino, und ich weise meine Leser darauf hin, wie ich oft thun werde, wenn ich nicht wiederholen mag, was ich früher schon besser entwickelt habe.
Ich weiß wohl, daß ich nicht für gewöhnliche Menschen schreibe. Diese haben mehr zu thun, als sich die Kenntniß einer Reihenfolge von Romanen zu erwerben und die Geschichte eines Wesens zu lesen, das dem öffentlichen Leben fremd ist. Leute meines Handwerks schreiben nur für eine gewisse Zahl von Personen, die sich in ähnlichen Verhältnissen befinden, oder in ähnliche Träumereien verloren sind, wie sie selbst. Ich werde also nicht fürchten müssen, rücksichtslos zu sein, indem ich die, welche nichts Besseres zu thun haben, auffordere, einige Seiten von mir wiederzulesen, um diejenigen zu ergänzen, die sie vor Augen haben.
So habe ich in Teverino ein junges Mädchen dargestellt, welches, wie die erste Eva, alle Vögel beherrscht — und hier will ich es aussprechen, daß dies durchaus nicht rein erfunden ist; ebensowenig, wie die Wunder dieser Art, die man von dem poetischen, bewunderungswürdigen Betrüger, Apollonius von Tyana, erzählt, dem Geist des Christenthums zuwider sind. Wir leben in einer Zeit, in welcher die natürlichen Ursachen, deren Wirkungen bis jetzt für Wunder gehalten sind, noch nicht gründlich erklärt werden; aber dennoch kann man jetzt schon behaupten, daß nichts an den Wundern ist, und daß die Gesetze des Universums, obwohl sie nicht alle ergründet und erklärt sind, doch der ewigen Ordnung angemessen sein müssen.
Aber es ist Zeit das Kapitel der Vögel zu schließen, um zu dem meiner Geburt zurückzukehren.
Zweites Kapitel
Das Blut der Könige war also in meinen Adern mit dem Blute der Armen und Geringen vermischt. Und da, was man Bestimmung zu nennen pflegt, der Charakter des Individuums ist; da der Charakter des Individuums auf seiner Organisation beruht, und die Organisation eines Jeden von uns das Ergebniß der Vermischung oder Gleichheit der Racen ist, und die immer modificirte Fortsetzung einer Folge von Urbildern, die sich an einander anreihen — so habe ich immer daraus geschlossen, daß die natürliche Erblichkeit, die des Körpers und der Seele, eine ziemlich wichtige Verbindung zwischen einem jeden von uns und unseren Ahnen bildet.
Denn wir Alle — Große und Kleine, Plebejer und Patricier — wir Alle haben Ahnen. Ahnen heißt patres, das heißt eine Folge von Vätern, denn dies Wort hat keinen Singular. Es ist lächerlich, daß der Adel diesen Ausdruck zu seinen Gunsten in Beschlag genommen hat — als ob der Handwerker und der Bauer nicht eben so gut eine Reihe von Vätern hinter sich hätte; als ob nur der Besitzer eines Wappens den heiligen Vaternamen führen dürfte; als ob endlich die legitimen Väter in der einen Klasse häufiger als in der andern gefunden würden.
Meine Meinung über den Adel der Geschlechter habe ich im Piccinino ausgesprochen und vielleicht habe ich diesen Roman jener drei Kapitel wegen geschrieben, in welchen meine Ansichten über die Standesvorrechte entwickelt sind. Wie man denselben bis jetzt aufgefaßt hat, ist er ein ungeheures Vorurtheil, weil er die Heiligkeit der Familie, deren Princip allen Menschen theuer und unantastbar sein sollte, zum Besten einer reichen und mächtigen Klasse in Beschlag nimmt. An und für sich ist dieses Princip unveräußerlich und darum finde ich etwas Unvollständiges in dem spanischen Spruche: „Cada uno es hijo de sus obras.“ Zwar ist es ein großer und edler Gedanke, daß Jeder der Sohn seiner Thaten ist, und durch seine Tugenden so viel gilt, als der Patricier durch seinen Rang. Aus dieser Idee ist unsre große Revolution hervorgegangen — aber es ist eine reactionäre Idee — und solche fassen immer nur eine Seite der Frage in's Auge — die Seite, die zu lange vernachlässigt und verkannt war. So ist es zwar sehr richtig, daß Jeder der Sohn seiner Thaten ist — aber es ist ebenso wahr, daß Jeder der Sohn seiner Väter, seiner Ahnen, seiner patres und matres ist. Von Geburt an sind wir mit Trieben begabt, die nichts andres sind, als die Ergebnisse des Blutes, das uns vererbt wurde — und diese Triebe würden uns wie ein schreckliches Verhängniß beherrschen, wenn wir nicht ein gewisses Maß des Willens besäßen, das jedem Einzelnen unter uns von der gerechten Gottheit verliehen wird.
Bei dieser Gelegenheit — und das wird abermals eine Abschweifung sein — möchte ich es aussprechen, daß ich nicht an unsre vollständige Willensfreiheit glaube, und daß diejenigen, welche die fürchterliche Lehre der Prädestination angenommen haben — um consequent zu sein und um Gottes Güte nicht zu beleidigen — die gräßliche Idee der Hölle aufgeben müßten, wie ich sie in meiner Seele und in meinem Gewissen aufgegeben habe. Aber wir sind auch nicht vollständig Sklaven der Nothwendigkeit unserer Triebe. Gott hat uns Allen ein mächtiges Mittel gegeben, sie zu bekämpfen, indem er uns die Vernunft gab, die Erkenntniß, die Fähigkeit, unsre Erfahrungen zu nützen — mit einem Worte, die Fähigkeit, uns zu retten; sei es durch wohlverstandene Liebe für uns selbst, sei es durch Liebe zur absoluten Wahrheit.
Man würde umsonst versuchen, dieser Ansicht die Blödsinnigen, Wahnsinnigen und eine gewisse Art von Mördern entgegenzustellen, die von einer wüthenden Monomanie beherrscht werden und somit in die Reihen der Wahnsinnigen und Blödsinnigen gehören. Jedes Gesetz hat seine Ausnahmen, durch die es bestätigt wird. Jede Ordnung, so vollkommen sie auch sei, ist Unfällen ausgesetzt. Aber ich bin überzeugt, daß diese unheilbringenden Unfälle mit dem Fortschritt der Gesellschaft, mit der bessern Erziehung des Menschengeschlechts verschwinden werden — sowie auch das Verhängnis?, das wir von Geburt an in uns tragen, das Ergebniß einer bessern Vereinigung ererbter Triebe sein, unsre Stärke und die natürliche Stütze unsrer errungenen Urtheilskraft ausmachen wird, anstatt unaufhörliche Kämpfe zwischen unserer Neigung und unsern Grundsätzen zu veranlassen.
Es ist vielleicht ein kühnes Absprechen über Fragen, die Jahrhunderte lang Philosophie und Theologie beschäftigt haben. wenn ich es wage, ein bestimmtes Quantum der Sklaverei und der Freiheit anzunehmen. Die Religionen haben es für unmöglich gehalten, sich fest zu begründen, ohne auf absolute Weise die Freiheit des Willens anzuerkennen oder zu verwerfen.. Ich glaube, die Kirche der Zukunft wird verstehen, daß sie dem Verhängniß Rechnung tragen muß, der Gewalt der Triebe, dem Zuge der Leidenschaften. Die Kirche der Vergangenheit hatte das schon geahnt, da sie ein Fegefeuer annahm, ein Mittelding zwischen ewiger Verdammniß und ewiger Glückseligkeit. Die Theologie der vervollkommneten Menschheit wird zwei Principien anerkennen: Verhängniß und Freiheit. Aber da wir, wie ich hoffe, den Manichäismus überwunden haben, wird sie ein drittes Princip annehmen, welches die Lösung der Antithese enthalten wird: das Princip der Gnade.
Sie braucht dieses Princip nicht zu erfinden, sondern nur zu erhalten, denn es ist das Beste und Schönste, das sie aus ihrem alten Erbe zu erneuern haben wird. Die Gnade ist die göttliche Thätigkeit, die immer befruchtend, immer bereit ist, dem Menschen zu Hülfe zu kommen, welcher sie anruft. Daran glaube ich — und ohne dies würde ich nicht an Gott glauben können.
Auch die alte Theologie hatte diese Lehre entworfen, zum Gebrauch von Menschen, die naiver und unwissender waren als wir, das heißt also, in Folge der unzulänglichen Erkenntnisse jener Zeit. Sie hatte gesagt: Versuchung des Teufels, Willensfreiheit und Hülfe der Gnade, um Satan zu besiegen. So hatte sie drei Begriffe aufgestellt, die nicht mit einander im Gleichgewicht stehen — zwei gegen einen: vollständige Freiheit der Wahl und Hülfe der Allmacht Gottes, um dem Verhängniß, der Versuchung des Teufels zu widerstehen, der auf diese Weise leicht unterworfen werden konnte. Wenn es so wäre, wie sollten wir die menschliche Thorheit erklären, die fortfuhr, ihren Leidenschaften zu fröhnen und sich dem Teufel zu ergeben; trotz der Gewißheit ewiger Flammenqual und obwohl es ihr so leicht war, mit voller Geistesfreiheit und der Unterstützung Gottes den Weg der ewigen Seligkeit einzuschlagen.
Es scheint, als hätte diese Lehre die Menschen nie recht überzeugt. Denn diese Lehre, hervorgegangen aus einer strengen, enthusiastischen, muthigen Gesinnung; kühn bis zum Hochmuth und durchdrungen von leidenschaftlichem Verlangen des Fortschritts, ohne jedoch dem eigentlichen Wesen des Menschen Rechnung zu tragen; diese Lehre, die ebenso ungestüm in ihren Ergebnissen, als tyrannisch in ihren Urtheilssprüchen ist — da sie den Unsinnigen, der sich freiwillig den Dienst des Bösen erwählt hat, dem ewigen Hasse Gottes preisgiebt — diese Lehre hat nie ein Wesen gerettet. Die Heiligen haben den Himmel nur durch die Liebe gewonnen, und, die Furcht hat den Schwachen niemals gehindert, in die katholische Hölle hinabzustürzen. Indem die katholische Kirche die Seele vom Körper, den Geist von der Materie vollständig trennte, mußte sie das Wesen der Versuchung verkennen und konnte behaupten, daß diese ihren Sitz in der Hölle hätte. Aber wenn die Versuchung in uns selbst liegt, wenn Gott gestattet hat, daß es so sei, indem er selbst das Gesetz vorzeichnete, das den Sohn mit der Mutter verbindet, oder die Tochter mit dem Vater, alle Kinder mit dem einen oder mit der andern und zuweilen mit beiden in derselben Weise, zuweilen auch mit dem Großvater, dem Onkel, dem Urgroßvater — denn alle diese Phänomene der Aehnlichkeit, die bald körperlich, bald moralisch, bald beides zugleich ist, können jederzeit in Familien nachgewiesen werden — so ist es gewiß, daß die Versuchung nicht ein zum Voraus verdammtes Element, und daß sie nicht dem Einflusse eines abstracten Princips zuzuschreiben ist, das außer uns stände, um uns zu prüfen und zu quälen.
Jean Jacques Rousseau glaubte, daß wir Alle von Geburt gut und bildsam wären und dadurch verwarf er das Verhängniß. Aber wie vermochte er nun die allgemeine Schlechtigkeit zu erklären, die sich jedes Menschen von der Wiege an bemächtigt, um ihn zu verderben und um ihm die Liebe zum Bösen einzuflößen? Er glaubte doch an den freien Willen! Mir scheint es, als müßte uns der Glaube an die absolute Willensfreiheit des Menschen und der Anblick der schlechten Anwendung, die er davon macht, unvermeidlich zum Zweifel am, Dasein Gottes führen oder zum Glauben an seine Unthätigkeit und Gleichgültigkeit — und so müßten wir zuletzt, in Verzweiflung, zum Glauben an Vorherbestimmung zurückkehren. Das ist so ungefähr die Geschichte der Theologie in den letzten Jahrhunderten.
Wenn wir aber annehmen, daß die Bildsamkeit oder Wildheit unserer Triebe, wie ich oben sagte, ein Erbtheil ist, das wir nicht abweisen können und das abzuleugnen vergebene Mühe wäre, so ist das Ewig-Böse, das Böse als unabweisliches Princip, zerstört; denn der Fortschritt wird durch die Art des Verhängnisses, die ich anerkenne, nicht ausgeschlossen. Es ist ein wandelbares und immer umgewandeltes, oft vortreffliches und erhabenes Verhängniß — denn zuweilen ist unser Erbtheil eine herrliche Begabung, der Gottes Güte nie entgegentritt. — Das Menschengeschlecht ist nun nicht mehr eine Horde vereinzelter Wesen, die ohne Ziel umherirren, sondern eine Vereinigung von Linien, die sich an einander reihen und die nie zerrissen werden, wenn auch einzelne Namen aussterben — ein geringer Unfall, um den nur der Adel sich kümmert. — Die Einflüsse der geistigen Eroberungen der Zeit machen sich immerfort geltend auf den freien Theil der Seele und die göttliche Thätigkeit, welche die Seele dieses Fortschrittes bildet, ist es auch, die den Menschengeist immer auf's Neue belebt, und ihn so nach und nach frei macht von den Banden der Vergangenheit und der Erbsünde seines Geschlechtes.
So verlassen die physischen Uebel nach und nach unser Blut, wie der Geist des Bösen unsre Seele verläßt. So lange unvollkommene Generationen gegen sich selber kämpfen, sollte die Philosophie nachsichtig und die Religion erbarmungsreich sein. Sie haben nicht das Recht, den Menschen für eine That des Irrsinns zu tödten, ihn zu verdammen wegen eines falschen Gesichtspunktes. Und wenn sie für reinere, stärkere Wesen eine neue Lehre vorzuschreiben haben, werden sie nichts mehr mit dem Richter der Finsterniß, dem Henker der Ewigkeit, dem Peiniger Satan zu thun haben. Die Furcht wird keinen Einfluß mehr auf die Menschen üben, — sie hat ihn schon jetzt nicht mehr — die Gnade wird genügen; denn was man Gnade genannt hat, ist die Thätigkeit Gottes, den Menschen durch den Glauben offenbart. Das menschliche Bewußtsein hat sich empört gegen diese fürchterliche Lehre von der Hölle, gegen die Tyrannei eines Glaubens, der weder Verzeihung noch Hoffnung jenseit des Lebens annahm. Es hat seine Fesseln zersprengt und hat die Gesellschaft mit der Kirche, das Grab seiner Väter mit den Altären der Vergangenheit zerstört, es hat sich aufgeschwungen und hat sich für einen Augenblick verirrt — aber fürchtet euch nicht, es wird auch den rechten Weg wiederfinden.
Nun bin ich wieder einmal weit von meinem Gegenstande entfernt und meine Geschichte läuft Gefahr, der von den sieben Schlössern des Königs von Böhmen zu gleichen. Wohlan, was kümmert es Euch, meine guten Leser? Meine Geschichte ist an und für sich sehr uninteressant. Thatsachen spielen darin die kleinste Rolle und Grübeleien füllen sie aus. Niemand hat in seinem Leben weniger gethan und mehr geträumt als ich — konntet Ihr vom Dichter etwas Anderes erwarten?
Hört mich an: mein Leben ist das Eure — denn wer mich liest, ist nicht betheiligt an dem Lärm der Tagesinteressen, er würde sonst mein Buch mit Ueberdruß bei Seite schieben. Ihr seid Träumer wie ich. Also hat Alles, was mich auf meinem Wege aufhält, auch Euch gefesselt. Ihr habt, wie ich gesucht, Euch Rechenschaft zugeben von Euerm Dasein — und Ihr seid zu einigen Schlüssen gekommen. Vergleicht die meinigen mit den eurigen, wägt sie gegen einander und entscheidet, die Wahrheit geht erst aus der Prüfung hervor.
Wir werden also bei jedem Schritte still stehen und jeden Gesichtspunkt in's Auge fassen. Hier ist mir eine Wahrheit klar geworden: nämlich daß der Götzendienst der Familie falsch und gefährlich ist, aber daß Achtung und Einigkeit in der Familie nothwendig sind. Im Alterthum spielte die Familie eine große Rolle — aber dann überschätzte sie ihre Bedeutung; der Adel übertrug sich wie ein Privilegium und die Edelleute des Mittelalters hatten eine so hohe Meinung von ihrer Abstammung, daß sie die ehrwürdigen Familien der Patriarchen verachtet haben würden, wäre ihr Andenken nicht durch die Religion geheiligt. Die Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts erschütterten den Kultus des Adels, die Revolution warf ihn nieder; aber auch das fromme Ideal der Familie wurde in dieser Zerstörung fortgerissen und das Volk, das unter erblichen Bedrückungen gelitten hatte, das Volk, das die Wappen verlachte, begann sich allein für den „Sohn seiner Thaten“ zu halten. Das Volk irrte sich, denn es hat seine Ahnen so gut wie die Könige. Jede Familie hat ihren Adel, ihren Ruhm, ihre Würden: die Arbeit, den Muth, die Tugend oder die Klugheit. Jeder Mensch, der mit irgend welcher natürlichen Auszeichnung begabt ist, verdankt sie einem der Männer, die vor ihm lebten oder einer der Frauen, von denen er abstammt. Jeder Abkömmling irgend welcher Linie hätte also Vorbilder aus der Geschichte seiner Familie zu befolgen, wenn er in die Vergangenheit zurückschauen könnte; auch würde er dort Manches sehen, was er zu vermeiden hätte. Die berühmten Geschlechter geben Beispiel davon — und so wäre es keine üble Lehre für das Kind, wenn es aus dem Munde seiner Amme die alten Traditionen der Familie hörte, die einst den Unterricht des Edelmanns ausmachten.
Ihr Handwerker, die ihr anfangt Alles zu verstehen, ihr Bauern, die ihr anfangt lesen zu lernen, vergeßt doch Eure Todten nicht mehr. Uebertragt das Leben Eurer Väter auf Eure Söhne; macht Euch Titel und Wappen, wenn Ihr wollt, aber macht sie Euch Alle! Die Mauerkelle, die Hacke oder das Gartenmesser sind ebenso schöne Attribute als das Jagdhorn, der Thurm oder die Glocke. Ihr könnt Euch dies Vergnügen machen, wenn es Euch zusagt — Kaufleute und Geldwechsler machen es sich auch.
Aber Ihr seid ernster als diese Leute. — Nun wohl, so möge sich ein Jeder unter Euch bemühen, die guten Thaten und die nützlichen Arbeiten seiner Vorfahren kennen zu lernen und vor Vergessenheit zu bewahren. Und dann handelt danach, daß Eure Nachkommen Euch die nämliche Ehre erweisen. Vergessenheit ist ein geistloses Ungeheuer, das nur zu viele Generationen verschlungen hat. Wie viele Helden bleiben auf ewig unbekannt, weil sie nicht genug hinterließen, ein Grabmal zu errichten! Wie manches Licht ging der Geschichte verloren, weil der Adel die einzige Fackel und die einzige Geschichte der vergangenen Jahrhunderte zu sein begehrte! Entzieht Euch der Vergessenheit, Ihr Alle, die Ihr mehr im Sinne tragt, als die begrenzte Kenntniß der Gegenwart. Schreibt Eure Geschichte, Ihr Alle, die Ihr das Leben verstanden und Euer Herz ergründet habt — aus diesem Grunde schreibe ich auch die meinige, wie das, was ich von meinen Eltern erzählen werde.
Friedrich August, Kurfürst von Sachsen und König von Polen, war der größte Wüstling seiner Zeit. Es ist gerade keine seltne Ehre, etwas von seinem Blute in den Adern zu haben, denn er hatte, wie man behauptet, einige hundert Bastarde. Von der schönen Aurora von Königsmark, der großen, gewandten Kokette, vor welcher Karl XII. zurückwich, so daß sie sich an Furchtbarkeit einer Armee überlegen glauben konnte *), hatte er einen Sohn, der ihn an Adel bei weitem übertraf, obwohl er nie mehr war, als Marschall von Frankreich. Es war Moritz von Sachsen, der Sieger von Fontenay; er war gutmüthig und tapfer wie sein Vater und nicht weniger unsittlich; aber er war geschickter in der Kriegskunst, war glücklicher in seinen Unternehmungen und wurde besser unterstützt.
*) [Diese Anekdote ist ziemlich sonderbar; Voltaire erzählt sie folgendermaßen in seiner Geschichte Karl's XII.: „August zog es vor, die harten Gesetze seines Siegers, als die seiner Unterthanen zu empfangen. Er entschloß sich, den König von Schweden um Frieden zu bitten und wollte einen geheimen Vertrag mit ihm abschließen; aber dieser Schritt mußte dem Senat verborgen bleiben, den er als einen noch unerbittlichern Feind betrachtete. Die Sache war äußerst schwierig und er übertrug sie der Gräfin Königsmark, einer Schwedin, von hoher Geburt, mit welcher er damals ein Verhältniß hatte. Es ist dieselbe, deren Bruder durch seinen unglücklichen Tod bekannt wurde und deren Sohn die französischen Heere mit so viel Erfolg und Ruhm befehligte. Diese in der ganzen Welt durch Geist und Schönheit berühmte Frau war mehr als jeder Minister dazu geeignet, eine Unterhandlung zum Ziele zu führen. Da sie überdies in den Staaten Karl's XII. begütert war und lange an seinem Hofe gelebt hatte, fehlte es ihr nicht an glaubwürdigen Vorwänden diesen Fürsten aufzusuchen. Sie ging also nach Lithauen in das Lager der Schweden und wendete sich zuerst an den Grafen Piper, der ihr leichtsinnigerweise eine Audienz bei seinem Gebieter versprach. Unter den Vollkommenheiten, welche die Gräfin zu einer der liebenswürdigsten Frauen Europa's machten, besaß sie das wunderbare Talent, die Sprachen verschiedener Länder, die sie nie gesehen hatte, mit einer Zartheit zu sprechen. als wenn sie dort geboren wäre. Sie unterhielt sich zuweilen auch damit, französische Verse zu machen — und man würde geglaubt haben, daß ihre Verfasserin in Versailles lebte.
Sie dichtete einige für Karl XII., welche die Geschichte nicht verschweigen darf; nachdem sie alle Götter des Heidenthums eingeführt hatte, die verschiedene Tugenden des Königs priesen, schloß sie mit den Worten.
„Enfin chacun des dieux discourant à sa gloire Le plaçait par avance au temple de Mémoire: Mais Vénus et Bacchus n'en dirent pas un mot.“
Auf einen Mann wie der König von Schweden blieben so viel Geist und Liebenswürdigkeit wirkungslos. Er weigerte sich beharrlich, die Gräfin zu sehen, und so ergriff sie endlich das Mittel, ihm bei einem seiner häufigen Spazierritte zu begegnen. Sie traf ihn wirklich eines Tages auf einem sehr schmalen Wege und stieg aus dem Wagen, sobald sie ihn erblickte. Der König grüßte sie, ohne ein Wort zu sagen, drehte sein Pferd um und ritt augenblicklich von dannen, so daß die Gräfin von Königsmark von ihrer Reise nur die Genugthuung mitbrachte, sich für das einzige Wesen zu halten, vor welchem der König von Schweden Furcht empfand.“]