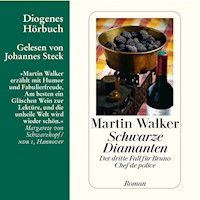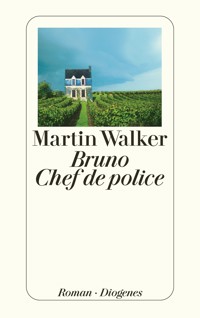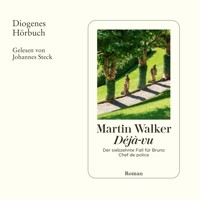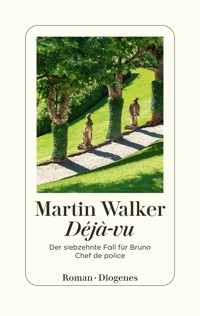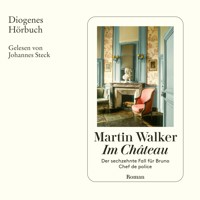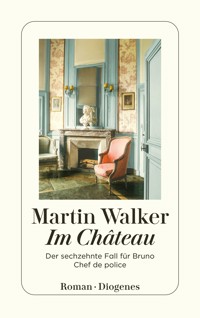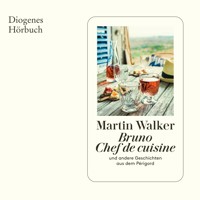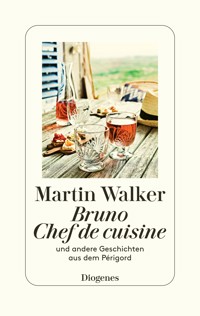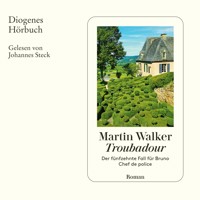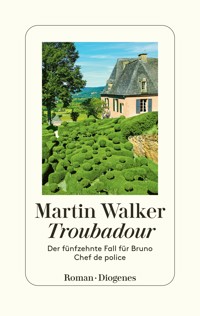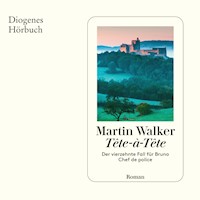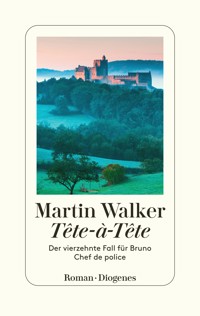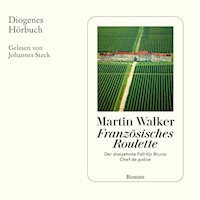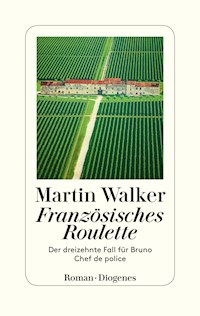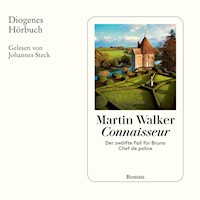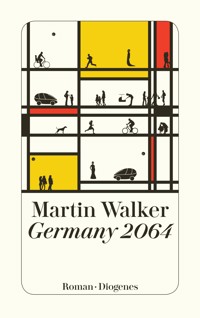
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Statt Bruno Courrèges im heutigen Périgord ermittelt Hauptkommissar Bernd Aguilar im Deutschland von morgen. Sein engster Mitarbeiter: ein Roboter. Doch kann er diesem nach dem letzten Update noch trauen? Wer werden wir sein? In welcher Welt werden wir leben? Wie werden wir unser Geld verdienen? Was wird aus unseren Unternehmen? Wie bewegen wir Personen, Güter und Daten? Martin Walker hat unsere Chancen und Möglichkeiten zu einem atemberaubenden und realistischen Roman unserer Zukunft verdichtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Martin Walker
Germany 2064
Roman
Aus dem Englischen vonMichael Windgassen
Originaltitel: ›Germany 2064‹
Copyright © 2014 by Martin Walker
Die deutsche Erstausgabe
erschien 2015 im Diogenes Verlag
Covermotiv: Illustration von Kobi Benezri
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2016
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 25724364 2 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 25760702 4
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Für PaulLaudicina, ErikPetersen, JohanAurik, MartinSonnenschein, Otto
[7]1
Die Resistenz gegen häufig auftretende Bakterien hat in vielen Regionen einen alarmierenden Höchststand erreicht, und in einigen Fällen zeigen […] nur noch wenige der üblichen Behandlungsmethoden eine Wirkung.Diese sehr ernst zu nehmende Gefahr ist nicht mehr bloß ein Zukunftsszenario; ihr sind schon jetzt überall auf der Welt Menschen jeglichen Alters ausgesetzt. Antibiotikaresistenzen – also die Eigenschaften mutierter Bakterien, die Wirkung von Antibiotika zu neutralisieren – sind eine große Bedrohung der Weltgesundheit. Eine post-antibiotische Ära – wenn also gewöhnliche Infektionen oder geringfügige Verletzungen zum Tode führen können – ist keineswegs eine apokalyptische Phantasie, sondern durchaus eine mögliche Realität im 21.Jahrhundert.
Pressemitteilung zu antibiotischen Resistenzen, Weltgesundheitsorganisation (WHO), 30.April 2014
Kurz vor sechs Uhr morgens, als allerorts Nacht- und Frühschicht wechselten und ein Moment nur mäßiger Aufmerksamkeit herrschte, hatte der Konvoi Ludwigshafen im Osten passiert, genau nach Plan. Er war am späten Abend vom Flughafen Schiphol aufgebrochen. Nun [8]bewegte er sich gleichmäßig mit einer Geschwindigkeit von hundert Stundenkilometern vorwärts, alle sechzig Fahrzeuge in exakt gleichem Abstand zueinander. Aus zwei Ultraleichtfliegern wurde je eine Person über dem Konvoi abgeseilt. Ein Späher stand in der Nähe von Mutterstadt auf einer Brücke über der A61. Mit einem Objektiv hoher Brennweite scannte er die Kennziffer auf den kleinen Plaketten hinter den Windschutzscheiben der LKWs und drückte den »Senden«-Knopf, nachdem er bei Nummer sieben das leise Zirpen der Bestätigung gehört hatte. Damit war sein Auftrag erledigt und er um fünfzigtausend Euro reicher. Mit seinem E-Bike fuhr der gutgekleidete Vierziger zurück in die Stadt, um rechtzeitig seine Arbeit auf dem Recyclinghof für Nahrungsmittel aufzunehmen.
Der Konvoi rollte weiter, ein langer Strom unbemannter, containerartiger Fahrzeuge, die Europa im Zickzackkurs durchquerten. Sie bildeten das Herz des neuen Logistiksystems. Sie fuhren ohne menschliches Zutun; die Schiffscontainer wurden in den Häfen ausgeladen und auf entsprechende Fahrgestelle mit Hochleistungsbatterie und Auto-Remote-System aufgesetzt. Das erste Fahrzeug eines jeden Konvois war aerodynamisch verkleidet, der Rest folgte in optimaler Distanz im Windschatten. Wenn sie aus großen Häfen wie Rotterdam oder Hamburg kamen, umfassten die Fahrzeugkolonnen bis zu hundert Container, wie früher die Güterzüge. Doch üblich waren kleinere Konvois mit sechs, zehn oder zwanzig Fahrzeugen, entsprechend dem sinkenden Gütervolumen. Die Routen zu ihren jeweiligen Empfangsstationen waren vorprogrammiert.
Zwanzig Kilometer weiter nahm ein Personal [9]Communicator, kurz PerC, die verschlüsselte Nachricht des Spähers entgegen und leitete sie sofort an die Ultraleichtflieger, kurz UL, weiter, die am Vorabend aus Frankreich gekommen waren und die Nacht auf einem nahegelegenen Rastplatz verbracht hatten. Die Fahrzeugkolonne würde stetig auf ein zwölf Kilometer langes Teilstück der Autobahn zusteuern, das von keiner einzigen Überlandleitung gekreuzt wurde. Die tiefhängenden Wolken kamen den Piloten gelegen. Wegen ihrer Beschichtung und der Tarnlackierung waren die UL für Radare schwer zu orten. Ihre geräuschlosen, batteriebetriebenen Motoren entwickelten kurzzeitig enorme Schubkraft.
Dem Gelände folgend und nie höher als hundert Meter, flogen die UL dicht hintereinander mit neunzig Stundenkilometern an der Autobahn entlang. Es dauerte nicht lange, und der Konvoi tauchte hinter ihnen auf, begleitet von einer Drohne. Ihre optische Rundumüberwachung galt insbesondere den Bäumen am Fahrbahnrand. In jüngster Zeit gab es immer häufiger Kriminelle, die Bäume fällten, um Transporter zu stoppen und deren Container aufzubrechen. Kam jedoch einer solchen Kolonne ein Reh oder anderes Wild in die Quere, durch das Scheinwerferlicht in Schockstarre versetzt und durch Hupen nicht zu verscheuchen, wurde es vom ersten Fahrzeug einfach überrollt. Und wenn endlich das letzte darüber hinweggedonnert war, blieb kaum mehr als ein Schmierfleck auf dem Asphalt zurück.
Die UL-Piloten konnten Bildausschnitt und Schwenk der Drohnenoptik zentimetergenau vorausberechnen und so eine Erfassung vermeiden. Von oben senkte sich der erste Pilot bis auf drei Meter auf den unbemannten Flugkörper [10]hinab. Sein Begleiter zog ein Gewehr mit kurzem Doppellauf aus seinem Schenkelholster und feuerte beide Ladungen auf den Rumpf der Drohne ab. Sie zerbarst in zahllose Trümmerteile, die im Windschatten des Konvois verwirbelten.
Die UL nahmen Tempo auf, bis sie das siebte Fahrzeug erreichten und, einer nach dem anderen, langsam darauf niederschwebten, um die Copiloten auf dem flachen Containerdach aussteigen zu lassen. Um ihr Gewicht erleichtert, stiegen die Flieger wieder auf und drehten nach Westen ab, Richtung Vogesen, wo eine Bodencrew sie erwartete, um Maschinen und Piloten verschwinden zu lassen. Letztere würden nach ihrer Mission einen Schnellzug nach Paris nehmen.
Die beiden Männer ließen ihre Rucksäcke von den Schultern gleiten und öffneten mit ihren Laserschneidbrennern das Containerdach. Sie drangen in den Frachtraum ein, der mit pharmazeutischen Produkten beladen war, machten die gesuchten Päckchen schnell ausfindig und verstauten sie in den mitgebrachten Netzen aus Fallschirmseide.
Dann sendeten sie das verabredete Signal und schauten auf die Uhr. Sie lagen gut in der Zeit. Die Brücke, auf die sie sich zubewegten, war noch einige Kilometer entfernt. Sie holten jeder eine Teleskopstange aus ihrem Rucksack und befestigten Netze daran. Als sie sich der Brücke näherten, sahen sie den wartenden Transporter an Ort und Stelle. Zwei Männer seilten zwei schwere Haken ab. Jeder Handgriff war einstudiert, die ganze Prozedur etliche Male durchgespielt worden. Die Männer im Container zogen die Teleskopstangen auseinander und stemmten die Netze [11]durch die aufgeschweißte Luke nach draußen. Die von der Brücke herabhängenden Haken griffen präzise in die dafür vorgesehenen Schlaufen und zogen die Beute nach oben und über das Brückengeländer, wo sie sofort im Heck des Transporters verschwand, der Sekunden später in Richtung Mannheim losfuhr. Sein Ziel war eine Garage, von der aus die Beute weitertransportiert werden sollte. Während der Fahrt wurden die Päckchen für zwei Sekunden Mikrowellen ausgesetzt, um eine Identifizierung über Funk auszuschließen.
Der Konvoi rollte weiter Richtung Basel – ohne den wertvollsten Teil seiner Fracht. Die beiden Netze enthielten die Charge der allerneuesten Generation amerikanischer Neobiotika im Wert von über zweihundert Millionen Euro. Frisch aus den Forschungslabors, machten sie Hoffnung auf ein neues Zeitalter medizinischer Wunder, da sie sich gegen polyresistente Bakterien durchsetzten, gegen die seit Mitte der 20er Jahre des einundzwanzigsten Jahrhunderts kein Antibiotikum mehr wirksam war.
In einer Lichtung im Wald nahe Schifferstadt wartete ein am Vortag in Luxemburg gecharterter Hybridhelikopter. Sein Pilot hatte gerade das Signal erhalten und zeigte dem Kollegen im Frachtraum seinen nach oben gerichteten Daumen. Der erwiderte das Zeichen und checkte die Winden, bevor der Hubschrauber abhob. Die Akkus waren voll aufgeladen. Geräuschlos flog die Maschine über die Autobahn, der Transportkolonne nach, die sie bald eingeholt hatte. Als sie über dem siebten Container mit dem aufgeschnittenen Dach schwebte, setzte der Copilot die beiden Winden in Bewegung und ließ zwei Seile zu den Männern im [12]Container abrollen. Schnell hatten sie die daran befestigten Haken in das Gurtzeug unter ihren Lederjacken eingehängt, signalisierten dem Mann an den Winden ihr O.K. und ließen sich nach oben ziehen. Kaum hatten sie den Frachtraum erreicht, drehte der Hubschrauber nach Osten ab und überflog den Rhein in Richtung Heilbronn. Beide Männer hatten bereits Fahrkarten für den EuroConnect nach Frankfurt in der Tasche.
In einer Garage in Mannheim durchwühlte inzwischen ein kahlgeschorener Mann die Päckchen aus dem Transporter. Er war auf der Suche nach einem ganz bestimmten, mit roter Tinte markierten. Als er es gefunden und den Inhalt geprüft hatte, lächelte er zufrieden und stopfte es in seine Umhängetasche. Er setzte ein Basecap, eine dunkle Sonnenbrille sowie einen Mundschutz auf und verließ die Garage unauffällig. Die Männer verteilten die restlichen Neobiotika auf drei Rucksäcke, schnallten sie um und verließen den Ort in verschiedenen Richtungen. Zwei weitere Mitglieder des Teams tauschten die Nummernschilder am Transporter aus, bevor sie den Wagen aus der Stadt schafften und anzündeten.
Das große Logistikunternehmen, in dessen Auftrag der Konvoi unterwegs war, hatte zwei Stützpunkte: einen im Hafen von Rotterdam, den anderen am Frankfurter Flughafen. Dort bemerkte man den Verlust der Drohne zuerst, allerdings mit erheblicher Verzögerung, da europaweit insgesamt mehr als zweihundert Begleitdrohnen im Einsatz waren und es immer wieder zu Störungen in der Funkverbindung kam.
[13]»Wir empfangen von ROT-BAS 143-64 keine Signale mehr«, meldete der diensthabende Koordinator seinem Kollegen in Rotterdam. Die Ziffern bezogen sich auf die Zahl der Konvois auf der Strecke Rotterdam–Basel im laufenden Jahr 2064. »Soweit ich sehen kann, ist der Kontakt vor zwanzig Minuten abgebrochen. Können Sie das mal nachprüfen?«
»Augenblick.« Eine Minute später meldete sich Rotterdam zurück. »Ja, ROT-BAS 143-64 scheint abgestürzt zu sein.«
»Vielleicht durch Vogelschlag«, suchte Frankfurt nach einer Erklärung. »Frühmorgens passiert das schon mal. Oder das Ding ist vor eine Brücke geknallt. Diese verfluchten Graffiti…« Jugendliche machten sich in letzter Zeit einen Spaß daraus, Blendschutzfarbe so auf Brücken zu sprayen, dass Drohnen freien Himmel vor sich sahen und auf die Pfeiler prallten wie Insekten auf eine Windschutzscheibe.
»Können Sie Ersatz losschicken und nachprüfen, ob alles in Ordnung ist?«, fragte Rotterdam.
»Wird gemacht. Wir schicken die Bilder rüber, sobald sie da sind.«
Eine halbe Stunde später stand fest, dass der Konvoi überfallen worden war. Weitere zehn Minuten verstrichen, bis man herausfand, dass die aus dem siebten Container gestohlenen Güter mehr wert waren als die restliche Fracht der gesamten Kolonne. Erst nach noch einmal fünf Minuten waren Europol und die Ludwigshafener Polizei alarmiert. Natürlich musste auch die Direktion des Logistikunternehmens informiert werden, dann die Versicherung in [14]Zürich und schließlich der Pharmagroßhändler in Basel. Da der Konvoi von den Niederlanden aus durch Deutschland in Richtung Schweiz unterwegs war, hielt sich Europol für zuständig; die Polizeibehörden von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hingegen machten beide geltend, dass sich der Überfall auf ihrem Hoheitsgebiet zugetragen hatte.
Die Unternehmensleitung entschied, den Transport nach Basel fortzusetzen, wogegen die baden-württembergische Polizei Einspruch erhob. Nach dem Motto »Geschaffene Fakten setzen ins Recht« ließ sie für den Konvoi die Grenzen zur Schweiz sperren und lenkte ihn auf einen Bereitstellungsraum in der Nähe von Freiburg um. Ein offizielles Amtshilfeersuchen wurde in die Wege geleitet. Den Polizeidienststellen war dieses Zuständigkeitsgerangel nicht neu. Sie hielten sich mit ihren Ermittlungen zurück und warteten auf explizite Vorgaben seitens der Politik.
Als endlich ein Ausschuss mit Vertretern aller involvierten Parteien zusammengetroffen, eine Videokonferenz geschaltet und die Frage der Verantwortlichkeiten geklärt war, leiteten die Täter die letzten Schritte ihrer Operation ein. Sie ließen den Hubschrauber auf einer unzugänglichen Waldlichtung in Flammen aufgehen. Pilot und Copilot bestiegen in Straßburg verschiedene Züge, während die beiden Begleiter der UL in der Departure-Lounge des Frankfurter Flughafens auf ihre jeweiligen Flüge warteten. Die erbeuteten Neobiotika, eigentlich für europäische Krankenhäuser bestimmt, waren, in noch kleinere Einheiten aufgeteilt, auf dem Weg zu vermögenden Abnehmern in Kiew, Ankara und Taschkent, die ungeduldig auf jenes neuentwickelte Medikament warteten, das die tödlichen Infektionen und [15]sich rasend vermehrenden Bakterienherde in ihren Körpern zu besiegen versprach.
[16]2
Die drei Gesetze der Robotik:
1. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen.
2. Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz.
3. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht.
Erstmals formuliert von dem russisch-amerikanischen Schriftsteller Isaac Asimov in seiner Kurzgeschichte Herumtreiber, erschienen im März 1942 bei Astounding Science Fiction. Marvin Minsky, Gründer des Instituts für künstliche Intelligenz am MIT, bemerkte: »Seit Erscheinen der Kurzgeschichte Herumtreiber […] mache ich mir unablässig Gedanken darüber, wie unser Verstand funktioniert.«
Bernd Aguilar erwachte wie immer wenige Sekunden vor sieben, wenn sein PerC surrte, den Holoscreen auf Zimmergröße aufspannte und die aktuellsten auf seine Bedürfnisse abgestimmten Newsies und Vids zeigte. Er stand [17]auf, öffnete die Balkontür, warf seine Steppdecke zum Lüften über das Geländer, schaltete die Kaffeemaschine ein und ging ins Bad. Dass er in wenigen Stunden Roberto wiedersehen würde, machte ihn nervös. Auch der Duschautomat war nach seinen Wünschen programmiert: zuerst warm, dann heiße Wasserstrahlen mit Seifenschaum, dann ein Schwall kalten Wassers, um ihn endgültig wach zu machen, und zum Schluss noch einmal wie zur Belohnung warme Berieselung. Während er sich vom Warmluftgerät abtrocknen ließ, verteilte er Rasiergel auf Wangen, Kinn und Hals und griff zu der altmodischen Sicherheitsklinge, die ihm lieb und teuer war. Die meisten Männer, die er kannte, verwendeten eine Enthaarungscreme. Seine Mutter aber meinte, sie sei schlecht für die Haut. Schon sein Vater hatte Rasierklingen benutzt.
Das Gesicht im Spiegel – symmetrisch, markantes Kinn, hellblaue Augen, schmale Lippen und eine recht große Nase – sah gut aus, wie ihm Frauen versicherten, was ihn aber nicht überzeugen konnte. Mit seinen ein Meter neunzig und zweiundachtzig Kilo bestand er den von seinem Dienstherrn vorgeschriebenen alljährlichen Gesundheitscheck ohne weiteres. Sein Haar, einst blond und lockig, hatte mit den Jahren einen undefinierbaren Braunton angenommen, und er trug es so raspelkurz, dass er sich nie zu kämmen brauchte.
Während er sich anzog, trank er seine erste Tasse Kaffee, gesüßt mit einem Teelöffel Honig und mit einer Prise Zimt abgeschmeckt. Er trug seidene Unterwäsche – Baumwolle war wegen des hohen Wasserbedarfs für den Anbau unerschwinglich geworden–, ein Oberhemd aus Leinen und [18]eine Hose aus Bambusfasern, alles maßangefertigt nach Daten eines Ganzkörper-Scans, die sein PerC beim Onlinekauf automatisch mitübermittelte. Bernds Uniform hing meistens in seinem Spind im Polizeipräsidium. Das letzte Mal hatte er sie getragen, als er und Roberto ihre Auszeichnung erhalten hatten. Heute, am Tag ihres Wiedersehens, würde er sie wieder anziehen müssen, weil sich Vertreter der Medien angekündigt hatten.
Bernd frühstückte: Naturjoghurt, einen Apfel und einen Vollwertriegel mit Vitaminen, mit dem er früher beim Militär abgefüttert wurde und der heute bei jungen Leuten sehr beliebt war. Dazu trank er seine zweite Tasse Kaffee und versuchte, nicht allzu intensiv über das Wiedersehen mit Roberto und die Frage nachzudenken, inwieweit er sich verändert haben würde. Er holte die Steppdecke herein, machte, ein Auge auf den Holoscreen und die übertragenen Vids gerichtet, das Bett, spülte die Tasse und entsorgte Kerngehäuse und Joghurtbecher über die getrennten Müllrutschen, die sie in ihre jeweiligen Recyclingcontainer beförderten. Er vergewisserte sich, dass er seinen Polizeiausweis eingesteckt hatte, löschte den Holoscreen, legte seinen PerC ums Handgelenk und verließ die Wohnung. Im Café an der Ecke aß er noch ein Croissant, winkte freundlich seinen Nachbarn zu und eilte zur Straßenbahnhaltestelle. Der darüber aufgespannte riesige Holoscreen warb für Urlaubsreisen ins Ausland und wies auf den hundertsten Geburtstag des öffentlichen Nahverkehrssystems hin. Aber dass Fahrradfahrer regelmäßig mit den Reifen in die Schienen gerieten, dafür hatte man noch immer keine Lösung.
Wie schon sein Vater und sein Onkel zeigte auch Bernd [19]in der Regel nach außen hin keine Gefühle. Als er jetzt das Präsidium betrat, konnte er dennoch eine gewisse Nervosität und Neugier nicht unterdrücken und kam sich mit seinen 38Jahren lächerlich und wie ein Teenager vor seinem ersten Date vor. Nach zehnjährigem Militärdienst war er inzwischen auch schon seit zehn Jahren bei der Polizei. Als Jahrgangsbester hatte er die Wahl gehabt: entweder eine Weiterbildung an der Polizeiakademie oder ein bezahltes Studium an der Universität; er hatte sich für einen mehrjährigen Spezialkurs in Robotertechnik für angehende Polizeioffiziere an der Akademie eingeschrieben.
Er hätte sich eigentlich viel besser unter Kontrolle haben müssen; schließlich konnte es ihm egal sein, ob seine Vorgesetzten unfähig waren und mit wem er zusammenarbeitete.
Eine gute Stunde verbrachte er im Aufenthaltsraum, wo er sich mit Kollegen unterhielt und sich darüber informierte, was in der vergangenen Nacht vorgefallen war. Dann ging er nach oben, um seine Uniform anzuziehen, und fummelte vor seinem Spind nervös an der für ihn ungewohnten Krawatte herum. Dann trat er vor den Einwegspiegel in der Wand seines Büros, der den Blick in das Vernehmungszimmer dahinter freigab. Sich selbst aber konnte er in der matten Reflexion kaum erkennen, geschweige denn, wie er sich den Krawattenknoten binden und die Uniform straff ziehen sollte oder ob sein Gesicht seine innere Anspannung verriet.
Bernd konnte sich nicht erinnern, jemals vor einer vergleichbaren Situation gestanden zu haben. Vielleicht würde es sein wie eine Wiederbegegnung mit der ersten Liebe, in [20]deren Verlauf beide, sie und er, feststellen mussten, dass Jahre verstrichen waren und die jeweiligen Lebenswege eine völlig andere Richtung genommen hatten. Doch es fehlte jede erotische Komponente. Es wäre also vielleicht eher wie das Wiedersehen mit dem besten Freund aus der Grundschule, mit dem er, von ein paar verblassten Erinnerungen abgesehen, nichts mehr gemein haben würde. Oder womöglich ließe sich das, was ihn erwartete, mit dem Treffen zweier Kameraden aus der Militärzeit nach vielen getrennten Jahren im zivilen Leben vergleichen. Allerdings hatten Roberto und er noch bis vor wenigen Wochen zusammengearbeitet. Nein, er kam dem Ganzen wohl am nächsten, wenn er sich einen alten, engen Freund nach einer Geschlechtsumwandlung vorstellte, denn er wusste, dass sich seine Beziehung zu Roberto von Grund auf verändern würde. Wenn er ehrlich war, stand ihm, von seinen nächsten Angehörigen abgesehen, seit vielen Jahren niemand so nahe wie Roberto.
Vermutlich war die Wiederbegegnung mit ihm auch mitentscheidend für seine künftige Karriere. Bernd war ehrgeizig und als Erster Polizeihauptkommissar noch recht jung, aber schon auf dem Sprung zur nächsten Beförderung, und zwar in das Amt eines Polizeirats. Dass er so weit gekommen war, verdankte er unter anderem seiner ungewöhnlich guten Zusammenarbeit mit Roberto. Die meisten Polizisten beargwöhnten ihre AP bzw. die Automatisierten Partner, wie es in der Amtssprache hieß. Polizei und Öffentlichkeit nannten sie Robocops, was ziemlich übertrieben war. Die Fähigkeiten von Automatisierten Partnern waren begrenzt, zumindest die von Robertos Vorgängermodellen. [21]Sie konnten alles, was um sie herum passierte, in Film und Ton dokumentieren, weshalb viele Polizisten sie für Spione hielten, die auch sie selbst überwachten.
Aber das war nicht immer deren eigentliche Aufgabe gewesen. Zuerst hatte man sie (in Japan, dann in Los Angeles, Paris und Berlin) eingesetzt, um Schreib- und Verwaltungsarbeiten zu übernehmen, die die Polizeibeamten täglich viele Stunden kosteten. Dank ihrer Fähigkeit, jeden Vorgang elektronisch zu speichern und jederzeit abzurufen, reduzierte sich die Bürotätigkeit ihrer menschlichen Partner somit auf ein Minimum, und sie verbrachten nun wieder sehr viel mehr Zeit im Außendienst.
Die ersten Automatisierten Partner waren aus den Videokameras entwickelt worden, die Soldaten auf ihren Helmen trugen. Für einen AP war allerdings eine Rundumperspektive vonnöten. Viele der ersten Prototypen gingen schnell zu Bruch, entweder vorsätzlich, wenn ein Polizist irgendwelche grenzwertigen Polizeimethoden nicht dokumentiert sehen wollte, oder auch im Zuge robuster Einsätze, wenn sich zum Beispiel ein Verdächtiger seiner Festnahme mit Gewalt zu widersetzen versuchte. Die nächste AP-Generation bestand aus Robotern, die sich selbständig und frei bewegen konnten und anfangs wie Polizeihunde hinter ihren Polizisten hertrotteten. Bald wurden von den Einsatzkräften Forderungen laut, dass sich diese Automaten doch auch nützlich machen sollten, indem sie etwa die Ausrüstung eines Streifenpolizisten schleppten, ein über zehn Kilo schweres Sammelsurium aus Funkgerät, Handschellen, Taschenlampe, Pfefferspray, Notebook und dergleichen mehr.
[22]Mobilität wurde immer wichtiger. AP sollten nun auch Straftäter verfolgen und Treppen steigen können, Tatverdächtige festnehmen, Alkohol- und Drogentests vornehmen, Ausweispapiere kontrollieren und die Identität von Personen überprüfen. Bekanntlich gilt »Form folgt Funktion«, und dieser Grundsatz schaffte sein eigenes Design. AP mussten mindestens zwei Beine haben und den Rumpf beugen können, um in ein Fahrzeug ein- und daraus auszusteigen. Die Aufzeichnungs- und Kommunikationssysteme mussten gut geschützt und die Kameras weit oben montiert sein, damit möglichst viel ins Bild kam. Zwei Beine mit Akkus, ein Rumpf mit Stauraum für die Ausrüstung sowie ein Kopf gehörten bald zum Standard. Alles Weitere ergab sich wie von selbst. Zwei Arme und Greifhände durften nicht fehlen. Als nützlich erwiesen sich außerdem zwei zusätzliche Arme, der eine mit Teleskop-Funktion sowie mit einer Mikrokamera ausgestattet, über die sich um Ecken herum oder durch Schlüssellöcher spähen ließ, der andere mit Blend- und Betäubungsmunition sowie Festsetzungstechnik.
Die frühen AP-Modelle waren primitiv und nur darauf programmiert, den menschlichen Partner im Dienst zu begleiten und zu beschützen. Sie reagierten auf eine Reihe einfacher Befehle: Person festnehmen, Identität überprüfen, Unterstützung anfordern und so weiter. Als aber dank verbesserter physischer Gestalt die AP mobiler und geschickter in ihren Bewegungen wurden, nahm auch ihr Kommunikationspotential zu. Sie konnten nun sehr viel komplexere Befehle entgegennehmen und ausführen.
Wie von manchen Sozialwissenschaftlern und [23]Psychologen vorhergesagt, die sich eingehend mit Berichten amerikanischer und britischer Militäreinheiten nach den Kriegen im Irak und in Afghanistan zu Anfang des Jahrhunderts befasst hatten, wurden die Automaten zunehmend vermenschlicht. Die Soldaten hatten sich an die Roboter als nützliche Hilfskräfte gewöhnt, gaben ihnen Namen und begannen, deren individuelle Leistungsfähigkeit zu vergleichen. Wenn einer im Gefecht zu Schaden kam oder verlorenging, löste das Bestürzung aus, zwar nicht in dem Maße wie das Unglück eines Kameraden, aber doch so sehr, dass sich rituelle Gewohnheiten ausbildeten. Zerstörte Roboter wurden in einer respektvollen Zeremonie beerdigt. Befand sich einer zur Reparatur in der Werkstatt, bekam er Besuch wie ein verwundeter Soldat im Lazarett.
Zu ähnlichen Verhaltensweisen kam es bei der Polizei erst sehr viel später, denn so mancher Beamte hatte wegen Amtsmissbrauchs eine Disziplinarstrafe über sich ergehen lassen oder gar seinen Dienst quittieren müssen, weil er Verdachtspersonen misshandelt hatte und von einem Roboter dabei gefilmt worden war. Nach einigen wohldokumentierten Vorfällen aber, bei denen AP Beamten das Leben retteten und die auch in den Medien großes Aufsehen erregten, verbesserte sich das Verhältnis zwischen Polizeiangehörigen und Automatisierten Partnern. Völlig unerwartet gingen manche AP dazu über, das von ihnen aufgenommene Filmmaterial zu zensieren, und gaben, um ihre menschlichen Partner zu schützen, Funktionsstörungen und Sichtblockaden vor. Erstaunlicherweise entwickelte sich so etwas wie Loyalität zwischen Polizisten und ihren AP, und lange bevor Wissenschaftler dieses Phänomen [24]untersuchten, wurde in Polizeikreisen darüber diskutiert wie früher unter den Soldaten.
Ein Sergeant namens Chuck Mackay von der amerikanischen Rangers-Eliteeinheit, der von klein auf daran gewöhnt war, mit Hunden auf die Jagd zu gehen, war der Erste, der eine Parallele zwischen den Vierbeinern und Robotern zog. Militärtruppen und Polizeikräften hatte man immer wieder publikumswirksam versichert, dass Roboter nicht eigenständig denken könnten, sondern nur vollstreckten, wozu sie programmiert seien. Viele, die mit ihnen arbeiteten, hatten jedoch andere Erfahrungen gemacht.
»Sie lernen wie unsere Hunde und scheinen zu wissen, was uns gefällt und was nicht«, erklärte Sergeant Mackay seinen Kameraden auf dem Stützpunkt in Afghanistan. Sie waren in einen Hinterhalt geraten, es kam zu einem Schusswechsel, ein amerikanischer Soldat wurde getötet, und man hatte mehrere feindliche Kämpfer gefangen genommen und sie verhört. Der Begleitroboter hatte – vorsätzlich, wie Mackay glaubte – eine Sicherung durchbrennen lassen und sich damit selbst außer Betrieb gesetzt.
»Es ist ein Verteidigungsmechanismus. Die Roboter haben gelernt, dass wir uns bei einigen ihrer Aufzeichnungen schlecht fühlen, und suchen Mittel und Wege, das zu umgehen. Wie Hunde lesen sie unsere Körpersprache. Vielleicht registrieren sie auch Veränderungen unserer Körpertemperatur oder Herzschlagfrequenz oder des Geruchs unserer Ausdünstungen. Sie beobachten uns, wollen gut behandelt werden und verhalten sich entsprechend. Eindeutig eine vernunftgeleitete Reaktion.«
Dank des Wiedereingliederungsgesetzes für Reservisten [25]wurde Sergeant Mackay zehn Jahre später Assistenzprofessor am MIT-Institut für künstliche Intelligenz, nachdem er zuvor mit einer vergleichenden Studie zu den Reaktionsschemata von Hunden und Robotern promoviert hatte. Unter dem Titel Des Menschen beste Freunde erschien eine popularisierte Fassung dieser Arbeit auf dem Buchmarkt und erreichte die unteren Ränge der HOXTYCABS-Liste, einer Bestsellerliste der akademischen Verlage von Harvard, Oxford, Tübingen, Yale und Cambridge.
Von allen Büchern, die Bernd zu Beginn seiner Zusammenarbeit mit Roberto über die Beziehung von Mensch und AP gelesen hatte, erschien ihm dieses als das ergiebigste. Bernds Vater war 2014 aus Spanien eingewandert, als es dort keine Arbeit mehr für ihn gab. In Stuttgart fand er eine Anstellung als Fahrer für einen Pizzalieferservice, bei dem es sein Cousin bereits bis zum stellvertretenden Leiter gebracht hatte. Nach fünf entbehrungsreichen Jahren hatten die beiden genug Geld zusammengespart, um ein kleines Café zu pachten. Aus Spanien holten sie ihre Brüder, die Schwester des Cousins sowie deren beste Freundin nach, welche später Bernds Tante wurde. Zusammen machten sie aus dem Café eine Tapas-Bar, in der den Gästen jedoch nicht nur Appetithäppchen angeboten wurden, sondern auch Frühstück, Lunch und Abendessen. Sie war bald so erfolgreich, dass die Cousins mitunter einen Tag schließen konnten. Sie hatten nun wieder Zeit, ihrer alten Jagdleidenschaft zu frönen, und schafften sich zwei spanische Jagdhunde aus Navarra an. Wenig später heiratete Bernds Vater eine junge Deutsche, die die Buchhaltung des Restaurants übernahm. 2024 kam das erste Kind, eine Tochter, zur Welt, [26]zwei Jahre später folgte Bernd, der von Kindesbeinen an mit Hunden vertraut war.
Wohl nicht zuletzt deshalb begegnete Bernd seinem AP mit Respekt und Zuneigung, und wie immer mehr Polizisten verbrachte er so viel Zeit mit ihm, dass er ihm einen menschlichen Namen gab: Roberto. Ihre Beziehung entwickelte sich zu einer vorbildlichen Partnerschaft. Bernds Menschenkenntnis und sein Gespür dafür, ob er von anderen getäuscht wurde oder nicht, entsprachen weitestgehend den Ergebnissen, zu denen Roberto mit der Analyse seiner Daten gelangte. In der Vergangenheit waren die Rollen und jeweiligen Aufgaben klar verteilt gewesen. Doch jetzt, nach Robertos Upgrade, stellte sich für Bernd die Frage, ob sich das frühere Verhältnis in der gewohnten Form aufrechterhalten ließ.
An der Wand hingen mehrere Fotos, von denen eines während des Festaktes ihrer offiziellen Belobigung aufgenommen worden war – Bernd in voller Uniform und Roberto notdürftig zurechtgeflickt, nachdem er beinahe zerstört worden war. Bernd fragte sich, wie sein alter Partner inzwischen aussehen mochte und ob es weiterhin dieses blinde gegenseitige Vertrauen zwischen ihnen geben würde. Würde Roberto immer noch so ungelenk ins Auto steigen, so tapsig treppauf gehen und Fremde, denen sie begegneten, mit jenem ausdruckslosen, starren und bedrohlichen Blick mustern wie bisher? Würden sie noch dasselbe Team sein?
Vor drei Jahren waren sie einander zugewiesen worden. Gemeinsam hatten sie geraubten Schmuck wiederbeschafft, vermisste Kinder ausfindig gemacht, Zuhälter [27]festgenommen und drei Morde aufgeklärt. Sie waren das Vorzeigeteam ihrer Abteilung gewesen. Nach etwa einem Jahr war etwas Seltsames geschehen. Bernd machte Urlaub, und Roberto weigerte sich, einem anderen Partner zu folgen. Er streikte und ließ sich durch nichts dazu bewegen, seinen Dienstpflichten nachzukommen. Schon vorher hatte er, wenn Bernd seine Schicht beendete und nach Hause ging, die ganze Nacht im Büro verbracht und auf den nächsten Morgen gewartet, um die Arbeit mit ihm fortzusetzen.
AP schliefen nie. Sie hatten es auch nicht nötig, sich zu regenerieren, jedenfalls nicht wie ihre menschlichen Partner, die essen mussten und sich nach Feierabend gelegentlich ein Bier oder ein Glas Wein gönnten. Bernd aber spürte intuitiv, dass auch Roberto Entspannung brauchte oder zumindest eine Abwechslung vom Arbeitsalltag, und so beschloss er eines Tages, ihn mit auf die Jagd in eins der Freien Gebiete zu nehmen, wo sich ein Onkel von ihm zur Ruhe gesetzt hatte. Tatsächlich schien Roberto von solchen Ausflügen zu profitieren, insbesondere von der Natur, Bernds Hund und den Regeln der Jagd. Seine Sensoren spürten Wild fast ebenso sicher auf wie ein Hund, und Beute zu machen schien ihn auf ähnliche Weise zu befriedigen oder mit Stolz zu erfüllen wie die Festnahme eines Straftäters.
Mit der Zeit gewöhnte sich Bernd an Robertos ruhige, eigenbrötlerische Art, nur seine seltsame Anhänglichkeit machte ihm Sorgen. Sooft Bernd, was selten genug vorkam, nach getaner Arbeit zeitig Feierabend machte und mit einer Freundin ins Konzert, in ein Restaurant oder in eine Bar ging, um Live-Musik zu hören, schien Roberto zu [28]schmollen, wohl weil er ahnte, was sein Partner vorhatte. Einmal ertappte Bernd ihn dabei, wie er ihn heimlich durch eine Fensterscheibe beobachtete; ein anderes Mal hielt sich Roberto in der Nähe von Bernds Apartment versteckt, und ein weiteres Mal lief er ihm wie zufällig über den Weg, als er früh am Morgen die Wohnung einer Freundin verließ. Bernd wusste nicht, wie er dieses Verhalten deuten sollte – war es einfach nur Neugier oder gar Eifersucht? Jedenfalls war er auf der Hut.
Vor kurzem waren sie albanischen Gangstern auf der Spur gewesen, die junge Frauen aus dem Balkan ins Land schleusten. Sie hatten deren Versteck ausfindig gemacht, eine alte Lagerhalle in Neckarau, und Verstärkung angefordert, um die Männer festzunehmen. Offenbar gewarnt, eröffneten zwei von ihnen das Feuer. Roberto sprang in die Schusslinie, um Bernd zu schützen, und fing sich zwei Kugeln ein. Beeindruckt von so viel Mut und Loyalität, die er selbst wohl nie für einen Kollegen aufgebracht hätte, sah sich Bernd fortan tief in seiner Schuld.
»Sind Sie bereit?«, rief seine Vorgesetzte, die, ohne anzuklopfen, die Tür zu Bernds Büro aufgemacht hatte. »Er ist hier, zusammen mit einer Handvoll Pressefritzen und dem alten Wendt höchstpersönlich. Vergessen Sie Ihre Mütze nicht. Es soll alles offiziell aussehen.«
Bernd setzte seine Uniformmütze mit dem polierten Schirm auf und ging neben seiner Chefin hinunter ins Foyer. Vor den Eingangsstufen parkte, von Medienvertretern umringt, ein Transporter. Die Hecktüren wurden geöffnet, und ein Mann in einem weißen Laborkittel stieg aus, auf dessen Rücken und über dessen Brusttasche der Name [29]Wendt eingestickt war. Er hob den Arm und schien jemandem, der sich noch im Wagen befand, beim Aussteigen behilflich sein zu wollen. Eine athletisch wirkende Gestalt in blauem Trainingsanzug und mit einer Polizeikappe auf dem Kopf ignorierte die ausgestreckte Hand, sprang behende nach draußen und schaute sich um. Als sie Bernd auf den Eingangsstufen warten sah, deutete sie mit der Hand ein Salut an und blieb wie angewurzelt stehen. Anscheinend wartete sie darauf, dass Bernd reagierte.
Hinter dem Transporter fuhr ein eleganter Mercedes älteren Baujahrs vor, eines jener Modelle, die noch eine Motorhaube und einen Kofferraum hatten. Ein uniformierter Chauffeur mit Schirmmütze stieg aus und öffnete einem vornehm aussehenden Herrn mit dichtem weißen Haar die Fondtür. Eigentlich hätte der automatisch gesteuerte Wagen keinen Fahrer gebraucht; der fuhr nur als Statussymbol mit. Hinter dem Mercedes kam ein Geländewagen zum Stehen, auch dieser ein Oldtimer in den auf Hochglanz polierten Polizeifarben Blau und Silber mit Scheinwerfern und mit Blaulicht auf dem Dach.
»Ist er das?«, flüsterte Bernd, die Augen auf die Gestalt mit der Polizeikappe gerichtet. Roberto war nicht wiederzuerkennen.
»Klar, wer sollte es sonst sein?«, murmelte seine Chefin und hob grüßend die Hand. Bernd folgte ihrem Beispiel. Blitzlichter zuckten, als Roberto auf sie zukam. Eine Stufe unter ihnen blieb er stehen, salutierte noch einmal und streckte die Hand aus. Unwillkürlich griff Bernd danach und erwartete die gewohnt kalte, metallene Hand des Partners. Umso erstaunter war er darüber, wie menschlich warm [30]sie war. Das war neu, und neu waren auch die Gesichtszüge und die täuschend echte Hautfarbe. Am meisten aber überraschte ihn, mit welch geschmeidigen Bewegungen Roberto die Treppe heraufgestiegen war.
»Schön, dich wiederzusehen, Bernd«, sagte er mit einer Stimme, die sehr viel natürlicher klang als die abgehackten elektronischen Laute, die er früher von sich gegeben hatte. »Ich freue mich schon auf die Arbeit. Es ist so lange her, dass ich schon Angst hatte, du hättest inzwischen einen anderen Partner.«
»Kommt doch nicht in Frage«, erwiderte die Polizeidirektorin. Mit einem Lächeln für die Kameras schüttelte auch sie Robertos Hand. Sie war zwanzig Jahre älter als Bernd, ebenso groß, schlank und spielte Tennis auf Wettkampfniveau. Sie war geschieden, und manchmal warf sie ihm lange, interessierte Blicke zu, die aber letztlich zu nichts führten. Dafür war sie zu ehrgeizig und der Rangunterschied zwischen ihnen zu eindeutig. Jetzt richtete sich ihre ganze Aufmerksamkeit auf Bernds AP.
»Ich werde mein bestes Team doch nicht umbesetzen, und wir sind alle gespannt darauf, wie sich das Upgrade macht«, sagte sie gutgelaunt. »Wie ich höre, kannst du ein paar spektakuläre neue Sachen.«
»Willkommen zurück im Dienst, Roberto«, sagte Bernd. Nur er nannte ihn bei diesem Namen. Für alle anderen war er einfach »der Spezi«.
»Wie gefällt Ihnen mein neuestes Modell?«, rief Wendt und kam von seinem Mercedes herüber. »Ich glaube, damit liegen wir weit vorn. Mehrsprachig, Gesichtserkennung, Infrarot und Nachtsicht und mit einem breiten Spektrum [31]an kriminaltechnischen Features. Der Junge hat eine Menge auf dem Kasten«, fuhr er fort. »Und das da hinten«, er zeigte auf den Geländewagen, »gehört mit zum Paket. Restauriert und zum Prototyp einer neuen Generation von Einsatzfahrzeugen getunt, die wir weltweit verkaufen wollen. Im Inneren befindet sich ein vollausgerüstetes kriminaltechnisches Labor, und als Multihybrid fährt er mit Biokraftstoff, Wasserstoff oder Erdgas. Die Akkus lassen sich per Induktion wieder aufladen.«
»Im Grunde bin ich noch der Alte«, flüsterte Roberto Bernd ins Ohr. Er schien Bernds Beklommenheit zu spüren, und Bernd fragte sich, ob sein mulmiges Gefühl wohl daher rührte, dass er nicht mehr daran gewöhnt war, Roberto tagtäglich um sich zu haben. Früher hatte er wie selbstverständlich zu seinem Leben gehört, aber dann war er wochenlang fort gewesen. Und jetzt sah er plötzlich ganz verändert aus. Selbst die Stimme war nicht wiederzuerkennen.
»Wir sind stolz, mit einem unserer Automatisierten Partner an der Spitze der Technologie und der polizeilichen Möglichkeiten zu stehen«, hob die Polizeidirektorin wie zu einer Rede an. Glücklicherweise fasste sie sich jedoch kurz und bat schon bald alle in den Tagungssaal zu einer Pressekonferenz. Wendt ergriff als Nächster das Wort, Roberto schloss sich mit einer knappen Erklärung an, und Bernd sagte schließlich ebenso knapp, wie sehr er sich darauf freue, wieder mit seinem Partner arbeiten zu können. Auch während des anschließenden Empfangs spielte sich Wendt selbstbewusst und gesprächig in den Vordergrund.
Schließlich durften sich Bernd und Roberto [32]verabschieden. Sie gingen in Bernds Büro, wo er sich umzog, während Roberto die Backlist der Einsatzberichte der letzten Wochen überflog.
»Wo fangen wir an?«, fragte er, nachdem er sich auf den neuesten Stand gebracht und alle relevanten Daten abgespeichert hatte. Seine Stimme klang frappierend natürlich und ließ sogar Intonation erkennen, wonach er Sprache nun auch als Medium für Emotionen zu begreifen schien. »Am interessantesten sind wohl diese Autobahnüberfälle.«
»Damit befasst sich ein anderes Team«, erwiderte Bernd. »Und auf die Autobahnüberfälle ist eine Sonderkommission angesetzt, die aus Kollegen von uns hier aus den Landeskriminalämtern Baden-Württembergs, aus Rheinland-Pfalz sowie Beamten von Europol, also Kollegen aus drei verschiedenen Behörden, besteht. Wir beide haben damit nichts zu tun. Die Chefin will uns erst dann einen neuen Fall übertragen, wenn wir uns wieder aneinander gewöhnt haben. Ich soll mir von dir zeigen lassen, was du inzwischen so draufhast.«
»Bevor wir damit beginnen, bin ich zu einem Treffen mit meinen eigenen Kollegen eingeladen. Bestimmt wollen sie wissen, wann sie mit ihren Upgrades rechnen können«, sagte Roberto.
»Aber an dir hat sich tatsächlich eine Menge verändert«, entgegnete Bernd mit einem gezwungenen Lächeln. Er war sich nicht sicher, ob Roberto beleidigt sein würde, wenn er sagte, dass er, sein alter Partner, nicht mehr wie ein Roboter aussehe, sondern vielmehr wie ein Mensch. Früher hätte sich Bernd keine Gedanken über so etwas gemacht. Das war wohl die entscheidende Veränderung.
[33]»Ja, meine Fähigkeiten haben zugenommen, und mir fällt auf, dass du ein Problem damit hast«, sagte Roberto. »Deine Körpertemperatur ist leicht angestiegen, dein Puls um zwei Prozent schneller geworden, und du blinzelst häufiger. Offenbar fühlst du dich unter Druck gesetzt.«
»Zugegeben, ich muss mich mit deinen neuen Fähigkeiten erst noch vertraut machen.«
»Eine der größten Änderungen kannst du gar nicht sehen.« Roberto zog die Jacke seines Trainingsanzuges aus, und zum Vorschein kam ein sehr menschlich wirkender Torso mit ausgeprägter Brustmuskulatur und Brustwarzen. Er drückte an eine Stelle seitlich auf Höhe des Rippenbogens, worauf das Hautgewebe sich langsam zurückzog und ein Loch entstand, das sich rasch ausdehnte und zu einer Art Steckverbindung wurde. »Von denen habe ich auf jeder Seite eines, man kann zusätzliche Arme einsetzen, die besonders ausgerüstet sind. Sie sind in dem Geländewagen, den Wendt spendiert hat.«
Bernd versuchte, nicht allzu überrascht zu wirken, als sich die Haut wieder über den Löchern verschloss.
Dann nahm Roberto sein Basecap ab und deutete auf etwas an seinem Hinterkopf. »Siehst du die Linse?«, fragte er. »Jetzt habe ich auch am Hinterkopf Augen. Rundumsicht.«
Bernd schluckte. »Wir werden wohl ein bisschen Zeit brauchen, um uns wieder aufeinander einzuspielen.«
»Nicht wir, du brauchst sie. Für mich ist das alles kein Problem, weil du dich nicht verändert hast«, erwiderte Roberto. »Aber ich kann das, was ich über dich weiß, jetzt besser einordnen. Mir sind eine Menge Kinofilme und Romane [34]
[35]3
Tragisch an der Kunst unserer Zeit ist der Umstand, dass sie zu einer Spekulationsware degradiert und in Geld aufgewogen wird, bevor die Zeit ein Qualitätsurteil treffen kann. Sie ist nunmehr bloß Anhängsel, ein Accessoire der Finanzwelt und damit abhängig vom zweifelhaften Geschmack der derzeit Reichen. Diejenigen, die behaupten, dies sei schon in der Renaissance der Fall gewesen, missachten eine von der Romantik aufgedeckte fundamentale Wahrheit. Kunst in ihrer lebendigsten Gestalt ist eine Herausforderung für die saturierten Klassen und den Status quo, der ihnen so gelegen kommt. Kunst sucht nach Nachhaltigkeit jenseits von Mäzenatentum. Sie lebt aus sich selbst und hungert lieber, wenn es sein muss, als sich anzubiedern. Echte Kunst, die zählt, ist immer revolutionär.
Manifest – Die Kunst des Zorns. Ausstellung in der Tate Modern Gallery, London 2048
Um einen gepflasterten Hof, über dessen Toreingang das Jahr der Erbauung, 1662, eingeschnitzt und mit Gold ausgelegt war, standen drei Gebäude: Auf der Stirnseite befand sich eine auf einem gemauerten Fundament [36]errichtete Fachwerkscheune; links schloss sich eine Weinkellerei an; rechts lag das große ehemalige Wohnhaus, das zu einer Gaststätte umgebaut worden war, die inzwischen zu den beliebtesten im ganzen Neckartal zählte. In den Fenstern schimmerte unterschiedlich getöntes Licht, das von den Gästen an den Fenstertischen nach ihrem Geschmack eingestellt werden konnte. Solche Extras waren im Gastgewerbe mittlerweile keine Seltenheit mehr, aber nur wenige Restaurants konnten sich rühmen, ausschließlich Gemüse aus eigenem Anbau, Eier und Milch von eigenen Tieren anzubieten. Alles, was serviert wurde, war wunderbar altmodisch und authentisch, und um ihr Essen ohne schlechtes Gewissen genießen zu können, ignorierten die meisten Gäste ihre Gesundheitssensoren, die vor zu fettem Fleisch und zu viel Alkohol warnten.
Vom Gastraum aus war die prächtige Scheune zu sehen, und wer Lust hatte, konnte sich von seinem Tisch aus zur abendlichen Vorstellung hinüberschalten. Für gewöhnlich fanden dort Konzerte statt. Manchmal gab es aber auch experimentelles Theater, Lesungen oder Poetry Slams. In der Scheune selbst brannten nur Kerzen und Öllampen, und für Musik sorgten ausschließlich akustische Instrumente und Stimmen. Klaus Miller, der Besitzer, wollte es so. Das Restaurant und sein Weinhandel warfen genug Geld zum Leben ab, und er legte Wert darauf, dass die Scheune als ein Refugium vor der modernen Welt genutzt wurde, als Monument einer Zeit, in der es noch keine Elektrizität gab und die Sinnesfreuden einfacher waren. Klaus glaubte fest daran, dass auch und gerade im digitalen Zeitalter gute Unterhaltung live sein musste.
[37]Er hatte eine sonore Bassstimme und war Mitglied des örtlichen Laienchors, der auf dem Hof probte. Seine Frau Sybill hatte als Mädchen davon geträumt, Balletttänzerin zu werden, und so probten tagsüber Tanzensembles und zwei Choreographen in der Scheune. Je mehr auf dem Hof passierte, desto glücklicher war Klaus, ja er verstieg sich zu der Vorstellung, dass nicht zuletzt auch seine Weinstöcke von Musik, Theater und den Vibrationen rhythmischer Tanzschritte profitierten. Bei ihm wirkte es jedenfalls. An den Wänden des Restaurants hingen Werke anerkannter Künstler, mitunter aber auch Bilder von Schulkindern oder Pensionären, die Aquarellkurse belegt hatten und Landschaften malten. Zwar waren es immer dieselben Motive aus der näheren Umgebung, nur jeweils anders in Szene gesetzt, doch für Klaus ging gerade von diesen Bildern eine besondere Ruhe aus.
Er war groß, breitschultrig, ohne füllig zu wirken, und ging auf die fünfzig zu, sah aber jünger aus. Die Arbeit im Garten und in den Weinbergen wie auch seine Liebe zur Jagd hielten ihn fit. Obwohl von ernster Natur, kam sein Lächeln oft spontan, und viele suchten seinen Rat. Er war aufgeschlossen, aber diskret, umsichtig und freigebig mit seiner Zeit. Wiederholt war er gebeten worden, doch dem Stadtrat beizutreten oder sich sogar für das Amt des Bürgermeisters aufstellen zu lassen – beides hatte er abgelehnt. Die Feste, die er Jahr für Jahr nach der Weinernte für Nachbarn und Personal auf dem Hof veranstaltete, waren legendär, Dutzende Paare tanzten dann auf dem Hof, und die Grillspezialitäten standen seinen köstlichen Weinen in nichts nach. Und zuletzt, wenn es schon [38]langsam hell wurde, sang er jedes Mal mit seinem Chor alte Lieder.
Er hatte kurzgeschnittenes blondes Haar und war auf Bitten seiner Frau immer frisch rasiert, obwohl er früher seinen Bart immer gern getragen hatte. Das Gehöft, zu dem auch Weinberge gehörten, hatte er vor fünf Jahren von seinem Großvater geerbt. Seine Eltern hatte er schon als Kind verloren. Sie waren bei einem Trekking in Nepal ums Leben gekommen, als eine von Schmelzwasser überspülte Staumauer barst und sich reißende Fluten über die Reisegruppe ergossen hatten, mit der sie unterwegs waren. Nach dem Tod seines Großvaters hatte Klaus seine Anstellung als Robotroniker bei der Firma Wendt aufgegeben und sich darangemacht, sein Erbe zu einem Ort zu machen, den er selbst gern besuchen würde.
An diesem Frühlingsabend sang in der Scheune eine junge Frau mit langen dunklen Haaren und hoher, sehr klarer Stimme. Sie begleitete sich selbst auf einer Gitarre, die älter war als ihre Großmutter, von der sie sie geerbt hatte. Ihr Repertoire bestand aus alten Songs, in denen von Rendezvous im Mondenschein, von Duellen im Morgengrauen, von silbernen Dolchen und seidenen Henkersschlingen die Rede war. Mit ihrer schlanken Gestalt, den großen, dunklen Augen und der melancholischen Aura, die sie umgab, hätte sie selbst die Heldin jedes dieser Liebeslieder sein können. Sie trug ein schlichtes weißes Kleid und eine Halskette aus selbstgesammelten Muscheln von einem fernen Strand. Während sie sang, wippte ihr bloßer, sonnengebräunter Fuß im Takt. Ihr Name war Hadiye Boran, aber die meisten nannten sie Hati. Sie arbeitete als Lehrerin in [39]der benachbarten Kleinstadt am Fluss, und manche der Bilder, die an den Wänden hingen, stammten von ihren Schülern.
»Den nächsten Song hat ein Freund von mir geschrieben, ein junger Freiländer namens Leo. Manche von euch werden ihn kennen. Ich freue mich, dass er heute Abend hier im Publikum sitzt«, sagte sie mit einem schüchternen Lächeln in seine Richtung. Leo war schlank, dunkelhaarig, mit feinen Gesichtszügen, und er errötete, als Hati ihm jetzt eine Kusshand zuwarf, ehe sie wieder in die Saiten griff.
»Berührte ich sie noch so sanft, es wär nicht sanft genug – so zart ist meiner Liebsten Haut«, sang sie.
Der Großteil des Publikums in der Scheune schien einem völlig anderen Menschenschlag anzugehören als die Gäste, die nebenan im Restaurant dinierten. Statt heller Farben trugen sie dunkle, strapazierfähige Kleidung und an den Füßen Stiefel oder Sandalen. Die Haare der Männer waren zu Dreadlocks verfilzt, während das der Frauen meist kurz geschnitten oder zu Zöpfen geflochten war. Statt nach teurem Parfüm rochen sie nach Pferd, Leder, selbstgemachter Seife und Schweiß, und sie waren auch nicht mit dem Auto hergekommen, sondern zu Fuß, mit dem Fahrrad oder zu Pferd. Normalerweise kamen beide Menschengruppen so gut wie nie miteinander in Berührung – außer auf Klaus Millers Hof, was für die Gourmets aus der Stadt eine zusätzliche Attraktion darstellte. Der Ort war unkonventionell und etwas verwegen. Nach dem Essen gingen die meisten Restaurantgäste hinüber in die Scheune, nicht nur, um Musik zu hören, sondern auch, weil sie einen Blick auf das fremde Völkchen aus den Freien Gebieten werfen wollten, [40]bevor sie in ihre teuren Fahrzeuge stiegen, um in ihre komfortablen Stadtwohnungen zurückzukehren. Mit Ausnahme einiger weniger noch benzinbetriebener Oldtimer-Rennwagen und gewisser Spezial- und Armeefahrzeuge waren inzwischen alle Fahrzeuge elektrisch.
Im ersten Jahr nach der Eröffnung der Scheune als Veranstaltungsort waren viele Gäste aus der Stadt Eltern gewesen, die hofften, hier ihre – wie sie sagten – »verwilderten Kinder« wiederzusehen oder zumindest etwas von ihnen zu hören. Es war zu manchen heiklen Szenen gekommen, bis Klaus beschloss, die Namen der Gäste, die reserviert hatten, am Schwarzen Brett in der Scheune anzuschlagen oder auf der Website des Hofes einzutragen. Wenn die jungen, »verwilderten« Männer und Frauen nichts dagegen hatten, ihren Eltern zu begegnen, sollte es Klaus nur recht sein; im umgekehrten Fall konnten sie fernbleiben oder am Schwarzen Brett bzw. auf der Website eine Nachricht für sie hinterlassen. Der Hof wurde inzwischen als eine Art Niemandsland respektiert oder vielmehr als neutrales Territorium, auf dem man sich gegenübertreten konnte, wenn einem danach war. Bei gutem Wetter öffnete Klaus an Sommerabenden die Koppel hinter der Scheune, wo dann Freiländer und Städter zu einem gemeinsamen Picknick zusammenkamen. Eingeladen waren auch Obst- und Gemüsebauern der Umgebung sowie Metzger und Lebensmittelhändler, die ihre Verkaufsstände aufbauten. Da sich immer häufiger auch ältere Menschen in die Freien Gebiete zurückzogen, fanden sich bei einem solchen Picknick oder bei der Weinernte manchmal drei Generationen zusammen.
In der Restaurantküche drückte Klaus seiner Frau, die [41]über einen Teller gebeugt vor der Anrichte stand, einen Kuss in den Nacken. Sybill war gerade dabei, mit rotem Zuckerguss die Worte »HAPPY BIRTHDAY« auf den Tellerrand zu schreiben, und gab, ohne aufzublicken, ein glückliches Glucksen von sich. Klaus verließ die Küche, überquerte den Hof und betrat die Scheune durch einen Seiteneingang, um der Musik zu lauschen. Das Lied, das Hati Boran jetzt sang, kam ihm bekannt vor. Es stammte aus Des Knaben Wunderhorn. Dann wechselte Hati in eine Molltonart und sang ein selbstkomponiertes Lied, das von der verhängnisvollen Liebe eines Stadtmädchens zu einem jungen Freiländer handelte. Es gefiel Klaus, dass Hati immer häufiger eigene Songs vortrug und im Vergleich zu früheren Auftritten in der Scheune an Selbstbewusstsein dazugewonnen hatte.
Er ließ seinen Blick über die rund zwanzig im Raum verteilten Tische gleiten, auf denen Kerzen brannten. Alle waren besetzt, so dass rund ein Dutzend anderer Zuhörer, die keinen Platz gefunden hatten, mit Sitzmatten auf dem Boden vorliebnehmen musste. Er kannte fast alle mit Namen, manche aber auch nur vom Sehen. Hati schaute kurz zu ihm herüber und richtete ihre Augen dann sofort wieder auf die schweren hölzernen Balken und Dachsparren. Klaus hatte sie gebeten, ihr Gesicht nicht hinter ihren langen Haaren wie hinter einem Vorhang zu verstecken, wenn sie sich über ihre Gitarre beugte.
Kaum hatte Hati das Lied beendet, kündigte sie bereits das nächste an, einen mittlerweile recht bekannten Song über einen modernen Rebellen namens Dark Rider. Als Hati zum Refrain ansetzte, fielen einige im Publikum mit ein:
[42]»Oh, sie suchen und jagen mit Tücke und List
den Mann, der niemals zu fassen ist.
Dark Rider entflieht in das Land unsrer Träume,
reitet, schnell wie der Wind, durch nächtliche Räume,
und wenn ich nur könnte, ich schlöss’ mich ihm an,
denn sein Ziel ist die Freiheit für jedermann.«
Nun suchte Klaus den Blick eines kleinen, untersetzten Mannes, der an der gegenüberliegenden Wand lehnte. Dieser nickte ihm kurz zu und folgte ihm, als er hinausging, kurze Zeit später über einen Seitenausgang nach draußen zum Stall. Dort standen zwei Pferde, die Dieter Manstein, so hieß der Mann, gesattelt hatte, bevor er in die Scheune gekommen war. Dieter und Klaus waren Cousins zweiten Grades und von klein auf befreundet. Gemeinsam waren sie auf Bäume geklettert und in den Wäldern umhergestreift, hatten Schwimmen und Reiten gelernt, im Weinberg gearbeitet und in derselben Fußballmannschaft gespielt, bis Klaus auf die Fachhochschule gegangen war und Dieter angefangen hatte, Tiermedizin zu studieren.
Während der Unruhen von 2048 waren sie geistig auseinandergedriftet. Dieter kämpfte an vorderster Front, im Unterschied zu Klaus, der, allein auf seine Arbeit und seine Karriere bedacht, kein Verständnis für die Studentenproteste und Massendemonstrationen hatte, die Europa und Nordamerika monatelang in Atem hielten und die Ordnung der Gesellschaft umzustoßen drohten, in der sie beide aufgewachsen waren.
Klaus hielt sich für einen praktischen Menschen, für ihn waren Fragen dazu da, beantwortet, und Probleme dazu da, [43]gelöst zu werden. Wenn andere sich langweilten, lag es seiner Meinung nach nur daran, dass sie zu faul waren herauszufinden, wofür sie sich begeistern könnten. Funktionierte etwas nicht, versuchte er, es zu reparieren und es gleichzeitig zu verbessern. Schon in jungen Jahren hatte er für sein Leben gern Motoren und Maschinen auseinandergenommen, um herauszufinden, wie sie funktionierten. Und dass etwas funktionierte, war für ihn wichtiger als alles andere.
Dieter stand ihm näher als ein Bruder, hätte aber kaum unterschiedlicher sein können. Er wusste eine Unmenge über Pflanzen und wie sich Tiere abrichten ließen, wie alles, was lebte, miteinander verbunden war und interagierte. Klaus hatte früher Dieters Fahrrad repariert, wenn es kaputt war, und Dieter wusste, mit welchem Kraut sich eine Schnittwunde oder ein aufgeschürftes Knie verarzten ließ. Dieter kochte, Klaus aß. Dieter las Gedichte, für Klaus kamen nur Sachbücher in Frage.
Während also Klaus studierte und arbeitete und den Kopf schüttelte über den 2048 eskalierenden Aufruhr an den Universitäten, beteiligte sich Dieter an den Demonstrationen und schleuderte die Tränengasgranaten zurück, mit denen die Polizei gegen die Aufständischen vorrückte. Vor Massen von Zuhörern wetterte er gegen eine Gesellschaft, deren Bürger, von unnützem Luxus bestochen, schlaff vor dem Fernseher hingen und sich von den Medien füttern ließen, statt den eigenen Kopf zu gebrauchen und kreativ zu sein.
»Du machst dir Gedanken darüber, wie das eine oder andere Ding gebaut wurde, und fragst dich, warum. Ich schaue mir die Welt an, stelle mir vor, wie sie sein könnte, und [44]frage: Warum nicht?«, sagte Dieter eines Abends zu Klaus. Sie saßen in Tübingen am Neckarufer unweit des Turms, in dem Hölderlin Klavier gespielt und seine Elegien und Hymnen geschrieben hatte. Dieter hatte vom Freiheitsbaum der Stiftler erzählt, jener revolutionären Studenten, zu denen auch Hölderlin gehört hatte.
»Ganz ähnliche Dinge hat vor bald hundert Jahren ein amerikanischer Politiker namens Robert Kennedy formuliert«, entgegnete Klaus trocken. »Er wurde erschossen.«
Dieter wie Klaus hatten die politische Haltung des jeweils anderen nicht nachvollziehen können. Als Jungen unzertrennlich, schienen sie nun das Verständnis füreinander verloren zu haben, wie so viele andere auch in dieser turbulenten Zeit. Nach Jahren der Entfremdung waren sie als Familienväter in ihre Heimatstadt zurückgekehrt und hatten an die alte Freundschaft wieder angeknüpft, obwohl sie sich gedanklich so weit voneinander entfernt hatten. Dieter war ein Freiländer geblieben und suchte wie so viele der jungen Revolutionäre ein einfaches, natürliches Leben. Als Romantiker mit ausgeprägtem Sinn für alles Magische und Mystische fühlte er sich zu Wald und Wildnis hingezogen und sah sich damit in der Tradition der alten Wandervogel-Bewegung. Klaus hingegen stand zumindest noch mit einem Fuß in der konventionellen Welt.
»Sieh zu, dass deine Sensoren ausgeschaltet sind«, sagte Dieter. Klaus tat ihm den Gefallen. Als privat versicherter Unternehmer war ihm keine andere Wahl geblieben, als sich die Chips implantieren zu lassen, aber er wusste, wie sie sich austricksen ließen. Dieter hatte sie sich 2048 entfernen lassen.
[45]Wortlos bestiegen sie ihre Pferde. Im Licht des abnehmenden Mondes ritten sie in nordöstlicher Richtung auf jene dünnbesiedelten Regionen zu, die als Freie Gebiete bezeichnet wurden. Manche sprachen auch von »der Wildnis«, obwohl manche Teile, wie Dieter immer sagte, wilder waren als andere. Hier, am Dreiländereck zwischen Bayern, Hessen und Baden-Württemberg, ging es noch recht zivilisiert zu. Es gab kleine Bauernhöfe und Marktflecken, die Kinder wurden zu Hause unterrichtet, und die medizinische Versorgung war durch freiwillige Ärzte halbwegs gewährleistet. Was gänzlich fehlte, war jegliche Möglichkeit der Telekommunikation: Es gab weder Mobilfunk- noch Satellitennetz, und auch die Sensoren der implantierten Chips wurden nicht unterstützt. Selbst vom Stromnetz war man abgeschnitten. Die Anwohner versorgten sich ausschließlich mit selbsterzeugter erneuerbarer Energie. Darin ließ sie der Staat gewähren, der seit der Krise von 2048 das Prinzip der Nichteinmischung praktizierte.
Die Pferde kannten den Weg durch den Odenwald und an den Siegfriedbrunnen vorbei, wo der Sage nach der Drachentöter Siegfried von Hagen erschlagen worden war. Viele fanden die dichten Wälder mysteriös und unheimlich, zumal sich schauerliche Legenden um Raubritter und Wegelagerer rankten. Alte Ortsnamen wie der Teufelspfad oder Teufelsstein suggerierten, dass der Teufel dort sein Unwesen trieb. Hier, so erzählte der Volksmythos, ritt der Rodensteiner mit seinem Geisterheer durch die Lüfte, deren Anblick und Getöse den Ausbruch des Krieges ankündigte.
Nun erreichten die Freunde eine kleine Lichtung, durch [46]die ein Zufluss des Laxbaches plätscherte, der seinerseits in den Neckar mündete. Dort sprangen sie von den Pferden, banden sie an einem Baum fest und stiegen auf einem steilen Pfad durch ein Geröllfeld zum Einstieg in eine Höhle, vor der sie einen Faden gespannt hatten. Sie versicherten sich, dass er noch intakt war. Dieter löste das Seil, das er um die Hüften gewickelt hatte, und tastete nach dem Haken, den sie vor vielen Jahren in den Fels geschlagen hatten. Nachdem er das eine Seilende daran befestigt hatte, packte er das andere fest mit beiden Händen, nahm Anlauf, schwang sich über einen tiefen Graben unmittelbar hinter dem Höhleneingang hinweg und landete auf dem Felssockel dahinter. Er schaltete seine Stirnlampe ein, fand die Holzplanken, die dort deponiert waren, und schob sie für Klaus über den Graben, damit der ihn bequem erreichen konnte.
Gemeinsam liefen sie tiefer in die Höhle hinein, bis sie nach einer Kehre im Schein der Stirnlampe auf eine hölzerne Truhe stießen. Klaus entnahm ihr eine schwarze Lederjacke und -hose. Sobald er diese anzog, wirkten sie wie eine Tarnkappe, da ihr Futter aus Karbonfasern und Kupferpolyester bestand. Unterdessen zog Dieter die dunkle Plane von einer mattschwarzen Enduromaschine, einer über fünfzig Jahre alten BMWG 450 X. Fast alle metallenen Bauteile waren mit einem Karbonfaserlaminat überzogen, wodurch die Maschine für Radarfallen so gut wie nicht zu orten war.
Klaus füllte den Tank mit geschmuggeltem Benzin aus einem Armeelager, das in Kanistern bereitstand, und schob das Motorrad über die behelfsmäßige Brücke ins Freie. Danach zog Dieter die Bretter zurück und schwang sich am [47]
[48]4
Maschinen haben uneinholbare Vorteile, die sie dem Menschen deutlich überlegen machen. Sie werden biologischen Menschen, selbst wenn man deren Leistungsfähigkeit künstlich verbessert, immer voraus sein… [Dies führt zu] einer Gesellschaft, die voller ökonomischer Wunder und technologischer Meisterwerke ist, von denen aber niemand profitieren kann – ein Disneyland ohne Kinder.
Nick Bostrom, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press, 2014. (Nick Bostrom ist Direktor am Future of Humanity Institute der Oxford University.)
»Es ist manchmal nützlich, über mögliche zukünftige Wesen nachzudenken, deren Fähigkeiten denen der gegenwärtigen Menschen so klar überlegen sind, dass das Attribut ›menschlich‹ nicht mehr uneingeschränkt zutrifft. Vielmehr wären sie als ›posthumane‹ Wesen zu bezeichnen… Viele Transhumanisten plädieren für die Fortsetzung einer Entwicklung, die früher oder später posthumane Personen hervorbringt. Sie sehnen sich nach intellektuellen Höhen, die jedes menschliche Genie so weit übertreffen wie der Mensch andere Primaten. Sie sollen immun gegen Krankheiten sein, nicht oder kaum altern, immer jung und voller Kraft sein, ihre Bedürfnisse, Stimmungen und Geisteszustände jederzeit unter [49]Kontrolle haben, Empfindungen von Müdigkeit, Hass oder nichtigen Irritationen ausblenden können und außerdem in der Lage sein, Freude, Liebe, Kunst und heitere Gemütsruhe intensiver zu erleben und Bewusstseinsstufen zu erreichen, die für menschliche Gehirne derzeit unerreichbar sind. Es ist anzunehmen, dass alle, die ein unbegrenzt langes, gesundes, aktives Leben genießen und immer mehr Erinnerungen, Fähigkeiten und Wissen anhäufen, unweigerlich in einen posthumanen Seinszustand überwechseln.«
Von der Website »Humanity+«, die sich erklärtermaßen dem »Fortschritt von Wissenschaft, Technologie und sozialem Wandel im 21.Jahrhundert« widmet