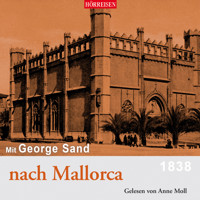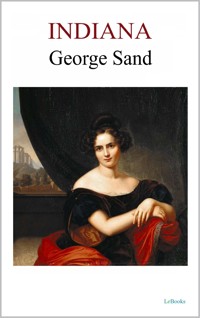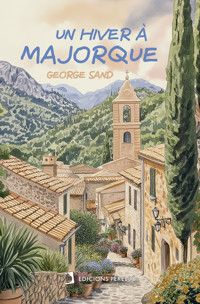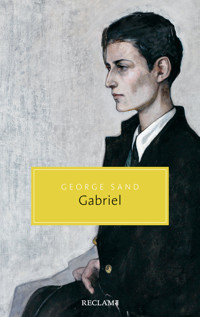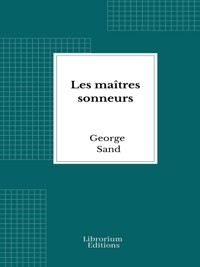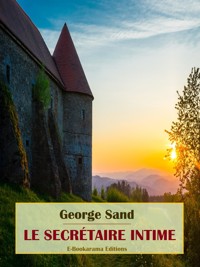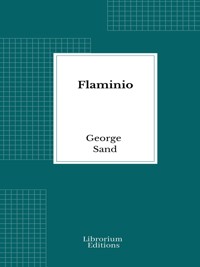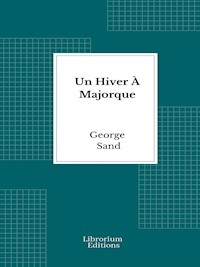1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Gesammelte Werke: Romane + Novellen + Autobiographie + Briefe" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. George Sand (1804-1876) war eine französische Schriftstellerin, die neben Romanen auch zahlreiche gesellschaftskritische Beiträge veröffentlichte. Sie setzte sich durch ihre Lebensweise und mit ihren Werken sowohl für feministische als auch für sozialkritische Ziele ein. So rebellierte sie beispielsweise gegen die Beschränkungen, die den Frauen im 19. Jahrhundert durch die Ehe als Institution auferlegt waren, und forderte an anderer Stelle die gleichberechtigte Teilhabe aller Klassen an gesellschaftlichen Gütern ein. Inhalt: Die kleine Fadette Indiana Lelia Isidora Teverino Der Teufelssumpf Die Marquise Franz der Champi Lavinia Pauline Kora Geschichte meines Lebens (Autobiografie) Madame George Sand über Mozart George Sand und ihre Kinder Wie George Sand jetzt lebt George Sand als Rednerin Briefe an George Sand (Gustave Flaubert)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Gesammelte Werke: Romane + Novellen + Autobiographie + Briefe
Die kleine Fadette + Indiana + Lelia + Isidora + Teverino + Der Teufelssumpf + Die Marquise + Franz der Champi + Geschichte meines Lebens + Lavinia + Pauline + Kora…
Übersetzer: Adolph Braun, Johannes Scherr, Aug. Cornelius, Claire von Glümer
Inhaltsverzeichnis
Die kleine Fadette
Erstes Kapitel
Der Vater Barbeau in la Cosse war ein Mann, der sich keineswegs in schlechten Verhältnissen befand; und daß er Mitglied des Municipalrates in seinem Orte war, mag als Beweis dafür dienen. Er besaß zwei Grundstücke, deren Ertrag ihn und seine Familie ernährte, und noch darüber hinaus einen Überschuß lieferte. Von seinen Wiesen erndete er tüchtige Fuder Heu, und ausgenommen von derjenigen, welche an den Ufern des Baches lag und durch die Binsen ein wenig beeinträchtigt wurde, war dies Heu als eins von der besten Sorte in der ganzen Gegend bekannt.
Das Haus des Vaters Barbeau war von solidem Bau und mit Ziegeln gedeckt. Es stand in gesunder Lage auf einem Hügel und war mit einem Garten von reichlichem Ertrage und mit einem Weinberge von sechs Tagewerken verbunden. Schließlich befand sich hinter der Scheune noch ein Baumgarten, wie man bei uns zu sagen pflegt, der einen Überfluß von Früchten lieferte, sowohl an Pflaumen und süßen Kirschen, wie auch an Birnen und Vogelbeeren. Sogar die Nußbäume längs der Umzäunungen waren die ältesten und größten auf zwei Meilen weit in der Runde.
Vater Barbeau war ein Mann von tüchtiger Sinnesart, ein sorglicher Familienvater, ohne Neid und Mißgunst, ohne seinen Nachbarn und Ortsgenossen je zu nahe zu treten.
Er hatte schon drei Kinder, als die Mutter Barbeau, – jedenfalls, weil sie der Meinung war, daß sie genug hätten, um deren fünf zu ernähren, vielleicht auch, weil es galt sich zu beeilen, da ihr das Alter näher rückte, – sich's einfallen ließ, ihren Mann mit einem Zwillingspaar, zwei schönen Knaben, zu beschenken. Da die beiden sich einander ähnlich sahen, daß man sie kaum zu unterscheiden vermochte, waren sie auf den ersten Blick als Zwillinge zu erkennen. Die Mutter Sagette, welche sie bei ihrem Eintritt in die Welt in ihrer Schürze auffing, vergaß nicht dem zuerst Geborenen mit ihrer Nadel ein kleines Kreuzchen auf dem Arme zu punktieren. Sie war der Meinung, daß ein als Erkennungszeichen umschlungenes Band oder Halskettchen, leicht verwechselt werden könnte, und so das Recht der Erstgeburt in Gefahr gerate, verloren zu gehen. Wenn das Kind kräftiger geworden sei, müsse man es mit einem Zeichen versehen, das sich nie verwischen lasse, und man verfehlte nicht dies zu thun.
Der Ältere erhielt den Namen Sylvain, woraus man bald Sylvinet machte, um ihn von seinem ältesten Bruder zu unterscheiden, den man ihm als Taufpaten gegeben hatte. Der jüngere Zwilling wurde Landry genannt, und diesen Namen ließ man ihm unverändert, wie er ihn in der Taufe erhalten hatte, weil sein Onkel, der ihm als Pate gedient hatte, von frühester Jugend auf Landriche genannt worden war.
Der Vater Barbeau war ein wenig erstaunt, als er bei seiner Heimkehr vom Markte zwei kleine Köpfe in der Wiege erblickte. »Ohl oh!« sagte er, »da seht einmal, die Wiege ist zu klein. Morgen früh muß ich daran, sie etwas größer zu machen.« Er verstand sich ein wenig auf das Handwerk des Zimmermanns, ohne es erlernt zu haben, und die Hälfte seiner Möbeln war von ihm selbst verfertigt. Er wunderte sich nicht weiter, sondern wandte sich lieber seiner Frau zu, die ein großes Glas Glühwein trank, nach dessen Genuß sie sich um so besser befand. – »Du bist so gut im Zuge, Frau,« sprach der Mann zu ihr, »daß ich wirklich meine Kräfte zusammen nehmen muß. Es gilt jetzt zwei Kinder mehr zu ernähren, die wir gerade nicht nötig gehabt hätten. Das will soviel sagen, als daß ich nun ohne Rast noch Ruhe auf unseren Äckern und bei unserem Vieh im Stalle schaffen muß. Aber, sei nur ruhig, Frau; ich werde mit der Arbeit schon fertig werden, wenn du das nächste Jahr nur nicht mit Drillingen heran kommst; das wäre des Guten zu viel!«
Die Mutter Barbeau war dem Weinen nahe, worüber ihr Mann sehr bekümmert wurde. – »Ruhig, ruhig! liebe Frau,« sagte er; »laß dich's nicht verdrießen. Ich sagte dir's ja nicht um dir einen Vorwurf zu machen, sondern ganz im Gegenteil, um dir meinen Dank auszusprechen; diese beiden Kinder sind gesund und wohlgestaltet; am ganzen Körper haben sie nicht einen einzigen Fehler, und ich freue mich darüber.«
»Ach Gott,« sagte die Frau, ich weiß recht gut, daß du mir keine Vorwürfe machen willst; aber ich selbst bin voller Sorgen, da es in der Welt nichts lästigeres und unsicheres geben soll, als ein Paar Zwillinge aufzuziehen. Der eine beeinträchtigt den anderen, und fast immer muß einer von ihnen zu Grunde gehen, damit der andere gedeihen kann!«
»Ei, was!« sagte der Vater, »sollte das wirklich so sein? Diese da sind in meinem Leben die ersten Zwillinge, die ich sehe; dergleichen kommt nicht oft vor. Aber, da haben wir ja die Mutter Sagette, die sich darauf verstehen muß, und die uns sagen kann, was man davon zu halten hat.«
Die Mutter Sagette, die sich in dieser Weise dazu aufgefordert sah, erwiderte: – »Laßt's euch von mir gesagt sein: Diese beiden Zwillinge werden schön und gut gedeihen, und mit Krankheiten nicht mehr zu schaffen haben, als andere Kinder auch. Seit fünfzig Jahren betreibe ich mein Geschäft als Hebamme, und sehe alle Kinder, die im Bezirk geboren werden, leben oder sterben. Es ist also auch nicht das erste Mal, daß ich dabei bin, wenn Zwillinge geboren werden. Zunächst thut's ihrer Gesundheit keinen Schaden, daß sie einander ähnlich sehen. Es giebt aber auch Zwillinge, die sich ebensowenig gleichen, wie ihr und ich, oft kommt's auch vor, daß einer von ihnen kräftig und der andere schwach ist: dann geschieht's, daß der eine lebt und der andere stirbt. Nun betrachtet aber einmal die eurigen! Seht! wie sie beide gleich schön und richtig gebaut sind; als ob sie jeder ein einziger Sohn wären. Im Schoße ihrer Mutter haben sie sich also keinerlei Schaden zugefügt; der eine wie der andere sind sie leicht zur Welt gekommen, ohne ihrer Mutter, oder sich selbst viele Schmerzen verursacht zu haben. Sie sind wunderniedlich und haben kein anderes Verlangen als zu leben. Tröstet euch also, Mutter Barbeau; es wird euch großes Vergnügen machen, wenn ihr seht, wie sie gedeihen. Wenn sie so bleiben, wie sie da sind, wird es außer euch und denjenigen, die sie täglich vor Augen haben, kaum jemanden geben, der sie voneinander unterscheiden könnte, denn noch nie habe ich zwei so vollkommen gleiche Zwillinge gesehen. Man könnte sagen: sie sind wie zwei Feldhühner, die aus demselben Ei gekrochen sind. Da ist alles so niedlich und so gleichartig, daß niemand als die Mama Feldhuhn sie voneinander unterscheiden kann.«
»Das wäre!« ließ sich der Vater Barbeau vernehmen, indem er sich den Kopf kraute; »ich hörte aber sagen, daß Zwillinge mit der Zeit aneinander hängen sollen, daß sie nicht mehr leben können, wenn sie voneinander getrennt werden; daß wenigstens einer von ihnen sich vor Kummer verzehren würde, bis er daran gestorben sei.«
»Das ist die reine Wahrheit,« bestätigte die Mutter Sagette; »aber merkt euch, was eine Frau von Erfahrung euch sagen wird. Vergeßt es nicht! denn um die Zeit, in der eure Kinder das Alter erreicht haben, wo sie das elterliche Haus verlassen, werde ich vielleicht nicht mehr in der Welt sein, um euch mit meinem Rat beistehen zu können. Sobald euere Zwillinge anfangen verständig zu werden, seid auf euerer Hut, sie nicht immer beisammen zu lassen, schickt den einen zur Arbeit hinaus, während der andere zu Hause bleibt. Wenn der eine auf den Fischfang geht, schickt den anderen auf die Jagd. Wenn der eine die Schafe hütet, laßt den anderen die Ochsen auf die Weide treiben; gebt ihr dem einen ein Glas Wein zu trinken, so reicht dem anderen ein Glas Wasser, und so umgekehrt. Scheltet oder bestraft sie ja nicht beide zu gleich, laßt sie auch nicht beide gleich gekleidet sein: wenn der eine einen Hut trägt, setzet dem anderen eine Kappe auf; und vor allem achtet darauf, daß ihre Blusen nicht von derselben blauen Farbe sind. Schließlich bietet alles auf, was in eurer Macht steht, sie daran zu verhindern, sich so leidenschaftlich aneinander anzuschließen und sich so zu gewöhnen, daß der eine ohne den anderen nicht mehr sein kann. Ich fürchte sehr, ihr werdet das, was ich euch da gesagt habe, ins eine Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus gehen lassen. Aber, wenn ihr euch nicht darnach haltet, werdet ihr es eines Tages bitter zu bereuen haben.«
Mutter Sagette sprach goldene Weisheit, und man glaubte daran. Man versprach ihr, nach ihren Worten zu thun, und entließ sie mit einem schönen Geschenke. Da sie dringlichst empfohlen hatte, die Zwillinge nicht mit derselben Milch zu ernähren, war man darauf bedacht, sich rasch eine Amme zu verschaffen.
Es war indessen im ganzen Orte keine aufzutreiben. Mutter Barbeau hatte in dieser Hinsicht keine Vorkehrungen getroffen, da sie auf Zwillinge nicht gerechnet, und alle ihre anderen Kinder selbst genährt hatte. So geschah es also, daß Vater Barbeau sich auf den Weg machen mußte, in der Umgegend nach einer passenden Amme zu suchen. Mittlerweile nahm die Mutter, die ihre Kleinen doch nicht darben lassen konnte, eins nach dem anderen an die Brust.
Bei uns zu Hause sind die Leute nicht eben rasch von Entschluß, und wie reich man auch sein mag, so muß bei jedem Geschäft doch immer etwas gehandelt werden. Man wußte, daß die Barbeaus es bezahlen konnten und war auch der Meinung, daß die Mutter, die nicht mehr in der ersten Blüte stand, unmöglich würde zwei Säuglinge stillen können, ohne sich selbst zu erschöpfen. Die Ammen alle, die Vater Barbeau auftreiben konnte, verlangten für den Monat achtzehn Franken, nicht mehr, noch weniger, als sie von einem Bürger gefordert haben würden.
Vater Barbeau wollte nur zwölf bis fünfzehn Franken geben und meinte, dies sei für einen Bauersmann schon viel. Er wandte sich überall hin und knüpfte Unterhandlungen an, ohne jedoch zum Abschluß kommen zu können. Die Sache drängte auch nicht so sehr, denn die beiden noch so kleinen Kinder konnten der Mutter nicht beschwerlich werden. Dabei befanden sie sich so wohl, waren so ruhig, so durchaus keine Schreihälse, daß sie fast nicht mehr Störung im Hause verursachten, als wenn nur ein einziges dagewesen wäre. Sobald der eine schlief, schlief auch der andere; auch hatte der Vater die Wiege in passender Weise verändert, und wenn sie beide zu weinen anfingen, wiegte und beruhigte man sie zu gleicher Zeit.
Endlich war man so weit gekommen, daß Vater Barbeau mit einer Amme einen Kontrakt abschloß, der auf fünfzehn Franken pro Monat lautete; es handelte sich nur noch um die Bewilligung eines Nadelgeldes von hundert Sous, als seine Frau plötzlich zu ihm sagte: – »Ei was! lieber Mann, ich sehe nicht ein, warum wir jährlich hundertundachtzig, oder gar zweihundert Franken hinauswerfen sollen, als wären wir eine große Herrschaft, oder als ob ich über die Jahre hinaus wäre, meine Kinder selbst nähren zu können. Ich habe mehr Milch, als dazu nötig ist. Unsere Buben sind jetzt schon einen Monat alt, und sieh nur, ob sie nicht dick und rund sind. Die Merlaude, die du dem einen von beiden zur Amme geben wolltest, ist nicht halb so kräftig und gesund wie ich. Ihre Milch ist schon achtzehn Monate alt, und das ist nicht mehr das richtige für ein so kleines Kind. Es ist wohl wahr, die Sagette hat uns geraten die Zwillinge nicht mit derselben Milch zu nähren, damit sie nicht eine zu große Anhänglichkeit füreinander gewinnen sollten. Aber sie hat uns ja auch gesagt, daß die Kinder beide gleich gut gepflegt werden müssen, weil alles in allem genommen, Zwillinge nicht ganz dieselbe Lebenskraft hätten, wie andere Kinder. Mir ist es lieber, wenn die unsrigen sich künftig zu lieb haben, als wenn eins dem anderen geopfert werden sollte. Und dann, welches von den beiden sollten wir der Amme übergeben? Ich muß dir gestehen, daß ich mich gerade so ungern von dem einen wie von dem anderen trennen würde. Ich kann sagen, daß ich alle meine Kinder sehr lieb hatte; aber ich weiß nicht, wie es kommt, ich meine doch, diese hier wären die niedlichsten und hübschesten, die ich auf dem Arm gehabt hätte. Ich habe für sie eine sogar eigene Empfindung, die mich immer fürchten läßt, ich könnte sie verlieren. Ich bitte dich, Mann, denke nicht mehr an die Amme. Im übrigen wollen wir alles thun, was die Sagette uns so dringlich empfohlen hat. Wie sollte das nur zugehen, daß Kinder an der Mutter Brust eine zu große Anhänglichkeit für einander gewinnen könnten. Zur Zeit der Entwöhnung werden sie doch nicht weiter sein, als daß sie höchstens ihre Hand von ihrem Fuß zu unterscheiden wissen.«
»Was du da sagst, Frau, läßt sich hören,« erwiderte Vater Barbeau, indem er seine Frau betrachtete, die noch immer frisch und kräftig war, wie man wenig andere Frauen in ihrem Alter sah. »Wenn nun aber trotzdem, wie die Kinder zunehmen, deine Gesundheit verkümmern würde?«
»Sei unbesorgt deshalb,« sagte Frau Barbeau, »das Essen schmeckt mir noch so gut, als wenn ich erst fünfzehn Jahre alt wäre. Überdies verspreche ich dir, sobald ich fühlen werde, daß es mich erschöpfen könnte, dir dies nicht zu verbergen, und dann wird es noch immer Zeit sein, eins von den beiden armen Kindern aus dem Hause fort zu thun.«
Vater Barbeau fügte sich diesen Vorstellungen um so lieber, da er selbst sehr geneigt war, überflüssige Ausgaben zu vermeiden. Mutter Barbeau nährte ihre Zwillinge ohne zu klagen, und ohne darunter zu leiden; sie war von so trefflicher Konsumtion, daß sie sogar zwei Jahre, nachdem sie ihre Zwillinge entwöhnt hatte, einem allerliebsten Töchterchen das Leben gab, welches in der Taufe den Namen Nanette erhielt, und das gleichfalls von ihr selbst genährt wurde. Dies war jedoch des Guten zu viel, und sie würde Mühe gehabt haben, ihre Aufgabe zu Ende zu führen, wenn nicht ihre älteste Tochter, die gerade ihr erstes Kind hatte, sie von Zeit zu Zeit in ihren mütterlichen Pflichten unterstützt hätte, indem sie ihrer kleinen Schwester die Brust gab.
In dieser Weise wuchs die kleine Familie heran und tummelte sich bald in der Sonne herum: die kleinen Onkels und Tanten mit den kleinen Neffen und Nichten, die sich einander nichts vorzuwerfen hatten, wer von ihnen am meisten lärmte, oder wer verständiger war.
Zweites Kapitel
Die Zwillinge wuchsen munter heran, ohne häufiger von Krankheiten heimgesucht zu werden, als andere Kinder auch; ja sie waren sogar von so sanfter und gutartiger Gemütsart, daß man hätte meinen können, das Zahnen und Wachsen mache ihnen lange nicht so viel zu schaffen, als der ganzen übrigen kleinen Welt.
Sie waren blond und blieben blond, ihr Leben lang. Sie waren von überaus einnehmender Erscheinung, hatten große blaue Augen, schön abfallende Schultern, einen ebenmäßigen Wuchs und eine gute Haltung. Dabei waren sie größer und von kühnerem Vorgehen, als alle ihre Altersgenossen. Die Leute aus der Umgegend, welche durch den Marktflecken la Cosse kamen, blieben stehen, um sie zu betrachten und wunderten sich über ihr gutes Benehmen. Im Weitergehen sagte jeder: »Wie allerliebst die beiden kleinen Buben sind!«
Dies war die Ursache, weshalb die Zwillinge sich beizeiten daran gewöhnten Auskunft zu geben, wenn Fragen an sie gerichtet wurden, und dies keineswegs in verschüchterter oder einfältiger Weise zu thun. Zwanglos begegneten sie jedermann, und statt sich hinter Gesträuch zu verbergen, wie dies die Kinder bei uns zu thun pflegen, wenn sie einen Fremden erblicken, hielten sie jedermann stand, waren immer sehr höflich und antworteten auf alles, was man sie fragte, ohne den Kopf hängen, oder sich dazu nötigen zu lassen. Auf den ersten Blick vermochte man keinen Unterschied zwischen ihnen wahrzunehmen, und man glaubte sie wären einander so ähnlich Wie ein Ei dem anderen. Aber hatte man sie eine Weile betrachtet, dann erkannte man, daß Landry um ein Atom größer und stärker war, daß er ein etwas dichter gewachsenes Haar, eine etwas stärkere Nase und ein lebhafteres Auge hatte. Auch hatte er eine breitere Stirn und eine entschlossenere Miene, und sogar ein Mal, welches sein Bruder auf der rechten, und er auf der linken Wange hatte, trat bei ihm viel deutlicher hervor. Die Leute im Orte wußten sie daher recht gut zu unterscheiden; allein sie bedurften dazu doch eines kurzen Besinnens, und beim Eintritt der Dunkelheit, oder in geringer Entfernung täuschten sich fast alle, umsomehr, da bei den Zwillingen die Stimme von ganz gleichem Klange war; und da sie recht gut wußten, daß sie miteinander verwechselt werden konnten, antworteten sie oft der eine im Namen des anderen, ohne sich die Mühe zu geben dritte Personen über den Irrtum aufzuklären. Selbst Vater Barbeau war es einige Male begegnet, daß er sich irrte. So geschah es, wie die Sagette es vorher gesagt hatte, daß allein die Mutter sich niemals täuschte, mochte es Mitten in der Nacht, oder in der größten Entfernung sein, wo ihr Auge die Gestalt ihrer Kinder noch eben zu erreichen, oder ihr Ohr deren Stimme noch zu vernehmen vermochte.
In der That, einer war des andern wert; wenn Landry auch etwas fröhlicheren und kühneren Sinnes war, als sein älterer Bruder, so war Sylvinet dagegen von so zutraulicher und sinniger Gemütsart, daß man ihm nicht weniger gut sein konnte, als dem Jüngeren. Während des ersten Vierteljahres war man wohl darauf bedacht zu verhindern, daß sie sich nicht zu sehr aneinander gewöhnen sollten. Drei Monate, das ist eine lange Zeit auf dem Lande, um etwas, das gegen die Gewohnheit ist, zu beobachten. Indessen, auf der einen Seite erkannte man, daß es keine besondere Wirkung hatte, und andererseits hatte der Pfarrer gesagt, die Mutter Sagette sei eine unverständige Schwätzerin, und was Gott durch die Gesetze der Natur angeordnet habe, könnte durch den Menschen nicht wieder aufgehoben werden. Das war einleuchtend und so kam es, daß man allmählich alles vergaß, was man sich zu thun vorgenommen hatte. Das erste Mal, als man bei den Zwillingen die Kinderkleidchen fort ließ, und ihnen Höschen anzog, um sie mit in die Messe zu nehmen, waren diese aus demselben Tuche gefertigt, denn es war ein Unterrock der Mutter, der für die beiden Anzüge hingereicht hatte; auch waren sie von ein und demselben Schnitt, da der Schneider der Ortschaft sich nur auf diesen einen verstand.
Als die Zwillinge heranwuchsen, stellte es sich heraus, daß sie in Bezug auf Farben denselben Geschmack hatten. Als ihre Tante Rosette jedem von ihnen zum Neujahrstage ein Halstuch schenken wollte, wählten sie bei dem hausierenden Händler, der seine Ware auf dem Rücken seines Pferdes von Haus zu Haus führte, sich jeder ein Tuch von derselben Lilafarbe. Die Tante fragte sie darauf, ob sie dies thäten, weil sie sich dabei dächten, daß sie immer gleich gekleidet sein wollten. Die Zwillinge aber suchten ihre Gründe nicht so weit, und Sylvinet antwortete, daß dies die schönste Farbe sei, und das Tuch das schönste Muster habe von allen die in dem Ballen des Händlers zu finden wären. Gleich darauf versicherte Landry, daß an alle den anderen Halstüchern ihm nichts gelegen sei.
»Und was haltet ihr denn von der Farbe meines Pferdes?« fragte lächelnd der Handelsmann.
»Sehr häßlich!« sagte Landry. »Es sieht aus wie eine alte Elster.«
»Ganz abscheulich!« bekräftigte Sylvinet. »Grade wie eine schlecht befiederte Elster.«
»Ihr seht wohl,« wandte der Händler sich mit verständnisvoller Miene an die Tante, »daß diese Kinder alles mit demselben Auge ansehen. Wenn der eine etwas für gelb hält, was rot ist, wird der andere sofort für rot halten, was gelb ist. Man muß ihnen darin nicht widersprechen, denn es heißt: wenn man Zwillinge verhindern wolle, sich als Abdrücke nach ein und demselben Vorbilde zu betrachten, würden sie blöde im Kopf werden und gar nicht mehr wissen, was sie sagen sollten.«
Der Händler sagte dies, weil seine Tücher von Lilafarbe schlecht gefärbt waren, und er gern zwei davon los werden wollte.
Mit der Zeit ging es mit allen Dingen in dieser Weise fort; und die Zwillinge waren immer ganz gleich gekleidet, so daß die Gelegenheit sie zu verwechseln, noch viel häufiger vorkam. Mochte es nun kindischer Übermut sein, oder mochte es durch die Gewalt jenes Naturgesetzes geschehen, wogegen nach des Pfarrers Ansicht nicht anzukämpfen war, – kurz, wenn der eine von den Zwillingen etwas an seinem Holzschuh zerbrochen hatte, beschädigte rasch auch der andere etwas an dem seinigen, und zwar an dem desselben Fußes. Hatte der eine an seinem Wams oder seiner Mütze etwas zerrissen, so machte der andere ohne Zögern den Riß an den seinigen so genau nach, daß man hätte sagen können, er sei durch denselben Zufall verursacht worden. Wenn die Zwillinge darüber befragt wurden, lachten sie und nahmen eine harmlos verstellte Miene an.
Ob es nun zum Glück oder zum Unglück war: diese Freundschaft nahm mit den Jahren immer mehr zu, und mit dem Tage, da sie zu denken begannen, sagten die beiden Kinder sich, daß es ihnen unmöglich sei, sich am Spiel mit anderen Kindern zu erfreuen, wenn einer von ihnen nicht dabei sei. Wenn der Vater den Versuch machte, den einen seiner Zwillinge den ganzen Tag über bei sich zu behalten, während der andere bei der Mutter blieb, waren die Kinder beide so niedergeschlagen und lässig bei der Arbeit, und blickten so bleich und verkümmert drein, daß man hätte glauben sollen, sie seien krank. Fanden sie sich dann aber am Abend wieder zusammen, dann machten sie sich miteinander Hand in Hand auf den Weg, und waren nicht so bald wieder nach Hause zurückzubringen, so wohl war es ihnen wieder beisammen zu sein; auch grollten sie ihren Eltern ein wenig, ihnen solch ein Entbehren auferlegt zu haben. Man machte eigentlich auch keinen weiteren Versuch mit diesen vorübergehenden Trennungen, denn um die Wahrheit zu sagen, war es unverkennbar, daß Vater und Mutter, ja sogar die Onkel und Tanten, die Brüder und Schwestern eine an Schwäche streifende Vorliebe für die Zwillinge hatten. Sie waren stolz darauf, wegen der Schmeicheleien, die sie in Bezug auf diese Kinder zu hören bekamen, und auch, weil dies wahrlich ein Paar Knaben waren, die sicherlich nichts von Häßlichkeit, Dummheit oder Bosheit an sich trugen. Von Zeit zu Zeit machte es dem Vater Barbeau noch einige Sorge, was schließlich aus dieser Gewohnheit des beständigen Beisammenseins werden sollte, wenn sie einmal das Alter der Reife erlangt haben würden. In Erinnerung an das, was die Sagette gesagt hatte, versuchte er manchmal durch verschiedene Neckereien sie zur gegenseitigen Eifersucht aufzustacheln. Wenn sie zum Beispiel etwas Verkehrtes angestellt hatten, zupfte der Vater Sylvinet an den Ohren, während er zu Landry sagte: »Dir mag es für dieses Mal hingehen, da du sonst meistens der Vernünftigste bist.« Indessen, wenn es Sylvinet heiß um die Ohren wurde, fand er gerade darin seinen Trost, das man wenigstens seinen Bruder verschont hatte, und Landry weinte, als ob er es gewesen wäre, der die Strafe erlitten hatte. Man versuchte es auch damit, das man etwas, nachdem sie beide Verlangen trugen, nur dem einen von ihnen gab; bestand dies aber in irgend einer Näscherei, so wurde diese sofort unter ihnen geteilt. Oder, war es irgend eine andere artige Spielerei, so nahmen sie dieselbe gemeinschaftlich in Besitz; oder der eine nahm sie an und gab sie abwechselnd dem anderen, ohne einen Unterschied zwischen dem mein und dein gelten zu lassen. Belobte man den einen wegen seines guten Betragens, und nahm dabei die Miene an, als ob man dem anderen die gerechte Anerkennung versagen wollte, so bezeigte dieser seine Zufriedenheit und war stolz darauf, seinen Zwillingsbruder ermuntert und geliebkost zu sehen; ja er schickte sich an, ihn gleichfalls zu streicheln und zu liebkosen. Schließlich wäre es nur eine verlorene Mühe gewesen, hätte man noch weitere Versuche anstellen wollen, sie innerlich oder äußerlich voneinander zu trennen. Gleich wie man Kindern, die man liebt, nur ungern verweisend entgegentritt, selbst dann, wenn es zu ihrem besten wäre, so machte man es auch bald mit den Zwillingen und ließ die Dinge gehen, wie es Gott gefiel. Höchstens trieb man nur noch ein Spiel mit diesen kleinen Neckereien, ohne daß die Zwillinge sich dadurch täuschen ließen. Sie besaßen eine große Schlauheit, und damit man sie in Ruhe lassen sollte, thaten sie einige Male, als ob sie untereinander stritten und sich schlagen wollten. Ihrerseits war dies nur ein Scherz und während sie übereinander herfielen, nahmen sie sich Wohl in acht, daß keiner dem anderen auch nur im geringsten weh thun konnte. Wenn irgend ein müßiger Gaffer sich wunderte, sie miteinander streiten zu sehen, liefen sie davon, um über ihn zu lachen, und dann hörte man sie plaudern und zwitschern wie ein paar Amseln die auf demselben Zweige sitzen.
Trotz ihrer großen Ähnlichkeit und dieser außerordentlichen Zuneigung, war es Gottes Wille, der im Himmel und auf Erden nichts vollkommen gleiches erschaffen hat, daß sie ganz verschiedene Schicksale haben sollten, und dann war es zu erkennen, daß sie zwei in der Idee des Schöpfers getrennte Wesen waren, die sich durch ihr eignes Empfindungsvermögen voneinander unterschieden. Vater Barbeaus Familie vergrößerte sich, dank sei's den beiden ältesten Töchtern, die nicht feierten, schöne Kinder in die Welt zu setzen. Sein ältester Sohn Martin, ein schöner und braver Bursche war bei anderen im Dienst; seine Schwiegersöhne arbeiteten tüchtig, aber es war nicht grade immer Überfluß an Arbeit vorhanden. Es hat bei uns hintereinander eine Reihe von schlechten Jahren für die Ernte gegeben, sowohl durch die ungünstigen Witterungsverhältnisse, als auch durch die Stockungen des Handels; durch diese Verhältnisse war aus der Tasche des Landmannes mehr Geld hinaus geschafft, als wieder herein gebracht worden. Dies war so sehr der Fall gewesen, daß Vater Barbeau nicht mehr die hinreichenden Mittel besaß, seine ganze Familie bei sich zu behalten, und so mußte wohl daran gedacht werden, die Zwillinge bei anderen in den Dienst zu geben. Da war nun der Vater Caillaud von la Priche, der ihm das Anerbieten machte einen von beiden zu nehmen, um seine Ochsen zu führen, denn er hatte einen ansehnlichen Grundbesitz zu bewirtschaften, und seine eignen Söhne waren für jenen Dienst, entweder schon viel zu erwachsen, oder noch viel zu jung. Die Mutter Barbeau geriet in große Angst, als ihr Eheherr zum erstenmale über diese Angelegenheit mit ihr sprach und empfand großen Kummer darüber. Man hätte denken sollen, es sei ihr noch nie in den Sinn gekommen, daß ihren Zwillingen ein derartiges Los bevorstehen könne, und dennoch war sie in dieser Hinsicht schon immer in Sorgen gewesen. Indessen, da sie ihrem Manne gegenüber sehr unterwürfig war, fand sie kein Wort der Erwiderung dagegen. Der Vater empfand seinerseits Wohl auch große Bekümmernis und leitete die Sache von weitem ein. Die Zwillinge weinten anfangs und streiften drei Tage lang in Wald und Wiesen umher, ohne sich im Hause blicken zu lassen, als zu den Stunden der Mahlzeiten. Mit ihren Eltern sprachen sie nicht ein Wort darüber, und wenn man sie fragte, ob sie daran gedacht hätten sich zu fügen, erwiderten sie nichts, aber so bald sie allein waren, besprachen sie sich viel untereinander.
Den ersten Tag nach der traurigen Botschaft, verbrachten sie nur mit Klagen, und sie hielten sich umschlungen, wie in der Furcht, daß man sie gewaltsam trennen könnte. Aber Vater Barbeau würde es nicht in den Sinn gekommen sein, so etwas zu thun. Er besaß die Weisheit des Landmannes, die zum Teil in der Geduld besteht und zum Teil in dem Vertrauen auf die heilsame Wirkung der Zeit. Auch waren die Zwillinge am folgenden Morgen, als sie sahen, daß man sie durchaus nicht drängte, und daß man darauf rechnete, die Vernunft würde ihnen schon kommen, in viel größerer Bekümmernis über den väterlichen Beschluß, als Drohungen und Strafen ihnen zu verursachen vermocht hätten, – »Es wird nicht anders sein, als daß wir uns darin fügen müssen,« sagte Landry; »es kommt jetzt nur noch darauf an, wer von uns gehen wird; man ließ uns ja die Wahl, und der Vater Caillaud hat gesagt, daß er uns nicht alle beide nehmen könne.«
»Was liegt mir noch daran, ob ich gehe oder bleibe,« sagte Sylvinet, »da wir uns ja doch trennen müssen. Ich denke nicht einmal darüber nach, daß ich hinaus soll, anderswo zu leben; wenn ich nur dich bei mir behalten könnte, würde ich mich recht gut vom Hause entwöhnen.«
»Das ist leicht gesagt,« erwiderte Landry, »und doch wird es dem, der bei unseren Eltern bleibt tröstlicher zu Mute sein, und er wird, weniger von der Sehnsucht zu leiden haben als der andere, der nichts mehr von alledem sieht, was ihm Trost und Erquickung war: weder seinen Zwillingsbruder, noch seinen Vater und seine Mutter, weder seinen Garten noch seine Tiere.«
Landry sagte dies alles mit ziemlich gefaßter Miene; aber Sylvinet war dem Weinen nahe, denn er besaß lange nicht einen so festen entschlossenen Sinn, wie sein Bruder. Die Vorstellung alles, was ihm lieb und teuer war, mit einem Male verlassen zu müssen, erfüllte ihn mit solchem Schmerz, daß er seine Thränen nicht länger zu bezwingen vermochte.
Landry weinte auch, aber nicht so fassungslos; überhaupt in einer ganz anderen Weise, denn er war stets darauf bedacht, den schlimmsten Teil alles Unangenehmen auf sich zu nehmen, und er wollte sehen, wie viel sein Bruder ertragen könne, um ihm dann alles Übrige zu ersparen. Er wußte recht gut, daß Sylvinet sich mehr ängstigen würde, an einem anderen Orte zu wohnen und in einer fremder Familie zu leben, als er dies thun würde.
»Höre Bruder,« sprach er zu ihm, »wenn wir uns zu einer Trennung entschließen müssen, ist es am besten, daß ich gehe. Du weißt ja, daß ich etwas stärker bin, als du; wenn wir von einer Krankheit befallen werden, was beinah immer zu gleicher Zeit geschieht, hast du das Fieber jedesmal etwas mehr als ich. Man sagt, daß wir sterben könnten, wenn man uns trennt. Was mich betrifft, so glaube ich nicht, daß ich sterben würde; aber für dich möchte ich nicht einstehen, und das ist es, weshalb es mir lieber wäre, dich bei unserer Mutter zu wissen, die dich trösten und pflegen kann. Wenn man in der Liebe zwischen uns beiden einen Unterschied macht, was freilich kaum der Fall zu sein scheint, so glaube ich, daß du es bist, den man am liebsten hat, und ich weiß auch, daß du der Hübscheste und Zutraulichste bist. Bleibe du also hier, und ich gehe dann. Wir werden nicht weit voneinander fort sein. Die Ländereien des Vaters Caillaud grenzen an die unsrigen, und wir können uns jeden Tag sehen. Mir wird es angenehm sein, wenn ich mich tüchtig plagen muß; das wird mich zerstreuen, und da ich schneller laufen kann als du, komme ich dann gleich dich aufzusuchen, so bald ich mein Tagewerk beendet habe. Und du, da du nicht so viel zu thun hast, kommst jeden Tag herüber und suchst mich bei meiner Arbeit auf. So werde ich deinetwegen viel weniger Sorge haben, als wenn du aus dem Hause fort gingst, und ich daheim bliebe. Ich bitte dich also, bleibe hier.«
Drittes Kapitel
Sylvinet wollte von diesen Vorstellungen nichts wissen. Wenn er auch mit größerer Zärtlichkeit als Landry an seinem Vater, seiner Mutter und an seiner kleinen Nanette hing, so schrak er doch davor zurück seinen lieben Zwilling den schwersten Teil ihres Geschicks auf sich nehmen zu lassen.
Nachdem sie genug herumgestritten hatten, beschlossen sie, das Los, durch Strohhalm ziehen, entscheiden zu lassen, und Landry war es, der den kürzesten Halm zog. Sylvinet war mit dieser Probe nicht zufrieden; er wollte es noch einmal mit dem Werfen eines dicken Sousstückes versuchen. Dreimal fiel für ihn die Hauptseite des Gepräges nach oben. Es war also immer für Landry, den das Los zu gehen traf.
»Du siehst nun wohl, Wie das Schicksal es beschlossen hat,« sagte Landry, »und du weißt, daß man dem Willen des Schicksals nicht zuwiderhandeln darf.«
Sylvinet weinte am dritten Tage noch sehr, Landry aber vergoß kaum noch eine Thräne. Der erste Gedanke an das Verlassen des väterlichen Hauses, hatte ihm vielleicht noch größeren Schmerz verursacht, als seinem Bruder. Er war sich seines Mutes bewußt, und hatte sich nicht einen Augenblick über die Unmöglichkeit getäuscht, dem Willen seiner Eltern zu widerstehen. Aber grade, weil er viel über seinen Schmerz nachdachte, hatte er diesem den Stachel genommen; auch hatte er viele Gründe aufgefunden, die ihm sein Schicksal als eine unabwendbare Notwendigkeit erscheinen ließen. Sylvinet dagegen, der immer nur trostlos war, hatte nicht den Mut gehabt über die Angelegenheit nachzudenken. So war es also gekommen, daß Landry ganz entschlossen war zu gehen, während Sylvinet sich noch nicht einmal in die Notwendigkeit der Trennung gefunden hatte.
Auch hatte Landry überhaupt etwas mehr Selbstgefühl als sein Bruder. Es war ihnen so oft vorgesagt worden, daß sie nie ein ganzer Mann sein würden, wenn sie sich nicht darein finden könnten, voneinander getrennt zu sein. Landry nun, der den Stolz seiner vierzehn Jahre in sich keimen fühlte, wandelte die Lust an zu zeigen, daß er kein Kind mehr sei. Seitdem sie zum erstenmale ausgezogen waren, auf dem Wipfel eines Baumes ein Vogelnest zu suchen, bis auf den gegenwärtigen Tag, war er es stets gewesen, der bei jeder Unternehmung seinen Bruder überredete und mit sich fort zog. So gelang es ihm denn auch diesesmal ihn zu beruhigen, und als sie am Abend in das Haus der Eltern zurückkehrten, erklärte er seinem Vater: daß er und sein Bruder bereit seien, sich in das Unvermeidliche zu fügen, daß sie das Los gezogen hätten, und daß er hinaus gehen werde, die großen Ochsen von la Priche zu führen.
Vater Barbeau nahm seine Zwillinge und setzte jeden, obgleich sie schon groß und stark waren, auf eins seiner Kniee und sprach zu ihnen:
»Meine Kinder, ihr steht jetzt im Alter der Vernunft, das erkenne ich an eurer Unterwerfung, und ich bin mit euch zufrieden. Merkt es euch: Wenn die Kinder ihren Eltern Freude machen, sind sie Gott im Himmel wohlgefällig, der sie früher oder später dafür belohnen wird. Ich weiß nicht, wer von euch beiden der erste war, der sich zu unterwerfen bereit war. Aber Gott weiß es und wird ihn dafür segnen, daß er zum Guten gesprochen hat, wie er den anderen dafür segnen wird, daß er sich darnach gerichtet hat.«
Darauf führte der Vater seine Zwillinge zur Mutter, damit auch sie ihnen ihr Lob spende. Aber Mutter Barbeau wurde es so schwer ihre Thränen zu unterdrücken, daß sie keines Wortes fähig war, und sich damit begnügen mußte, ihre Lieblinge zu umarmen und zu küssen.
Vater Barbeau, der einen guten Verstand hatte, wußte recht gut, welcher von den beiden der mutigste war, und welcher am meisten Anhänglichkeit besaß. Er wollte den guten Willen Sylvinets nicht wieder erkalten lassen, denn er sah wohl, daß Landry für sich selbst ganz entschlossen war, und daß nur eins: der Kummer seines Bruders, ihn wieder zum Wanken bringen konnte. Er ging deshalb vor Tagesanbruch an das Bett der Zwillinge und weckte Landry auf, nahm sich dabei aber wohl in acht den älteren Bruder, der an dessen Seite schlief, ja nicht anzurühren.
»Auf, mein Junge,« flüsterte er Landry leise zu, »wir müssen uns aufmachen nach la Priche, ehe deine Mutter es sieht, du weißt, sie ist voller Kümmernis, und man muß ihr den Abschied ersparen. Ich selbst will dich zu deinem neuen Herrn führen und dir deine Sachen tragen.«
»Soll ich denn ohne Abschied von meinem Bruder gehen?« fragte Landry. »Er wird mir böse werden, wenn ich ihn so ohne weiteres verlasse.«
»Wenn dein Bruder aufwacht und dich fortgehen steht, dann fängt er an zu weinen und weckt auch deine Mutter auf, und die Mutter wird noch heftiger weinen, wenn sie euch so betrübt sieht. Komm, Landry, du bist ein mutiger Bursche, du kannst es nicht wollen, daß deine Mutter krank wird. Erfülle deine Pflicht ganz, mein Kind, und gehe still hinaus. Schon heute Abend werde ich deinen Bruder zu dir führen, und da morgen Sonntag ist, kommst du den ganzen Tag zu deiner Mutter auf Besuch.«
Landry gehorchte mit mutiger Fassung und schritt zum Hause hinaus, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Mutter Barbeau hatte nicht so ruhig geschlafen, um nicht alles gehört zu haben, was ihr Mann zu Landry gesagt hatte. Die arme Frau fühlte, daß ihr Mann recht habe; sie rührte sich nicht von der Stelle und begnügte sich damit die Gardine des Bettes ein wenig zu lüften, um Landry fortgehen zu sehen. Das Herz wurde ihr dabei so schwer, daß es sie nicht länger im Bette hielt: sie sprang heraus, um ihn noch einmal zu umarmen; aber, als sie bis zu dem Lager der Zwillinge gekommen war, wo Sylvinet noch im festen Schlafe lag, blieb sie stehen. Der arme Knabe hatte seit drei Tagen, und so zu sagen, seit drei Nächten so viel geweint, daß er völlig erschöpft davon war. Er hatte sogar etwas Fieber, denn er warf sich auf seinen Kissen hin und her, stieß schwere Seufzer aus und stöhnte laut, ohne sich aus dem Schlafe losreißen zu können.
Als die Mutter Barbeau den einzigen Zwilling, der ihr noch verblieb, betrachtete, konnte sie nicht umhin sich zu gestehen, daß dieser es sei, dessen Scheiden ihr noch größeren Schmerz verursachen würde. Er war wirklich der gefühlvollere von den beiden; mochte es nun sein, daß er von zarterer Konstitution war, oder, daß es in dem von Gott gegebenen Naturgesetze so angeordnet war, daß, wo zwei Personen durch Liebe oder Freundschaft miteinander verbunden sind, die eine immer von größerer Hingabe ergriffen sein wird, als die andere. Vater Barbeau hatte und einer Feder Gewicht mehr Zuneigung für Landry, denn ihm galten Arbeitskraft und Mut mehr als Liebkosungen und zarte Aufmerksamkeiten. Die Mutter empfand eine kaum zu bemerkende größere Vorliebe für den zierlicheren und schmiegsameren ihrer Zwillinge, also für Sylvinet.
Da stand sie nun und betrachtete ihren armen Knaben, der ganz bleich und abgemattet dalag, und sie sagte sich, daß es himmelschreiend gewesen wäre, ihn schon so früh in einen Dienst zu geben. Landry habe eher das Zeug dazu, Mühe und Arbeit auszuhalten, und überdies würden die Liebe und Sehnsucht nach seinem Bruder und seiner Mutter ihm nicht so zusetzen, daß er krank davon werden könnte. Landry ist ein Bursche, der einen großen Begriff von seiner Pflicht hat, fuhr sie in ihren Betrachtungen fort; aber darin liegt es eben, wenn er nicht ein etwas trockenes Gemüt hätte, würde er nicht so entschlossen fortgegangen sein, ohne nur ein einziges Mal den Kopf zu wenden, oder auch nur eine einzige Thräne zu vergießen. Er würde nicht die Kraft gehabt haben, zwei Schritte weit zu gehen, ohne den lieben Gott anzuflehen, ihm Kraft und Mut zu verleihen. Er würde sich an mein Bett geschlichen haben, wo ich lag und so that, als ob ich schliefe, wenn auch nur, um mich noch einmal anzusehen, und den Zipfel meines Bettvorhanges zu küssen. Mein Landry ist freilich ein richtiger Bursche, der nur verlangt zu leben, sich tüchtig herumzutummeln, zu arbeiten, und der sich nach Ortsveränderung sehnt. Aber dieser hier hat ein Herz, so weich, wie das eines Mädchens; der ist so zärtlich und so sanft, daß man gar nicht anders kann, als ihn lieb haben, wie seinen eigenen Augapfel.
So dachte die Mutter Barbeau und kehrte ins Bett zurück, aber ohne wieder einschlafen zu können. Vater Barbeau und Landry schritten indessen querfeldeinwärts über Wiesen und Triften rüstig dahin in der Richtung nach la Priche. Als sie auf einer kleinen Anhöhe angelangt waren, von der aus man die Häuser von la Cosse, sobald man auf der anderen Seite hinabsteigt, nicht mehr sieht, blieb Landry stehen und blickte zurück. Das Herz wurde ihm schwer, und er setzte sich auf das Farnkraut nieder, unfähig einen Schritt weiter zu gehen. Sein Vater that, als ob er nichts bemerke, und setzte die Wanderung fort. Nach einer kleinen Weile rief er den Sohn sanft beim Namen und sprach zu ihm.
»Sieh, wie es schon dämmert, Landry; wir müssen uns beeilen, wenn wir noch vor Sonnenaufgang da sein wollen.«
Landry richtete sich wieder auf, und da er es sich zugeschworen hatte, vor seinem Vater nicht zu weinen, bezwang er die Thränen, die ihm in dicken Tropfen die Augen füllen wollten. Er that, als habe er sein Taschenmesser fallen lassen, und so kam er glücklich nach la Priche, ohne von seinem Schmerz, der gewiß kein geringer war, etwas blicken zu lassen.
Viertes Kapitel
Als der Vater Caillaud sah, daß man ihm den stärksten und thätigsten der Zwillinge zuführte, war er hoch erfreut darüber und empfing ihn mit großer Freundlichkeit. Er wußte recht gut, daß es viel gekostet haben würde, bis man zu einem Entschluß gekommen war, und da er ein wackerer Mann und ein guter Nachbar war, der mit Vater Barbeau auf freundschaftlichem Fuße stand, bot er alles aus, den jungen Burschen durch ermunterndes Entgegenkommen zu ermutigen. Er ließ ihm rasch die Suppe vorsetzen und einen Krug Wein dazu, um ihm den Sinn wieder aufzufrischen, denn es war leicht zu erkennen, daß der Kummer ihn drückte. Dann nahm er ihn mit hinaus, um die Ochsen anzuspannen und zeigte ihm, auf welche Art er dies zu thun pflege. Aber, wahrlich, Landry war kein Neuling in diesen Dingen; sein Vater besaß ja selbst ein stattliches Ochsenpaar, das er schon oft angeschirrt und zum Staunen aller, ausgezeichnet geführt hatte. Sobald er die großen Ochsen des Vater Caillaud erblickte, welche von der größten und schönsten Race, und die am besten gepflegten und am besten genährten in der ganzen Gegend waren, fühlte er, wie es seinem Stolze schmeicheln würde, ein so schönes Gespann mit seinem Stachel leiten zu dürfen. Und dann machte es ihm auch Freude zu zeigen, daß er weder ungeschickt noch feige sei, und daß man ihm nichts zu zeigen brauche, was er nicht schon verstehe. Sein Vater unterließ nicht, ihn zu loben und seine guten Eigenschaften herauszustreichen; und als es nun Zeit geworden war auf die Felder hinauszugehen, kamen alle Kinder Vater Caillauds, Knaben und Mädchen, groß und klein, freundlich herbei, den Zwilling zu begrüßen. Das jüngste von den Mädchen befestigte mit Bändern einen Blumenzweig an seinem Hut, weil dies der erste Tag seines Dienstes war, den die Familie, bei der er einstand, wie einen Festtag feiern wollte. Sein Vater gab ihm noch, bevor er sich zur Heimkehr anschickte, in Gegenwart seines neuen Herrn einige Ermahnungen, worin er ihn anwies, diesen in allen Dingen zufrieden zu stellen und das Vieh mit derselben Sorgfalt zu pflegen, als ob es sein eignes wäre.
Landry versprach sein möglichstes zu thun und zog dann an die Arbeit hinaus. Er hielt sich tapfer und arbeitete den ganzen Tag über tüchtig, und nach der Rückkehr vom Felde hatte er großen Appetit. Es war das erste Mal, daß er so streng gearbeitet hatte, und ein wenig Ermüdung ist das beste Mittel gegen Kummer.
Der arme Sylvinet war unterdessen auf dem Zwillingshofe viel übler daran. Dies war nämlich, wie hier gesagt werden muß, der Name, den man im Marktflecken la Cosse dem Anwesen des Vaters Barbeau seit der Geburt der beiden Knaben gegeben hatte; umsomehr, da einige Zeit später auch eine Magd des Hauses ein paar Zwillingsmädchen geboren hatte, welche freilich tot zur Welt gekommen waren. Da nun die Bauern stark darin sind, allerlei Geschwätz aufzubringen und Spitznamen zu erfinden, hat das Haus mit den dazu gehörenden Grundstücken den Namen: »Der Zwillingshof« erhalten; und überall, wo Sylvinet und Landry sich blicken ließen, wurden sie von der Dorfjugend mit dem Geschrei empfangen: »Seht da! die Zwillinge vom Zwillingshofe!«
Der erste Tag der Trennung wurde auf dem Hofe des Vaters Barbeau in großer Traurigkeit verbracht. Sobald Sylvinet erwachte und seinen Bruder nicht mehr an seiner Seite fand, ahnte er die Wahrheit; aber er konnte doch nicht begreifen, daß Landry so ohne Abschied von ihm zu nehmen, fortgegangen sein könne. Sylvinet war deshalb bei alle seinem Schmerz etwas böse auf seinen Bruder.
»Was kann ich ihm nur gethan haben?« fragte er seine Mutter, »und wodurch sollte ich ihn wohl erzürnt haben? In alles, was er mir zu thun riet, habe ich mich stets gefügt. Wenn er nur sagte, ich solle in Gegenwart unserer lieben Mutter nicht weinen, habe ich die Thränen zurückgedrängt, wenn auch der Kopf zu springen drohte. Er hatte mir versprochen, daß er nicht fortgehen wolle, ohne mir vorher noch einmal Mut eingeredet zu haben, und ohne mit mir am Ende des Hanfackers zu frühstücken, grade an der Stelle, wohin wir sonst immer miteinander gingen, um zu plaudern und zu spielen. Ich wollte ihm seine Sachen zusammenpacken und ihm mein Messer schenken, das viel besser ist als das seinige. Nun hast du ihm wohl gestern Abend seine Sachen gepackt, ohne mir etwas davon zu sagen, und du wußtest also darum, liebe Mutter, daß er fortgehen wollte, ohne mir Adieu zu sagen?«
»Ich habe nach dem Willen deines Vaters gehandelt,« lautete die Antwort der Mutter.
Und sie sagte ihm dann alles, was sie nur ersinnen konnte, um ihn zu trösten. Er aber wollte auf nichts hören, und erst als er bemerkte, daß auch die Mutter weinte, bat er sie mit zärtlichem Kuß um Verzeihung, daß er ihren Schmerz vergrößert habe und gab ihr das Versprechen, daß er wenigstens bei ihr bleiben wolle, um ihr einen Ersatz zu gewähren. Sobald sie ihn aber allein gelassen hatte, um nach dem Geflügel zu sehen, oder die Wäsche zu besorgen, machte er sich fort und lief in der Richtung nach la Priche, ohne nur daran zu denken wohin er ging, ganz sich seinem Instinkt überlassend, wie der Tauber, der seinem Täubchen nacheilt, ohne sich um den Weg zu bekümmern.
Er würde in dieser Weise nach la Priche gekommen sein, wenn er nicht seinem heimkehrenden Vater begegnet wäre. Dieser aber nahm ihn bei der Hand, um ihn wieder mit zurück zu nehmen und sprach zu ihm: »Wir wollen heute Abend zu ihm gehen. Dein Bruder darf bei der Arbeit nicht gestört werden; das würde seinen Herrn verdrießen, und überdies ist bei uns zu Hause die Mutter sehr betrübt, und ich rechne darauf, daß du sie trösten wirst.«
Fünftes Kapitel
Sylvinet kehrte also ins Haus zurück, und hing sich wie ein kleines Kind an den Rock seiner Mutter, die er den ganzen Tag nicht mehr verließ. Er plauderte ihr fortwährend von Landry vor, mit dem seine Gedanken unablässig beschäftigt waren; jeder Ort und jeder Winkel, wo sie gewöhnlich beisammen gewesen waren, erinnerte ihn daran. Als es Abend wurde, ging er mit seinem Vater, der ihn ja begleiten wollte, nach la Priche. Sylvinet war ganz außer sich vor Freude, daß er nun seinen Zwillingsbruder wiedersehen würde. Es drängte ihn so sehr fortzukommen, daß er sich nicht die Zeit nahm zu Abend zu essen. Da er darauf rechnete, daß Landry ihm entgegenkommen würde, glaubte er schon immer von weitem zu erkennen, wie er auf ihn zulaufe. Landry indessen, obgleich er wirklich gute Lust dazu gehabt hätte, rührte sich nicht von der Stelle. Er fürchtete, daß die jungen Leute und die Buben von la Priche ihn wegen dieser Zwillingsliebe ausspotten möchten, die unter dem Volk für eine Art von Krankheit galt. So fand Sylvinet seinen Bruder am Tische sitzend, wo das Abendessen aufgetragen war, und wo er es sich schmecken ließ, als ob er sein Leben lang bei der Familie Caillaud gewesen wäre.
Sobald Landry den Bruder eintreten sah, schlug ihm das Herz vor Freude, und er mußte sich mit Gewalt bezwingen, sonst hätte er Tisch und Bank bei Seite gestoßen, um ihn desto schneller umarmen zu können. Aber er wagte es nicht, weil die Familie seines Herrn ihn neugierig beobachtete. Alle freuten sich darauf in dieser Zwillingsliebe etwas Neues zu sehen, etwas wie ein Naturwunder, wie der Schullehrer des Dorfes sich darüber ausdrückte.
Als Sylvinet nun dem Bruder um den Hals fiel, ihn unter Thränen küßte, sich an ihn schmiegte, wie im Nest sich ein Vogel an den anderen drängt, um sich zu erwärmen, wurde Landry der anderen wegen ärgerlich, wenn ihm an und für sich diese Äußerungen der brüderlichen Liebe auch nur wohlthuend waren. Er wollte verständiger erscheinen als sein Bruder und machte diesem ab und zu ein Zeichen, daß er sich zusammennehmen solle, worüber Sylvinet nicht weniger erstaunt als betrübt war. Während der alte Barbeau sich neben den Vater Caillaud setzte, um zu plaudern und zu trinken, gingen die beiden Zwillinge miteinander hinaus, denn es drängte Landry mit seinem Bruder zärtlich zu sein, ihn zu umarmen und zu küssen, nur wollte er dabei von den anderen nicht gesehen sein. Aber die anderen Burschen hatten die beiden aus der Ferne beobachtet, und sogar die kleine Solange, die jüngste von Vater Caillauds Töchtern, die wie ein echter Nestling schalkhaft und neugierig war, schlich mit leisen Schritten hinter ihnen her bis zu den Haselsträuchern. Wenn sie zufällig von den Zwillingen bemerkt wurde, lächelte sie mit verlegener Miene, aber ohne deshalb ihre Absicht aufzugeben. Sie bildete sich nämlich steif und fest ein, daß sie irgend etwas Seltsames erblicken werde, ohne zu begreifen, was es denn so Merkwürdiges an der innigen Freundschaft zweier Brüder sein könne.
Sylvinet war freilich erstaunt gewesen, daß sein Bruder ihn so kühl empfangen hatte; aber er dachte doch nicht daran, ihm deshalb einen Vorwurf zu machen, so glücklich war er, einmal wieder mit ihm zusammen zu sein. Am folgenden Morgen, – da Landry wußte, daß der Tag ihm gehöre, weil der Vater Caillaud ihn von aller Arbeit befreit hatte, – machte er sich früh auf den Weg nach la Cosse, da er glaubte, er werde seinen Bruder noch im Bett überraschen. Aber trotzdem, daß Sylvinet die Gewohnheit hatte von den beiden am längsten zu schlafen, so erwachte er doch grade, als Landry die Umzäunung des Kampos überschritt. Hastig sprang er aus dem Bett und eilte mit bloßen Füßen hinaus, als ob irgend etwas ihm zugeflüstert hätte, daß sein Zwillingsbruder ihm nahe sei. Für Landry war dies ein Tag vollkommener Freude. Sein Entzücken, das Vaterhaus und seine Familie wieder zu sehen, wurde durch das Bewußtsein erhöht, daß dies nicht mehr alle Tage geschehen könne, daß es gleichsam wie eine Belohnung für ihn sei. Sylvinet vergaß alle seine Schmerzen wenigstens während der einen Hälfte des Tages. Beim Frühstück sagte er sich vor, daß er mit seinem Bruder zu Mittag essen werde, als aber der Abend nahte, dachte er daran, daß dies nun für eine Zeit lang die letzte gemeinsame Mahlzeit wäre, und darüber begann er unruhig und betrübt zu werden. Er sorgte mit zärtlicher Aufmerksamkeit für seinen Zwillingsbruder, gab ihm das beste von seinem eigenen Essen, die Kruste von seinem Brote und die zarten Mittelstückchen von seinem Salat. Auch die Kleider seines Bruders und dessen Schuhe waren ein Gegenstand seiner Fürsorge, als ob dieser einen weiten Weg zu gehen habe, und als ob derselbe überhaupt sehr zu beklagen sei. Es kam ihm gar nicht in den Sinn, daß er selbst der Beklagenswerteste von ihnen sei, weil er der am meisten Betrübte war.
Sechstes Kapitel
So verging die ganze Woche. Sylvinet ging täglich hinaus, um seinen Bruder zu besuchen, und wenn er dann vom Zwillingshofe herübergekommen war, blieb dieser für ein paar Augenblicke bei ihm stehen. Landry fügte sich immer besser in seine Lage; Sylvinet aber wußte sich in die seinige gar nicht zu finden, und wie eine im Fegefeuer auf Erlösung harrende Seele begann er die Tage und Stunden der Trennung zu zählen.
Auf der ganzen Welt gab es niemanden als Landry, der ihn hätte zur Vernunft bringen können. Auch die Mutter wandte sich an diesen, daß er ihr helfen möchte, den Bruder zu beruhigen, denn mit der Betrübnis des armen Knaben wurde es von Tag zu Tag schlimmer. Er mochte sich an keinem Spiele mehr beteiligen, und arbeitete nur noch, wenn es ihm gradezu befohlen wurde. Seine kleine Schwester führte er wohl noch spazieren, aber fast ohne ein Wort dabei zu reden, oder ihr auf irgend eine andere Art die Zeit zu vertreiben; er gab nur darauf acht, daß sie nicht fallen oder auf eine andere Art zu Schaden kommen könne. Sobald man ihn nicht immer im Auge behielt, machte er sich davon und wußte sich so gut zu verbergen, daß man gar nicht wußte, wo man ihn suchen sollte. Alle Gräben, alle Furchen, alle Schluchten, wo er gewohnt gewesen war mit Landry zu spielen und zu plaudern, suchte er wieder auf. Er setzte sich auf die Baumwurzeln, auf denen sie miteinander gesessen hatten, und netzte sich die Füße in allen kleinen Bächen, in denen sie wie ein paar junge Enten miteinander herumgepascht waren; er freute sich, wenn er nur ein Stück Holz wieder auffand, welches Landry mit seinem Gartenmesser zugeschnitten hatte; oder irgend einen Kieselstein, den dieser als Schleuder oder zum Feuerschlagen benutzt hatte. Er sammelte sie alle, diese Kleinigkeiten und versteckte sie in einem hohlen Baume oder unter einer Holzschicht; von Zeit zu Zeit holte er sie dann wieder hervor, um sich an ihrem Anblick zu erlaben, als ob sie Gegenstände von großer Wichtigkeit gewesen wären. In Gedanken ging er alles wieder durch und zerbrach sich den Kopf, auch nur die geringsten Nebenumstände des vergangenen Glückes in seiner Erinnerung wieder heraufzubeschwören. Was für jeden anderen gar keinen Wert gehabt hätte, galt ihm noch über alles. Wie es in der Zukunft werden sollte, das kümmerte ihn gar nicht, denn er hatte nicht einmal den Mut an eine Reihenfolge solcher Tage zu denken, wie sie ihm jetzt auferlegt waren. Er lebte mit seinen Gedanken nur in der Vergangenheit und verzehrte sich in den endlosen Träumereien seiner Sehnsucht.
Es gab Zeiten, wo er sich einbildete seinen Zwillingsbruder leibhaftig vor sich zu sehen und zu hören. Dann plauderte er ganz allein vor sich hin, in der Meinung diesem zu antworten. Manchmal überraschte ihn auch der Schlaf, wo er sich gerade befand, und er träumte von ihm; wenn er dann aber erwachte und sich wieder allein fand, begann er bitterlich zu weinen, und er ließ seinen Thränen um so freieren Lauf, weil er hoffte durch die Ermüdung seinen Schmerz endlich gelindert zu fühlen.
Eines Tages, da er auf seinen Streifereien bis zu der Stelle gelangt war, wo das Schlagholz von Champeaux steht, fand er auf dem Bach, der zur Regenzeit aus dem Gehölz herausfließt, jetzt aber ganz ausgetrocknet war, eine jener kleinen Mühlen wieder auf, wie die Kinder sie in unserer Gegend so geschickt aus Hobelspänen zu machen verstehen, daß sie sich bei der Strömung drehen und sich manchmal lange auf der Oberfläche des Wassers erhalten, bis andere Kinder sie zerbrechen, oder der höhere Wasserstand sie mit fortreißt. Diese, welche Sylvinet wieder aufgefunden hatte, lag hier schon seit mehr als zwei Monaten, und da es eine einsame Stelle war, hatte niemand sie gesehen, noch etwas daran verderben können. Sylvinet erkannte sie sogleich als das Werk seines Zwillingsbruders; beim Anfertigen derselben hatten sie sich vorgenommen wieder hierher zu kommen, um darnach zu sehen. Sie hatten aber nicht weiter daran gedacht, und seitdem an anderen Orten viele andere Mühlen gemacht.
Sylvinet war also sehr erfreut sie wieder zu finden, und trug sie etwas weiter hinauf, wohin das Wasser des Baches sich zurückgezogen hatte. Dort wollte er sehen, wie sie sich drehte und dabei an das Vergnügen denken, welches Landry gehabt hatte, als er ihr den ersten Anstoß gab. Dann ließ er sie an der Stelle, wohin er sie getragen und freute sich schon darauf, wenn er am nächsten Sonntag mit Landry wiederkommen würde, um ihm zu zeigen, wie ihre so fest und gut gefügte Mühle sich erhalten habe.
Aber er konnte es sich nicht versagen, schon am folgenden Tage allein dahin zurückzukehren. Das Wasser des Baches war ganz getrübt, und die Ufer desselben zerstampft durch die Füße der Ochsen, welche dort zur Tränke geführt waren, und die man am Morgen zwischen das Schlagholz auf die Weide getrieben hatte. Er trat etwas näher hinzu und sah, daß die Tiere auf seine Mühle getreten und sie so zerstampft hatten, daß nur noch wenig davon zu sehen war. Das Herz wurde ihm schwer darüber, und er bildete sich ein, daß an diesem Tage seinem Bruder irgend ein Unglück zustoßen müsse, und er lief bis nach la Priche, um sich zu überzeugen, daß ihm nichts Schlimmes widerfahren sei. Hier aber begnügte er sich damit, seinen Bruder von weitem zu betrachten, und zwar so, daß er selbst nicht gesehen werden konnte. Er hatte nämlich bemerkt, das es Landry nicht angenehm war, wenn er unter tags kam, weil dieser fürchtete, daß solch eine Störung bei der Arbeit seinen Herrn verdrießen könne. Da er sich geschämt haben würde zu gestehen, von welchen Gedanken gedrängt er herbei geeilt war, kehrte er ohne ein Wort zu verlieren, wieder um; er sprach Überhaupt mit niemanden darüber; erst sehr lange Zeit nachher that er dies.
Da seine Gesichtsfarbe blaß wurde, weil er wenig schlief und so zu sagen fast gar nichts aß, wurde seine Mutter sehr betrübt, und sie wußte nicht mehr, was sie thun sollte, um ihn zu trösten. Sie versuchte es, ihn mit sich zu nehmen, wenn sie in den Marktflecken ging, oder sie redete ihm zu, seinen Vater oder seinen Onkel zu begleiten, wenn diese zu den Viehmärkten gingen. Aber er nahm an nichts einen Anteil, und nichts konnte ihn mehr erfreuen. Ohne ihn etwas merken zu lassen, machte sich deshalb Vater Barbeau auf den Weg und versuchte es, den Vater Caillaud zu bereden die Zwillinge beide in seinen Dienst zu nehmen. Dieser aber gab ihm eine Antwort, die er selbst als begründet anerkennen mußte.
»Vorausgesetzt,« so ungefähr sprach der alte Caillaud, »ich würde sie eine Zeitlang alle beide in meinen Dienst nehmen, so könnte dies doch nicht von Dauer sein, denn wo man mit einem Diener genug hat, würde es für Leute unseres Schlages nicht gut thun, deren zwei in den Dienst zu nehmen. Wenn das Jahr herum wäre, würdet ihr immerhin wieder genötigt sein, für den einen eurer Zwillinge irgend einen anderen Dienst zu suchen. Und seht ihr denn nicht ein, daß Sylvinet nicht mehr so viel träumen würde, wenn er in einem Dienst wäre, wo er zur Arbeit gezwungen wäre? Dann würde er es machen wie der andere, der sich tapfer in sein Schicksal gefunden hat. Früher oder später muß es doch so kommen. Ihr werdet ihn vielleicht nicht grade an den Ort hin verdingen können, wie ihr wohl möchtet, und wenn diese beiden Buben noch weiter voneinander entfernt werden, so daß sie sich nur noch jede Woche, oder jeden Monat einmal sehen können, so ist es immer besser sie schon beizeiten daran zu gewöhnen, daß sie nicht immer zusammenhocken können. Seid also vernünftig, lieber Nachbar, und macht nicht so viele Umstände mit den Einbildungen eines Kindes, das von eurer Frau und von euren anderen Kindern etwas zu viel verhätschelt und verzogen wurde. Das Schlimmste ist überwunden, und glaubt nur, daß er sich in das Übrige schon finden wird, sobald ihr nur nicht nachgebt.«
Vater Barbeau ließ sich belehren, und er sah ein, das Sylvinets Sehnsucht nach seinem Zwillingsbruder nur immer mehr zunehmen werde, je häufiger er ihn sehen würde. Er nahm sich deshalb vor am nächsten Johannistag für Sylvinet einen Dienst zu suchen. Er hoffte, daß dieser, wenn er Landry immer weniger sehen würde, sich schließlich daran gewöhnen werde, wie alle anderen zu leben, und sich nicht mehr von einem Gefühl bewältigen zu lassen, das in ein krankhaftes Verlangen zu entarten drohte.
Aber vor der Mutter Barbeau durfte noch nicht von diesem Plane geredet werden, denn schon bei der ersten Andeutung davon, weinte sie sich halbtot. Sie meinte, Sylvinet könne daran zu Grunde gehen, und der Vater Barbeau wußte sich wirklich nicht mehr zu helfen.