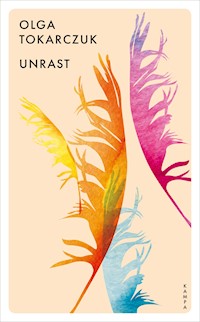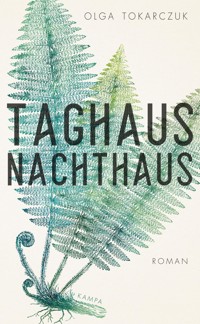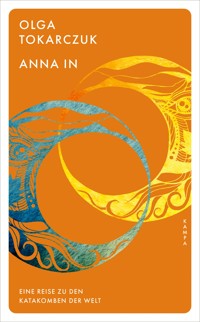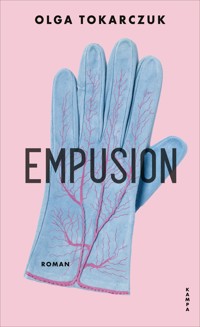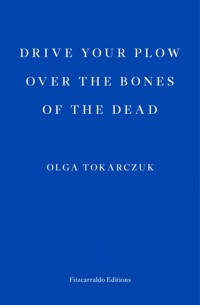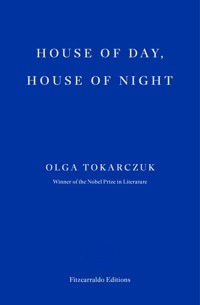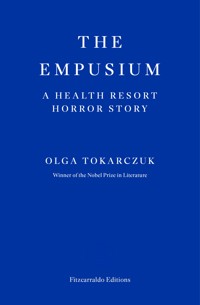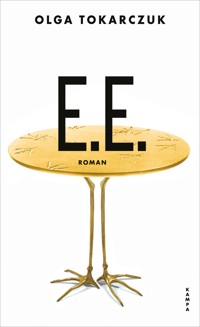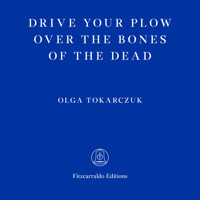Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kampa Pocket
- Sprache: Deutsch
Im Sommer tummeln sich wohlhabende Städter auf dem Hochplateau an der polnisch-tschechischen Grenze. Im Winter fliehen die allermeisten Einwohner den windumtosten Ort. An den langen dunklen Tagen widmet sich Janina Duszejko der Astrologie und der Lyrik des von ihr verehrten William Blake. Man hält die ältere Dame für verschroben, wenn nicht gar für verrückt, auch weil sie die Gesellschaft von Tieren der von Menschen vorzieht. Dann gibt es einen Toten. Janinas Nachbar Bigfoot ist grausam erstickt: In seiner Kehle steckt der Knochen eines Rehs. Und es bleibt nicht bei einer Leiche. Janina ermittelt auf eigene Faust. Kriminalfall, philosophischer Essay, Fabel, literarisches Spiel - auf ebenso komische wie ergreifende Weise zeigen Olga Tokarczuk und ihre hinreißende Heldin, wie sehr es unserer Gesellschaft an Respekt mangelt, ob der Natur und den Tieren oder jenen Menschen gegenüber, die am Rande stehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Olga Tokarczuk
Gesang der Fledermäuse
Roman
Aus dem Polnischen von Doreen Daume
Kampa
Für Zbyszek und Agata
1Und jetzt aufgepasst!
»Einst, fromm und auf gefährlichem Pfad,
Hielt der Gerechte fest an seinem Weg
Durch das Tal des Todes.«
Mein Alter und auch mein Zustand erfordern es mittlerweile, dass ich mir vor dem Zubettgehen ordentlich die Füße wasche, für den Fall, dass ich in der Nacht von einem Krankenwagen abgeholt werden muss.
Wenn ich an jenem Abend in den Ephemeriden nachgesehen hätte, was am Himmel passiert, dann hätte ich mich überhaupt nicht schlafen gelegt. Doch so hatte ich noch mit einem Tässchen Hopfentee und zwei Baldrian-Dragees nachgeholfen und war fest eingeschlafen. Deshalb konnte ich auch zunächst nicht richtig zu mir kommen, als mich mitten in der Nacht ein rücksichtsloses, heftiges und unheilverkündendes Hämmern an meiner Tür weckte. Ich rappelte mich auf und stand schwankend neben dem Bett – mein verschlafener, zitternder Körper schaffte den Sprung vom unschuldigen Schlaf ins plötzliche Wachsein nicht auf Anhieb. Schwäche überkam mich, und ich taumelte, wie kurz vor einer Ohnmacht. Das war in letzter Zeit häufiger vorgekommen, es hat mit meinem Leiden zu tun. Ich musste mich setzen und mir einige Male sagen: Ich bin zu Hause, und es ist Nacht, jemand hämmert an meine Tür. Erst dann bekam ich meine Nerven wieder in den Griff. Während ich im Dunkeln meine Pantoffeln suchte, hörte ich, wie derjenige, der gehämmert hatte, jetzt vor sich hinmurmelnd ums Haus ging. Unten, im Elektrozählerkasten habe ich eine Dose Pfefferspray, das ich einmal von Dionizy wegen der Wilderer bekommen habe, es fiel mir jetzt wieder ein. Ich tastete nach der vertrauten, kühlen Form der Spraydose, und so bewaffnet knipste ich das Außenlicht an. Durch das Seitenfenster sah ich auf die Veranda. Der Schnee knirschte, und vor mir tauchte mein Nachbar Matoga auf. Um seine Hüften hielt er einen alten Pelz zusammen, worin ich ihn schon einige Male gesehen hatte, wenn er beim Haus arbeitete. Unter diesem Pelz schauten seine Beine hervor, sie steckten in einem gestreiften Pyjama und Bergschuhen.
»Mach auf!«, sagte er.
Mit unverhohlener Verwunderung musterte er meinen leinenen Sommeranzug (ich schlafe meistens in den Sachen, die Herr und Frau Professor im Sommer wegwerfen wollen und die mich an die Mode und die Jahre meiner Jugend erinnern – so verbinde ich das Nützliche mit dem Sentimentalen), und ohne sich zu entschuldigen trat er ein.
»Zieh dich bitte an, Bigfoot ist tot.«
Vor Schreck konnte ich nichts sagen, wortlos zog ich die hohen Schneestiefel an, nahm die erstbeste Fleecejacke vom Bügel und warf sie mir über. Draußen, im Lichtflecken der Flurlampe verwandelte sich das Schneien in ein langsames verschlafenes Tröpfeln. Matoga stand schweigend neben mir, groß und schlank, knochig wie eine flüchtig skizzierte Bleistiftfigur. Bei jeder Bewegung rieselte Schnee von ihm herab wie Puderzucker von den Fastnachtskrapfen.
»Was heißt ist tot?«, fragte ich endlich, während ich mit zugeschnürter Kehle die Tür öffnete, doch Matoga gab keine Antwort.
Er spricht auch sonst nicht viel. Ich glaube, sein Merkur steht in einem Zeichen des Schweigens, vielleicht im Steinbock, oder in der Konjunktion, im Quadrat, oder vielleicht in Opposition zum Saturn. Vielleicht war der Merkur auch gerade rückläufig unterwegs gewesen, das hat immer Verschlossenheit zur Folge.
Wir verließen das Haus, und sofort umfing uns die wohlbekannte kalte und feuchte Luft, die uns jeden Winter wieder daran erinnert, dass die Welt nicht für den Menschen geschaffen ist und uns jetzt mindestens ein halbes Jahr lang zeigen wird, wie unfreundlich sie uns gesonnen ist. Der Frost schlug brutal an unsere Wangen, und aus dem Mund stiegen uns weiße Dampfwölkchen. Das Licht im Flur erlosch automatisch, und wir stapften in völliger Dunkelheit durch den knirschenden Schnee. Nur Matogas Stirnlampe durchlöcherte mit einem vorwärts hüpfenden Fleck die Dunkelheit vor ihm. Ich tappte hinter ihm her.
»Hast du keine Taschenlampe?«, fragte er.
Natürlich hatte ich eine, aber wo? Das würde ich erst am nächsten Morgen sagen können. So ist es mit Taschenlampen: Am besten man sucht sie, wenn es hell ist.
Das Haus von Bigfoot stand etwas abseits, höher als die anderen Häuser in der Umgebung. Er war einer der drei ganzjährigen Bewohner. Nur er, Matoga und ich wohnten immer hier, wir fürchteten den Winter nicht. Die übrigen Bewohner dichteten ihre Türen schon im Oktober ab, ließen das Wasser aus den Leitungen und zogen in die Stadt.
Wir gingen auf dem verschneiten Weg, der durch unsere Siedlung führte und von dem aus einzelne Pfade zu den Häusern hin abbogen. Zu Bigfoot führte nur ein Trampelpfad im tiefen Schnee, er war so schmal, dass man die Füße einen hinter den anderen setzen und immer auf das Gleichgewicht achten musste.
»Es wird kein schöner Anblick.« Matoga wandte sich zu mir um, und seine Lampe blendete mich.
Ich hatte nichts anderes erwartet. Nach kurzem Schweigen sagte er, wie um sich zu entschuldigen: »Das Licht in seiner Küche war irgendwie unheimlich. Und seine Hündin hat so verzweifelt gebellt. Hast du nichts gehört?«
Nein, ich hatte nichts gehört. Ich hatte geschlafen, betäubt vom Hopfen und vom Baldrian.
»Wo ist sie jetzt, die Hündin?«
»Ich habe sie zu mir mitgenommen und habe sie gefüttert. Sie hat sich, glaube ich, inzwischen beruhigt.«
Wieder schwiegen wir.
»Er ist immer früh schlafen gegangen und hat das Licht ausgemacht, um zu sparen, aber diesmal hat das Licht gebrannt und gebrannt. Ein heller Streifen im Schnee. Den konnte ich von meinem Schlafzimmerfenster aus sehen. Also bin ich hingegangen, ich dachte, er ist vielleicht betrunken, oder vielleicht hat er dem Hund was getan, dass der so winselt.«
Wir gingen an einer verfallenen Scheune vorbei, und das Licht von Matogas Stirnlampe fiel auf zwei grünliche, im Dunkeln fluoreszierende Augenpaare.
»Schau, Rehe«, flüsterte ich aufgeregt und packte Matoga am Ärmel. »So nah am Haus. Die müssten doch Angst kriegen.«
Die Rehe standen fast bis zum Bauch im Schnee. Sie sahen uns ruhig an, als hätten wir sie bei der Ausübung eines Rituals angetroffen, dessen Sinn sich uns nicht erschließen konnte. In der Dunkelheit konnte ich nicht erkennen, ob es die Weibchen waren, die im Herbst aus Tschechien herübergekommen waren. Vielleicht waren sie neu dazugekommen? Und warum nur zwei? Die aus Tschechien waren zu viert gewesen.
»Geht heim«, sagte ich und machte eine Handbewegung. Sie zuckten zusammen, bewegten sich aber nicht von der Stelle. Mit ihren Blicken begleiteten sie uns bis zur Tür. Ich schauderte.
Matoga stampfte mit den Füßen, um den Schnee von den Schuhen abzuklopfen. Wir standen vor der Tür des verwahrlosten Hauses, dessen kleine Fenster mit Folie und Papier abgedichtet waren. Die Holztüren waren mit schwarzer Teerpappe beschlagen.
Vor den Wänden des Flurs lag unordentlich geschichtetes Brennholz. Es war ungemütlich hier, man konnte es kaum anders bezeichnen. Schmutzig und heruntergekommen. Überall roch es nach Feuchtigkeit, nach nassem Holz und gefräßiger Erde. Der Rauchgestank vieler Jahre klebte wie eine fettige Schicht an den Wänden.
Die Küchentür war angelehnt, und ich sah sofort den auf der Erde liegenden Körper von Bigfoot. Mein Blick prallte zurück. Es dauerte einen Moment, bis ich wieder hinsehen konnte. Der Anblick war grauenhaft.
Er lag seltsam verdreht da, mit den Händen am Hals, als wolle er einen drückenden Kragen wegreißen. Langsam, wie hypnotisiert, ging ich näher. Ich sah seine offenen Augen, die irgendwohin unter den Tisch starrten. Das schmutzige Unterhemd war um den Hals herum ausgerissen. Es sah aus, als hätte der Körper mit sich selbst gerungen und sich schließlich geschlagen gegeben. Mir wurde kalt vor Entsetzen, mein Blut stockte in den Adern, oder es war gänzlich aus meinen Extremitäten gewichen. Noch gestern hatte ich diesen Körper lebendig gesehen.
»Mein Gott«, stammelte ich. »Was ist da passiert?«
Matoga zuckte die Achseln.
»Ich konnte telefonisch nicht zur Polizei durchkommen, wir sind wieder im tschechischen Netz.«
Ich zog mein Handy aus der Tasche und tippte die Nummer, die ich aus dem Fernsehen kannte – 997, und nach einer Weile meldete sich ein tschechischer Anrufbeantworter. So ist das hier. Die Reichweite verlagert sich ständig, sie hält sich nicht an Staatsgrenzen. Manchmal verläuft die Grenze zwischen den Anbietern durch meine Küche, sie kann aber auch plötzlich vor Matogas Haus stehen oder auf der Veranda, man kann ihre Launen kaum vorhersehen.
»Wir müssen höher hinauf, auf den Berg.« Doch wir wussten beide, wir durften keine Zeit verlieren.
»Bevor irgendwer kommt, wird er schon steif sein.« Matoga hatte einen Ton angeschlagen, den ich gerade bei ihm nicht ausstehen konnte. Als hätte er die Weisheit mit Löffeln gefressen. Er zog seinen Pelz aus und hängte ihn über eine Stuhllehne. »Wir können ihn hier nicht so liegen lassen. Es sieht furchtbar aus. Schließlich war er unser Nachbar.«
Ich betrachtete den armen, verkrümmten Körper von Bigfoot, und ich konnte kaum glauben, dass ich mich noch gestern vor diesem Menschen gefürchtet hatte. Ich hatte ihn nie gemocht. Nein, das war zu wenig gesagt. Vielmehr hatte ich ihn abstoßend gefunden, widerlich. Eigentlich hatte ich ihm alle menschlichen Eigenschaften abgesprochen. Jetzt lag er da auf dem fleckigen Fußboden, in schmutziger Wäsche, klein und mager, kraftlos und harmlos. Er war ein Stück Materie, die sich infolge schwer vorstellbarer Einwirkungen in ein von allem abgeschnittenes, vergängliches Wesen verwandelt hatte. Das berührte mich schmerzhaft, denn auch ein abscheulicher Mensch wie dieser verdiente den Tod nicht. Doch wer verdiente ihn schon? Auch mich wird dieses Schicksal einmal treffen, ebenso wie Matoga und die beiden Rehe da draußen. Irgendwann einmal werden wir alle nichts anderes sein als totes Fleisch.
Ich sah Matoga trostsuchend an, doch er war schon dabei, das zerwühlte Schlaflager auf der desolaten Couch herzurichten, und so versuchte ich mich gedanklich selbst zu trösten. Es könnte sein, dass der Tod von Bigfoot in gewissem Sinne sein Gutes hatte. Sein Tod hatte ihn von dem Chaos befreit, aus dem sein Leben bestanden hatte. Und er hatte andere Lebewesen von ihm befreit. Ja, plötzlich wurde mir die Güte und Gerechtigkeit des Todes klar. Er ist wie ein Desinfektionsmittel, wie ein Staubsauger. Ich gestehe, dass ich wirklich so etwas dachte und eigentlich noch immer denke.
Bigfoot war mein Nachbar gewesen. Zwischen unseren Häusern lag kaum ein halber Kilometer, aber ich hatte selten etwas mit ihm zu tun gehabt. Zum Glück. Ich sah ihn meistens von Weitem – seine winzige, sehnige Gestalt, die sich, immer etwas schwankend, vor dem Hintergrund der Landschaft vorwärtsbewegte. Beim Gehen brabbelte er vor sich hin, und manchmal hinterbrachte mir die winddurchwehte Akustik des Hochplateaus Fetzen dieses simplen, wenig abwechslungsreichen Monologs. Sein Wortschatz bestand vorwiegend aus Flüchen, an die er lediglich Eigennamen hängte.
Er kannte im Wald jedes Stückchen Erde, offenbar war er hier geboren worden und nie weiter als bis nach Glatz gekommen. Er wusste, womit man hier gut verdiente, was man wem verkaufen könnte. Pilze, Beeren, gestohlenes Holz, Unterzündholz, Drahtschlingen, die jährliche Rallye mit Geländewagen, die Jagd. Der Wald ernährte diesen Gnom. Er hätte also den Wald respektieren sollen, doch das tat er nicht. Einmal, in einem August, als die Landschaft von der Sonne ausgedorrt war, hatte er ein ganzes Blaubeergebiet angezündet. Ich hatte die Feuerwehr gerufen, aber es konnte nicht viel gerettet werden. Was ihn dazu bewogen hatte, habe ich nie erfahren. Im Sommer wanderte er immer mit einer Säge durch die Gegend und legte Bäume um, die in vollem Saft standen. Einmal hatte ich ihn höflich darauf aufmerksam gemacht, mit mühsam zurückgehaltenem Zorn, und er zischte mir darauf nur so etwas wie »hau ab, Alte« entgegen, allerdings etwas drastischer ausgedrückt. Bigfoot verdiente dazu, indem er hier und da etwas klaute, ein Ding drehte oder irgendetwas organisierte. Wenn die Sommergäste draußen eine Laterne oder eine Heckenschere liegen ließen – Bigfoot packte sofort die Gelegenheit beim Schopf und sackte sie ein, denn solche Dinge konnte er später in der Stadt zu Geld machen. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte er schon oft bestraft werden oder sogar ins Gefängnis wandern müssen. Ich weiß nicht, wie es kam, dass er immer irgendwie davonkam. Vielleicht beschützte ihn irgendein Engel. Es soll ja vorkommen, dass die auf der falschen Seite stehen.
Ich wusste auch, dass er auf alle möglichen Arten wilderte. Den Wald behandelte er wie sein Eigentum – alles darin gehörte ihm, und er plünderte ihn nach Bedarf.
Viele Nächte hatte ich seinetwegen nicht geschlafen. Doch ich war machtlos. Einige Male hatte ich die Polizei angerufen. Wenn dort überhaupt jemand abhob, nahm er meine Beschwerde zwar höflich entgegen, doch dann passierte nichts. Bigfoot drehte weiterhin seine Runden, mit einem Bündel Drahtschlingen über der Schulter, lautstark Verwünschungen ausstoßend. Eine kleine, boshafte Gottheit. Böswillig und unberechenbar. Ständig war er leicht betrunken, und wahrscheinlich war er deswegen immer so schlecht gelaunt. Er schimpfte vor sich hin und hieb mit einem Stock auf die Baumstümpfe ein, als wolle er sie von seinem Weg vertreiben. Vielleicht war er schon leicht benebelt auf die Welt gekommen. Oft folgte ich ihm auf seinen Pfaden und sammelte die primitiven Drahtfallen wieder ein, die er auslegte. Es waren Drahtschlingen, die an jungen hinuntergebogenen Bäumen fixiert waren, sodass das Tier, wenn es hineingeriet, mit dem Hochschnellen des Baumes in die Luft geschleudert wurde und dort baumelte. Manchmal fand ich derart getötete Tiere – Hasen, Dachse und Rehe.
»Wir müssen ihn auf die Liege betten«, sagte Matoga. Dieser Gedanke gefiel mir nicht. Es gefiel mir nicht, ihn anfassen zu müssen.
»Ich glaube, wir müssen auf die Polizei warten«, erwiderte ich. Aber Matoga hatte den Platz auf der Couch schon vorbereitet und krempelte die Ärmel hoch. Er blickte mich aus seinen hellen Augen durchdringend an.
»Du würdest auch nicht wollen, dass man dich so findet. In einem solchen Zustand. Das ist unmenschlich.«
Ja, tatsächlich, ein menschlicher Körper ist unmenschlich. Besonders ein toter.
Ist es denn kein finsteres Paradoxon, dass wir uns jetzt mit dem Körper von Bigfoot abgeben müssen, dass er uns seinen Körper als letzte Sorge überlassen hatte? Ausgerechnet uns, den Nachbarn, die er nicht respektiert, nicht gemocht hatte, die ihm ganz egal gewesen waren?
Wenn es nach mir ginge, dann käme es nach dem Tod zur Annihilation der Materie. Das wäre die passendste Art, mit ihr umzugehen. Die annihilierten Leichen würden auf diese Weise direkt in die schwarzen Löcher zurückkehren, aus denen sie gekommen wären. Und die Seelen würden mit Lichtgeschwindigkeit zum Licht sausen. Wenn es so etwas wie eine Seele überhaupt gibt.
Ich überwand meinen ungeheuren Widerstand und tat, was Matoga von mir verlangte. Wir packten den Leichnam an Händen und Füßen und zogen ihn auf die Couch. Überrascht stellte ich fest, wie schwer er war. Er war überhaupt nicht kraftlos, sondern eher bockig, steif und sperrig wie gestärkte, eben aus der Mangel gezogene Bettwäsche. Ich sah die Socken, oder eher das, was anstelle von Socken an seinen Füßen war – schmutziggraue, fleckige Fußlappen aus in Streifen gerissenen Bettlaken. Ich weiß nicht, warum der Anblick dieser Fußlappen mich wie ein Schlag traf, auf die Brust, auf mein Zwerchfell, auf meinen ganzen Körper, sodass ich unwillkürlich aufschluchzte. Matoga sah mich kühl und flüchtig an, in seinem Blick lag eine deutliche Rüge.
»Wir müssen ihn anziehen, bevor sie kommen«, sagte er, und ich sah, wie auch sein Kinn beim Anblick dieses menschlichen Elends zitterte, auch wenn er das aus welchen Gründen auch immer nie zugegeben hätte.
Also versuchten wir zunächst, ihm das schmutzige, stinkende Unterhemd auszuziehen, doch es war ein Ding der Unmöglichkeit, es ihm über den Kopf zu ziehen. Matoga holte aus seiner Tasche ein kompliziertes Taschenmesser und schnitt den Stoff über der Brust auf. Bigfoot lag jetzt halbnackt vor uns auf der Couch, haarig wie ein Troll, die Brust und die Hände vernarbt, mit unleserlichen Tätowierungen, in denen ich nichts Sinnvolles erkennen konnte. Seine Augen waren ironisch zusammengekniffen, während wir in seinem desolaten Schrank etwas Anständiges zum Anziehen für ihn suchten, bevor sein Körper für immer erstarren und wieder zu dem werden würde, was er seinem Wesen nach immer gewesen war: ein Klümpchen Materie. Seine zerrissene Unterhose guckte unter der fast neuen, silbrigen Trainingshose hervor.
Vorsichtig nahm ich ihm die ekelhaften Fußlappen ab und sah mit Staunen seine Füße. Ich war immer der Meinung, dass die Füße unsere intimsten und persönlichsten Körperteile sind, ganz und gar nicht die Genitalien, auch nicht das Herz oder gar das Gehirn. Das sind nur Organe, ohne Bedeutung. Auch wenn diese Bedeutung immer überschätzt wird. Doch es sind die Füße, in denen das ganze Wissen zum Thema Mensch liegt. Der wichtigste Sinn dessen, was uns wirklich ausmacht, fließt aus dem Körper in die Füße. Wie wir uns der Erde gegenüber verhalten. In der Berührung mit der Erde, dort wo die Erde auf den Körper trifft, steckt das ganze Geheimnis: dass wir aus den Grundelementen der Materie gebaut und gleichzeitig dieser Erde fremd sind, losgelöst von ihr. Die Füße – das sind unsere Kontaktstecker. Und jetzt waren diese nackten Füße für mich der Beweis, dass Bigfoot woandersher stammen musste. Er konnte kein Mensch sein. Es musste sich um eine namenlose Form handeln, eine von denen, die – wie unser Blake sagt – Metalle in der Unendlichkeit auflöst, ihre Ordnung in Chaos verwandelt. Vielleicht war er so etwas wie ein Dämon. Dämonische Wesen kann man immer an den Füßen erkennen, sie haben eine andere Art, wie sie der Erde ihren Stempel aufdrücken.
Diese Füße, lang und schmal, mit ihren schlanken Zehen, mit ihren schwarz umrandeten, eingewachsenen Nägeln, schienen Greiforgane zu sein. Die große Zehe stand etwas von den anderen ab, wie ein Daumen. Sie waren dicht und schwarz behaart. Hat irgendwer so etwas schon gesehen? Matoga und ich wechselten einen Blick.
Im fast leeren Schrank fanden wir einen kaffeebraunen Anzug, er hatte ein paar Flecken, schien aber sonst kaum getragen. Ich hatte Bigfoot nie darin gesehen. Er lief immer in Filzstiefeln und verschlissenen Hosen herum, dazu ein kariertes Hemd und eine Steppweste, egal zu welcher Jahreszeit.
Das Ankleiden des Verstorbenen erinnerte mich an Liebkosungen. Ich glaube nicht, dass Bigfoot zu Lebzeiten je irgendwelche Zärtlichkeiten erfahren hatte. Wir hoben ihn vorsichtig an den Schultern hoch, um ihn anzuziehen. Sein Gewicht drückte auf meine Brust, und eine Welle natürlichen Ekels überlief mich. Mir wurde übel. Doch dann kam es mir plötzlich in den Sinn, diesen Körper an meinen zu drücken, ihm auf den Rücken zu klopfen und etwas Beruhigendes zu sagen: Mach dir nichts draus, wird schon wieder. Ich tat es nicht, mit Rücksicht auf Matoga. Es wäre ihm wahrscheinlich irgendwie pervers vorgekommen.
Die nicht ausgeführte Geste verwandelte sich in einen Gedanken. Bigfoot tat mir leid. Vielleicht hatte ihn seine Mutter ausgesetzt, und er war sein ganzes trauriges Leben lang unglücklich gewesen. Langjähriges Unglücklichsein zerstört einen Menschen mehr als eine tödliche Krankheit. Ich hatte bei ihm nie Gäste gesehen, weder Familienmitglieder noch Freunde kamen zu ihm. Nicht einmal die Pilzsammler blieben bei seinem Haus stehen, um ein wenig zu plaudern. Die Leute hatten Angst vor ihm, keiner mochte ihn. Offenbar unterhielt er nur mit den Jägern ein wenig Kontakt, wenn auch selten. Ich glaube, er war um die fünfzig, ich hätte viel gegeben, um sein achtes Haus zu sehen, ob es da bei ihm nicht zufällig irgendwelche miteinander vermischten Aspekte von Neptun und Pluto und Mars im Aszendenten gab. Mit der Kettensäge in seinen Händen hatte er immer an ein Raubtier erinnert, das nur lebt, um den Tod zu säen und Leiden zuzufügen.
Um ihm die Jacke anzuziehen, hievte ihn Matoga in die Sitzposition, und da sahen wir seine große geschwollene Zunge und dass er noch etwas anderes im Mund hatte. Ich zögerte. Doch dann biss ich die Zähne zusammen und griff, vor Ekel schaudernd, vorsichtig nach der Spitze dieses Etwas, wobei meine Hand immer wieder zurückzuckte. Endlich hielt ich zwischen den Fingern einen kleinen Knochen, lang und dünn, spitz wie ein Stilett. Den leblosen Lippen entfuhr ein kehliges Glucksen und etwas Luft, ein leises Pfeifen, fast wie ein Seufzer. Wir schreckten beide vom Toten zurück, und sicher fühlte Matoga dasselbe wie ich: nacktes Entsetzen. Besonders, als kurz darauf aus seinem Mundwinkel ein wenig dunkelrotes, fast schwarzes Blut quoll. Es war etwas Unheilvolles, das aus ihm heraussickerte.
Wir erstarrten wie im Schock.
»Also das war es.« Matogas Stimme zitterte. »Er ist erstickt. An einem Knochen erstickt. Der Knochen ist ihm im Hals stecken geblieben. Er hat ihn nicht rausgekriegt, und er ist daran erstickt.« Nervös wiederholte er den gleichen Satz ein ums andere Mal. Und dann, als wolle er sich selbst beruhigen: »An die Arbeit. Es ist nicht angenehm, aber die Pflicht gegenüber dem Nächsten ist nun einmal selten angenehm.«
Er hatte sich zum Befehlshaber dieser Nachtschicht ernannt, und ich fügte mich.
Wir konzentrierten uns nun auf die undankbare Aufgabe, Bigfoot in den kaffeebraunen Anzug zu stecken und ihn in eine würdige Position zu lagern. Ich hatte lange keinen fremden Körper berührt, schon gar keinen Toten. Ich spürte, wie die Starre ihn mehr und mehr durchdrang, wie sein Körper von Minute zu Minute versteinerte. Wir beeilten uns. Und als Bigfoot bereits im Sonntagsanzug vor uns lag, verlor sein Gesicht endgültig seinen menschlichen Ausdruck: Nun war er ein Leichnam, daran bestand kein Zweifel mehr. Allein der rechte Zeigefinger wollte nicht gehorchen und in der traditionellen Position brav gefalteter Hände bleiben. Er ragte nach oben, als wolle er damit unsere Aufmerksamkeit erregen, als wolle er unsere nervösen, hastigen Anstrengungen unterbrechen. »Und jetzt aufgepasst!«, sagte der Finger. »Jetzt passt mal auf, denn hier ist etwas, was ihr nicht seht, es ist der wesentliche Ausgangspunkt eines Prozesses, der euch verborgen ist, und er ist höchst bemerkenswert. Ihm ist es zu verdanken, dass wir uns alle an diesem Ort eingefunden haben, zu dieser Zeit, in diesem kleinen Haus auf dem Hochplateau, tief im Schnee, tief in der Nacht. Ich als toter Körper, und ihr, zwei ältliche Menschenwesen, die keinerlei Bedeutung haben. Doch das ist erst der Anfang. Erst jetzt geht alles richtig los.«
Matoga und ich standen in der feuchtkalten Kammer, in dieser frostigen Einöde, in dieser grauen Stunde, und ich dachte, dass dieses Etwas, das aus einem toten Körper ausfährt, ein Stück Welt mit sich fortnimmt. Ganz egal, ob böse oder gut, schuldbeladen oder makellos, was zurückbleibt, ist ein großes Nichts.
Ich blickte durchs Fenster. Der Morgen graute, und langsam füllte sich dieses Nichts mit behäbigen Schneeflocken. Sie fielen gemächlich, sie drehten sich in der Luft um die eigene Achse wie Federn.
Bigfoot war von uns gegangen, also konnte man ihm gegenüber schwerlich Wut oder Groll hegen. Nur sein Körper war geblieben, tot, in einen Anzug gesteckt. Er schien jetzt ruhig und zufrieden zu sein, als freute sich sein Geist über die Befreiung von der Materie und als freute sich die Materie über die Befreiung von seinem Geist. In kurzer Zeit hatte sich eine metaphysische Scheidung vollzogen. Schluss.
Wir setzten uns in die Küche, und Matoga nahm eine halbvolle Wodkaflasche vom Tisch. Er fand zwei saubere Gläser und schenkte ein, erst mir, dann sich selbst. Durch das zugeschneite Fenster sickerte langsam das Morgengrauen, milchig wie Krankenhauslicht, und in diesem Licht sah ich, dass Matoga unrasiert war und seine Bartstoppeln genauso grau waren wie mein Haar, ich sah seinen verwaschenen, blauweiß gestreiften, schlabberigen Pyjama unter seinem Schaffellmantel, und ich sah alle möglichen Flecken auf dem Mantel.
Ich trank ein großes Glas Wodka, und mein Inneres erwärmte sich.
»Ich glaube, wir haben ihm gegenüber unsere Pflicht getan. Wer sonst hätte es tun sollen?« Matoga sprach mehr zu sich selbst als zu mir. »Er war ein armer kleiner Dreckskerl, aber was soll’s?«
Er schenkte sich noch ein Glas ein, kippte es hinunter und schüttelte sich angewidert. Er hatte sichtlich keine Übung darin.
»Ich gehe telefonieren.« Er ging hinaus, vielleicht war ihm schlecht geworden.
Ich stand auf und inspizierte das entsetzliche Durcheinander in der Hoffnung, irgendwo Bigfoots Personalausweis mit seinem Geburtsdatum zu finden. Das wollte ich wissen, ich wollte seine Rechnungen überprüfen.
Auf dem mit verschlissenem Wachstuch bedeckten Tisch stand eine Pfanne mit den gebratenen Stücken eines Tieres, und im Kochtopf daneben schlummerte unter einer weißen Fettschicht eine Rote-Bete-Suppe. Eine abgeschnittene Brotscheibe, Butter in goldener Folie. Auf dem mit abgetretenem Linoleum ausgelegten Boden lagen noch weitere Tierreste, die mit dem Teller auf den Boden gefallen waren, auch Gläser und Kekskrümel. Alles war auf dem schmutzigen Boden zertrampelt und verschmiert.
Plötzlich fiel mein Blick auf etwas, das mein Gehirn erst nach längerem Hinsehen erkannte, weil es sich dagegen wehrte: Auf einem Blechtablett auf der Fensterbank lag ein sorgfältig abgetrennter Rehschädel. Daneben vier Rehbeine. Die halb offenen Augen hatten unser Hantieren die ganze Zeit aufmerksam verfolgt.
Es war eines dieser ausgehungerten Rehe, die sich im Winter naiv in eine Falle mit angefrorenen Äpfeln locken lassen und die dann, von der Schlinge erfasst, qualvoll vom Draht erwürgt werden.
Als mir langsam bewusst wurde, was hier geschehen war, packte mich das Grauen. Er hatte das Reh mit einer Drahtschlinge gefangen, es umgebracht, sein Fleisch zerstückelt, gebraten und gegessen. Ein Lebewesen hatte ein anderes aufgegessen, schweigend, in aller Stille, in der Nacht. Niemand hatte protestiert, kein Blitz war hineingefahren. Doch der Dämon war seiner Strafe nicht entgangen, obwohl keine Menschenhand seinen Tod herbeigeführt hatte.
Rasch, mit zitternden Händen schob ich die Überreste, alle kleineren Knochen, zu einem Haufen zusammen, um sie später zu begraben. Ich stopfte alles in eine alte Plastiktüte, die herumlag, jeden einzelnen der kleinen Knochen packte ich in dieses Leichentuch aus Plastik. Auch den Schädel steckte ich in die Tüte.
Ich wollte den Geburtstag von Bigfoot erfahren, der Wunsch war so dringend, dass ich im Geschirrschrank, unter vielen anderen Papieren, Kalenderblättern und Zeitungen nervös seinen Ausweis suchte und die Schubladen durchwühlte, wo man in Landhäusern die Dokumente aufbewahrte. Dort fand ich ihn auch, in einer kaputten grünen Hülle, sicher war er schon abgelaufen. Auf dem Bild war Bigfoot etwas über zwanzig Jahre alt. Ein längliches, asymmetrisches Gesicht mit irgendwie verkniffenen Augen. Nicht schön, nicht einmal damals. Mit einem Bleistiftstummel notierte ich mir Datum und Ort seiner Geburt. Bigfoot war am 21. Dezember 1950 geboren. Hier.
Ich sollte sagen, dass in der Schublade noch etwas war: ein Stapel Fotos, ziemlich neu, in Farbe. Ich blätterte sie rasch durch, wie immer, und eines machte mich stutzig. Ich sah es genauer an und wollte es schon zurücklegen. Lange konnte ich nicht verstehen, was ich sah. Es war plötzlich ganz still um mich, und in der Stille war nur ich. Ich sah das Foto an. Mein Körper spannte sich, ich war kampfbereit. Mir wurde schwindlig, und in meinen Ohren rauschte es dumpf, ein Summen, ein Dröhnen, als stürmte vom Horizont eine vieltausendköpfige Armee herbei, ich hörte Stimmen, Eisengeklirr, kreischende Räder, alles aus weiter Ferne. Der Zorn macht den Geist klar und scharf, auch die Sicht wird geschärft. Der Zorn nimmt alle anderen Emotionen in sich auf und beherrscht den Körper. Es besteht kein Zweifel, dass alle Weisheit aus dem Zorn entsteht, denn er ist imstande, alle Grenzen zu sprengen.
Meine Hände zitterten, als ich die Fotos in meine Tasche steckte, und gleich darauf hörte ich, wie sich alles weiter vorwärtsbewegte, wie die Motoren der Welt ansprangen und ihre Maschinerie wieder in Gang kam – eine Tür knarrte, eine Gabel fiel zu Boden. Aus meinen Augen tropften Tränen.
Matoga stand in der Tür.
»Er war es nicht wert, dass du weinst.«
Mit zusammengepressten Lippen wählte er eine Nummer.
»Noch immer der tschechische Anbieter. Wir müssen auf den Hügel, kommst du mit?«
Leise schlossen wir die Tür hinter uns und kämpften uns durch den Schnee. Auf dem Hügel drehte sich Matoga mit zwei Mobiltelefonen in den ausgestreckten Händen um die eigene Achse, um Empfang zu bekommen. Vor uns lag der ganze Glatzer Kessel, in silbrigen, fahlgrauen Morgendämmer getaucht.
Matoga rief seinen Sohn an: »Hallo, habe ich dich auch nicht geweckt?« Eine unverständliche Stimme antwortete krächzend.
»Unser Nachbar ist tot. Ich glaube, an einem Knochen erstickt.
Heute Nacht.«
Wieder das Krächzen am anderen Ende der Leitung.
»Noch nicht. Ich rufe gleich an. Ich bin nicht durchgekommen. Wir haben ihn angezogen. Mit Frau Duszejko, du kennst sie, meine Nachbarin.« Er sah mich flüchtig an. »Damit er nicht starr wird, und …«
Die krächzende Stimme klang genervt.
»Immerhin trägt er jetzt einen Anzug …«
Die Stimme sprach jetzt schnell und viel, Matoga hielt das Telefon vom Ohr weg und schaute es missbilligend an.
Dann riefen wir die Polizei.
2Testosteron-Autismus
»Ein Hund, der hungert vor dem Haus,
Sagt den Ruin des Staats voraus.«
Ich war ihm sehr dankbar, dass er mich zu sich auf ein heißes Getränk einlud. Ich fühlte mich total zerschlagen, und der Gedanke, dass ich in mein kaltes, leeres Haus zurückkehren sollte, deprimierte mich.
Bigfoots Hündin, die seit einigen Stunden bei Matoga residierte, sprang mir zur Begrüßung entgegen. Sie erkannte mich und freute sich offenbar, mich zu sehen. Sie wedelte mit dem Schwanz und dachte ganz bestimmt nicht mehr daran, dass sie einmal vor mir davongelaufen war. Hunde sind manchmal ziemlich dumm, ähnlich wie Menschen, und diese Hündin war sicher eine von der dummen Sorte. Wir setzten uns in die Küche an den Holztisch, der so sauber war, dass man seine Wange darauf legen konnte. Das tat ich auch.
»Du bist wohl sehr müde«, meinte Matoga.
Alles hier war sauber und hell, warm und gemütlich. Was für ein Glück ist es im Leben, eine saubere und warme Küche sein Eigen zu nennen. Dies war mir versagt geblieben. Bei mir war es unmöglich, Ordnung zu halten. Aber ich habe mich schon damit abgefunden. Pech.
Bevor ich mich noch umsehen konnte, stand schon ein Glas Tee vor mir. Es war in einem hübschen Metallkörbchen mit Henkel, auf einem Untersetzer. In der Zuckerdose war Würfelzucker – das erinnerte mich an die süße Zeit meiner Kindheit, und es hob tatsächlich meine jammervolle Laune.
»Vielleicht hätten wir ihn wirklich nicht bewegen sollen?« Matoga öffnete die Tischschublade, um Löffelchen herauszuholen. Die Hündin strich um seine Beine, als wolle sie ihn nicht aus dem nächsten Umkreis ihres kleinen, mageren Körperchens herauslassen.
»Du wirfst mich noch um«, sagte Matoga mit schroffer Zärtlichkeit. Er hatte sichtlich noch nie einen Hund gehabt und wusste nicht genau, wie man sich verhält.
»Wie wirst du sie nennen?«, fragte ich, als mir vom Tee etwas warm geworden war und sich dieses Knäuel von Emotionen, das mir im Hals steckte, ein wenig löste.
Matoga zuckte die Achseln.
»Ich weiß nicht. Vielleicht Mücke oder Schneeball.«
Ich sagte nichts, aber das gefiel mir nicht. Das waren keine Namen, die zu diesem Tier gepasst hätten, besonders im Hinblick auf seine persönliche Geschichte. Wir würden uns etwas anderes für sie ausdenken müssen.
Offiziell verliehene Namen beschneiden massiv die Kreativität. Man kann sie sich nicht merken, denn sie sind losgelöst von der Persönlichkeit und meist sehr banal. Sie haben überhaupt nichts mit der Person zu tun. Dazu kommt, dass jede Generation ihre Moden hat, und plötzlich heißen alle Magdalena, Patrick oder – du lieber Himmel – Janina. Deshalb bin ich bemüht, keine bestehenden Vor- und Nachnamen zu verwenden, sondern eher Bezeichnungen, die einem spontan einfallen, wenn man jemanden zum ersten Mal sieht. Ich bin überzeugt, dass dies der einzig richtige Umgang mit Sprache ist und dass man niemandem abgegriffene Worte überstülpen soll. Matoga zum Beispiel heißt Świerszczyński, so steht es an seiner Tür, und vor dem Nachnamen steht ein »Ś.« Gibt es einen Vornamen mit Ś? Er stellt sich immer mit »Świerszczyński« vor, erwartet aber offenbar nicht, dass sich jemand die Zunge verknotet, um das auszusprechen. Ich glaube, jeder von uns sieht die anderen Menschen auf eine eigene Art, also darf er diesen auch Namen geben, die ihm passend erscheinen. Ich habe ebenso viele Vornamen, wie ich Menschen kenne, die mit mir in irgendeiner Beziehung stehen.
Świerszczyński habe ich Matoga genannt und ich finde, dass dieser Name ganz gut zu ihm passt.
Jetzt eben, als ich die Hündin ansah, kam mir prompt ein Menschenname in den Sinn – Marysia. Vielleicht weil sie so ein ausgemergeltes Waisenkind war.
»Heißt sie nicht zufällig Marysia?«, fragte ich.
»Kann sein«, antwortete Matoga. »Ja, ich glaube ja. Sie heißt Marysia.«
In ähnlicher Weise war Bigfoot zu seinem Namen gekommen. Es lag ja ziemlich nahe, wenn man seine Spuren im Schnee sah, da war es einfach sonnenklar. Matoga hatte von ihm immer als »Zottelkopf« gesprochen, dann übernahm er aber automatisch meinen »Bigfoot«. Und das konnte nur heißen, dass ich gut gewählt hatte.
Leider konnte ich für mich selbst keinen vernünftigen Vornamen aussuchen. Was in den Papieren steht, halte ich für skandalös unpassend und kompromittierend – Janina. Ich glaube, dass ich in Wirklichkeit Emilia heiße oder Joanna. Manchmal glaube ich auch, irgendwie so ähnlich wie Irmtrud. Oder Bożygniewa. Oder Nawoja.
Matoga hingegen vermeidet es, wo er nur kann, mich beim Vornamen zu nennen. Das bedeutet sicher etwas. Irgendwie schafft er es immer, mich unmittelbar mit »du« anzureden.
»Wartest du mit mir, bis sie kommen?«, fragte er.
»Na klar.« Gerne war ich dazu bereit, und mir fiel auf, dass ich mich gescheut hätte, ihn noch extra mit seinem Namen »Matoga« anzusprechen. Wenn man so dicht beieinander wohnt, braucht man keine Namen zu nennen, um sich direkt aneinander zu wenden. Wenn ich bei ihm vorbeigehe und sehe, dass er Unkraut jätet, brauche ich seinen Namen nicht, um ihn anzusprechen. Es ist ein besonderer Grad der Vertrautheit.
Unsere Siedlung besteht aus wenigen Häusern, die auf einem Hochplateau stehen, weit ab vom Rest der Welt. Ein Hochplateau ist geologisch gesehen ein entfernter Verwandter des Tafelbergs, so etwas wie dessen Vorbote. Vor dem Krieg nannte sich unsere Kolonie »Luftzug«, heute, im Polnischen, ist – nicht ganz offiziell – »Lufcug« daraus geworden, und offiziell gibt es gar keinen Namen. Auf der Karte sieht man bloß den Weg und einige Häuser, keine Buchstaben. Hier weht immer Wind, enorme Luftmassen strömen durch die Berge von Westen nach Osten, von Tschechien zu uns. Im Winter pfeift der Wind gewaltig, er heult in den Kaminen. Und im Sommer streicht er raschelnd durch die Blätter. Still ist es hier nie. Viele Leute können es sich leisten, ein Haus in der Stadt zu haben, als offizielles, als Ganzjahreshaus, und ein zweites – ein irgendwie verspieltes, ein Kinderhaus – auf dem Land. So sehen die Häuser denn auch aus, kindlich. Klein, geduckt, mit steilen Dächern und winzigen Fenstern. Alle sind vor dem Krieg auf die gleiche Art gebaut worden: mit langen ost- und westseitigen Mauern, eine kurze Mauer Richtung Süden und eine zweite, kurze nordseitige Mauer, an der eine Scheune lehnt. Nur das Haus der Schriftstellerin, mit seinen überall angebauten Terrassen und Balkonen, ist etwas exzentrischer.
Man darf sich nicht über die Leute wundern, die im Winter das Hochplateau verlassen. Von Oktober bis April ist es hart, hier zu wohnen, davon kann ich ein Lied singen. Jedes Jahr fällt hier der große Schnee, und der Wind meißelt mit Akkuratesse seine Verwehungen und Dünen in den Schnee hinein. Die letzten klimatischen Veränderungen haben alles erwärmt, bis auf unser Hochplateau. Hier ist es gerade umgekehrt, im Februar schneit es noch einmal besonders stark, und der Schnee bleibt besonders lange liegen. Die Temperaturen sinken im Winter mehrere Male bis auf minus zwanzig Grad, und bis Ende April ist hier Winter. Der Weg ist schlecht, Frost und Schnee zerstören das, was die Gemeinde mit ihren kümmerlichen Mitteln immer wieder zu reparieren versucht. Bis zum Asphaltweg muss man vier Kilometer auf einem tief zerfurchten Feldweg fahren, und eigentlich gibt es nichts, wofür man sich das antun würde – der Autobus hinunter nach Kudowa fährt morgens ab und kehrt nachmittags zurück. Im Sommer, wenn die wenigen, bleichen Kinder hier Ferien haben, fährt gar kein Bus. Durch die Gegend führt eine Straße, die sich an einem Punkt wie eine Wünschelrute verzweigt und dann unbemerkt in den Vorort des Städtchens verwandelt. Sollte jemand Lust dazu bekommen, so kann er auf dieser Straße weiter nach Wrocław oder Tschechien fahren.
Aber es gibt auch Menschen, denen das gefällt. Man könnte viele Hypothesen darüber aufstellen, so man Spaß an hypothetischen Ansätzen hat. Psychologie und Soziologie könnten hier auf manche Spur lenken, aber mich lässt so was vollkommen kalt.
Matoga und ich zum Beispiel, wir bieten dem Winter tapfer die Stirn. Übrigens ist die Wendung »die Stirn bieten« ziemlich blödsinnig, denn wir schieben kämpferisch den Unterkiefer vor, wie die Männer auf der kleinen Brücke im Dorf. Wenn man die provoziert oder anpöbelt, dann sagen sie angriffslustig: »Na, und? Na, und?« In gewissem Sinne provozieren wir auch den Winter, aber der ignoriert uns ebenso wie den Rest der Welt. Die alten Exzentriker. Hippies von Gottes Gnaden.
Alles hier ist so schön in weiße Winterwatte gekuschelt. Der Winter kürzt die Tage maximal, sodass man, wenn man unbesonnen etwas zu lang in die Nacht hinein zusammensitzt, erst im Dämmer des nächsten Nachmittags erwacht. Was mir, zugegebenermaßen, seit letztem Jahr immer wieder passiert. Der Himmel hängt hier über uns, tief und dunkel, wie ein schmutziger Bildschirm, auf dem sich übermütige Wolken-Kissenschlachten abspielen. Dafür sind unsere Häuser da – um uns vor diesem Himmel zu schützen, der ohne die Häuser unsere Körper bis ins Innerste durchdringen würde, bis in unsere Seele, die einer kleinen Murmel gleicht. Wenn es so etwas wie die Seele überhaupt gibt.
Ich weiß nicht, was Matoga in diesen dunklen Monaten macht. Wir haben wenig Kontakt zueinander, auch wenn ich – zugegeben – gerne mehr hätte. Wir sehen uns alle paar Tage und wechseln ein paar Worte. Aber wir sind nicht deshalb hierhergezogen, um miteinander Tee zu trinken. Matoga hat sein Haus ein Jahr nach mir gekauft, und es sieht so aus, als hätte er beschlossen, ein neues Leben zu beginnen, wie jeder, dem die Ideen und die Mittel für das alte Leben ausgegangen sind. Angeblich hat er früher im Zirkus gearbeitet, aber ich weiß nicht, ob er dort Buchhalter oder Akrobat war. Lieber wäre mir Akrobat, denn wenn ich ihn humpeln sehe, dann stelle ich mir immer vor, dass vor langer Zeit, in den schönen siebziger Jahren, während einer ganz besonderen Nummer etwas geschehen sein könnte, was bewirkte, dass seine Hand das Trapezholz nicht erreichte, und er von weit oben in die mit Sägespänen bestreute Manege fiel. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr will mir scheinen, dass der Beruf des Buchhalters auch kein schlechter Beruf ist, und die den Buchhaltern eigene Ordnungsliebe weckt meine Bewunderung, Zustimmung und meinen ausnehmenden Respekt. Matogas Ordnungsliebe erkennt man auf seinem kleinen Anwesen auf einen Blick: Das Brennholz schichtet er in kunstvollen, spiralförmigen Klaftern übereinander. Daraus entsteht dann ein hübscher runder, ideal proportionierter Hügel. Matogas Holzklafter könnte man als ein lokales Kunstwerk auffassen. Dem Reiz dieser schönen, spiraligen Ordnung kann ich mich nicht entziehen. Immer wenn ich dort vorbeigehe, bleibe ich einen Moment stehen und bewundere diese beispielhafte Zusammenarbeit von Hand und Kopf, die mit etwas so Banalem wie Brennholz die vollkommenste Bewegung im Universum ausführt.
Der Pfad vor Matogas Haus ist so gleichmäßig mit Kies bestreut, dass man glauben könnte, es sei ein besonderer Kies, aus identischen Steinchen, von Hand ausgesucht, in unterirdischen Felsenhöhlen oder in von Kobolden geführten Kiesfabriken. Vor seinen Fenstern hängen saubere Gardinen, gleichmäßig gefältelt, sicher verwendet er für diesen Effekt eine spezielle Vorrichtung. Seine Blumen im Garten stehen fein säuberlich und ordentlich da, gerade aufgerichtet und schlank, als hätten sie ein Fitnesstraining absolviert.
Als Matoga in der Küche hantierte und uns Tee machte, fiel mir auf, wie akkurat die Tassen in seinem Geschirrschrank standen, was für ein makelloses Deckchen auf der Nähmaschine lag. Er hatte sogar eine Nähmaschine! Beschämt hielt ich meine Hände zwischen die Knie gepresst. Meinen Händen hatte ich lange Zeit kaum Aufmerksamkeit gewidmet. Also, es ließ sich nicht verbergen, dass meine Fingernägel ganz einfach schmutzig waren.
Als er die Teelöffelchen holte, sah ich kurz das Innere der Schublade, und ich konnte meinen Blick nicht davon abwenden. Sie war breit und flach wie ein Tablett. In den mittleren Fächern lagen sorgfältig nebeneinander das Besteck und daneben die anderen Küchenutensilien. Jeder der mir größtenteils unbekannten Gegenstände hatte seinen eigenen Platz. Matogas knochige Finger wählten bedächtig zwei Löffel aus und legten sie auf die zartgrünen Servietten neben unseren Teegläsern. Leider zu spät, denn ich hatte meinen Tee bereits ausgetrunken.
Es war nicht leicht, mit Matoga ein Gespräch in Gang zu halten. Er war sehr wortkarg. Wenn man nicht sprechen kann, muss man schweigen. Mit manchen Personen sind Gespräche fast unmöglich, besonders mit männlichen. Ich habe eine Theorie zu dem Thema. Viele Männer erkranken mit fortschreitendem Alter an Testosteron-Autismus, was mit einem langsamen Schwinden der sozialen Intelligenz und einem zunehmenden Unvermögen, was zwischenmenschliche Kommunikation betrifft, einhergeht und auch das Formulieren von Gedanken beeinträchtigt. Ein von diesem Leiden befallener Mensch wird schweigsam, er scheint immer in Gedanken versunken zu sein. Er ist mehr an Gegenständen und Mechanismen interessiert. Etwa am Zweiten Weltkrieg, den Biografien bekannter Persönlichkeiten, besonders von Politikern und Verbrechern. Er verlernt fast völlig, Romane zu lesen, denn der Testosteron-Autismus behindert das psychologische Verstehen der Figuren. Ich glaube, dass Matoga so ein Fall war.
Doch an diesem Morgen konnte man von niemandem besondere Redseligkeit verlangen. Wir waren einfach nur bedrückt.
Andererseits war ich erleichtert. Manchmal, wenn man sein Denken weiter fasst und die Gewohnheiten des Geistes ebenso mit einbezieht wie die Bilanz der Tätigkeiten, wird einem klar, dass das Leben des einen nicht in jedem Fall gut für die anderen ist. Ich glaube, jeder wird mir Recht geben.
Ich bat um ein weiteres Glas Tee, eigentlich nur, um ihn mit dem hübschen Löffel umzurühren.
»Einmal habe ich mich wegen Bigfoot bei der Polizei beschwert«, sagte ich.
Matoga hielt kurz beim Trockenreiben eines Kuchentellers inne.
»Wegen dem Hund?«, fragte er.
»Ja. Und wegen Wilderei. Ich habe eine Klage verfasst.«
»Und? Was dann?«
»Nichts.«
»Willst du sagen, es ist gut, dass er jetzt tot ist?«
Noch vor letzten Weihnachten war ich zur Gemeinde gegangen, um den Fall persönlich anzuzeigen. Bis dahin hatte ich Briefe geschrieben. Niemand hatte darauf geantwortet, obwohl es eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt. Die Polizeidienststelle war winzig und erinnerte mit ihren überhaupt nicht zusammenpassenden Materialien an ein tristes Einfamilienhaus aus kommunistischen Zeiten. Dementsprechend war auch die Stimmung. Die mit Ölfarbe gestrichenen Wände waren über und über mit Zetteln bedeckt, die allesamt mit »Bekanntmachung« überschrieben waren – übrigens ein fürchterliches Wort. Die Polizei verwendet ziemlich viele ausnehmend abstoßende Worte, etwa »Mordopfer« oder »Lebensgefährte«.
In dieser Stätte Plutos war es zuerst ein junger, hinter einer Holzschranke sitzender Mann, der versuchte, mich abzuwimmeln. Später übernahm sein älterer Vorgesetzter den Job. Ich wollte den Kommissar sprechen und ließ mich nicht abweisen. Ich vertraute darauf, dass letztlich beide die Geduld mit mir verlieren und mich ihm vorführen würden. Man ließ mich lange warten, und ich fürchtete schon, die Geschäfte könnten schließen, denn ich hatte noch Einkäufe zu erledigen. Es dämmerte bereits, also es war etwa sechzehn Uhr, ich hatte zwei Stunden gewartet.
Endlich, kurz vor Ende der Amtszeit, erschien im Flur eine junge Frau. »Bitte, Sie können hineingehen.«
Ich war in Grübeleien versunken, doch was ich jetzt brauchte, war Geistesgegenwart. Als ich der Frau zur Audienz in den ersten Stock folgte, wo der Chef der lokalen Polizei sein Arbeitszimmer hatte, sammelte ich meine Gedanken.
Es war ein beleibter Mann, etwa in meinem Alter, doch er sprach mich so an, als sei ich seine Mutter oder sogar Großmutter. Er warf mir einen flüchtigen Blick zu und sagte:
»Setzen, bitte.« Als er merkte, dass er mit diesem Infinitiv seine Unbildung verraten hatte, räusperte er sich und korrigierte sich.
»Bitte, nehmen Sie Platz.«