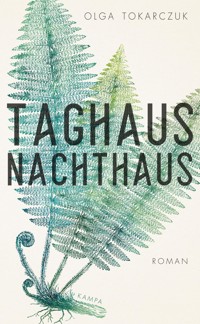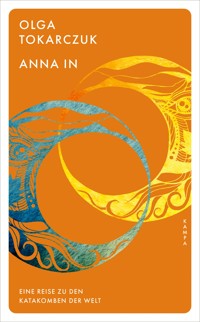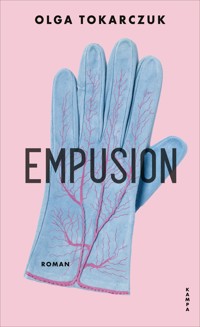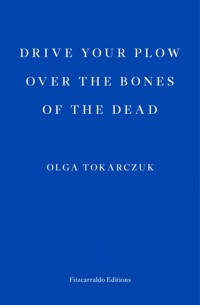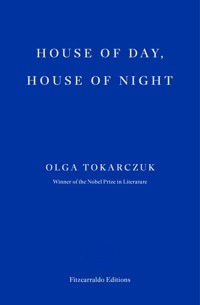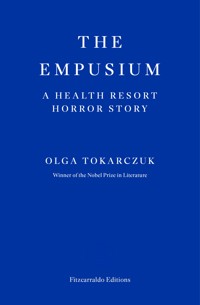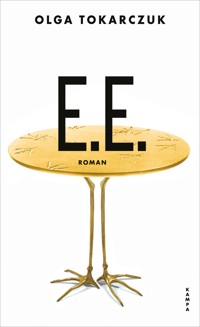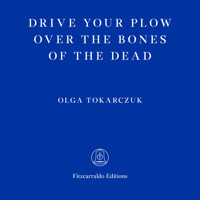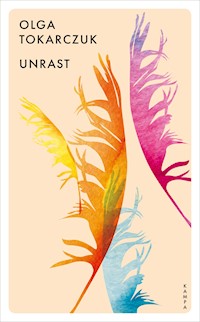
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Noch nie wurde so viel gereist wie heute. Und doch hat sich das Reisen seine Poesie bewahrt. Aber was heißt es, in dieser rasenden Welt ein Körper in Bewegung zu sein? Nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit zu reisen? Da ist die Erzählerin, die unentwegt auf Wanderschaft ist, zu Fuß, im Auto, im Flugzeug und in Gedanken. Oder Eryk, den es als Fährmann in den hohen Norden verschlagen hat und der irgendwann mit seinen verdutzten Passagieren Kurs aufs offene Meer nimmt. Da ist der junge Mann, der langsam dem Wahnsinn verfällt, als Frau und Kind während eines Urlaubs plötzlich verschwinden, um ebenso plötzlich wieder aufzutauchen. Und schließlich Chopins Schwester, die ihren Bruder abgöttisch geliebt hat und nun sein Herz auf eine letzte Reise nach Warschau begleitet. »Unrast« ist eine Wundertüte voller Mythen, Bekenntnisse, Notizen und Gedanken über das Reisen, die Verbindung zwischen Leib und Seele, über Leben und Tod, Entwurzelung und Migration - ein Potpourri unterschiedlichster Geschichten, die alle einem geheimen Fahrplan folgen und eine gemeinsame Destination haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
- Unsere Empfehlungen
- Ich erinnere mich nicht an den Titel, aber das Cover war gelb
- Top E-Books 2022
- Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk
- Geschichten die verzaubern
- E-Books & Hörbücher perfekt für unterwegs
- Bücher, so bunt wie das Leben selbst
- Bücher von Literaturnobelpreisträger*innen
- Buch-Highlights vom Kampa Verlag
- Nobelpreis für Literatur
Ähnliche
Olga Tokarczuk
Unrast
Aus dem Polnischen von Esther Kinsky
Kampa
Ich bin
Ich bin ein paar Jahre alt. Ich sitze auf der Fensterbank, ringsum liegen Spielsachen verstreut, umgestürzte Türme aus Bauklötzen, Puppen mit weit aufgerissenen Augen. Im Haus ist es dunkel, die Luft in den Zimmern wird kühler, der Abend dämmert. Niemand ist zu Hause; sie sind fortgegangen, verschwunden, man hört noch ihre verhallenden Stimmen, Rascheln, das Echo von Schritten, ein fernes Lachen. Draußen vor dem Fenster liegt der verlassene Hof. Sanft senkt sich das Dunkel herab. Wie schwarzer Tau breitet es sich über die Dinge.
Am spürbarsten ist die Starre, sie ist dicht und sichtbar: der kalte Dämmer und das schwache Licht der Natriumlampen, das kaum einen Meter von seiner Quelle schon im Dunkel versinkt.
Nichts ereignet sich, der Anmarsch der Finsternis macht vor der Tür des Hauses Halt, der ganze Tumult des Dunkelns kommt zur Ruhe, bildet eine pelzige Haut wie auf erkaltender Milch. Vor dem Hintergrund des Himmels dehnen sich die Umrisse der Gebäude ins Unendliche, verlieren langsam alle scharfen Kanten, Ecken, Winkel. Das erlöschende Licht zieht die Luft mit sich, das Atmen wird schwer. Das Dunkel dringt jetzt durch die Haut. Die Töne rollen sich zusammen, ziehen die Schneckenaugen zurück; das Orchester der Welt ist abgezogen und im Park verschwunden.
Dieser Abend ist der Rand der Welt, ich habe ihn zufällig und absichtslos beim Spiel ertastet. Ich habe ihn entdeckt, als man mich einen Augenblick allein, ohne Obhut gelassen hatte. Natürlich saß ich in der Falle, war eingesperrt. Ich bin ein paar Jahre alt, sitze auf der Fensterbank, blicke in den erstarrten Hof. Die Lichter in der Schulküche sind schon ausgeschaltet, alle sind schon heimgegangen. Die Betonplatten auf dem Hof haben sich mit Dunkelheit vollgesogen und sind verschwunden. Die Türen sind geschlossen, die Luken dichtgemacht, die Rollladen heruntergelassen. Ich würde gern hinausgehen, weiß aber nicht, wohin. Einzig und allein meine Gegenwart nimmt schärfere Umrisse an, die zittern und wogen, das tut weh. In einem einzigen Augenblick entdecke ich die Wahrheit: Es lässt sich nicht mehr ändern – ich bin.
Die Welt im Kopf
Meine erste Reise unternahm ich zu Fuß, quer über die Felder. Meine Abwesenheit wurde lange nicht bemerkt, und so kam ich ziemlich weit. Ich ging durch den ganzen Park, dann über Feldwege, durch Maisfelder und über feuchte Wiesen mit Butterblumen und einem Netz von Entwässerungsgräben – bis hin zum Fluss. Der Fluss war in diesem Tiefland ohnehin allgegenwärtig, er durchtränkte die Grasschicht und leckte an den Feldern.
Ich kletterte auf den Deich und sah ein bewegliches Band, einen Weg, der über die Grenzen des Blickfelds, über die Grenzen der Welt hinausfloss. Und wenn man Glück hatte, konnte man Kähne darauf sehen, große, flache Boote, die stromauf und stromab fuhren, ohne auf die Ufer zu achten, auf die Bäume, die Menschen, die auf dem Deich standen und wahrscheinlich als unstete, nicht weiter beachtenswerte Orientierungspunkte erschienen, Zeugen der anmutigen Bewegung der Boote. Ich träumte davon, später, wenn ich groß sein würde, auf einem solchen Kahn zu arbeiten oder – besser noch, überhaupt ein Kahn zu werden.
Es war kein großer Fluss, es war nur die Oder, aber ich war ja damals auch klein. Sie hatte ihren Platz in der Hierarchie der Flüsse, wie ich später auf der Landkarte nachprüfte, und war eher unbedeutend, aber machte sich doch bemerkbar, eine Edelfrau aus der Provinz am Hof der Königin Amazonas. Mir jedoch reichte sie vollauf, sie kam mir riesig vor. Sie floss nach Belieben, nie reguliert, zu Überschwemmungen neigend, unberechenbar. An manchen Stellen stieß sie am Ufer auf Hindernisse unter der Wasseroberfläche, dort bildeten sich Strudel im Wasser. Sie strömte dahin, zog vorüber, mit ihren Zielen befasst, die irgendwo weit im Norden, jenseits des Horizonts lagen. Man konnte den Blick nicht auf ihr ruhen lassen, sie zog ihn mit sich fort, auf den Horizont zu, so dass man das Gleichgewicht verlor.
Sie schenkte mir keine Beachtung, war mit sich beschäftigt, ein unstetes wanderndes Gewässer, in das man nie zweimal steigt, wie ich später lernte.
Jedes Jahr forderte der Fluss seinen gesalzenen Lohn dafür, dass er die Kähne auf seinem Rücken trug, denn jedes Jahr ertrank jemand darin: sei es ein Kind beim Baden an einem heißen Sommertag, sei es ein Betrunkener, den es irgendwie auf die Brücke verschlagen hatte und der dort trotz des Geländers ins Wasser gefallen war. Die Ertrunkenen wurden lange und mit großem Aufwand gesucht, die ganze Gegend hielt den Atem an. Taucher kamen, das Militär stellte Motorboote. Den belauschten Gesprächen der Erwachsenen zufolge waren die schließlich gefundenen Leichen aufgedunsen und bleich, das Wasser hatte alles Leben aus ihnen gewaschen und ihre Gesichtszüge so verwischt, dass die Angehörigen die Toten nur mit Mühe erkennen konnten.
Als ich so in den Anblick der Strömung versunken auf dem Flutwall stand, wurde mir klar, dass aller Gefahren zum Trotz das, was in Bewegung ist, immer besser sein wird, als das, was ruht, dass der Wandel edler ist als die Stetigkeit, dass das Unbewegliche Zerfall und Auflösung anheimfallen muss und zu Schutt und Asche wird, während das Bewegliche sogar ewig währen kann. Von da an wurde der Fluss zur Nadel, die in meiner sicheren, steten Landschaft stak: im Park, in den Beeten, wo die Gemüse in verschämten Reihen standen, in dem Gehweg aus Betonplatten, wo Himmel und Hölle gespielt wurde. Die Nadel durchstach sie alle, bezeichnete vertikal eine dritte Dimension, sie hatte ein Loch gemacht, und die kindliche Welt erwies sich als ein Aufblasspielzeug, aus dem pfeifend die Luft entwich.
Meine Eltern waren nicht ganz vom sesshaften Schlag. Immer wieder zogen sie um, von einem Ort zum anderen, bis sie sich schließlich für längere Zeit in einer Provinzschule niederließen, weitab von jeder ordentlichen Straße und Eisenbahnstation. Jedes Überschreiten der Gartengrenze, jeder Ausflug in die kleine Stadt war schon eine Reise. Einkäufe, Papiere, die im Gemeindeamt eingereicht werden mussten, immer derselbe Friseur am Markt vor dem Rathaus, der immer denselben erfolglos gewaschenen und gebleichten Kittel trug, auf dem die Färbemittel für die Haare seiner Kundinnen kalligraphische Flecken hinterlassen hatten, chinesische Schriftzeichen. Mama ließ sich die Haare färben, der Vater wartete an einem der beiden Tische draußen vor dem Café »Nowa« auf sie und las Zeitung. Er las die Lokalzeitung, in der die Rubrik »Kriminalfälle« mit Berichten über Marmeladen- und Gewürzgurkenraub aus irgendwelchen Kellern immer das Interessanteste war.
Comparative overview of important rivers (undatiert)
Ihre Ferienausflüge unternahmen sie zaghaft, mit einem bis unters Dach voll gepackten Skoda. Lange vorbereitet, an Vorfrühlingsabenden geplant, wenn der Schnee gerade getaut, die Erde aber noch nicht wieder erwacht war und sie sich auch bis auf weiteres nicht den Pflügen und Hacken hingeben, sich noch nicht befruchten lassen und die Zeit der Menschen vom Morgen bis zum Abend in Anspruch nehmen würde.
Sie gehörten zu einer Generation, die mit Wohnwagen unterwegs war, einen Hausersatz hinter sich herzog. Einen kleinen Gasherd, Klappstühle, einen Klapptisch. Eine Plastikschnur zum Aufhängen der Wäsche, wo man Halt machte, hölzerne Wäscheklammern. Wasserfestes Wachstuch für den Tisch. Ein Picknick-Set für die Reise, bestehend aus bunten Tellern, Besteck, Salzfässchen und Gläsern – alles aus Plastik.
Irgendwo unterwegs, auf einem Flohmarkt, wie ihn er und meine Mutter besonders gerne besuchten (wenn sie sich zufällig einmal nicht gerade gegenseitig vor Kirchen und Denkmälern fotografierten), hatte mein Vater einen Wasserkocher aus der Armee erstanden, einen Kupferbehälter mit einem Rohr in der Mitte, in das man eine Handvoll kleingebrochenes Reisig legen und anzünden konnte. Obwohl es auf den Campingplätzen Stromanschlüsse gab, kochte er das Wasser immer in diesem Teekessel, der qualmte und ewig brauchte. Er kniete über dem heißen Gefäß und lauschte stolz auf das Bullern des kochenden Wassers, das er dann auf die Teebeutel goss – ein echter Nomade.
Sie hielten an den dafür bestimmten Orten, auf Campingplätzen, immer in Gesellschaft anderer Leute ihres Schlags, und hielten Schwätzchen mit den Nachbarn über die Socken hinweg, die an den Zeltschnüren trockneten. Mit Hilfe des Reiseführers legte man Reiserouten fest, wobei die Sehenswürdigkeiten sorgfältig aufgelistet wurden. Bis Mittag Baden im Meer oder in einem See, am Nachmittag ein Ausflug zu den Ruinen und Überresten von Städten, zum Abschluss das Fertigabendessen, meistens aus Eingewecktem bestehend: Gulasch, Frikadellen, Klopse in Tomatensauce. Dazu brauchte man nur noch Reis oder Nudeln zu kochen. Ewiges Sparen, der Zloty steht schlecht, das ist der rote Heller der Welt. Orte suchen, wo es Stromanschluss gibt, dann wieder unwillig packen, um weiterzureisen, jedoch immer in der metaphysischen Umlaufbahn des eigenen Heims. Sie waren keine echten Reisenden, denn sie reisten, um zurückzukehren. Und immer kehrten sie erleichtert heim, hatten das Gefühl, eine Pflicht gut erfüllt zu haben. Sie kamen zurück und nahmen den Stapel Briefe und Rechnungen von der Kommode. Machten große Wäsche. Langweilten die heimlich gähnenden Freunde mit ihren Fotos zu Tode. Das sind wir in Carcassone. Und hier ist meine Frau, vor der Akropolis.
Dann führten sie das ganze Jahr ein sesshaftes Leben, dieses merkwürdige Leben, in dem man morgens da weitermacht, wo man am Abend aufgehört hat, in dem die Kleidung ganz vom Geruch der eigenen Wohnung durchdrungen ist und die Füße unermüdlich ihren Pfad auf dem Teppich treten.
Das ist nichts für mich. Offenbar fehlt mir irgendein Gen, das beim Menschen dazu führt, nach kurzer Zeit an einem Ort Wurzeln zu schlagen. Ich habe es oft versucht, aber meine Wurzeln waren flach, jeder beliebige Windstoß konnte mich ausreißen. Ich konnte nicht sprießen, diese den Pflanzen eigene Fähigkeit fehlt mir. Ich ziehe keine Säfte aus der Erde, ich bin ein Anti-Anteus. Meine Energie schöpft sich aus der Bewegung – aus dem Ruckeln von Autobussen, dem Dröhnen von Flugzeugen, dem Schaukeln von Fähren und Zügen.
Ich bin handlich, klein und kompakt. Mein Magen ist anspruchslos, mein Bauch fest, meine Lungen sind kräftig, meine Armmuskeln stark. Ich nehme weder Medikamente noch Hormone und trage keine Brille. Vierteljährlich schere ich mir die Haare mit dem Rasierapparat, ich benutze so gut wie keine Schminke. Ich habe gesunde Zähne, vielleicht nicht ebenmäßig, doch ganz, nur eine alte Plombe ist da, ich glaube im Sechser links unten. Leberwerte normal. Bauchspeicheldrüsenwerte normal. Die Nierenfunktion rechts und links hervorragend. Meine Bauchschlagader in der Norm. Meine Harnblase genau richtig. Hämoglobin: 12.7; Leukozyten: 4.5; Hämatokrit: 41.6; Thrombozyten: 228; Cholesterin: 204; Kreatinin: 1.0; Bilirubin: 4.2; und so weiter. Mein IQ – wenn man an so etwas glaubt – ist 121, das reicht. Ich habe eine außergewöhnlich gut entwickelte räumliche Vorstellungskraft, die fast eidetisch ist, dafür ist mein laterales Denken schlecht ausgeprägt. Kein stabiles Persönlichkeitsprofil, wahrscheinlich wenig vertrauenswürdig. Alter: psychologisch. Geschlecht: grammatisch. Bücher kaufe ich lieber im Taschenbuch, um sie ohne Bedauern auf Bahnsteigen liegen zu lassen, für die Augen anderer. Ich sammle nichts.
Ich habe mein Studium abgeschlossen, aber im Grunde habe ich keinen Beruf erlernt, was ich sehr bedaure: Mein Großvater war Weber, er bleichte die gewebte Leinwand, indem er sie auf einem Hang ausbreitete und dem hellen Sonnenlicht aussetzte. Es würde mir Spaß machen, Kette und Schuss miteinander zu verweben, aber es gibt keine transportablen Webrahmen, die Weberei ist eine Kunst für sesshafte Menschen. Unterwegs stricke ich. Leider ist es neuerdings bei manchen Fluggesellschaften verboten, Strick- oder Häkelnadeln mit an Bord zu nehmen. Wie gesagt, ich habe kein Fach gelernt, dennoch habe ich, ungeachtet der Warnungen meiner Eltern, immer überleben können, indem ich auf Reisen alle möglichen Arbeiten ausgeübt habe und keineswegs unter die Räder gekommen bin.
Als meine Eltern nach zwanzig Jahren ihr romantisches Experiment aufgaben und in die Stadt zurückkehrten, als sie der Dürren und Fröste überdrüssig waren, der gesunden Nahrung, die den ganzen Winter über im Keller kränkelte, der von den eigenen Schafen geschorenen Wolle, mit denen die unersättlichen Kehlen der Kissen- und Deckenbezüge gestopft wurden, da bekam ich ein wenig Geld von ihnen und machte mich zum ersten Mal auf den Weg.
Ich arbeitete in Gelegenheitsjobs, wo ich gerade hinkam. In einer internationalen Manufaktur am Rand einer Weltstadt schraubte ich Antennen in Luxusyachten. Dort arbeiteten viele wie ich. Wir arbeiteten schwarz, keiner fragte nach unserer Herkunft und nach unseren Zukunftsplänen. Freitags bekamen wir den Wochenlohn, und wem es nicht gefiel, der kam am Montag nicht wieder. Zukünftige Studenten arbeiteten dort, die ihre Zeit zwischen Abitur und Uni-Aufnahmeprüfung überbrückten. Emigranten auf ewiger Reise zu einem idealen gerechten Land irgendwo im Westen, wo die Menschen Schwestern und Brüder sind und ein starker Staat die Rolle eines fürsorglichen Elternteils übernimmt. Flüchtlinge, die vor ihren Familien ausgerissen waren, vor Frauen, Männern, Eltern, unglücklich Verliebte, verstört, melancholisch, ewig verfroren. Manche, nach denen das Gesetz seinen langen Arm ausstrecken wollte, weil sie ihre überzogenen Kreditkarten nicht abbezahlt hatten. Herumtreiber, Vagabunden. Verrückte, die beim nächsten psychotischen Schub in die Klinik gebracht und von dort – kraft uneindeutiger Vorschriften – in ihr Herkunftsland abgeschoben wurden.
Nur ein Inder war da, der schon seit Jahren in diesem Werk arbeitete. Doch ehrlich gesagt unterschied sich seine Situation nicht sehr von unserer. Er war nicht versichert und bekam keinen Urlaub. Er arbeitete schweigend, geduldig, in gleichmäßigem Tempo. Nie kam er zu spät, nie fragte er um einen arbeitsfreien Tag. Ich überredete ein paar Leute, sich wenigstens seinetwillen gewerkschaftlich zu organisieren – das waren die Zeiten der Solidarność –, aber er wollte nicht. Von meiner Anteilnahme gerührt, bewirtete er mich jeden Tag mit scharfem Curry, das er im Henkelmann von zu Hause mitbrachte. Heute kann ich mich nicht mal mehr an seinen Namen erinnern.
Ich war Kellnerin, Zimmermädchen in einem exklusiven Hotel und Kindermädchen. Ich habe Bücher und Tickets verkauft. In einem kleinen Theater verdingte ich mich für eine Saison als Garderobiere im Fundus und konnte so den langen Winter zwischen Plüschkulissen, schweren Kostümen, atlasseidenen Umhängen und Perücken verbringen. Nach meinem Studienabschluss habe ich außerdem als Pädagogin, Beraterin in der Suchthilfe und zuletzt in einer Bibliothek gearbeitet. Sobald ich ein wenig Geld verdient hatte, machte ich mich wieder auf den Weg.
Der Kopf in der Welt
In einer großen düsteren kommunistischen Stadt habe ich Psychologie studiert, mein Fachbereich war in dem Gebäude untergebracht, in dem sich während des Krieges der Sitz der dortigen SS befand. Dieser Stadtteil war auf den Ruinen des Ghettos errichtet worden, das ließ sich ganz leicht erkennen, wenn man genau hinschaute: Der ganze Stadtteil stand nämlich rund einen Meter höher als die übrige Stadt. Ein Meter Trümmer. Ich fühlte mich dort nie wohl, zwischen den neuen Wohnblocks und den kläglichen Grünanlagen blies immer der Wind, die eisige Luft fühlte sich besonders scharf an und schnitt ins Gesicht. Trotz der Bebauung gehörte die Gegend im Grunde noch den Toten. Das Institutsgebäude kommt heute noch in meinen Träumen vor – seine breiten, wie aus Fels gehauenen Korridore, die von den Füßen der verschiedensten Menschen glattgelaufen waren, die ausgetretenen Treppenstufen, die von unzähligen Händen blankpolierten Geländer, lauter Spuren, die im Raum ihre Abdrücke hinterlassen hatten. Vielleicht besuchten uns deshalb ab und zu Geister.
Wenn wir Ratten ins Labyrinth setzten, war immer eine dabei, deren Verhalten den Theorien widersprach und unserer raschen Hypothesen spottete. Sie stellte sich auf zwei Beine und zeigte nicht das geringste Interesse an der Belohnung am Ausgang der Versuchsstrecke, den mit dem pawlowschen Reflex verbundenen Privilegien abgeneigt, musterte sie uns und kehrte dann um oder machte sich daran, in aller Ruhe das Labyrinth zu erkunden. Sie suchte etwas in den Seitengängen, wollte auf sich aufmerksam machen. Sie quiekte verwirrt, und die Mädchen hoben sie entgegen den Vorschriften aus dem Labyrinth und nahmen sie in die Hand.
Die Muskeln eines toten, in die Länge gezogenen Froschs beugten und streckten sich nach dem Diktat elektrischer Impulse, doch auf eine Art und Weise, wie sie in unseren Lehrbüchern noch nicht beschrieben worden war: Sie gaben uns Zeichen, die Extremitäten vollführten eindeutig Droh- und Spottgebärden und widerlegten damit den geheiligten Glauben an die mechanische Unschuld physiologischer Reflexe.
Hier wurde uns beigebracht, dass sich die Welt beschreiben, ja sogar mit einfachen Antworten auf intelligente Fragen erklären lässt. Dass sie dem Wesen nach ohnmächtig und unbelebt ist, dass in ihr recht simple Gesetze herrschen, die man erklären und nennen muss, am besten mit Hilfe eines Schaubilds. Von uns wurden Experimente verlangt. Wir sollten Hypothesen formulieren. Verifizieren. Wir wurden in geheime Statistiken eingeführt, denn man glaubte, mit ihrer Hilfe ließen sich alle möglichen Gesetzmäßigkeiten der Welt perfekt erfassen, schließlich hat 90 Prozent eine größere Bedeutung als fünf.
Doch heute weiß ich eines: Wer Ordnung sucht, soll die Psychologie meiden. Lieber soll man sich mit Physiologie oder Theologie beschäftigen, dann kann man sich wenigstens auf etwas Ordentliches stützen, nämlich entweder auf die Materie oder auf den Geist, anstatt auf der Psyche auszurutschen. Die Psyche ist ein sehr unsicherer Untersuchungsgegenstand.
Sie hatten recht, die behaupteten, diese Fachrichtung suche man sich nicht im Hinblick auf einen zukünftigen Beruf, aus Interesse, aus dem Wunsch heraus, anderen zu helfen, oder ähnlichen schlichten Gründen. Ich habe den Verdacht, dass wir alle einen tief im Innern verborgenen Defekt hatten, obwohl wir bestimmt wie intelligente, gesunde junge Leute wirkten. Es war ein maskierter Defekt, der bei der Aufnahmeprüfung geschickt getarnt wurde. Ein heillos verheddertes, verfilztes Emotionsknäuel, wie die seltsamen Geschwulste, die man manchmal im menschlichen Körper entdeckt und in jedem Anatomie- und Pathologiemuseum findet, das etwas auf sich hält. Aber vielleicht waren unsere Prüfer ja vom gleichen Schlag und wussten in Wirklichkeit genau, was sie taten. Dann wären wir sozusagen ihre Erben gewesen.
Als wir im zweiten Jahr die Funktion von Schutzmechanismen behandelten und verwundert die Macht dieses Teils unserer Psyche erkannten, verstanden wir allmählich eines: Wenn wir keine Rationalisierung, Sublimierung, Verdrängung, keines dieser Kunststückchen hätten, derer wir uns bedienen, wenn wir ganz schutzlos, ehrlich und mutig die Welt betrachten würden – dann würde es uns das Herz brechen.
Was wir in diesem Studium lernten, war, dass wir aus Schutzvorrichtungen bestehen, aus Schild und Rüstung, wir sind Städte, deren Architektur aus Mauern, Basteien und Befestigungen besteht, wir sind Bunkerstaaten.
Alle Tests, Interviews und Untersuchungen führten wir aneinander durch, und nach dem dritten Studienjahr konnte ich mein Problem schon benennen, das war wie die Entdeckung eines geheimen Eigennamens, mit dem man zu einer Initiation aufgerufen wird.
In meinem erlernten Beruf hielt es mich nicht lange. Während einer meiner Reisen, als ich ohne Geld in einer großen Stadt festsaß und als Zimmermädchen arbeitete, begann ich zu schreiben. Es war eine Geschichte für die Reise, zum Lesen im Zug, etwas, was ich für mich selbst schreiben würde. Ein Buch wie ein Häppchen, das man ganz herunterschluckt, ohne abzubeißen.
Ich konnte mich entsprechend konzentrieren, für eine gewisse Zeit wurde ich zu einem ungeheuerlichen Ohr, das auf Geräusche, Echos und Geflüster lauschte, auf ferne Stimmen, die hinter einer Wand erklangen.
Doch nie wurde ich eine richtige Schriftstellerin oder – besser gesagt – ein Schriftsteller, denn in diesem Genus hört sich das Wort ernsthafter an. Das Leben entwischte mir immer wieder. Ich stieß immer nur auf seine Spuren, auf erbärmliche abgestreifte Häute. Wenn ich seine Position anpeilte, war es schon wieder woanders. Ich fand nur Zeichen, wie diese eingeritzten Inschriften in der Rinde von Parkbäumen: Ich war hier. In meinem Schreiben wurde das Leben zu unvollständigen Erzählungen, traumgleichen kleinen Geschichten mit ausfransenden Erzählfäden, von weitem erschien es in ungewöhnlich verschobenen Perspektiven oder wie ein Querschnitt – und es ließen sich kaum Schlussfolgerungen auf das Ganze ziehen.
Jeder, der schon einmal versucht hat, einen Roman zu schreiben, weiß, was das für ein mühsames Unterfangen ist, es ist zweifellos eine besonders schlechte Form der Selbstbeschäftigung. Die ganze Zeit muss man in sich selbst sein, in einer Einpersonenzelle, in völliger Einsamkeit. Es ist eine kontrollierte Psychose, eine Paranoia und zugleich Obsession, die mit Arbeit verbunden ist und deshalb auch nicht mit den Federn, Rüschen und venezianischen Masken ausgestattet, die wir damit assoziieren, sondern eher mit Fleischerschürze und Gummistiefeln und einem Messer zum Ausweiden in der Hand. Aus diesem Schriftstellerkeller sieht man allenfalls die Beine der Passanten, hört das Klappern der Absätze. Manchmal bleibt einer stehen, bückt sich und wirft einen Blick hinein, dann bekommt man ein menschliches Gesicht zu sehen und kann sogar ein paar Worte wechseln. Doch in Wirklichkeit ist der Geist mit seinem Spiel beschäftigt, das in einem hastig skizzierten Panoptikum abläuft, er stellt die Figuren auf einer provisorischen Bühne zurecht: Autor und Held, Erzählerin und Leserin, den, der beschreibt, und diejenige, die beschrieben wird; Füße, Schuhe, Absätze und Gesichter werden früher oder später ein Teil dieses Spiels.
Es tut mir nicht leid, dass ich mir just diese Tätigkeit ausgesucht habe. Zum Psychologen hätte ich nicht getaugt. Ich konnte keine Erklärungen finden, konnte in den Dunkelkammern des Geistes keine Familienfotos entwickeln. Die Bekenntnisse anderer haben mich oft gelangweilt, wie ich betrübt eingestehen muss. Ehrlich gesagt kam es öfter vor, dass ich gern die Rollen getauscht und ihnen von mir erzählt hätte. Ich musste mich vorsehen, dass ich nicht unvermittelt eine Patientin am Ärmel fasste und sie mitten im Satz unterbrach. »Was Sie nicht sagen! Das empfinde ich ganz anders! Wenn Sie wüssten, was ich geträumt habe! Hören Sie zu …« Oder: »Was wissen Sie schon von Schlaflosigkeit, guter Mann! Das soll eine Panikattacke sein? Dass ich nicht lache! Der Patient vor ihnen, der hat vielleicht …«
Ich konnte nicht zuhören. Ich wahrte nicht die Grenzen, war anfällig für Übertragungen. Ich glaubte nicht an Statistiken, nicht an die Verifizierbarkeit von Theorien. Die Prämisse der Deckungsgleichheit von Persönlichkeit und Mensch kam mir immer zu minimalistisch vor. Ich neigte dazu, das Offensichtliche zu verschleiern, felsenfeste Argumente in Zweifel zu ziehen, es war eine Angewohnheit, perverses Yoga des Hirns, ein subtiler Genuss beim Verspüren innerer Bewegung. Urteile betrachtete ich mit Skepsis, schmeckte sie unter der Zunge und machte die keineswegs überraschende Entdeckung, dass keines echt war, dass alles künstlich war, gefälschte Marken. Ich wollte keine festen Überzeugungen, sie wären unnötiger Ballast für mich gewesen. In Diskussionen stand ich mal auf dieser, mal auf jener Seite, ich weiß, dass mich das bei meinen Gesprächspartnern nicht beliebt machte. Ich war Zeuge eines merkwürdigen Vorgangs in meinem Kopf: Je mehr Argumente ich »für« etwas fand, desto mehr fielen mir »dagegen« ein, und je stärker ich an den ersteren hing, desto mehr drängten sich die letzteren auf.
Wie sollte ich andere untersuchen können, wenn mir selbst schon jeder Test so schwerfiel. Persönlichkeitstest, Umfragen, Fragebögen mit Kolonnen von Fragen und Skalen zum Ankreuzen der Antwort kamen mir zu schwierig vor. Diese Unzulänglichkeit wurde mir bald bewusst, und wenn wir uns in den praktischen Übungen während des Studiums gegenseitig befragen mussten, gab ich meine Antworten auf gut Glück. Ein seltsames Profil kam dabei heraus, eine schiefe Kurve im Koordinatennetz. »Glaubst du, dass die beste Entscheidung immer die ist, die sich am leichtesten ändern lässt?« Ob ich glaube? Was für eine Entscheidung? Ändern? Wann? Und was heißt leicht? »Du betrittst einen Raum – nimmst du eher einen Platz in der Mitte oder am Rand ein?« Was für ein Raum? Und wann? Ist der Raum leer, oder stehen rote Plüschsofas an der Wand? Und die Fenster – wie ist der Ausblick? Und was Bücher angeht: Lese ich lieber das Buch, anstatt auf eine Party zu gehen, oder hängt es vom Buch und von der Party ab?
Was für eine Methodologie! Stillschweigend geht man davon aus, dass der Mensch sich selbst nicht kennt, doch, mit so schlauen Fragen konfrontiert, sich selbst ausspionieren wird. Er selbst stellt sich die Frage, er selbst gibt die Antwort. Und unversehens verrät er sich selbst gegenüber ein Geheimnis, von dem er nichts gewusst hat.
Und die zweite lebensgefährliche Annahme ist die, dass wir statisch und unsere Reaktionen berechenbar sind.
Das Syndrom
Die Geschichte meiner Reisen ist nur die Geschichte einer Unzulänglichkeit. Ich leide an einem Syndrom, das sich mühelos in jedem Atlas klinischer Syndrome finden lässt und das – wie die Fachliteratur behauptet – immer mehr um sich greift. Am besten greift man zu »The Clinical Syndrome« in einer älteren Ausgabe, aus den siebziger Jahren. Das ist eine Art eigener Syndrom-Enzyklopädie. Für mich übrigens eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Würde es da noch jemand wagen, den Menschen als Ganzes zu beschreiben, allgemein und objektiv? Sich voller Überzeugung des Begriffs der »Persönlichkeit« zu bedienen? Begeisterung für eine überzeugende Typologie aufzubringen? Ich glaube kaum. Der Begriff des Syndroms passt wie angegossen auf die Reisepsychologie. Ein Syndrom ist nicht groß, übertragbar, an keine schlaffe Theorie gebunden, episodisch. Man kann damit etwas erklären und es dann in den Papierkorb werfen. Ein Erkenntniswerkzeug zum Einmalgebrauch. Meines heißt Perseveratives Detoxifikationssyndrom. Ganz nüchtern und schlicht erklärt, bedeutet es nur so viel, dass es dem Wesen nach auf der hartnäckigen Bewusstmachung bestimmter Vorstellungen, ja sogar auf der zwanghaften Suche nach diesen Vorstellungen beruht. Es ist eine Variante des »Mean World Syndrome« (»Böse-Welt-Syndrom«), das in der jüngsten Zeit in der neuropsychologischen Literatur ziemlich gut als eine spezifische Form der Infektion durch die Medien beschrieben wird. Im Grunde ein sehr bürgerliches Leiden. Der Patient verbringt Stunden vor dem Fernseher und sucht mit der Fernbedienung nur die Sender, auf denen besonders schreckliche Nachrichten gebracht werden: Kriege, Epidemien, Katastrophen. Gebannt von dem Anblick, kann der Zuschauer die Augen nicht mehr abwenden.
Die Symptome selbst sind nicht bedrohlich, man kann in Ruhe damit leben, solange man eine gewisse Distanz behält. Dieses unangenehme Leiden lässt sich nicht heilen, die Wissenschaft begnügt sich in diesem Fall mit der bedauernden Feststellung, dass es existiert. Gelangt der über sich selbst entsetzte Patient schließlich in die Sprechstunde eines Psychiaters, wird dieser ihm raten, seine Lebenshygiene zu verbessern: Verzicht auf Kaffee und Alkohol, Schlafen bei offenem Fenster, Gartenarbeit, Stricken oder Weben.
Mein Symptomkomplex besteht darin, dass mich alles anzieht, was kaputt, unvollkommen, defekt, zerbrochen ist. Mich interessiert das Unansehnliche, Irrtümer der Schöpfung, Sackgassen. Das, was sich entwickeln sollte, doch aus irgendwelchen Gründen unentwickelt geblieben oder, umgekehrt, übers Ziel hinausgeschossen ist. Alles, was von der Norm abweicht, was zu klein oder zu groß ist, wuchernd oder verkümmert, monströs und abstoßend. Formen, die keine Symmetrie wahren, die sich vervielfältigen, in die Breite gehen, sprießen oder, umgekehrt, die Vielzahl zur Einzahl reduzieren. Mich interessieren keine wiederholbaren Vorkommnisse, über die sich aufmerksam die Statistik beugt, die von allen mit zufriedenem freudigem Grinsen gefeiert werden. Meine Sensibilitäten sind teratologisch, monstrophil. Ich bin der unbeirrbaren und irritierenden Überzeugung, dass genau darin das wahre Sein zum Vorschein kommt und seine Natur offenbart. Eine plötzliche, zufällige Enthüllung. Ein verschämtes »Hoppla«, ein Zipfel Unterwäsche unter dem sorgsam plissierten Rock. Ein abscheuliches Metallskelett dringt plötzlich durch den Samtbezug, eine Eruption der Federn im Plüschsessel, die jedwede Illusion von Weichheit schamlos demaskiert.
Kuriositätenkabinett
Für den Besuch von Kunstmuseen habe ich nie viel übrig gehabt, und wenn es nach mir ginge, könnte man an ihrer Stelle gerne Kuriositätenkabinette einrichten, wo das Seltene und Einmalige, das Absonderliche und Monströse gesammelt und ausgestellt wird. Das, was im Schatten des Bewusstseins existiert und aus dem Blickfeld verschwindet, sobald man hinschaut. Ja, mit Gewissheit leide ich an jenem unglückseligen Syndrom. Mich zieht es nicht zu Ausstellungen in den Stadtzentren, sondern eher in kleine, zu Krankenhäusern gehörige Sammlungen, die oft in den Keller verbannt sind, als verdienten sie keinen wertvollen Ausstellungsraum, Indizien für den suspekten Geschmack früherer Sammler. Ein Salamander mit zwei Schwänzen in einem ovalen Glas, der mit hochgereckter Schnauze den Tag des Jüngsten Gerichts abwartet, wenn alle Präparate der Welt wiederauferstehen. Die Niere eines Delphins in Formalin. Die reine Anomalie: ein Schafsschädel mit je zwei Augenpaaren, Ohrenpaaren und Schnauzen, schön wie das Bildnis einer vielgesichtigen antiken Gottheit. Ein mit Glasperlen geschmückter menschlicher Embryo, dazu ein in sorgfältiger Schönschrift gefertigtes Etikett: »Fetus Aethiopis 5 mensium«. Jahrelang wurden hier die schrägen Launen der Natur gesammelt, Doppelköpfige und Kopflose, ungeboren treiben sie träge in Formaldehyd-Lösung. Oder der Fall des Cephalothoracophagus Monosymetro, bis heute in einem Museum in Pennsylvanien ausgestellt, der in Gestalt der pathologischen Morphologie einer Leibesfrucht mit einem Kopf und zwei Körpern die Grundlagen der Logik als Gleichung 12 in Frage stellt. Und zu guter Letzt ein rührendes hausgemachtes Präparat aus der Küche: Äpfel aus dem Jahre 1848 mit seltsamen, ganz abartigen Formen schlummern in Spiritus, weil offensichtlich jemand erkannte, dass diesen Launen der Na-tur Unsterblichkeit gebührt und nur das überdauert, was anders ist.
Und genau deshalb unternehme ich meine geduldigen Reisen, auf denen ich die Fehler und Reinfälle der Schöpfung aufspüre.
Ich habe gelernt, in Zügen, Hotels und Wartesälen zu schreiben. Auf den Klapptischchen im Flugzeug. Ich mache mir beim Mittagessen unter dem Tisch Notizen, oder sogar auf der Toilette. Ich schreibe auf Museumstreppen, in Cafés, auf geparkten Autos am Straßenrand. Ich schreibe auf Papierfetzchen, in Notizbücher, auf Postkarten, auf meinen Handrücken, auf Servietten, auf die Seitenränder in Büchern. Meistens kurze Sätze, Skizzen, manchmal schreibe ich auch Stücke aus Zeitungen ab. Es kommt vor, dass mich irgendeine Gestalt in der Menge von meinem Weg abbringt, ich folge ihr eine Zeitlang, fange an zu erzählen. Das ist eine gute Methode, in der ich mich vervollkommnen will. Von einem Jahr aufs andere ist die Zeit meine Verbündete geworden, wie für jede Frau: Ich bin unsichtbar, durchsichtig geworden. Ich kann mich wie ein Geist umherbewegen, Menschen über die Schulter schauen, ihren Streit belauschen, zusehen, wie sie mit dem Kopf auf dem Rucksack schlafen, wie sie mit sich selbst reden, ohne sich meiner Anwesenheit bewusst zu sein, die Lippen bewegen, Worte formulieren, die ich ihnen laut nachspreche.
Sehen ist wissen
Das Ziel meiner Pilgerreise ist immer ein anderer Pilger. Diesmal ist es ein gebrechlicher Pilger, in Stücken.
Hier werden zum Beispiel Knochen gesammelt, aber nur solche, mit denen etwas nicht stimmt: verkrümmte Wirbelsäulen und verdrehte Rippen, die bestimmt aus ebenso verdrehten Körpern gezogen worden sind, um präpariert, getrocknet und zum Schluss mit Lack überzogen zu werden. Eine kleine Nummer gibt einen Hinweis auf die Krankheitsbeschreibung in längst zerbröselten Listen. Wie kurzlebig ist Papier im Vergleich mit Knochen! Man hätte gleich auf Knochen schreiben sollen.
Da ist zum Beispiel ein Oberschenkelknochen, den jemand vorwitzig der Länge nach durchgesägt hat, um zu sehen, was darin steckt. Bestimmt war er enttäuscht, denn er hat beide Teile mit Schnur umwickelt und sie, mit den Gedanken schon bei etwas anderem, zurück in den Schaukasten gelegt.
In diesem Schaukasten befinden sich mehrere Dutzend Menschen, die sich nicht kannten, deren Leben zeitlich und räumlich weit voneinander entfernt stattfanden. Jetzt sind sie gemeinsam in diesem schönen, geräumigen, trockenen und gut beleuchteten Grab zur musealen Ewigkeit verurteilt; die Knochen, die auf ewig in der Erde stecken, beneiden sie bestimmt darum. Und manche von ihnen – die Knochen der Katholiken – machen sich vielleicht Sorgen darüber, wie sich alle am Tag des Jüngsten Gerichts wiederfinden werden, wie sie sich so versprengt wieder zu dem Körper zusammenfinden sollen, der Sünden begangen und gute Taten vollbracht hat.
Schädel mit allen nur vorstellbaren Strukturen, durchschossen, durchlöchert, geschrumpft. Vom Rheumatismus befallene Handknochen. Mehrfach gebrochene Arme, die ohne Hilfe wieder zusammengewachsen sind, so, wie es sich gerade fügte, ein versteinerter vieljähriger Schmerz.
Lange Knochen, die zu kurz sind, und kurze Knochen, die zu lang sind, tuberkulös, von Veränderungen gezeichnet, als hätte ein Borkenkäfer an ihnen genagt.
Arme Menschenschädel in beleuchteten viktorianischen Glaskästen, wo sie die eigenen Zähne demonstrativ blecken. Der eine hat zum Beispiel mitten in der Stirn ein großes Loch, aber schöne Zähne. Man fragt sich, ob dieses Loch tödlich war. Nicht unbedingt. Es gab einmal einen Eisenbahningenieur, dem eine Eisenstange das Gehirn durchbohrte und der trotz dieser Verletzung noch viele Jahre lebte. Diesen Fall machte sich selbstverständlich die Neuropsychologie zunutze und erklärte, der Sitz unseres Seins sei im Gehirn. Der Verletzte starb nicht, veränderte sich aber stark. Er wurde – wie man so sagt – ein anderer. Denn es hängt vom Gehirn ab, wie wir sind, deshalb wollen wir gleich nach links abbiegen, in den Gang mit den Gehirnen. Da sind sie! Cremefarben liegen sie in der Lösung, große und kleine, geniale und solche, die nicht bis zwei zählen konnten.
Weiter hinten liegt das Revier der Föten, der Menschen im Miniaturformat. Kleine Püppchen, Präparatchen, alles im Miniaturformat, so passt ein ganzer Mensch in ein kleines Glas. Die Allerjüngsten, die Embryonen, die man fast nicht sehen kann, sind kleine Fischchen, Fröschchen, die an einem Rosshaar im Formaldehyd hängen. Die Größeren veranschaulichen uns die Ordnung des menschlichen Körpers, in dem alles so wunderbar verpackt ist. Nicht menschgewordene Würmchen, semihominidale Winzlinge, deren Leben nie die magische Grenze des Potentiellen überschritt. Sie haben eine Gestalt, doch in den Geist sind sie noch nicht hineingewachsen – vielleicht ist die Gegenwart des Geistes irgendwie mit der Größe der Gestalt verbunden. In ihnen hat die Materie angefangen, sich in schläfriger Unbeirrbarkeit zu Leben zu fügen, Gewebe anzusammeln, Verbindungen zwischen den Organen herzustellen, ein festes Netz zu bilden, schon hat die Arbeit am Auge begonnen, sich die Lunge vorbereitet, obwohl Licht und Luft weit weg sind.
In der nächsten Reihe die gleichen Organe, doch ausgewachsen, glücklich, dass die Umstände ihnen gewogen waren und sie ihre volle Größe erreichen konnten. Ihre Formen? Woher wussten sie, wie groß sie sein sollten, wann sie aufzuhören hatten? Manche wussten es nicht, sie wuchsen und wuchsen, und die braven Professoren hatten Mühe, ein Glas zu finden, das groß genug war. Umso schwerer kann man sich vorstellen, wie sie im Bauch des Mannes Platz fanden, dessen Initialen auf dem Etikett vermerkt sind.
Ein Herz. Sein ganzes Geheimnis ist ein für alle Mal offengelegt: Es ist dieser unförmige Klumpen, faustgroß und schmutzigweiß. Das ist nämlich die Farbe unseres Körpers, grau-cremeweiß, graubraun, hässlich, das darf man nicht vergessen. Weder in unserem Haus noch in unserem Auto würden wir eine solche Farbe sehen wollen. Das ist die Farbe des Inneren, der Dunkelheit, der Orte, wo die Sonne nicht eindringt, wo sich die Materie im Feuchten vor fremden Blicken verbirgt, da muss sie sich nicht mehr zur Schau stellen. Nur mit dem Blut kann sie sich noch Eskapaden leisten. Das Blut soll warnen, sein Rot soll der Alarm sein, dass die Muschel des Körpers sich geöffnet hat, dass die Geschlossenheit des Gewebes unterbrochen ist.
In Wirklichkeit haben wir im Innern gar keine Farbe. Wenn alles Blut aus dem Herzen gespült ist, sieht es genau so aus: wie ein Schleimklumpen.
Sieben Jahre Reisen
Jedes Jahr eine Reise, seit sieben Jahren, seitdem wir geheiratet haben«, erzählte ein junger Mann im Zug. Er trug einen eleganten langen schwarzen Mantel und hatte ein schwarzes Köfferchen bei sich, das aussah wie ein feiner Besteckkasten.
»Wir haben viele Fotos«, erklärte er. »Alle der Reihe nach geordnet. Südfrankreich, Tunesien, Türkei, Italien, Kreta, Kroatien, sogar Skandinavien.« In der Regel schauen sie die Bilder mehrmals an: zuerst mit der Familie, dann bei der Arbeit, dann mit Freunden, und danach liegen die Fotos jahrelang wohlverwahrt in Plastikhüllen, wie Beweisstücke im Schrank eines Detektivs: »Wir sind dort gewesen.«
Er wurde nachdenklich und schaute aus dem Fenster. Draußen entflohen die Landschaften, werweißwohin hastend. Dachte er nicht manchmal darüber nach, was das heißt: »Wir sind gewesen«? Wohin sind die zwei Wochen in Frankreich, die sich heute mit Mühe in ein paar Erinnerungen quetschen lassen: plötzlicher Hunger an der Stadtmauer eines mittelalterlichen Orts und ein Augenblick, eines Abends in einem Lokal, unter einem weinberankten Dach. Was ist von Norwegen übrig geblieben? Nur die Kälte des Wassers in einem See und ein Tag, der nicht zu Ende gehen wollte, und dann noch die Freude über das Bier, das man kurz vor Geschäftsschluss hatte erstehen können, oder der umwerfende erste Blick auf einen Fjord.
»Was ich gesehen habe, das gehört mir«, erklärte der Mann zusammenfassend, dabei lebte er plötzlich auf und schlug sich begeistert auf die Schenkel.
Eine Prophezeiung von Cioran
Ein anderer Mensch, der sanftmütig und schüchtern war, nahm immer ein Buch mit ganz kurzen Texten von Cioran auf seine Dienstreisen mit. Im Hotel hatte er das Buch auf seinem Nachttisch liegen, und gleich nach dem Aufwachen schlug er es auf gut Glück auf, um sein Motto für den neuen Tag zu finden. Seiner Meinung nach sollten die Bibeln in europäischen Hotels schleunigst gegen Cioran ausgetauscht werden. Von Rumänien bis Frankreich. Denn was Prophezeiungen anging, hatte die Bibel ihre Aktualität verloren. Was sollte einem beispielsweise der folgende Vers sagen, wenn man ihn an irgendeinem Freitag im April oder einem Mittwoch im Dezember aufschlagen würde: »Bei allen Geräten der Wohnung zu all ihrem Bedarf, und alle Pflöcke dazu, und alle Pflöcke des Hofes seien von Kupfer«. Wie sollten wir das verstehen? Es müsse übrigens gar nicht unbedingt Cioran sein, erklärte er. Er sah mich herausfordernd an.
»Bitte, schlagen Sie etwas anderes vor«, sagte er.
Mir fiel nichts ein. Da zog er das dünne abgewetzte Büchlein aus seinem Rucksack, schlug es willkürlich irgendwo auf, und sein Gesicht strahlte:
»Statt auf die Gesichter der Vorübergehenden achtzugeben, beobachtete ich ihre Füße – all diese Erregten schrumpften gleichsam zusammen zu dahineilenden Schritten – wohin eilten sie? Und es wurde mir klar, dass unsere Sendung drin besteht, den Staub zu streifen auf der Suche nach einem Geheimnis, dem jeder Ernst abgeht«, las er befriedigt vor.
Kunicki. Wasser I
Es ist Vormittag, die Uhrzeit weiß er nicht genau, er hat nicht auf die Uhr geschaut, aber er wartet höchstens seit einer Viertelstunde – meint er. Er lehnt sich bequem in den Sitz zurück und schließt die Augen. Die Stille ist durchdringend wie ein hoher unablässiger Ton, es ist unmöglich, die Gedanken zu sammeln. Noch weiß er nicht, dass die Stille wie ein Alarm klingt. Er schiebt den Fahrersitz zurück und streckt die Beine aus. Sein Kopf wird schwer, den Körper zieht es hinterher in diese Schwere, er sinkt in die erhitzte weiße Luft. Er wird sich nicht rühren, er wartet.
Sicher raucht er eine Zigarette, vielleicht sogar zwei. Nach ein paar Minuten steigt er aus dem Auto und pinkelt in den Graben. Kein einziges Auto schien in der Zwischenzeit vorbeigekommen zu sein, aber jetzt ist er sich nicht mehr so sicher. Er steigt wieder ins Auto und trinkt Wasser aus der Plastikflasche. Allmählich wird er ungeduldig. Er drückt heftig auf die Hupe, und der ohrenbetäubende Ton lässt eine Zorneswelle aufbrausen, die ihn rasch holt. Mit einem Mal sieht er alles deutlicher: Er macht sich auf, über den Pfad ihnen hinterher und denkt sich unwillkürlich schon die Worte aus, die er gleich sagen wird: »Mensch, was zum Teufel machst du so lange? Was treibst du da?«
Der Olivenhain ist knochentrocken. Das Gras knistert unter den Sohlen. Zwischen den knorrigen Olivenbäumen wachsen wilde Brombeeren: Junge Ranken schieben sich auf den Pfad und greifen nach seinen Füßen. Überall liegt Abfall: Papiertaschentücher, schmutzige Binden, fliegenübersäte menschliche Exkremente. Manche Leute entleeren sich gleich auf dem Weg, machen sich nicht mal die Mühe, ins Gebüsch zu gehen, sogar hier haben sie es eilig.
Kein Wind. Keine Sonne. Der reglose weiße Himmel wirkt wie ein Zelt. Es dampft. Kleine Wassertröpfchen zersprühen in der Luft, überall riecht man das Meer – elektrisch, ozonhaltig, fischig.
Er sieht, dass sich etwas bewegt, aber nicht dort zwischen den Bäumen, sondern auf dem Weg, zwischen seinen Füßen. Ein riesiger schwarzer Käfer krabbelt auf dem Pfad. Einen Augenblick streckt er die Fühler prüfend in die Luft, hält inne, offenbar spürt er die Anwesenheit eines Menschen. Der weiße Himmel spiegelt sich als milchiger Fleck in seinem makellosen Panzer, und Kunicki hat ganz kurz das Gefühl, als schaue ihn ein einzelnes Auge aus der Erde an, das zu keinem Körper gehört, ein frei schweifendes, unbeteiligtes Auge. Kunicki stößt die Spitze seiner Sandale leicht in die Erde. Der Käfer eilt über den Pfad, raschelt im ausgedörrten Gras. Verschwindet im Brombeergebüsch. Sonst nichts.
Fluchend kehrt Kunicki zum Auto zurück, unterwegs hat er noch die Hoffnung, dass sie mit dem Jungen auf irgendeinem Umweg zurückgekommen und schon dort ist, ja er ist ganz sicher, dass das so sein wird. »Stundenlang suche ich nach euch!«, wird er ihnen sagen. »Was zu Teufel habt ihr getrieben?«
Sie sagte: Halt an. Als er anhielt, stieg sie aus und öffnete die hintere Tür. Sie löste den Gurt des Kindersitzes, nahm den Kleinen an die Hand und ging mit ihm davon. Kunicki hatte keine Lust auszusteigen, er war müde und schläfrig, obwohl sie erst ein paar Kilometer gefahren waren. Er sah sie nur aus dem Augenwinkel, ohne darauf zu achten, er wusste nicht, dass er besser genau hätte hinschauen sollen. Jetzt versucht er, sich dieses verschwommene Bild in Erinnerung zu rufen, es scharf zu stellen und näher zu holen, zu halten. Da sieht er sie von hinten, wie sie über den knirschenden Pfad gehen. Sie trägt eine helle Leinenhose, glaubt er, und ein schwarzes T-Shirt, der Kleine ein Trikothemd mit einem Elefanten darauf, das weiß er genau, denn er hat es ihm am Morgen selbst angezogen. Im Gehen reden die beiden miteinander, er hat nicht zugehört, er wusste nicht, dass er besser zugehört hätte. Sie verschwinden zwischen den Olivenbäumen. Er weiß nicht, wie lange das dauert, bestimmt nicht lange. Eine Viertelstunde, vielleicht ein wenig mehr, er vertut sich leicht mit der Zeit, er hat nicht auf die Uhr geschaut. Er wusste nicht, dass er besser auf die Zeit geachtet hätte. Er hasste es, wenn sie ihn fragte: Woran denkst du? An nichts, sagte er dann immer, aber sie glaubte ihm nicht. Man kann nicht nicht denken, sagte sie dann und war beleidigt. Aber klar! Kunicki empfand so etwas wie Genugtuung, er schaffte das – an nichts zu denken. Er kann das.
Doch dann bleibt er plötzlich mitten im Brombeerdickicht stehen, erstarrt, als hätte sein Körper im Bücken nach einem Brombeerstrunk wider Willen einen neuen Mittelpunkt seines Gleichgewichts gefunden. Das Summen der Fliegen und ein Dröhnen im Kopf begleiten die Stille. Einen Augenblick lang sieht er sich selbst von oben: ein Mann in alltäglichen Khakihosen und weißem Hemd, mit einer kleinen Glatze oben auf dem Kopf, der in dem kleinen, niedrigen Dickicht steht, ein Eindringling, ein Gast in einem fremden Haus. Ein dem Beschuss ausgesetzter Mensch, ein Ausgelieferter genau in der Mitte eines vorübergehenden Waffenstillstands in der Schlacht, in die der glühende Himmel und die schrundige Erde verstrickt sind. Angst überfällt ihn, er möchte sich sofort verstecken, im Auto verkriechen, doch sein Körper ignoriert ihn, er kann die Beine nicht rühren, kann sie nicht zwingen, sich in Bewegung zu setzen. Nur einen Schritt tun – er hat das nie für so schwer gehalten, die Übertragungsleitungen sind gerissen. Sein Fuß in der Sandale ist ein Anker, der ihn auf der Erde hält, er steckt fest. Konzentriert, mit Mühe, über sich selbst erstaunt zwingt er ihn zur Bewegung. Anders kann er diesen glühenden grenzenlosen Raum nicht verlassen.
Sie waren am 14. August angekommen. Die Fähre von Split war voll besetzt, ziemlich viele Touristen, aber die meisten waren Einheimische, die auf dem Festland eingekauft hatten, denn dort war es billiger. Auf den Inseln gibt es nicht viel anzubauen. Die Touristen ließen sich leicht erkennen, denn als sich die Sonne anschickte, unweigerlich ins Meer zu versinken, gingen sie alle nach Backbord und richteten ihre Objektive auf sie. Die Fähre passierte langsam die verstreuten Inseln, dann sah es kurze Zeit so aus, als führe sie aufs offene Meer hinaus. Ein unangenehmes Gefühl, einen ganz kurzen, unbedeutenden Augenblick lang machte sich Panik bemerkbar.
Problemlos fanden sie ihre direkt am Meer gelegene Pension namens »Poseidon«. Der Besitzer, der bärtige Branko in einem Hemd mit Muschelmuster, ließ sich gleich beim Vornamen nennen und klopfte Kunicki vertraulich auf die Schulter, während er sie in den ersten Stock des Hauses führte und stolz die Wohnung präsentierte. Sie hatten zwei Schlafzimmer zur Verfügung, eine kleine, traditionell eingerichtete Küchenecke mit Schränken aus laminiertem Pressspan. Aus den Fenstern sah man direkt auf den Strand und das offene Meer. Unter einem Fenster war eine Agave erblüht, die Blüte saß auf dem starken Stängel und reckte sich triumphierend über das Wasser.
Er nimmt eine Karte der Insel hervor und erwägt die Möglichkeiten. Vielleicht hatte sie die Orientierung verloren und war einfach an einer anderen Stelle auf die Fahrstraße gestoßen. Bestimmt steht sie woanders, stoppt vielleicht sogar ein Auto und fährt damit weg – aber wohin? Er sieht auf der Karte, dass die Landstraße auf Vis in einer gewundenen Linie über die ganze Insel führt und dass man darauf die Insel durchqueren kann, ohne einmal ans Meer zu kommen. So hatten sie selbst vor ein paar Tagen eine Tour über Vis gemacht. Er legt die Karte zu ihrer Tasche auf den Beifahrersitz und fährt los. Er fährt langsam, hält zwischen den Olivenbäumen nach ihnen Ausschau. Doch etwa nach einem Kilometer ändert sich die Landschaft, die Olivenhaine weichen steinigem Ödland, das mit trockenem Gras und Brombeergestrüpp bedeckt ist. Die weißen Kalksteinbrocken sind schartig wie Riesenzähne, die irgendein wildes Geschöpf hier verloren hat. Nach einigen Kilometern kehrt er um. Zu seiner Rechten sieht er jetzt verblüffend grüne Weingärten, in denen hier und da kleine Gerätehütten aus Stein stehen – alles leer und düster. Im besten Fall hat sie sich verirrt, vielleicht ist ihr auch schlecht geworden, oder aber dem Kleinen, es ist ja so schwül und heiß. Vielleicht brauchen sie Hilfe, und anstatt etwas zu tun, gondelt er die Landstraße hinauf und hinunter. Ach, wie dumm er ist, das begreift er erst jetzt. Sein Herz schlägt heftiger. Vielleicht hat sie einen Sonnenstich. Oder ein Bein gebrochen.
Er geht zurück und hupt ein paarmal. Zwei deutsche Autos kommen vorbei. Er schaut auf die Uhr: Ungefähr anderthalb Stunden sind schon vergangen, das heißt, dass die Fähre schon weg ist. Sie hat die Autos verschluckt, die Tore geschlossen und ist in See gestochen, ein mächtiger weißer Dampfer. Mit jeder Minute liegt ein größerer Streifen gleichgültiges Meer zwischen ihnen und der Fähre. Kunicki hat eine düstere Ahnung, von der ihm der Mund ganz trocken wird, eine Ahnung von etwas, das mit dem Abfall auf dem Pfad zusammenhängt, mit den Fliegen und den menschlichen Exkrementen. Er begreift. Sie sind umgekommen. Beide sind sie verschwunden. Er weiß, dass sie nicht in dem Olivenhain sind, trotzdem läuft er über den ausgedörrten Pfad dorthin und ruft nach ihnen, obwohl er schon gar nicht mehr glaubt, dass sie antworten werden.
Jetzt ist Siesta, die kleine Stadt ist so gut wie ausgestorben. Am Strand gleich neben der Fahrstraße lassen drei Frauen einen hellblauen Drachen steigen. Beim Parken kann er sie genau sehen. Eine von ihnen trägt eine cremefarbene Hose, die ihre dicken Gesäßbacken eng umspannt.
Er findet Branko an einem Tisch in dem kleinen Café. Dort sitzt er mit zwei anderen Männern. Sie trinken Obstler mit Eis, wie Whisky. Branko lächelt überrascht, als er ihn sieht.
»Hast du was vergessen?«, fragt er.
Sie bieten ihm einen Stuhl an, aber er will sich nicht setzen. Er will alles der Reihe nach erzählen, geht zu Englisch über, während er gleichzeitig in einem anderen Teil seines Kopfes nachdenkt, wie man jetzt vorgehen würde, wenn das Ganze ein Film wäre. Er sagt, sie seien verschwunden, Jagoda und der Kleine. Er sagt, wo und wann. Er sagt, dass er sie gesucht hat und sie nicht gefunden hat.
»Habt ihr euch gestritten?«
Fragt Branko.
Er verneint, wahrheitsgemäß. Die beiden Männer trinken von ihrem Obstler. Er hätte auch Lust darauf. Im Mund spürt er den scharf-süßlichen Geschmack. Langsam räumt Branko seine Zigaretten und Streichhölzer vom Tisch. Die beiden anderen stehen auf, widerspenstig, als wollten sie sich vor einem Kampf konzentrieren, vielleicht wollen sie aber auch nur hier im Schatten der Markise sitzen bleiben. Alle wollen zu der Stelle fahren, aber Kunicki beharrt darauf, dass erst die Polizei benachrichtigt werden muss. Branko zögert. Hier und da scheint ein graues Haar durch seinen schwarzen Bart. Auf dem gelben T-Shirt prangt das Bild einer roten Muschel und die Aufschrift »Shell«.
»Vielleicht ist sie ans Meer gegangen?«
Vielleicht. Sie beschließen, dass Branko und Kunicki zurück an die Stelle fahren, die beiden anderen gehen auf die Wache, um in Vis anzurufen. Branko erklärt, dass in Komiża nur ein Polizist stationiert ist, die richtige Wache ist in Vis. Auf dem Tisch lassen sie die Gläser mit den schmelzenden Eiswürfeln zurück.
Kunicki erkennt die kleine Bucht, wo er zuvor gestanden hat, sofort wieder. Ihm scheint es Ewigkeiten her zu sein, die Zeit fließt jetzt anders, sie ist zäh und herb, setzt sich aus Einzelsequenzen zusammen. Hinter den weißen Wolken kommt die Sonne hervor, auf einmal wird es heiß.
»Hup mal!«, sagt Branko, und Kunicki drückt auf die Hupe.
Ein langgezogener klagender Laut ertönt, wie von einem Tier. Er verstummt, zerfällt zu den Miniaturechos der Zikadenklänge.
Sie dringen in den Olivenhain vor, rufen sich hin und wieder etwas zu. Erst am Weingarten treffen sie wieder zusammen, nach kurzer Beratung beschließen sie, auch diesen ganz zu durchkämmen. Sie schreiten die schattigen Reihen ab und rufen nach der verschwundenen Frau: Jagoda! Jagoda! Kunicki wird sich der Bedeutung des Namens bewusst – Beere –, die war ihm ganz entfallen. Plötzlich hat er das Gefühl, an einem uralten, obskuren und grotesken Ritual teilzunehmen. Von den Weinstöcken hängen pralle dunkelviolette Trauben, perverse Ballungen von Brustwarzen, und er irrt in dem belaubten Labyrinth umher und schreit »Jagoda, Jagoda!«. An wen ist das gerichtet? Wen sucht er?
Er muss kurz stehen bleiben, er hat Seitenstechen, krümmt sich zwischen den Weinranken. Er taucht den Kopf in die schattige Kühle, die vom Laub gedämpfte Stimme Brankos verstummt, und Kunicki hört jetzt das Summen der Fliegen – den vertrauten Grundton der Stille.
Hinter diesem Weingarten beginnt der nächste, vom ersten nur durch einen schmalen Pfad getrennt. Sie bleiben stehen, und Branko macht einen Anruf von seinem Mobiltelefon. Er sagt mehrmals die beiden Worte »Zena« und »dijete« – »Frau« und »Kind« –, mehr kann Kunicki nicht verstehen. Die Sonne wird orange, wird groß und aufgedunsen, man kann zusehen, wie sie kraftloser wird. Gleich kann man ihr direkt ins Gesicht sehen. Die Weingärten nehmen jetzt ein tiefes Dunkelgrün an. Zwei menschliche Gestalten stehen ratlos in diesem Meer aus grünen Streifen.
Als es dämmert, haben sich bereits mehrere Autos und ein Männergrüppchen an der Landstraße eingefunden. Kunicki sitzt in einem Auto mit der Aufschrift »Polizei« und beantwortet mit Brankos Hilfe die ihm chaotisch erscheinenden Fragen des dicken, verschwitzten Polizisten. Er spricht in einem einfachen Englisch: »We stopped. She went out with the child. They went right, here.« Er zeigt die Richtung mit der Hand. »I was waiting, let’s say fifteen minutes. Then I decided to go and look for them. I couldn’t find them. I didn’t know what had happened.« Sie geben ihm lauwarmes Mineralwasser, er trinkt gierig. »They are lost.« Kurz darauf sagt er noch einmal: »Lost.« Der Polizist wählt eine Nummer auf dem Handy. »It is impossible to get lost here, my friend«, sagt er zu ihm. Dieses »my friend« kommt Kunicki merkwürdig vor. Dann meldet sich das Walkie-Talkie. Noch eine Stunde vergeht, bis sie in offener Schwarmlinie ins Innere der Insel aufbrechen.
Unterdessen sinkt die Sonne langsam über dem Weingarten, und als sie den Kamm erreichen, sieht man, dass sie schon das Meer berührt. Sie werden unfreiwillige Zeugen ihres theatralischen langen Untergangs. Schließlich schalten sie ihre Taschenlampen an. Es ist schon dunkel, als sie auf den hohen, felsigen Küstenstreifen der Insel kommen, wo zahlreiche Buchten sind. Sie steigen in zwei Buchten hinab, um nachzufragen. In kleinen Steinhäusern wohnen dort etwas exzentrischere Touristen, die keine Hotels mögen und dafür lieber etwas mehr bezahlen, um weder fließendes Wasser noch Strom zu haben. Sie bereiten ihr Essen auf Steinöfen zu, manche haben auch Gasflaschen mitgebracht. Sie fangen Fische, die direkt vom Meer auf den Grill wandern. Nein, niemand hat eine Frau mit einem Kind gesehen. Gleich gibt es bei ihnen Abendessen, Brot, Käse, Oliven und die armen Fische, die sich am Nachmittag noch ihren sorglosen Spielen im Meer hingegeben haben. Immer wieder ruft Branko im Hotel in Komiøa an – Kunicki bittet ihn darum, weil er sich nur vorstellen kann, dass sie sich verirrt hat und schließlich doch auf einem anderen Weg dorthin zurückgelangt. Doch nach jedem Anruf klopft Branko ihm nur wortlos auf die Schulter.
Gegen Mitternacht löst sich die Gruppe der Männer langsam auf. Auch die beiden, die Kunicki am Cafétisch in Komiża gesehen hat, sind dabei. Jetzt erst, beim Abschiednehmen, stellen sie sich vor: Drago und Roman. Zusammen gehen sie zum Auto. Kunicki ist ihnen für ihre Hilfe dankbar, er weiß nicht, wie er es ausdrücken soll, er hat vergessen, was auf Kroatisch »danke« heißt. Wahrscheinlich ein dem Polnischen entfernt ähnelndes Wort. Mit einem bisschen guten Willen müsste man eigentlich eine slawische Verständigungsform entwickeln können, eine Zusammenstellung ähnlicher praktischer slawischer Wörter, die man ohne Grammatik benutzen könnte, anstatt sich einer hölzernen und simplifizierten Version des Englischen zu bedienen.
In der Nacht legt ein Boot an dem Haus an, wo er wohnt. Sie müssen evakuiert werden, es gibt eine Überschwemmung. Das Wasser reicht schon bis zum ersten Stockwerk der Häuser. In der Küche dringt es durch die Fugen zwischen den Kacheln und strömt in warmen Bächen aus den Steckdosen. Die Bücher sind von der Nässe schon aufgequollen. Er öffnet eines und sieht, dass die Buchstaben wie Schminke zerfließen und verschmierte leere Seiten hinterlassen. Es stellt sich heraus, dass alle schon mit dem letzten Transport fortgefahren sind, nur er ist zurückgeblieben.
Im Schlaf hört er Tropfen, die vereinzelt vom Himmel fallen und kurz darauf zu einem heftigen kurzen Wolkenbruch werden.
Benedictus, qui venit
April auf der Autobahn, rote Sonnenstreifen auf dem Asphalt, eine vom Regen wie mit sorgfältig aufgetragenem Zuckerguss überzogene Welt – ein Osterkuchen. Es ist Karfreitag, irgendwo zwischen Belgien und Holland bin ich mit dem Auto unterwegs, ich weiß nicht genau, in welchem Land ich bin, die Grenze ist verschwunden, hat sich verwischt, wird nicht mehr gebraucht. Im Radio wird ein Requiem übertragen. Beim Benedictus leuchten plötzlich entlang der Autobahn die Lampen auf, als wollten sie den mir unfreiwillig übers Radio erteilten Segen wirksam werden lassen.
Eigentlich kann es aber auch nur daran gelegen haben, dass ich nun in Belgien angelangt war, wo man alle Autobahnen reisefreundlich zu beleuchten pflegt.
Panoptikum
Das Panoptikum und die Wunderkammer sind, wie ich einem Museumsführer entnahm, ein etabliertes Paar, das einen Vorläufer der Museen darstellt. Dort zeigte man alle möglichen gesammelten Kuriositäten, die die Eigentümer von ihren Reisen nach nah und fern mitgebracht hatten.
Man sollte nicht vergessen, dass Bentham sein geniales System zur Überwachung von Gefangenen auch als Panoptikum bezeichnete: Er plante eine Anlage, die räumlich so gestaltet war, dass jeder Gefangene jederzeit beobachtet werden konnte.
Kunicki. Wasser II
So groß ist die Insel ja nun auch wieder nicht«, sagt Djudzica am nächsten Morgen zu Branko, als sie ihm einen starken schwarzen Kaffee einschenkt.
Alle wiederholen diese Worte wie ein Mantra. Kunicki versteht, was sie sagen wollen, er weiß ja selbst, dass die Insel so klein ist, dass man nicht darauf verloren gehen kann. Die Insel ist nur zehn Kilometer lang, und es gibt zwei größere Orte darauf: Vis und Komiża. Man kann sie Zentimeter für Zentimeter durchsuchen, wie eine Schublade. Und in bei-den Orten kennen sich alle. Die Nächte sind warm, auf den Feldern wächst der Wein, die Feigen sind fast schon reif. Selbst wenn sie sich verirrt hätten, würde ihnen nichts zustoßen, sie würden weder verhungern noch erfrieren und auch nicht Opfer wilder Tiere werden. Sie würden eine warme Nacht im trockenen, sonnenerhitzten Gras verbringen, unter den Zweigen eines Olivenbaums und beim schläfrigen Rauschen des Meeres. Von keiner Stelle aus sind es mehr als drei, vier Kilometer zur Landstraße. Auf den Feldern stehen Steinhütten, wo die Weinfässer aufbewahrt werden, manchmal sind auch Essen und Kerzen da. Zum Frühstück nehmen sie sich eine Handvoll reife Weintrauben oder bekommen bei den Sommergästen in einer der Buchten eine richtige Mahlzeit.
Sie gehen hinunter zum Hotel, wo schon ein Polizist auf sie wartet, diesmal ist es ein anderer, jüngerer. Einen Augenblick lang hat Kunicki die Hoffnung, dass er gute Nachrichten hat, aber der Polizist fragt nur nach seinem Pass. Alle Angaben schreibt er ganz genau auf, sagt, dass sie jetzt auch auf dem Festland nach den beiden suchen werden, in Split. Und auf den benachbarten Inseln.
»Vielleicht sind sie übergesetzt«, erklärt er.
»Sie hatte kein Geld. No money. Alles ist hier drin.« Kunicki zeigt die Tasche und zieht ihr Portemonnaie heraus, es ist rot und mit kleinen Perlen bestickt. Er öffnet es und hält es dem Polizisten unter die Nase.
Der zuckt mit den Schultern und notiert seine Adresse in Polen.
»Wie alt ist das Kind?«
»Drei«, sagt Kunicki.
Sie fahren über eine Serpentinenstraße an dieselbe Stelle, der Tag verspricht heiß und klar zu werden, erleuchtet wie ein Dia. Am Mittag wird das Bild ganz daraus verschwinden. Kunicki denkt über die Möglichkeit nach, die Insel von oben zu betrachten, aus einem Hubschrauber, sie ist ja fast kahl. Er denkt auch an Erkennungschips, wie sie Vögeln eingesetzt werden, Kranichen und Störchen, aber für Menschen gibt es keine. Alle sollten so einen Chip haben, zu ihrer eigenen Sicherheit. Später könnte man dann alle ihre Bewegungen im Internet verfolgen: Strecken, Begegnungen, Verirrungen. Wie viele könnten vorm Tod gerettet werden! Er sieht einen Computerbildschirm vor sich, darauf bunte Linien, die Menschen bezeichnen, lauter Spuren, Zeichen. Kreise und Ellipsen, Labyrinthe. Vielleicht auch Endlosschleifen, vielleicht missratene Spiralen, die plötzlich abbrechen.
Ein Hund ist da, ein schwarzer Schäferhund, sie halten ihm ihren Pullover vom Rücksitz vor die Nase. Der Hund schnüffelt um das Auto herum, dann schlägt er den Pfad zwischen den Olivenbäumen ein. Kunicki fühlt plötzlich, wie neue Energie in ihm erwacht, gleich wird sich alles aufklären. Sie laufen hinter dem Hund her. Der Schäferhund bleibt an einer Stelle stehen, offenbar haben sie hier ihre Notdurft verrichtet, obwohl man keine Spur davon sieht. Er bleibt stehen, mit sich zufrieden – aber wir sind noch nicht fertig, Hund! Wo sind die Leute, wohin sind sie gegangen? Der Hund versteht nicht, was sie von ihm wollen, aber nach kurzem Zögern bewegt er sich weiter, biegt seitlich ab, Richtung Straße, weg von den Weingärten.
Dann ist sie an der Straße entlang gegangen, denkt Kunicki. Sie muss sich vertan haben. Sie mochte weiter unten an der Straße herausgekommen sein und auf ihn gewartet haben. Aber hatte sie die Hupe nicht gehört? Und dann? Vielleicht hatte jemand sie mitgenommen – doch wohin, da sie ja nicht aufzufinden waren? Jemand. Eine unscharfe, verschwommene breitschultrige Gestalt. Ein schwerer Nacken. Entführung. Hatte er sie geknebelt und in den Kofferraum verfrachtet? Dann hatte er sie mit der Fähre aufs Festland gebracht, und jetzt sind sie schon in Zagreb oder München oder werweißwo. Aber wie konnte er mit zwei bewusstlosen Menschen die Grenze überqueren?
Nun biegt der Hund in eine leere Schlucht ein, die schräg von der Straße abgeht, eine lange steinige Rinne, die läuft er hinab, über das Geröll. Dort fängt ein schmaler, verwilderter alter Weingarten an, darin steht ein kleines, mit rostigem Wellblech gedecktes Steinhäuschen, das an einen Kiosk erinnert. Vor der Tür liegt ein Haufen vertrockneter Traubenpergel, wahrscheinlich zum Verbrennen. Der Hund läuft im Kreis um das Haus, kehrt dann zur Tür zurück. Doch die Tür ist mit einem Vorhängeschloss versperrt, sie schauen alle verdutzt. Der Wind hat Reisig auf die Schwelle geweht, man sieht, dass hier niemand hineingegangen ist. Der Polizist schaut durch die schmutzige Scheibe ins Innere und rüttelt dann an der Scheibe. Er rüttelt immer fester und fester, bis sie nachgibt. Alle schauen hinein, Modergeruch schlägt ihnen entgegen und der Geruch nach Meer, der allgegenwärtige.
Die Walkie-Talkies rauschen, der Hund bekommt zu trinken, dann lässt man ihn wieder an dem Pullover schnüffeln. Jetzt macht er drei Runden um das Haus, kehrt zum Weg zurück, trabt nach kurzem Zögern auf dem Weg weiter, auf ein paar kahle Felsen zu, nur mit einzelnen Grasbüscheln bewachsen. Tief unten am Abhang sieht man das Meer. Dort bleiben alle Sucher stehen, das Gesicht dem Wasser zugewandt.
Der Hund hat die Spur verloren, kehrt zurück, legt sich schließlich mitten auf den Pfad.
»To je zato jer je po noci padala kisa«, sagt jemand auf Kroatisch, und Kunicki versteht genau, dass es um den Regen geht, der in der Nacht gefallen ist.
Branko lädt ihn zu einem späten Mittagessen ein. Die Polizisten bleiben zurück, sie fahren nach Komiża. Sie reden kaum ein Wort. Kunicki kann sich denken, dass Branko nicht weiß, was er sagen soll, dazu noch in einer fremden Sprache, auf Englisch. Nun gut, er braucht nichts zu sagen. In einem Restaurant direkt am Meer bestellen sie gebratenen Fisch. Eigentlich ist es kein Restaurant, es ist die Küche von Brankos Bekannten. Hier sind alle seine Bekannten, sie sehen sich sogar ähnlich, ihre Gesichtszüge sind irgendwie schärfer, die Gesichter wie vom Wind gegerbt, ein Stamm der Seewölfe. Branko schenkt ihm Wein ein, redet ihm zu, er soll trinken. Er selbst leert sein Glas in einem Zug. Er lässt nicht zu, dass Kunicki bezahlt. Branko bekommt einen Anruf.
Details of St. Petersburg (1850)
»They manage to get a helicopter, an airplane. Police«, sagt Branko.