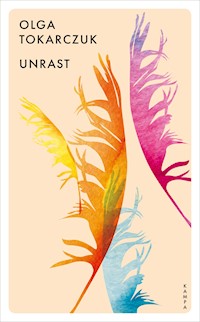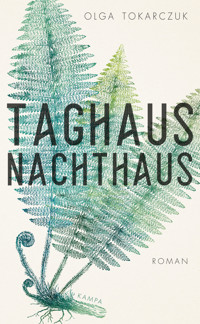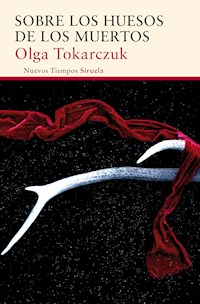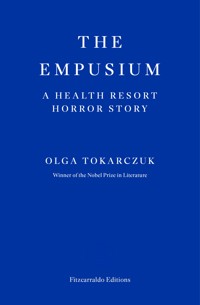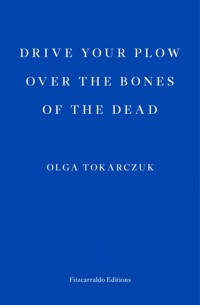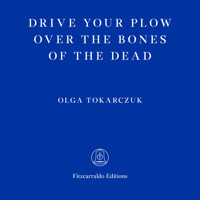Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesen Essays und Reden zeichnet Olga Tokarczuk eine Karte ihrer vielfältigen Interessen und Inspirationen und gewährt uns Einblick in ihr schriftstellerisches Laboratorium. Wie baut sie ihre Geschichten auf? Welcher realistischen und phantastischen Motive bedient sie sich? Wie konstruiert sie ihre Figuren, die so unterschiedliche Gefühle bei den Lesern wecken? Jede dieser essayistischen Exkursionen zeigt uns aber auch ihr Bemühen, die Welt in ihrer unendlichen Komplexität zu begreifen und vermeintlich alltäglichen Dingen einen neuen Sinn zu verleihen. Und so ist dieses Buch eine Einladung, hinter die Kulissen des Werks der Literaturnobelpreisträgerin zu schauen, und zugleich eine große, faszinierende Erzählung über die Welt, in der wir leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Olga Tokarczuk
Übungen im Fremdsein
Essays und Reden
Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann, Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein
Kampa
Ognosie
Der Wanderer
Den Anfang machen möchte ich mit einem Holzstich unbekannter Urheberschaft, den der französische Astronom Camille Flammarion im Jahr 1888 veröffentlichte: Er zeigt einen Wanderer, der an die Grenzen der Welt gelangt ist, der seinen Kopf über die irdische Sphäre hinausstreckt und sich am Anblick eines geordneten und überaus harmonischen Kosmos freut. Seit meiner Kindheit bewundere ich dieses herrlich metaphorische Bild, das mir bei jeder Betrachtung neue Bedeutungen enthüllt. Es definiert das menschliche Wesen vollkommen anders als Leonardo da Vincis weithin bekannte Zeichnung des statischen und triumphalen vitruvianischen Menschen als Maßstab des Universums und seiner selbst.
Bei Flammarion handelt es sich nämlich um einen Menschen in Bewegung, einen Wanderer mit Pilgerstab, Reisemantel und Haube. Und auch wenn wir sein Gesicht nicht sehen, können wir uns doch dessen Ausdruck vorstellen – Faszination wird sich darauf malen, Bewunderung, Staunen über die Harmonie und unfassbare Größe der außerhalb unserer Sichtweite liegenden Welt. Aus unserer Perspektive sind wir lediglich in der Lage, einen Bruchteil der Welt wahrzunehmen, doch jener Wanderer sieht offensichtlich um vieles mehr. Auch haben wir hier deutlich umrissene Sphären, Himmelskörper, Umlaufbahnen, Wolken und Strahlen – die schwer darstellbaren Dimensionen des Universums, die sich gewiss weiter und weiter komplizieren, bis in die Unendlichkeit. Ausdruck des Unbegreiflichen sind auch die ineinandergreifenden Räder; solche Räderwerke begleiteten früher häufig die Engelswesen auf den Illustrationen zur Vision des Ezechiel. Auf der anderen Seite, hinter dem Rücken des Wanderers, befindet sich die Welt mit ihrer Natur, dargestellt durch einen mächtigen Baum und einige andere Pflanzen, und ihrer Kultur, symbolisiert durch die Türme von Städten. Diese Welt erscheint recht konventionell und banal, um nicht zu sagen – langweilig. Der Holzstich beschreibt, wie man sich denken kann, den Endpunkt einer langen Wanderung – dem Wanderer ist gelungen, was nicht vielen vor ihm gelang: Er hat den Rand der Welt erreicht. Und was jetzt?
Mir scheint der geheimnisvolle Holzschnitt unbekannter Provenienz eine ausgezeichnete Metapher für ebenjenen Moment zu sein, an den wir nun alle gelangt sind.
Die Welt ist klein
— im Laufe des vergangenen Jahrhunderts ist sie stark geschrumpft.
Wir haben zahlreiche Pfade ausgetreten, haben uns Wälder und Flüsse angeeignet, Ozeane überquert. Viele von uns haben den subjektiven Eindruck einer Endlichkeit der Welt erlangt. Dieses Gefühl hängt gewiss damit zusammen, dass sich dank der Globalisierung die Distanzen verringern und man jeden Ort auf Erden erreichen kann, vorausgesetzt, man hat die Mittel dazu. Und es hängt mit der leichteren Erkundbarkeit der Welt zusammen – schließlich kann man so gut wie alles im Internet nachschlagen, mit jeder beliebigen Person rasch in Kontakt treten.
Ganz sicher haben wir es hier mit einer neuen historischen Erfahrung des Menschen zu tun – und ich frage mich, wer wohl als Erster dieses Gefühl empfunden hat: dass die Welt im Grunde eher klein und gänzlich erfassbar sei. Vielleicht war es ein Geschäftsmann der neuen Generation, einer derjenigen, die gebakken lucht verkopen, wie die Niederländer sagen – »heiße Luft verkaufen«. Ein Herr Buy-Low-Sell-High, der immer auf Achse ist, der von Kontinent zu Kontinent jettet, einen Pass aus irgendeinem »guten Staat« in der Tasche. Morgens Zürich, abends New York. Und am Wochenende ein Abstecher auf eine warme Insel, wo der Herr ozeanische Träume träumt und seine Sinne mit Kokain schärft. Oder ist es im Gegenteil jemand gewesen, der nie die Grenzen seines Landkreises verlässt und nun seinem Kind Spielzeug aus fernen Landen kauft, gefertigt von Menschen, deren Existenz ihm bis vor Kurzem nicht einmal bekannt war? Das Spielzeug aber wirkt dennoch ganz vertraut und harmlos, es verbirgt seine Exotik hinter einer universalisierten und neutralen Form.
Eine Rolle bei dieser neuen Erfahrung der Kleinheit der Welt spielt gewiss das triste post iterum, die Nachreisetrauer, die uns befällt, wenn wir nach den intensiven Erfahrungen des weiten Reisens nach Hause zurückkehren. Wir meinen, bestimmte Grenzen erreicht oder etwas erlebt zu haben, das uns verwehrt geblieben wäre, wenn wir nicht in ein Zeitalter hineingeboren wären, in dem Reisen mehr bedeutet als Privileg oder Fluch – ein Abenteuer nämlich. Und wenn wir dann unseren Koffer wieder daheim in der Wohnung abgestellt haben, fragen wir uns: War das alles? Ist es das jetzt gewesen? Das ist es also, worum sich alles dreht?
Wir haben den Louvre besucht und die Mona Lisa mit eigenen Augen gesehen. Haben die Pyramiden der Maya bestiegen und versucht, das Drama der verrinnenden Zeit zu erspüren, die erbarmungslos vernichtet, was im Laufe von Jahrtausenden entstand. Haben in tunesischen oder ägyptischen Badeorten unsere Bäuche von der Sonne bescheinen lassen und einen Einheitsbrei von Ethnofood genossen, der ausnahmslos allen schmeckte. Die Steppen der Mongolei, die überfüllten Städte Indiens, der Blick auf den himmelhohen Himalaya …
Selbst wenn wir den einen oder anderen Ort noch nicht besichtigt haben sollten, so lebten wir doch bis zur Pandemie im Bewusstsein der realen Möglichkeit, dies jederzeit zu tun – Prospekte von Reisebüros verzeichneten die sogenannten Destinationen. Die ganze Welt lag fußläufig vor uns, überall hinzugelangen war möglich, wenn wir nur genügend Geld zusammensparten.
Wohl zum ersten Mal in seiner Geschichte macht der Mensch diese eindringliche Erfahrung der Endlichkeit der Welt. An den Abenden verfolgt er das Leben anderer auf den Bildschirmen und Displays seiner schlauen Geräte, sieht Menschen zu, denen er noch vor hundert Jahren niemals begegnet wäre auf seinem Lebensweg. Und während er sie so von Weitem betrachtet, entdeckt er, dass auch das Repertoire an Rollen und Möglichkeiten endlich ist und dass die Menschen einander stärker ähneln, als unsere Vorfahren es je gedacht hätten. Diese nämlich – wir erinnern uns – ließen ihrer Phantasie freien Lauf und malten sich genüsslich das Erscheinungsbild jener Völker aus, die auf jener anderen Seite der Erdkugel leben mochten, von der frühere Reisende so fasziniert waren.
Heute wissen wir – Fernsehen, Kino und Social Media sei Dank –, dass die Menschen in Übersee weder mehrere Köpfe noch ein einziges Bein mit einem großen Fuß oder aber ihr Gesicht vorn auf der Brust haben. Zwar unterscheiden sich die Menschen tatsächlich in ihrer Hautfarbe, ihrer Körpergröße und in manchen Sitten und Gebräuchen, diese Unterschiede jedoch sind – auch das wissen wir inzwischen – verschwindend gering im Vergleich mit den Ähnlichkeiten. Die anderen Menschen in ihren Städten und Ländern, Sprachen und Kulturen funktionieren ganz ähnlich wie wir. Sie lieben, verspüren Sehnsucht, begehren, sorgen sich um die Zukunft, ringen mit der Erziehung ihrer Kinder. Auf dieser fundamentalen Ähnlichkeit gründet sich die rasante Karriere einer neuen Erfindung – der Streamingportale. Der Reisende sieht, dass es im Grunde überall recht ähnlich ist. Es gibt Hotels, man isst von Geschirr, man wäscht sich mit Wasser, kauft den Daheimgebliebenen Souvenirs und Geschenke, die zwar das regionale Kunsthandwerk imitieren, aber dennoch (fast alle) eines gemeinsam haben: die Aufschrift made in China.
Auch ist bekannt, dass uns von jeder Erdenbürgerin, jedem Erdenbürger nur ungefähr sechs andere Personen trennen (nach dem Prinzip: Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der X kennt usw.) und von den Zeiten Christi gerade einmal siebzig Generationen.
Früher einmal war die Welt riesig und mit der Vorstellungskraft nicht zu erfassen – jetzt ist nicht einmal mehr Vorstellungskraft vonnöten, denn alles ist zum Greifen nah, so nah wie das Smartphone in unserer Hand. Früher leuchteten auf den sorgsam erstellten Weltkarten weiße Flecken, die die Phantasie anstachelten und vor menschlicher Hybris warnten. Menschen, die auf Reisen gingen, rechneten stets damit, nicht zurückzukommen. Vor einer Reise setzte man vorsorglich sein Testament auf, und die Reise selbst war eine Grenzerfahrung, eröffnete einen Initiationsprozess, einen Prozess des Wandels, dessen Ergebnis weder bekannt sein noch so recht verstanden werden konnte.
Paradoxerweise lebten wir damals in einer Welt, die offen war für Phantasie, einer Welt mit allenfalls skizzierten Grenzen und voller Ungewissheiten. Diese Welt verlangte nach neuen Geschichten und neuen Formen, sie wandelte sich immerfort, entstand vor unseren Augen stets wieder neu.
Heute passt die Welt in unseren Kalender und in unsere Uhr. Wir können sie uns vorstellen, haben ihr tatsächliches Bild vor Augen. Innerhalb von drei Tagen kann man hingelangen, wohin man nur will (mit wenigen, mäßig interessanten Ausnahmen). Die weißen Flecke auf den Landkarten wurden von Google Maps bis zum Rand ausgefüllt, die Karten bilden mit grausamer Genauigkeit selbst die hintersten Winkel ab. Außerdem gibt es überall nur das Gleiche – die gleichen Dinge, Artefakte, Denkweisen, Währungen, Marken, Logotypen. Das Exotische und das Außergewöhnliche sind Mangelware und lassen sich häufig im Alltag gar nicht mehr finden; sie werden zu reinen Gadgets – wie in jenem Ostseebad, in dem ein direkt aus Thailand importiertes komplettes Thai-Restaurant aufgebaut wurde, oder auf dem flachen Land mitten in Europa, wo sich in einer gigantischen Halle eine imitierte Tropenlandschaft erstreckt.
Mit dem mobilen Endgerät in der Hand oder auf dem Schoß lässt sich immer und überall mit der Familie Kontakt halten, und sei sie Tausende von Kilometern entfernt, befinde sich in einer anderen Klimazone, herrsche bei ihr eine andere Tages- oder gar Jahreszeit. Ein Tourist in Tibet kann sich innerhalb von Sekunden mit seinem Zuhause im polnischen Skaryszewo verbinden. Menschen, die früher nie eine Chance gehabt hätten, einander kennenzulernen, können heute über Medien kommunizieren. Für unsere fünf Sinne ist die Welt – ich sage es noch einmal – klein geworden. Nichtsdestoweniger ist der Anblick der Erdkugel auf einem Foto aus dem All, aufgenommen von Menschenhand, atemberaubend und ergreifend. Eine kleine blaugrüne Kugel schwebt über einem unendlichen Abgrund. Zum ersten Mal in der Geschichte nehmen wir unseren Platz planetarisch wahr – als fest umrissen, zerbrechlich und leicht zu zerstören.
Hinzu kommt der Eindruck von Überfüllung, begrenztem Raum, Enge, der immerwährenden Anwesenheit anderer Menschen – der Eindruck der Endlichkeit unserer erlebten Welt mündet in ein klaustrophobisches Gefühl. Wen wundert’s, dass neuerdings der Traum vom Reisen ins Weltall wieder erwacht, der Traum, das alte wohlbekannte, enge und vollgestopfte Haus einfach zurückzulassen. Der Eindruck einer schrumpfenden und endlichen Welt verstärkt sich noch durch die Anbindung ans Internet und die allgegenwärtige Überwachung. O ja, denn wir leben bereits in einem Panoptikum – immerfort werden wir gesehen, beobachtet und analysiert. Das Gefühl der Endlichkeit banalisiert alles, denn nur das, was sich unserer Erkenntnis entzieht, kann unsere Begeisterung wecken und sich seinen wundersam geheimnisvollen Status bewahren.
Sesamische Welt
Unendlichkeit aber betrachten wir häufig als Chaos, da sie uns nicht gestattet, unsere bewährten Erkenntnismaßstäbe an sie anzulegen, ihr eine Struktur zu geben. Karten der Unendlichkeit gibt es nicht. Auch den Menschen verwirft sie als Maß aller Dinge.
Wünscht jemand wieder Unendlichkeit zu erfahren, so braucht er sich nur ins Internet einzuloggen. Hier lehrt ihn das starke Gefühl eines Zuviel an Welt eine Art resignierter Zurückhaltung – ich gehe meines Weges und lerne, einen Bogen um die überall winkenden Attraktionen zu machen; wie Lot bin ich, der aus dem brennenden Sodom flieht und dessen Wille stark genug ist, dass er sich – im Gegensatz zu seiner neugierigen Frau – nicht noch einmal umdreht.
Heute wird diese fast mit einer Katatonie vergleichbare Art der Erstarrung vor dem Bildschirm auch als Lot’s Wife Syndrome bezeichnet. Dieses Syndrom betrifft Millionen von Jugendlichen und Incels, die, besonders jetzt, in den Zeiten der Pandemie, allen Warnungen zum Trotz auf die brennenden Städte starren und ihren Blick nicht mehr abwenden können. Wenn ich auf der Suche nach Informationen im Internet surfe, habe ich oft das Gefühl, auf einem riesigen Ozean an Daten zu treiben, die sich zudem ständig selbst neu erschaffen und kommentieren. Derjenige, der das Verb »surfen« für die Internetsuche geprägt hat, verdient es, ein Genie genannt zu werden: Das Bild eines Menschen, der sich, einsam und allein, mit einem schmalen Brett auf den Wellenkämmen eines aufgepeitschten Ozeans zu halten versucht, trifft hier den Nagel auf den Kopf. Der Surfer wird von den Elementen fortgetragen, während er selbst seine Strecke nur in begrenztem Maße beeinflussen kann – er ergibt sich der Energie und der Bewegung der Wellen. Dieses Gefühl, lediglich der Spielball einer vom eigenen Willen unabhängigen Bewegung zu sein und somit gelenkt zu werden, sich einer Kraft von mysteriöser Gleichgültigkeit unterzuordnen, holt den alten Begriff des Fatum aus der Vergessenheit hervor, den wir heute bereits anders verstehen – als ein Netz der Abhängigkeit von anderen, als Übernahme von Verhaltensmustern nicht nur im biologischen, sondern auch im kulturellen Sinne, und die Folge davon ist der lebhafte und sich wohl noch intensivierende Identitätsdiskurs.
Die neue Unendlichkeit trat in die Welt des homo consumens, als diese Welt einem Sesam zu ähneln begann. Wir befahlen: »Sesam, öffne dich!«, und – es geschah! Der Sesam öffnete sich und überschüttete uns mit einer Fülle an Diensten, Waren, Typen, Mustern, Varianten, Arten, Moden, Trends. Ein jeder von uns hat wohl wenigstens einmal diese märchenhafte Vielfalt an Angeboten erlebt – und den beunruhigenden Verdacht, man bräuchte mehrere Leben, um sie auszukosten.
Und so reduzierte sich unser Leben quasi unbemerkt auf die Konsumption – den Erwerb von Waren, die Buchung von Dienstleistungen aus dem unerschöpflichen Angebot. In einer Erzählung des genialen Philip K. Dick können die von einer durchgedrehten Intelligenz gesteuerten Fabriken ihre Produktion nicht mehr stoppen, sodass für eine unendliche Zahl programmierter Waren der ideale Käufer geschaffen werden muss, ein vom Kosmos an Gütern hypnotisierter Superkonsument, ein Kunde, zu dessen Lebenssinn es werden soll, alle erdenklichen Varianten dieses oder jenes Produkts zu probieren, die Güte verschiedener Marken abzuwägen – von Lippenstiften, Gadgets, Parfüms, Kleidung, Autos, Toastern, wobei ihm spezielle Programme und Zeitschriften als Entscheidungshilfen dienen.
Diese Version, so futuristisch sie in den sechziger Jahren auch erscheinen mochte, ist schneller eingetreten als gedacht. Heute ist sie eine Beschreibung unseres Hier und Jetzt.
Dasselbe betrifft auch unsere Konsumption intellektueller Güter. Die Bestände virtueller Bibliotheken sind unendlich geworden – sitzt man am Computer, gewinnt man leicht den Eindruck, sich in einem Sesam zu bewegen, dessen Reichtum sich beim besten Willen nicht mehr erfassen lässt – weder die Fülle an Autoren noch an Titeln noch an Schlagwörtern. Ich finde es erschreckend, mir zu vergegenwärtigen, dass in derselben Zeit, in der ich diese Worte niederschreibe, Hunderte, wenn nicht Tausende anderer Artikel, Gedichte, Romane, Essays, Reportagen und Ähnliches entstehen. Die Unendlichkeit reproduziert sich selbst, sie dehnt sich immer weiter aus – und wir mühen uns, sie mit unseren gebrechlichen Suchmaschinen zu durchmessen, um das Gefühl zu wahren, noch immer die Kontrolle zu besitzen.
Meine Generation kommt damit besonders schlecht zurecht – sind wir doch in Zeiten des Mangels aufgewachsen, und viele von uns häufen Vorräte »für eine Krise«, »für eine Inflation« an. Das ist der Grund, warum mein Mann Zeitungen sammelt und Ausschnitte aufbewahrt, und es ist der Grund, warum er im Gefühl einer Mission, vergleichbar mit der göttlichen Weisung an Noah, Holzregale für Papierbücher zimmert. Unsere und die vorangehenden Generationen sind darauf gepolt, JA, JA, JA zur Welt zu sagen. Wir dachten uns: Ich probiere dies und das, fahre hierhin und dann dorthin, erlebe dies und jenes. Ich nehme dieses hier, und – kann ja nicht schaden – das da nehme ich auch noch.
Und nun taucht eine Generation an unserer Seite auf, die begreift, dass es in der neuen Situation die menschlich und ethisch wertvollste Entscheidung ist, sich im NEIN, NEIN, NEIN zu üben. Ich gebe dies und jenes auf. Beschränke das hier und das. Dies hier brauche ich nicht. Will ich nicht. Lasse ich lieber …
Mein Name ist Million
Eine der wichtigsten Entdeckungen der letzten Jahre – Entdeckungen, die Einfluss hatten auf die Selbstwahrnehmung des Menschen als Wesen – war ganz sicher die Feststellung, dass der menschliche Organismus, dass Organismen allgemein – also auch die von Tieren und Pflanzen – in ihrer Entwicklung und Funktionsweise mit anderen Organismen zusammenwirken, dass die Organismen somit in gegenseitiger Abhängigkeit verbunden sind. Aus der biologischen und medizinischen Forschung – hier ist zuallererst Lynn Margulis’ bahnbrechende Erkenntnis zu nennen, dass Symbiose und die Verbindung von Organismen untereinander als Motor für die Evolution und die Entstehung der Arten fungierten – wissen wir, dass wir eher kollektive als individuelle Wesen sind, eher eine Republik vieler verschiedener Organismen als ein Monolith, als eine hierarchisch strukturierte Monarchie. Dein Körper, das bist nicht nur DU – der Mensch hat lediglich 43 Prozent menschlicher Zellen, verkünden die Boulevardzeitungen und wecken so gewiss die Besorgnis manchen Lesers. Egal, wie oft du dich wäschst, Mensch, deinen Körper besiedeln doch weiterhin deine »Nachbarvölker«: Bakterien, Pilze, Viren und Archäone. Die meisten sind in den dunklen Winkeln unserer Eingeweide zu finden. Die derzeitige Corona-Pandemie bedient genau diese Horrorvorstellung – dass der menschliche Körper von anderen Wesen »kolonisiert« werden kann. Das klingt unfassbar und vollkommen revolutionär, wurden wir doch bislang von Philosophie und Psychologie monadisiert: Der Mensch als Monade, als »ins Sein geworfenes« Einzelwesen thronte einsam als »Krone der Schöpfung« über einem Königreich von Pflanzen und Tieren. Dieses Bild dominierte unsere Vorstellung und Selbstwahrnehmung. Beim Blick in den Spiegel sahen wir den reflektierten, denkenden Eroberer, eine von der Welt isolierte, häufig einsame und tragische Figur. Vor uns erschien das Gesicht eines weißen Mannes, und aus irgendeinem Grund stimmten wir der Aussage »Der Mensch – das klingt stolz« zu. Heute wissen wir, dass jener grandiose Homo sapiens nur zu 43 Prozent er selbst ist. Der Rest besteht aus diesem lächerlichen Kroppzeug, das man sich bisher leicht mit Antibiotika und Pestiziden vom Leib halten konnte. Das langsam entstehende Bewusstsein, dass wir komplex und abhängig von anderen Geschöpfen, ja sogar Teil eines biologischen »Multiorganismus« sind, bringt uns dazu, eher in Kategorien des Schwarms, der Symbiose, der Kooperation zu denken.
Ich denke, die Sünde, für die wir aus dem Paradies vertrieben wurden, war nicht Sex, sie war auch nicht Ungehorsam, ja nicht einmal die Entdeckung göttlicher Geheimnisse – unsere Sünde war ebenjene Selbstwahrnehmung als monolithische, vom Rest der Welt getrennte Einzelwesen. Wir haben uns abgesondert, uns aus dem Zusammenspiel der wechselseitigen Verbindungen ausgeklinkt. Das Paradies verließen wir unter dem gestrengen Blick eines ebenso von der Welt getrennten, monolithischen, monotheistischen Gottes (angesichts der derzeitigen Situation juckt es mich in den Fingern, ihn metaphorisch einen »Gott mit Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen« zu nennen), und von da an pflegten wir die Werte jenes Standes: das Streben nach einer mythologisierten Integration, nach Ganzheit, die Egoisierung, den Monolithismus, den Monismus, das analytische, separierende Denken nach dem Entweder-oder-Prinzip (»Du sollst keine anderen Götter neben mir haben«), den Monotheismus, die Unterscheidung, Bewertung, Hierarchie, Abgrenzung, Absonderung, die strikte Schwarz-Weiß-Unterteilung, den Gattungsnarzissmus. Zusammen mit jenem gestrengen Gott gründeten wir eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die die Welt und unser Gewissen monopolisierte und zerstörte. Und infolgedessen war es uns nicht mehr möglich, die faszinierende Komplexität dieser Welt zu verstehen.
Die traditionelle Wahrnehmung des Wesens Mensch unterliegt heute einem drastischen Wandel – nicht nur aufgrund der Klimakrise, der Epidemie und der Entdeckung, dass die wirtschaftliche Entwicklung ihre Grenzen hat, sondern auch wegen unseres neuen Spiegelbildes: Das Bild des weißen Mannes, des Eroberers mit Anzug oder Tropenhelm, verblasst allmählich und verschwindet; stattdessen sehen wir so etwas wie Giuseppe Arcimboldos gemalte Gesichter – organische, vielfach verschachtelte, hybride Antlitze, bei denen man mehrmals hinschauen muss, die eine Synthese aus biologischen Kontexten, Entlehnungen und Bezügen bilden. Wir sind keine Bionten mehr, wir sind ein Holobiont, also ein Komplex verschiedener, miteinander in Symbiose lebender Organismen. Komplexität, Vielheit, Verschiedenartigkeit, gegenseitige Beeinflussung, Metasymbiose – das sind die neuen Perspektiven, aus denen wir die Welt betrachten. Ebenfalls im Verschwinden begriffen ist ein bestimmter, bis vor Kurzem noch fundamental erscheinender Aspekt des alten Systems: die Unterteilung in zwei Geschlechter. Heute erkennt man immer klarer, dass die menschliche Geschlechtlichkeit eine Art Kontinuum mit unterschiedlich stark hervortretenden Eigenschaften ist und nicht deren polare Gegenüberstellung. Jede/r kann hier seinen/ihren individuellen Platz finden. Welche Erleichterung!
Diese neue, komplexitätsbasierte Perspektive betrachtet die Welt nicht als hierarchisch aufgebauten Monolithen, sondern als Vielheit und Verschiedenartigkeit, als eine lockere organische Netzstruktur. Das Wichtigste ist aber, dass wir uns selbst innerhalb dieser Perspektive zum ersten Mal als komplexe und vielschichtige Organismen wahrzunehmen beginnen – dahingehend wirkt auch die Entdeckung von Biom und Mikrobiom mit ihrem überwältigenden Einfluss auf unseren Körper und unsere Psyche, auf die Gesamtheit dessen, was wir »Mensch« nennen. Ich vermute, dass die psychologischen Konsequenzen eines solchen Zustands sich als erstaunlich erweisen werden. Vielleicht kehren wir zur Auffassung von der menschlichen Psyche als einem Gefüge vieler Schichten und Strukturen zurück. Vielleicht fangen wir an, Persönlichkeit als Vielheit wahrzunehmen, und scheuen uns nicht mehr, multiple Persönlichkeiten als völlig normal und natürlich anzuerkennen. Im gesellschaftlichen Raum könnten dezentralisierte, netzartig organisierte Strukturen eine Aufwertung erfahren, während der hierarchische, auf dem ausgrenzenden Nationalgedanken gründende Staat zu etwas völlig Anachronistischem wird. Und vielleicht können irgendwann die monotheistischen Religionen mit ihrer starken Tendenz zu gewalttätigen Fundamentalismen die veränderten Bedürfnisse des Menschen nicht mehr befriedigen und fangen an, sich zu »polytheisieren«. Denn angeblich passt ja der Polytheismus viel besser zur Idee der Demokratie.
Heute ist jene traditionelle, raffinierte Konstruktion eines vom Rest der Welt sich abhebenden Menschen im Zerfall begriffen. Ich stelle mir das so vor, wie wenn ein mächtiger, morscher Baum sich langsam zu Boden neigt. Dieser Baum hört schließlich nicht auf zu existieren – lediglich sein Zustand durchläuft eine Veränderung. Von nun an wird er zum Ort noch intensiveren Lebens: andere Pflanzen beginnen auf ihm zu keimen, Pilze und Saprophyten besiedeln ihn, Insekten und Tiere richten sich Höhlen ein. Und auch der Baum selbst wird wiedergeboren aus seinen eigenen Trieben, Samen, Wurzeln.
Viele Welten an einem Ort
Noch niemals in der Geschichte der Menschheit waren wohl die Abstände zwischen den Generationen so groß wie heute. Damit meine ich die tiefen Gräben, die sich infolge der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und der lawinenartigen Veränderungen beim Zugang zu Informationen aufgetan haben. Es sieht ganz danach aus, als hätte sich die menschliche Gesellschaft in Generationenzonen aufgeteilt, die sich in ihrer Sicht auf die Welt, ihrem Wissen, in der Verwendung und Beschaffenheit ihrer Sprache, ihren Fähigkeiten, ihrer Mentalität, ihrer politischen Teilnahme und ihren Lebensentwürfen unterscheiden. Während einerseits die Unterschiede zwischen den Kulturen und Ethnien in unserer Welt, die einen rasend schnellen Globalisierungsprozess durchläuft (jedenfalls galt das bis zur Pandemie), sich sukzessive verwischten und verschwanden und alles immer ähnlicher wurde, vertieften sich andererseits die Gräben zwischen den Generationen. Immer klarer und lauter wird der Konflikt zwischen Alt und Jung verbalisiert; besonders erkennbar wird dies nun in der Pandemie, die durch die altersbedingten Unterschiede bei der körperlichen Widerstandskraft gegen das Virus zusätzlich dämonisiert wird. Ähnliche Ungleichheiten haben sich allerdings auch schon früher gezeigt, bei den Klimaveränderungen und der Notwendigkeit ihrer Eindämmung. Auch hier traten die Jüngeren gegen die Älteren auf und warfen ihnen – zu Recht – einen Mangel an perspektivischem Denken und konkreten Verbesserungsplänen vor. Diese Kluft ist jedoch nicht nur Ausdruck eines Konflikts zwischen Alt und Jung, sondern auch einer eigentümlichen Unstimmigkeit der verschiedenen Altersgruppen von Menschen im selben geographischen Raum. Enkel und Großeltern haben heute weniger gemeinsam als in früheren Zeiten die Einwohner von New York und Sandomierz. Und bei Urenkeln und Urgroßeltern müsste man zur Veranschaulichung wohl auf interplanetare Entfernungen zurückgreifen … Die einzelnen Generationen verwenden heute nicht nur ihre eigenen Sprachen, sondern auch ihre eigenen Alltagsrituale mit jeweils spezifischen Konsumptionsmustern und Lebensstilen. Sie haben eigene Vorstellungen von der Zukunft und sind auf andere Weise von ihr abhängig, ihr Bezug zur Vergangenheit ist ein anderer, ebenso ihr Verhältnis zur Gegenwart. Die Enkel sitzen über immer neuen Apps, die Großeltern vor ihren Lieblingssendungen im Fernsehen. Internetblasen dringen ein ins reale Leben, was dort besonders deutlich hervortritt, wo es die Älteren betrifft. Eine eigentümliche Erfahrung waren für mich die »Seniorenstunden«, die in Polen während der Pandemie festgelegt wurden: An den Vormittagen zwischen neun und zwölf sah man nur Menschen ab fünfundsechzig auf die Straße gehen und ihre Einkäufe erledigen. An den Nachmittagen wiederum standen nur Dreißig- bis Vierzigjährige Schlange vor den Supermärkten. Der Anfang einer Dystopie …
Der Zerfall der Bevölkerung in verschiedene »Stämme« je nach Generationszugehörigkeit veranschaulicht, wie viele Realitäten sich in ein und demselben Raum befinden. Sie verzahnen, überschneiden, stimulieren sich gegenseitig – und bleiben dennoch strikt getrennt.
Der seltsame Sommer 2020
Die großen Veränderungen traten meist in der Folge von Kataklysmen und Kriegen ein. So sollen die Menschen kurz vor dem Ersten Weltkrieg das Gefühl gehabt haben, es nahe das Ende einer Etappe, einer ganzen Welt. Vielen erschien die Situation unerträglich, wenn sie sich auch dieses Eindrucks nicht vollkommen bewusst waren. Heute können wir den Enthusiasmus nicht mehr verstehen, der jubelnde Menschenmengen auf die Straßen trieb, wo sie mit Vivatrufen die in den Krieg ziehenden jungen Männer verabschiedeten. Ihr munterer Schritt – der wegen der damaligen Filmtechnik zackig wirkt, als marschierten Marionetten – führte die Soldaten irgendwo weit fort, bis hinter den Horizont, wo bereits die Schützengräben von Verdun und die Oktoberrevolution lauerten. Bald sollte die ganze Ordnung ihrer Welt einstürzen. Auf dass wir diesen Fehler nicht wiederholen …
Heute – wo der seltsame Sommer 2020 seinem Ende zugeht – sind wir es, die nicht wissen, was auf sie zukommt. Sogar die Experten hüllen sich in Schweigen; sie wollen nicht zugeben, dass die in keiner anderen Lage sind als die heutigen Meteorologen, die wegen der klimatischen Wirren das Wetter nicht mehr vorhersagen können. Die Welt um uns herum ist zu komplex geworden – und das in mehreren Dimensionen zugleich. Eine spontane, reflexartige Antwort auf diesen Zustand ist die Reaktion von Traditionalisten und Konservativen, die die gestiegene Komplexität wie eine Krankheit, wie eine Störung behandeln. Als Heilmittel wollen sie uns Nostalgie, die Rückkehr in die Vergangenheit verordnen, halten krampfhaft an Traditionen fest. Da die Welt zu kompliziert geworden ist, muss man sie vereinfachen. Dass wir mit der Realität nicht zurechtkommen – umso schlimmer für die Realität. Die Sehnsucht nach einer verlorenen Zeit zieht sich durch unser Denken, durch die Mode, durch die Politik. Was Letztere betrifft, so verbreitet sich der Glaube, man könne die Zeit zurückdrehen und in denselben Fluss steigen, dessen Wasser vor Jahrzehnten vorüberflossen. Ich glaube nicht, dass wir heute in das damalige Leben noch hineinpassten. Wir fänden nicht mehr genügend Platz in der Vergangenheit. Weder unsere Körper noch unsere Psyche.
Und wenn wir einen Schritt zur Seite machten? Wenn wir die ausgetretenen Pfade unserer Überlegungen, Gedanken, Diskurse verließen und uns aus den Systemen von Blasen hinausbegäben, die alle um ein gemeinsames Zentrum kreisen? An einen Ort, von dem wir besser und weiter sehen, von dem aus die Konturen des breitesten Kontextes erkennbar sind.
Als Greta Thunberg postulierte: Schließt die Bergwerke, fliegt nicht mehr, konzentriert euch auf das, was ihr habt, und nicht auf das, was ihr alles haben könntet, wollte sie damit wohl kaum sagen, dass wir wieder auf Pferdewagen umsteigen und in Hütten mit Holzöfen ziehen sollten. Als Schwarzer Schwan hat sich hier die Pandemie erwiesen, die – wie es bei Schwarzen Schwänen eben so ist – niemand vorausgeahnt hat und die alles verändert. Mein Lieblingsbeispiel für einen Schwarzen Schwan sind die Ereignisse in London zu Ende des 19. Jahrhunderts: Die Einwohner der hoffnungslos überfüllten, engen und verdreckten Stadt sorgten sich, dass die Haufen an Pferdemist auf den Straßen in naher Zukunft den ersten Stock der Wohnhäuser erreichen würden, wenn das Verkehrsaufkommen weiter so rasant anstiege. Schon begann man, nach Lösungen zu suchen, schon meldete man Patente auf spezielle Ablaufsysteme für den Straßenrand an und rieb sich die Hände in Erwartung der florierenden Geschäfte mit dem Abtransport von Pferdemist. Und da wurde das Auto erfunden.
Im kognitiven Sinn kann der derzeitige Schwarze Schwan einen Wendepunkt darstellen – allerdings nicht, weil er möglicherweise eine Wirtschaftskrise ausgelöst oder den Menschen ihre Vergänglichkeit und Sterblichkeit vor Augen gehalten hätte, denn schließlich gibt es zahlreiche und höchst unterschiedliche Auswirkungen der Pandemie. Die wichtigste davon scheint mir allerdings zu sein, dass das tief verinnerlichte Narrativ vom Menschen als Herrn der Schöpfung, der Kontrolle über die ganze Welt besitzt, einen Bruch erfahren hat. Vielleicht ist dem Menschen als Gattung die Macht zu Kopfe gestiegen, die ihm aufgrund seines Verstandes und seiner Kreativität zufiel, und das wiederum hat ihn zu dem Gedanken verleitet, dass er und seine Interessen immer und überall im Vordergrund stünden. Mit einer anderen Perspektive, einem anderen Blick aber wird er sich ebenso wichtig und obendrein unentbehrlich fühlen können – als entscheidendes Auge des gesamten Netzes nämlich, als Übermittler von Energie, vor allem aber als Verantwortlicher für die Gesamtheit des komplexen Gebäudes. Verantwortung ist dabei der Faktor, der es ihm gestattet, sich ein Gefühl der eigenen Wichtigkeit zu bewahren, und der dadurch das mühevoll im Laufe von Jahrhunderten errichtete Konstrukt der Vorrangstellung des Homo sapiens nicht abwertet.
Ich bin überzeugt, dass unser Leben nicht nur eine Summe von Ereignissen ist, sondern ein verschlungenes Sinngefüge – das wir selbst schaffen, indem wir den Ereignissen jeweils einen Sinn zuschreiben. Die einzelnen Sinnhaftigkeiten wiederum ergeben zusammen ein wundersames Geflecht von Geschichten, Begriffen, Ideen, und man könnte es als eines der Elemente bezeichnen, die – wie Luft, Erde, Feuer und Wasser – unsere Existenz physisch bedingen und uns als Organismen formen. Die Geschichte, das Erzählen ist somit das fünfte Element, das uns die Welt auf ebendiese und keine andere Weise sehen lässt, das uns ihre unendliche Vielfalt und Vielschichtigkeit verstehen, unsere Erfahrung einordnen und sie von Generation zu Generation, von einer Existenz zur anderen weitergeben lässt.
Kairos
Der Holzstich aus Flammarions Werk zeigt einen kairotischen Augenblick. Kairos ist eine der niederen Gottheiten, die verglichen mit den Olympischen Göttern nicht besonders bedeutend erscheinen und sich nur irgendwo in der mythologischen Peripherie bewegen. Jener Kairos nun ist ein recht eigentümlicher Gott mit einer ebenso eigentümlichen Frisur. Sie ist sein Erkennungsmerkmal: Sein Hinterkopf ist kahl, der Stirn entspringt ein Schopf, bei dem man ihn packen kann, wenn er näher kommt – nicht mehr aber, wenn er sich bereits wieder entfernt. Er ist der Gott der Gelegenheit, des flüchtigen Moments, der unfassbaren Möglichkeit, die sich nur für einen kurzen Augenblick eröffnet und die man, ohne zu zögern, ergreifen (beim Schopfe packen!) muss, damit sie nicht ungenutzt vorübergeht. Übersieht man Kairos, verpasst man die Gelegenheit zur Veränderung – zur metanoia –, die aber nicht Resultat eines langen Prozesses, sondern eines folgenschweren Moments ist. In der griechischen Tradition bezeichnet kairos die Zeit, jedoch nicht den mächtigen Zeitstrom, den chronos, sondern eine Ausnahmezeit: den entscheidenden, alles verändernden Augenblick. Kairos ist immer mit einer Entscheidung des Menschen selbst verbunden, nicht mit unweigerlichem Schicksal, Fatum, äußeren Umständen. Die symbolische Geste des »Beim-Schopfe-Packens« bedeutet, sich der Möglichkeit zur Veränderung gewahr zu werden, die Schicksalswende selbst in die Hand zu nehmen.
Für mich ist Kairos der Gott der Exzentrik – wenn man unter »Exzentrik« die Aufgabe der »zentrischen« Sichtweise, der ausgetretenen Pfade im Denken und Handeln versteht, das Verlassen wohlbekannten Terrains, das mittels gemeinschaftlicher Denkgewohnheiten, Rituale, verfestigter Weltanschauungen gewissermaßen abgesteckt worden ist. Exzentrik gilt seit jeher als wunderlich und randständig – dabei muss doch alles Schöpferische und Geniale, das die Welt in eine neue Richtung lenkt, zwangsläufig »ex-zentrisch« sein. Exzentrik bedeutet, das Althergebrachte, das, was als normal und selbstverständlich angesehen wird, spontan und auf spielerische Art infrage zu stellen; sie ist eine Herausforderung an Konformismus und Hypokrisie, ein kairotischer Akt des Mutes, dessen es bedarf, im richtigen Moment zuzugreifen und das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.
Wir haben das allgemeine Wissen verdrängt und den Sinn für eine ganzheitliche Wahrnehmung irgendwo verloren. Nach und nach gehen die letzten Gelehrten von uns, die großen »Ex-zentriker« – wie etwa Stanisław Lem oder Maria Janion –, die Verbindungen zwischen scheinbar weit auseinanderliegenden Wissensgebieten zu erfassen und aufzugreifen in der Lage sind, die ihren Kopf über den Weltenrand der vereinbarten Ordnung hinausstrecken. Früher haben wir wenigstens versucht, die Welt in einer Ganzheit zusammenzufassen, indem wir kosmogonische und ontologische Visionen entwickelten und Sinnfragen stellten. Doch dann sind wir irgendwo auf unserem Weg proletarisiert worden – auf ähnliche Weise, wie die Handwerker, die noch das vollständige Produkt anfertigen konnten, durch die kapitalistische Fabrikation proletarisiert und zu Arbeitern gemacht wurden, die nur noch die Einzelteile herstellten und sich des Ganzen nicht einmal mehr bewusst waren. Der Vorgang, in dessen Zuge sich die menschliche Gesellschaft in einzelne Blasen unterteilt, ist der Prozess einer unvorstellbaren, totalen Proletarisierung. Wir ziehen uns in unsere Blasen zurück, machen es uns bequem in der abgesonderten Sphäre unserer eigenen Erfahrung, die uns den Zugang zu den Erfahrungen und Gedanken anderer blockiert – und wir wollen es so, es geht uns gut damit, während die anderen, die wirklich anderen, die zu verstehen oder auch nur wahrzunehmen ein Hinauslehnen über den Rand von uns verlangen würde, uns herzlich egal sind.
Der öffentliche Raum existiert natürlich, jedoch eher als Substitut, als Schein, als ein Schauspiel vor stark abgenutzten Kulissen, das die Herrschenden und ihre Rituale sich angeeignet haben. In den ausgetretenen Zentren, den früheren Orten des Gedankenaustauschs, gibt es keine Luft mehr. Die Agora ist nur mehr eine Ansammlung von Strecken und Bahnen, auf denen wir uns mechanisch bewegen. Die Universitäten haben ihre alte Rolle verloren und sind zum grotesken Abklatsch ihrer selbst geworden – statt Wissen zu erzeugen und Plattformen gegenseitiger Verständigung zu schaffen, ziehen sie sich hinter ihre Mauern und Portale zurück, indem sie den Wissenszugang beschränken und Forschungsergebnisse eifersüchtig voreinander geheim halten. Die Forschenden wetteifern blindwütig um Fördermittel und Punkte, haben sich in rivalisierende Lohnarbeiter verwandelt. Da wir das große Ganze nicht sehen, werden wir hin- und hergeworfen von lokalen Verwirbelungen und Strudeln und bleiben abhängig von den einzelnen Teilen des großen Puzzles – der gegebenen Welt und der, die wir darüber errichten.
In meinem Schreiben versuche ich immer, das Augenmerk und die Sensibilität meiner Leser und Leserinnen auf das große Ganze zu lenken. Ich habe mich am allwissenden Erzähler abgearbeitet, habe mit fragmentarischen Formen provoziert, indem ich suggerierte, es gebe Konstellationen, die über die simple Summe von Bestandteilen hinausgehen und einen eigenen Sinn kreieren. Mir scheint, die Literatur als unaufhörlicher Prozess des Erzählens der Welt hat größere Möglichkeiten als irgendetwas sonst, diese Welt in ihrer gesamten Perspektive gegenseitiger Einflüsse und Verbindungen zu zeigen. Weit gefasst, so weit wie möglich, ist sie von ihrer Natur her ein Netz, das die verzweigte, umfassende Korrespondenz zwischen allen Teilhabern des Seins verbindet und abbildet – eine raffinierte und ganz besondere, präzise und zugleich totale Art der zwischenmenschlichen Kommunikation.
Ich komme in diesem Text immer wieder auf die Literatur zu sprechen – hier erwähne ich Kairos, da beziehe ich mich auf Flammarion und den anonymen Holzstich, den er irgendwo auftrieb, um sein Buch L’atmosphère. Météorologie populaire zu illustrieren. Viele Menschen, das weiß ich, sehen Literatur als leichte Unterhaltung an, in Form von Büchern, die man »wegliest« – ein Zeitvertreib, ohne den es sich ebenso glücklich und erfüllt leben lässt. Im weitesten Verständnis aber ist die Literatur ein Sesam der anderen Gesichtspunkte, der unterschiedlichen, durch den individuellen Verstand der einzelnen Menschen gefilterten Weltsichten. Und darin lässt sie sich mit nichts anderem vergleichen. Literatur, auch die älteste, die mündlich überlieferte Literatur, schafft Ideen und zeichnet Perspektiven, die sich tief in unserem Verstand verankern und ihn formatieren – ob wir es nun wollen oder nicht. Sie ist die Heimat der Philosophen (was ist denn Platons Gastmahl anderes als ein Stück gute Literatur?), bei ihr beginnt das Philosophieren.
Es wäre schwierig, eine Vision der Literatur für neue Zeiten zu kreieren, insbesondere, weil gut informierte Quellen zu wissen meinen, dass eben derzeit die letzte lesende Generation heranwächst. Trotzdem möchte ich, dass wir uns weiterhin zugestehen, neue Geschichten zu ersinnen, neue Begriffe und neue Wörter. Zugleich aber weiß ich, dass in der Welt – in diesem gewaltigen, wandelbaren, flirrenden Universum – nichts jemals neu ist. Es ist lediglich eine andere Konfiguration, die die Dinge auf andere Weise darstellt, neue Assoziationen und damit neue Begriffe schafft. Der Terminus »Anthropozän« ist gerade einmal dreißig Jahre alt, doch dank ihm sind wir imstande zu begreifen, was rings um uns und mit uns geschieht. Er setzt sich aus zwei gut bekannten griechischen Wörtern zusammen: ánthrōpos (Mensch) und kainós (neu), und er beweist den großen Einfluss des Menschen auf die weltweit vor sich gehenden Prozesse in der Natur.
Was haltet ihr von Ognosie?
Ognosie (poln. ognozja, engl. ognosia, frz. ognosie) – narrativ orientierter, ultrasynthetischer Erkenntnisprozess, in dessen Zuge Dinge, Situationen und Phänomene einer Reflexion unterzogen und so in ein höheres Sinngefüge der wechselseitigen Bedingtheiten eingeordnet werden sollen, siehe auch →Fülle, →Vielheit; ugs.: die Fähigkeit, sich Fragestellungen und Problemen auf synthetische Weise anzunähern, indem sowohl in den Narrativen selbst als auch in den Details, den einzelnen Teilchen des Ganzen, nach einer zugrundeliegenden Ordnung gesucht wird. Im Fokus der Ognosie stehen Ereignisketten außerhalb der kausalen und logischen Zusammenhänge, sie präferiert →Fügung, →Brücke, →Refrain, →Synchronizität. Häufig wird eine Verbindung zwischen Ognosie und →Mandelbrot-Menge, →Chaostheorie nahegelegt. Gelegentlich wird die Ognosie als alternative religiöse Haltung betrachtet, als →Alterreligion, die eine sog. verbindende Kraft nicht in einem übergeordneten Sein erkennt, sondern eher in untergeordneten, »niederen« Existenzen, den sog. →ontologischen Kleinformen. Eine Ognosiestörung äußert sich in der Unfähigkeit, die Welt als integrale Ganzheit wahrzunehmen, stattdessen wird alles zersplittert und unzusammenhängend gesehen; bei dieser Störung ist die Funktion des →Einblicks in die Situation, der Synthese und der Verknüpfung von scheinbar unverbundenen Fakten blockiert. In der Ognosietherapie wird häufig die Heilmethode der Romanbehandlung angewandt (ambulant auch die mündliche Erzählbehandlung).
Lasst uns eine Bibliothek der neuen Begriffe schaffen und sie mit ex-zentrischen Inhalten füllen – Inhalten, von denen das Zentrum noch nie gehört hat. Denn schließlich wird es uns an Wörtern, Termini, Wendungen, Phrasen fehlen, und wer weiß, vielleicht sogar an ganzen Stilen und Gattungen zur Beschreibung dessen, was da kommt. Neue Landkarten werden wir brauchen und den Mut, den Humor von Wanderern, die sich nicht scheuen, den Kopf aus der Sphäre der bisherigen Welt hinauszustrecken, über den Horizont der bisherigen Wörterbücher und Enzyklopädien. Ich bin schon gespannt, was wir dort sehen werden.
Deutsch von Lisa Palmes
Übungen im Fremdsein
Ich bin mit den Büchern von Jules Verne aufgewachsen – sie haben mir eine ferne Welt gezeigt, haben meine Vorstellung davon geformt, wie der Mensch des Westens auf Reisen geht. Das nahm ich mir zum Maß, dem wollte ich nacheifern, während ich in der abgeschlossenen und öden Sphäre der Volksrepublik lebte. Und der Verne’sche Reisende war nicht irgendwer – auch wenn die letzten weißen Flecken noch nicht von der Weltkarte verschwunden waren, schien er die Gefahren nicht wahrzuhaben, selbstsicher und mutig machte er sich auf den Weg, im Gefühl, dass ihm die Welt gehöre, dass ihm dies alles zustehe. Auf seinen Reisen behielt er seine Gewohnheiten bei, blieb der Mode seines Landes treu (unverzichtbar die tabakbraunen Hosen und der schwarze Gehrock). Für gewöhnlich genügte ihm auch die eigene Muttersprache. Stets dachte er daran, die neuesten technischen Erfindungen mitzunehmen, die ihm im entscheidenden Moment aus der Klemme halfen, ihm das Leben retteten. Und selbst wenn er ein guter, ein weltoffener Mensch war, steckten doch in der Tiefe seiner Seele die Überzeugung seiner evolutionären Überlegenheit sowie das Bewusstsein, dass es unstrittige historische Prozesse gebe, die früher oder später jeden Winkel der Erde auf das zivilisatorische Niveau des Westens heben würden. Atemberaubende Abenteuer brachten ihn in die entferntesten Einöden, doch auch dort fühlte er sich sicher, denn noch in den einsamsten Gegenden traf er auf einen Beamten des eigenen Kulturkreises, der ihm im Falle eines Falles den verlorenen Reisepass ersetzte und ihn mit etwas Klatsch über die Eingeborenen versorgte.
Faszinierende Dekoration
In der Form des Pastiches kehrt der Verne’sche Standpunkt häufig in der Popkultur wieder, zum Beispiel in den Indiana-Jones-Filmen. Hier ist die Welt nur ein exotisches Bühnenbild für die Heldentaten des Protagonisten, deren Struktur an ein Computerspiel denken lassen. Und wie faszinierend die Kultur auch wäre, auf die der Held träfe – er wird sich nicht ändern, wird bis zum Schluss derjenige bleiben, der er im Moment seiner Ankunft war. Eingeschlossen in der dichten Kapsel der westlichen Identität, zeigt er sich wie imprägniert gegen alles Fremde, auch wenn er als Archäologe agiert, der in dieser Hinsicht aufgeschlossen sein sollte. Fixiert auf sein Ziel (den Schatz zu finden, das Geheimnis zu lüften), knüpft er keine engeren Beziehungen zu den Eingeborenen, nimmt keinen kulturellen Dialog auf. In der festen Überzeugung, dass die Menschen ihn verstehen müssten, spricht er Englisch oder Französisch mit ihnen. Er hält an seinen Standards fest, lässt sich auf keine engeren Verhandlungen ein, behandelt alles und jeden von oben herab, seiner zivilisatorischen (und damit seiner menschlichen) Überlegenheit sicher. Wir haben die legendäre Szene vor Augen, in der Indiana Jones von einem Ismailiten zu einem Duell herausgefordert wird. Wir befinden uns auf einem Basar, inmitten der Menge, die beiseitetritt, um den Kämpfenden Platz zu machen. Als der traditionell gekleidete Krieger seinen Säbel wirbeln lässt, um seine Fertigkeiten zu zeigen, zückt Indiana Jones, der es eilig hat, seine Pistole und erschießt ihn. Ende des Duells.
Überrumpelt von dieser Wendung, muss der Zuschauer lachen, auch wenn ihn die eigene Reaktion überrascht. Die Nonchalance, ja Dreistigkeit des Indiana Jones wirkt imponierend, zugleich spricht sie jedem Reflex politischer Korrektheit Hohn.
Im Grunde nimmt der Reisende des Westens die Welt als nicht wirklich wahr. Gleich einem ewig eilenden Schatten bewegt er sich durch die Länder und Kulturen, die er besucht. Nichts berührt er, in nichts ist er einbezogen, er bleibt verkapselt in seinem Überlegenheitsgefühl.
Die unschuldige exotische Welt, in die der westliche Reisende vom Schlage eines Indiana Jones gelangt, geht zumeist am Ende der Geschichte auf dramatische Weise unter. Der Untergang vollzieht sich mit einem Donnerschlag – als sollte diese Welt, wenn das Ziel erreicht, das Geheimnis aufgedeckt ist, ihre Existenzberechtigung verlieren. Der Zuschauer muss einstürzende Pyramiden sehen, zusammenfallende unterirdische Verliese, Vulkanausbrüche und ähnliche apokalyptische Bilder. Hier gilt die alte römische Formel: veni, vidi, vici. Was gesehen und erfahren (benutzt) wurde, ist abgehakt, mit anderen Worten: bezwungen. Und hört damit auf zu existieren.
Exotisch, aber in Maßen
Das Paradigma des Reisenden im 19. Jahrhundert erfuhr seine industrialisierte Vermassung durch den modernen Tourismus. Erbe des Phileas Fogg und des Indiana Jones ist heute der Tourist, der im Reisebus in zwölf Tagen Mexiko durchquert auf einer Tour, die natürlich in Cancún enden muss, dem scheußlichsten Ort, den ich je gesehen habe – monströse Hotelanlagen und abgeteilte Strandabschnitte. Oder er erholt sich all-inclusive in türkischen Seebädern und gibt sich alle Mühe, nicht daran zu denken, dass ein paar Hundert Meter weiter die Leichen von Flüchtlingen an den Strand gespült werden.
Der blasse und vom langen Sitzen steif gewordene Reisende knipst verwackelte Bilder durch die Scheibe des Busses, und die Beine kann er erst dort wieder ausstrecken, wohin ihn der Wille und der Geschäftssinn des Reiseleiters bringen. Während des kurzen Aufenthalts sieht er dann mit eigenen Augen, was die Reiseführer empfehlen, und befriedigt vermerkt er in Gedanken, dass dies alles tatsächlich existiert. An den Abenden bekommt der Tourist ein exotisches real life geboten, das alles andere als real ist und mit life eigentlich gar nichts zu tun hat.
Der Tourist möchte es exotisch, aber in Maßen. Er möchte, dass es echt wirkt, aber bitte nicht um den Preis der Dusche am Morgen. Er möchte ein bisschen Nervenkitzel, aber nicht so, dass es ihn beunruhigen müsste. Er möchte Kontakt mit den Einheimischen, solange er oberflächlich bleibt und unverbindlich. Einmal hörte ich ein Gespräch meiner Landsleute im mittleren Alter, sie wollten gemeinsam nach Kuba reisen und bestärkten einander darin, die Reise zu unternehmen, solange Fidel noch lebe. Solange dort noch Armut herrsche. Denn später wäre es dann »wie überall«. Der Geschäftssinn hat auch im Tourismus die Grenzen der Ethik verschoben.