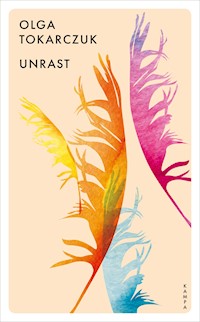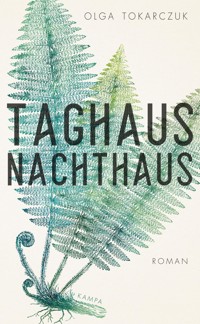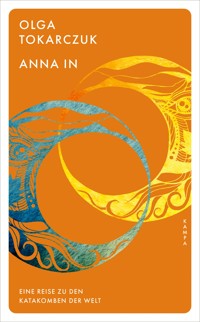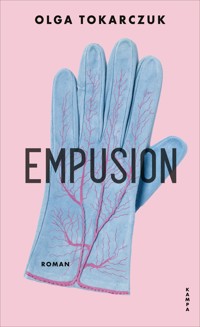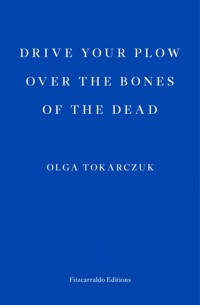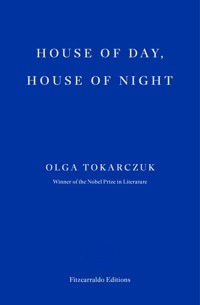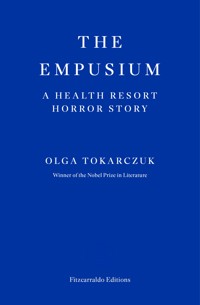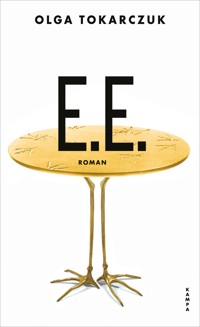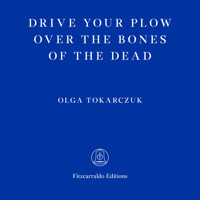Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er galt als Luther der Juden - seine Anhänger sahen in ihm einen Messias, für seine Gegner war er ein Scharlatan, ja Ketzer. Jakob Frank war eine der schillerndsten Gestalten im Europa des 18. Jahrhunderts. Die Religionen waren ihm wie Schuhe, die man auf dem Weg zum Herrn wechseln könne: Er war Jude, bevor er mit seiner Gefolgschaft zum Islam und dann zum Katholizismus konvertierte. Er war ein Grenzgänger, der, aus dem ostjüdischen Schtetl stammend, das Habsburger und das Osmanische Reich durchstreifte und sich schließlich in Offenbach am Main niederließ.»Die Jakobsbücher« sind das vielstimmige Porträt einer faszinierenden Figur, deren Lebensgeschichte zum Vexierbild einer Welt im Umbruch wird. Olga Tokarczuk hat einen historischen Roman über unsere Gegenwart geschrieben, der zugleich ein Plädoyer für Toleranz und Vielfalt ist. Ihr Opus magnum, vom Nobelpreiskomitee explizit in der Begründung erwähnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1613
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
- Unsere Empfehlungen
- Ich erinnere mich nicht an den Titel, aber das Cover war gelb
- Bücher mit 5-Sterne-Bewertungen
- Dicke Schinken, Bücher mit mehr als 400 Seiten
- Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk
- E-Books & Hörbücher perfekt für unterwegs
- Bücher von Literaturnobelpreisträger*innen
- Buch-Highlights vom Kampa Verlag
- Nobelpreis für Literatur
Ähnliche
Olga Tokarczuk
Die Jakobsbücher
oder Eine grosse Reise über sieben Grenzen, durch fünf Sprachen und drei grosse Religionen, die kleinen nicht mitgerechnet. Eine Reise, erzählt von den Toten und von der Autorin ergänzt mit der Methode der Konjektur, aus mancherlei Büchern geschöpft und bereichert durch die Imagination, die größte natürliche Gabe des Menschen. Den Klugen zum Gedächtnis, den Landsleuten zur Besinnung, den Laien zur erbaulichen Lehre, den Melancholikern zur Zerstreuung.
Aus dem Polnischen von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein
Kampa
Meinen Eltern
Prolog
Das verschluckte Stück Papier bleibt in der Speiseröhre stecken, auf der Höhe des Herzens. Saugt sich mit Speichel voll. Die schwarze, eigens verfertigte Tinte verwischt, verschwimmt, die Buchstaben verlieren ihre Form. Im Körper des Menschen spleißt das Wort sich auf, trennt sich in Substanz und Wesen. Wenn Erstere verschwindet, lässt sich Letzteres, seiner Gestalt entledigt, von den Geweben des Körpers aufnehmen, denn unermüdlich sucht das Wesen nach Materie, die es tragen könnte; mag diese Suche auch so manches Unglück nach sich ziehen.
Jenta erwacht. Dabei war sie schon so gut wie tot gewesen. Jetzt fühlt sie es deutlich, wie ein Schmerz, wie die Strömung eines Flusses ist es, ein Zittern, ein Beben, ein drängender Puls.
Nahe dem Herzen verspürt sie wieder das zarte Vibrieren, schwach schlägt ihr Herz, doch regelmäßig, seines Taktes sicher. Und Wärme strömt zurück in Jentas verdorrte Brüste. Sie blinzelt, hebt mühsam die Lider. Sieht über sich die sorgenvolle Miene des Elischa Schor. Sie möchte lächeln, doch ihr Gesicht gehorcht ihr nicht ganz. Elischa Schor, die Brauen zusammengezogen, schaut sie vorwurfsvoll an. Seine Lippen bewegen sich, doch dringt kein Laut an Jentas Ohr. Von irgendwoher tauchen Hände auf – die großen Hände des alten Schor, sie suchen ihren Hals, schieben sich unter die Decke. Ungeschickt versucht er, den kraftlosen Körper auf die Seite zu drehen, er will sehen, ob das Laken unter ihrem Leib etwas verbirgt. Von diesen Bemühungen spürt Jenta nichts, nur die Wärme nimmt sie wahr, die Anwesenheit des bärtigen, schwitzenden Mannes.
Und plötzlich, als hätte es einen Schlag getan, sieht Jenta alles von oben – sich selbst im Bett, die kahle Stelle auf dem Kopf des alten Schor, denn über der Geschäftigkeit mit ihrem Körper ist ihm die Mütze vom Scheitel gerutscht.
Von nun an bleibt es so – Jenta sieht alles.
IDas Buch des Nebels
1
1752, Rohatyn
Es ist Ende Oktober, früh am Morgen. Der Dechant steht im Windfang des Pfarrhauses, wartet auf das Gespann. Er ist es gewohnt, so zeitig aufzustehen, doch heute fühlt er sich benommen, weiß nicht recht, wie ihm geschieht – so allein vor diesem Ozean aus Nebel. Er kann sich nicht erinnern, wie er aufgestanden ist, sich angekleidet hat. Hat er überhaupt etwas gegessen? Verwundert betrachtet er sein robustes Schuhwerk, das unter der Soutane hervorlugt, mustert den schon etwas ausgefransten Saum seines verschossenen Wollmantels, die Handschuhe, die er hält. Er schlüpft in den linken; das Innere fühlt sich angenehm warm an, er passt perfekt, als wären Hand und Handschuh seit Jahren miteinander vertraut. Erleichtert atmet er auf. Betastet die Tasche, die er an einem Riemen über der Schulter trägt, streicht mechanisch an den rechteckigen Kanten entlang, die hart und verdickt sind wie Narbengewebe in der Haut, und jetzt fällt ihm auch wieder ein, was die Tasche enthält – die schwere, wohlbekannte, wohltuende Form. Etwas Gutes ist es, das hat ihn hierher gebracht, Worte und Zeichen – und innig verbunden ist es mit seinem Leben. O ja, er weiß jetzt wieder, was er bei sich trägt, und dieses Wissen beginnt, seinen Körper zu wärmen, und der Nebel, so scheint es, lichtet sich davon. Hinter ihm die dunkle Türöffnung, der eine Flügel ist geschlossen, es muss kalt gewesen sein in der Nacht, vielleicht hat schon der erste Frost die Zwetschken im Obstgarten mürbe gemacht. Über der Tür eine undeutliche Schrift – der Dechant sieht sie, ohne hinzuschauen, er weiß, was dort steht, er hat es selbst in Auftrag gegeben. Eine ganze Woche lang waren die beiden Handwerker aus Podhajce mit der Schnitzarbeit beschäftigt, der Dechant wollte es in schmucker Ausführung haben:
DZIŚ CO BYŁO, JUTRO PO NIM.
CO UCIEKŁO, NIE DOGOИIM
Was heute war, liegt morgen in vergangnen Tagen. / Ist es vorbei, wir werden’s nicht erjagen. In dem Wort »dogonim«, und das ärgert ihn gewaltig, ist der Buchstabe »N« falsch herum geschrieben, als wäre es sein Spiegelbild.
Zum wer weiß wievielten Male irritiert von dem Lapsus schüttelt der Geistliche heftig den Kopf – und hat endlich das Gefühl, ganz erwacht zu sein. Dieser verkehrte Buchstabe … Was für eine Nachlässigkeit! Wenn man ihnen nicht ständig auf die Finger schaut! Und weil die Handwerker Juden sind, sind ihnen die Buchstaben irgendwie jüdisch geraten, zu verschnörkelt sehen sie aus, und seltsam verwackelt. Einer der beiden wollte sich noch streiten, dass ein solches »N« auch möglich, ja eigentlich hübscher sei, denn der Querstrich laufe von links unten nach rechts oben, also auf christliche Weise, und anders herum wäre es eben jüdisch. Die kleine Irritation schärft ihm die Sinne, und Benedykt Chmielowski, der Dechant von Rohatyn, begreift jetzt auch, woher das seltsame Gefühl rührte, er schlafe noch – der Nebel, der ihn umgibt, hat die Farbe seiner Bettwäsche; ein eingetrübtes Weiß, schon heimgesucht vom Schmutz, den Schattierungen aus den unermesslichen Vorräten an Grautönen, die das Unterfutter der Welt bilden. Reglos steht der Nebel, alle Winkel des Hofes füllt er aus, nur schemenhaft sind die vertrauten Umrisse zu erahnen – der mächtige Birnbaum, die kleine Mauer, ein Stückchen weiter der Wagen mit den Seitenwänden aus Weidengeflecht. Eine gewöhnliche Himmelswolke, die auf die Erde sank, gegen die sie ihren Bauch jetzt drückt. So hat er es gestern bei Comenius gelesen.
Nun hört er das vertraute Knarren, das Klappern der Hufe, Geräusche, die ihn während jeder Reise unweigerlich in den Zustand einer schöpferischen Meditation versetzen. Hinter den Lauten erst taucht Roschko aus dem Nebel auf, er führt das Pferd am Zügel, die Britschka gewinnt Kontur. Ihr Anblick beflügelt den Geistlichen, er schlägt sich mit dem Handschuh auf die Handfläche, klettert auf den Sitz. Roschko, schweigend wie immer, rückt das Geschirr zurecht, wirft dem Dechanten einen langen Blick zu. Der Nebel lässt Roschkos Gesicht fahl erscheinen, Chmielowski will es vorkommen, als wäre er im Laufe einer Nacht gealtert, dabei ist Roschko ein junger Bursche.
Endlich fahren sie los. Doch ist es, als verharrten sie an der Stelle, von der Bewegung zeugen allein das Schaukeln und das beruhigende Knarren des Gefährts. So oft schon haben sie diesen Weg genommen, dass es nicht mehr nötig ist, sich den Ausblicken hinzugeben oder Punkte zur Orientierung zu suchen. Der Pater weiß, dass sie eben auf den Pfad gelangt sind, der dem Waldrand folgt, hier geht es weiter, bis sie an die Kreuzung kommen, wo das Marterl steht. Das übrigens Chmielowski vor ein paar Jahren hat errichten lassen, als er die Pfarrei in Firlejów übernahm. Lange überlegte er damals, wer hier seinen Platz finden sollte. Der heilige Benedikt kam ihm in den Sinn, sein Namenspatron, auch dachte er an Onuphrius, den Eremiten, den in der Wüste eine Palme auf wunderliche Weise mit Datteln genährt hatte, und jeden achten Tag waren Engel vom Himmel gekommen, um ihm den Leib des Herrn zu bringen. Auch Firlejów sollte für Chmielowski eine Art Wüste sein, nach den Jahren, in denen er Dymitr erzogen hatte, den Sohn des hochwohlgeborenen Herrn Jabłonowski. Nach längerem Abwägen jedoch kam er zu dem Schluss, dass der Bildstock nicht für ihn errichtet werde und nicht dazu dienen sollte, seine eigene Eitelkeit zu befriedigen, sondern dass er für das einfache Volk gedacht sei, dass es an dieser Kreuzung einen Ort habe, an dem es rasten und seine Gedanken gen Himmel erheben könne. So steht nun auf dem gemauerten, geweißten Sockel die Muttergottes und Weltenkönigin, mit einer Krone auf dem Haupt. Unter ihrem kleinen Schnabelschuh windet sich eine Schlange.
Heute versinkt auch die Muttergottes im Nebel, wie das Marterl und die Kreuzung. Nur die Baumwipfel sind zu sehen, ein Zeichen, dass der Nebel fällt.
»Seht nur, Hochwürden, die Kaśka will nicht gehen«, sagt Roschko düster, als die Britschka zum Stehen kommt. Roschko steigt vom Bock, schlägt mehrere Male schwungvoll das Kreuz.
Er beugt sich vor, stiert in den Nebel, als schaute er in Wasser. Unter seinem feiertäglichen roten Wams, das schon ein wenig verblichen ist, spitzt sein Hemd hervor.
»Ich weiß nicht, wohin.«
»Wie das? Er weiß es nicht? Wir sind doch schon auf der Chaussee nach Rohatyn«, sagt der Pater erstaunt.
Also nun? Er klettert aus der Britschka, folgt seinem Diener, ratlos umkreisen sie das Gefährt, starren in das milchige Weiß. Es scheint ihnen, als wäre da etwas zu sehen, doch die Augen, die nichts finden, woran sie sich halten könnten, gaukeln ihnen etwas vor. Dass ihnen so etwas wahrhaftig widerfährt! Als verirrte man sich in der eigenen Hosentasche.
»Still!«, sagt der Pater und hebt, während er angestrengt lauscht, den Zeigefinger in die Höhe. Tatsächlich, von links dringt aus den Nebelschwaden ein leises Rauschen herüber.
»Wir fahren dem Rauschen nach. Dort fließt Wasser«, verfügt der Geistliche.
Jetzt werden sie in behäbigem Tempo dem Lauf eines Flüsschens folgen, das Gniła Lipa heißt, Modrige Linde; das Wasser wird sie leiten.
Bald lehnt sich der Pater bequem in der Britschka zurück, streckt die Beine aus und lässt seine Blicke durch den Ozean aus Nebel gleiten. Unweigerlich verfällt er in seine Reiseversonnenheit, denn am besten denkt es sich, wenn der Mensch in Bewegung ist. Zögernd nur kommt der Mechanismus seines Geistes in Gang, springen die Zahnrädchen und Federchen an, die sein Denken in Schwung versetzen, als wäre es das Räderwerk der Uhr, die in seinem Pfarrhaus in der Diele steht – ein Stück aus Lemberg, das eine Stange Geld gekostet hat. In Kürze wird sie ihr Bim-Bom ertönen lassen. Ob nicht die Welt womöglich aus solchem Nebel entstanden ist, beginnt er zu sinnieren. Der jüdische Historiker Flavius Josephus behauptet doch, die Welt sei im Herbst erschaffen worden, beim Äquinoktium. Zu dem Schluss konnte man kommen, wenn man bedachte, dass es im Paradies Früchte gegeben hatte; wenn ein Apfel am Baum gehangen hatte, musste es Herbst gewesen sein … Nicht von der Hand zu weisen. Doch kommt ihm noch ein anderer Gedanke in den Sinn: Sollte das ein Beweisgrund sein? Konnte nicht ein allmächtiger Gott solche Nichtigkeiten wie Äpfel auch nebenher erschaffen, zu jeder beliebigen Jahreszeit?
Als sie die Chaussee nach Rohatyn erreichen, reihen sie sich in den Strom ein, der hier unterwegs ist, zu Fuß, zu Pferde, mit Fuhrwerken jeder Art, und wie das ganze Treiben aus dem Nebel auftaucht, möchte man meinen, es wären Figuren aus Pfefferbrot, wie sie zur Weihnachtszeit gebacken werden. Es ist Mittwoch, Markttag in Rohatyn, Bauernwagen sind unterwegs, hoch beladen mit Säcken voller Korn, Käfigen mit Federvieh und allen Früchten der Gärten und Felder. Dazwischen gehen wackeren Schrittes Händler mit allen möglichen Waren – ihren Kramladen tragen sie sinnreich zusammengelegt auf den Schultern, in Kürze wird diese Hucke sich in einen Stand verwandeln, auf dem sie bunte Stoffe feilbieten, Spielzeug aus Holz oder Eier, die sie auf den Dörfern zu einem Viertel des Preises erworben haben … Die Bauern bringen auch Ziegen und Kühe auf den Markt – die Tiere sind verängstigt vom Getümmel, stemmen sich mit den Beinen in die Pfützen. Jetzt rattert in scharfem Tempo ein Wagen vorbei, der mit einer löchrigen Plache gedeckt ist, eine Gruppe lautstark sich gebärdender Juden sitzt darauf, aus der ganzen Umgebung kommen sie zum Markt nach Rohatyn. Dahinter schiebt sich eine herrschaftliche Kutsche durchs Gedränge, die in diesem Wetter und dem Tumult auf der Straße einiges an Vornehmheit einbüßen muss. Die hell lackierten Schläge sind schwarz vom Schlamm, und die Miene des Kutschers, der eine hellblaue Pelerine trägt, wirkt verdrießlich genug, ein solches Durcheinander hat er offenbar nicht erwartet, jetzt schaut er sich verzweifelt nach einer Möglichkeit um, von der teuflischen Straße wegzukommen.
Roschko lässt sich nicht aufs Feld abdrängen, verbissen hält er sich rechts, und mit einem Rad auf dem Wiesenrain und einem auf der Chaussee kommt er flink voran. Sein langgezogenes, schwermütiges Gesicht bedeckt sich mit roten Flecken, verwandelt sich in eine Grimasse der Verdammung. Als der Dechant ihn betrachtet, fällt ihm ein Kupferstich ein, den er gestern betrachtet hat. Auf dem Bild sind Menschen zu sehen, die Höllenstrafen erleiden; sie haben denselben Gesichtsausdruck wie Roschko jetzt.
»Platz für den ehrwürdigen Pater!«, schreit er, »Platz da! Aus dem Weg, Gesindel!«
Die ersten Gebäude tauchen auf, jäh, wie aus dem Nichts. Der Nebel verändert das Empfinden für die Entfernung. Auch die gute Kaśka scheint es scheu zu machen. Sie stampft, reißt an der Deichsel, und hätte nicht Roschko geistesgegenwärtig die Peitsche zur Hand gehabt, die Britschka wäre umgeschlagen. Vielleicht dass das Tier von den Funken erschrak, die aus den Feuerstellen stieben, oder dass die Unruhe der Pferde auf sie überging, die darauf warten, beschlagen zu werden.
Ein Stück weiter liegt die Schenke, armselig und elend sieht sie aus, einer Bauernkate ähnlich. Wie ein Galgen starrt über ihr der Schwengelbalken des Ziehbrunnens, ragt in den Nebel auf, seine Spitze verschwindet in den Höhen. Der Pater bemerkt, dass die staubbedeckte Kutsche hier gehalten hat, der erschöpfte Kutscher lässt den Kopf fast bis auf die Knie hängen, klettert nicht vom Bock, es steigt auch niemand aus. Da steht schon ein großer, dürrer Jude vor dem Gefährt, neben ihm tauchen kleine Mädchen mit zerzausten Haaren auf. So viel nur kann der Dechant erkennen, der Nebel verschluckt sofort jedes Bild, an dem er vorüberfährt. Kaum ist es wahrgenommen, schmilzt es dahin wie eine Schneeflocke.
Das also ist Rohatyn.
Es beginnt mit Katen aus Stampflehm, die aussehen, als würden sie von ihren Strohdächern zur Erde gedrückt; je näher es auf den Markt zugeht, desto schlanker muten die Häuser an, auch die Strohdächer scheinen von feinerer Art, bis es schließlich Schindeldächer werden, mit denen die Behausungen aus ungebrannten Lehmziegeln gedeckt sind. Hier stehen die Pfarrkirche, ein Dominikanerkloster und am Markt die St. Barbara-Kirche, ein Stück weiter zwei Synagogen und fünf orthodoxe Gotteshäuser. Rund um den Markt ducken sich, wie Pilze, kleine Häuschen, und in jedem betreibt jemand sein Geschäft. Hier der Schneider, dort der Seiler, dort der Kürschner, sie alle sind Juden, gleich daneben der Bäcker mit dem Namen Laib, was den Dechanten immer mit Freude erfüllt, zeigt es doch, dass eine verborgene Ordnung existiert, und wäre sie ein wenig deutlicher zu sehen und träte zwingender in Erscheinung, die Menschen lebten ein besseres Leben, näher an der Tugend. Neben dem Bäcker hat der Klingenschmied seine Werkstatt, Luba wird er gerufen; die Fassade seines Hauses lässt auf Wohlstand schließen, die hellblauen Wände sind frisch gestrichen, über der Tür hängt ein langes, rostiges Schwert. Er muss sich auf sein Fach verstehen, dieser Luba, und seine Kunden haben, so scheint es, gut gefüllte Beutel. Nun kommt der Riemer, einen hölzernen Bock hat er vor die Tür gestellt, darauf ein Prachtstück von einem Sattel, so wie die Steigbügel blitzen, müssen sie versilbert sein.
Überall ist der fade Geruch von Malz zu spüren; jeder Ware, die zum Verkauf angeboten wird, haftet er an. Diesen Malzgeruch kann man essen wie Brot. Am Rande von Rohatyn, in Babińce, gibt es einige kleine Brauereien, von dort breitet sich der sättigende Dunst über die ganze Umgebung aus. In vielen Lädchen in Rohatyn wird Bier verkauft, die etwas besseren Geschäfte führen auch Branntwein und Trinkhonig, vor allem den beliebten Trójniak, der nicht zu süß und nicht zu wässrig ist. Der jüdische Kaufmann Wakschul bietet sogar echten Ungar- und Rheinwein an, außerdem einen leicht säuerlichen Tropfen, den er aus der Walachei bezieht.
Der Pater bewegt sich an den Ständen entlang, die aus allem möglichen Material gefertigt sind – Bretter, grob gewebte Leinwand, Flechtwerk, selbst Lagen von Laub finden Verwendung. Ein Weiblein mit weißem Kopftuch verkauft Kürbisse vom Wagen herab, das leuchtende Orange lockt die Kinder an. Neben ihr preist eine andere ihre Käselaibchen, die sie auf Meerrettichblättern ausgebreitet hat. Ein Stück weiter stehen noch andere Krämerinnen, die Handel treiben, weil sie entweder Witwen sind oder einen Trunkenbold zum Manne haben – Öl, Salz und Leinwand bieten sie feil. Gewöhnlich kauft der Pater bei der Pastetenbäckerin, eben schenkt er ihr ein freundliches Lächeln. Hinter ihr sind zwei Stände mit grünen Zweigen geschmückt; ein Zeichen, dass es frisch gebrautes Bier gibt. Und hier ein reich bestückter Stand, den armenische Kaufleute führen – herrliche, luftige Stoffe, Messer in kunstvoll verzierten Scheiden –, gleich daneben gibt es Trockenfisch, dessen Geruch in die wollenen türkischen Wandteppiche zieht. Wieder ein paar Schritte weiter trägt ein Mann in einem staubbedeckten Kaftan an Schnüren einen Kasten über den mageren Schultern; Eier hat er anzubieten, jeweils ein Dutzend in Körben, die aus Gras geflochten sind. Ein anderer verkauft Eier im Schock, in großen Körben, zu einem wahren Spottpreis. Der Stand eines Bäckers ist ganz mit Beigeln behangen – ein Kringel ist jemandem in den Schlamm gefallen, jetzt frisst ihn gierig ein kleiner Hund.
Gehandelt wird hier mit allem, womit man handeln kann. Auch mit geblümten Stoffen, Tüchern und Schals, die direkt vom Basar in Stambul stammen, Kinderschuhe gibt es, Obst und Nüsse. Der Mann dort beim Zaun bietet eine Pflugschar an und Nägel in allen Formen, von Stecknadelgröße bis zum Zimmermannsnagel für Dachgebälk. Neben ihm hat eine stämmige Frau in gestärkter Haube Schnarren für Nachtwächter ausgebreitet: Der Klang der kleinen erinnert eher an Grillenzirpen, als dass er zur Schlafenszeit gemahnen würde, die großen wiederum bewirken genau das Gegenteil, sie würden einen Toten erwecken.
Wie oft wurde den Juden verboten, mit Waren zu handeln, die mit der Kirche zu tun haben! Nicht nur die Priester haben dagegen gewettert, die Rabbiner taten es ebenso. Geholfen hat es nichts. So gibt es auch jetzt wieder schöne Gebetbücher mit schmucken Bändchen als Lesezeichen und wunderschönen Buchstaben in Silberprägung auf dem Einband, die unter den Fingerspitzen wirken, als wären sie warm und lebendig. Ein adrett gekleideter Mann, der fast elegant anmutet in seiner Pelzmütze, hält die Bücher in den Händen, als wären es Reliquien. In cremefarbenes Seidenpapier sind sie eingeschlagen, damit der schmutzig-neblige Tag die unschuldig christlichen und noch nach Druckerschwärze duftenden Schriften nicht befleckt. Außerdem hat der brave Mann Wachskerzen anzubieten und Heiligenbilder, und die Heiligen haben einen Heiligenschein.
Der Pater geht zu einem der wandernden Buchhändler, in der Hoffnung, etwas Lateinisches zu finden. Doch bietet der Mann nur jüdische Schriften feil, und neben den Büchern liegen Gegenstände, deren Zweck der Geistliche nicht kennt.
Je tiefer der Blick in die Seitengassen dringt, desto schärfer springt die Armut ins Auge, wie eine ungewaschene Zehe im löchrigen Stiefel. Die schiere Armut, die sich zur Erde beugt. Keine Lädchen oder Kramstände mehr, sondern elende Verschläge, die Hundehütten gleichen, aus kümmerlichen Holzresten gezimmert, die von Abfallhaufen zusammengeklaubt wurden. In einer dieser Hütten sitzt ein Flickschuster und richtet Schuhe, die schon wer weiß wie oft genäht und besohlt worden sind. In einer anderen, die ganz mit eisernen Töpfen behangen ist, werkelt ein Kesselflicker. Er hat ein mageres, eingefallenes Gesicht, die Mütze sitzt ihm in der Stirn, die von braunen Flecken übersät ist. Der Pater hätte Angst, hier seine Töpfe flicken zu lassen, womöglich würden die Finger dieses Unglückseligen eine böse Krankheit übertragen. Daneben wetzt ein Alter Messer und allerlei Sensen und Sicheln. Seine Werkstatt besteht aus einem Stein in Form eines kleinen Rades, das er um den Hals trägt. Bringt jemand eine Klinge, die geschärft werden soll, klappt er ein einfaches Gestell auf, mithilfe einiger Lederriemen verwandelt sich das Ganze in eine primitive Maschine, und der Stein, von Hand in Schwung versetzt, schleift an der metallenen Schneide. Manchmal fliegen ein paar richtige Funken von dem Wetzstein in den Schlamm, worüber sich vor allem die Kinder freuen, allesamt ungewaschen und von Krätze befallen. Mit dieser Arbeit verdient der Alte ein paar armselige Groschen. Er könnte auch mit dem Stein um den Hals ins Wasser gehen – ein weiterer Vorzug dieses Metiers.
Zerlumpte Frauen sammeln auf den Gassen Sägespäne und Pferdeäpfel als Brennmaterial. An den Lumpen ist nicht zu erkennen, ob es jüdisches, orthodoxes oder katholisches Elend ist. Die Armut kennt weder Konfession noch Staatspapiere.
Si est, ubi est?, fragt sich der Geistliche im Gedanken an das Paradies. Wenn es denn existiert, so gewiss nicht in Rohatyn, und vermutlich auch nirgends sonst in Podolien. Und falls jemand glauben sollte, in den größeren Städten sei es besser, so ist er auf dem Holzweg. Zwar war der Dechant Chmielowski noch nie in Warschau oder Krakau, doch hat er dies und jenes erfahren aus den Erzählungen des Bernhardinerpaters Pikulski, der weiter herumgekommen ist als er; außerdem hört er so allerhand auf den Gütern der Adligen.
Das Paradies, den Garten der Lüste, hat der Schöpfer an einen herrlichen, doch unbekannten Ort verlegt. In Athanasius Kirchers Arca Noë heißt es, es liege im Lande der Armenier, hoch in den Bergen; Brunus hingegen behauptet, sub polo antarctico – am Südpol – sei das Paradies zu finden. Vier Flüsse verweisen angeblich auf seine Nähe: Gebon, Philon, Euphrat und Tigris. Wiederum andere Gelehrte, die dem Paradies auf Erden keinen Platz zuzuweisen wussten, erhoben es in die Lüfte, fünfzehn Ellen über den Gebirgen. Das allerdings will dem Dechanten ein wenig närrisch erscheinen. Wie sollte das sein? Würden dann die Menschen, die auf der Erde unter dem Paradies leben, selbiges von unten sehen? Die Fersen der Heiligen betrachten?
Andererseits wollte man aber auch gegen diejenigen opponieren, welche die irrige Annahme zu verbreiten suchen, was die Heilige Schrift vom Paradiese sage, besitze nur eine mystische Bedeutung und solle also allein im allegorischen Sinne verstanden werden. Nicht nur seines Amtes wegen, sondern aus tiefem Herzen hegt der Pater Chmielowski die Überzeugung, dass man die Heilige Schrift wörtlich begreifen müsse.
Vom Paradies weiß er fast alles, denn vor eben einer Woche hat er ein Kapitel seines Buches beendet, an dem er voller Ehrgeiz arbeitet – und dieses Kapitel ist aus allen Büchern kompiliert, die ihm in Firlejów zur Verfügung stehen: einhundertdreißig Titel. Manche hat er in Lemberg erworben, für manche ist er sogar bis nach Lublin gereist.
Hier ist auch schon das Eckhaus, ein bescheidenes Gebäude – dort möchte er hin. Eine Empfehlung von Pikulski. Die niedrige zweiflüglige Tür steht weit offen; ein würziger Geruch weht heraus, gänzlich unerwartet in diesem Dunst von Pferdedung und nassem Herbst, und eine andere, scharfe Note ist noch dabei, dem Geistlichen bereits bekannt: kaffa. Bisher ist Chmielowski diesem Gebräu abhold gewesen, doch wird er sich dem Trunk wohl einmal annähern müssen.
Der Pater blickt zurück, hält Ausschau nach Roschko, entdeckt ihn, wie er mit mürrisch prüfendem Blick Schafpelze hin und her wendet. Der ganze Markt ist versunken in seinem Treiben, niemand achtet auf den Geistlichen in dem wimmelnden Stimmengewirr.
Über dem Eingang des Hauses verkündet ein ungelenk gefertigtes Schild:
SCHOR WARENLAGER
Dann folgen hebräische Buchstaben. An der Tür hängt eine Art Plakette aus Metall, daneben sind Zeichen zu sehen, und der Dechant erinnert sich, was er bei Kircher gelesen hat: Wenn bei den Juden eine Frau niederkommt und die Angst vor Hexen umgeht, schreiben sie die folgenden Worte an die Wände: »Adam, Hawa. Hutz – Lilith.« Das bedeutet: Adam und Eva. Hinfort – Lilith! Ja, das muss es sein. Dann wurde also auch hier vor Kurzem ein Kind geboren.
Der Pater tritt über die hohe Schwelle und taucht in den warmen, würzigen Geruch ein. Es dauert eine Weile, bis seine Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt haben. Der Tag dringt hier nur durch ein kleines Fensterchen herein, das zudem mit Pflanztöpfen verstellt ist.
Hinter der Ladentheke steht ein Bengel, dem eben der erste Schnurrbartflaum sprießt. Er hat einen üppigen Mund, der leicht zu beben beginnt, als er den Pater sieht, und dann nach Worten sucht. Der Arme ist völlig überrascht.
»Wie heißt du denn, mein Junge?«, fragt Chmielowski, um zu zeigen, wie sicher er sich fühlt in diesem düsteren, niedrigen Gewölbe, auch möchte er den Knaben dazu zu bewegen, etwas zu sagen, doch der bleibt stumm.
»Quod tibi nomen est?«, versucht es der Geistliche noch einmal, doch das Lateinische, das die Verständigung erleichtern soll, klingt viel zu feierlich – als wäre der Pater gekommen, um einen Exorzismus vorzunehmen, wie Christus, von dem es bei Lukas heißt, er habe sich mit eben dieser Frage an den Besessenen gewandt. Der Bengel reißt die Augen nur noch weiter auf, macht »bh, bh, bh« und verschwindet wie ein geölter Blitz hinter den Regalen, wobei er einen Knoblauchzopf vom Nagel reißt.
Chmielowski befindet, dass das unklug war; er kann nicht erwarten, dass hier jemand Lateinisch spricht. Mit kritischem Blick schaut er an sich hinunter. Unter dem Mantel schauen die Rosshaarknöpfe der Soutane hervor. Deshalb wahrscheinlich hat der Bengel sich so erschreckt – wegen der Soutane. Und er muss schmunzeln, denn der Prophet Jeremias fällt ihm ein, der auch einmal wirren Sinnes war und stammelte: »Aaa, Domine Deus, ecce nescio loqui!« – »Ach, HERR, Herr! Ich verstehe nicht zu reden!«
Der Dechant nennt den Bengel für sich Jeremias. Aber was nun, nachdem er so mir nichts, dir nichts verschwunden ist? Er sieht sich in dem Laden um, knöpft sich den Mantel zu. Pater Pikulski hat ihm geraten, hierher zu kommen, und er ist dem Rat gefolgt. Ob das wirklich eine gute Idee war? Er möchte es jetzt bezweifeln.
Von draußen kommt niemand herein, wofür Chmielowski dem Herrgott dankt. Der Anblick wäre auch gar zu wunderlich – ein katholischer Geistlicher, der Dechant von Rohatyn, um genau zu sein, wartet im Laden eines Juden, bedient zu werden, als wäre er ein Hausweib.
Pater Pikulski hatte ihm geraten, zu Rabbi Dubs nach Lemberg zu gehen, selbst sei er schon mehrfach dort gewesen und vieles hätte er erfahren können. Also begab sich auch Chmielowski dorthin, der alte Dubs aber hatte offenbar schon genug von katholischen Geistlichen, die ihn nach Büchern ausfragten. Als er Chmielowskis Bitte hörte, zeigte er sich unangenehm überrascht, und mit dem Gesuchten konnte er nicht dienen. Oder er tat nur so, als besäße er es nicht. Er machte ein biederes Gesicht, schüttelte den Kopf und schnalzte leise. Als Chmielowski fragte, wer ihm wohl helfen könne, fuchtelte Dubs mit den Armen, wandte den Kopf, als stünde jemand hinter ihm – das mochte besagen, dass er es nicht wusste oder nicht die Absicht hatte, es mitzuteilen. Pikulski erklärte später, dass es um jüdische Häresie gehe, denn obwohl die Juden sich damit rühmten, es gebe keine Häresie bei ihnen, waren sie offenbar doch gewillt, gewisse Ausnahmen zuzulassen, und diese hassten sie dann von ganzem Herzen.
Pikulski riet ihm schließlich, zu Schor zu gehen. Das Haus mit dem Laden am Markt. Dabei sah er Chmielowski seltsam an. War das Ironie? Oder kam es Chmielowski nur so vor? Vielleicht hätte er versuchen sollen, diese jüdischen Bücher über Pikulski besorgen zu lassen? Auch wenn er ihn nicht unbedingt mochte. Aber dann müsste er wenigstens jetzt nicht hier stehen und schwitzen. Eine peinliche Lage. Doch weil der Dechant auch seinen Trotz hatte, befand er sich jetzt in Rohatyn. Und etwas anderes war noch im Spiel, schwer zu erklären, schwer zu fassen – ein kleiner Wortzauber hatte sich in die Geschichte eingeschlichen. Wer wollte glauben, dass solche Dinge Einfluss haben auf den Gang der Welt? Chmielowski arbeitete nämlich eifrig über einem Passus bei Kircher, in dem von dem großen Ochsen Schorobor die Rede ist. Und diese Ähnlichkeit der Wörter brachte ihn womöglich hierher: Schor, Schorobor. Seltsam sind die Wege des Herrn.
Wo aber sind die berühmten Bücher? Wo ist die Persönlichkeit, die so furchtsamen Respekt einflößt? Das Geschäft sieht aus wie jeder gewöhnliche Krämerladen, doch der Besitzer ist angeblich der Nachfahre eines großen Rabbiners, des hochverehrten Weisen Salman Naftali Schor. Und hier jetzt der Knoblauch und die Kräuter, Tiegel mit Gewürzen, Einmachgläser in allen Größen, darin verschiedene Ingredienzien, zerstoßen, gemahlen oder noch in ihrer ursprünglichen Gestalt – Vanilleschoten, Gewürznelken, Muskatnuss. Außerdem liegen Stoffballen auf den Regalbrettern, auf eine Lage Heu gebettet. Seide und Atlas, wenn nicht alles täuscht, die leuchtenden Farben locken das Auge. Chmielowski überlegt, ob er nicht etwas brauche, da hat auch schon eine windschiefe Aufschrift auf einem großen dunkelgrünen Glas seine Aufmerksamkeit angezogen: »Herba the«. Jetzt weiß er, worum er bitten wird, wenn endlich jemand kommt, ihn zu bedienen: um eine kleine Portion dieser Kräuter, die seine Laune heben, was nichts anderes bedeutet, als dass er arbeiten kann, ohne müde zu werden. Außerdem fördert der Aufguss die Verdauung. Auch ein paar Gewürznelken könnte er noch kaufen, dann schmeckt der Wein besser, den er sich abends heiß macht. Die letzten Nächte waren so kalt, dass ihm die Füße zu Eisklötzen erstarrten und er sich nicht mehr auf sein Schreiben konzentrieren konnte. Er sucht mit den Blicken, ob hier nicht irgendwo eine Bank – als zwischen den Regalen ein kräftig gebauter, bärtiger Mann auftaucht. Er trägt ein langes wollenes Gewand, unter dem türkische Schnabelschuhe hervorspitzen, über die Schultern hat er sich einen dünnen, dunkelblauen Mantel geworfen. Er blinzelt, als käme er gerade aus einem Brunnenschacht. Hinter seinem Rücken macht jener Jeremias, der eben noch Hals über Kopf davongestürzt ist, neugierige Augen, und neben ihm erscheinen zwei weitere Gesichter, die ihm sehr ähnlich sehen, rotbackig und nicht minder vorwitzig. Gegenüber, in der Tür zum Markt hin, kommt atemlos ein schmächtiges Kerlchen zum Stehen, offenbar schon ein junger Mann, denn ein üppiger blonder Ziegenbart ziert sein Kinn. Er stützt sich an den Türstock, ringt nach Atem, er muss gerannt sein, was die Beine hergeben. Mit dreister Offenheit mustert er den Geistlichen, verzieht den Mund zu einem schelmischen Lächeln, wobei er gesunde, breit auseinanderstehende Zähne zeigt. Der Geistliche fragt sich, ob das nicht Hohn ist, der ihm da entgegengebracht wird. Die würdevolle Gestalt im Mantel behagt ihm eher, und an diese wendet er sich jetzt mit ausgesuchter Höflichkeit:
»Wenn der verehrte Herr die Heimsuchung verzeihen möchte …«
Der Mann sieht ihn in gespannter Erwartung an, dann ändert sich sein Gesichtsausdruck, der Anflug eines Lächelns zeichnet sich ab. Der Dechant begreift, dass sein Gegenüber nichts versteht, so versucht er es auf Latein, in freudiger Zuversicht, seinesgleichen gefunden zu haben.
Der Jude lenkt den Blick auf den immer noch keuchenden Burschen in der Tür, der sich jetzt mit forschem Schritt von der Schwelle löst; energisch zieht er sich die Jacke aus dunklem Tuch zurecht:
»Ich werde übersetzen«, verkündet er mit unerwartet tiefer Stimme, seine Worte haben eine weiche ruthenische Melodie, und während er freimütig auf den Dechanten deutet, sagt er ergriffen, dass dieser ein echter, waschechter Priester sei!
Dass ein Dolmetscher vonnöten sein könnte – daran hatte Chmielowski überhaupt nicht gedacht. Unbehaglich wird ihm zumute, denn die Angelegenheit, die er diskret behandelt wissen wollte, gewinnt unerwartet öffentlichen Charakter; fehlte nur noch, dass sich gleich der ganze Markt hier versammelt. Am liebsten wäre er wieder gegangen, hinaus in den kühlen Nebel, der nach Pferdedung riecht. Er fühlt sich bedrängt in diesem niedrigen Laden, in der Luft, die schwer ist vom Geruch der Gewürze, und jetzt steckt auch schon jemand von draußen die Nase herein, neugierig, was hier wohl im Gange sei.
»Ich möchte mit dem verehrten Elischa Schor sprechen, wenn es gestattet ist. Unter vier Augen …«
Die Juden sind überrascht. Sie wechseln einige Sätze. Jeremias verschwindet und taucht erst nach einer geraumen Weile unerträglichen Schweigens wieder auf. Das Anliegen des Paters wurde offenbar genehmigt, sie führen ihn hinter die Regale. Das Ganze wird begleitet von Flüsterstimmen, dem Tapsen von Kinderfüßen und unterdrücktem Gekicher – als stände hinter den dünnen Wänden eine ganze Menschenmenge, die durch die Bretterritzen zusieht, wie der Dechant von Rohatyn durch das verwinkelte jüdische Haus geht. Es erweist sich nämlich, dass der Laden am Markt nur der äußerste Ausläufer einer verzweigten Struktur ist, die etwas von einem Bienenstock hat: Zimmer, kleine Flure, Treppchen – viel größer ist das Haus, als es von der Marktseite aus scheinen mag, um einen Innenhof herum errichtet, den der Pater nur aus dem Augenwinkel durch das kleine Stubenfenster sehen kann, als sie einen Moment innehalten.
»Ich bin Hrytschko«, sagt das Kerlchen mit dem Ziegenbart, und Chmielowski wird sich bewusst, dass er alleine nicht mehr herausfände aus diesem Immenstock. Er beginnt zu schwitzen, knarrend öffnet sich eine der Türen, und ein schlanker Mann im besten Alter steht auf der Schwelle. Er hat ein helles, unergründliches Gesicht, trägt einen weißen Bart, der Rock reicht ihm bis über die Knie, seine Füße stecken in wollnen Socken und schwarzen Pantoffeln.
»Das ist Rebbe Elischa Schor«, flüstert Hrytschko ergriffen.
Das Zimmer ist klein und niedrig, die Einrichtung bescheiden. In der Mitte steht ein ausladender Tisch, darauf liegt ein aufgeschlagenes Buch, daneben stapeln sich weitere Bände – der Pater sucht gierig die Buchrücken ab, er möchte die Titel lesen. Über die Juden weiß er überhaupt nur wenig, und die Juden aus Rohatyn kennt er lediglich vom Sehen.
Es gefällt ihm, dass sie beide recht klein sind. In der Gegenwart großer Menschen empfindet er immer ein Unbehagen. So stehen sie einander gegenüber, und Chmielowski hat den Eindruck, auch Elischa Schor finde Gefallen an der Ähnlichkeit der Körpergrößen. Der Jude lässt sich bequem nieder, deutet lächelnd auf die Bank, der Pater möge ebenfalls Platz nehmen.
»Mit Verlaub und unter diesen außergewöhnlichen Umständen gestatte ich mir, dem werten Herrn incognito gegenüberzutreten, nachdem ich so viel über Eure Weisheit und Gelehrsamkeit gehört habe …«
Hrytschko stockt in der Hälfte des Satzes:
»In-co-gnito?«
»Nun … will sagen, dass ich um Diskretion suppliziere.«
»Um was? … Dis-kre-tion? … Sup-pli …?«
Chmielowski verstummt. Da hat er ja einen feinen Dolmetscher erwischt. Wie sollen sie sich jetzt verständigen? Chinesisch parlieren? Er bemüht sich um möglichst einfache Sätze:
»Bitte betrachten Sie das als Geheimnis, ich kann nicht umhin zu bekennen, dass ich katholischer Priester bin, der Dechant von Rohatyn. Vor allem aber bin ich ein Autor.« Das Wort »Autor« unterstreicht er mit erhobenem Zeigefinger. »Und hier und heute möchte ich nicht als Geistlicher sprechen, sondern als Autor, der an einem gewissen Opusculum arbeitet.«
»O-pus-cu-lum …?«, lässt sich mit zweifelnder Stimme Hrytschko vernehmen.
»Ein nicht sehr großes, sozusagen kleineres Werk …«
»Ah so … Ich bitte Hochwürden um Verzeihung, ich bin ein einfacher Mann, mit dem Polnischen tue ich mir schwer, ich kenne nur die Sprache, wie sie die Leute reden. Was man so aufschnappt bei den Pferden.«
»Von den Pferden?«, wundert sich der Pater, der verärgert ist über den schlechten Dolmetscher.
»Weil ich doch mit Pferden zu tun habe, beim Handel.«
Hrytschko behilft sich in seiner Rede mit den Händen, und mit so dunklen, undurchdringlichen Augen schaut er den Pater an, dass Chmielowski für einen Augenblick denkt, er sei womöglich blind.
»Nachdem ich mehrere Hundert Autoren von A bis Z studieret«, fährt der Geistliche fort, »deren Bücher ich mir hier geliehen, dort auch gekauft habe, sehe ich, dass ich viele Bücher noch nicht konsultierte, und sie zu erlangen, bereitet mir große Schwierigkeiten.«
Er macht eine Pause, in Erwartung einer Erwiderung, doch Schor nickt nur mit einem freundlichen Lächeln, das nicht zu deuten ist.
»Und da ich hörte, dass der werte Herr hier im Hause eine bemerkenswerte Bibliothek besitze, fasste ich den Mut, ohne freilich inkommodieren zu wollen …«, unwillig verbessert er sich, »stören zu wollen oder Umstände zu bereiten, und entgegen allgemeiner Gepflogenheiten, doch gewiss zum Wohle auch anderer Gelehrter, hierher zu kommen und vorzusprechen …«
Er bricht ab, da sich in diesem Augenblick mit Schwung die Tür öffnet und eine Frau den niedrigen Raum betritt. Hinter ihr folgen, flüsternd, tuschelnd, Gesichter, im Dämmerlicht kaum zu erkennen. Eines der Kinder wimmert mit hellem Stimmchen, dann wird es still, als sollte sich nun alle Aufmerksamkeit auf die Frau richten: den Kopf entblößt, von dem die Haare in üppigen Locken fließen, bewegt sie sich mit sicherem Schritt; den Männern schenkt sie nicht die geringste Beachtung, den Blick nach vorne gerichtet, hält sie ein Tablett mit einem Krug und getrockneten Früchten. Sie trägt einen breitgeschnittenen geblümten Rock, darüber eine bestickte Schürze, klappert mit den Absätzen spitz zulaufender Stiefelchen. Zierlich ist sie, aber hübsch anzusehen, ihr Körper zieht die Blicke an. Hinter ihr trippelt ein kleines Mädchen mit zwei Gläsern in den Händen. Mit solchem Entsetzen schaut die Kleine auf den Pater, dass sie gegen die Frau stolpert und hinfällt. Die Gläser rollen über den Boden, ein Glück, dass sie so dickwandig sind. Die Frau achtet nicht auf das Kind, sie sieht jetzt den Pater an, mit einem raschen, kecken Blick. Ihre dunklen Augen glimmen, groß und unergründlich, und eine jähe Röte überfliegt die erschreckend weißen Wangen. Der Dechant, der keinen Umgang pflegt mit jungen Frauen, ist von dem unerwarteten Auftritt überrumpelt; er muss schlucken. Mit hartem Laut stellt sie den Krug auf den Tisch, den Teller, die beiden Gläser, die sie vom Boden aufgehoben hat, dann verlässt sie, den Blick abermals starr nach vorne gerichtet, den Raum. Die Tür schlägt zu. Auch Hrytschko, der Dolmetscher, scheint sich unbehaglich zu fühlen. Elischa Schor springt unterdessen auf, hebt das Mädchen hoch, setzt es auf seine Knie, doch die Kleine windet sich frei, läuft ihrer Mutter hinterher.
Chmielowski hätte seinen Kopf verwettet, dass die ganze Szene sich nur abspielte, weil man ihn sehen wollte. Ein Pater in einem jüdischen Haus! Exotisch wie ein Salamander. Ja und? Ist der Arzt, der mich behandelt, etwa kein Jude? Und wer bereitet mir die Arzneien zu? Auch ein Jude. Und die Sache mit den Büchern hat schließlich in gewissem Sinne auch mit Hygiene zu tun.
»Bücher«, wiederholt der Geistliche und deutet auf die Rücken der Folianten und der Bände im Elsevier-Format auf dem Tisch. Auf jedem sind, in Goldfarbe geschrieben, zwei Zeichen zu sehen, die Chmielowski als Initialen des Besitzers deutet. Die hebräischen Buchstaben kann er erkennen: .
Nun holt er sein Billett für diese Reise zum Volke Israel hervor, legt behutsam das mitgebrachte Buch auf den Tisch. Sein Lächeln ist Triumph – es handelt sich um Athanasius Kirchers Turris Babel, ein großes Buch nicht nur in Hinsicht auf das Format, sondern ebenso auf den Inhalt, und Chmielowski hat einiges riskiert, es mitzunehmen. Was, wenn es ihm in den stinkenden Schlamm von Rohatyn gefallen wäre? Was, wenn es ihm ein Schurke auf dem Markt entrissen hätte? Ohne dieses Buch wäre der Dechant nicht der, der er ist. Ohne dieses Buch wäre er ein gewöhnlicher, beschränkter Pfaffe, ein Jesuitenlehrer auf einem Adelsgut, ein eitler Diener der Kirche, mit prächtigen Ringen und voll Widerwillen für die Welt.
Er schiebt das Buch näher zu Schor. Als präsentierte er ihm seine Ehefrau. Klopft sacht auf den Einband aus Holz.
»Ich habe noch mehr davon. Aber Kircher ist der beste.«
Er öffnet es auf gut Glück – sie sehen eine Erdkugel, auf der sich ein hoher, schlanker Kegel erhebt: der Turm von Babel.
»Kircher weist nach, dass der Turm von Babel, dessen Beschreibung wir in der Bibel haben, nicht so hoch gewesen sein kann, wie es dargestellt wird. Ein Turm, der bis in die Sphäre des Mondes reicht, würde die gesamte kosmische Ordnung stören. Sein Fundament auf der Erde müsste von gewaltigen Ausmaßen sein. Der Turm würde die Sonne verdecken, was verheerende Folgen für die gesamte Schöpfung hätte. Die Menschen müssten den gesamten Holzvorrat und allen Lehm auf der Erde aufbrauchen …«
Chmielowski hat das Gefühl, häretische Gedanken zu verkünden, und eigentlich weiß er überhaupt nicht, warum er das dem schweigend dasitzenden Juden erzählt. Er möchte, dass ihn sein Gegenüber als Freund ansieht und nicht als Feind. Aber wird er das erreichen können? Vielleicht ist es möglich sich zu verständigen, auch wenn der eine des anderen Sprache nicht spricht, der eine mit des anderen Gebräuchen nicht vertraut ist, auch wenn sie sich persönlich nicht kennen, nichts wissen von den Dingen, den Gegenständen des anderen, sein Lachen, seine Gesten, seine Zeichen nicht zu deuten verstehen – vielleicht dass es dann möglich ist, sich mithilfe von Büchern zu verständigen? Ist nicht gerade das der einzige Weg? Läsen die Menschen dieselben Bücher, lebten sie in derselben Welt – so aber leben sie in einer jeweils anderen, wie die Chinesen, von denen Kircher schreibt. Und dann gibt es auch noch solche, und beileibe nicht wenige, die überhaupt nicht lesen. Ihr Verstand ist in Schlaf versetzt, ihr Geist ist schlicht, den Tieren ähnlich, wie bei den Bauern mit den ausdruckslosen Augen. Wenn er, der Pater Chmielowski, König wäre, würde er an einem Wochentag statt Fronarbeit Lektüre verordnen, den ganzen Bauernstand würde er zu den Büchern jagen, da sähe es gleich anders aus in der Rzeczpospolita! Vielleicht ist es auch eine Frage des Alphabets – weil es nicht nur ein Alphabet gibt, sondern viele, so formt dann jedes auf seine Weise die Gedanken. Die Alphabete sind wie Ziegelsteine – aus der einen Sorte, den gebrannten, ebenmäßig glatten, entstehen Kathedralen, aus der anderen, den lehmigen und rauen, gewöhnliche Häuser. Und obwohl doch das lateinische Alphabet ohne Frage das vollkommenste ist, hat Schor offenbar keine Kenntnis davon. So deutet Chmielowski jetzt auf den Stich, und dann auf einen zweiten, und noch auf einen dritten, und er sieht, wie sich der Rabbi mit wachsendem Interesse über die Abbildungen beugt, bis er schließlich von irgendwoher ein Augenglas hervorholt, schmuck in einen Drahtbügel gefasst – ein solches Stück möchte Chmielowski auch gerne haben, er muss fragen, wo man es bekommen kann. Auch der Dolmetscher scheint interessiert, so beugen sie sich zu dritt über den Stich.
Der Geistliche freut sich, dass er sie jetzt beide im Netz hat; im Bart des Juden sieht er kastanienfarbene und golden schimmernde Haare.
»Wir könnten unsere Bücher tauschen«, schlägt Chmielowski vor.
Und er erzählt, dass er in seiner Bibliothek in Firlejów noch zwei Werke von Kircher hat, Arca Noë und Mundus subterraneus, wohl verwahrt und verschlossen, die Bände sind zu wertvoll, um sie täglich in die Hand zu nehmen. Er weiß, dass es auch noch weitere Titel gibt, die aber kennt er nur aus flüchtigen Erwähnungen. Und viele andere Denker vergangener Zeiten hat er noch gesammelt, so etwa – schmeichelnd fügt er es hinzu – den jüdischen Historiographen Flavius Josephus.
Man schenkt ihm Kompottsaft ein, schiebt ihm den Teller mit den getrockneten Feigen und Datteln zu. Der Geistliche kostet sie andächtig, lange hat er keine mehr gegessen – die himmlische Süße hebt sofort seine Laune. Er weiß, dass er jetzt den Kern seines Anliegens zur Sprache bringen muss, es ist höchste Zeit, er schluckt die Süße und kommt zur Sache; doch ehe er zu Ende gesprochen hat, weiß er, dass es voreilig war, viel wird er nicht mehr erreichen.
Er bemerkt es am veränderten Verhalten Hrytschkos, auch ist er sich sicher, dass der Bursche bei dem, was er übersetzt, sein Teil dazutut. Nur weiß er nicht, ob er Warnungen hinzufügt oder zu Chmielowskis Gunsten spricht. Unmerklich rutscht Elischa Schor auf seinem Stuhl zurück, beugt den Kopf in den Nacken und schließt die Augen, als begäbe er sich zur Beratung in seine eigene, innere Dunkelheit.
In dieser Haltung verharrt er, bis der Pater – unwillkürlich – einen vertraulichen Blick mit seinem Dolmetscher wechselt.
»Der Rebbe hört auf die Stimmen der Alten«, erklärt dieser flüsternd, worauf Chmielowski nickt, als wäre er im Bilde, dabei begreift er überhaupt nichts. Vielleicht steht dieser Jude tatsächlich mit irgendwelchen Teufeln in Verbindung; bei den Juden wimmelt es ja nur so von Lamien und Liliths. Schors Zögern, sein Verharren mit geschlossenen Augen – nein, es wäre besser gewesen, nicht zu kommen. Was für eine heikle Geschichte. Wenn es nur nicht mit Schimpf und Schande endet.
Schor steht auf, wendet sich zur Wand, senkt den Kopf und bleibt eine Weile so stehen. Chmielowski wird ungeduldig. Ist es ein Zeichen, dass er gehen soll?
Auch Hrytschko hat die Augen halb geschlossen, seine jugendlich langen Wimpern werfen zarte Schatten auf die flaumigen Wangen. Sind die beiden eingeschlafen? Der Geistliche räuspert sich leise, dieses Schweigen hat ihm den letzten Rest an Selbstvertrauen genommen. Er bedauert es aufrichtig, hierher gekommen zu sein.
Unvermutet tritt Rabbi Schor zu den Schränken. Nimmt mit feierlicher Sorgfalt einen dicken Folianten heraus, auf dem dieselben Zeichen zu sehen sind wie auf den anderen Büchern. Legt ihn vor Chmielowski auf den Tisch. Er schlägt das Buch von hinten auf und blättert. Der Geistliche sieht eine prächtig verzierte Titelseite …
»Sefer ha-Sohar«, sagt Schor voller Ehrfurcht und verstaut den Band wieder im Schrank.
»Wer sollte das Hochwürden auch vorlesen …?«, sagt Hrytschko, wie zum Trost.
Chmielowski lässt bei Schor zwei Bände seiner Nowe Ateny – Neues Athen – zurück, als Anreiz für zukünftige Begegnungen in Sachen Büchertausch. Er klopft mit dem Zeigefinger auf die Bücher, deutet dann auf sich, mitten auf die Brust: Ich habe das geschrieben. Das sollten sie lesen, wenn sie nur die Sprache verstünden. Sie könnten daraus viel erfahren über die Welt. Er wartet auf eine Reaktion von Schor, doch der hebt nur leicht die Braue.
Chmielowski und Hrytschko gehen hinaus in die empfindlich kühle Luft. Hrytschko redet noch, Chmielowski betrachtet ihn aufmerksam – sein jugendliches Gesicht mit dem Flaum an den Wangen, die langen, gebogenen Wimpern, die ihm etwas Kindliches verleihen, seine bäuerliche Kleidung.
»Bist du Jude?«
»A wo …«, erwidert Hrytschko und zuckt mit den Schultern. »Ich bin von hier, aus Rohatyn, da, aus diesem Haus. Rechtgläubige Christen sind wir.«
»Woher kennst du dann ihre Sprache?«
Hrytschko kommt näher, fast Schulter an Schulter geht er neben dem Pater her, er fühlt sich wohl ermutigt zu dieser Vertraulichkeit. Seine Mutter und sein Vater, so erzählt er, starben vor sechs Jahren an der Seuche. Sie hatten mit den Schors Geschäfte gemacht, der Vater war Gerber, und als er starb, hat Schor sich um Hrytschko gekümmert, auch um seine Großmutter und den jüngeren Bruder, Olesch. Schor bezahlte die Schulden und sorgte für die drei. So leben sie hier, in der Nachbarschaft, und jetzt hat er mehr mit Juden zu tun als mit seinesgleichen, und er weiß selbst nicht, wann er angefangen hat, ihre Sprache zu verstehen, jedenfalls spricht er sie jetzt gut, was von Nutzen ist bei allen möglichen Geschäften, denn die Juden, und vor allem die älteren, sprechen nur ungern das Polnische oder Ruthenische. Die Juden sind auch nicht so, wie die Leute sagen, vor allem die Schors nicht. Die Familie ist zahlreich, herzensgute Menschen sind sie, führen ein gastfreundliches Haus. Immer gibt es einen Happen zu essen, und wenn es kalt ist, auch ein Gläschen Wodka. Und Hrytschko lernt jetzt den Beruf seines Vaters. Gerber werden immer gebraucht.
»Hast du denn keine christlichen Verwandten?«
»Ja, doch, die hab ich, aber die wohnen weit weg und kümmern sich nicht. O … da ist mein Bruder Olesch.«
Ein sommersprossiger Bub läuft herbei, ungefähr acht Jahre alt.
»Hochwürden muss sich um uns keine Sorgen machen, das ist nicht nötig«, sagt Hrytschko heiter, »Gott hat dem Menschen die Augen vorne in den Kopf gegeben, nicht hinten, das heißt, er soll an das denken, was kommt, nicht an das, was schon vergangen ist.«
Der Geistliche muss zugeben, dass das als Beweis für die kluge Umsicht des Schöpfers gelten darf, doch kann er sich nicht erinnern, an welcher Stelle in der Heiligen Schrift davon die Rede ist.
»Lerne von ihnen die Sprache, dann kannst du ihre Bücher übersetzen.«
»A wo, die Bücher, Hochwürden … zu den Büchern zieht’s mich nicht, das macht mir keine Freude. Ich möchte lieber Handel treiben, daran hab’ ich Gefallen. Am liebsten Pferdehandel. Oder wie die Schors, Wodka und Bier verkaufen.«
»Oj, oj, das hat wohl schon abgefärbt …«
»Ja ist es denn eine schlechtere Ware als die anderen? Die Leute müssen trinken, das Leben ist schwer.«
Und er redet noch weiter, wie er so hinter Chmielowski hergeht. Der wäre ihn jetzt doch ganz gerne losgeworden, er wendet sich zum Markt, hält Ausschau nach Roschko, zuerst bei den Schafpelzen, dann auf dem ganzen Gelände, doch immer mehr Menschen sind in der Zwischenzeit gekommen, kein Gedanke, dass er seinen Diener und Fuhrmann fände. So beschließt er, alleine zur Britschka zu gehen. Der Dolmetscher aber hat sich so gut eingefunden in seine Rolle, dass er dem Dechanten noch dies und jenes auseinandersetzt, sichtlich zufrieden, dass er die Möglichkeit hat zu reden. Denn eine große Hochzeit wird es geben im Hause Schor, der Sohn von Elischa (Chmielowski hat ihn im Laden gesehen, jener Jeremias also, der eigentlich Isaak heißt) wird die Tochter mährischer Juden heiraten. Bald kommt ihre ganze Familie, und viele Verwandte noch aus der Gegend werden erwartet, aus Busk und Podhajce, aus Jezierzany und Kopyczyńce, sogar aus Lemberg und vielleicht aus Krakau, aber es ist ja schon spät im Jahr, und wenn man ihn fragen würde, also besser wäre es, im Sommer zu heiraten. Und Hrytschko, die Schnatterdrossel, fährt munter fort, dass es doch fein wäre, wenn Hochwürden auch zu dieser Hochzeit käme, was er sich dann offenbar ausmalt, denn er fängt an zu lachen, und Chmielowski sieht denselben Gesichtsausdruck an ihm, den er eben für Hohn hatte nehmen wollen. Hrytschko bekommt einen Kupfergroschen.
Er schaut auf die Münze und ist im selben Augenblick verschwunden. Chmielowski steht noch eine Weile da, dann taucht er ins Marktgetümmel ein wie in aufgewühltes Wasser; versinkend folgt er der köstlichen Spur – dem herrlichen Pastetenduft.
2
Von einer fatalen Kutschenfederung und der Frauenmalaise der Katarzyna Kossakowska
In derselben Zeit langen die Kastellanin von Kamieniec Podolski, Katarzyna Kossakowska, geborene Potocka, und die ältere Dame, in deren Begleitung sie seit einigen Tagen schon unterwegs ist von Lublin nach Kamieniec, in Rohatyn an. Eine Stunde hinter ihnen fahren Wagen mit den Reisetruhen, darin ihre Kleider, Weißwäsche und das Tafelservice, damit sie an den Orten, an denen sie Rast einlegen, ihr eigenes Porzellan und Besteck benutzen können. Obwohl sie Sendboten vorausschicken, die Verwandte und Bekannte auf den jeweils zunächst liegenden Gütern von der Reise der beiden Frauen in Kenntnis setzen, gelingt es ihnen nicht immer, ein sicheres und kommodes Nachtlager zu bekommen. Dann bleiben Gasthäuser und Herbergen, in denen das Essen oft zu wünschen übrig lässt. Frau Drużbacka, die nicht mehr die Jüngste ist, fühlt sich mehr tot als lebendig. Sie leidet an schlechter Verdauung, was sicher daher rührt, dass jede Mahlzeit im Magen durchgerüttelt wird wie Rahm im Butterfass. Doch Sodbrennen ist keine Krankheit. Schlimmer steht es um die Kastellanin Kossakowska – seit gestern plagt sie der Unterleib, jetzt sitzt sie in der Kutsche, in eine Ecke gedrückt, völlig entkräftet, kaltschweißig und derart bleich, dass die Drużbacka um ihr Leben zu bangen beginnt. Deshalb suchen sie jetzt Hilfe, hier, in Rohatyn, wo der Starost, Szymon Łabęcki, ein angeheirateter Verwandter der Kastellanin ist – wie im Übrigen jede bedeutendere Persönlichkeit in Podolien.
Es ist Markttag, und die lachsfarbene, gefederte Kutsche mit dem golden schimmernden Ornament in weicher Linienführung, dem aufgemalten Wappen der Potockis auf den Wagenschlägen, mit dem Kutscher auf dem Bock und dem schützenden Geleit der Männer in ihren grellfarbenen Uniformen hat schon beim Schlagbaum am Ortseingang für eine Sensation gesorgt. Alle Augenblicke muss die Kutsche halten, eingekeilt im Strom der Menschen und Tiere. Da hilft es auch nichts, dass die Peitsche über den Köpfen knallt. Die beiden Frauen im Innern des Gefährts gleiten wie in einer kostbaren Muschel durch das aufgewühlte Wasser der vielsprachigen Menge in Marktlaune.
Schließlich wird die Kutsche, was in dem Gedränge hatte kommen müssen, von einer Deichsel aufgespießt, die Federung geht zu Bruch, diese neue Errungenschaft, die dem Komfort der Reise dienen soll und selbige nun beschwerlicher macht, die Kastellanin purzelt von der Sitzbank auf den Boden, und ihr Gesicht verzieht sich zu einer Grimasse des Schmerzes. Mit einer Verwünschung auf den Lippen springt die Drużbacka aus dem Wagen in den Schlamm und macht sich alleine auf, Hilfe zu suchen. Als Erstes spricht sie zwei Frauen mit Körben an, die kichern nur und suchen das Weite, ruthenische Worte flattern hin und her. Dann greift sie einen Juden in Mantel und Mütze am Ärmel – der gibt sich alle Mühe zu verstehen, was sie sagt, antwortet ihr auch in seiner Sprache, deutet hinunter ins Städtchen, Richtung Fluss. Als Nächstes vertritt die Drużbacka, ungeduldig schon, zwei ansehnlichen Kaufleuten den Weg, die eben einer noblen Kutsche entsteigen und sich dem kleinen Aufruhr nähern, doch sind die beiden wohl Armenier, offenbar nur auf der Durchreise. Sie schütteln die Köpfe. Und die Türken, die gleich in der Nähe stehen, schauen die Drużbacka, wenn sie nicht alles täuscht, ironisch an.
»Spricht hier jemand Polnisch?«, ruft sie aus, verärgert über das Getümmel und verdrossen, dass es sie überhaupt hierher verschlagen hat. Da heißt es, es sei alles ein und dasselbe Königreich, die eine Rzeczpospolita, doch was sie hier sieht, hat mit Großpolen, der Gegend, aus der sie stammt, wahrhaftig nicht mehr viel zu tun. Eine einzige Wildnis, fremd wirken die Gesichter, wunderlich, die sonderbarste Kleidung ist zu sehen, zerschlissene Bauernröcke, Pelzmützen, Turbane, nackte Füße. Kleine, gedrungene Hütten, aus Lehm gebaut, selbst noch um den Markt. Und dieser Geruch nach Malz und Dung und nassem, welkem Laub.
Schließlich sieht sie die zierliche Gestalt eines älteren Geistlichen vor sich, er ist bereits ergraut, trägt einen schon etwas fadenscheinigen Mantel und eine Tasche an einem Riemen über der Schulter. Er starrt sie mit Stielaugen an, so überrascht ist er. Sie fasst ihn an den Schößen seines Mantels, und während sie ihn beutelt, stößt sie zwischen den Zähnen hervor:
»Um Christi willen, sagen Sie mir, wo das Haus des Starosten Łabęcki ist! Und zu niemandem auch nur ein Sterbenswort!«
Der Pater zwinkert eingeschüchtert mit den Augen. Er weiß nicht, soll er etwas sagen, soll er schweigen? Soll er mit der Hand die Richtung zeigen? Die Frau, die so erbarmungslos an ihm zerrt, ist nicht sehr groß, von rundlicher Gestalt, ausdrucksstarke Augen hat sie und eine beachtliche Nase; unter der Haube ringelt sich eine graumelierte Strähne hervor.
»Eine bedeutende Person – incognito«, sagt sie und deutet auf die Kutsche.
»Incognito, incognito«, wiederholt der Geistliche beflissen. Er fischt einen jungen Burschen aus der Menge, heißt ihn, die Kutsche zum Haus des Starosten bringen. Geschickter, als man es hätte vermuten wollen, hilft dieser, die Pferde auszuspannen, damit man wenden könne.
In der Kutsche, hinter den verhängten Fenstern, stöhnt und ächzt die Kastellanin. Und auf jedes Ächzen folgt ein saftiger Fluch.
Vom Blut auf Seidenstoffen
Szymon Łabęcki, verheiratet mit Pelagia Potocka, ist ein Vetter der Katarzyna Kossakowska – ein entfernter Vetter zwar, aber dennoch. Seine Frau ist derzeit nicht zugegen, sie weilt bei Verwandten auf einem Gut in einem nahe gelegenen Dorf. Überrascht von dem Besuch schließt Łabęcki eilig die Knöpfe an seinem Justaucorps, zupft sich die Spitzenmanschetten zurecht.
»Bienvenu, bienvenu«, wiederholt er ein wenig abwesend, als die Bediensteten gemeinsam mit der Drużbacka die Kastellanin nach oben führen, wo der Hausherr der Base die besten Zimmer zur Verfügung stellt. Dann schickt er, vor sich hin murmelnd, nach dem Medicus von Rohatyn. »Quelque chose de féminin, quelque chose de féminin«, brabbelt er immer wieder.
So gänzlich glücklich ist er nicht über diesen Besuch, nein, er behagt ihm überhaupt nicht. Fast schon war er unterwegs zu einem Ort, an dem er regelmäßig Karten spielt. Allein der Gedanke an das Kartenspiel bringt sein Blut in angenehme Wallung, wie ein Glas vom besten Tropfen. Doch hat ihn sein Laster auch schon gehörig Nerven gekostet. Er tröstet sich damit, dass sich bedeutendere Leute als er, wohlhabender und von weiter reichender Reputation, an den Kartentisch setzen. Letzthin spielt er mit dem Bischof Sołtyk, deshalb auch der elegante Aufzug heute. Er war so gut wie unterwegs, es war schon angespannt – und jetzt ist nichts damit. Ein anderer wird gewinnen. Er atmet tief ein, reibt sich die Hände, als wollte er sich gut zureden. Nun gut, dann eben beim nächsten Mal.
Den ganzen Abend glüht die Kranke vor Fieber, der Drużbacka scheint es gar, sie deliriere. Zusammen mit Agnieszka, der Gesellschaftsdame, legt sie ihr kalte Umschläge auf die Stirn, der eilends herbeigerufene Medicus verordnet Kräuter – jetzt wallt ein Geruch wie von Süßholz und Anis in einer weichen Wolke über der Bettstatt, und die Kranke gleitet in den Schlaf. Der Arzt lässt außerdem kalte Umschläge auf den Bauch legen. Langsam beruhigt sich das Haus, nach und nach erlöschen die Kerzen.
Nun, es ist nicht das erste und gewiss auch nicht das letzte Mal, dass die Monatsbeschwerden der Kastellanin derart zusetzen. Wen sollte man dafür verantwortlich machen – schuld ist sicher die Erziehung der Fräuleins auf den Gütern, in dumpfer Luft, ohne jegliche Anstrengung des Körpers. Die Mädchen sitzen krumm über die Stickrahmen gebeugt, arbeiten an der Verzierung von Priesterstolen. Auch der Speisezettel auf den Gütern, schwer und mit viel Fleisch, tut das Seine. Die Muskeln erschlaffen. Zudem hat die Kossakowska eine Schwäche für Reisen, ganze Tage verbringt sie in der Kutsche, im ständigen Gerumpel und Geholper. Die Nervenaufregung, die ewigen Intrigen. Kurzum Politik, denn wer ist Katarzyna Kossakowska, wenn nicht eine Gesandte des Klemens Branicki? Für seine Angelegenheiten tritt sie ein. Und sie macht es gut, denn ihre Seele hat etwas Männliches – so sagt man jedenfalls, und die Leute haben Respekt vor ihr. Die Drużbacka aber kann von dieser »Männlichkeit« nichts erkennen. Was sie sieht, ist ein Frauenzimmer, das sich darin gefällt zu herrschen. Groß gewachsen und selbstbewusst, mit kräftiger Stimme. Und dann heißt es noch, ihr Gatte, ein wenig einnehmender Wicht, sei impotent. Als er sich um ihre Gunst bemühte, stieg er wohl auf einen Sack voll Geld, um die fehlende Körpergröße auszugleichen.
Und wenn ihr Gottes Wille auch den Kindersegen vorenthält, wirkt sie doch nicht unglücklich dabei. Hat sie Zwist mit ihrem Gatten, so wird gemunkelt, packt sie ihn an den Hüften und stellt ihn auf den Kaminsims, von wo er sich nicht mehr heruntertraut, und solcherart zur Reglosigkeit verdammt, muss er anhören, was sie ihm zu sagen hat. Wie kommt eine so ansehnliche Frau dazu, einen solchen Gnom zu erwählen? Wohl allein, um die Position der Familie zu stärken, und Positionen stärkt man mit Politik.
Zu zweit haben sie die Leidende jetzt entkleidet, und mit jedem weiteren Stück der Garderobe tritt unter der Kastellanin Kossakowska deutlicher das Wesen mit Namen Katarzyna hervor, schließlich die Frau mit Namen Kasia, die nun stöhnend, jammernd, weinend vor lauter Schwäche den Händen entgleiten will. Der Arzt hat verfügt, ihr eine Bandage aus sauberem Leinenstoff zwischen die Beine zu legen und ihr viel Flüssigkeit zu geben, so zwingen sie sie fast zu trinken, vor allem einen Sud aus irgendeiner Rinde. Wie dünn die Kastellanin der Drużbacka jetzt erscheint, und deshalb auch so jung. Dabei ist sie doch schon dreißig.
Als die Kastellanin eingeschlafen ist, nehmen sich die Drużbacka und Agnieszka der Kleidungsstücke an, auf denen große Blutflecke zu sehen sind – Weißzeug, Unterkleid und Rock, sogar auf ihrem dunkelblauen Mantel. Wie viele solcher Blutflecke man im Leben schon gesehen hat, geht es der Drużbacka durch den Kopf.
Das schöne Kleid der Kastellanin – dicker Atlasstoff, ein cremefarbener Grund, darauf die sparsam filigranen roten Blüten, Glockenblumen, mit einem grünen Blättchen jeweils links und rechts. Ein leichtes, heiteres Muster, passend zum dunklen Teint der Besitzerin des Kleides, passend zu ihren dunklen Haaren. Jetzt hat das Blut die Blumen mit unheilvoller Woge überschwemmt. Die gestaltlosen Formen haben jegliche Ordnung aufgesogen und zerstört. Als wäre von irgendwoher eine feindselige Macht hervorgebrochen.
Auf den Gütern weiß man eine besondere Lektion – wie man Blutflecke auf Kleiderstoff beseitigt. Seit Jahrhunderten lernen es die zukünftigen Gattinnen und Mütter. Es wäre der wichtigste Gegenstand an einer Universität der Frauen, sollte eine solche je entstehen. Geburt, Menstruation, Krieg, Raufhandel, Einritt, Überfall, Pogrom – daran erinnert das Blut, das unablässig sich bereithält unter der Haut. Was tun mit diesem Inneren, das es gewagt hat, sich nach außen zu begeben, mit welcher Lauge, welchem Essig soll es ausgewaschen werden? Vielleicht ein Läppchen zart mit Tränen netzen und behutsam reiben? Oder kräftig mit Speichel tränken? Bettlaken, Bettbezug, Weißwäsche, Unterkleider, Hemden, Schürzen, Kopftücher, Hauben, Spitzenmanschetten und Jabots, französische Fräcke und Korsetts. Teppiche und Fußbodendielen. Verbände, Laken, Uniformen.
Als der Doktor gegangen ist, schlafen die Drużbacka und Agnieszka so im Knien, so im Sitzen an der Bettstatt ein. Die eine mit dem Kopf auf der eigenen Hand, deren Spur sie für den Rest des Abends auf der Wange tragen wird, die zweite im Sessel, den Kopf auf der Brust. Von ihrem Atem bewegt sich die zarte Spitze am Décolleté wie Blumentiere in einem warmen Meer.