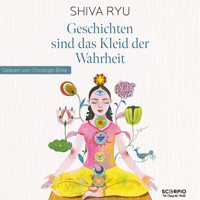Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Scorpio Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
"Die Wahrheit, die du der Welt erzählen willst, musst du in deine Geschichte hineintun. Wenn du deine Wahrheit geradewegs als Behauptung hinstellst, wird sie niemanden interessieren. Kleidest du sie jedoch in deine ganz eigene Geschichte, gewinnt sie an Überzeugungskraft, und die Menschen werden dir gerne zuhören. Doch dafür musst du zuerst das Leben erfahren. Denn die Geschichten entstehen aus der Erfahrung des Lebens." Diese Worte seines indischen Meisters nahm sich Shiva Ryu zu Herzen. So begann er auf seiner Reise durch das Land die unterschiedlichsten Fabeln zu sammeln, um ihren Zauber und ihre Weisheit nun auf seine Art und im Kontext seiner Wahrheit zu vermitteln. Denn es gibt Dinge, die den Wandel der Zeiten überdauern. Fabeln erhellen, was im Leben wichtig und wertvoll ist und lassen uns das Wesen des Menschen verstehen. Sie bringen uns dazu, das Wundersame unserer Welt zu erkennen und wer weiß – vielleicht können uns diese Geschichten aus Indien als Rahmen dienen, wenn wir unsere eigene Wahrheit erzählen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCORPIO
SHIVA RYU
Geschichten sind das Kleid der Wahrheit
Aus dem Koreanischenvon Jan Henrik Dirks
SCORPIO
Der Druck dieses Buches wurde durch die finanzielle Unterstützung des Literature Translation Institute of Korea ermöglicht.
신이 쉼표를 넣은 곳에 마침표를 찍지 말라
Don’t put a Period where God put a Commaby Shiva Ryu
Copyrights © 2019 by The Forest Book Publishing Co.
All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews.
German Translation Copyight © 2023 by Scorpio Verlag
German edition is published by anangement with The Forest Book Publishing Co. through BC Agency, Seoul
1. eBook-Ausgabe 2023
Copyright der deutschen Erstausgabe
© 2023 Scorpio in der Europa Verlage GmbH, München
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
Lektorat: Angela Hermann-Heene
Illustrationen: Olaf Hajek
Layout & Satz: Margarita Maiseyeva
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95803-350-4
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.scorpio-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
Vorwort
Wie man einen Falken zum Fliegen bringt
Ernsthafte Worte
Die Blume und der Kieselstein
Der Bildhauer und der Todesbote
Lasst uns Rasgulla essen
Wer heilt den kranken Arzt?
Schon ein einziges Instrument erfüllt die Welt mit Musik
Die Bhagavad Gita und der Kohlenkorb
Der Neunundneunziger Klub
Ist das Leben gerecht?
Der Weg ins Himmelreich
Der Erleuchtete und das Mädchen
Wenn die Blüte aufgeht, wird man es wissen
Ohne Krücken laufen
Die vier Briefe
Welches Bündel hast du zu tragen?
Meine Sprache
Der Dieb, der zum Heiligen wurde
Der Segenswunsch für den Armen
Das Lied, das den Gott zur Rührung brachte
Das Problem, Probleme zu entdecken
Eine Nadel
Der Name Bhamati
Das Lächeln der Granatäpfel
Tu es heute
Wenn du etwas siehst, tu nichts, als es zu sehen
Auch dieses Stück Kohle war einmal ein Sandelholzbaum
Du und ich im Spiegel
Viel Lärm um nichts
Der Mann, der den Todesgott besiegte
Ein Beutel voller Gold
Vergebung
Das Gesetz der Anziehung
Ein Kürbis, du Dummkopf!
Der blaue Schakal
Warum die Dämonen des Krieges eine Niederlage erlitten
Wer ist wohl der Klügere?
Die Kraft des Mantras
Man spiele dort weiter, wo der Affe den Ball hat fallen lassen
Eine geplatzte Hochzeit
Gibt es für dich so einen Menschen?
Wenn du den Weg zu den Göttern gehst, geh ihn tanzend
Ein Leben
Das Versteck der Edelsteine
Die Fabel vom Bleistift
Beschützen die Götter auch die kleinen Vögel?
Das Arztrezept
Der Gute und der Schlechte
Der Grund dafür, einen Becher mit der linken Hand zu reichen
Und was wurde später aus den Adlern?
Der Unterschied zwischen deinem Sohn und meiner Ziege
Buddha und Mara verkünden ihren Ruhestand
Der Mann, der die Aussteuer vorab bezahlte
Was nur ein Blinder sieht
Das Missverständnis der Schlange
Der Felsen
Der Mönch und der Skorpion
Der König und der Gelehrte
Das Mantra der Erlösung
Die beiden Vögel
Binde das Kamel nicht an dir fest
Shava Shava
Der Lebensunterricht des Königs
Gefährliches Wissen
Bestimmt mein Name, wie ich bin, oder bestimme ich, wie mein Name ist?
Die Illusion von der eigenen Großartigkeit
Was im Leben an oberster Stelle steht
Die Tätowierung
Der Mann, der sich für ein paar Orangen beinahe selbst verkauft hätte
Das Schicksal
Probleme, die eine vorgestellte Kuh bereitet
Das Gift im Herzen
Der Webervogel und der Affe
Wie man die Dunkelheit vertreibt
Wofür kämpfst du?
Den Weg kennen und den Weg gehen
Woher kommt die Kraft?
In welche Richtung soll man das heilige Wasser werfen?
Traumdeutung
Viele dankenswerte Dinge
Die Wachteln, die sich nicht fangen ließen
Die Gelehrten, die zu Ochs und Esel wurden
Eine harte Arbeit
Das Schwert über dem Bett
Der Wert des Lebens
Wenn schon dumm, dann richtig dumm
Jetzt oder nie
Wer ist es, den wir grüßen?
Wie Arjuna zum größten Bogenschützen wurde
Das Rätsel im Kopf
Der Affe und die Schuhe
Ansaugwasser
Baba-ohne-was
Ob Ding, ob Mensch
Was passiert, wenn man mit ganzem Herzen zuhört?
Der Blütenbaum
Wenn man seine Geschichte nicht erzählt
Nachwort: Eine Art, ins Schwarze zu treffen
VORWORT
»Ich wollte mein Leben lang Geschichten sammeln. Schöne Geschichten. Die gesammelten Geschichten wollte ich in einer Tasche mit mir herumtragen, um sie im richtigen Augenblick an Ohren zu verschenken, die es verstehen, aufmerksam zuzuhören. Und ich wollte Augen sehen, die von diesen Geschichten verzaubert sind. Allen Menschen wollte ich den Samen meiner Geschichten ins Ohr streuen.«
MARYAM MADJIDI
französische Schriftstellerin iranischer Herkunft
Es gibt eine Geschichte, die mir ein indischer Meister erzählt hat, vor langer Zeit, als ich darüber nachdachte, wie ich meine Geschichten schreiben solle.
In einem Dorf lebten einmal zwei Frauen. Die eine war wunderschön und trug prächtige Kleider, sodass ihr überall viel Aufmerksamkeit zuteilwurde. Jeder wollte sich mit ihr unterhalten, stellte ihr Fragen und hörte zu, wenn sie etwas sagte. Die andere Frau war auch nicht ohne Reiz, aber die Leute nahmen sie überhaupt nicht wahr. Niemand interessierte sich für sie, denn sie war arm. Da stand sie in ihren schäbigen Kleidern und sah einsam und traurig mit an, wie die andere Frau in ihrem schönen Gewand von allen umworben wurde. Dabei gab es doch so vieles, was die arme Frau gerne mit den anderen Leuten geteilt hätte.
Eines Tages nahm sie ihren Mut zusammen, ging zu der schönen Frau und fragte:
»Sag, darf ich dich wohl um einen Gefallen bitten?«
»Gewiss doch. Wie kann ich dir helfen?«, erwiderte die schöne Frau freundlich.
Die arme Frau zögerte und meinte dann:
»Alle Leute schenken dir ihre Gunst, nicht nur, weil du wunderschön bist, sondern auch, weil du so prächtige Kleider trägst. Ich aber bin schäbig angezogen, und so interessiert sich niemand für mich. Ob du mir wohl nur einen Tag lang einmal deine Kleider leihen und mit mir zusammen durch die Straßen gehen könntest? Dann würden all die Leute, die herbeikommen, um dich zu sehen, sich vielleicht auch ein wenig für mich interessieren, und auch ich könnte mit ihnen teilen, was ich habe.«
Die schöne Frau kam der Bitte der armen Frau mit Freude nach, und so liefen sie am nächsten Tag, beide in edle Gewänder gehüllt, gemeinsam durch die Straßen. Wie sonst auch blieben die Leute stehen, um der schönen Frau Komplimente zu machen, doch dieses Mal interessierten sie sich auch für die arme Frau, die in ihrem hübschen Kleid an der Seite der reichen Frau ging.
Und wie sie so gemeinsam umherliefen, unterhielt sich die schöne Frau mit der armen Frau, stellte ihr viele Fragen und nahm tiefen Anteil an all den Dingen, die die arme Frau der Welt gerne mitteilen wollte. Und sie stellte fest, wie weise die arme Frau tatsächlich war. Seit diesem Tag waren sie Freundinnen und von nun an immer zusammen. Und so laufen sie bis zum heutigen Tag stets gemeinsam durch die Welt.
Der Name der schäbig gekleideten Frau lautet »Wahrheit«. Und die Frau in den prächtigen Gewändern, die bei allen so beliebt war, heißt »Geschichte«. Eine Geschichte ist der Atem, welcher der Wahrheit Leben einhaucht. Und umgekehrt erfüllt auch die Wahrheit die Geschichte mit Leben. Das ist es, was wir eine »wahre Geschichte« nennen.
Nachdem mir der Meister diese Geschichte erzählt hatte, meinte er:
»Du bist deine Geschichte. Die Wahrheit, die du der Welt erzählen willst, musst du in deine Geschichte hineintun. Wenn du deine Wahrheit geradewegs als Behauptung hinstellst, wird sie niemanden interessieren. Man wird dich für einen egozentrischen Sturkopf halten. Kleide deine Wahrheit in deine ganz eigene Geschichte. Dann gewinnt sie an Überzeugungskraft, und die Menschen werden dir gerne zuhören. Doch dafür musst du zuerst das Leben erfahren. Denn die Geschichten kommen aus der Erfahrung des Lebens.«
Ich wollte kein Schriftsteller werden, der sich Geschichten ausdenkt, sondern einer, der Geschichten sammelt. Geschichten, die in einfacher Sprache Einsicht in das Wesen des Menschen und in das Leben vermitteln. Es war für mich ein großes Glück, dass der spirituelle Meister, dem ich bei meinem ersten Indienaufenthalt begegnet bin, es so vortrefflich verstand, seine Lehre von der Wahrheit in Form vielfältiger Geschichten zu vermitteln. Suchende aus der ganzen Welt kamen herbei, um seine Geschichten zu hören. Er entwirrte das Knäuel der unzähligen Lebensfragen zu einem einzigen Erzählstrang und spann daraus Fäden zu neuen Geschichten.
Der Untertitel dieses Buches lautet »Indische Fabeln«, aber wollte man genau sein, hätte es heißen müssen: »Fabeln, die aus Indien überliefert sind«. Und in den bibliografischen Informationen werde zwar ich als Autor dieses Buches genannt, eigentlich aber bin nicht ich der Urheber all dieser Fabeln und Geschichten. Sondern es sind die Menschen in Indien, die die einzelnen Geschichten zunächst mündlich überliefert und dann schriftlich auf Papier festgehalten oder neu aufgeschrieben haben. Ich bin ein Herausgeber oder, anders gesagt, ein Geschichtensammler. So, wie ich es immer habe sein wollen.
Der Ursprung der Fabel reicht zurück ins alte Indien, und so kann man Indien mit Recht als Land der Fabeln und Geschichten bezeichnen. Das Mahabharata und das Ramayana, die beiden umfangreichsten indischen Epen, sind Sammlungen von Geschichten. Ungefähr im 5. vorchristlichen Jahrhundert bat der König, frustriert über die »Nutzlosigkeit« seiner Söhne, einen hochgelehrten Brahmanen, ihnen etwas beizubringen. Um den Prinzen die Prinzipien einer weisen Lebensführung zu vermitteln, griff der Brahmane auf alte Fabeln zurück, die seit etwa 1500 v. Chr. überliefert worden waren, und sammelte sie im Panchatantra, einer Dichtung in fünf Büchern. Diese uralte Fabelsammlung enthält Geschichten darüber, wie sich das menschliche Wesen verstehen lässt, wie man glaubwürdige und zuverlässige Freunde findet, wie man Schwierigkeiten mit Humor und Weisheit überwindet, wie man Falschheit und Tücke begegnen sollte und wie man ein friedvolles und harmonisches Leben führt.
Eine Geschichte aus dem Panchatantra geht so: Ein Mann hatte auf dem Markt ein Zicklein gekauft und trug es nun über der Schulter nach Hause. Als er durch einen Wald kam, lauerten ihm schon drei Schurken aus dem nahe gelegenen Dorf auf, um ihm das Zicklein zu stehlen.
Einer der Kerle, der sich hinter einem Baum versteckt hatte, kam nun hervor, trat auf ihn zu und sagte:
»Sei gegrüßt. Weshalb trägst du denn da einen Hund auf deiner Schulter?«
Da sagte der Mann: »Dies ist doch kein Hund, dies ist eine Ziege, siehst du das denn nicht?«
Da sagte der Gauner wie beiläufig:
»Na, so was, da hat er sich doch auf dem Markt tatsächlich einen Hund anstelle einer Ziege aufschwatzen lassen.«
Nun kam ein zweiter Gauner hinter einem Baum hervor und sagte:
»Guten Tag! Oh, da hast du aber ein hübsches Hündchen, das da auf deiner Schulter sitzt.«
Da sagte der Mann wieder: »Aber dies ist doch kein Hund! Dies ist eine Ziege!«
Da sagte der zweite Gauner wie beiläufig: »Der Dummkopf muss wirklich gedacht haben, es sei eine Ziege, als er sich diesen Hund gekauft hat …«
Am Waldausgang wartete schon der dritte Gauner und sagte: »Wo hast du denn das Hündchen aufgetrieben, das du da mit dir herumträgst?«
Wie er nun immer wieder dasselbe gehört hatte, befielen den Mann doch große Zweifel. Und schließlich hielt er die Ziege auf seiner Schulter tatsächlich für einen Hund, warf sie auf der Straße von sich und lief davon. So fiel das Zicklein schließlich den Gaunern in die Hände.
Die Fabel zeigt, wie jemand verliert, was er hat, weil er nur auf die Worte anderer hört, anstatt sich auf seine eigene Urteilskraft zu verlassen.
Nicht nur das Panchatantra, auch viele andere Fabeln aus Indien sind durch griechische Übersetzer und durch Wandervölker wie die Roma in den Westen gelangt, und man geht davon aus, dass sie die Grundlage für Äsops Fabeln bildeten. Jean de La Fontaine, der für seine Fabeln bekannte französische Dichter des 17. Jahrhunderts, wies selbst darauf hin, wie viel er dem indischen Fabeldichter »Pilpay« (eine fehlerhafte Umschrift von Bidpai) verdanke. So kam auch die Ansicht auf, dass letztlich alle Geschichten der Welt ihren Ursprung in Indien hätten.
Es gibt Dinge, die den Wandel der Zeiten überdauern. Fabeln erhellen, was im Leben wichtig und wertvoll ist, und lassen uns das Wesen des Menschen verstehen. Sie bringen uns dazu, das Wundersame unserer Welt zu erkennen.
Ein Zauberer, der sich auf Reisen befand, entdeckte in einem Bach einen großen Edelstein und nahm ihn mit. Da traf er auf seinem Weg einen anderen Wanderer. Dieser war vollkommen ausgehungert, und so schnürte der Zauberer sein Bündel auf, um seine Mahlzeit mit ihm zu teilen. Als der Blick des Wanderers auf den kostbaren Stein fiel, bat er den Zauberer, ihm diesen doch zu schenken. Und ohne zu zögern, gab der weise Mann ihm nicht nur die Hälfte seines Essens, sondern überreichte ihm auch den Edelstein. Der Wanderer freute sich über sein Glück, steckte den Stein ein und brach auf. Dank dieses Kleinods würde er nun ein sorgloses Leben führen können. Doch nach einigen Tagen suchte der Wanderer den Zauberer auf, gab ihm den Edelstein zurück und sagte:
»Ich weiß sehr wohl, wie wertvoll dieser Stein ist, aber ich glaube, es gibt etwas noch viel Wertvolleres, das Ihr mir geben könntet. Ihr tragt etwas in Euch, das dafür gesorgt hat, dass Ihr mir diese Kostbarkeit so bereitwillig überlassen habt. Nur das wünsche ich mir von Euch.«
Es gibt noch eine andere Fabel, in der es um einen Edelstein geht. Ein Reisender ging einmal in ein großes Juweliergeschäft. Er bestaunte all die prächtigen Steine, die dort in der Glasvitrine lagen und das Auge des Betrachters blendeten: die schimmernden Opale, die blutroten Rubine, die durchsichtigen, aber umso prächtiger leuchtenden Brillanten. Doch unter all den funkelnden Edelsteinen befand sich einer, der vollkommen matt und glanzlos aussah.
»Der dort ist aber bei Weitem nicht so schön wie die anderen!«, rief der Reisende, verwundert über den scheinbar gewöhnlichen Stein inmitten all der glitzernden Kostbarkeiten.
Da sagte der Juwelier mit einem Lächeln: »Warten Sie mal einen Moment.«
Er nahm den Stein aus der Vitrine und umschloss ihn mit der Hand. Kurz darauf öffnete er seine Finger wieder und nun erstrahlte der Stein plötzlich in unbeschreiblichem Glanz. Der Reisende war erstaunt und fasziniert. Der Juwelier erklärte ihm:
»Diesen Opal hier nennen wir den ›empfindsamen Edelstein‹. Er verändert seine Farbe je nach der Körpertemperatur des Menschen, der ihn berührt. Um diesen Stein so wunderbar zum Gleißen zu bringen, muss man ihn nur behutsam in die Hand nehmen.«
Will man also einen gewöhnlichen Stein zu einem Edelstein machen, muss man wissen, dass man ihn nicht einfach auf dem Boden liegen lassen darf, sondern ihn in die Hand nehmen muss, um zu erkennen, wie wertvoll er ist.
Wir alle sind unsere eigenen besonderen Geschichten. Menschen, die nicht einfach nur Meinungen oder Theorien, sondern edelsteinerne Geschichten in sich tragen, sind uns menschlich näher. Und solange wir diese Geschichten nicht vergessen, sind wir am Leben. Irgendwann einmal habe ich gehört, wie ein spiritueller Meister von einer Biene erzählt hat:
»Einmal entdeckte eine umherfliegende Biene einen Honigtopf. Aufgeregt landete sie auf dem Topf und kostete von dem leckeren Honig. Als sie den Honigtopf wieder verließ, flog sie sogleich zu den anderen Bienen, um ihnen von ihrer Entdeckung zu erzählen. Und wie sie so aufgeregt berichtete, flogen ein paar Tropfen Honig von ihrem Mund zu den anderen Bienen hin. Die anderen Bienen konnten es erst gar nicht glauben. So kamen alle Bienen durch die Begeisterung und Tatkraft einer einzigen in den Genuss des köstlichen Honigs. Ebenso ist es ganz natürlich, dass wir, wenn wir für etwas tiefe Zuneigung oder Liebe empfinden, diese Liebe gerne mit allen Menschen teilen wollen.«
Ich möchte diese Biene werden. Wenn ich wie in einem Honigtopf in meinem Arbeitszimmer oder in einer alten indischen Buchhandlung sitze, mein Gesicht in die alten Bücher stecke und von den herrlichen Geschichten koste, dann möchte ich sie weitererzählen, voller Freude, so, als versprühte ich kleine Honigtropfen. Denn die Aufgabe des Autors ist die einer emsigen Honigbiene.
Die alten Geschichten, die aus Indien zu uns gekommen sind, besitzen alle die Besonderheit, dass sie der Wahrheit als Kleider dienen. Es sind juwelengleiche Geschichten, in denen magische Geschichtenerzähler, weise Ratgeber und dumme Könige, eingebildete Gelehrte, Heilige und Diebe, Menschen und Tiere abwechselnd in ganz individueller Weise in Erscheinung treten. Die Ereignisse und wahren Begebenheiten in all den Fabeln, Geschichten und Mythen, die ich hier unter der Bezeichnung »indische Fabeln« gesammelt habe, enthalten alle ihre Wahrheiten über die Welt und über das Leben der Menschen. Und so hoffe ich, dass auch euch, wenn ihr eure eigene Wahrheit erzählt, diese Geschichten zu wunderbaren metaphorischen Kleidern werden können. Und dass sie auch euch die Tür öffnen werden zu eurer eigenen inneren Weisheit. Denn ein guter Geschichtenerzähler ist immer auch ein guter Zuhörer.
SHIVA RYU
Wie man einen Falken zum Fliegen bringt
Einmal bekam der König ein besonderes Geschenk. Es waren zwei wunderschöne Falken, die prächtigsten ihrer Art. Der Herrscher eines benachbarten Reiches hatte sie ihm zum Zeichen seiner Freundschaft geschickt. Der Rücken glänzte grau, mit einem Stich ins Grünliche, und der Körper unterhalb der mächtigen Schwingen war von schwarzweißem Gefieder umhüllt. Der König, fasziniert vom stolzen Blick und von der majestätischen Haltung der beiden Tiere, verbrachte viel Zeit damit, sie zu betrachten. Nie zuvor hatte er Vögel von solch erhabener Eleganz gesehen.
Schließlich fasste der König den Entschluss, die beiden Vögel in die Obhut des fachkundigsten Falkners des Landes zu geben, den er eigens hierfür ausgewählt hatte, damit dieser sie in einer Weise dressierte, die einem majestätischen Greifvogel gerecht würde.
So wartete der König ein paar Monate lang und fieberte dem Tag entgegen, an dem er, wie er sich erhoffte, die beiden prächtigsten Vögel der Welt zu Gesicht bekäme. Als der König seine Ungeduld allmählich nicht mehr im Zaume halten konnte, kam der Falkner, um ihm Bericht zu erstatten. Er sagte, dass einer der Falken das Training ganz hervorragend absolviert habe und bemerkenswerte Fortschritte erkennen lasse. Die wunderschönen, großen Schwingen weit ausgebreitet, schwebe er nun stolz und erhaben über Berg und Feld dahin. Und steige bisweilen so hoch auf, dass er auch am wolkenlosen Himmel mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen sei. Weder Sturm noch Wolkenbruch könnten die Richtung und die Beharrlichkeit seines Fluges stören.
Der König war vom Anblick des fliegenden Falken tief beeindruckt. Und auch die Menschenmenge auf dem Hofe des Palastes bedachte den Falken, der dort so unbeschreiblich schön und elegant am blauen Himmel schwebte, mit nicht enden wollendem Beifall.
Der Falkner jedoch war über die begeisterte Reaktion der Leute nicht recht glücklich. Denn da war ja noch der zweite Vogel. Der Falkner berichtete dem König, dass der zweite Falke einfach nicht fliegen wolle. Dieser sitze noch immer regungslos auf dem Ast, auf dem er sich am ersten Tag der Ausbildung niedergelassen habe.
Und was auch immer man unternahm, der Falke machte keine Anstalten, seine Flügel auszubreiten. So sehr der Falkner es auch mit Befehlen, Bitten und Locken versuchte, der Vogel zeigte nicht das geringste Interesse am Fliegen. Der König war erstaunt und fragte, was denn wohl der Grund sei, doch auch der Falkner hatte keinerlei Erklärung für das Verhalten des Tieres. Er war durchaus ein erfahrener Falkner, doch noch nie hatte er sich so hilflos gefühlt, und so war er nicht nur vor dem König, sondern auch vor sich selbst zutiefst beschämt.
Der König verstand, dass der Falkner sein Bestes gegeben hatte, und rief nun Vogelkundler aus dem ganzen Land herbei, damit sie den prächtigen, wertvollen Falken zum Fliegen brächten. Sogar Vogelpsychologen und Schamanen ließ er kommen. Doch ungeachtet aller Bemühungen – der Vogel wollte sich einfach nicht in die Lüfte erheben. Die Experten waren der Ansicht, dass der Vogel vermutlich infolge des plötzlichen Ortswechsels unter Schock stehe. Manche behaupteten auch, dass er vielleicht als Küken aus dem Nest gestoßen worden sein und ein tiefes Trauma erlitten haben könne. Doch trotz aller Therapiebemühungen und trotz aller Nährstofflösungen, die man dem Futter beigemengt hatte, rührte sich der Vogel nicht. Ein Philosoph erklärte, der Falke werde schon von alleine fliegen, wenn erst die rechte Zeit gekommen sei, und die Priester versuchten es mit religiösen Ritualen, Beschwörungsformeln und Gebeten, aber das Verhalten des Vogels veränderte sich nicht im Mindesten.
Der König, der vielen Diagnosen und Rezepte müde, sagte dem obersten Minister, dass die Lösung dieses Problems vielleicht doch eines ganz besonders weisen Mannes bedürfe. Nur jemand, der tiefstes Verständnis vom Wesen der Tiere und vom Wesen der Natur besitze, könne die Antwort erbringen. Und so machte sich der Minister auf, um im ganzen Land nach so einem Menschen zu suchen.
Ein paar Tage später sah der König zum Himmel und erschauerte. Hoch über dem Palast sah er den zweiten Falken schweben, die Flügel majestätisch ausgebreitet. Nichts erinnerte an den Vogel, der sich so ängstlich an den Ast geklammert und das Fliegen so beharrlich verweigert hatte. Mit elegantem Flügelschlag und voller Genuss flog er dahin, stieg auf und ließ sich fallen. An Selbstgewissheit und Gewandtheit stand er dem ersten Falken in nichts nach.
Der König, der den Flug des Falken vom großen Garten seines Palastes aus beobachtete, wollte seinen Augen kaum trauen. Sogleich rief er nach dem Minister und befahl ihm, den weisen Mann herbeizubringen, der dieses Wunder ermöglicht hatte. Der Minister erschien und brachte zum großen Erstaunen des Königs einen ganz gewöhnlichen Bauern mit.
Der König fragte: »Wie hast du den Falken zum Fliegen gebracht?«
Und der Bauer erwiderte: »Das war ganz einfach.«
»Ganz einfach? Was soll das heißen?«, fragte der König. »Alle Experten und Tierpfleger haben es über lange Zeit vergeblich versucht. Wie ist es dir gelungen?«
Da sagte der Bauer: »Nun, ich habe einfach den Ast abgesägt, auf dem der Falke saß.«
Was mag wohl der Ast sein, den ich selbst umklammert halte? Den ich festhalte, sodass ich nicht hoch in den Himmel emporsteigen kann? Wann werde ich den Ast absägen, der mich daran hindert, in eine neue Welt hineinzufliegen?
Wenn ich nicht fliege, wird mich das Leben eines Tages zum Fliegen zwingen. Indem es den Ast abbricht, auf dem ich sitze. Will ich ihn selbst abschneiden oder will ich darauf warten, dass das jemand anderes tut?
Ernsthafte Worte
Diese Geschichte handelt von der Kindheit des Yudhishthira, einem der Helden des alten indischen Epos Mahabharata. Yudhishthira, der als erstgeborener Königssohn als Thronfolger vorgesehen war, erhielt gemeinsam mit seinen vier jüngeren Brüdern und allerlei Vettern Privatunterricht in einem Gurukula, also im Hause eines Gurus, wo die Schüler mit ihren Lehrern lebten und in Schriftkunde und Weisheitslehre unterwiesen wurden.
Eines Tages kam der Guru, um zu überprüfen, wie viel die Schüler bereits gelernt hatten. Er fragte einen nach dem anderen nach ihrem Lernstand, und ein jeder berichtete gewissenhaft, was er schon alles wusste.
Als nun Yudhishthira an der Reihe war, fragte ihn der Guru ebenfalls, was er denn bisher gelernt habe. Da schlug der Junge das Buch für Leseanfänger auf und erklärte freudig und ohne Scham:
»Ich kann inzwischen die Buchstaben, und nun habe ich den ersten Satz aus diesem Buch gelernt.«
Der Guru fragte erstaunt: »Ist das alles? Sonst hast du nichts gelernt?«
Da zögerte Yudhishthira einen Augenblick und antwortete dann:
»Nun, vielleicht auch noch ein wenig den zweiten Satz …«
Der Guru wurde wütend. Er hatte gehofft, dass Yudhishthira als erstgeborener Königssohn sich besonders gewissenhaft auf sein Studium besinnen würde, um breites Wissen und tiefe Weisheit zu erlangen. Nie hätte er erwartet, dass er in solch einem Schneckentempo vorankriechen würde.
Der Guru befahl dem Jungen, unverzüglich aufzustehen. Er war ein Meister, der fest von dem Grundsatz überzeugt war, die Rute zu schonen sei der beste Weg, ein Kind zu verderben. Seiner Philosophie nach war es so, dass aus einem Kind ein umso besserer Mensch würde, je mehr Stockschläge es erhielte. Und so verprügelte er den Jungen nach Strich und Faden.
Auf brutale Weise schlug er auf den Jungen ein, doch seltsamerweise blieb dieser vollkommen ruhig. Und sein Gesicht strahlte noch immer ebenso glücklich wie zuvor. Auch als der Guru die Prügelstrafe so lange fortgesetzt hatte, dass ihn selber schon die Erschöpfung befiel, zeigte das Gesicht des Jungen keine Spur von Zorn, Angst oder Unwillen. Und wie der Guru seinem Schüler so ins Gesicht blickte, begann er sich allmählich zu beruhigen.
Und er dachte bei sich:
›Wie kommt es, dass dieser Junge, der später über mich und ganz Indien regieren wird und mich mit einem einzigen Wort wird vernichten können, so ruhig und friedlich bleibt? Obwohl ich ihn so hart mit dem Stock schlage, zeigt er keinerlei Anzeichen von Zorn. Seine Brüder geraten jedes Mal in Wut, wenn ich sie streng behandele, und bisweilen greifen sie sogar selbst nach dem Stock, um mich zu schlagen. Doch dieser Junge hier wird überhaupt nicht wütend. Er bleibt einfach ruhig und besonnen und gut gelaunt.‹
Da fiel sein Blick auf den ersten Satz des Lesebuches, den Satz, den der Junge gelernt hatte. Indische Schulbücher für Leseanfänger beginnen nicht mit Wörtern wie »Hund« oder »Katze«. Sie beginnen mit Ratschlägen für das Leben. Und in diesem in Sanskrit geschriebenen Buch stand gleich nach dem Alphabet als erster Satz:
Gerate nicht in Wut. Gerate nicht in Aufregung. Verliere nie deine Besonnenheit.
Und der zweite Satz lautete:
Sage die Wahrheit. Sage stets nur die Wahrheit.
Der Junge hatte gesagt, dass er den ersten Satz gelernt habe. Und dann, mit leichtem Zögern, dass er auch den zweiten Satz gelernt habe. Noch einmal las der Guru den ersten Satz.
Gerate nicht in Wut. Gerate nicht in Aufregung. Verliere nie deine Besonnenheit.
Wieder blickte er in das Gesicht des Jungen. Mit einem Auge sah er den Jungen, mit dem anderen die Worte auf dem Papier. Und mit einem Male traf ihn der Sinn dieser Worte wie ein Blitz. Es waren diese Worte, die aus dem Gesicht des Jungen zu ihm sprachen, es waren diese Worte, die im Gesicht des Jungen geschrieben standen. Gerate nicht in Wut. Das ruhige, besonnene, helle und reine Gesicht des Jungen brachte dem Meister diese Worte zu Herzen. Gerate nicht in Wut.
Der Guru begriff nun, dass er selbst es gewesen war, der nicht begriffen hatte. Er hatte die Bedeutung jenes Satzes nur mit den Lippen gelernt. Nun aber hatte er den Satz als etwas verstanden, das nicht nur papageienartig nachgeplappert, sondern im tatsächlichen Leben umgesetzt werden konnte. Nun begriff er, wie beschränkt sein Verständnis gewesen war. Und er schämte sich zutiefst, dass er selbst den ersten Satz des Buches nicht gelernt hatte, während der Junge ihn in all seiner Wahrhaftigkeit verstanden hatte.
Für den Jungen bedeutete Lernen nicht, dass man den Sinn eines Wortes mechanisch auswendig lernte. Sondern dass man ihn in die Tat umsetzte, ihn begriff und spürte und mit ihm eins wurde. Dies war es, was der Junge unter wahrem Lernen verstand.
Der Guru legte den Prügelstock aus der Hand. Dann nahm er den Jungen auf den Arm und küsste ihn auf die Stirn. Und voller Scham über seine eigene Dummheit und Beschränktheit sagte er:
»Ich beglückwünsche dich, dass du diesen einen Satz wahrhaftig gelernt hast. Nur diesen einen Satz aus der heiligen Schrift. Mir war nicht bewusst, dass ich noch nicht einmal diesen einen Satz wirklich gelernt habe. Weil ich so leicht wütend geworden und in Zorn ausgebrochen bin und meinen kühlen Kopf und meinen klaren Verstand verloren habe. Es gibt so vieles, über das ich in Wut gerate. Ich bin ein armseliger Kerl. Du weißt mehr als ich. Du hast mehr gelernt als ich.«
Nachdem der Junge die Worte des Gurus gehört hatte, sagte er:
»Nein. Auch ich habe diesen Satz noch nicht vollständig gelernt. Ich habe gespürt, wie noch ein wenig Unwillen und Zorn in meinem Herzen aufgestiegen sind. In den fünf Minuten, in denen ich den Stock zu spüren bekam, habe ich manchmal Wut gefühlt. Und als ich das Lob zu hören bekam, begann mein Herz zu schwanken, und ich habe die Versuchung gespürt, meine eigene Schwäche zu verstecken. Noch kann ich nicht sagen, dass ich den ersten Satz wirklich ganz gelernt hätte.«
Und deshalb hatte der Junge gezögert, als er gesagt hatte, dass er den zweiten Satz gelernt habe. Sage stets nur die Wahrheit. Denn die Behauptung, er habe den ersten Satz gelernt, entsprach noch nicht ganz der Wahrheit.
Vielleicht sind diese beiden Sätze schon genug, um gelernt zu werden. Wie die spätere Geschichte beweisen sollte, lebte Yudhishthira tatsächlich nach diesen beiden Grundsätzen. Und auch nachdem er ein mächtiger König in Hastinapur (der Hauptstadt des Kaurava-Stammes am Oberlauf des Ganges) geworden war, vergaß er keinen dieser beiden Sätze.
Welchen einen Satz habe ich in meinem Leben gelernt? Habe ich ihn nicht nur im Kopf auswendig gelernt, sondern ihn auch in seiner Lebendigkeit begriffen und ihn auf mein Leben übertragen? Welches ist das wahre Wissen, das mich mit der Welt verbindet?
Die Blume und der Kieselstein
Ein Sadhu, ein asketischer hinduistischer Wandermönch, saß am Ufer des Ganges und war in seine Meditation versunken. Vor der leuchtend rot aufgehenden Morgensonne zog ein Schwarm Vögel vorbei, am gegenüberliegenden Flussufer trieb der Ochsentreiber seine Büffelherde mit lautem Ruf über den Sandstrand. Am Ufer durchwühlten Affen, um so vielleicht ein Stück Obst zu ergattern, die Kleider der Menschen, die zum heiligen Bad an den Fluss gekommen waren. Der Sadhu, der nichts besaß außer einer verstaubten Gebetsperlenkette, war für die Affen uninteressant. An keinem Ort hätte es sich besser meditieren lassen als hier.
Nicht weit von der Stelle, wo der Sadhu saß, war jeden Morgen ein Dhobi Wallah, ein Wäscher, damit beschäftigt, Kleider zu waschen. Auch an diesem Tag hatte der Dhobi Wallah schon zu früher Stunde einen großen Stapel Kleider und Decken und andere in Auftrag gegebene Wäsche auf den Rücken seines Esels geladen, hierher an den Fluss gebracht und dann am Ufer abgeladen, um nun mit der Arbeit zu beginnen. Jedes Mal, wenn er die grob eingeseifte Wäsche zusammengerollt auf einen flachen Stein am Ufer schlug, hallte das klatschende Geräusch durch die klare Luft. Dann wusch er die Kleider aus und hängte sie auf eine Schnur, die zwischen zwei provisorisch am Ufer aufgestellten Pfosten gespannt war.
Der Dobhi Wallah, der noch nicht einmal gefrühstückt hatte, hätte sich nun gerne ein wenig ausgeruht und eine Tasse Chai, einen schwarzen Tee mit Milch und Gewürzen, getrunken. Doch er sorgte sich um seinen Esel, der alleine am Flussufer graste. Wie er so überlegte, erblickte er den Sadhu, der dort an der Flussböschung saß, und rief zu ihm hinüber:
»Ich gehe kurz einen Tee trinken, pass doch bitte so lange auf meinen Esel auf.«
Ohne sich weiter um den Sadhu zu kümmern, stieg er die Böschung hinauf und verschwand in einer Gasse, um eine Teestube aufzusuchen.
Als der Dobhi Wallah nach einer Weile zurückkam, schaute er sich um. Doch alles, was er erblickte, war die inzwischen getrocknete Wäsche, die dort flatterte. Von seinem Esel war nichts zu sehen. Er trat auf den Sadhu zu und fragte laut:
»Wo ist mein Esel?«
Der Sadhu öffnete die Augen und fragte:
»Was ist los, dass du hier so herumschreist?«
Der Dhobi Wallah rief wütend:
»Was los ist? Ich habe dich gebeten, kurz auf meinen Esel aufzupassen, und nun ist er weg! Wo ist mein Esel?«
Der Sadhu entgegnete, so als ginge ihn dies alles gar nichts an:
»Sehe ich so aus wie jemand, der auf deinen Esel aufpasst? Siehst du denn nicht, dass ich ein heiliger Sadhu bin, der nach dem Göttlichen strebt?«
Der Dobhi Wallah, erbost über den überheblichen Ton des Sadhu, war nicht bereit zurückzustecken.
»Du sitzt hier herum, hast nichts zu tun und vertrödelst deine Zeit. Da habe ich dich halt gebeten, dass du auf meinen Esel aufpasst.«
Angesichts dieser Beleidigung stieg dem Sadhu der Zorn bis in die Spitzen seiner verfilzten, langen Haare.
»Was sagst du da? Ich habe nichts zu tun und vertrödele meine Zeit?«
Nun kam es zwischen den beiden Männern zu einer handfesten Auseinandersetzung. Der Sadhu setzte an, um den Dobhi Wallah von hinten zu stoßen, doch dieser wich aus und schubste den Sadhu zu Boden. Nun flogen Flüche und Fäuste und Fußtritte in wildem Durcheinander hin und her.
Doch der Kampf verlief sehr einseitig. Der Dobhi Wallah, der durch seine Arbeit beträchtliche Muskelkraft entwickelt hatte, drückte den abgemagerten Sadhu, der nur sehr unregelmäßig Mahlzeiten zu sich nahm, zu Boden. Der Sadhu konnte sich nicht aus dem Griff des Dobhi Wallah befreien, zappelte hilflos herum und rief seinen Gott laut um Hilfe an. Doch so laut er auch rief, die göttliche Antwort blieb aus.
Im Nu kamen Leute herbeigeeilt, und auch die Affen, die von den Bäumen aus zusahen, ließen sich dieses Spektakel nicht entgehen. Erst nachdem ein paar Männer dazwischengegangen waren, nahm der Kampf schließlich ein Ende. Der Dobhi Wallah machte sich auf, um nach seinem Esel zu suchen, und der Sadhu saß jämmerlich da, mit blutverschmiertem Gesicht, und betete zu seinem Gott. Da erschien der von ihm angerufene Gott vor seinen Augen.
Der Sadhu schluchzte:
»Oh, wie dankbar ich bin, dass du erschienen bist. Doch warum hast du mir nicht geholfen, als ich von diesem ordinären Wäscher verprügelt worden bin und dich um Hilfe angerufen habe? Ich habe dir lange Zeit gehuldigt, weshalb hast du mich vergessen und mich vor aller Augen diese Schmach erleiden lassen?«
Da sprach der Gott:
»Mein Sohn, als du nach mir gerufen hast, da bin ich sogleich erschienen. Doch als ich ankam, sah ich nichts außer zwei Männern im Streit, die sich am Boden wälzten und mit Fäusten aufeinander losgingen. Ich konnte nicht unterscheiden, wer von beiden der Gottesjünger und wer der Wäscher war. In Zorn und Rachgier unterschieden sich die beiden nicht im Geringsten. Da habe ich mir gedacht, es sei das Beste, die beiden Wäscher sich selbst zu überlassen, denn so würde sich das Problem schon von selbst lösen.«
Die Welt ist stets voller Menschen im Streit. Stein und Blume mögen von ihrem Wesen her verschieden sein, doch wenn sie einander anbrüllen, kann selbst ein Gott nicht mehr unterscheiden, wer Stein und wer Blume ist. Befangen in dem Irrglauben, ich sei die Blume und der andere der Stein, wähnen wir uns alle als Blume und werfen doch ständig mit Steinen aufeinander. Mit wem liege ich gerade im Streit?
Der Bildhauer und der Todesbote
Vor langer Zeit lebte einmal in einer Stadt ein berühmter Bildhauer. Er schuf Skulpturen von Tieren, von Vögeln und von Menschen, und dies in so vortrefflicher Weise, dass man beim Anblick der Figuren das Gefühl hatte, wirkliche Lebewesen vor Augen zu haben. Gefühls- und Körperausdruck waren aufs Genaueste nachgebildet, und man hätte meinen können, die Figuren würden jeden Augenblick anfangen, sich zu bewegen.
Der Bildhauer genoss die Anerkennung zahlreicher Kunstkritiker und wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, und so war er selbst sehr stolz auf seinen Erfolg. Selbstbewusst tat er kund, dass seine Werke derart vollendet seien, dass niemand auch nur einen einzigen Makel daran finden könne.
Doch auch er wurde mit den Jahren älter und spürte, dass ihn allmählich die Kräfte verließen. Und wo er so viel Ehre und Ruhm genossen hatte, machte ihm der Gedanke an den Tod umso größere Angst. Wie jeder andere auch, wollte er nicht sterben.
Heutzutage kommt es bisweilen vor, dass Menschen vollkommen unerwartet an Herzversagen sterben. Damals jedoch, im Goldenen Zeitalter, war der Tod nichts, was plötzlich gekommen wäre. Zu jener Zeit wurde jeder einzelne Mensch, dem der Tod bevorstand, von einem Todesboten aufgesucht, gesandt von Yamaraja, dem Gott der Unterwelt. So wusste jeder, wann sein eigener Tod bevorstand und somit seine irdische Zeit enden würde.
Der Bildhauer, der an ein Leben voller Ruhm und Reichtum gewöhnt war, wurde nun immer mehr von dem Gedanken an den Tod geplagt. Er konnte sein Leben, mit dem er doch so zufrieden gewesen war, nicht mehr genießen und erschauerte bei dem Gedanken, alles, was er in seinem Leben angehäuft hatte, irgendwann zu verlieren. So beschloss er, den Todesboten der Unterwelt zu überlisten.
Er fertigte einhundert Skulpturen an, die alle genau nach seiner eigenen Gestalt geformt waren. Körpergröße, Körperform, Gesichtsausdruck und jede einzelne Hautfalte – alles bildete er lebensecht nach. Alle Skulpturen waren ihrem Aussehen nach vollkommen mit ihm identisch, und wenn er sich zwischen all die Figuren stellte, vermochte sogar seine Familie nicht mehr zu erkennen, welches die Steinfigur und welches der echte Mensch war. Er stellte nun all diese Skulpturen dicht an dicht in seinem Hause auf.
Als es so weit war, kam pünktlich der Todesbote, um die Seele des Bildhauers mitzunehmen. Doch als er in dessen Hause all die vollkommen gleich und lebendig aussehenden Steinskulpturen stehen sah, einhundertundeins an der Zahl, war er verwirrt. Er sollte doch die Seele nur eines einzigen Menschen mitnehmen, und nun stand er vor diesem Wald aus Figuren. Schließlich blieb dem Todesboten nichts anderes übrig, als unverrichteter Dinge in die Unterwelt zurückzukehren.
Als Yamaraja sah, dass der Todesbote mit leeren Händen ankam, wurde er sehr wütend. Zitternd vor Angst erklärte ihm der Todesbote, er sei im Hause des Bildhauers nicht einem einzigen Menschen, sondern einhundertundeins vollkommen identisch aussehenden Menschen gegenübergestanden und habe nicht entscheiden können, welchen davon er mitnehmen solle. Aus Angst, vielleicht die falsche Seele zu erwischen, sei er schließlich unverrichteter Dinge wieder gegangen. Yamaraja befahl dem Todesboten erbost, sofort wieder aufzubrechen, um die Seele des Bildhauers zu holen.
Als der Bildhauer spürte, dass der Todesbote zurückkehren würde, versteckte er sich wieder zwischen den hundert Selbstbildnissen, die er in seinem Hause aufgestellt hatte. Der Todesbote hatte sich vorgenommen, die Seele des Bildhauers dieses Mal ganz gewiss nicht entkommen zu lassen. Kehrte er wieder mit leeren Händen zurück, würde die Unterwelt in schwere Unordnung geraten und Yamaraja ihn ganz sicher hart bestrafen.
Der Todesbote wusste, dass der Bildhauer sich zwischen den Figuren versteckt hielt, um ihn zu verwirren. Mit angehaltenem Atem und ohne die geringste Bewegung. Daran konnte kein Zweifel bestehen. Der Todesbote besah sich jede der einhundertundeins Skulpturen ganz genau, eine nach der anderen, aber alle ähnelten dem echten Bildhauer bis aufs Haar, sodass er, so sehr er sich auch bemühte, einfach nicht herausfinden konnte, wo dieser sich befand. In dem Augenblick, als er schon aufgeben wollte, kam ihm plötzlich ein Gedanke. Er sagte mit lauter Stimme:
»He, Bildhauer! Du bist ganz ohne Frage ein genialer Künstler. Aber diese Figur hier weist eklatante Schwächen auf und kann mitnichten als vollendetes Kunstwerk bezeichnet werden. Selbst ein drittklassiger Künstler hätte das besser hinbekommen.«
Als der Bildhauer, der bis dahin die Luft angehalten hatte, dies hörte, konnte er seinen Ärger nicht zurückhalten und polterte los:
»Ein drittklassiger Künstler soll mir überlegen sein? Welchen Makel soll mein Werk denn haben?«
Da griff der Todesbote ihn am Genick und rief:
»Jetzt hab ich dich!«
Und dann nahm er seine Seele mit.
So unerschütterlich die Steinskulpturen dastanden, so leicht geriet das Ego des Bildhauers schon durch die geringste Kritik ins Wanken, weshalb er sich schließlich selbst verriet.
Das Streben nach Perfektion ist etwas Gutes. Doch für die Vollendung des Selbst gibt es nichts Wichtigeres, als sich von seinem Ego zu befreien. Was andere Menschen mir antun, wird zu ihrem Karma, wie ich aber darauf reagiere, wird zu meinem eigenen Karma.
Lasst uns Rasgulla essen
König Krishnachandra, Herrscher im Gebiet von Bengalen, erlangte seinen Ruhm vor allem dadurch, dass er dem Reich der Mogule bis zuletzt heftigen Widerstand leistete. Auch als Kunstkenner und -förderer war er bekannt. Doch ebenso wie alle anderen Menschen war auch er nicht vollkommen, sondern hing einem schlimmen Aberglauben an, der die Menschen in seinem Umfeld in große Angst versetzte.
Und zwar war er der festen Überzeugung, dass diejenige Person, die er morgens, nachdem er erwacht war, als Erstes zu Gesicht bekam, den gesamten Tag lang sein Schicksal bestimme. Wenn sich der Tag als glücklicher Tag erwies, belohnte er daher die betreffende Person, wenn jedoch an diesem Tag ein Unglück geschah oder der Tag in unerwarteter oder unerwünschter Weise verlief, wurde die Person als Unglücksbringer und in schlimmen Fällen gar als Bedrohung für das Land betrachtet und dementsprechend bestraft. Auch vor harten Strafen schreckte der König nicht zurück.
Zu jener Zeit, in der vorwissenschaftlichen Epoche, waren abergläubische Vorstellungen wie diese weitverbreitet. Auch die unsichere Lage des Landes, das sich den muslimischen Eindringlingen und den englischen Kolonialherren entgegenstellen musste, trug vermutlich dazu bei, dass manch sonderbare Ansicht Verbreitung fand. Da aber in diesem Fall ein König, der mit aller Macht und Autorität ausgestattet war, dem Aberglauben anhing, waren die Auswirkungen auf die anderen Menschen umso größer.
Jeder im Palast, der um den skurrilen Aberglauben des Königs wusste, wollte dem Herrscher am Morgen auf keinen Fall als Erster begegnen. Zwar konnte man bei einem glücklichen Verlauf des Tages mit ein paar Goldmünzen, einer Kuh oder einem Stück Land belohnt werden, wenn an diesem Tag aber etwas schiefging, wurde man mit Stockschlägen bestraft oder sogar aus dem Land gejagt. Auf dieses Risiko wollte sich niemand einlassen.
Nun waren aber diejenigen, die dem König am Morgen als Erstes gegenübertreten mussten, vor allem Diener oder Leibwächter, die Königin oder Kurtisanen oder Minister, die mit ihm wichtige Staatsangelegenheiten besprechen mussten, sodass gewöhnliche Leute gemeinhin nichts zu befürchten hatten. Und da die Personen, mit denen der König morgens als Erstes in Berührung kam, vor allem enge Vertraute waren, bereitete er ihnen meist keine größeren Schwierigkeiten.
Am Königshof gab es einige Gaukler, darunter auch einen namens Gopal, der dem Stand der Haarschneider entstammte. Gopal brachte die Leute stets durch gewitzte Worte und sein unberechenbares Verhalten zum Lachen. Auch besaß er die Gabe, alle Leute zum Narren zu halten, bisweilen auch den König. Obwohl sich mancher über seine Späße ärgerte, konnten ihn doch alle gut leiden. Auch der König freute sich, wenn er in Gopals Gegenwart die schwierige Lage des Landes einen Augenblick lang vergessen konnte. Gopal, der als Improvisationskünstler jede Situation zu seinen Gunsten umkehren konnte, fürchtete die Launen des Königs nicht und kümmerte sich auch nicht um die Strafen, die dieser zuweilen verhängte.
Da alle ihm morgens aus dem Weg gingen, war der König zu dieser Zeit immer ein wenig einsam. So verließ er bisweilen den Palast, um einen Spaziergang zu unternehmen. Er schlenderte am Fluss entlang oder durch einen nahe gelegenen Obstgarten, oder er ging auf den Markt. Das ganze Land wusste von den abergläubischen Vorstellungen des Königs, und so zitterte jeder, der ihm morgens zufällig als Erster über den Weg lief, den ganzen Tag lang voller Furcht, ob er am Ende belohnt oder bestraft würde.
Der Gaukler Gopal war von friedlichem, entspanntem Naturell und pflegte morgens lange auszuschlafen. An diesem Tag aber wurde er früh wach, spürte, dass er hungrig war, und ging zum Fluss, wo sich das Haus eines Fischers befand, denn er hatte Lust, ein wenig Fisch zu essen. Er wusste, dass der Fischer jeden Morgen in aller Frühe vom Fischfang zurückkehrte. Aber an diesem Morgen war niemand zu sehen. Es war gerade so, als hätte der Fischer sich versteckt. Wen Gopal aber stattdessen am Ufer erblickte, war der König, der dort einen Spaziergang machte.
Als der König ihn sah, sagte er erstaunt:
»Gopal! Du stehst doch sonst immer erst auf, wenn die Sonne schon hoch am Himmel steht, was treibt dich denn so früh hierher?«
Da sagte Gopal:
»Guten Morgen, Majestät. Ihr habt ganz recht. Ich schlafe für gewöhnlich recht lange, doch heute Morgen kam mir plötzlich der Gedanke, dass ich mein Glück gerne einmal auf die Probe stellen würde, und so bin ich schon früh hierher an den Fluss gekommen.«
Der König entgegnete:
»Ich verstehe nicht, was du meinst. Wieso willst du denn hier am Flussufer dein Glück auf die Probe stellen?«
Und Gopal, nicht auf den Mund gefallen, antwortete:
»Nun, ich wusste, dass ich Eure Majestät hier heute Morgen früher treffen würde als irgendjemand sonst.«
»Wie konntest du das denn wissen?«, fragte der König erstaunt.
»Intuition. Jeder hat doch solche Momente. Mit Worten schwer zu erklären. Nun jedenfalls bin ich gewiss, dass der heutige Tag nur Gutes bringen wird. Denn niemand anderes als Ihr, Majestät, der Bringer allergrößten Glücks, war es, der mir heute Morgen als Erster begegnet ist!«
»Aber gewiss doch!«, erwiderte der König hocherfreut.
Die beiden Männer gingen gemeinsam zum Palast zurück. Da sagte der König, dem gerade ein Gedanke gekommen zu sein schien:
»Hör mal, Gopal, vergiss auf keinen Fall, dass du derjenige warst, der mir heute Morgen als Erster begegnet ist. Ich werde den Verlauf des heutigen Tages genau beobachten. Und am Abend werde ich wissen, ob du mir Glück oder Unglück gebracht hast. Und dementsprechend werde ich dich belohnen oder bestrafen.«
»Gewiss doch, Majestät«, antwortete Gopal ehrfurchtsvoll. »Ich bin gespannt, wer von uns beiden der größere Glücksbringer ist.«
»Was willst du damit sagen? Nimmst du dir nicht ein bisschen zu viel heraus?« Der König runzelte die Stirn.
»Ich bin doch nur ein armer Gaukler. Ihr solltet meine Worte nicht auf die Goldwaage legen, Majestät.«
Bald darauf waren sie am Palast angekommen. Jeder, der ihnen unterwegs begegnet war und Gopal an der Seite des Königs gesehen hatte, war sehr erleichtert gewesen, dass er an diesem Tag nicht dem König als Erster begegnet war. Sogar die kleinen Kinder hatten aufgeatmet und sprangen nun wieder unbeschwert umher.
Der König rief Gopal nach drinnen und forderte ihn auf, bei der Unterredung mit seinem Minister, die bald stattfinden werde, mit anwesend zu sein. Da Gopal mit seinen Späßen stets für Auflockerung sorgte, wollte der König ihn bei ernsten Angelegenheiten gerne dabeihaben.
Bevor die Unterredung beginnen sollte, erschien zunächst der königliche Barbier. Der König pflegte sich jeden Morgen, bevor er mit den Tagesgeschäften begann, zunächst rasieren zu lassen. Als der Barbier Gopal erblickte, dankte er den Göttern, dass nicht er selbst dem König an diesem Morgen als Erster begegnet war. Um die allmorgendliche schicksalsträchtige Begegnung zu vermeiden, war jeder der königlichen Barbiere stets bemüht, den anderen den Vortritt zu lassen.
»Zeit für die Rasur, Majestät«, sagte der Barbier. Der König lehnte sich in den Frisierstuhl und sagte:
»Nun denn. Beginne er sogleich mit der Rasur!«
Dann fragte er Gopal, wie denn die Hochzeitsfeier gewesen sei, an der er am Abend zuvor teilgenommen hatte. Wie gewöhnlich schmückte Gopal seinen Bericht mit allerlei Unfug und Scherzen aus und brachte damit alle Leibwächter und Kammerdiener zum Lachen. Und auch der König konnte nicht an sich halten und brach in schallendes Gelächter aus. Ebenso der Barbier. Da rutschte dem Barbier das Messer ab, das er in der Hand hielt, sodass er dem König eine tiefe Schramme im Gesicht beibrachte.
Das Blut floss aus der Wunde und augenblicklich entstand ein gewaltiger Aufruhr. Die Kammerdiener eilten herbei, um die blutende Wunde zu stillen, und die Leibgarde ergriff den Barbier. Die Wunde war rasch gestillt, doch der Barbier zitterte vor Angst. Dem König eine Schnittwunde im Gesicht zuzufügen, war kein geringfügiges Vergehen. Darauf stand lebenslängliches Exil oder die Todesstrafe.
Alle waren wie vom Schlag getroffen – bis auf einen. Gopal war das Lachen auch in diesem Augenblick nicht vergangen.
Da schrie der König voller Zorn:
»Lach nicht! Erinnerst du dich denn nicht, dass du es warst, der mir heute Morgen als Erster begegnet ist?«
»Sehr richtig, Majestät«, antwortete Gopal. »Und Ihr wart derjenige, der mir heute Morgen als Erster begegnet ist.«
»Was spielt das für eine Rolle?«, fragte der König voller Missmut. »Ich spreche von dem Schicksal, das mir am heutigen Tag widerfahren ist. Du bist der unseligste Unglücksbringer, dem ich jemals begegnet bin. Dein Gesicht war das erste, das ich heute Morgen gesehen habe, und kaum dass ich in den Palast zurückgekehrt bin, blutet mir mein Gesicht! Nun bin ich am Überlegen, welche Strafe ich dir angedeihen lassen werde!«
»Strafe? Wieso?« Gopal gab sich erstaunt. Dann begann er zu schluchzen.
Da sagte der König:
»Aber gewiss doch! Ich habe noch niemals in meinem Leben so geblutet wie heute. Da brauche ich gar nicht lange zu überlegen. Die Todesstrafe ist das Einzige, was du verdient hast! Ein Kerl, der dafür verantwortlich ist, dass königliches Blut vergossen wurde, verdient nichts anderes als den Tod!«
Da erhob Gopal beide Hände zum Himmel und klagte laut:
»Oh, welch entsetzliche Ungerechtigkeit!«
Der König runzelte die Stirn und fragte:
»Was soll daran ungerecht sein?«
Da sagte Gopal:
»Dabei seid Ihr doch der größere Unglücksbringer von uns beiden, Majestät.«
Der König schrie:
»Wie kannst du es wagen, so etwas zu sagen? Für dein ungebührendes Verhalten dem König gegenüber sollte man dir gleich zweimal den Kopf abschlagen!«
Doch Gopal hielt entschlossen dagegen:
»Ich wage dies zu sagen, weil es die Wahrheit ist!«
»Wieso?«
In die Wut des Königs begann sich Neugier zu mischen.
Gopal erwiderte:
»Niemand kann bezweifeln, dass mir das größere Unglück widerfahren ist. Ich war der Erste, dem Eure Majestät heute Früh begegnet ist, und Ihr habt deshalb eine kleine Schramme im Gesicht erlitten. Und Eure Majestät war der Erste, der mir heute Früh begegnet ist, und ich muss deshalb sterben. Muss ich nun wirklich noch aussprechen, wer hier wem das größere Unglück gebracht hat?«
Der König sagte einen Augenblick lang nichts. Dann aber brach er in schallendes Gelächter aus.
»Gopal, du hast recht. Eine blutende Wunde ist nicht vergleichbar damit, den Tod zu erleiden. Ja, es stimmt. Ich bin der größere Unglücksbringer von uns beiden. Deine Worte haben mich zur Vernunft gebracht. Ich sehe nun ein, wie unsinnig meine Denkweise war. Du hast es mir unmissverständlich klargemacht.«
Da sagte Gopal:
»Nun, Majestät, wäre es dann nicht angebracht, dass Ihr mir vielleicht ein Rasgulla spendiert? Wisst Ihr, ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gegessen und sterbe vor Hunger.«
Da lachte der König und sagte: »Ein vortrefflicher Gedanke. Lasst uns Rasgulla essen!«
Und er ließ auf der Stelle ein paar Kisten Rasgulla hereinbringen, und alle, Gopal und der Friseur und die Leibwächter, aßen nach Herzenslust.
In Indien wird jeden Tag Milch getrunken, und damit diese bei dem heißen Wetter nicht schlecht wird, wird sie über dem Feuer gekocht. So sind in Indien viele süße Milchprodukte entstanden und eines davon ist Rasgulla: kleine, weiße Käsekugeln von weicher luftiger Substanz. Ein Dessert, das ursprünglich aus der Region von Bengalen stammt und auf dem gesamten indischen Subkontinent gerne bei Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und anderen festlichen Anlässen verzehrt wird. Wenn man bei einer indischen Familie eingeladen ist und Rasgulla als Gastgeschenk mitbringt, wird man besonders herzlich empfangen. Und wer einmal in Indien war und auf seiner Reise kein einziges Mal Rasgulla gegessen hat, darf sich wohl mit Fug und Recht einen Pechvogel nennen.
Wir verfallen leicht dem Vorurteil, jemanden als Unglücksbringer zu betrachten. Doch wer weiß, ob wir aus Sicht ebendesjenigen nicht viel größere Unglücksbringer sind. Anstatt unserer bornierten, selbstbezogenen Sichtweise zu folgen, sollten wir vielleicht lieber jeden Morgen eine Portion Rasgulla essen.
Wer heilt den kranken Arzt?
Sushruta, Urvater der indischen Medizin und Pionier der Chirurgie, lebte im 6. Jahrhundert v. Chr. und soll unter anderem die ersten Schönheitsoperationen und Transplantationen der Menschheit durchgeführt haben. Damals war es üblich, Kriminelle damit zu bestrafen, dass man ihnen die Nase abschnitt, und Sushruta soll es beispielsweise gelungen sein, einem Mann Haut von einer anderen Körperpartie auf die Stelle der abgeschnittenen Nase zu verpflanzen.
Sushruta war so berühmt, dass sein Name auch im Epos Mahabharata erwähnt wird, und auch im Bereich der Inneren Medizin hatte er den Ruf eines Wunderheilers, der jede Krankheit zu kurieren verstand. Er gilt als indischer Hippokrates und führte sogar Gehirn- und Augenoperationen durch. Das auf Palmenblättern geschriebene Sushruta Samhita, ein Grundlagenwerk über ayurvedische Medizin, liefert detaillierte Erklärungen zur menschlichen Anatomie sowie zahlreichen Krankheitsbildern und Therapiemöglichkeiten, beispielsweise zu Herz-, Haut-, Augen-, Hals-, Nasen- und Ohrenerkrankungen.
»Sushruta, du bist kein gewöhnlicher Mensch, sondern die Verkörperung von Dhanvantari, des Arztes der Götter!«, sagten viele Menschen voller Bewunderung, doch Sushruta erwiderte darauf nur in aller Gelassenheit:
»Jeder Arzt besitzt ebenso viel Wissen wie ich. Der Grund für die Wirksamkeit meiner Behandlungen liegt darin, dass man mir vertraut. All dies ist nichts anderes als die Gnade der Götter.«
Seine Fähigkeiten und Kenntnisse, seine Weisheit und Bescheidenheit hinterließen bei allen Menschen tiefen Eindruck. Aus allen Städten und Dörfern kamen unzählige Leute zu ihm, um sich behandeln zu lassen.
Eines Tages aber wurde Sushruta selber krank und litt unter schlimmem Husten. Und auch nach einigen Monaten hatte sich sein Zustand noch immer nicht gebessert.
Ein Freund sagte zu ihm:
»Sag Bescheid, wenn du irgendwelche Heilkräuter brauchst. Ich kann dir welche besorgen.«
Doch Sushruta lächelte nur.
Da kam ein anderer Freund, der sagte:
»Sagt man nicht, kein Arzt, so hervorragend er auch sein mag, ist in der Lage, sich selbst zu heilen? Wie wäre es, wenn du dich von Ayushman behandeln lässt?«
»Daran habe ich auch schon gedacht«, erwiderte Sushruta.
Auch Sushruta hatte schon viel von Ayushman, dem berühmten Heiler gehört. So brach er noch am selben Tag gemeinsam mit ein paar Freunden auf, um Ayushman aufzusuchen.
Doch als sie den ganzen Tag gelaufen waren und schließlich an dessen Haus ankamen, erfuhren sie, dass sie Ayushman nicht treffen könnten. Dieser sei bereits seit über einem Monat krank und habe sich daher auf den Weg gemacht zu Bedhiyaman, einem anderen hervorragenden Arzt, um sich von ihm beraten zu lassen. Bedhiyaman wohnte in einer Stadt, die einen Tagesmarsch entfernt lag.
Da dachte Sushruta: ›Auch ich sollte zu Bedhiyaman gehen. Er ist zweifellos der beste Arzt von uns allen.‹
So übernachteten sie in einer Herberge und machten sich am nächsten Morgen in aller Frühe auf den Weg. Bei Sonnenuntergang erreichten sie die Stadt. Doch da sahen sie, dass die Menschen in den Marktgassen alle traurige Gesichter machten. Als sie sich Bedhiyamans Haus näherten, war dort eine große Menschenmenge versammelt. Viele der Umherstehenden hatten Tränen in den Augen.
»Was ist passiert? Ist eine hochrangige Persönlichkeit gestorben, die Patient bei Bedhiyaman war?«, fragte Sushruta einen der Trauernden.
Da sagte der Mann:
»Kein Patient, sondern Bedhiyaman selbst hat diese Welt verlassen. Den ganzen letzten Monat lag er krank darnieder. Eigentlich wollte er sich morgen aufmachen zu Sushruta, dem großen Arzt, um sich von ihm behandeln zu lassen. Doch dann hat ihn plötzlich der Tod ereilt. Nun sind wir alle in großer Trauer.«
Als Zeichen seiner Ehrerbietung legte Sushruta beide Hände zusammen und hob sie zur Stirn. Dann wandte er sich, um heimzukehren.
Seine Begleiter betrachteten ihn mit bedeutungsvollem Blick. Sushruta nickte und sagte:
»Gehen wir heim. Sorgt euch nicht. Mir wird es bald besser gehen.«
»Aber wie?«, fragten seine Gefährten.
Und Sushruta erklärte:
»Alle haben mir vertraut, nur ich selbst hatte kein Vertrauen zu mir. Dieses Vertrauen ist nun zurückgekehrt. Das Vertrauen in mich selbst, der Glaube an die heilenden Kräfte in mir selbst. Dies ist die beste Medizin! Nun werde ich mich selbst heilen können.«
Schon ein einziges Instrument erfüllt die Welt mit Musik
Tansen, der manchmal als »Vater der Musik Nordindiens« bezeichnet wird, hatte schon als Kind eine besondere Stimme. Wenn er jemandem auf dem Feld laut etwas zurief, klang seine Stimme so energisch, dass manch einer einen brüllenden Tiger gehört zu haben meinte, mit seinem Gesang soll er dagegen einmal einen wild gewordenen Elefanten besänftigt haben. Solcherlei Geschichten verbreiteten sich durch Mund-zu-Mund-Propaganda rasch im ganzen Reich des Moguls, dem islamisch geprägten Königreich im Norden Indiens, und so erfuhr auch der Großmogul Akbar von den meisterhaften gesanglichen und instrumentalen Fähigkeiten Tansens, den er schließlich als Hofmusiker bei sich im Palast anstellte.
Tansens Spezialität war der traditionelle Raga. Wenn er den Regen-Raga sang, zogen sich am Himmel Regenwolken zusammen, sang er den Laternen-Raga, begannen im Palast alle Laternen zu leuchten, sang er den Frühlings-Raga, so brachten die Blumen noch vor der Zeit ihre Blüten hervor. Bei der Gattung des Ragas, die auf Tonleitern basiert, die jeweils ganz bestimmte menschliche Gefühle