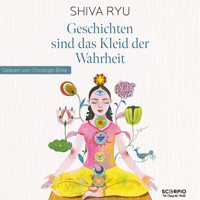Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Scorpio Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Koreas Bestsellerautor Shiva Ryu gewährt uns mit seiner wunderbar poetischen Sprache Eintritt in eine Welt voller Weisheit und Schönheit des Lebens. Seine Erfahrungen und Erkenntnisse, die er auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage "Was wollte das Leben mir sagen?" machen durfte, bilden die Grundlage für seine klugen Geschichten. Wer kann schon wissen, ob etwas für das Leben gut oder schlecht ist? Das Leben scheint uns gelegentlich auf einen Weg zu führen, der nicht Teil unseres Plans ist, doch dieser Weg ist der, nach dem sich unser Herz sehnt. Für den Kopf ist das zunächst nicht nachvollziehbar, aber für unser Herz durchaus. Das Buch ist eine Erinnerung daran, dass nichts auf der Welt ausschließlich schlecht sein kann und wir lernen können, das Gute im vermeintlich Schlechten zu erkennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Shiva Ryu
SETZE KEINEN PUNKT AN DIE STELLE, AN DIE GOTT EIN KOMMA GESETZT HAT
Weisheitsgeschichten
Aus dem Koreanischen vonHyuk-Sook Kim und Manfred Selzer
Die koreanische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »«. »Good or Bad, Who Knows?« bei The Forest Book Publishing Co., durch Vermittlung von BC Agency, Seoul
All rights reserved.
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
1. eBook-Ausgabe 2020
1. Auflage 2020
Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe 2020 Scorpio Verlagin Europa Verlage GmbH, München© 2019 Shiva Ryu
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.
Umschlaggestaltung, Layout und Satz: Danai Afrati
Umschlagmotiv und Illustrationen im Buch: Miroco Machiko
Lektorat: Ulla Rahn-Huber
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95803-316-0
Alle Rechte vorbehalten.www.scorpio-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Müncheninfo@europa-verlag.com+49 89 18 94 733-0mr@europa-verlag.com
Inhalt
PROLOG: AUTOR DES EIGENEN LEBENS
1
Der Narr, der sich in den Regen stellt
Ein Vogel fliegt, auch wenn er nicht weiß, wo er landen wird
Häng die Sache nicht so hoch auf!
Ein Mantra fürs Leben
Nimm beim Zählen segensreicher Momente die Verletzungen nicht aus
Gott schreibt mit geschwungener Schrift eine gerade Botschaft
Alles Lebendige empfindet Schmerz
2
Wer kann schon sagen, ob etwas für unser Leben insgesamt gut oder schlecht ist?
Warum gibst du mir nur das?
Die Kunst, Wunder zu wirken
Hindi-Unterricht
Mein Lieblingsschüler
C. G. Jungs steinerner Turm
Du bist nicht vollkommen, aber du kannst mir eine vollkommene Rose schenken
3
Vom Graben und Pflanzen
Ich mag mich am liebsten, wenn ich bei dir bin
Wer bin ich, wenn keiner mir zuschaut?
Das innere Kind
Ist »ich« ein Nomen oder Verb?
Hallo, meine Seele, geht es dir gut?
Das Wiedersehen – ein Wunder
4
Welchen Weg du auch gehst, werde eins mit ihm
Sprachliche Reinheit – eine Fiktion
Denk nicht an einen Affen
Sei mir willkommen, Emotion
Von »Lenchak« oder der karmischen Schuld
Eine Geschichte von Äpfeln
Der Tod des Orpheusbülbül
5
Keine Begegnung ist zufällig
Man merkt schon, wenn die Blumen blühen
Sechs Milliarden Welten
Mitgefühlsmüdigkeit
Uns Sorgen zu machen bringt nichts
Warum bin ich ich und nicht du?
Ich bin es
6
Ein einziger wahrer Satz
Der Mann, der den Fallschirm gefaltet hat
Ich, das Original – du, die Fälschung
Kein Stern leuchtet, ohne zu verglühen
Das, wonach du suchst, sucht eigentlich nach dir
EPILOG: GESCHENK DES HIMMELS
PROLOG: AUTOR DES EIGENEN LEBENS
Der Berg Kailash in der tibetischen Hochebene ist Pilgerort für verschiedene Religionen. Auf seinem mit Firnschnee bedeckten, alles überragenden Gipfel wohnt der Überlieferung zufolge Gott Shiva. Er verbringt einen Großteil seiner Zeit in der Meditation und mit asketischen Übungen, und so verwundert es nicht, dass seine Gattin Parvati ständig friert und sich langweilt.
An einem Tag konnte sie es kaum aushalten und drängte ihren Gatten: »Erzähl mir doch bitte eine spannende Geschichte.«
»Aber gerne, wenn du es dir wünschst«, antwortete Shiva.
»Aber es soll eine ganz besondere Geschichte sein, die nur für mich bestimmt ist. Eine vollkommen neue, die noch keiner auf der Welt je gehört hat«, forderte sie.
Shiva nickte und fing zu erzählen an. Seine Geschichte war tatsächlich ungemein spannend und bedeutungsvoll. Parvati war begeistert, und kaum hatte ihr Gatte sie zu Ende erzählt, bat sie ihn um eine weitere Geschichte.
Shiva erzählte ihr also noch eine Geschichte, und noch eine und noch eine, denn Parvati war unersättlich, und er hörte erst auf, als ihr die Lider schwer wurden und sie endlich einschlief.
Parvati aber war nicht die Einzige, die ihm zugehört hatte. Einer von Shivas Dienern, der gerade eine Nachricht hatte überbringen wollen, war an der Tür stehen geblieben. Die erste Geschichte hatte ihn so sehr in den Bann gezogen, dass er der Versuchung nicht hatte widerstehen können, weiter zu lauschen. Das Ohr fest an die Tür gepresst, hörte er sie alle mit an.
Danach eilte er nach Hause, und die ganze Nacht hindurch gab er seiner Frau all die interessanten Geschichten weiter und tat so, als habe er sie alle selbst ersonnen.
Die Frau des Dieners wiederum stand in Parvatis Diensten. Am nächsten Morgen, als sie ihrer Herrin das Haar kämmte, wollte sie dieser eine Freude machen, und so begann sie, ihr eine der Geschichten zu erzählen, die sie in der Nacht zuvor von ihrem Mann gehört hatte.
Kaum hatte sie die ersten Sätze gesprochen, da sprang Parvati auf und eilte wutentbrannt zu Shiva: »Hattest du mir nicht versprochen, mir Geschichten zu erzählen, die noch keiner auf der Welt je gehört hat?«
»Ja, das habe ich dir versprochen, und mein Versprechen habe ich auch gehalten«, gab Shiva erschrocken zurück.
»Wieso kennt dann selbst meine Dienerin sie?«
Auf der Stelle rief Shiva die Frau zu sich und stellte sie zur Rede: »Von wem hast du diese Geschichten gehört?«
»Von meinem Mann«, brachte diese stotternd hervor.
Sogleich wurde ihr Mann herbeizitiert, und er gestand mit zitternden Knien: »Tatsächlich hatte ich gestern Nacht eine Nachricht an Euch zu überbringen, und so kam es, dass ich vor der Tür stand und Euch erzählen hörte. Es war auf keinen Fall meine Absicht zu lauschen. Die erste Geschichte war so unglaublich interessant, dass ich nicht anders konnte, als mir auch die anderen anzuhören. Ich konnte mich einfach nicht losreißen und musste sie bis zum Ende hören.«
Shiva war etwas besänftigt, doch er befahl seinem Diener: »Wenn das so ist, sollst du vom Berg Kailash hinunter in die Welt zu den Menschen gehen und jedem einzelnen die Geschichten erzählen, die du gehört hast. Und dass es dir ja nicht in den Sinn kommt, je zu diesem Berg zurückzukehren!«
Der Diener wurde also aus dem Tempel hoch oben im Himalaya verbannt und wandert seither durch die Welt, um den Menschen seine Geschichten zu erzählen.
In meinen Augen sind Schriftsteller Menschen, die das Schicksal von Shivas Diener teilen. Sie sind Geschichtenübermittler, die ständig Neues und Interessantes erzählen müssen – voll von tiefem Sinn und dazu angetan, den Weg zur Erleuchtung zu weisen. Und sie müssen dafür sorgen, dass ihre Leser nach der ersten auch die zweite Geschichte erfahren wollen.
Jeder von uns ist Autor seines eigenen Lebens. Nur wir selbst können wissen, welche Geschichte unser Leben gerade schreibt, welchen Sinn sie macht und ob sie spannend genug ist, um die nächste Seite aufzuschlagen.
Nach dem Essayband Die Vögel schauen nicht zurück, wenn sie fliegen lege ich nun dieses neue Buch vor. Mögen Sie an der Lektüre Freude haben!
SHIVA RYU
1
Bauen wir auf Sicherheit und Gewissheit, haben wir uns den falschen Planeten ausgesucht. In dem Moment, in dem wir uns an Sicherheiten klammern, stößt uns das Leben eine Klippe hinab. Reißt uns eine Woge des Schicksals zu Boden, ist es an der Zeit, ein neues Leben anzufangen. Verlust und Abschied haben immer einen Sinn. Gott schreibt mit geschwungener Schrift eine gerade Botschaft.
DER NARR, DER SICH IN DEN REGEN STELLT
Ich war im letzten Semester meines Studiums, als ein Freund mir von einer sehr günstigen Unterkunft in der Siedlung einer Glaubensgemeinde am Rand der Provinz Gyeonggi erzählte. Ich mietete sie unbesehen. Es war eine sehr kleine Einzimmerwohnung in einem heruntergekommenen Reihenhaus, aber die Sonne schien angenehm herein, und ich konnte die Tür abschließen und für mich allein sein. Zudem gab es unweit von dort eine Allee, die zu einem Fluss hinunterführte, was für mich als Literaturstudenten wie ein Geschenk des Himmels war. Nachts schrieb ich Gedichte und untertags unternahm ich Spaziergänge in die Umgebung, statt die Vorlesungen an der Uni zu besuchen.
Mein Glück war leider nicht von Dauer. Bei den Nachbarn erregte ich Misstrauen. Für sie war ich ein Fremder mit langem Haar, der selbst im Sommer in einen schwarzen Mantel gehüllt (in der Wohnung war es kalt) durch ihre geheiligten Gefilde lief und dabei wie ein Geisteskranker vor sich hin murmelte (ich rezitierte Gedichte). Eines frühen Morgens schließlich statteten mir mehrere Leute ohne jegliche Vorankündigung einen Besuch ab. Sie traten ein, ohne sich die Schuhe auszuziehen, als ob meine Wohnung weder heilig noch unantastbar wäre, und forderten mich auf, auf der Stelle aus der Siedlung zu verschwinden.
Ich erklärte ihnen höflich, dass ich die Miete für einige Monate im Voraus bezahlt habe und daher das Recht zu bleiben hätte. Beinahe flehend fügte ich hinzu, dass ich möglichst lange hier wohnen bleiben wolle, weil mir die Gegend unbeschreiblich gut gefalle, und ich gestand, dass ich Dichter sei. Letzteres verschlimmerte die Lage ungemein. Aufgebracht, wie sie waren, verstanden meine Besucher nicht »Shiin« (Koreanisch für »Dichter«), sondern »Shin« (»Gott«). »Das ist der Teufel!«, schrien sie daraufhin. »Verschwinde von hier! Sofort!« Eine Frau deutete sogar mit dem Finger gen Himmel und schrie, ich solle den Zorn Gottes fürchten.
Das Wort Teufel traf mich wie ein Dolch ins Herz. Ich hatte während meines gesamten Studiums kaum mehr als ein paar schwer verständliche Gedichte zu Papier gebracht. Und nun musste ich die Wohnung verlassen, ohne meine im Voraus bezahlte Miete zurückzubekommen – für andere womöglich ein Taschengeld, mich aber kostete es fast mein gesamtes Vermögen. Mit verschränkten Armen standen die Leute da und ließen mich nicht aus den Augen, bis ich durch das Tor an der Einfahrt zur Siedlung verschwunden war. Sie sahen nicht mich, sie sahen den Fremden, der uneingeladen in ihrer Mitte aufgetaucht war. Dennoch fühlte ich mich wie von aller Welt verstoßen.
Aber Gott hatte mich nicht völlig vergessen. Plötzlich obdachlos und ohne die leiseste Ahnung, wo ich nun unterkommen sollte, lief ich einen Feldweg entlang. Dort begegnete ich einem Kommilitonen aus meiner Theatergruppe, der in der Nähe wohnte. Mich zu so früher Stunde mit einem Bündel Bücher und einer gefalteten Militärdecke durch die Gegend irren zu sehen, machte ihn zunächst etwas misstrauisch. So wie ich aussah, passte ich ganz und gar nicht in die herrliche Landschaft. Aber nachdem er erfahren hatte, wie es mir ergangen war, nahm er mich mit zu sich nach Hause und bot mir ein Glas Wasser mit Honig an. Die Erschöpfung war mir offenbar anzusehen. Dann fragte er bei den Nachbarn herum, ob jemand für mich eine Unterkunft habe.
Dank seiner Vermittlung gelang es mir, einen Lagerschuppen zu mieten, der mitten in einem Gemüsefeld am Flussufer stand. Ich fühlte mich dort sicher, denn zum einen war er weit genug vom Dorf entfernt, sodass ich nicht fürchten musste, erneut vertrieben zu werden, und zum anderen hatte ich einen Freund in der Nähe, der mir in einem Augenblick der Not ein Glas Wasser mit Honig reichte. Es gab nichts, worüber ich mich hätte beklagen können, außer dass es in der Hütte keinen Strom gab und ich mich mit Kerzenlicht begnügen musste. Nachts schaute ich dem Spiel der Flamme zu oder schrieb Gedichte, und am Tag unternahm ich lange Spaziergänge, auf denen ich Werke von Arthur Rimbaud oder Stéphane Mallarmé rezitierte.
Es nahte die Zeit des sommerlichen Monsuns, und eines Tages zogen über dem Dach des Lagerschuppens tief hängende, dunkle Regenwolken auf. Es donnerte. Eine leere Drohung, dachte ich zunächst. Am Abend aber öffnete der Himmel alle Schleusen. Der Regen peitschte aus allen Richtungen hernieder, und an Schlaf war nicht zu denken. Es war schon spät in der Nacht, als ich vor die Tür trat, und ich erschreckte mich zu Tode. Der Wolkenbruch hatte den Fluss anschwellen lassen, und der Pegel stieg und stieg. Es sah aus, als würde das Gemüsefeld samt meinem Schuppen schon im nächsten Augenblick verschluckt. Es war noch vor Anbruch der Morgendämmerung und alles war finster, aber das Wasser leuchtete und schäumte so schrecklich, dass mir angst und bange wurde.
Dies alles geschah zu einer Zeit, in der mir in meinem Leben ohnehin der Boden unter den Füßen schwankte. Mein Studienabschluss stand vor der Tür, aber was danach kommen sollte, erschien mir eine noch größere Herausforderung als alles, was ich bis dahin erlebt hatte. Ich hatte keinerlei Ziele im Hinblick auf die Zukunft. Und nun stand ich an diesem tosenden Fluss, der mich hinwegzuspülen drohte.
Meine Lage war aussichtslos! Ich war in Panik. Doch dann kam mir niemand anderer als ich selbst zu Hilfe und erlöste mich aus meiner Angst. Wie ich vor diesem alten Schuppen stand und die Fluten auf mich zukommen sah, kam mir plötzlich der Gedanke: »Ich bin doch Dichter!«
Und mit einem Mal erschien mir alles, was um mich herum vorging, als etwas, das ich unbedingt erleben musste, um darüber schreiben zu können. Damit erwachte mein Lebenswille.
Gibt es denn etwas Passenderes für einen Dichter, als bei Kerzenschein und Sturm und Regen Gedichte zu schreiben? In pechschwarzer Nacht mutterseelenallein am Ufer dieses entfesselten Flusses zu stehen und Gefahr zu laufen, mir eine Lungenentzündung zu holen – mich hier in den Regen zu stellen, das erlebte ich doch nur, weil ich Dichter war! In ihrem Buch Schreiben in Cafés führt Natalie Goldberg aus, dass der Normalmensch bei einem Regenguss den Schirm aufspannt oder mit einer Zeitung über dem Kopf ins Trockene flüchtet; nur der Schriftsteller ist dumm genug, sich einfach in den Regen zu stellen. Statt Schutz zu suchen oder sich darum zu kümmern, rechtzeitig irgendwo unterzukommen, schaut er fasziniert den Regentropfen zu, wie sie in eine Pfütze fallen und dabei Muster bilden. So fängt er seine Glanzmomente ein.
Wie ich in jener Nacht allein am Ufer des anschwellenden Flusses stand und den Boden unter meinen Füßen schwanken spürte, beschloss ich, von nun an nicht mehr davonzulaufen. Ich beschloss, mir immer und immer wieder dicke Regentropfen auf die Stirn prasseln zu lassen, um meiner schriftstellerischen Berufung gerecht zu werden. Beunruhigung und Einsamkeit würden in meinen Gedichten von nun an zu Adjektiven und Adverbien werden. In jenem Moment fühlte ich mich wirklich wie der Gott meiner kleinen Welt.
In Paulo Coelhos Der Alchimist widersetzt sich Santiago dem Wunsch seines Vaters, Priester zu werden. Er wird Schafhirte und macht sich auf die Suche nach dem Schatz, den er im Traum gesehen hat. In Tanger in Marokko aber wird er um das ganze Geld betrogen, das er für seine Schafe bekommen hat. Da steht er nun auf diesem Markt in diesem fremden Land, völlig mittellos, wütend und verzweifelt. Man hat ihn ausgenommen!
Von einem Moment zum anderen aber ändert er seine Perspektive und sieht sich nicht länger als Opfer eines Betrügers. Er ist ein Abenteurer auf der Durchreise, und wenn er seinen Schatz finden will, gehört es dazu, solche Dinge zu erleben. Und schon kehren sein Mut und die Lust am Reisen zurück. Er geht gestärkt aus dieser Situation hervor und schaut der Gegenwart ins Auge, statt sich beraubt zu fühlen.
Das Leben beschert uns bisweilen viel Schlimmeres als einen Betrüger. In solchen Stunden fühlen wir uns wie eine Seele, die auf einem fremden Planeten notgelandet ist und nicht weiß, wohin sie sich wenden soll. Santiago beneidet den Wind, der überall hingehen kann, und da wird ihm auf einmal bewusst: Nichts kann ihn von seinem Abenteuer abhalten.
Lieben wir unsere Berufung, lieben wir die Welt. Wie ich in jener Nacht dort draußen im Regen stand, rezitierte ich aus ganzem Herzen Gedichte. Und mir war klar, dass ich weder einer bin, der nicht weiß, wohin er sich wenden soll, noch ein von einer Schar Gläubiger verjagter Teufel. Ich bin Dichter. Die Regentropfen, die mir ins Gesicht peitschten, die Böen, die die Maisblätter zum Tanzen brachten, ja selbst das Wachs, das auf die Fensterbank tropfte – dies alles empfand ich plötzlich als Segen. Und ebenso bewusst war mir, dass ein solcher Moment voll von Poesie nicht jedem Menschen vergönnt ist.
Das wollte das Leben mir sagen. Was ich in jener Nacht erlebte, ließ mich nicht mehr los. Wo auch immer ich bin und was auch immer geschieht, ich brauche mir nur vor Augen zu führen, dass ich Dichter bin, und schon kann ich alles, was mir begegnet, mit offenem Herzen empfangen. Es war ein Moment, den mir mein Leben zum Geschenk gemacht hat. Ihm habe ich zu verdanken, dass ich schreiben kann und mir bis heute den Sinn für wahre Schönheit und die Kostbarkeit des Daseins bewahren konnte.
EIN VOGEL FLIEGT, AUCH WENN ER NICHT WEISS, WO ER LANDEN WIRD
Nach dem Tod ihres Mannes zog eine Frau ihre Tochter alleine groß. Als diese schließlich erwachsen war, fand sie keine Arbeit, und da die Mutter inzwischen zu krank zum Geldverdienen war, musste sie nach und nach alles verkaufen, was sie je besessen hatte. Nur noch ein Stück war ihr geblieben: eine goldene Halskette mit einem Saphir, ein Erbstück der Familie ihres Mannes. Doch sosehr sie ihr am Herzen lag, es kam der Tag, an dem sie sich selbst davon trennen musste.
Sie trug ihrer Tochter also auf, das Schmuckstück zum besten Juwelier der Stadt zu bringen und es ihm anzubieten. Der Mann begutachtete es sorgfältig und fragte die junge Frau, warum sie es verkaufen wolle, und da erzählte sie ihm von den finanziellen Schwierigkeiten, in denen sie sich befanden.
Der Juwelier schüttelte den Kopf. »Im Moment ist der Goldpreis sehr niedrig. Es ist kein guter Zeitpunkt, deine Kette zu verkaufen. Es wäre besser zu warten.«
Er lieh ihr etwas Geld und sagte, sie solle am nächsten Tag zu ihm ins Geschäft kommen. Sie könne als Aushilfe bei ihm anfangen und sich so etwas verdienen, um für sich und ihre Mutter zu sorgen.
So kam es, dass die junge Frau in dem Juwelierladen zu arbeiten begann. Dabei lernte sie unter anderem, den Wert von Schmuckstücken einzuschätzen. Der Juwelier war zufrieden, und er brauchte die junge Frau nur zu sehen, und es zauberte ihm ein Lächeln ins Gesicht.
Eines Tages sagte er zu ihr: »Wie du weißt, ist der Goldpreis in letzter Zeit stark gestiegen. Rede mit deiner Mutter. Es wäre jetzt eine gute Zeit, die Kette mit dem Saphir zu verkaufen.«
Nach der Arbeit ging die junge Frau also nach Hause und überbrachte ihrer Mutter die Botschaft. Natürlich sah sie sich die Kette genauer an, bevor sie sie mit ins Geschäft nahm. Und sie merkte, dass sie nur vergoldet war und der Saphir feine Risse aufwies. Er war also von minderwertiger Qualität.
»Warum hast du die Kette nicht mitgebracht?«, fragte der Juwelier sie am nächsten Morgen.
»Das hätte keinen Sinn gemacht. Ihr habt mich gelehrt, Schmuckstücke zu begutachten, und so genügte ein Blick, um zu wissen, dass sie nicht wertvoll ist. Warum habt ihr es mir nicht gleich gesagt? Ihr müsst es doch gesehen haben.«
Schmunzelnd antwortete der Juwelier: »Hättest du mir geglaubt, wenn ich dir das damals gesagt hätte? Wahrscheinlich wärst du misstrauisch geworden und hättest vermutet, dass ich eure Notlage ausnutzen und die Kette billig erwerben wollte. Oder du wärst mit falschen Erwartungen von einem Juwelier zum anderen gelaufen, um doch noch einen höheren Preis zu erzielen. Vielleicht wärest du gar so verzweifelt gewesen, dass du den Lebensmut verloren hättest. Was hätten wir gewonnen, wenn ich dir damals die Wahrheit gesagt hätte? Du wärst mit Sicherheit nie zur Schmuckkennerin geworden. Aber so weißt du nun über Gold und Edelsteine Bescheid, und ich habe dein Vertrauen gewonnen.«
Dank eigener Erfahrung Echtes von Falschem unterscheiden zu können, ist mehr wert als jeder noch so gute Rat. Ein Mensch, der sein Urteilsvermögen durch eigenes Erleben schult, vergeudet seine Zeit nicht damit, anderen zu misstrauen oder in Verzweiflung zu verfallen. Er geht einfach seinen Weg. Und damit er dies tun kann, dürfen wir ihn nicht mit vorschnellen Ratschlägen und unausgegorenen Weisheiten daran hindern. Erkenntnisse, die wir uns nicht selbst erarbeitet haben, sind wie Flügel, die wir nicht ausbreiten können. Die Probleme des Lebens sind im Erleben zu lösen.
Bei einem meiner ersten Trekking-Aufenthalte im Himalaya plante ich, zum Dorf Langtang in Nepal aufzusteigen. Der Oktober oder November wären ideale Monate für diese Tour gewesen, aber es war Januar, als ich, der langhaarige Tourist, in einem Gasthof in Kathmandu meinen Koffer auspackte. Zu meiner Freude lief ich im Ort einem Bekannten aus Nepal über den Weg, der Profi-Bergsteiger war. Ich erzählte ihm von meinem Plan: in einer Woche hin und zurück von Syabru Bensi bis hinauf zum Kyanjin Gompa auf 3800 Metern. Bei meiner letzten Tour hatte ich einen Sherpa und viel Gepäck dabeigehabt. Diesmal wollte ich ganz leicht unterwegs sein – nur mit dem Allernötigsten im Rucksack. Ich hatte schon diverse Trekking-Touren unternommen und fühlte mich gut gerüstet. Ich strotzte nur so vor Zuversicht.
Als ich meinem Freund sagte, dass ich nicht einmal einen Schlafsack mitnehmen wollte, zog er die Augenbrauen hoch, aber er sagte kein Wort. Er nickte nur.
Die Tour nach Langtang wurde zu einem einzigen Fiasko. Die Route war wesentlich gefährlicher und anspruchsvoller, als ich es mir vorgestellt hatte. Da ich keinen Sherpa hatte, verlief ich mich andauernd. Statt einer Woche wie geplant brauchte ich zehn Tage, und die Einheimischen, denen ich unterwegs begegnete, waren entsetzt bei meinem Anblick. Ich war angezogen, als wollte ich eben kurz den Hügel hinterm Haus hochlaufen. Bei meinem Aufbruch in Syabru Bensi sah ich aus wie ein zivilisierter Mensch.
War es eine ausschließlich leidvolle Erfahrung? Ich habe seither im Himalaya über zwanzig Touren unternommen, aber der Weg nach Langtang hat sich mir am intensivsten eingeprägt. Nicht nur wegen der Landschaft, der schneebedeckten Gipfel von Ganesh Himal, die meine Augen und meine Seele überwältigten. Die kaum zu ertragende Kälte, die mich dazu brachte, unterwegs in einem Laden eine dicke Jacke, ein paar Handschuhe und eine Mütze aus Yakwolle zu kaufen; vor allem aber die liebevolle Hilfe der Einheimischen vor Ort sind mir unvergesslich geblieben. Weil es unmöglich war, im Winter auf dem Berg ohne Schlafsack zu campieren, ließen mich die Besitzer der Gasthäuser in ihrer Küche übernachten, wo ich dem Knistern des Feuers im Lehmofen lauschte. So kam ich mit den Leuten, die dort wohnten, ins Gespräch, und dieser zwischenmenschliche Austausch machte diese Tour zu etwas ganz Besonderem.
Als wäre ich zu nah an einer Bombenexplosion gewesen, war mein Gesicht von der erbarmungslosen Hochgebirgssonne total verbrannt, und meine Lippen waren mit Fieberbläschen übersät, als ich, körperlich völlig ausgezehrt, mit letzter Kraft Syabru Bensi erreichte. Aber mein Geist war noch nie so frisch gewesen und mein Blick noch nie so strahlend. In diesem Zustand traf ich meinen nepalesischen Freund, den Profi-Bergsteiger, wieder.
»Warum hast du mich nicht gewarnt?«, fragte ich. »Wieso um Himmels willen hast du mir nicht gesagt, was an Ausrüstung unverzichtbar ist? Du kennst das Langtang-Gebiet doch wie deine Westentasche!«
»Weil es besser für dich ist, es durch eigene Erfahrung zu lernen. Das hier wird doch nicht deine letzte Tour sein! Ich wusste, dass du dir unterwegs alles besorgen kannst, was du brauchst. Und auch dass du alle Probleme am Ende irgendwie meistern wirst.«
Leben heißt nicht, sich Erklärungen anzuhören. Es heißt, die Dinge selbst zu erleben. Alles in uns, was nicht gut und richtig ist, wird dabei verbrannt. Hätte mein Freund nicht so sehr mit Ratschlägen gegeizt, hätte sich mir die Langtang-Tour nicht so tief ins Gedächtnis gegraben. Ich bin fest überzeugt, dass mir der Weg damals vorbestimmt war. Ich habe dabei gelernt, mein Leben nicht nach den Ratschlägen erfahrenerer Menschen auszurichten, sondern mich ohne groß zu zögern ins Nichtvorhersehbare zu stürzen, damit mir, wann immer ich mich auf unbekanntes Terrain begebe, kein Sherpa, sondern das wahre Leben begegnet. Das Leben, so weiß ich jetzt, wird mir letzten Endes die Lösung zeigen. Um es mit einem meiner Lieblingssprüche zu sagen: »Ein Vogel fliegt, auch wenn er nicht weiß, wo er landen wird.« Und fliegen lernt er immer.
HÄNG DIE SACHE NICHT SO HOCH AUF!
Auf einer Reise durch die indische Provinz Ladakh gelangte ein Mann in die Stadt Leh. Sie ist auf 3500 m Höhe gelegen. Als er in der Herberge, in die er sich einquartierte, einen Mann mit einem mobilen Sauerstoffgerät und Atemmaske daliegen sah, war dies seine erste Begegnung mit der Höhenkrankheit, die er bis dahin nur vom Hörensagen kannte. Sein Zimmer befand sich im zweiten Stock, und selbst das Treppensteigen vom Erdgeschoss hinauf fiel ihm schwer. Schon bald stellten sich Kopfschmerzen und Schwindel ein. Nach dem Abendessen verschlimmerte sich sein Zustand, und es ging ihm richtig schlecht.
Der Wirt versicherte ihm, dass er sich bloß einen Tag schonen solle, und schon würde es ihm besser gehen. Aber je länger er sich in dieser Höhe aufhielt, desto stärker wurden seine Kopfschmerzen und desto mehr raste sein Puls. Das Sauerstoffgerät, das er für viel Geld auslieh, schien keine nennenswerte Besserung zu bringen. Seine Angst vor der Höhenkrankheit wurde Stunde um Stunde größer. Am dritten Tag ließ er einen Arzt rufen. Der stellte nach eingehender Untersuchung und Überprüfung des Blutsauerstoffs fest, dass er an einem einfachen Verdauungsproblem litt und verordnete diverse Medikamente. Seine Angst aber wurde der Mann nicht los.
So kam es, dass er die ganze Woche, die er eigentlich hatte herumreisen wollen, sein Zimmer nicht verließ und im Bett lag und am Ende mit dem Flugzeug ins Tal zurücktransportiert wurde. Erst später, so erzählte er mir, habe er von anderen Reisenden erfahren, dass seine Symptome nicht wirklich schlimm gewesen seien. Alle hätten sie gehabt. Im Nachhinein habe er begriffen, wie dumm er gewesen war. Er hatte sich sein Problem nur eigeredet.
Wir alle wissen um die Neigung der menschlichen Psyche, uns in einen Zustand innerer Aufruhr zu versetzen, indem sie in das äußere Geschehen viel zu viel hineininterpretiert. Was für eine Zeit- und Energieverschwendung! Stellen Sie sich vor, man würde Ihnen sagen: »Setz dich hin, schließ die Augen und denke an alles, bloß nicht an einen gelben Papageien.« Kaum hätten Sie die Lider geschlossen, wäre er da, der gelbe Papagei. Er würde sie gnadenlos verfolgen – ob Sie essen oder arbeiten, immerzu würden Sie an ihn denken. Er würde Ihnen sogar noch nachts im Traum erscheinen! Und es ist niemand anders als Sie selbst, der diesen Vogel zum Monster macht.
Es war nach Mitternacht, als ich zum ersten Mal nach Chennai in Südindien kam, und obwohl es Dezember war, goss es in Strömen. Ich nahm mir eine Motorrikscha, um ins Hotel zu fahren, jene Mischung aus Motorrad und Auto, die in Indien das Fahrzeug der armen Leute ist. Der Stoff, der die Kabine überspannte, hatte dem Regen wenig entgegenzusetzen. Schon nach hundert Metern war ich völlig durchnässt, und mein Rucksack sah aus wie aus dem Wasser gezogen.
Noch nie hatte ich innerhalb von so kurzer Zeit so viel Regen niedergehen sehen. Die Räder der Rikscha waren komplett unter Wasser, und ich konnte nicht sagen, ob wir durch Sumpf oder Pfütze fuhren, aber sie kämpfte sich tapfer voran. Der Regen prasselte mit solcher Wucht herab, dass ich mich des Gefühls nicht erwehren konnte, er hätte es gezielt auf uns abgesehen. Es war kaum jemand auf der Straße, aber wenn wir an jemandem vorbeikamen, konnte ich nicht sagen, ob es Mensch war oder Kuh. Der alte Fahrer schien meine Angst zu spüren, denn wie ich mich mit beiden Händen an die Streben klammerte, versicherte er mir: »Nothing special!«
Nichts Besonderes. Mach dir keine Sorgen. (In Südindien sind solche Wolkenbrüche selbst im Dezember keine Seltenheit, denn die Regenzeit dauert dort sehr lange.) Durch die Worte des Rikschafahrers verschob sich mein Blickwinkel, und der Gedankenschlacht in meinem Kopf ging augenblicklich die Luft aus. Auf einmal dachte ich: »Ich bin doch auf Reisen! Wo, wenn nicht hier, in einem subtropischen Land, soll ich einen solchen Regenguss erleben?« Im Hotel angekommen, breitete ich meine nasse Kleidung und alle Habseligkeiten aus meinem Rucksack im Zimmer aus. Dann legte ich mich ins Bett. Als ich am nächsten Morgen aufwachte und das Fenster öffnete, schaute ich in einen wolkenlosen Himmel, und unten auf der Straße holperte ein mit frischen Bananen voll beladener Karren vorbei.
Befreien wir uns von unseren zwanghaften Gedanken, öffnen sich Geist und Herz. Wir neigen dazu, vorübergehenden Problemen zu viel Macht zu geben, und während wir gegen sie ankämpfen, finden wir keine ruhige Minute, um das Schöne im Leben zu genießen. Unter dem Zwang unserer Gedanken lassen wir uns von einem einzelnen Ereignis völlig in Beschlag nehmen. Wenn wir es zulassen, wachsen die Themen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben, zu wahren Monstern heran – zu Monstern, die uns noch weiter von den eigentlich wichtigen Dingen entfernen. Das Herz öffnen, annehmen – das ist der Schlüssel zu einem spirituellen Leben.
Neulich traf ich mich mit einem indischen Freund, der nach Korea gekommen war. Wir tranken Tee, und er erzählte mir von seinem Onkel Patak, den ich auch kenne. Der Mann hatte einen akuten Blutsturz erlitten und brauchte dringend eine Bluttransfusion. Da er eine seltene Blutgruppe hat, war es schwierig, den passenden Spender zu finden, doch zum Glück gelang es noch rechtzeitig. Die Transfusion verlief reibungslos, Patak wurde gesund, und er konnte ganz normal weiterleben.
Einen Monat später allerdings trat ein neues Problem auf. Patak war orthodoxer Hindu, und plötzlich bekam er Bedenken. »Wer war der Blutspender? Stammt er aus einer oberen Kaste wie ich oder aus einer niederen? Was, wenn es ein Unberührbarer ist? Wenn er Muslim ist? Oder vielleicht sogar Verbrecher?«
Patak grübelte so sehr über das fremde Blut, das nun in seinen Adern floss, dass sein Puls zu rasen begann und es ihm ständig den kalten Schweiß aus den Poren trieb. Dass der Arzt ihm versichert hatte, es gäbe keinerlei Komplikationen wegen des gespendeten Bluts, vergaß er völlig. Irgendwann war er mit den Nerven derart am Ende, dass er sich in psychotherapeutische Behandlung begeben musste. Doch nichts half ihm. Er war fest davon überzeugt, dass seine Anfälle von Herzrasen, seine innere Unruhe und Müdigkeit auf die DNA und das Hämoglobin des unbekannten Blutspenders zurückzuführen seien. Wütend rief er bei allen möglichen Behörden an und forderte den Erlass eines Gesetzes, das es den Angehörigen niederer Kasten verbietet, Blut an Angehörige höherer Kasten zu spenden.
Es war nicht damit zu rechnen, dass Patak je wieder ein normales Leben führen könnte. Die Erleichterung, eine lebensbedrohliche Krankheit überstanden zu haben, war längst vergessen. Der Mann wirkte mit aller Kraft darauf hin, seine Situation zu verschlimmern. Die Welt reagierte darauf, indem sie ihm weitere Probleme auflud. Und so kam es, dass er, der Meister im Problem-Erschaffen, die Chance vergeudete, etwas aus dem neuen Leben zu machen, das ihm geschenkt worden war.
Da fällt mir die folgende Fabel ein.
»Weißt du, wie schwer eine Schneeflocke ist«, fragte eine Tannenmeise eine Wildtaube.
»Sie wiegt fast gar nichts«, antwortete diese.
»Dann erzähle ich dir eine unglaubliche Geschichte«, sagte die Tannenmeise. »Ich saß auf einem der unteren Zweige einer Tanne, als es zu schneien anfing – nicht sehr viel, und es ging auch kein Wind. Es schneite leise wie im Traum. Ich hatte nichts anderes zu tun, und so begann ich, die Schneeflocken zu zählen, die auf meinen Zweig fielen. Genau 3.741.952 Schneeflocken hatte ich gezählt, als die nächste vom Himmel schwebte, die ja deiner Meinung nach so gut wie gar nichts wiegt. Aber als sie landete, brach der Zweig.«
Wie viele Schneeflocken häufen sich gerade in meinem Geist an? Es gibt nichts, was uns leichter zu Fall bringen könnte als unsere eigenen Gedanken. Kaum hat der Kopf eine Lösung gefunden, schafft er sich tausend neue Probleme. In diesem Sinne verfügen wir alle über die Fantasie von Geschichtenerzählern. Hören wir auf, in Gedanken Krieg gegen uns selbst zu führen, tut sich plötzlich eine völlig neue Welt vor uns auf.
Bei einer Frau wurde Krebs im Endstadium diagnostiziert. Sie reagierte schockiert und verfiel in Depressionen. Als ihr spiritueller Lehrer sie besuchte, bat sie ihn um Rat.
»Häng die Sache nicht so hoch auf«, sagte der.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: