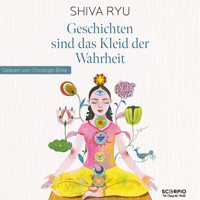Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Scorpio Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Als ich noch jung war, stellte ich Fragen über das Leben. Fragen über Wahrheit und Erleuchtung, über Glück und Sinn des Lebens und darüber, wer ich bin. Heute verstehe ich, dass uns das Leben erst nach und nach die Antworten mitteilt. Ein Prozess, der Jahre dauert. Damals wusste ich das noch nicht. Ich wusste nicht, dass nur Erfahrung die Rätsel des Lebens lösen kann. Ich bereiste viele Länder und las Bücher, auf der Suche nach Lehrmeistern, doch es war das Leben selbst, das mich erleuchtete. Wir denken, wir machen eine Reise, dabei macht die Reise uns, indem sie uns formt. Die Geschichten, die ich in diesem Buch gesammelt habe, sind Antworten, die das Leben auf meine Fragen bereithielt. Mögen sie den Lesern Trost und Kraft in unsicheren Zeiten spenden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Shiva Ryu
Ein fliegender Vogel blickt nie zurück
Die Freiheit nach dem Loslassen
Die koreanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel (The Bird Does Not Look Back While Flying) bei The Forest Book Publishing Co. durch Vermittlung von BC Acency, Seoul.All rights reserved.
Der Druck dieses Buches wurde durch die finanzielle Unterstützung des Literature Translation Institute of Korea ermöglicht.
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
1. eBook-Ausgabe 2021
1. Auflage 2021
Deutsche Erstausgabe
© der deutschsprachigen Ausgabe 2021 Scorpio Verlag
in Europa Verlage GmbH, München
© 2017 Shiva Ryu
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche,
auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München,
unter Verwendung eines Motivs von Hosaka
Illustrationen im Innenteil: © Elicia Edijanto
Lektorat: Ulla Rahn-Huber
Layout und Satz: Danai Afrati
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95803-348-1
Alle Rechte vorbehalten.
www.scorpio-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Inhalt
Ich stelle die Fragen, das Leben antwortet
Querencia
Eine Fliege in der Tasse
Warum schreien Menschen, wenn sie wütend sind?
Ein letztes Lächeln
Jim Corbetts Geschichte
Wer bin ich?
Der Weg des Herzens
Die blaue Blume
Der optimale Zeitpunkt ist jetzt
Über das Staunen
Vom Wert der namenlosen Begegnung
Wer liebt, geht nicht achtlos vorüber
Wir sind nie allein unterwegs
Der lange Weg zu dir
Auf Visionssuche
Was wäre, wenn wir nicht lachen könnten?
Mein ganz persönliches Lied
Was ist Schönheit?
Ein Ort offenbart nicht gleich sein wahres Gesicht
Wann hast du das letzte Mal getanzt?
Die Einbildung ist eine Geschichtenerzählerin
Letztlich sind wir alle gleich
Ich schau dir ins Gesicht
Der verwundete Heiler
Von der verletzenden Kraft der zweiten Pfeile
Mutter Wal
Übertragungsfehler
Vor dem Tod
Häuptling Tu-nicht-gut
Siehst du die Sterne?
Verletzen und verletzt werden
Mönch und Skorpion
Kleine Geste mit großer Wirkung
Der Schmerz vergeht, das Schöne bleibt
Therapiekreis
Was hat mich heute zum Staunen gebracht?
Und an welchem Blatt malen Sie?
Ein fliegender Vogel blickt nie zurück
Was denkst du gerade?
Die köstlichste Mahlzeit
Mumyeong, der Namenlose
Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen
Der Oktopus spricht
Hühner zählen
Im Dunkeln lernen die Augen zu sehen
Der gesprungene Diamant
Von Kritikern, Kühen und Schweinen
Unerwartete Geschenke
Mehr als eine statistische Größe
Der Mann, der den Himalaya malt
Ithaka
Quellen
Wir haben einen inneren Antrieb, der uns zur Regeneration und Neubelebung anhält und uns Kräfte mobilisieren lässt, die uns in unserem Wesen von innen heraus verändern. Instinktiv suchen wir nach einem Platz, an dem wir uns erholen können. Wir lassen uns vom Leben nicht niederdrücken, sondern sind bereit, uns selbst zu heilen und ganz zu werden.
Ich stelle die Fragen, das Leben antwortet
In jungen Jahren stellte ich viele Fragen. Ich fragte nach der Wahrheit und der Erleuchtung, nach dem Glück und dem Sinn des Lebens und danach, wer ich bin. Heute verstehe ich, dass uns das Leben die Antworten erst nach und nach gibt. Es ist ein Prozess, der Jahre dauert. Damals wusste ich das nicht. Ich hatte noch nicht begriffen, dass sich die Rätsel des Lebens nur mit Erfahrung entschlüsseln lassen. Ich bereiste zahlreiche Länder und las viele Bücher, stets auf der Suche nach Lehrern und Meistern, doch es war das Leben selbst, das mir Erkenntnis brachte. Wir denken, wir machen eine Reise, dabei »macht« die Reise uns, indem sie uns formt.
Kein Dichter ist wie der andere, und kein Schriftsteller kann einen anderen ersetzen. Jedes neue Gedicht hat zuvor nicht existiert, jedes neue Buch hat es so noch nicht gegeben. Ganz gleich, ob man Texte verfasst oder nur liest: Zu leben bedeutet, seine eigene Geschichte zu schreiben. Nicht die Erwartungen oder Vorgaben anderer zu erfüllen, sondern eigene Antworten zu finden. Wovon möchten Sie erzählen, wenn man Sie eines Tages nach Ihrem Leben fragt? Können Sie Ja dazu sagen, selbst wenn Sie einen unerträglichen Verlust erlitten haben und durch ein schmerzvolles Fegefeuer gegangen sind? Können Sie Ihrem Leben immer wieder Briefe schreiben, auch wenn es Sie ignoriert?
Die Geschichten, die ich in diesem Buch gesammelt habe, enthalten Antworten, die mir das Leben gegeben hat. Der indische Dichter Ghalib schrieb einmal: »Ich gehe ganz in meinen Gedichten auf.« Aber kein Text ist in der Lage, unserem Selbst ganz und gar gerecht zu werden. Zudem hoffe ich doch, mehr zu sein als die Summe des von mir Geschriebenen. Auch wenn Ihnen in diesen unsicheren Zeiten das, was ich mitzuteilen habe, womöglich weder Trost noch Kraft schenken kann, würde ich mich gern mit Ihnen über das Leben unterhalten.
Shiva Ryu
Querencia
Auf der Suche nach Selbstheilung
Im Verlauf eines Stierkampfes wählt der Stier sich in der Arena einen von unsichtbaren Grenzen abgezirkelten Bereich, in dem er sich sicher und stark fühlt. Ist er vom Zweikampf mit dem Matador erschöpft, zieht er sich dorthin zurück, um zu Atem zu kommen und Kraft zu schöpfen, bevor er erneut attackiert. Er empfindet dort keine Angst. Auf Spanisch nennt man diesen Bereich Querencia – ein Zufluchtsort, eine Oase der Ruhe.
Auch außerhalb der Arena steht die Querencia für einen Ort der Heilung, an dem man sich sicher fühlt vor den Gefahren der Welt. Man sucht ihn auf, um sich zu regenerieren, wenn man todmüde und erschöpft ist, und man kommt sich selbst dort näher als irgendwo sonst. Die Querencia, das ist eine versteckte Lichtung, auf der Gämsen und Steinböcke sorglos grasen, eine unzugängliche Stelle, an der Adler nisten, die Unterseite eines Blattes, an die sich Insekten vor dem Regen flüchten, oder ein unterirdischer Gang, der einem Maulwurf Deckung bietet – eine kleine Nische der Sicherheit und des Friedens, in die kein anderer einzudringen vermag.
Auf die Meditation übertragen ist die Querencia der heilige Ort in unserem Inneren. Meditieren wir, begeben wir uns auf die Suche nach ihm.
Ich lebte eine Zeit lang in einer Wohngemeinschaft, und wir hatten jeden Tag Besuch, zehn Leute oder mehr. Die, die aus der Provinz angereist kamen, blieben oft tagelang. Das Haus quoll über von Menschen, und jeder brachte, von wo immer er herkam, sein eigenes kleines Päckchen mit. Glücklicherweise gab es einen kleinen Raum im hinteren Teil des Hauses, zu dem Außenstehende keinen Zutritt hatten. Dieses Zimmer wurde für mich zu einem wichtigen Rückzugsort. Er gehörte mir allein – meine Querencia. Nur ein oder zwei Stunden dort zu sitzen, gab mir die Energie, nachher wieder den vielen Leuten zu begegnen, und ohne diese Oase der Stille hätte mich das ganze Getriebe sicher um den Verstand gebracht und körperlich aufgerieben.
Viele der spirituellen Meister und Meditationslehrer, die ich im Laufe der Zeit kennengelernt habe, empfangen zwar täglich viele Menschen, die von ihnen lernen möchten. Von Zeit zu Zeit aber ziehen sie sich von alldem zurück, um neue Energie zu schöpfen, was sie zu besseren Lehrern macht. Täten sie es nicht, würde ihr innerer Quell versiegen.
Ich bin im Leben in manch schwierige Situation geraten. Hätte ich nicht gelernt, mir durch kontrolliertes, gleichmäßiges Atmen über solche Momente hinwegzuhelfen, hätten meine negativen Gefühle mich manchmal bestimmt übermannt oder zu extremen Reaktionen getrieben. In kritischen Phasen fand ich meine Querencia durch Reisen. Kaum war ich am Ziel angekommen, spürte ich, wie die ganze Last der Probleme von mir abfiel. Ich war auf einmal wieder ganz ich selbst und fand in mein seelisches Gleichgewicht zurück. Nach einer Weile konnte ich dann frisch motiviert nach Hause zurückkehren.
Tiere begreifen instinktiv, was Querencia bedeutet. Schlangen und Frösche etwa erkennen anhand ihrer Körpertemperatur, wann es Zeit für den Winterschlaf ist, und wenn der Moment des Aufbruchs gekommen ist, wissen Monarchfalter und Kraniche nicht nur, wohin sie fliegen müssen, sondern auch, wo sie sich unterwegs ausruhen können. Sie folgen dem genetisch programmierten Ruf, ihr eigenes Überleben zu sichern. Ohne diese Pausen würde sich ihr Lebensquell erschöpfen. Wir Menschen wissen auch, wann wir unsere Arbeit unterbrechen und innehalten sollten. Unser Körper sagt es uns, wenn wir hinhören. Und in solchen Momenten brauchen wir eine Querencia, einen Ort, an dem wir uns ausruhen und wieder Kraft schöpfen können, um uns anschließend erneut dem Leben zu stellen.
Querencia, das ist nicht nur ein Ort. Nehmen wir an, wir wären mit voller Konzentration mit der Aufgabe beschäftigt, das passende Holz für einen Schreibtisch oder ein Bücherregal auszuwählen. In solchen Momenten treten die Sorgen des Alltags in den Hintergrund, und wir tanken neue Energie. Querencia, das ist eine Zeit der Selbstläuterung; ein Raum, den wir lieben; die Zeit, in der wir tun, wofür unser Herz schlägt; eine Begegnung mit einem geliebten Menschen. All das spielt in unserem Leben die Rolle einer Querencia. Die Zeit, in der wir uns vom Alltagslärm zurückziehen und bei uns selbst Einkehr halten, in der wir beten und meditieren; die Abende, an denen wir nach einem langen Arbeitstag entspannende Musik hören oder den Geräuschen der Insekten lauschen; die Momente, in denen wir uns von allem anderen zurückziehen und in unserem Inneren eine eigene Welt und unseren eigenen Zufluchtsort entdecken – all das ist Querencia. Ohne dieses Innehalten und Atemschöpfen versiegen unsere Energien, und wir werden psychisch krank.
Wo genau in der Arena sich die Querencia befindet, steht nicht von Anfang an fest. Während des Kampfs erspürt der Stier nach und nach, wo für ihn die sicherste Stelle ist, um zu verschnaufen. Um den Kampf zu gewinnen, muss der Matador diesen Bereich erahnen und seinen Gegner daran hindern, ihn aufzusuchen. »Ein Stier ist in seiner Querencia so unbeschreiblich stark, dass es unmöglich ist, ihn zu besiegen«, schrieb Hemingway, der sich Hunderte von Stierkämpfen angesehen hat, um das Geschehen in der Tiefe zu verstehen.
Das Leben ist oft herausfordernd und beängstigend. Immer wieder geraten wir in Situationen, die sich unserer Kontrolle entziehen, und wir fühlen uns bedrängt und hilflos wie ein in die Ecke getriebener Stier. Wenn das passiert, gilt es, uns in unser inneres Reich zurückzuziehen, bewusst zu atmen, unseren Geist still werden zu lassen und in unsere Kraft zurückzufinden. Durch bewusstes Atmen kommen wir aus dem emotionalen Chaos heraus und finden zurück in die Ruhe.
Im Himalaya auf Trekkingtour gehen, eine Zeit lang im Hochgebirge mit einem Nomadenstamm oder in einem entlegenen Dorf bei einer Bauernfamilie leben, mich in einem kleinen Boot auf dem Ganges treiben lassen und gedankenverloren in den blauen Himmel schauen, mit einem Bettelmönch mit vier abgebrochenen Schneidezähnen eine Wette eingehen, ob er von einem Apfel abbeißen kann, und dabei kindisch herumalbern … ohne solche Auszeiten für die Seele hätte ich um meine Gesundheit bangen müssen. Jemand sagte mir einmal, das Leben sei wie ein Notenblatt ohne Pausenzeichen. Wir sind der Dirigent unseres Lebens, und es obliegt jedem Einzelnen von uns, dort Pausen zu setzen, wo wir sie brauchen.
Querencia ist auch der Ort, an dem wir uns am ehrlichsten begegnen. Wenn wir immer und jederzeit wirklich wir selbst sein können; wenn es uns gelingt, mit dem Kämpfen aufzuhören und inneren Frieden zu finden, kann Querencia überall sein. Genau so hat Gott diese Welt ursprünglich geschaffen – als einen Ort, an dem das Ich noch unbeschadet ist, als einen Quell der Spiritualität und Vitalität, wo wir im Einklang mit der Erde und der Natur leben, wie es den Traditionen indigener Völker entspricht. Wir selbst sind es, die diese Welt zur Kampfarena machen.
Dieses Buch zu schreiben, erlebe ich als eine wertvolle Zeit von Querencia. Dem Trappisten und Ordenspriester Thomas Merton zufolge verfügen wir über einen inneren Antrieb zur Regeneration und Neubelebung. Wir können Kräfte mobilisieren, die uns in unserem Wesen von innen heraus verändern. Instinktiv suchen wir nach einem Platz, an dem wir uns erholen können. Wir lassen uns vom Leben nicht niederdrücken, sondern sind bereit, uns selbst zu heilen und ganz zu werden.
Wie definieren Sie Ihre Querencia? Am Sonntag wandern gehen, am Strand sitzen und zuschauen, wie die Sonne untergeht, Ausflüge zu unbekannten Orten unternehmen, neue Gegenden und Menschen kennenlernen? Vielleicht sind es für Sie die Mußestunden, in denen Sie Musik hören, sich Bilder anschauen oder ein Buch lesen; die Zeit, in denen Sie tun, was Ihnen Spaß macht, Sie sich der Freude des Lebens hingeben und träumen … All das kann Querencia sein. Selbst banale Dinge wie das Abschreiben von Gedichten und Texten mit Füller und Tinte oder das Vorlesen gehören dazu.
Wenn es mir nicht möglich ist, für längere Zeit zu verreisen, gönne ich mir ein paar Tage, um zur Insel Cheju überzusetzen und dort eine Bergtour zu unternehmen oder im Saryeoni-Wald wandern zu gehen. Jedes Mal, wenn ich dort bin, werde ich eins mit der Erde, dem Sonnenlicht und dem Wind. Es ist wie Kraftschöpfen an einer heiligen Quelle. Meine Füße werden zu Flügeln. Es gibt nichts Heilsameres als die Zeit, in der wir uns in der Erde verwurzeln und mit der Natur verschmelzen. In solchen Momenten begreifen wir die Worte aus der altindischen Heiligen Schrift Ashtavakra Gita:
»Lass die Wellen des Lebens steigen und sinken. Du hast nichts zu verlieren oder zu gewinnen. Denn du selbst bist das Meer.«
Wenn wir etwas Kostbares im Leben verlieren, wenn uns der Alltag langweilt und uns die Welt ringsum eintönig und farblos erscheint, wenn geliebte Menschen uns das Herz brechen oder wir geistig erschöpft sind und vergessen haben, wer wir eigentlich sind, ist es Zeit, unsere Querencia aufzusuchen und uns die Zeit zu nehmen, die unsere Seele zur Genesung braucht; Zeit zum Alleinsein, ungestört von der Welt. So kommen wir in unsere Kraft zurück.
Wie können Sie Ihre Querencia finden? Wo ist der Ort, an dem Sie sich am stärksten fühlen und Sie ganz Sie selbst sein können? Bevor Sie in die Ferne ziehen, kehren Sie erst zu sich selbst zurück! Eine eigene, ganz persönliche Querencia zu haben – das heißt, über eine sichere Oase zu verfügen, die Ihnen den Raum gibt, das Leben zu lieben.
Eine Fliege in der Tasse
Wenn die Welt leidet, leide ich mit
Eines der Dinge, die mir zu schaffen machten, als ich zum ersten Mal nach Indien und Nepal kam, war, dass ich meinen Lebensraum mit allerlei Getier zu teilen hatte. Es waren nicht nur Rucksackreisende wie ich, die scharenweise in diese Länder reisten, um Erleuchtung zu erlangen. Wohin ich auch ging, überall waren Fliegen, Flöhe, Wanzen, Tausendfüßler und Eidechsen. Nur wenig Kleingetier ist dort so menschenfreundlich wie bei uns. Immer wieder stellte ich staunend fest, wie viele Mücken es in einem Meditationszentrum geben kann. Ihr ganz besonderer Lieblingsplatz war meine Stirn, wo sie sich in Scharen niederließen, um intensiv mit zu meditieren. Während ich mich an den roten Pusteln über meinen Brauen kratzte, scherzte ich, dass die Tierchen bestimmt noch vor mir ins Nirwana kämen, da sie keine Angst vor dem Sterben hätten. Die Plagegeister zögerten auch nicht, tagein, tagaus meinen Schlafsack, meinen Tee, ja sogar meinen gebratenen Reis für sich zu beanspruchen.
Die Umweltaktivistin und Tiefenökologin Joanna Macy verbrachte einige Zeit in Nordindien am Fuße des Himalayas, wo sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin beim United States Peace Corps in der tibetischen Flüchtlingsgemeinde im Einsatz war. Sie gründete dort unter anderem eine Kooperative, um die Leute dabei zu unterstützen, mit der Herstellung und dem Verkauf von traditionellen tibetischen Schmuckgegenständen etwas Geld zu verdienen. Eines Nachmittags landete während einer Besprechung mit tibetischen Mönchen eine Fliege in ihrer Tasse.
Natürlich war das nichts, worum sie groß Aufhebens gemacht hätte. Sie lebte damals bereits seit über einem Jahr in Indien und war insgeheim stolz, sich von Würmern und Insekten nicht sonderlich beeindrucken zu lassen – Ameisen in der Zuckerdose, Spinnen in den Schränken und sogar Baby-Skorpione morgens in ihren Schuhen, wen störte das schon. Als sie aber die Fliege in ihrer Tasse sah, zog sie leicht angewidert die Stirn kraus.
Der Mönch Choigyal Rinpoche bemerkte es und fragte sie, ob es ein Problem gäbe. Joanna lächelte, um von vornherein deutlich zu machen, dass sie das Ganze nicht hoch aufzuhängen gedachte. »Da ist bloß eine Fliege in meiner Tasse«, erklärte sie. Auf keinen Fall wollte sie den Eindruck erwecken, dass sie sich von einem kleinen Insekt aus der Fassung bringen ließ.
Besorgt murmelte Choigyal Rinpoche: »Oh, eine Fliege ist in die Tasse gefallen.«
Joanna lächelte erneut, um den Rinpoche zu beruhigen. Es mache ihr wirklich nichts aus, betonte sie. Immerhin sei sie viel in der Welt herumgekommen, habe Erfahrung mit dem Leben in Entwicklungsländern und sei nicht von modernen Hygienekonzepten besessen. Mit einer großzügigen Geste wischte sie den Zwischenfall vom Tisch. Alles kein Problem! »Ich hole sie einfach heraus und trinke weiter meinen Tee.«
Daraufhin erhob sich Choigyal Rinpoche, beugte sich zu ihr herab, tauchte seinen Finger in ihre Tasse, fischte sehr vorsichtig die Fliege heraus und ging aus dem Raum. Die Anwesenden nahmen den Gesprächsfaden wieder auf, und Joanna fuhr fort in ihrem Bemühen, einen hochrangigen Mönch von dem Geschäftsmodell zu überzeugen, aus im Hochland hergestellter Wolle Teppiche zu weben und zu verkaufen.
Kurz darauf kehrte Choigyal Rinpoche ins Besprechungszimmer zurück. Über beide Ohren strahlend flüsterte er ihr zu: »Der Fliege dürfte es jetzt wieder gut gehen!« Er habe sie vor der Tür auf ein Blatt gesetzt und abgewartet, bis sie anfing, die Flügel zu bewegen. Sie sei unversehrt und würde schon bald wegfliegen können. Joanna brauche sich also keine Sorgen um sie zu machen.
Joanna Macy veröffentlichte diese Anekdote in ihrem Buch Geliebte Erde, gereiftes Selbst und gesteht, dass sie die Frage, ob es ein Problem gäbe, einzig aus ihrer eigenen Perspektive betrachtet habe. Choigyal Rinpoche hingegen habe den Blickwinkel der Fliege eingenommen. Ein Blick in sein strahlendes Gesicht genügte, um ihr klarzumachen, was sie übersehen hatte. Für sie selbst war es kein Problem, dass die Fliege in der Tasse gelandet war, für das Tier hingegen schon.
Mit einem Mal war die Nachricht, dass der Fliege nichts passiert sei, wichtiger für sie, als ihre Geschäftsidee durchzusetzen, und es wurde ihr warm ums Herz. Sie stand damit noch längst nicht auf einer spirituellen Ebene mit dem Mönch, aber der Perspektivenwechsel bereitete ihr unbeschreibliche Freude.
Als könnten wir über die Schwierigkeiten des Lebens einfach so hinweggehen, behaupten wir gern, dass etwas kein Problem sei. Würden wir aber den Fokus weg von uns selbst auf andere richten, sähe die Sache oft anders aus. Eine Perspektive, die ausschließlich egozentrisch bleibt, ist letztlich immer ein Problem.
Es zeugt von einem hohen Maß an Erleuchtung, nicht sich selbst in den Mittelpunkt des eigenen Denkens zu stellen, sondern eine größere Gemeinschaft, die alle Lebewesen mit einschließt, also die ganze Welt und nicht die eigene Person in den Vordergrund zu rücken. Solange wir uns selbst für das Maß aller Dinge halten, werden wir in der egozentrischen Rolle eines Menschen verharren, der sich nur um das eigene Überleben und seine eigenen Interessen kümmert. Jedes Problem, dem wir heutzutage in unserer Welt begegnen, beruht auf dieser ich-fixierten Haltung.
Wenn es uns gelingt, die Welt mit den Augen von Choigyal Rinpoche zu sehen, belassen wir es nicht bei der Feststellung: »Mir geht es gut.« Wir fragen: »Geht es den anderen auch gut?«, »Ist das Leben auch für sie in Ordnung?«, »Sind auch sie glücklich?« Joanna Macy etwa schlägt als Übung vor, uns mittels Empathie-Meditation in einen Schwertwal hineinzuversetzen, um zu begreifen, wie sich ein vom Aussterben bedrohtes Lebewesen fühlt. Sie verspricht einen massiven Bewusstseinssprung.
Der Buddha sagte, es gebe keine bessere Eigenschaft, als den Schmerz anderer mitfühlen zu können. Spiritualität, das ist für mich die Erkenntnis, mit allen Lebewesen verbunden zu sein und andere genauso wertzuschätzen wie mich selbst; die Einsicht, dass Probleme anderer auch meine eigenen sein könnten. Wenn die Welt leidet, leide ich zwangsläufig mit. Lehren wie diesen verdankt Joanna Macy ihr weltweites Ansehen als spirituelle, ganzheitliche Umwelt- und Naturphilosophin.
Warum schreien Menschen, wenn sie wütend sind?
Der Abstand zwischen zwei Herzen
Ein buddhistischer Meister ging mit seinen Schülern zum Fluss, um ein Bad zu nehmen. Als sie am Ufer entlanggingen, begegneten sie einem Mann und einer Frau, die plötzlich anfingen, sich wütend anzuschreien. Die Frau hatte beim Baden ihre Kette verloren, und als der Mann ihr deshalb Vorwürfe machte, fing sie lauthals zu schimpfen an.
Der Lehrer blieb stehen und fragte seine Schüler: »Warum schreien Menschen, wenn sie wütend sind?«
Nach kurzem Nachdenken antwortete einer: »Schreit man nicht, weil man die Fassung verliert?«
Ein anderer vermutete: »Liegt es nicht daran, dass die Wut die Vernunft lähmt?«
Da fragte der Lehrer erneut: »Aber warum werden sie so laut, wo doch der andere direkt vor ihnen steht? Die Stimme zu erheben sorgt doch nicht dafür, dass man besser verstanden wird. Kann man nicht genauso gut leise sprechen, um zu vermitteln, was man sagen möchte?« Und noch einmal stellte er die Frage: »Warum also schreien Menschen, wenn sie wütend sind?«
Jeder der Schüler schlug irgendwelche Gründe vor, aber keine der Antworten schien den Kern der Frage zu treffen.
Schließlich erklärte der Meister: »Menschen haben das Gefühl, vom Herzen des anderen unendlich weit entfernt zu sein, wenn sie wütend sind. Sie schreien, um diese Distanz zu überbrücken. Sie glauben, dass sie ihr Gegenüber in der Ferne nur erreichen können, wenn sie ihre Stimme erheben. Je aufgebrachter sie sind, desto lauter schreien sie. Je mehr der eine schreit, desto wütender wird der andere, und desto größer wird die Distanz zwischen beiden. Und so werden ihre Stimmen immer lauter.«
Der Meister deutete auf das zunehmend in Rage geratende Paar:
»Wenn sie so weitermachen, entfernen sich ihre Herzen so weit voneinander, bis sie am Ende füreinander gestorben sind. Dann können sie noch so sehr brüllen, sie werden das tote Herz niemals erreichen. Und sie werden noch lauter schreien.«
»Was passiert, wenn sich zwei Menschen verlieben?«, fragte der Meister als Nächstes und fuhr fort: »Wer sich liebt, spricht leise und mit sanfter Stimme. Das liegt daran, dass Liebende ihren Abstand zueinander als überaus gering empfinden. Es besteht also kein Grund, sich gegenseitig anzubrüllen. Je inniger die Liebe, desto mehr schwindet die Distanz zwischen den Herzen, bis an den Punkt, an dem es keiner Worte mehr bedarf und die beiden Seelen miteinander verschmelzen. In diesem Zustand reicht es, einander anzusehen. Die beiden verstehen sich ohne Worte. So ist das mit der Wut und der Liebe.«
An seine Schüler gewandt, schloss der Meister mit dem folgenden Rat: »Lasst bei Meinungsverschiedenheiten nicht zu, dass sich das Herz des anderen entfernt. Stoßt ihn nicht weg, indem ihr eure Stimme erhebt, und wenn ihr noch so wütend seid. Es gibt dabei nämlich eine bestimmte Grenze, und wenn ihr die überschreitet, wird sich die Nähe nicht wiederherstellen lassen, und kein Weg führt mehr zur Versöhnung zurück.«
Die Allegorie, die uns der spirituelle Meister Meher Baba erzählt, führt uns vor Augen, was geschieht, wenn wir wütend aufeinander sind und uns anschreien, insbesondere wenn wir es in einer Liebesbeziehung, in der Familie oder Partnerschaft tun. Im Zorn verschließen wir unser Herz, sodass sich der andere abgelehnt fühlt. Das ist die Wirkung von Wut. Die Liebe dagegen öffnet die Tür zum Herzen und erzeugt ein Gefühl von Nähe zu einem Menschen, den wir bis dahin als fern erlebt haben. Das ist die Wirkung von Liebe.
Psychologen haben herausgefunden, dass nur 10 Prozent aller Konflikte auf tatsächliche Meinungsverschiedenheiten zurückzuführen sind. Die restlichen 90 Prozent resultieren aus einem unangemessenen Ton und Missklängen in der Stimme. Das Stimmvolumen ist kein Maß für das Rechthaben. In Beziehungen, in denen viel geschrien wird, sind die Herzen weit voneinander entfernt. In dem Versuch, sich dennoch Gehör zu verschaffen, wird die Lautstärke nach oben geregelt, was die Distanz noch einmal vergrößert. Das Schweigen nach dem Streit ist ein Zeichen dafür, dass auch die Herzen schweigen.
Oft sind es uns nahestehende Menschen, die wir anschreien. Nur selten lassen wir uns bei Fremden zu solchen Ausbrüchen hinreißen. Statt denen, die uns eng verbunden sind, unsere Liebe deutlicher zu zeigen, tun wir ihnen weh. Wenn Sie das nächste Mal in Zorn geraten, dann denken Sie an diese Geschichte. Daran, dass sich das Stimmvolumen proportional zum Abstand der Herzen verhält und wir mit unseren erhobenen Stimmen die Beziehung auseinandertreiben.
Es ist keineswegs so, dass der Angeschriene am meisten leidet; es ist derjenige, der schreit. Wer mit heißer Kohle wirft, verbrennt sich selbst zuerst. Wenn ich wütend auf andere bin, merke ich, wie mich meine Gefühle von der Umwelt isolieren. Schreien wir vielleicht deshalb, weil wir eine Beziehung als unendlich distanziert erleben, wir in ihr einsam sind und uns darin gefangen fühlen?
Es heißt, auf einer Insel im Südpazifik gäbe es ein Volk, das sich, wenn ein Baum im Wege steht, rings um ihn versammelt und ihn anzuschreien beginnt: »Was für ein nutzloser Baum du bist! Du hast keinen Wert!« Statt zu Axt oder Säge zu greifen, rufen alle: »Fall um! Fall um!« Und schon bald, so wird berichtet, würde der Baum verdorren und sterben. Wutgeschrei treibt nicht nur Menschen auseinander, es kann auch Seelen zerstören.
Wenn ein anderer uns anschreit, bedeutet das eigentlich, dass er uns braucht und die Entfernung zu uns verringern möchte. Um eine freundschaftliche Beziehung zu beschreiben, sagen wir auf Koreanisch: »Chob-chob-nam-nam«, und wir stellen uns dabei vor, wie man sich in heiterer Stimmung mit leiser Stimme unterhält, oder auch, wie zwei Liebende die Köpfe zusammenstecken und sich Koseworte zuflüstern. Das Rezept, um ein Auseinanderdriften Ihrer Beziehung zu verhindern, lautet also, mit leiser Stimme zu sprechen.
Ein letztes Lächeln
Balsam für ein verwundetes Herz
Vor einigen Tagen trank ich Tee mit der Schauspielerin Kim Hye-Ja, der Hauptdarstellerin des Films Mother (2009). Sie erzählte mir von ihren Erlebnissen in Liberia, Afrika. Mit einem Freiwilligenteam von Ärzten war sie in das Land gegangen, in dem ein über ein Jahrzehnt währender Bürgerkrieg Hunderttausende Menschenleben gefordert und die Hälfte der Bevölkerung in die Flucht getrieben hatte. An einem Tag begleitete sie einen der Ärzte zu einem Krankenbesuch in eine verfallene Lehmhütte.
Die Frau, die sie dort vorfanden, rang mit dem Tode. Als der Arzt sie abtastete, quoll unter seinen Fingern überall ekelhafter Eiter aus dem Körper hervor. Kim Hye-Ja fragte sich, wie ein Mensch überhaupt in einen solchen Zustand geraten konnte, und es schien ihr wie ein Wunder, dass die Frau überhaupt noch atmete. Der Arzt und sie brachten Stunden damit zu, die Haut der Patientin mit einer antiseptischen Lösung zu reinigen und den Eiter zu entfernen. Als sie fertig waren, tat die Frau friedlich ihren letzten Atemzug. Sie war erst Mitte 30.
Es schien, als hätte sie nur darauf gewartet, dass jemand kam, um sich um sie zu kümmern. In den armseligen Lebensbedingungen, in die sie hineingeboren worden war, hatte sie nie Zuwendung erfahren und wohl wenigstens ein einziges Mal auf eine helfende Hand gehofft. Während ihr von Keimen wimmelnder Körper gereinigt wurde, wich ihr anfänglich schmerzverzerrter Gesichtsausdruck einem friedlichen Lächeln. Sie war über und über von schmerzhaften Eiterbeulen bedeckt, und doch strahlte sie. Bevor sie ihre Augen für immer schloss, sagte sie dem Arzt und Kim Hye-Ja, sie sei nun glücklich.
Zwar hatte sie in ihrem kurzen Leben große Schmerzen erdulden müssen, dank der hingebungsvollen Hilfe aber verließ sie die Welt mit leichtem Herzen. Ihr sei dabei klar geworden, schloss Kim Hye-Ja ihre Geschichte, dass die Art und Weise, wie wir uns einem anderen gegenüber verhalten, das Letzte sein könnte, was er noch erlebt. Mit welchem Gefühl er aus der Welt scheidet, hängt davon ab, was wir sagen oder tun.
Vor einiger Zeit las ich in einer Meditationszeitschrift die Geschichte eines New Yorker Taxifahrers. Er wurde mitten in der Nacht angerufen, um einen Fahrgast abzuholen. Die angegebene Adresse lag in einem heruntergekommenen Viertel. Als er dort ankam, war es stockfinster und keine Menschenseele weit und breit zu sehen. Jeder andere hätte in einer solchen Situation einfach gewendet und wäre davonfahren, aber obwohl er ein mulmiges Gefühl hatte, hupte der Taxifahrer. Dann stieg er aus und ging zu dem angegebenen Gebäude hinüber. Als er an die Tür klopfte, antwortete eine Frau mit leiser Stimme, er möge sich bitte eine Minute gedulden.
Es dauerte eine ganze Weile. Dann öffnete sich die Tür, und eine alte Dame von schätzungsweise 80 Jahren stand vor ihm. Sie hatte eine kleine Reisetasche dabei. Mit ihrem Kleid und dem Hut mit Schleier sah sie aus, als käme sie direkt aus einem alten Hollywoodfilm. Nachdem ihr der Taxifahrer in den Wagen geholfen hatte, reichte sie ihm einen Zettel mit einer Adresse und bat ihn, den Weg durch die Stadt zu nehmen. Der Fahrer erklärte ihr, er könne sie in 20 Minuten an ihr Ziel bringen, wenn er die direkte Route nähme. Durch die Stadt würde die Fahrt mehrere Stunden dauern. Es gebe keinen Grund zur Eile, erwiderte die alte Dame, es ginge ins Seniorenheim.
Zwei Stunden lang fuhren sie kreuz und quer durch die Stadt. Einmal bat die alte Dame den Fahrer, vor einem Gebäude anzuhalten, in dem sie in jungen Jahren als Aufzugführerin gearbeitet hatte, und sie schaute lange aus dem Fenster. Als Nächstes fuhren sie in ein Viertel, in dem sie sich nach ihrer Heirat ihr erstes eigenes Zuhause eingerichtet hatte. Dann ließ sie vor einem Möbelhaus halten, in dem früher ein Ballsaal gewesen war. Dort hatte sie als junge Frau getanzt. Mal bat sie ihn, vor diesem, mal vor jenem Gebäude und mal an einer Straßenkreuzung stehen zu bleiben, und sie schaute vom dunklen Fond des Wagens aus wortlos auf die Szene, die sich ihr bot.
Dann war es so weit.
Als sie an dem kleinen, schäbigen Altersheim ankamen, wurde sie schon vom Personal erwartet.
»Ich muss jetzt gehen«, sagte sie, das Portemonnaie in der Hand. »Was bin ich Ihnen schuldig?«
»Nichts.« Der Fahrer stieg aus und half ihr aus dem Wagen.
»Vielen Dank«, sagte sie, und die beiden umarmten sich. »Sie haben einem alten Menschen die letzten freudigen Momente seines Lebens geschenkt.«
Ohne noch einmal umzuschauen, ging sie auf das Gebäude zu, und er hörte, wie die Tür hinter ihr ins Schloss fiel. Es war ein Geräusch, als würde sich die Tür ihres Lebens ein für alle Mal schließen.
Was wäre gewesen, wenn die alte Dame auf einen mürrischen oder ungeduldigen Fahrer getroffen wäre? Was, wenn er sich geweigert hätte, den langen Umweg zu fahren oder sie in dem heruntergekommenen Viertel gar nicht erst an Bord genommen hätte? Was wir tun, was wir sagen, die helfende Hand, die wir jemandem reichen – es könnte das Letzte sein, was er im Leben erlebt. Und mit diesem Gefühl wird seine Seele diese Welt verlassen.
Jim Corbetts Geschichte
Von den Freuden am Wegesrand
In Südkorea aß ich vor Kurzem mit dem indischen Konsul Bed Pal Singh zu Mittag, und wir kamen auf Jim Corbett zu sprechen, den legendären Tigerjäger, der Anfang des vorigen Jahrhunderts in Indien lebte. Zu dieser Zeit war es im Dschungel von Kumaon im Norden des Landes keine Seltenheit, dass Menschen von Tigern angefallen wurden. Die 33 Tiger und Leoparden, die Jim Corbett im Laufe seiner Jagdkarriere erlegte, hatten etwa 1500 Menschen getötet.
Jim Corbett wurde als Sohn eines britischen Postmeisters geboren und war von klein auf vom Dschungel und der Vielfalt an wild lebenden Tieren in seiner Umgebung fasziniert. Bereits in jungen Jahren kannte er die meisten Vogelarten und anderen Spezies und konnte sie benennen. Sein Interesse und seine Begeisterung für die Natur ließen ihn zu einem ausgezeichneten Spurenleser und Jäger werden. Der Mythos um Corbett entstand, als es ihm gelang, ganz allein den Tiger von Champawat zu erlegen, eine Aufgabe, an der die Armee ebenso wie zahlreiche andere Jäger gescheitert waren.
Es gehörte jedoch zu Corbetts unverhandelbaren Prinzipien, nur diejenigen Tiger zur Strecke zu bringen, die erwiesenermaßen Menschen getötet hatten. Als überzeugter Umweltschützer gründete er Indiens ersten Nationalpark in Kumaron und übernahm eine führende Rolle in dem Bemühen, Wildtiere, allen voran den gefährdeten bengalischen Tiger, unter Artenschutz zu stellen. In Würdigung seiner Arbeit wurde der Nationalpark ebenso nach ihm benannt wie eine der fünf indischen Tigerarten.
Konsul Bed Pal erzählte mir die folgende beeindruckende Anekdote über ihn:
Einmal war Corbett mit einer Gruppe von Jägern im Dschungel am Fuß des Himalayas unterwegs. Es war April, und die Natur entfaltete gerade ihre ganze Pracht. Bäume, Sträucher und Kletterpflanzen blühten, bunte Schmetterlinge flatterten von Blüte zu Blüte. Die Luft war erfüllt vom Gezwitscher seltener Vögel und einem süßen, betörenden Duft. Es schien, als hätten die Frühlingsgefühle den ganzen Dschungel erfasst, denn die Zugvögel, die den Winter im Süden verbracht hatten, balzten, als gäbe es kein Morgen. Die Sonnenstrahlen, die durch das üppige Blattwerk der Bäume fielen, tauchten alles in ein geheimnisvolles Licht. Wohin man sich auch wandte, es war ein einziger Genuss für die Seele.
In diesen Anblick versunken, wanderte die Gruppe auf gewundenen Pfaden durch den Dschungel und erreichte gegen Abend das Camp. Als alles gerichtet war und die Jäger schließlich plaudernd beisammensaßen, fragte Corbett einen seiner Gefährten, ob ihm der Weg denn gefallen habe.
»Nein, absolut nicht!«, erwiderte dieser mürrisch. »Das Gelände war viel unwegsamer und alles viel anstrengender, als ich erwartet hatte.«
Der Mann hatte die ganze Zeit nur das Ziel vor Augen gehabt und war darum nicht in der Lage gewesen, die Schönheit der Natur ringsum zu genießen. Die Blütenpracht, das Zwitschern der Vögel, die Düfte – all dies war nicht an ihn herangedrungen. Der Weg durch den Dschungel war an vielen Stellen überwuchert gewesen, und sie hatten sich mit der Machete durch das Geranke kämpfen müssen. Immer wieder musste man sich Insekten vom Körper streifen und steile Anstiege bewältigen, auf deren schlammigem Untergrund es schwer war, Halt zu finden. Außerdem war da die Ungewissheit, ob man das Camp vor Sonnenuntergang würde erreichen können – und das angesichts der ständigen Angst vor all den unbekannten Gefahren, die da draußen lauerten.
Corbett indessen hatte beim Anblick der Wunder und Geheimnisse des wilden Urwalds alle Nöte und Sorgen vergessen. Einen Schritt vor den anderen setzend hatte er das Schauspiel der Natur genossen, und so war er am Lagerplatz angekommen, ohne es recht zu merken. Zwei Menschen waren denselben Weg gegangen, beladen mit Rucksäcken vom gleichen Gewicht, aber sie hatten ihn ganz anders empfunden. Was für den einen Mühsal war, empfand der andere als puren Genuss.
Auch wir übersehen gern die schönen Dinge, die uns im Streben nach Verwirklichung unserer Wünsche und Ziele unterwegs begegnen,