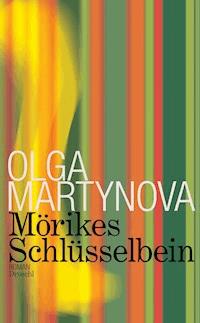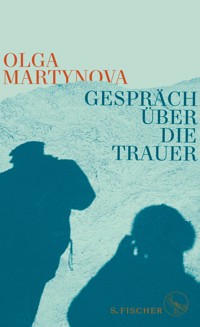
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Der Kopf eines Trauernden ist nicht viel klarer als der Kopf eines Verliebten und jedem Quatsch ausgeliefert.« Wer die Trauer nicht überwinden kann oder will, hat eine andere Option: mit ihr leben zu lernen. Olga Martynova hat nach dem Tod ihres Mannes, des russischen Dichters Oleg Jurjew, vier Jahre lang an diesem großen Essay geschrieben. Wie, will sie wissen, gehen andere Menschen mit etwas um, mit dem man eigentlich nicht umgehen kann und das zugleich so unumgänglich ist. Olga Martynova sucht nicht nach Ratschlag oder Trost, sondern gerät in ihrer Trauer in ein ebenso intimes wie reflektiertes, ein ebenso schamloses wie kluges »Gespräch« – nicht zuletzt mit berühmten Texten über Trauer und Tod von Roland Barthes bis Joan Didion, von Elias Canetti bis Emmanuel Lévinas. – Begreife mich, sagt das Unbegreifliche. Darauf zu antworten, versucht dieses erschütternde Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Olga Martynova
Gespräch über die Trauer
Über dieses Buch
Wer die Trauer nicht überwinden kann oder will, hat eine andere Option: mit ihr leben zu lernen. Olga Martynova hat nach dem Tod ihres Mannes, des russischen Dichters Oleg Jurjew, vier Jahre lang an diesem großen Essay geschrieben. Wie, will sie wissen, gehen andere Menschen mit etwas um, mit dem man eigentlich nicht umgehen kann und das zugleich so unumgänglich ist. Olga Martynova sucht nicht nach Ratschlag oder Trost, sondern gerät in ihrer Trauer in ein ebenso intimes wie reflektiertes, ein ebenso schamloses wie kluges »Gespräch« – nicht zuletzt mit berühmten Texten über Trauer und Tod von Roland Barthes bis Joan Didion, von Elias Canetti bis Emmanuel Lévinas. – Begreife mich, sagt das Unbegreifliche. Darauf zu antworten, versucht dieses erschütternde Buch.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Olga Martynova, geboren 1962 in Sibirien, aufgewachsen in Leningrad, wo sie in den 1980er-Jahren die Dichtergruppe »Kamera Chranenia« mitbegründete. 1991 zog sie zusammen mit Oleg Jurjew (1959–2018) nach Deutschland. Von 1999 an schrieb sie literarische Texte auf Russisch und Deutsch. Seit 2018 schreibt sie nur noch in deutscher Sprache. Olga Martynova ist Mitglied des PEN und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie der Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz). Sie erhielt u. a. den Ingeborg-Bachmann-Preis (2012) und den Berliner Literaturpreis (2015). Zuletzt erschienen bei S. Fischer: »Der Engelherd«, Roman (2016) und »Über die Dummheit der Stunde«, Essays (2018).
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Simone Andjelković
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491760-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
2018
3. August
11. August
12. August
13. August
14. August
15. August
16. August
17. August
18. August
19. August
20. August
22. August
25. August, Erlangen
26. August
27. August
29. August
30. August
6. September, Novi Sad
7. September, Novi Sad
10. September, Belgrad
14. September, wieder Frankfurt
15. September
16. September
20. September
21.–22. September
5. Oktober
6. Oktober
12. Oktober
19. Oktober
21. Oktober
24. Oktober
27. Oktober
28. Oktober
29. Oktober
1. November
3. November
3. November 2018–2022
5. November
6. November
10. November 2018–2022
10. November
10. November 2018–2022
12. November
16. November
25. November
26. November
27. November 2018–2022
28. November
29. November
30. November, Kiel
1. Dezember
3. Dezember
4. Dezember
11. Dezember
11. Dezember 2018–2022
12. Dezember
13. Dezember
16. Dezember
16. Dezember 2018–2022
12. Dezember
27. Dezember
30. Dezember
2019
6. Januar 2019(18)
16. Januar
18. Januar
23. Januar
24. Januar
25. Januar
27. Januar
28. Januar
28. Januar 2018–2022
29. Januar–Frühjahr 2022
29. Januar
30. Januar
30. Januar 2019–2022
31. Januar
1. Februar
8. Februar
9. Februar
10. Februar
12. Februar
13. Februar
14. Februar
16. Februar
17. Februar
18. Februar
18. Februar 2020–2022
19. Februar
24. Februar
25. Februar
28. Februar
8. März
15. März
24. März
24. März 2019–2022
26. März
30. März
5. April
6. April
7. April
8. April
8. April 2019–2022
10. April
11. April
12. April
21. April
22. April
23. April
24. April
26. April
30. April
10. Mai
14. Mai 2019–2022
16. Mai
16. Mai 2019–2022
17. Mai
17. Mai 2019–2022
18. Mai
17. Mai 2019–2022
19. Mai
17. Mai 2019–2022
21. Mai
22. Mai
6. Juni
6. Juni 2019–Frühjahr 2022
6. Juni
6. Juni 2019–2022
6. Juni
7. Juni
8. Juni
9. Juni
14. Juni
24. Juni
24. Juni 2019–2022
26. Juni
27. Juni
28. Juni
13. Juli
14. Juli
15. Juli
21. Juli
23. Juli
24. Juli
7. August. Edenkoben
8. August
9. August
16. August. Edenkoben
17. August
19. August
27. August
4. September
5. September
6. September
10. September
12. September
14. September
15. September
17. September
1. Oktober
31. Oktober
31. Oktober–2022
1. November
2. November
3. November
6. November
7. November
14. November
15. November
16. November
17. November
23. November
24. November 2019–2022
25. November
26. November
27. November
27. November 2019–2022
29. November
6. Dezember
6. Dezember 2019–2022
16. Dezember
22. Dezember
22. Dezember 2020–2022
26. Dezember
29. Dezember
2020
13. Januar
13. Januar 2020–2022
14. Januar
14. Januar 2020–2022
15. Januar
15. Januar 2020–2022
10. Februar
18. Februar
20. Februar
21. Februar
22. Februar
24. März
25. März
1. April
3. April
4. April
7. April
21. Mai
29. Mai
12. Juni
15. Juni
16. Juni
27. Juni 2020–2022
19. Juli
20. Juli
2. August
2. August 2020–2022
3. August
4. August
1. September
4. September
5. September
1. Oktober
2. Oktober
3. Oktober
4. Oktober
6. Oktober
6. Oktober 2020–2022
6. Oktober
8. Oktober
9. Oktober
10. Oktober 2020–2022
11. Oktober
12. Oktober
14. Oktober
16. Oktober
17. Oktober
23. Oktober
9. November
27. November
1. Dezember
2. Dezember
2. Dezember 2020–2022
3. Dezember
4. Dezember
5. Dezember
6. Dezember
7. Dezember
8. Dezember
9. Dezember
13. Dezember
15. Dezember
16. Dezember
16. Dezember 2020–2022
17. Dezember
23. Dezember
25. Dezember
27. Dezember
28. Dezember
29. Dezember
31. Dezember
2021
1. Januar
4. Januar
5. Januar
10. Januar
11. Januar
14. Januar
15. Januar
16. Januar
17. Januar
18. Januar
19. Januar
20. Januar
2. Februar
3. Februar
Anhang
Bücher (»›Wie ein krankes Tier ein bestimmtes Kraut frisst‹, lese ich bestimmte Bücher«)
Hölderlin und die braunen Frauen daselbst
Kalte Schokolade. Vier Tage mit Walter Benjamin
2018
3. August
Angesichts des Todes: Abwesenheit der Gegenwart. Gleichzeitiger Lauf der Vergangenheit und der Zukunft. Dazwischen ein Vakuumkorridor. Eine temporale Anomalie einer Grenzerfahrung.
Vielleicht erlaubt diese Abwesenheit der Gegenwart, den unerträglichen Schmerz zu ertragen. Wozu nur?
Später überfährt dich die Gegenwart wie eine Lokomotive.
Bis der Trost eintritt, schimmert noch Hoffnung.
Die Wunde ist heiß, offen, sie riecht nach seidenem Blut. Die Narbe ist kalt, geschlossen und hässlich.
Später wird das Leben durch die Poren der Zeit hineinsickern und mit seinem Gestank den sterilen Raum ohne Gegenwart mit Gegenwart füllen. Die Aggression der Gegenwart.
Das Leben steht still, bis die Wunde sich schließt.
Dann beginnt es sich zu bewegen.
Das Leben mit einem Henkergesicht.
11. August
Die am meisten unerwiderte Liebe ist die Liebe zu einem Gestorbenen.
12. August
Der dritte Tag in Edenkoben. Edenkobener Tal. Weinberge. Pfälzer Wald. Viel Himmel. Hier ist Olegs Präsenz noch stärker als in Frankfurt. Als würde er auf uns in »unserem« Zimmer des Herrenhauses warten, wenn Daniel und ich in den Weinbergen unterwegs sind.
Die Dankbarkeit an Barbara und Konrad Stahl, die uns eingeladen haben, hier den August zu verbringen.
13. August
Gleich am Morgen: Jetzt würden wir Vorhänge aufschieben, den über den Weinbergen stehenden Regen sehen, uns freuen, dass es kühler geworden ist.
Später: Jetzt würden wir Kaffee trinken.
Das Denken geht nur in solchen einfachen Schritten.
Das übrige Denken wird blockiert. Aber ich schreibe einen versprochenen kleinen Text, ich will allen zugesagten Verpflichtungen nachkommen. »Keinen einzigen Tag begann ich ohne ein gewisses Staunen, wie ein Mensch noch weiterlebt, wenn ihm das Herz herausgerissen und der Kopf abgehackt wurde«, schrieb Fjodor Tjutschew zwei Jahre nach dem Tod seiner Geliebten. Das fiel mir heute ein.
Nach dem Regen: Die Luft widerstrebt dem Atmen nicht mehr. Wir würden in die Weinberge gehen (wir wären gegangen …).
14. August
Aus einem Brief von Jelena Schwarz von 1999 (damals habe ich dem nicht die gebührende Bedeutung beimessen können, aber jetzt): »Das Schlimmste ist, dass alles zum Gegenstand der Kunst wird. Selbst das, was auf keinen Fall dazu werden kann.« Es geht um die Gedichte, die sie nach dem Tod ihrer Mutter geschrieben hat.
Die Mutter war für Lena der wichtigste Mensch ihres Lebens (danach kam ihr erster Mann, danach der Pudel Jascha. In den letzten Jahren der Japan-Chin Haiku. Ich denke, nächste Freunde waren in dieser Reihe irgendwo zwischen Jascha und Haiku).
15. August
Die anfängliche Betäubung aller Gefühle lässt manchmal nach. Wie bei einer unerwartet lange dauernden Zahnbehandlung, wenn der Schmerz durch die Anästhesie munter durchdringt. Was bedeutet »Schmerz«, wenn er nicht körperlich ist?
Novalis: »Im höchsten Schmerz tritt zuweilen eine Paralysis der Empfindsamkeit ein. Die Seele zersetzt sich. Daher der tödtliche Frost, die freye Denkkraft, der schmetternde unaufhörliche Witz dieser Art von Verzweiflung. Keine Neigung ist mehr vorhanden; der Mensch steht wie eine verderbliche Macht allein. Unverbunden mit der übrigen Welt verzehrt er sich allmählig selbst, und ist seinem Princip nach Misanthrop und Misotheos.«
Der Schmerz und die Erstarrung (»Paralysis der Empfindsamkeit«) – im Wechselspiel. Präzise dosiert, dass man gerade noch am Leben bleibt.
16. August
Heute kann ich kaum aus dem Bett. Es ist schon Abend. Ich versuche, wenigstens ein paar E-Mails zu beantworten.
Die paradiesische Landschaft von Edenkoben.
Als wäre in der labyrinthischen Unendlichkeit der Weinberge ein Teil von uns stecken geblieben (als wäre? »Unsere Schatten sind auf dem Pfad von dem Mond umgerissen.«):
OLEG JURJEW:Über Weingärten [Auszug]
Weingärten sind die perfidesten aller Labyrinthe: Kaum Biegungen und Blind-Enden, lediglich falsche Ein- und Ausgänge haben sie, aus welchem Grund es nahezu unmöglich ist, in das Zentrum des Labyrinths zu gelangen. Und wenn zufällig doch, dann ist es völlig unmöglich, zurück zu finden, zumindest nicht, wie du davor warst. […]
Nachts geht in die Weingärten gar niemand. […] Nur wir gehen hier spazieren am Labyrinthsperimeter, der überall ist, entlang – an den falschen Ein- und Ausgängen vorbei. Unsere Sandalen tappen leise, wir schauen über uns empor – in den Himmel, wo der Wein sich spiegelt als Sterne.
Unsere Schatten sind auf dem Pfad von dem Mond umgerissen. Der Mond ist feucht und mulmig und strahlend. […]
Blickst du zufällig querdurch – durch einen falschen Ein- oder Ausgang: da ist weit vorn ein dumpfes flimmriges Licht. Kann sein, dass das Nachbardorf hindurchleuchtet, kann auch sein, dass da das Labyrinthzentrum leuchtet, das nirgendwo ist.
Die Toten und ihre Trauernden kommen ins Zentrum des Labyrinths, das nirgendwo ist.
17. August
Olegs russischer Verlag macht ein Buch mit den letzten, nicht veröffentlichten Gedichten. Beim Korrekturlesen misstraue ich meinen Kräften und der Konzentration.
18. August
Das Buch wird gut aussehen: Schrift, Satzspiegel, Umschlag. Das posthume Buch. Obwohl ich keine Minute an etwas anderes denken kann, irritiert mich jede Handlung, die mit Olegs Tod verbunden ist, zum Beispiel den Ordner »Nachlass« zu öffnen, und versetzt mich in einen apathischen Zustand, in dem ich zu nichts fähig bin, dessen ich mich schäme.
Aus diesem Buch:
OLEG JURJEW
Ich schäme mich zu sterben – vor dir.
Bereits sind deine Augen, die Stirn, als sähe ich Von einem Flussgrund durch Wasserschichten, fließend-leuchtend.
Und einen Dunst um dich – meine Scham deines Kummers.
So lange haben du und ich Wange an Wange gelebt,
Dass ich schlichtweg vergaß, dass ich nunmehrdein Schicksal war,
Ich weiß erst jetzt, was dieses Schicksal ist,
Und was die Schwärze ist um deine Augen, deineStirn.
(13.04.2011)
Übersetzt von Olga Martynova
19. August
Wieder so ein Tag: Ich stehe spät auf, gehe früh ins Bett, schlafe meistens auch tagsüber, höre Requiems: Mozart, Ligeti.
20. August
Meine Korrekturfahnen für »Sprache im technischen Zeitalter« wird dankenswerterweise die Redaktion lesen. Ich habe das nicht geschafft.
22. August
Adrian La Salvia plant in seiner Übersetzer-Werkstatt (beim Erlanger Poetenfest) eine Gedenkstunde für Oleg ein.
25. August, Erlangen
Einmal haben Oleg, Elke Erb und ich hier über die Übersetzung russischer Gedichte gesprochen. Als hätte ich darüber bloß irgendwo gelesen. Die Erinnerungen kommen durch die »Paralysis der Empfindsamkeit« nicht durch.
26. August
Novalis wollte seiner Sophie nachsterben und starb nach. Er wollte das über Jahre hinweg, sogar über eine andere Verlobung hinweg. Er hat den Selbstmord in Erwägung gezogen, wurde aber durch den natürlichen Tod daran gehindert. Eine glückliche Fügung. (Brecht: »Glücklicher Vorgang. Das Kind kommt gelaufen. Mutter, binde mir die Schürze! Die Schürze wird gebunden.«)
27. August
Das Bedürfnis zu wissen, wie andere Trauernde damit umgehen, was man nicht umgehen kann.
Ein Grund, warum ich beschloss, all das niederzuschreiben.
Augusta Laar schreibt mir mit mutiger Offenheit über ihren Verlust, der 20 Jahre zurückliegt.
29. August
30. August
Jede Handlung, die eine bestimmte Fertigkeit vorausgesetzt hat, zum Beispiel heute eine Annonce für die Gedenkabende in Petersburg zu schreiben, und die als getane Arbeit eine Genugtuung hätte bringen sollen, führt in die Leere, wo der Schmerz in freudiger Erwartung aufschaut (ich will das Wort vermeiden, finde kein anderes).
6. September, Novi Sad
Erste neue (zu einem Ort, wo wir zusammen nicht gewesen sind) Reise. Es gibt Albträume, die nicht wegen ihres Inhalts als solche wahrgenommen werden, sondern wegen des Aufwachens: Der Traum war ganz alltäglich, nur erwacht man im verschwitzten Nachthemd, und die Haare am Kopf bewegen sich wie Meeresalgen.
7. September, Novi Sad
Gleich beginnt eine Abendveranstaltung. Verica Tričković und ich haben ausgemacht, dass wir mit einem Gedicht von Oleg beginnen (auf Russisch und auf Serbisch).
10. September, Belgrad
Ich checke bei jeder Wi-Fi-Gelegenheit zwanghaft meine E-Mails, als würde ich glauben, Oleg würde mir eine Nachricht schreiben. Und ich ihm antworten.
Via Wi-Fi ins Nichts:
Der Košava. So heißt der Wind hier.
Überall Popcorn. Serben meinen wohl, im Kino zu leben. In einem Film und als Zuschauer zugleich.
Buchläden (Ivo Andrić) und Restaurants (Vuk Karadžić) werden nach Schriftstellern benannt.
Im Osten Europas haben ältere Herren immer noch keine Hemmungen, Frauen paternalistisch an den Schultern und nackten Armen zu berühren, selbstbewusst und selbstverliebt.
14. September, wieder Frankfurt
Eine Zeile aus einem Gedicht von Oleg: »Ich erinnere mein Leben als wir.« (1983)
Als hätte Oleg damals das für mich jetzt geschrieben.
Nur kann ich mich an »damals« nicht erinnern. Ich erinnere mich nur an die Zeit von der Diagnose bis zum Tod.
Ein Freund sagte, nach dem Tod seines Vaters habe er sich ein Jahr lang nur an dessen Krankheit erinnern können.
15. September
Am Abend am Main. Ein langsamer Schwan im Wasser. Man trifft selten einen Schwan, der allein ist. Seine weißen Federn können vermutlich den Schmutz abweisen. Aber nur bis zu einem gewissen Grad: Sein Hals, den er immer wieder zum Fischen ins Wasser eintaucht, ist dunkelgrau.
Orpheus bei Platon wollte als Schwan wiedergeboren werden: Wegen der Mänaden, die ihn zerrissen haben, ekelte es ihn vor Frauen, und er wollte aus einem Ei schlüpfen. Dachte er nicht mehr an Eurydike?
16. September
Daniels Geburtstag. Daniel schreibt an dem Nachwort zu Wsewolod Petrows Erzählungen. Eines der Projekte, die wir zu dritt begonnen haben.
Später gehen wir ins English Theatre: »The Lion in Winter« von James Goldman.
20. September
Ich versuche, mir vorzustellen, was Oleg jetzt machen würde, wäre ich gestorben, nicht er. Wie er aufstehen würde, Tee trinken, seine Medizin nehmen, den Computer einschalten. Unbewusst warten, dass sich etwas ereignet, das eine Verbindung zu mir herstellen würde, eine E-Mail, eine SMS, ein Anruf, ein Hauch Wind. Wie er mit großer Mühe und gegen Unwillen alles erledigen würde, was zu erledigen ist, und dann: eine Enttäuschung, dass er diese Leistung nicht mit mir teilen kann. Freilich ist das eine lächerliche Leistung eines Trauernden, Kraft für die einfachsten Dinge des Alltags zu finden.
21.–22. September
Gedenkabend für Gregor Laschen in Utrecht. Er ist einen Monat vor Oleg gestorben. Gregors Familie und Dichterfreunde, auch Kollegen aus dem akademischen Leben.
Jemand hat aus Versehen einen Sekt auf meinen Rucksack gekippt. Am meisten hat mein Novalis gelitten, die »Hymnen an die Nacht«. Das Buch, das alle natürlichen Sinne verneint, wurde mit von Gefühlen sprudelndem Wein übergossen. »Endet nie des Irdischen Gewalt?«, hätte das Buch empört fragen können.
Wenn ich in Gesellschaft bin, beginnt »des Irdischen Gewalt«. Was mich von meiner Trauer ablenkt, ist störend.
Weil mir Novalis so nah ist, scheint mir manchmal, dass Oleg ein Kind ist, wie Sophie es war. Schutzlos und schutzbedürftig.
»Nah« ist natürlich übertrieben und überhaupt falsch. Novalis befand sich noch vor dem Leben (wenn auch er fast nichts mehr vor sich hatte); und ich befinde mich nach dem Leben (egal wie lange noch).
5. Oktober
Daniel und ich sind aus Petersburg zurück. Gedenkabende im Achmatowa-Museum und im Theater von Danila Korogodsky. Aus Korogodskys Wohnung, wo wir danach bis tief in die Nacht saßen, sieht man den Fluss Fontanka und sein Prachtufer mit den Häusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Es gibt Städte, deren gesamte Erzählung darum kreist, dass sie ans Jenseits grenzen. Jede Petersburger Sommernacht lässt die Trennwände zittern. Hat Orpheus im Averno-See die gespiegelten Lichter einer Petersburger Straßenbahn gesehen?
Nach Jelena Schwarz’ Tod bat eine Zeitschrift Oleg oder mich um eine Rezension ihrer letzten Gedichte. Wir haben sie in Gesprächsform geschrieben. Und noch einmal die schnelle Zeit ihres Sterbens miterlebt.
»[…] Oleg: ›… dieses Buch ist nicht nur eine kleine Sammlung großer Gedichte, es ist ein Fenster in den Tod. Oder sogar so: ein Fenster in ein Fenster in den Tod. Ein Fenster, in dem es noch ein Fenster gibt, erst dieses ist in den Tod geöffnet. Am ersten Fenster sitzt der Dichter und schaut mal dorthin, mal zurück, ins vergangene Leben – das bereits vergangene. Deshalb ist für mich das Schlüsselgedicht des Buches ›Erinnerung an Intensivstation mit der Aussicht auf Newas Wasser‹. Durch das Krankenzimmerfenster wird der Dichter in den Tod-Newa hineingezogen.‹
Ich: ›Also kann man sich Petersburg nicht entziehen. Es wartet auf einen jeden – jenseits.‹ […]«
Wir waren auch in Pawlowsk, der Sommerresidenz des Zaren Pawel I. Unser verrückter Zar ließ aus freimaurerischen Gründen einen schottischen freimaurerischen Architekten die Parklandschaft in Pawlowsk nach Himmelskarten planen. Seitdem spiegeln sie einander, der Himmel und der Pawlowsker Park.
6. Oktober
Alexander Block sagte angeblich über Achmatowa, sie schreibe so, als täte sie dies unter der Beobachtung eines Mannes, während man so schreiben solle, als stünde man vor Gottes Augen. Ich habe 37 Jahre alles in der Erwartung gemacht, es mit Oleg zu teilen. Und jetzt …
Blocks Bemerkung sieht misogyn aus, ist es aber nicht. Misogyn wäre, von ihr nicht zu verlangen, dass sie zum Gottesnarren würde.
12. Oktober
Ich versuche, für »NLO« (Neue literarische Rundschau, Moskau) den versprochenen Text zur geplanten Publikation in Olegs Andenken zu schreiben, »mit herausgerissenem Herz und abgehacktem Kopf«.
19. Oktober
Nach dem Tod meines Vaters habe ich lange getrauert. Das war (und ist an manchen Tagen, ganz verschwinden kann Trauer nicht) eben eine starke Trauer, kein Verlust, der mein weiteres Leben bestimmt und das eigentliche Ende meines Lebens ist. Ich glaube, Oleg hat so einen existenziellen Verlust nicht erlebt. Wäre ich als Erste gestorben, hätte ich das auch nicht. Das gehört nicht zwangsläufig zu jedem Leben. Interessanterweise.
21. Oktober
Menschen, die wissen, was so ein Verlust bedeutet, verstehen einander und erkennen einander. Und erkennen einander an.
Augusta Laar. Als würde sie mich laufen lehren, mir sagen, hier kannst du einen Schritt machen, der Boden wird halten.
24. Oktober
Meine heiß geliebte Vergangenheit.
»Amata nobis quantum amabitur nulla!«, aus einer Erzählung von Iwan Bunin.
27. Oktober
Kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, Anfang der 1980er Jahre, hat Oleg eine Geschichte über Joseph Brodsky erzählt, der bereits seit zehn Jahren in den USA lebte (solche Anekdoten waren eine verbreitete folkloristische Gattung unter jungen Autoren in Leningrad). Eine der Moden und Freiheiten der für uns damals, in der späten Phase der sowjetischen Stagnation, schon legendären 60er Jahre waren »Poetenturniere«: Jeder, der wollte, las Gedichte (in einem Café) und alle Anwesenden kürten den »König der Dichter«. Bei einem solchen »Turnier« soll Brodsky auf die Bühne gestiegen sein und hastig, mit seinen vielen Sprachfehlern die Hälfte der Laute nicht aussprechen könnend, gerufen haben: »Was macht ihr!? Das ist doch Profanierung der Poesie!«
An diese »Profanierung der Poesie« dachte ich, als ich keine Herbstlesungen abgesagt hatte. Ich wusste nicht, was ich lesen könnte, ohne das Gefühl zu bekommen, das sei ein Verrat nicht nur an der Trauer, sondern auch an den Gedichten, bloß eine mechanische Wiedergabe.
Ich habe am Ende eine Mischung aus deutschen und russischen Texten zusammengestellt und gesagt, dass ich nach Olegs Tod keine Gedichte auf Russisch schreiben kann (kann ich überhaupt schreiben? Auch die deutschen Gedichte wurden vor Olegs Tod geschrieben).
Und danach gedacht:
Ich stehe auf der Bühne und performe Schmerz-Stand-up.
Als würde ich meine Trauer verkaufen. Würde ich das nicht tun, wäre es, als hätte ich Oleg und mich verraten.
Das hat keine Lösung. Wie auch das Fehlen eines Menschen keine Lösung hat.
Aus Olegs Notizbüchern: »Die Verwandlung in eine literarische Figur ist die Berufskrankheit der Schriftsteller. Im Laufe der Zeit beginnt der Schriftsteller, sein eigenes Leben als Literatur zu betrachten – dieses oder jenes Genres, dieser oder jener Qualität, je nachdem; er verliert langsam das Volumen und verwandelt sich in eine literarische Figur.«
28. Oktober
Florenz-Ausstellung in der Alten Pinakothek. Ich hätte das lieber sein lassen sollen. Die Bilder sind fade geworden. Als wäre einem der Geruchs- oder Geschmackssinn abhandengekommen.
29. Oktober
1. November
Heute Morgen – eine Erinnerung an unsere Schiffsreise nach Amsterdam. Wir schauten nachts durch die Glaswand auf das langsame Wasser, die Wiesen mit den knietief im Nebel weidenden Kühen. Oleg, dem es nicht gut ging, wie so oft in den letzten Jahren, sprach mit zärtlicher Dankbarkeit über diese schemenhafte Schönheit der Welt.
3. November
3. November 2018–2022
… die zusammenleben im Gedächtnis …
»A Grief Observed« (in der deutschen Übersetzung »Über die Trauer«, ich würde das vielleicht als »Untersuchung der Trauer« übersetzen), das Clive Staples Lewis nach dem Tod seiner Frau schrieb, ist im englischsprachigen Raum eine Bibel der Trauernden. (In Deutschland ist er hauptsächlich durch seine Kinderbücher »Die Chroniken von Narnia« bekannt.)
Lewis registriert, wie sein Glaube dem Verlust weicht. Ob des qualvollen Todes seiner Frau ist er bereit, in Gott einen verrückten Sadisten zu sehen (wie Hiob? Aus der Sicht des Glaubens ist das immer noch besser, als Gott zu streichen).
Es gibt Menschen, die ihren Glauben trotz des Wissens um die unlösbare Unvollkommenheit der Welt bewahren. Ihr Glaube ist nicht jungfräulich, sie sind nicht getäuscht wie Buddha Gautama, bevor er einen Bettler, einen Kranken und einen Toten gesehen hat, aber sie reden sich irgendetwas ein. Und wenn der einzige Mensch, der für sie wirklich zählt, stirbt oder leidet, durchbricht das die solipsistische Schale.
Die anderen hingegen beginnen erst dann zu glauben. Auch hier wird die solipsistische Schale durchbrochen.
Die Trauer gibt mit einer unwiderlegbaren Schärfe zu spüren, dass es etwas außerhalb des eigenen Bewusstseins gibt, sie ist nicht nur eine offene Wunde, sie ist eine offene Frage über die Grenzen der wahrnehmbaren Welt hinaus.
In der akuten Trauer sind Materialisten und religiöse Menschen gleich verunsichert. Die einen zwingen sich zum Weiternichtglauben, die anderen zum Weiterglauben. Die meisten gewinnen mit der Zeit ihr Weltbild zurück. Beide in entgegensetzte Richtungen laufenden Impulse treffen sich im Nichts, was natürlich ein Pseudonym Gottes ist. Die Frage des Glaubens stellt sich von selbst im Zusammenhang mit der Trauer, auch den Atheisten, auch wenn die Antwort weiterhin »nein« lautet.
Joan Didion in »Das Jahr magischen Denkens« (dem Buch über die Trauer um ihren Mann): Sie habe daran, womit sie in der katholischen Umgebung aufgewachsen sei, an die Auferstehung von den Toten, nicht geglaubt und dies für eine klare Denkweise gehalten. Im Trauerzustand sieht sie in ihrem Unglauben eine nur noch stärkere Verwirrung.
Julian Barnes in »Lebensstufen« (einem Trauerbuch, geschrieben nach dem Tod seiner Frau): »Als wir Gott getötet – oder verbannt – haben, haben wir auch uns selbst getötet. […] Natürlich war es richtig […]. Aber wir haben den Ast abgesägt, auf dem wir saßen.«
Barnes hat sein Buch über die erste Trauerzeit hinaus und über Jahre geschrieben, was es von vielen anderen Trauerzeugnissen unterscheidet. Die Wörter »Schmerz« (»pain«) und »Leid« (»grief«) werden dadurch nicht weniger unvermeidbar. Der deutsche Übersetzer hat »grief« als »Leid« wiedergegeben. Mit »Trauer« gibt er das Wort »mourning« wieder. Barnes fragt sich nach dem Unterschied zwischen »grief« und »mourning«: »Man kann versuchsweise sagen, Leid ist ein Zustand und Trauer ein Prozess, aber beides muss sich zwangsläufig überschneiden. Nimmt der Zustand ab? Schreitet der Prozess voran? Woran erkennt man das?«
Joan Didion versucht »grief« und »mourning« (in der deutschen Übersetzung ebenso »Leid« und »Trauer«) in ähnlicher Weise voneinander zu trennen. »Leid« sei passiv, das, was geschieht. »Trauer« sei »Auseinandersetzung mit Leid«. Die »Trauer« nach dem Tod ihrer Eltern war ein Einschnitt im Leben, aber der Lauf des Lebens wurde bei allem Schmerz nicht aufgehoben. Das »Leid« nach dem Tod ihres Mannes änderte alles (»Das Leben ändert sich schnell. Das Leben ändert sich in einem Augenblick. […] das Leben, das man kennt, hört auf« – so beginnt ihr Trauerbuch).
Allerdings kann das unterschiedlich sein, wessen Tod »Trauer« und wessen Tod »Leid« auslöst (die Unzulänglichkeit dieser Wörter …). Bei Roland Barthes war der Tod seiner Mutter ein existenzieller, den Lauf des weiteren Lebens bestimmender Verlust.
Barthes denkt an Marcel Proust und dessen Trauer um die Mutter: »Proust spricht von Kummer, nicht von Trauer (neuer psychoanalytischer Ausdruck, der die Dinge verzerrt).«
Auf Französisch sind das »deuil« (»Trauer«) / »chagrin« (»Kummer«). Das entspricht wohl den englischen »mourning« und »grief«. Barthes’ datierte Notizen auf einzelnen Papierblättern wurden posthum verlegt. Die Herausgeber betitelten sie »Journal de deuil« (»Tagebuch der Trauer«), obwohl Barthes eben dieses Wort als Dinge verzerrend bezeichnet. Eine Notiz lautet: »Nicht von Trauer sprechen, das ist zu psychoanalytisch. Ich habe Kummer.«
Alles, was nicht rechtzeitig vernichtet wird, wird zu Freiwild für die Herausgeber. Wenn ich in der Nacht Atemnot bekomme, denke ich mit Bedauern, dass ich nicht alles gelöscht habe, was ich keinem zeigen will, auch der Nachwelt nicht, und verspreche mir, mich darum zu kümmern. Aus Kraftmangel bleibt das unerledigt.
Freuds »Trauer und Melancholie« heißt auf Englisch »Mourning and Melancholia«, aber für die Freud’sche »Trauerarbeit« wird abwechselnd »grief work« und »mourning work« verwendet.
Ich ziehe das Wort »Trauer« allen anderen vor, weil es den Ausnahmezustand der menschlichen Psyche schlicht benennt, ohne zu unbefriedigend unpräzisen Wörtern wie »Schmerz« oder »Verzweiflung« oder »Leid« zu greifen. Der Mensch wird von der Trauer genauso ergriffen wie von der Verliebtheit. Die Trauer ist ein anderer Aggregatzustand des Menschen. Die Wirklichkeit beginnt zu zittern, die festen Oberflächen scheinen sich aufzulösen, nichts ist mehr so sicher.
Der Gedanke an Selbstmord soll gedacht werden, er ist ein natürlicher Bestandteil der Trauer, ist nicht affektiert, was Außenstehenden schwer zu vermitteln ist. Barnes: »Es hat eine Weile gedauert, aber ich erinnere mich an den Moment – besser gesagt, das plötzlich auftauchende Argument –, mit dem es weniger wahrscheinlich wurde, dass ich mich umbringen würde. Sofern sie überhaupt lebendig war, sagte ich mir, dann war sie in meiner Erinnerung lebendig. […] Sie würde ein zweites Mal sterben, meine leuchtenden Erinnerungen an sie würden verblassen, während das Badewasser sich rötete.«
Man kann sich kaum jemanden vorstellen, der von dem nüchternen Barnes entfernter wäre als der ekstatische Novalis, aber hier treffen sie sich.
Novalis: »Der Mensch lebt, wirkt nur in der Idee fort, durch die Erinnerung an sein Daseyn. Vor der Hand giebts kein anderes Mittel der Geisterwirkungen auf dieser Welt. Daher ist es Pflicht an die Verstorbenen zu denken. Es ist der einzige Weg in Gemeinschaft mit ihnen zu bleiben. Gott selbst ist auf keine andere Weise bey uns wirksam als durch den Glauben.«
Ebenso spricht Roland Barthes davon, dass die Erinnerung an seine tote Mutter völlig von ihm abhänge.
Auch Hölderlin:
»Sie sich nicht fassen können
Einander, die zusammenlebten
Im Gedächtnis«.
5. November
Die Frage »Wie geht es dir?« irritiert. Soll man die Wahrheit sagen? Die niemand braucht. Soll man lügen?
Hansjörg Schneider (»Nachtbuch für Astrid«) schreibt über Arten, »die Hilflosigkeit einem trauernden Mann gegenüber, der seine langjährige Geliebte verloren hat, auszudrücken«. So sei »Aktion Wie gehts? Die Kondolanten wollen dem Trauernden helfen, indem sie sich nach seinem Zustand erkundigen. Das ist Stumpfsinn. Man sieht ja, wie es ihm geht. Er ist am Ende.«
Die Fragenden sind in keiner Weise schuld und folgen den zweifellos notwendigen Formalitäten. Wenn sich zwei Trauernde treffen, stellen sie sich gegenseitig diese Frage, wohl wissend, wie sinnlos das ist. In solchen Treffen zweier Trauernder liegt ein gewisser Slapstick.
Die Antwort »Danke, gut« fühlt sich als Verrat an, als würde man seinen Toten verleugnen.
6. November
Einer der wenigen Gedanken, dem etwas Kraft abzugewinnen ist: Das ist ganz normal, dass es mir schlecht geht.
10. November 2018–2022
Sprachverlust
Neapel.
Die neapolitanischen Gassen sind auf den ersten Blick ein Wirrwarr, auf den zweiten sind sie eine mit Farben und Tönen übersättigte Ordnung. Ich kaufe mir eine Babà, das mit Rum oder Madeira getränkte Hefegebäck, das wir als Kinder in Leningrad unter dem Namen »ромовая баба« oder »ромбаба« (Rum-Babà) in jedem Brotladen kaufen konnten. Mitten in der Mangelwirtschaft gab es Einsprengsel von ehemaligem Luxus, die im Laufe aller sowjetischen Jahrzehnte nicht vollständig ausgerottet worden waren. An »ромовая баба« dachten wir bei späteren Begegnungen mit der Babà in Frankreich oder Italien. Der chaotische Stoff der Welt wird durch solche Muster zusammengehalten.
Ich sehe diese Muster jetzt vielleicht noch deutlicher, aber:
In dem Roman »Die Erben« von William Golding bleibt am Ende ein Neandertaler als Letzter seiner Gattung übrig. Er hat keinen mehr, der seine Sprache spräche, und wird zu einer unbestimmten Kreatur, stumm, seine Sprache ist tot geworden. Ohne Oleg bin ich wie jener Neandertaler. Ein ungefähres Wesen mit einer Babà in der Hand, die keine Bedeutung mehr hat.
In einem Gedicht von Jelena Schwarz schreit ein solch ungefähres Wesen die Sprachfetzen vor sich hin – ein schiffbrüchiger Papagei auf einem Brett:
[…]
Er singt ein Lied über eine Mulattin, oder
Schreit plötzlich mit ganzer Kraft
Ganz oben auf der Woge, auf dem Wellenkamm –
Dass das Vögelchen, das arme, Wodka will.
Und er schaut mit so viel Stolz
Auf dieses gekräuselte Tal.
Wie sehr berührt im Herzen
Die Hochmut hilfloser, schwacher Wesen.
[…]
Er murmelt nickend:
Da stimm ich zu, jedoch …
Allerdings … wohl kaum … außer …
Ausnehmend … und außerdem …
[…]
Er schielt mit schläfrigem Auge,
Um das Meer auszutricksen.
God damn! … In einem gewissen
Maße, und strenggenommen …
[…]
Via Wi-Fi ins Nichts. Eine Freude mit jemandem zu teilen, für den diese Freude in keiner Weise mehr von Bedeutung ist. In Neapel fühlt sich das weniger absurd an als anderswo. Neapel meint es mit Toten und Trauernden gut. Es spielt seine sinnliche Fülle nicht gegen den Tod aus. Verkaufsstände mit Babàs, Weihnachtskrippen, Spaghettidosierern (ein schmales Brettchen mit drei Löchern von verschiedenen Durchmessern); Innenhöfe mit Springbrunnen und blühenden Zitronen; Menschen, die Kaffee trinken im Gehen oder mit Mobiltelefonen aus ihren Fenstern hängen, weil Wände aus dem porösen neapolitanischen Tuff den Empfang verhindern; und natürlich Motorroller – all das birst vom Leben und grenzt an die Totenwelt, die hier nicht verdrängt wird.
Die Ähnlichkeit, wenn nicht gar Verwandtschaft, von Petersburg und Neapel liegt nicht auf der Hand. Beide Städte scheinen das Gegenteil voneinander zu sein. Neapel ist südlich offen und durchlässig. Nicht nur Walter Benjamin vergleicht es mit einem afrikanischen Dorf, wo innen und außen nahtlos ineinander übergehen würden. Dagegen ist Petersburg nördlich zugeknöpft. Was Neapel in seiner theatralischen Natur zur Schau stellt, muss man in Petersburg noch erraten. Dabei ist Petersburg ebenso theatralisch, nur äußert sich seine Theatralik in den kalten klassizistischen und eitlen barocken Fassaden, hinter denen seine groteske Welt versteckt ist. Dieses Versteckte, die Bresche ins Jenseits brachte den Philosophen Wladimir Toporow auf den genialen Begriff »Petersburger Text«: Als würden Dichter an einem gemeinsamen grotesken Kunstwerk arbeiten. Der treue Begleiter des Petersburger Textes ist der Tod.
Als würde ich Neapel nicht zum ersten Mal begegnen, sondern mich an es erinnern.
Den neapolitanischen Totenkult hat die katholische Kirche Ende der 1960er Jahre verboten. Es ist zu bezweifeln, dass solche Verbote befolgt werden. Hier sieht es nicht danach aus.
Die Kirche Santa Maria delle Anime del Purgatorio ist laut Reiseführer der Haupttempel des Totenkultes (später werde ich lernen, dass solche Stätten über die ganze Stadt verstreut sind). Hier: Glanzlichter auf den bronzenen Schädeln beidseitig der Vortreppe und barocker Glanz drinnen. Um in die Unterkirche hinabzusteigen, zahlt man Eintritt: Als wäre das bloß ein Museum des gewesenen Kultes. Unten keine Pracht mehr, kahle Steinwände und nicht mehr bronzene, sondern wirkliche Schädel und Knochen, geordnet in Kästchen, ausgeziert mit Blumen, Bändchen, Spitzen, Broschen, Rosenkränzen, Bildchen. Man wird beobachtet. Nicht von den Toten (oder sie machen das diskret), sondern von den Frauen, die oben Tickets verkaufen, der ganze untere Raum ist mit Überwachungskameras versehen, selbst die hinterste Krypta, und kaum holt man das Mobiltelefon zum Fotografieren heraus, mahnt der Lautsprecher, das zu unterlassen. An einer Wand leuchtet die Zahl 16753. Wieder oben, frage ich nach deren Bedeutung und erfahre, dass das eine Kunstinstallation ist: So viele Flüchtlinge sind in den letzten fünf Jahren unterwegs zu uns ertrunken. Man kann sich kaum ein Kunstwerk vorstellen, das zum neapolitanischen Totenkult besser passen würde.
Wenn die Toten einen ordentlichen Abschied nicht nur brauchen, damit wir hier Menschen bleiben, sondern weil die Seelen der Unbeweinten sonst keinen sicheren Weg durchs Fegefeuer finden würden – was für eine Verwirrung muss im Jenseits herrschen, wenn nach Seuchen, Hungersnöten, Kriegen, Erdbeben und Vulkanausbrüchen Gebeine zusammengeschart oder gar verschollen bleiben. Nicht nur in Neapel, immer und überall sind wir auch im Tod nicht alle gleich, und in Zeiten der Not reicht der Platz nicht für alle Leichen. Neapel allerdings erklärt alle verwahrlosten Knochen zu Reliquien. Man »adoptiert« herrenlose Gebeine und betet für die Seelen, die dazu gehör(t)en, damit sie das Fegefeuer glimpflich passieren und im Gegenzug zu himmlischen Patronen ihrer Fürsorger werden. Eine anonyme Seele von Neapel bekommt die Illusion, für jemanden (die Person, die ihre sterblichen Überreste, den Schädel pflegt) der wichtigste Tote zu sein. Schafft sie es, daran zu glauben? Im Idealfall würden alle Gebeine ihre letzte Ruhe finden und alle Seelen bekämen ihr Geleit. Erlösung für alle! Genauso utopisch wie Champagner für alle.
Die Tuffhöhlen des Friedhofs Fontanelle in dem aus den Filmen des italienischen Neorealismus bekannten Viertel Sanità. Dass der neapolitanische poröse Tuff die Mobilfunksignale nicht durchlässt, heißt noch nicht, dass das auch für die Seelen und Gebete gilt. Sie gleiten auf und ab und hängen an den Sonnenstrahlen, die aus den Rissen oben kommen und silberne staubige Luft durchschießen. Die Gewölbe sind verstörend hoch, seltsam hell, bieten viel (Schau-)Platz für Gebeine. Schädel in den Puppenhäuschen. Knochenstapel in Fächern und Nischen wie weiland bei einer tüchtigen Hausfrau die Einweckgläser mit Marmelade und eingelegtem Gemüse.
»Die Wahl eines Schädels wird nicht leichtgenommen: die Leute gehen bedächtig auf die Suche, von einem Sarg zum anderen, während ihr Blick die traurigen Überreste mustert. Jäh bleiben sie stehen und beugen sich vor, um einen Schädel zu ergreifen, auf dem sie noch keinen Namen entdecken.
Sie betrachten ihn von allen Seiten, prüfen Konsistenz und Resonanz, indem sie ihn immer weiter herumdrehen und abklopfen […]. Ein an einer Mütze erkenntlicher Aufseher, der durch die Gänge schlendert, dient manchmal als Ratgeber und sogar als Lieferant. Ich hörte, wie ein Herr in Schwarz ihn fragte, ob er keinen Damenschädel zu finden wüsste. ›Keiner frei!‹ erwiderte er. ›Aber wir erwarten morgen eine Sendung Skelette, und dann werde ich wohl das Gewünschte für Sie haben.‹ Er half einer Frau bei der Wahl, doch das begleitende kleine Mädchen protestierte: ›Mama, nimm nicht diesen Schädel, ich will einen mit Zähnen haben.‹ Kinderschädel sind nicht aufzutreiben. ›Alle fragen danach‹, sagte der Aufseher zu mir.« (Roger Peyrefitte, »Vom Vesuv zum Ätna«.)
Roger Peyrefitte war hier 1952, als der Totenkult noch nicht verboten war. Warum hat die katholische Kirche ihn untersagt? Weil er an Heidentum erinnert? Aber was erinnert an den christlichen Bräuchen nicht daran? Oder teilt die Kirche die Abneigung gegen die Toten, die die meisten Menschen haben? Oder weil die Knochen des gemeinen Volkes von den wirklichen Reliquien ablenken? Oder weil sie eigentlich nicht glaubt, dass das Jenseits wichtiger ist als das Diesseits? Warum auch immer. Der verbotene Kult dringt durch die Tuffwände.
Neapel scheint keine irrationale Furcht vor den Toten zu haben.
»… das Totsein ist mühsam …«, Rilke. Das tibetanische Totenbuch und das altägyptische Totenbuch sind Ratgeber fürs Totsein. Brauchen unsere Toten unsere Unterstützung? Man begleitet sie auf ihrem Weg durch die Jenseitskorridore nicht immer uneigennützig. Oft glauben Menschen, auch solche, die keine volkstümlichen Kulte und überhaupt keine Religion praktizieren, ihre Verstorbenen würden ihnen bei den irdischen Angelegenheiten helfen können. Sie können das nicht. Sie haben hier keine Macht. Sie sind schutzlos, passiv, ausgeliefert, sind in unserer Macht.
Elias Canetti: »Die Toten haben vor den Lebenden Angst. Die Lebenden aber, die es nicht wissen, fürchten die Toten.«
10. November
Neapel, wo ich von einer nicht russischen und nicht deutschen Sprache umgeben bin, passt zum Sprachverlust, der Olegs Tod für mich ist.
Während des Podiumsgesprächs fragte Valentina di Rosa, die mich nach Neapel eingeladen hatte, warum ich Prosa auf Deutsch und Gedichte auf Russisch schreibe. Ich sagte, dass für mich das Schreiben von russischen Gedichten nach Olegs Tod jeden Sinn verloren hat. Danach wie im Oktober: Ich bin auf der Bühne und performe Schmerz-Stand-up.
Im theatralischen Neapel ist diese Schamlosigkeit, die Trauer, fast gerechtfertigt.