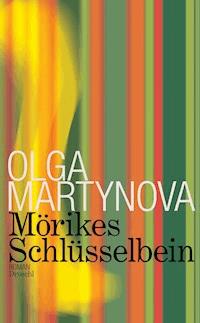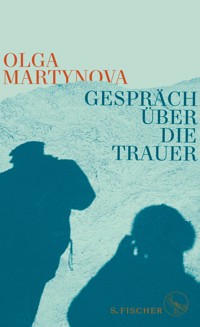18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Wir sehen die Gegenwart gar nicht. Noch nicht.« In welcher Zeit leben wir? Was verändert sich gerade, in Deutschland, in Europa, weltweit? Kann Literatur überhaupt etwas zur Erkenntnis der Gegenwart beitragen? Welche Rolle spielt die Vergangenheit dabei? Und sollte die Literatur wieder politischer werden? Olga Martynova reist ins heutige Jerusalem und zurück in die Sowjetunion der achtziger Jahre. Sie trifft Künstler und Intellektuelle auf der Krim, und immer wieder wirft sie die Frage auf, wie heutige Literatur den Schrecken des 20. Jahrhunderts gerecht werden kann. Im Reisegepäck hat sie dabei Autoren wie Joseph Brodsky und Paul Celan, Ossip Mandelstam und Ovid. Olga Martynovas Essays sind hellwach und hoch reflektiert. Es sind literarische Grenzgänge zwischen Gegenwart und Vergangenheit, sensible Momentaufnahmen unserer unruhigen Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Olga Martynova
Über die Dummheit der Stunde
Essays
Über dieses Buch
Was verändert sich gerade, in Deutschland, in Europa, weltweit? Kann Literatur überhaupt etwas zur Erkenntnis der Gegenwart beitragen? Welche Rolle spielt die Vergangenheit dabei? Und sollte die Literatur wieder politischer werden? Olga Martynova reist ins heutige Jerusalem und zurück in die Sowjetunion der achtziger Jahre. Sie trifft Künstler und Intellektuelle in ihrer Heimatstadt St. Petersburg und auf der Krim, und immer wieder wirft sie die Frage auf, wie Literatur mit den Schrecken der Zeit und der Tragik des Lebens umgeht. Im Reisegepäck hat sie dabei Autoren wie Joseph Brodsky und Paul Celan, Ossip Mandelstam und Ovid. Olga Martynovas Essays sind hellwach und hoch reflektiert. Es sind literarische Grenzgänge zwischen Gegenwart und Vergangenheit, sensible Momentaufnahmen einer unruhigen Welt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Olga Martynova, 1962 bei Krasnojarsk in Sibirien geboren, wuchs in Leningrad auf und studierte dort russische Sprache und Literatur. 1991 zog sie nach Deutschland. Sie schreibt Gedichte (auf Russisch) und Essays und Prosa (auf Deutsch). Mit ihrem Romandebüt »Sogar Papageien überleben uns« (2010) kam sie auf die Longlist des Deutschen Buchpreises und auf die Shortlist des aspekte-Literaturpreises. 2011 erhielt sie den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis und den Roswitha-von-Gandersheim-Preis. Für ein Kapitel aus ihrem Roman »Mörikes Schlüsselbein« gewann sie 2012 den Ingeborg-Bachmann-Preis. 2015 erhielt sie den Berliner Literaturpreis und hatte die Heiner-Müller-Gastprofessur für deutschsprachige Poetik an der FU Berlin inne. 2016 erschien ihr dritter Roman »Der Engelherd«. Olga Martynova lebt mit ihrem Mann, dem Autor Oleg Jurjew, in Frankfurt am Main.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: KOSMOS, Büro für visuelle Kommunikation, Münster
Coverabbildung: Valentin Alexandrowitsch Serow, »Raub der Europa«, AKG-Images
ISBN 978-3-10-403540-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
I Mein Geranienfrieden
Jerusalem oder Where are you from? oder Wie ein Dritter Ort Ihren Herkunftsort bestimmen kann
Der ewige Salat
Das neue alte Moskau: Die gefundene Zeit
Von Wenitschkas Denkmal zum Roten Platz
Vom Roten Platz zur Biennale der Dichter
Von der Biennale der Dichter zu den Arbeitszimmern des Literaturbetriebs
Und zurück zum Roten Platz
Reise in die drei Jahrzehnte
So viel ist so rasch geschehen, dass die Zeiten sich drängen
Kleine hübsche Zaren sind gekommen
Ein furchterregender Großer Peter
Eine Stadt voller Mythen
Die Hauptstadt der russischen Dichtung
Sieben schneeweiße Katzen
Heizer und Straßenfeger
Friedhöfe und Kinderspielplätze
Good-Bye, America, Oh
Christ ist erstanden. Auch in Russland
Warum Strassenbahn? Warum Lissabon?
Borschtsch, Schtschi und Brodsky
Die Russen, die Borschtsch-Usurpatoren
Joseph Brodsky als russischer Chauvinist
Gefährliche Geschenke
Das Sklavenblut
Verpasste alte Chancen
Neue alte Chancen
Ungeheuer von Helsinki
Von Öffentlichkeit und Verborgenheit
Mein Geranienfrieden
II Essayistische Fragmente
Probleme der Essayistik
Wer spricht aus einem Mund, der Wörter wie etwa »Elite«, »Demokratie«, »Volk«, »Europa«, »Politik« oder »post-« ausspricht?
Elite und Ohnmacht
Homo centonicus
Weltbürger auf der Flucht (Die Sprache und das Gewissen)
Gutmenschen? Gute Menschen? »Wir«?
Wer ist hier der Stier? Und wer das Mädchen?
Vox populi (Vox Dei?)
Den Schwimmkäfer zu Ende denken (oder lieber nicht?)
Kastanie, blühe!
Über die Dummheit der Stunde
Über den Patriotismus
Die andere Seite der Medaille
Meilensteine. Intelligenzija und Macht
West-Östliches Spiegelkabinett
Lob des Smalltalks
III Gebratene Nachtigallen
Mandelstam und Europa. Ein imaginäres Schicksal
Begegnung im Spiegel
Aufgeklärter Vampirismus
… ist selbst der bittere Kren wie Himbeere
Flaschenpost versus Flaschenpost
Gagaku
Flaschenpost
»Flaschenpost« versus »Flaschenpost«
Kassiber
Mich erreicht ein Kassiber
Vorlieben des Ozeans
Adressat und Empfänger
Der Flaschenhals
Das Leben hat über den Tod gesiegt, auf eine mir unbekannte Weise
Das digitale Babel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Die Zeit als Haustier
Pornographie der Vögel
Gebratene Nachtigallen
IV Der goldene Apfel der Zwietracht Krim-Tagebuch 2017
August/September
Die Reise
26. September
27. September
28. September
29. September
30. September
1. Oktober
2. Oktober
3. Oktober
4. Oktober
5. Oktober
6. Oktober
7. Oktober
8. Oktober
9. Oktober
Anhang
Quellenverzeichnis
Literaturhinweise
IMein Geranienfrieden
Jerusalem oder Where are you from? oder Wie ein Dritter Ort Ihren Herkunftsort bestimmen kann
In allen Ländern der Welt stellt man Ihnen gleich ab dem Flughafen dieselbe Frage (Taxifahrer, Kellner im Café, Verkäufer im Supermarkt, Menschen auf der Straße): »Where are you from?« Ich antworte immer: »I am from Russia.« Eventuell höre ich ein paar höfliche Komplimente zur russischen Sprache/Seele/Küche oder ein paar herzliche Mitleidsbekundungen anlässlich des Klimas/Putins/Alphabets, oder man fragt mich, ob in Russland auch Weihnachten gefeiert wird. Nachträglich frage ich mich, warum ich eigentlich so antworte, da ich doch seit dreißig Jahren in Deutschland lebe und nur selten Russland besuche, auch wenn ich mit starkem russischen Akzent spreche. Aber die Frage schien mir nie wichtig genug, dass es sich gelohnt hätte, weiter darüber nachzudenken.
Als ich das letzte Mal in Jerusalem war, konnte ich jedoch in dieser Sache eine überraschende Selbstbeobachtung machen. Dem Taxifahrer, der mich vom Ben-Gurion-Flughafen nach Jerusalem fuhr und »Where are you from?« fragte, sagte ich: »I am from Germany.« Na ja, dachte ich, ich lebe doch seit bald dreißig Jahren in Deutschland, klar, logisch. Der Taxifahrer erzählte mir, dass seine Frau und er mal in den Schwarzwald fahren möchten. Ich konnte das nur empfehlen, selbstverständlich. Auch in Cafés, in Läden und bei den Gesprächen sonst war die Antwort »I am from Germany«, ohne dass ich mir Gedanken darüber machen musste. Als ich in Yad Vashem (»Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust«) gefragt wurde, in welcher Sprache ich den Audioguide haben möchte, und »German« antwortete, war ich aber wirklich erstaunt: Da ich immer wieder etwas für mein armes Englisch zu tun versuche, wähle ich in allen Museen der Welt Audioguides auf Englisch.
Und da musste ich darüber nachdenken. Ich kam zu dem Schluss, dass meine diesmal andere Antwort nichts damit zu tun hat, dass ich nun schon lange genug in Deutschland lebe, sondern damit, dass ich mich vor der geschichtlichen Verantwortung nicht drücken will, die ich zusammen mit der Wahl der deutschen Sprache für meine Romane auf mich genommen habe. Ich will nicht sagen: »Ich habe nichts damit zu tun.« Wie ich auch nie über russische Angelegenheiten sage: »Ich habe nichts damit zu tun.«
Jerusalem mit seinen perlmuttgelben Bergen und vom Licht überschwemmten Tälern brachte mir diese Klarheit. Und nahm mir die Klarheit, was ich von nun an überhaupt antworten werde, wenn man mich, sagen wir in Spanien, »Where are you from?« fragt. Mal sehen. Aber unabhängig von dem Ort finde ich, dass Aussagen nach dem Muster: »Ich schäme mich, Deutscher zu sein« oder »Ich schäme mich, Russe zu sein« dem Versuch gleichkommen, sich vor der Verantwortung zu drücken und auf bequeme Weise ein unlösbares Problem zu lösen. Es geht im Leben sehr oft darum, mit einem unlösbaren Problem leben zu müssen. Vielleicht hat diese Stadt deshalb ihre magische Anziehungskraft: Sie ist selbst ein unlösbares Problem, wie jedes Leben ein unlösbares Problem ist.
Der ewige Salat
WEIHNACHTEN:
Farbe: Dunkelgrün, Gold, Silber
Licht: Kerzen
Geruch: Nadelbaum, Zimt, Zitrusfrüchte, Bratäpfel
Ton: Glockenläuten
Tastgefühl: Geschenkpapier, seiden, samtig; Nadelbaum, stachelig
Geschmack: Gans, Plätzchen
SILVESTER:
Farbe: Bunt von Konfetti und Knallbonbons
Geruch: Sekt, der die Nüstern kitzelt, Schnee, Feuerwerkspulver
Geräusch: Sektgläser, Feuerwerksknall, Zischen vom Bleigießen
Tastgefühl: Heiße Spuren von zu nah an die Finger gekommenen Zündhölzern
Geschmack: Karpfen blau, Heringssalat gegen den Kater
WEIHNACHTLICHE FRAGEN an mich
(kommen alle Jahre wieder wie Weihnachten selbst):
Wie macht ihr das eigentlich in Russland?
Habt ihr Weihnachten wie wir?
– Jawohl, aber der Heiligabend ist bei uns nicht am 24. Dezember, sondern am 6. Januar.
Schmückt ihr auch einen Tannenbaum und verteilt Geschenke?
– Ja, aber nicht am Heiligabend, sondern zu Silvester.
Und wann feiert ihr Silvester?
– Am 31. Dezember natürlich, wie alle anderen auch.
Also feiert ihr Neujahr vor Weihnachten?
Der deutsche Freund ist etwas durcheinander und erwartet Erklärungen.
… Vor dem Umsturz im Oktober 1917 war die Weihnachtszeit in Russland genauso wie im übrigen Europa. Deshalb konnte Tschaikowsky problemlos ein Ballett nach dem »Nussknacker« von E.T.A. Hoffmann komponieren, dessen Atmosphäre den russischen Kindern genauso vertraut war wie den deutschen. Nur hatten die russischen Kinder sämtliche Festlichkeiten mit zwei Wochen Verzögerung. Wir lebten ja nach verschiedenen Kalendern. 1918 entschloss sich die neue, bolschewistische Regierung für einen Wechsel zum gregorianischen, also »progressiven«, »europäischen« Kalender. Die russisch-orthodoxe Kirche, die ungefähr zur gleichen Zeit vom Staat getrennt wurde, lebt bis heute nach dem julianischen Kalender, den sie viel schöner findet, weshalb sie ihre Mission darin sieht, ihn für die Menschheit zu retten. Spuren der julianischen Zeitrechnung gibt es übrigens nicht nur in Russland. Als 1582 Papst Gregor XIII. den neuen Kalender einführte, beharrten die protestantischen Länder zunächst auf dem alten und akzeptierten die Zeitreform nur langsam. Am standhaftesten blieben dabei die Schweizer. Heute noch feiern sie in einigen protestantischen Gebieten den Jahresbeginn in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar, mit viel Lärm, Masken, Tanzen und allem, was zu einem Volksfest gehört. Sie haben dafür das schöne Wort »Silvesterklausen« und haben überhaupt nicht vor, darauf zu verzichten.
In Russland rutscht man nach staatlichem Kalender in der Nacht vom 31. Dezember zum 1. Januar ins neue Jahr. Religiöse Feiertage begeht man jedoch nach dem julianischen Kalender, so dass der Heiligabend am 24. Dezember dem 6. Januar nach heute üblicher Zeitrechnung entspricht. Aber die Geschichte hat uns gelehrt, dass Kerzen und Geschenke in erster Linie dazu da sind, die dunkelsten Tage des Jahres zu erleuchten, ihnen die erwartungsvolle und etwas märchenhafte Atmosphäre zu verleihen. Wie Lichter, Masken und Ratschen bereits in den vorchristlichen Zeiten die Dämonen aus dem unheimlichen Winterdunkel vertrieben.
Für die Kommunisten war all das nicht sonderlich wichtig: Weihnachten wurde ohnehin für rückständig erklärt. Die Tannenbäume wurden in den 1920er Jahren abgeschafft, wer dennoch einen wollte, stellte ihn heimlich und bei dicht vorgezogenen Gardinen auf (draußen, im Dunkeln, lagen die kommunistischen Dämonen auf der Lauer). Doch Tyrannen sind launisch und unberechenbar. 1936 hieß es plötzlich: Auch die sowjetischen Kinder sollen ein Neujahrsfest mit Tannenbaum und Geschenken haben. Natürlich freuten sich die Menschen über ein Stück Normalität. Für lange Zeit blieb der Jahreswechsel das einzige Fest, das mit keiner Ideologie verbunden war. Ein Tag der Familientreffen: Wärme, Liebe und Freude, kindliche Erwartung eines Wunders, Geschenke unter dem Tannenbaum. Ein Festtisch, für den die besten Lebensmittel seit spätestens Sommer zurückgelegt wurden: Eingelegtes Gemüse, Schokolade, Sekt standen in der Anrichte, und jeder in der Familie wusste, dass all das für Neujahr ist, also früher nicht zu berühren. In den entferntesten Ecken der Schränke versteckten die Familienmitglieder die Geschenke voreinander. Als Kind wusste ich immer, wo mein künftiges Geschenk verstaut worden war, habe aber nie geschaut, was es war, um den Erwachsenen die Freude, mich zu überraschen, nicht zu nehmen.
Aber wirklich Weihnachten zu feiern … Na ja. Da kommt mir eine Episode aus der Zeit von Chruschtschows »Tauwetter« in den Sinn: In rührender Sorge um die Allgemeinbildung der sowjetischen Kinder hatte man entschieden, eine Bibeladaption herauszugeben. Den Auftrag hatte der berühmte Kinderautor Kornej Tschukowsky bekommen. Die strengste Vorbedingung dieser Publikation war die konsequente Auslassung der beiden Wörter »Juden« und »Gott«. Jeder Gott war genauso halbverboten wie das jüdische Volk. Das führte dazu, dass jede Religion im Bewusstsein der Menschen eher mit der allgemeinen Freiheitsidee (!) verbunden war als mit ihrem eigentlichen Inhalt. Und Weihnachten zu feiern war eine Art Fronde, ein Protest gegen die Kommunisten. Manche machten das am 24. Dezember, was bedeutete, dass sie westlich orientiert waren oder ausländische Freunde hatten (was aus Sicht der Obrigkeit viel schlimmer war, als an Gott zu glauben). Manche feierten am 6. Januar, das waren russisch-orthodoxe Gläubige, die allen Bräuchen streng folgten. Manche berücksichtigten beide Daten: Sie feierten oder sie protestierten gerne oder beides. Aber das waren wirklich nur wenige, die Mehrheit freute sich auf das Neujahrfest, das sehr weihnachtlich aussah. Der Tannenbaum stand bis zum »alten Neujahr«, also bis zum 14. Januar.
Heute ist es in Russland erlaubt, alles zu feiern. Das bedeutet, heute nehmen alle an allem teil. Wenn die Deutschen den Winterfeiertagen »Adieu!« sagen, nach einem kritischen Blick in den Spiegel beginnen, ans Fasten zu denken, und sich voll guter Vorsätze endlich in den Alltag stürzen, sind die Russen mitten in den Feierlichkeiten. Viele – nicht nur Katholiken und Protestanten, sondern auch jene, die es mit dem Beginn des großen Feierns eilig haben – beginnen mit der »katholischen« Weihnacht am 24. Dezember. Alle feiern natürlich Silvester und Neujahr. Dem folgt dann das Weihnachtsfest am 6. Januar. Damit hat das alles jedoch noch kein Ende, denn jetzt kommt das »alte Neujahr« (wie in der protestantischen Schweiz): Alle, die noch Kraft zum Feiern haben, verabschieden in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar die Winterfeiertage mit noch einem kleinen Fest. Und erst nach diesem Fest beginnt endlich der Alltag des neuen Jahres.
Alle Geschäftsleute im Westen, die mit Russland zu tun haben, wissen: Wenn du eine Angelegenheit bis zum 20. Dezember nicht erledigt hast, dann musst du bis Mitte Januar warten.
RUSSISCHES WEIHNACHTS-NEUJAHRS-WEIHNACHTS-NEUJAHRSFEST:
Farbe: Dunkelgrün, Gold, Silber, Kerzenlicht/Bunt von Konfetti und Knallbonbons
Geruch: Zimt, Zitrusfrüchte, Bratäpfel/Schnee; seitdem man auch in Russland um Silvestermitternacht draußen die Feuerwerksraketen anzündet, Feuerwerkspulver
Geräusch: Glockenläuten/Champagnergläser, Feuerwerksknall, Zischen vom Wachsgießen (wir gießen Wachs, nicht Blei)
Tastgefühl: Geschenkpapier, seiden, samtig; Nadelbaum, stachelig/Heiße Spuren von zu nah an die Finger gekommenen Zündhölzern
Geschmack: Gans, Stör, Plätzchen/Salzgurke gegen den Kater, DER SALAT
DAS IST DAS WICHTIGSTE: DER SALAT!
Wie bitte?, sagt der deutsche Freund etwas verdutzt. Der Salat? Was für einer?
Auf all diesen Festen wird »Der Salat« gegessen, solange der Vorrat reicht. Und der Vorrat ist groß. Auch bei mir zu Hause, hier in Frankfurt. Auch bei den Russen, die in den USA, in Israel, Australien oder Japan leben.
In Zeiten spätsowjetischer Mangelwirtschaft scherzte man: »Keiner braucht heutzutage einen Zauberkessel, um zu sehen, welche Speisen auf den Herdplatten der Stadt zubereitet werden.« Denn bei allen gab es das Gleiche: das, was die staatlich gesteuerte Wirtschaft anbot. Heute hingegen gibt es in Russland nur ein Gericht, das obligatorisch auf den Neujahrstisch gehört. Wenn das festliche Menü besprochen wird, sagt man: Als Vorspeise machen wir den Salat … Dann noch Auberginensalat, Eier-Käse-Salat, frutti di mare … DER SALAT ist der berühmte, in Russland unter dem Namen »Olivier« bekannte »russische Salat«, von dem ein Moskauer Lyriker meinte, er habe durch die Vereinigung aller seiner Zutaten suchterzeugende Wirkung. Das stimmt: Auch ein Nichtrusse wird ganz schnell danach süchtig, wie ich mehrmals beobachten konnte.
DER SALAT hat eine lange Kulturgeschichte. Im 19. Jahrhundert gab es in Moskau ein schickes Restaurant mit einem französischen Koch namens Olivier. Dieser komponierte ein kompliziertes Gericht aus verschiedenen Fleischsorten, Haselwild, Krebsen, Krabben und Eiern mit Mayonnaise als Beilage. So wie sich der Tannenbaum – als Brauch am russischen Zarenhof im 19. Jahrhundert von deutschen Prinzessinnen eingeführt – schnell unter den Leuten verbreitete, so kam auch bald der Salat Olivier auf jedermanns Tisch. Der orthodoxen Kirche waren die Christbäume als fremde Sitte zunächst suspekt. Die Kommunisten verpönten Olivier als bourgeoises Gericht. Doch das Volk entschied selbst, für den Tannenbaum und den Salat. Was kann einem Tannenbaum schon passieren? Selbst der Bethlehemstern auf der Baumspitze überlebte die Jahre der kommunistischen Diktatur getarnt als roter Stern. Zu ihm gesellten sich andere Schmuckfiguren: Kosmonauten, Flugzeuge … Und doch bleibt der Tannenbaum im Grunde immer der gute alte Christbaum. Mit dem Salat lief es ein bisschen anders: Sein französischer Name und aristokratischer Ursprung sicherten ihm einen Platz auf dem Neujahrstisch des kleinen Mannes. Mit dem ursprünglichen Gericht hatte der »neue Olivier« jedoch kaum etwas gemein: Erstens war das Originalrezept so gut wie geheim, und zweitens waren die Zutaten für die meisten Leute ohnehin unerschwinglich.
Dafür sind die endgültige Variante und ihre Variationen weit verbreitet. Ein so wunderbares Gericht musste auch außerhalb Russlands Karriere machen, genauso wie der Tannenbaum aus Deutschland (so nimmt man zumindest an) in so viele Länder kam.
Der Heidelberger Lyriker Hans Thill hat für mich eine kleine Geographie des Russischen Salats geschrieben:
»du wirst lachen, wir kennen diesen salat als italienischen salat, eine partyspeise der sechziger jahre als ein mann noch 1 dicken bauch haben musste, um was zu gelten. zusammen mit 2 eierhälften hiess dasselbe gericht aber russische eier. und in frankreich heisst er (jetzt wieder ohne eierhälften) macédoine de légumes also mazedonischer salat (ohne fleisch). in spanien hingegen: ensaladilla rusa also russisches salätchen, mit thunfisch und meeresfrüchten, ein dick mit mayonnaise überstrichener haufen an jeder bar, wird als tapa oder ración auf einen grösseren oder kleineren teller geschaufelt. alle lesarten dieses gerichts esse ich gern, die meisten habe ich schon selber hergestellt.«
So geht die Geschichte weiter; was Hans Thill noch nicht weiß: Eine rumänische Freundin nennt ihren »russischen Salat« »Salade du bœuf«, obwohl er kein Rindfleisch enthält, sondern das übliche Hühnchen.
Selbst in sorgfältigst von Hausfrauen geführten kulinarischen Notizbüchern wird man vergeblich nach dem Rezept dieser Volkskreation suchen, denn einen Salat Olivier kann einfach jeder. Deshalb schreibt man es nicht auf, aber gut, ich versuch’s:
Man koche sechs ungeschälte Kartoffeln, dazu zwei Karotten (der Volksmund behauptet, die Karotten seien erst gekommen, als die Krabben zu teuer geworden waren; ein findiger Restaurantchef habe sich gedacht, seine angeheiterten Gäste würden den Schwindel nicht merken) und zwei Eier. Nach dem Abkühlen und Schälen schneide man diese sowie ein paar Salzgurken, einen Apfel und etwas Fleisch (das kann auch Hähnchenbrust oder Wurst sein) oder Krabben oder Garnelen oder – für Vegetarier – nichts in 1 cm große Würfel, dazu gebe man noch eine Dose Erbsen und etwas Salz und Mayonnaise (die man mit etwas saurer Sahne verfeinern kann). Fertig! Guten Appetit und frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!
Das neue alte Moskau: Die gefundene Zeit
(Herbst 2005, Biennale der Dichter)
Von Leningrad her gesehen war Moskau eine Anhäufung grauer Formen um den postkartenroten Kreml, bedrohlich und fast unbewohnbar, obwohl dicht bewohnt. Man bestritt zwar nicht, dass die Moskauer Boulevards in warmen herbstlichen Tagen von einer gewissen Lieblichkeit waren und einige Häuser nicht ohne morsche Eleganz, aber insgesamt: Für mich war das eine triste Stadt, die nie wieder so sein würde, wie sie – schenkt man den Büchern Glauben – einst war. Im 19. Jahrhundert galt Moskau als ein schläfriges Nest paschaähnlicher Grundbesitzer und langbärtiger Kaufleute. Der scharfzüngige Liberale und spätere politische Emigrant Alexander Herzen schrieb 1840, Moskau, die gigantische Wucherung eines reichen Marktfleckens, habe sich Russlands weniger dank der eigenen Vorzüge bemächtigen können als vielmehr aufgrund dessen, dass die anderen Teile Russlands einen noch größeren Mangel an Vorzügen gehabt hätten. Das damals hauptstädtische Petersburg war für ihn einerseits zu hart und kalt, andererseits erfrischend munter und sachlich: »In Petersburg sind alle Menschen insgesamt und jeder einzelne insbesondere hundsmiserabel. Petersburg kann man nicht lieben, jedoch fühle ich so, dass ich in keiner anderen Stadt Russlands leben würde«, schrieb er und ließ sich in London nieder.
Nun bin ich nach fünfzehn Jahren zum ersten Mal wieder nach Moskau gekommen: Mein Mann, Oleg Jurjew, und ich waren zum Poesiefestival »Biennale der Dichter« eingeladen.
Auf vieles waren wir gefasst, nur darauf nicht: Trotz allem sieht man heute, was man lange Zeit nur aus der Literatur wusste: Moskau ist eine nahezu gemütliche, geschäftige und sich amüsierende Handelsmetropole und nicht die gravitätische Hauptstadt einer Weltmacht, als die es seit 1918, als die Kommunisten den Regierungssitz aus Petrograd nach Moskau verlegt hatten, missbraucht wurde. Moskau löst allmählich die sowjetische Maske ab von seinem Gesicht. Ich kenne keine andere Stadt, der die Straßenwerbung so gut steht. Auch die emsig verschnörkelten Springbrunnen, neuen Türme und Türmchen und die heiligen George. Auch die neuen Denkmäler überall, die zu errichten eine Volkskrankheit zu sein scheint: Puschkin und seine Frau Natalie in einer Gartenlaube aus Gusseisen und Gold; der Liedermacher Wysozky mit Gitarre; Sergej Jessenin mit einem winzigen Pegasus zu seinen Füßen. Und es gibt sogar ein Denkmal für einen Schmelzkäse. Nichts ist dem Moskau von heute zu kitschig, es lebt jenseits von solchen Begriffen.
Als Petersburgerin werde ich oft wegen des Antagonismus zwischen Moskau und Leningrad/Petersburg angesprochen. »O nein«, antworte ich, »auch in Moskau kommt einmal in fünfzig Jahren ein guter Dichter zur Welt.« Das ist Smalltalk. Aber in den 60er Jahren wurden in Moskau Jewtuschenko und Wosnessenskij zu Ausstellungsstücken der sowjetischen Kulturpolitik, während der künftige Nobelpreisträger Joseph Brodsky in Leningrad als Schmarotzer verurteilt wurde. In Petersburg leben einige Dichter immer noch von den legendären Undergroundjobs: Nachtwächter, Wächter, Heizer. In Moskau hilft man einander bereitwilliger (und erwartet auch die Gegenleistung). Im 19. Jahrhundert war die Rede von Petersburger Sachlichkeit und Moskauer Idealismus. Seit 1918 ist es genau umgekehrt. Eine Hauptstadt bietet mehr Möglichkeiten, geschäftstüchtig zu sein. Aber ohne die Sowjetmacht wirkt die Moskauer Tüchtigkeit viel sympathischer. Unsere jungen Dichterkollegen aus Moskau scheinen echtere Moskauer zu sein als die unseres Alters.
Von Wenitschkas Denkmal zum Roten Platz
Eine Moskauer Geste, einladend, etwas gleichgültig, die (im Unterschied zu dem Petersburger kühlen und wählerischen Getrenntsein) zur Bildung einer warmen, lockeren Gemeinschaft führt. Wir folgen der Geste und schließen uns nach der Eröffnungsveranstaltung einer etwa zwanzigköpfigen Schar an. Anreger des nächtlichen Marsches ist der achtundzwanzigjährige Autor Danila Dawydow. Wir gehen zum Denkmal für Wenedikt Jerofejew, das aber nicht ihn, den legendären Schöpfer einer Moskauer Saufsaga, »Reise nach Petuschki«, darstellt, sondern seinen Helden Wenitschka und dessen Liebste. Jedes Mal, wenn Wenitschka zum Roten Platz will, findet er sich am Kursker Bahnhof wieder und fährt nach Petuschki, wo seine Geliebte wohnt. Erst sollte der schlotterige Wenitschka in seinem zerknitterten Anzug am Kursker Bahnhof stehn und seine kerzengerade Schöne mit dem auf den üppigen Busen geworfenen Zopf – in Petuschki. Die Verwaltung der Russischen Bahn meinte jedoch, das sei Propaganda für den Alkoholismus, und lehnte die sichere Geldquelle ab, die die Pendelwallfahrt gewesen wäre. Auch gut. So erspart man sich die 120 Kilometer lange Fahrt ins Blaue, wer will, kann ja auch blau werden, ohne Moskau zu verlassen. Aber niemand ist besoffen. Unterwegs wurde in einem Lebensmittelladen (sie haben beinah alle rund um die Uhr auf) eingekauft: Bier, Saft, Gin-Tonic-Dosen. Gesprächfetzen: Balladen haben Aussicht auf Erfolg./Ich schicke dir das Gedicht morgen als SMS./Nein, ich meine das gesamte Bild. Ein Milizwagen mit geöffneten Fenstern fährt langsam vorbei, hört zu, kein Interesse, verlässt den Platz.
Plötzlich hasten alle: Die U-Bahn schließt in Kürze. Niemand zieht in Erwägung, ein Taxi zu nehmen, Poeten leben bescheiden, selbst im reichen Moskau. Noch absurder aber wäre für einen Moskauer die Idee, zu Fuß zu gehen, selbst bei kleinsten Entfernungen. Unser Hotel ist ja am Roten Platz, und der Geist des Kursker Bahnhofs schwebt drohend vor uns. Nach einigem Kreisen fragen wir einen neben seinem Auto rauchenden Taxifahrer nach dem Hotel »Rossija«. »Na, da schaunse ma hoch«, sagt er. Am Himmel steht in roten Lettern »ROSSIJA«.
Vom Roten Platz zur Biennale der Dichter
Die Lyrikerin Natalja Gorbanewskaja war eine der wenigen, die 1968 am Roten Platz gegen den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei protestierten. Sie lebt seit 1976 in Paris. »Na, wie gefällt dir dieser Graus?« – Eine alte Freundin von ihr zeigte mit etwas wie masochistischem Stolz auf die originalgetreu wiedererrichtete Erlöserkathedrale (jahrzehntelang jammerten die Moskauer, dass ihnen die Kirche weggesprengt worden war, nun sind sie sauer, dass das Gebäude kein Meisterwerk ist) und auf die Schiffsegel des taktlosen Denkmals für Peter den Großen, der Moskau einst seine Bedeutung wegnahm. Der Bildhauer, Surab Zereteli, verschenkt Früchte seiner übernatürlichen Produktivität gegen den Willen (und Widerstand) der Bescherten und ist der Schreck der Städte. Wenn ich sage, dass ihm manches, z.B. Gogol in Rom, gelungen sei, riskiere ich nichts: Alle nehmen an, das sei ein snobistischer Scherz von mir. »Wunderschön«, antwortet Natalja Gorbanewskaja, die als gelernte Dissidentin nicht zu Verklärungen neigt: »Schau, wie haben die Pariser über den Eiffelturm oder das Centre Pompidou geschimpft! Und heute sind sie allen lieb!« (Möge so auch die trockene preußische Eleganz Berlins den Potsdamer Platz liebevoll kaschieren, denke ich dabei.)
»Ich war heute bei sechs Lesungen!«, sagt ein junger Mann am späten Abend in einem der vielen Moskauer Café-Clubs. Unser Biotop damals, im Frost der spätsowjetischen Epoche, waren die Wohnungsküchen, wo bis weit nach Mitternacht gesprochen wurde, nicht Cafés und Restaurants. Heute sind sie voll von jungen Menschen, Studenten: Fünf Mädchen an einem Tisch streiten heftig, wie man das lateinische »C« aussprechen muss: Zizero oder doch Kikero; eine der Freundinnen, beeindruckt von ihrer Italienreise, schlägt Tschitschero vor.
Der Eintritt zu den Lesungen ist gratis und oft auch das Büfett (für meinen Geschmack bekommen die Jungs zu viel Wodka, aber der einzige private Sponsor der Biennale der Dichter ist ein Spirituosenkonzern, der den Wodka »Stichotwornaja« – wörtlich: Versschöpferischer – zur Verfügung stellt, alles andere finanziert die Moskauer Regierung). Die Tür ist immer offen, alle kommen und gehen, das scheint niemanden zu stören. Die Moderatorin sagt, bevor der deutsche Lyriker Gerhard Falkner die Bühne besteigt: »Schalten Sie bitte Ihre Handys aus, unsere deutschen Gäste sind daran nicht gewöhnt.«
Zur Sowjetzeit schienen die Emigranten ins Jenseits zu gehen, über den Styx. Die im Diesseits Gebliebenen hatten zwar ein riesiges Territorium um sich, ein Sechstel des Festlandes, wie es hieß, waren aber doch eingesperrt, wohin auch immer sie sich auf diesem Sechstel begaben, zu den Schlössern des Baltikums, zu den Minaretten Samarkands oder den buddhistischen Klöstern am Baikalsee. Nach der Wende begann eine Bewegung in alle Himmelsrichtungen. Aber viele sind ins Ausland geraten, ohne sich vom Fleck zu rühren: in den ehemaligen Sowjetrepubliken. Nicht nur die dort lebenden Russen schreiben Russisch, auch Usbeken, Armenier oder Ukrainer. Man fühlt sich erinnert an die späte und posthume k.u.k.-Kultur: an das Aufblühen der deutschsprachigen Literatur in Böhmen und Mähren oder in der Bukowina. Nicht zufällig ist die Donaumonarchie heute ein Modethema in Russland.
Die Anthologie »Der befreite Ulysses« umfasst 244 im Ausland lebende russische Lyriker aus 26 Ländern. 21 von ihnen kamen zur Biennale. Auch sie nutzen die Gelegenheit, einander zu hören, Leonid Schwab und Gali-Dana Singer aus Israel, Andrej Poljakow von der Krim, Polina Barskowa aus den USA, um einige zu nennen. Bahit Kendschejew, ein in Kanada lebender Lyriker kasachischer Abstammung, sagt, diese Situation bereichere die russische Dichtung. Der Herausgeber der Mammut-Anthologie und einer nicht weniger umfangreichen Anthologie junger Lyrik sowie einer Sammlung mit Gedichten aus der russischen Provinz ist Dmitrij Kusmin. Solche Bücher geben einen Überblick, den die aktuelle Situation von Verlagen, Buchhandel und Kritik sonst kaum ermöglicht. Kusmin begann seine literarische Laufbahn zur Zeit der Wende. Anstatt sich den offiziellen Strukturen oder dem Underground anzuschließen, begründete er mit anderen eine neue autonome Szene, die Internetseite »Vavilon« und einige besonders für junge Lyriker wichtige Bücherreihen. Selbstverständlich gibt es auch andere Internetseiten und Verlage, die die »Vavilon-Bande« nicht unbedingt lieben. Moskau ist eine große Stadt, und in einem regen Literaturbetrieb kann nicht Eintracht herrschen.
Von der Biennale der Dichter zu den Arbeitszimmern des Literaturbetriebs
Wir kommen in die Redaktion einer der »dicken« Zeitschriften. Eine alte Wohnung mit hohen Stuckdecken. Man kocht Tee. Autoren sind willkommen. Vor Jahren (aber schon nach der Perestrojka) wurde hier ein Roman von Oleg Jurjew so zensuriert, dass er das Manuskript zurücknahm. Schuld sei der damalige Chefredakteur gewesen, das komme nicht mehr vor. Liebenswürdigkeit, etwas anachronistisch, der wohlbekannte »Intelligenzija«-Typ. Raubtiere ohne Zähne werden zu Kuschelbären. Einer Raubkatze ähnelte dagegen ein zwanzigjähriges Mädchen, das mich am Vortag nach dem »Runden Tisch über die deutsche Lyrik« ansprach. »Ich bin von (sie nennt ein Glanzmagazin). Deine Handynummer! Mach mir ein Interview mit einem der Deutschen, am liebsten mit Hans!« Verblüfft von so viel Unbefangenheit fragte ich, mit welchem Hans, unter den Teilnehmern – Gerhard Falkner, Monika Rinck, Steffen Popp und Hendrik Jackson – gab es keinen. »Na ja«, sagte sie, »warte, ja, hier«, und sie las stockend aus ihrem zerfetzten Notizbuch: »Hans – ä-ä – Mag – nus – Enz – ä-ä- ensberger!« Die neue Spezies! Glanzillustrierte in Moskau publizieren erstaunlicherweise auch Literatur und können bessere Honorare zahlen als die »Dicken«. Assar Eppel, unser alter Freund und Cicerone an diesem Tag, wird von den »Dicken« gefragt, ob er etwas hat, was für den »Glanz« zu lang ist. Eppels Erzählungen faszinieren mit den Bildern einer untergegangenen, keiner andern mehr ähnlichen Welt eines Moskauer jüdischen Vorortes, in dem er in den 40er Jahren aufgewachsen ist. Vor der Wende war er ein geschätzter Übersetzer, aber seine Prosa konnte er damals nirgendwo veröffentlichen.
Wie alle Moskauer wirkt auch Eppel unschlüssig, ob ihm die neue Architektur in der Stadt gefällt oder nicht. Doch eher ja: Die architektonische Entwicklung der Stadt knüpfe stilistisch eigentlich dort an, wo sie vor hundert Jahren unterbrochen wurde. Im Unterschied zu der asketischen Moderne Petersburgs, die immer das Stadtbild mitbestimmte, war die üppige Moskauer Moderne, sogar das gigantische Hotel »Metropol« mit seinen berühmten Majolikawandbildern, aufgefressen worden vom Sowjetgrau. Heute steht sie da wie frischgewaschen, optisch unterstützt von den zierlichen Türmen und Türmchen der neuen, allseits gescholtenen »Luschkow’schen Architektur« (Luschkow ist der allmächtige Oberbürgermeister Moskaus), welche die Belle Époque nachahmt.
Noch eine große Wohnung, diesmal eine private. Tiefe Sessel, Tee mit Apfelkuchen, Katze, Papagei und Hund. Nina Sadur, eine inoffizielle Berühmtheit der 80er Jahre, verdiente damals ihren Lebensunterhalt als Putzfrau in einem Theater. Heute ist sie eine anerkannte Dramatikerin. Doch das Zeitkarussell dreht sich zu schnell: Moskau ist eine teure Stadt, und am Computerbildschirm hängt eine Brotarbeit, eine Fernsehserie, die sie und ihre Tochter Jekaterina Sadur, eine talentierte junge Prosaikerin, gerade in Arbeit haben. So oder ähnlich geht es vielen Kollegen überall in der Welt. Das tröstet aber nicht. »Sagen Sie«, fragt Nina Sadur, »wird wenigstens posthum alles richtig geregelt?« »Ja«, antworte ich.
Und zurück zum Roten Platz
Der Rote Platz war einst der üppigste Marktplatz Russlands. Ende des 19. Jahrhunderts wurde hier anstelle der Marktbuden ein großes Ladenhaus errichtet, in einem damals modischen und zugleich verlachten pseudorussischen Baustil, der russischen Version des Historismus. So wurde der Platz zu einer breiten Straße zwischen dem Kaufhaus und der Kremlwand. Nichts von dem imperialen Ausmaß, das der Palastplatz in Petersburg oder der Wiener Heldenplatz aufweisen. Dreimal wollte die kommunistische Regierung das Ladenhaus abreißen lassen, um mehr Raum für die Panzerparaden zu schaffen, doch auf geheimnisvolle Weise verhinderte das der kaufmännische Moskauer genius loci. Lewis Carroll beschrieb einmal die schmucke Basilius-Kathedrale am Roten Platz zusammen mit ganz Moskau (seine Russlandreise war seine einzige Auslandsreise, sonst kam er nur mit Alice ins Wunderland):
»Eine Stadt aus Weiß mit grünen Dächern, mit konischen Türmen, die einer aus dem andern emporsteigen wie ein verkürztes Teleskop; mit bauchigen vergoldeten Kuppeln, in denen man wie in einem Spiegel verzerrte Bilder der Stadt sieht; mit Kirchen, die von außen wie Sträuße verschiedener Kakteen aussehen (einige Zweige mit grünen stacheligen Knospen besetzt, andere mit blauen, andere mit roten und weißen).«
Erstaunlich, wie diese Beschreibung auf das heutige Moskau passt.
Wieder gehen wir durch die Nacht zum Roten Platz, der Moskauer Liedermacher Andrej Anpilow, der weißrussische Lyriker Dmitrij Strozew, Oleg Jurjew und ich. Hin und wieder nützen wir das spärliche Licht einer Laterne oder eines Schaufensters, um Gedichte vorzulesen. Ein Milizwagen fährt mit geöffneten Fenstern langsam vorbei, hört zu, kein Interesse, fährt weiter. Der so direkt anmutende Weg zum Roten Platz wird plötzlich von dem Fluss Moskau unterbrochen. Die Männer wären bereit, hinüberzuschwimmen, doch es gelingt mir, sie mit meinen Fragen nach der weißrussischen Literatur abzulenken und auf die Brücke zu locken.
Früher sagte man in Russland über die Emigranten: Jeder bleibt für immer in dem Alter, in dem er ausgereist ist. So gesehen kam ich nach Moskau, um mir – zusätzlich zu meinen anderthalb Jahrzehnten in Deutschland – noch die ihretwegen fehlenden russischen 15 Jahre zu holen. Um – wie Zazie in dem berühmten Roman von Raymond Queneau – älter zu werden. Es ist mir besser ergangen als ihr, der französischen Alice: Sie hat die Metro nicht gesehen. Ich aber wohl und auch den Roten Platz.
Reise in die drei Jahrzehnte
(Herbst 2008, St. Petersburg)
So viel ist so rasch geschehen, dass die Zeiten sich drängen
Seit siebzehn Jahren wird das Land nicht mehr von den Kommunisten regiert, aber die bronzenen Lenins sind noch da. In Petersburg begrüßt dich der erste schon unweit vom Flughafen mit seiner (wohin nur?) weisenden Hand. Sie scheinen keinen zu stören. »A-a, der«, winkt man ab. »Egal. Lieber, sieh mal, was für ein widerwärtiges Haus sie hier gebaut haben!«
Unter allen ihren Namen (St. Petersburg/Petrograd/Leningrad/St. Petersburg) war die Stadt immer ein Symbol des von Peter I. gegründeten anderen, europäisierten Russland. Als ihr die Hauptstadtfunktion 1918 genommen wurde, blieben ihr die majestätischen Paläste, die Kanäle, Theater, Festungen und Kathedralen. Ich bin in dieser Stadt wie in einem Museum aufgewachsen, wie in Pompeji, einem Freilichtmuseum der untergegangenen Zivilisation. Nun verliert die Stadt ihre museale Starre, was nicht alle Petersburger gutheißen. Manch einer sieht selbst die modernen Verbundfenster (statt der Holzrahmen, die den baltischen nassen Wind in die Wohnungen ließen) als eine Verunstaltung der historischen Fassaden an.
In Russland ist so viel in so kurzer Zeit geschehen, dass hier mindestens drei Jahrzehnte gleichzeitig existieren: die spätsowjetischen 80er Jahre, die 90er Jahre des Umbruchs und die heutigen 2000er Jahre (die noch warten auf ihr Prädikat). Und manchmal fühlt man sich auch erinnert an die 60er Jahre, die Jahre der nachstalinistischen Hoffnung.
Kleine hübsche Zaren sind gekommen
Als Gegengewicht zu den Lenins sind plötzlich Zaren da. Auch zur Sowjetzeit beließ man ein paar Reiterstandbilder als Denkmäler der Kunst und Geschichte, jetzt aber kommen »neue« dazu, meist Büsten. Kleine hübsche Zaren mit adretten Schnurrbärten erscheinen in ihren eher marginalen Funktionen als »Gründer«: der Gründer der Russischen Staatsbank Alexander II.; der Gründer des Russischen Museums Alexander III.; der Gründer der Russischen Eisenbahn Nikolaus I. …
Ein furchterregender Großer Peter
Nicht so der thronende Peter I. in der Paul-und-Peter-Festung – als eigentlicher Gründer der Stadt und des modernen Russland. Ein mit seinen unproportionierten Konturen furchterregendes Werk von Michail Schemjakin, dem 1971 aus Leningrad ausgewanderten und in Paris und New York erfolgreichen Underground-Künstler. Von Peter I. als Verteidigungsanlage gebaut, wurde die Festung für zwei Jahrhunderte zu einem politischen Gefängnis und im 20. Jahrhundert zum Museum. Doch manche Räume der riesigen Anlage standen leer wie romantische Ruinen. Im Sommer konnte man in ihnen sitzen, Bier trinken und die funkelnde Newa anschauen; im Winter fauchte der Wind dort und sammelte sich das Regenwasser.
In einem der Ravelins hat vor zwei Jahren Danila Korogodsky, der Sohn des berühmten Leningrader Kindertheater-Regisseurs Sinowij Korogodsky, mit den Schauspielern seines verstorbenen Vaters ein kleines Theater gegründet. Heute ist er ein amerikanischer Professor, aber er verbringt hier jeden freien Monat. Die ersten Renovierungen hat er aus eigener Tasche bezahlt, nun, sagt er, wird das Theater von der Stadt unterstützt. Hinter zwei bereits renovierten Räumen (einem Foyer und einem Saal) folgt eine Gewölbeflucht mit einer Laufbrücke über das knöchelhohe Wasser: »Hier wird der große Saal sein, hier der Proberaum …«
Eine Stadt voller Mythen
Bei einer Bühnenetüde mit der blutroten sowjetischen Fahne, erzählt Korogodsky mit Staunen, fragte eine Schauspielerin, ob es sich gehört, die Fahne so zu behandeln. Korogodskys empörte Rede über Stalins Opfer traf auf höfliches, aber mäßiges Interesse. Überhaupt haben die jüngeren Menschen oft nur vage Vorstellungen von der jüngsten Vergangenheit. Meist wissen sie wohl, dass Stalin ein Verbrecher war. Aber sie wissen beispielsweise nicht, dass ihre Eltern nicht ins Ausland reisen durften (es sei denn, sie gehörten der Parteielite an). Oder dass sie bei den staatseigenen Geschäften stundenlang Schlange stehen mussten, um etwas Essbares zu ergattern. Oder dass alles Gedruckte, sogar Bonbonpapier, zensiert wurde. Sie leben ein viel normaleres und entspannteres Leben, als ihre Eltern es hatten, aber sie wissen es nicht, weil sie keine Ahnung haben, wie es früher war. Die Eltern erzählen kaum davon, weil sie es längst vergessen haben – nach all den einschneidenden Änderungen der 90er Jahre.
Parallel zum offiziellen Leningrad, »der Wiege der Revolution«, hatten wir damals noch eine geheime Stadt – eine Stadt voller inoffizieller Mythen. Da war zum Beispiel das legendäre Stehcafé auf dem Newsky Prospekt, im Volksmund »Saigon« genannt, in den 80er Jahren ein Treffpunkt der künstlerischen Boheme. Mit einem »kleinen doppelten Kaffee« standen hier stundenlang Lyriker und Maler, die im »Hauptberuf« Heizer und Straßenfeger waren, hier erzählten die Theaterleute ohne Theater von ihren imaginären Inszenierungen. Hier erfuhr man, wo eine Wohnungsausstellung stattfindet, in welchem Klub für »Volkskunst« halblegale Rock-Gruppen spielen. Hier konnte man Samisdat-Literatur austauschen. Jeder war überzeugt, dass dieses »Saigon« von Agenten nur so wimmelte, aber das änderte nichts … Das »Saigon« hat die Perestrojka nicht überlebt. In den 90er Jahren wurde in diesem Raum ein Geschäft für italienische Sanitärtechnik eröffnet, heute ist es ein Restaurant (10 Euro für eine Suppe).
Die Hauptstadt der russischen Dichtung
Nicht aus Nostalgie, sondern als Erinnerungsgeste veranstalteten wir, mein Mann Oleg Jurjew und ich, eine Hauslesung in unserer alten Petersburger Wohnung, sozusagen als eine Sitzung des Dichterkreises »Kamera Chranenija«. »Kamera Chranenija«, wörtlich »Verwahrkammer«, das russische Wort für »Gepäckaufbewahrung«, bedeutete für uns in den 80er Jahren eine imaginäre Kammer zur Aufbewahrung unserer Texte, die offiziell nicht erscheinen durften, heute ist das eine bekannte Online-Zeitschrift. Wir lasen einander vor, an einem Tisch, wie vor zweihundert Jahren, vor hundert Jahren, vor zwei Jahrzehnten in dieser Stadt gelesen wurde: Jelena Schwarz, Valerij Schubinsky (wie wir ein Lyriker der nächsten Generation nach dem Underground der 70er Jahre, der Generation von Jelena Schwarz, Alexander Mironow, Sergei Stratanovski – in Russland berühmten Dichtern, die, mit Ausnahme von Jelena Schwarz, im Ausland fast unbekannt sind) und Igor Bulatowsky, noch eine Generation jünger, also Mitte dreißig, ein sehr petersburgischer Dichter.
Solche Lesungen sind selten geworden, sagen die Kollegen. Sehr selten …
Der Leningrader Lyriker Joseph Brodsky beschrieb einmal die Lage eines Autors in der Diktatur und in einem freien Land:
»In beiden Fällen versucht ein Dichter eine ziemlich feste Wand mit seinem Kopf durchzubrechen. Im ersten Fall reagiert die Wand so, dass der physische Zustand des Dichters gefährdet ist. Im zweiten Fall schweigt die Wand, und das gefährdet seinen psychischen Zustand. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was furchtbarer ist.«
Nachdem die Literatur von der Obrigkeit nicht mehr als eine Bedrohung empfunden wird und der Elan der Perestrojka sich gelegt hat, hat der Literaturbetrieb noch nicht zu den neuen Umständen angepassten Formen gefunden. Und die Literaten haben sich noch nicht daran gewöhnt, dass »die Wand« schweigt. Während unseres Treffens mit den jüngeren Kollegen im Achmatowa-Museum fragen wir, wie sie das gegenwärtige literarische Leben empfinden. Sie wirken etwas ratlos, sie sind weder zufrieden mit dem Stand der Dinge, noch können sie sich vorstellen, was zu ändern wäre.
Sieben schneeweiße Katzen
Ein trauriger Besuch des Großen Prospekts auf der Petrograder Seite, gebaut im Stil der Petersburger Moderne, der sogenannten »Nord-Moderne« – im Unterschied zu den üppigen Moskauer Mosaiken und Panneaus ist sie zurückhaltend: dunkler Stein, viel Glas, klare Konturen. In dieser Straße lebte der 2001 verstorbene Lyriker Viktor Kriwulin, dessen Wohnung eines der Zentren der »parallelen«, inoffiziellen Literatur in Leningrad war. Seine Witwe, die erst seit Anfang der 90er Jahre in Petersburg lebende Literaturwissenschaftlerin Olga Kuschlina, verwaltet nicht nur seinen Nachlass, sondern entdeckt unter den Tapetenschichten in dieser Wohnung Spuren der Geschichte: alte Zeitungen, auch vor hundert Jahren in Petersburg erschienene deutsche Blätter (damals lebten in Petersburg viele Deutsche, heute übrigens auch, auch in Moskau, wo es bereits eine deutsche Zeitung gibt) oder die blass geblümten Tapeten, die ein Liebhaber der russischen Avantgarde sofort erkennt, weil ebensolche Tapeten als Papier für eine berühmte futuristische Lyriksammlung von 1910 dienten (u.a. mit Gedichten von Chlebnikow). Sieben schneeweiße Katzen leben hier, einander so gleich, dass ich zuerst dachte, es sei eine einzige, die sich so schnell bewegt.
Ein paar Tage später genießen wir bei Jelena Schwarz, Grande Dame der Petersburger Lyrik, einen ungewöhnlichen Leseabend: Alle tragen nicht eigene Gedichte, sondern Gedichte aus dem 18. Jahrhundert vor. Gekommen sind Dichter verschiedener Generationen und eine junge Slawistin aus der Schweiz, die ihre Diplomarbeit über Jelena Schwarz schreibt und auch ein russisches 18.-Jahrhundert-Gedicht auswendig vorträgt. Jelena Schwarz sagt, dass die immer von der Dichtung beseelte Stadt der Dichtung immer fremder wird. Vielleicht ist es so. Dabei schreiben hier nach wie vor wunderbare Lyriker.
Heizer und Straßenfeger
Der Leningrader Underground der 70er Jahre wurde zur entscheidenden literarischen Anregung der Lyriker der 90er Jahre. Underground-Dichter wurden zu Klassikern, was sich aber kaum auf ihre Lebensumstände auswirkte. Die Literatur ist in dieser Stadt ein unterirdischer Fluss geblieben.