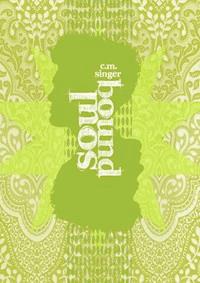
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Ghostbound
- Sprache: Deutsch
Woran glaubst du? Und was bist du bereit, dafür zu opfern? Als die Hintergründe um Daniels Tod ans Licht kommen, steht Elizabeth einmal mehr vor Entscheidungen, von denen nicht nur ihr eigenes Schicksal abhängt. Auf sich allein gestellt, kämpft sie um Daniels Seele und für ihre ungewöhnliche Liebe, die sämtliche Grenzen überwunden hat. Wird sie Daniel endgültig verlieren oder gibt es eine Chance auf ein Leben an seiner Seite? Band 2 der fantastischen Ghostbound-Trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
C. M. Singer
SOULBOUND
Band 2 derGhostbound-Trilogie
© 2013 Amrûn Verlag Jürgen Eglseer, Traunstein
Covergestaltung: Magdalena Braun Lektorat: Asaviel
Alle Rechte vorbehalten
ePub ISBN – 978-3-944729-31-2 Taschenbuch ISBN – 978-3-944729-22-0
Für all meine geduldigen und kritischen Beta-Leser
und meine moralischen Unterstützer.
There’s nothing left for you to give.
The truth is all that you’re left with.
Twenty paces, then at dawn
We will die and be reborn
1
»Elizabeth! Was ist passiert? Bist du verletzt?«
Verletzt? Nein, sie war nicht verletzt. Sie war vernichtet.
In sich zusammengesunken kniete sie auf den kalten Steinplatten und sah zu Wood auf, der, alarmiert von ihrem Schrei, auf die Terrasse des Penthouses gestürmt war.
Sie fühlte sich seltsam distanziert. Der Schmerz, der sie seit dem gestrigen Telefonat mit Sir Thomas fest im Griff gehabt hatte, war einer dumpfen Taubheit gewichen. Als hätte sie jedes Gefühl, das in ihr gewesen war, einfach hinausgeschrien und so einer gnädigen Empfindungslosigkeit Platz gemacht.
Wood ging vor ihr in die Hocke und rüttelte sie an den Schultern. »Elizabeth!«
»Wo ist Danny?« Ihr Blick flackerte zu Riley. Der hagere Junge war, gefolgt von Susan, ebenfalls nach draußen gekommen und hatte die Frage in einem leisen, argwöhnischen Ton gestellt.
»Gegangen«, flüsterte sie kaum hörbar.
»Gegangen? Wohin?«, frage Wood verständnislos. Dann dämmerte es ihm. »Etwahinübergegangen?« Als Elizabeth nicht antwortete, griff er nach ihrem Kinn und zwang sie dazu, ihn anzusehen. »Ist er hinübergegangen, Elizabeth?«, fragte er noch einmal. Seine stahlblauen Augen spießten sie förmlich auf.
Alles, was sie als Antwort zustande brachte, war ein schwaches Nicken.
Keuchend ließ Wood die Hand fallen und schloss kurz die Augen. »Wieso jetzt?«, verlangte er mit gepresster Stimme zu wissen.
Riley ging nun ebenfalls in die Hocke, während Susan mit über den Mund geschlagenen Händen auf einen der Rattansessel sank.
»Wieso jetzt?« Wood schrie beinahe, als er die Frage wiederholte. »Ich dachte, du hältst ihn, wenn er gerufen wird!«
»Ich habe ihn gehen lassen.« Das Echo dieser Worte hallte in Elizabeths Schädel. Sie hatte es tatsächlich getan. Sie hatte Daniel ins Licht gehen lassen. Auf die andere Seite …
Wood sprang auf und starrte auf sie hinunter. »Was ist nur los mit dir?«, rief er ungehalten. »Sind das die Nachwirkungen der Drogen, die sie dir in der Klapse verabreicht haben? Haben sie dort an deinem Hirn herumgepfuscht?« Wutentbrannt schüttelte er den Kopf. »Gestern machst du noch auf heile Welt und Wolke sieben und heute schickst du ihn in die Wüste!«
Ohne ihn anzusehen, geschweige denn zu antworten, ließ Elizabeth Woods Ausbruch über sich ergehen. Sie wusste nur zu gut, dass sie seinen Zorn durchaus verdiente. Durch ihre Entscheidung und ihr Handeln hatte Wood zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen seinen besten Freund verloren und sie hatte ihn nicht gewarnt, ihm keine Möglichkeit gegeben, sich zu verabschieden.
Susan erhob sich und legte zaghaft ihre Finger auf Woods Ellenbogen. »Tony ...«
Brüsk entzog er sich der Berührung und stürmte davon.
Susan sah ihm seufzend nach, dann setzte sie sich neben Elizabeth auf den Boden und umfing mit einem Arm deren Schultern. »Was ist passiert?«, fragte sie. »Du hast ihn doch nicht grundlos gehen lassen, nicht wahr?«
»Nein«, hauchte Elizabeth. »Ich konnte nicht zulassen, dass er das gleiche Schicksal wie Dorian erleidet.«
»Wer zum Geier ist denn Dorian?«, wollte Riley wissen, der nun in einem der Sessel saß.
»Dorian ist ein Geist«, presste Elizabeth heraus, »der sich zu lange dem Ruf der anderen Seite widersetzt hat, um bei seiner sterblichen Geliebten zu bleiben und der dafür nun bezahlen muss. Ihm bleibt die andere Seite auf ewig verwehrt. Er ist dazu verdammt in dieser Welt umherzuwandern. Als schwindender Schatten.« Sie schloss die Augen. »Einsam. Für immer von seiner geliebten Eleonor getrennt.«
Susan legte eine Hand auf Elizabeths Hinterkopf, drückte ihn sanft nach unten, bis die Stirn an ihrer Schulter ruhte, und streichelte über ihren Rücken.
»Ruf der anderen Seite?«, fragte Riley zweifelnd. »Wer hat dir das denn erzählt?«
»Sir Thomas«, flüsterte Elizabeth.
»Der Antiquitätenhändler?« Riley sah aus, als wollte er noch etwas sagen, doch Susan gab ihm mit einem Kopfschütteln zu verstehen, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür war.
»Er ist wirklich weg ...« Erst allmählich begann Elizabeth zu begreifen, dass es tatsächlich geschehen war. Das, was sie schon so lange befürchtet hatte, war nun Wirklichkeit geworden. Die Gnadenfrist, die das Schicksal Daniel und ihr gewährt hatte, war abgelaufen. Ihr Traum war zu Ende geträumt, ihr Prinz in unerreichbare Gefilde verschwunden. Und die Realität wartete mit nichts auf, das ihr Trost spenden konnte. Es gab für sie keine Wunder mehr und auch keine Magie. Nur kalte, herzlose Realität.
Ein Schluchzen brach aus Elizabeth heraus und mit ihm kam der Schmerz zurück. Zunächst nur als Ziehen im Magen, doch dann mit unverminderter Intensität. Keuchend rang sie nach Atem.
Aber wenigstens ist er nun an einem besseren Ort, sagte sie sich. Im Paradies. So wie das Elysium in der griechischen Mythologie, wo Helden die Ewigkeit mit Sport, Spielen und Musik verbrachten. Allerdings würde er dort nicht an sie denken, da man der Legende nach im Elysium alles Weltliche vergaß. Doch vermutlich wäre das auch besser so, denn wenn sie an Daniels verletzten Gesichtsausdruck dachte, als das gleißend helle Licht ihn in sich aufgenommen hatte, stand außer Frage, wie sehr er sich von ihr im Stich gelassen fühlte. Lieber sollte er gar nicht an sie denken, als dass er auf sie wütend war.
Sie wünschte, sie hätte ihm gesagt, warum sie ihn nicht länger halten konnte. Wenn er verstanden hätte, dass sie ihn nur deshalb gehen ließ, weil er ihr zu wichtig war, wichtiger als ihr eigenes Glück, dann wäre er vielleicht nicht so verwirrt und enttäuscht von ihr gewesen.
»Und was jetzt?«, fragte Riley nach einer Weile. »Wie geht es jetzt weiter?«
»Wir machen natürlich weiter wie bisher!« Elizabeth hob den Kopf und sah Riley grimmig an. »Was denn sonst! Wir können Dannys Mörder nicht ungestraft davonkommen lassen. Sie müssen dafür bezahlen. Jeder von ihnen!«
Außerdem brauchte sie eine Aufgabe. Etwas, auf das sie sich konzentrieren konnte und das sie beschäftigen würde. Denn wenn sie zu viel Gelegenheit hätte, über Daniel und ihre triste und freudlose Zukunft nachzudenken, würde sie mit Sicherheit den Verstand verlieren.
Mit einer energischen Geste wischte sie sich die Tränen aus den Augen und stand auf. »Was habt ihr gestern herausgefunden?« Obwohl sie sich schwach und zittrig fühlte, klang ihre Stimme doch entschlossen.
Die Hände fest vor ihrem Bauch verknotet, machte sie ein paar Schritte auf und ab. Sie musste in Bewegung bleiben, um zu funktionieren. Wenn sie stehen blieb, würde sie erst erstarren und dann zerbersten.
Weder Riley noch Susan antworteten ihr, sondern sahen sie nur betroffen an.
»Elizabeth«, sagte Susan schließlich, »denkst du nicht, du solltest dir etwas Zeit gönnen, um zu … um zu trauern?«
Ruckartig blieb Elizabeth stehen und fuhr zu der dunkelhaarigen Frau herum. Ihr war klar, dass Susan es nur gut meinte, und sie wusste auch, dass sie recht hatte. Trotzdem rief sie: »Nein! Ich will nicht um ihn trauern. Ich will, dass seine Mörder bestraft werden! Danach habe ich mehr als genug Zeit zum Trauern. Mein ganzes verdammtes Leben lang!« Zitternd holte sie Luft. »Also«, sagte sie betont ruhig. »Wo stehen wir?«
»Ich sag dir was.« Susan erhob sich. »Mach dich erst mal etwas frisch. Nimm dir Zeit und gönn dir eine lange Dusche. Und beim Frühstück reden wir weiter.«
Sie wusste, es war irrational, doch Elizabeth machte Susans bedächtige und fürsorgliche Art unglaublich wütend. Am liebsten hätte sie ihr ins Gesicht geschrien, sie solle sich gefälligst um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und aufhören, Mutter Theresa zu spielen. Doch bevor es aus ihr herausplatzen konnte, rannte sie in ihr Zimmer und dort direkt ins Bad.
Anstelle Susans Rat zu befolgen und eine lange Dusche zu nehmen, spritzte sie sich lediglich am Waschbecken etwas kaltes Wasser ins Gesicht und starrte dann ihr Spiegelbild an. Die braunen Augen waren fast schwarz und wirkten gehetzt. Ihr sonst so voller Mund war einer angespannten weißen Linie gewichen. Insgesamt wirkten ihre Züge bitter und gleichzeitig getrieben.
Dieses Gesicht konnte sie nicht zur Schau stellen.
Sie richtete sich kerzengerade auf, hob das Kinn und konzentrierte sich darauf, ihre Muskeln zu entspannen, einen nach dem anderen, bis der Ausdruck auf ihrem Gesicht gleichmütig wirkte und ihre Hände nicht mehr zu Klauen gekrümmt waren.
Und so fror sie sich ein, wurde zu einer Eisskulptur. Nach außen hin kühl und beherrscht, auch wenn in ihrem Inneren ein Höllenfeuer loderte.
So hatte es ihre Mutter ihr beigebracht. Man sprach nicht über seine Gefühle und man zeigte sie erst recht nicht.Contenance, hatte sie immer gesagt.Nimm dir ein Beispiel an der Queen. Bisher war Elizabeth nie sonderlich gut darin gewesen, die sprichwörtliche britische Haltung zu bewahren, doch nun wäre ihre Mutter mit Sicherheit zufrieden mit ihr.
»Endlich habe ich ein richtiges Pokerface, Danny«, flüsterte sie. »Und du kannst es nicht sehen.«
Sie ging zurück in ihr Zimmer und zog sich an. Dann suchte sie nach dem Foto, das sie aus Daniels Wohnung mitgenommen hatte. Hektisch wühlte sie in der Reisetasche und warf achtlos die Sachen auf den Boden, bis sie die Jeans gefunden hatte, in dessen Hosentasche sich das Foto befand. Darauf bedacht, es nicht anzusehen, faltete sie es und schob es in die Tasche der schwarzen Hose, die sie nun trug.
Nachdem sie ihre Erscheinung im Spiegel überprüft und ihre dunklen Locken zurecht gezupft hatte, verließ sie mit hölzernen Schritten das Zimmer und ging in die Küche, wo Riley und Susan in ein Gespräch vertieft am Tresen saßen.
»… nie gehört. Geister entscheiden selbst …« Riley brach abrupt ab, als er Elizabeth bemerkte, und senkte seinen Blick auf die Müslischale vor ihm.
Offensichtlich gab es heute kein Schlemmerfrühstück à la Susan, nur Toast und Cornflakes.
»Lasst euch nicht stören«, sagte Elizabeth und setzte sich mit geradem Rücken auf einen Barhocker. Doch anstelle weiterzureden, warfen Riley und Susan sich nur einen vielsagenden Blick zu.
Schweigend nahmen sie ihr Frühstück ein, wobei Elizabeth nur an ihrem Tee nippte und nichts aß. »Wo ist Tony?«, fragte sie nach einer Weile.
»Joggen im Park«, erwiderte Susan. »Er versucht wohl, seinen Unmut in den Boden zu stampfen.«
Irgendetwas sagte Elizabeth, dassUnmuteine Untertreibung war. Mit einem leisen Räuspern stellte sie die Teetasse vor sich ab und faltete die Hände auf der Theke. »Nun«, sagte sie und klang dabei, als eröffnete sie eine geschäftliche Besprechung. »Was ist der aktuelle Stand unserer Ermittlungen und wie machen wir weiter?«
»Ich habe die Angehörigen der toten Teenager angerufen, mit denen du noch nicht gesprochen hast und Termine für dich vereinbart«, erklärte Susan, verstohlen zu Riley schielend. »Ich habe dich als private Ermittlerin vorgestellt, die im Auftrag der Eltern eines der anderen ermordeten Jungs recherchiert. Wenn du willst, kann ich die Termine aber verschieben«, fügte sie schnell hinzu.
»Nein«, sagte Elizabeth. »Nicht nötig. Danke für deine Mühe Susan.«
»Kein Problem. Darüber hinaus haben Tony und ich angefangen, Informationen zu diesem Dr. Mortimer zusammenzutragen. Viel haben wir allerdings noch nicht.«
»Ich habe mit meinem Kumpel Mick gesprochen«, meldete sich Riley. »Er hat das Handy von diesem Typen, der Dannys Dad das Amulett abkaufen wollte, wieder geortet. Und zwar praktisch vor deiner Haustür.«
»Wann?«, wollte Elizabeth wissen.
»Vorgestern.«
»Als wir am Nachmittag in meiner Wohnung wahren, um meine Sachen zu holen?« Ihr Ton war beherrscht und verriet keine Emotion. Ihre Eismaske saß perfekt, doch innerlich erbebte sie. Hatte man ihnen nach ihrer Flucht aus St. Agnes vor der Wohnung aufgelauert? Kannten sie vielleicht sogar ihren neuen Aufenthaltsort?
»Nein, vormittags«, klärte Riley sie auf. »Und gestern Abend konnte Mick es noch mal orten. Im Westen von London, im gleichen Radius, in dem er es das erste Mal vor ein paar Tagen geortet hatte.«
»Dann sollten wir uns diese Gegend wohl mal genauer ansehen«, stellte Elizabeth fest.
»Tony hat mit seinem Chef Richard Merton gesprochen«, fuhr Susan fort. »Er steht nach wie vor zu ihm und hält die Ohren offen. Er versucht auch, an Personalfotos von leitenden Beamten heranzukommen, damit du diesen Mr Nadelstreifen identifizieren kannst.«
»Das hat sich erledigt.« In Shorts, T-Shirt und mit verschwitzten Haaren kam Wood in die Küche. Er steuerte direkt den riesigen Edelstahlkühlschrank an und nahm sich eine Wasserflasche heraus. Elizabeth würdigte er keines Blickes. »Ich knöpfe mir heute noch mal Clark und Stokes vor. Sie werden sich zwar sicherlich weiterhin unkooperativ zeigen, aber bei Gott, heute werden sie mir sagen, wer der Kerl war, und wenn ich es aus ihnen heraus prügeln muss.«
Fast hörte es sich so an, als hoffte Wood, dass die Detectives sich weiterhin weigern würden, mit ihm zu sprechen. So finster, wie er dreinschaute, zweifelte Elizabeth keine Sekunde daran, dass Wood tatsächlich handgreiflich werden würde, sollten die beiden ihm nicht verraten, wer der Mann im Nadelstreifenanzug gewesen war.
Da fiel Elizabeth ein, dass sie ja noch immer rätselten, woher ihre Gegenspieler überhaupt wussten, dass sie eine heiße Spur verfolgten und sich veranlasst fühlten, sie in St. Agnes verschwinden zu lassen.
»Riley«, wandte sie sich an den Jungen, »hast du Mick gefragt, ob er mit jemandem über den Bhowanee-Dolch oder die Handynummer gesprochen hat?«
»Nein«, antwortete er forsch. »Das ist nicht nötig. Er hat ganz sicher mit keinem drüber geredet.Ihmkann man vertrauen.«
Elizabeth überging die letzte Bemerkung, obwohl ihr natürlich klar war, dass diese auf sie abgezielt gewesen war. Auch Rileys Zorn hatte sie verdient. »Für wann hast du heute den ersten Termin vereinbart, Susan?«
»Um eins bei Mr und Mrs Morris«, entgegnete sie leise. »Und den nächsten um vier bei Mrs Orkafu.«
»In Ordnung«, nickte Elizabeth. »Dann kann ich vorher noch den Artikel fertigstellen und an Sir Thomas schicken. Wer begleitet mich zu den Terminen?«
In Woods Blick lag Fassungslosigkeit und sogar eine Spur Verachtung, als er ihr praktisch ins Gesicht spuckte: »Was sind wir heute wieder für ein effizienter kleiner Roboter!« Kopfschüttelnd verließ er die Küche. Kurz darauf hörte man den lauten Knall einer zuschlagenden Tür.
»Ich sollte wohl in ein Hotel umziehen«, murmelte Elizabeth, die es kaum überraschte, dass sie hier nun nicht mehr willkommen war.
Oder ich vergesse das Hotel und gehe einfach nach Hause, überlegte sie. Was machte es schon, wenn die Typen sie dort aufspürten? Was konnten sie ihr jetzt noch antun? Möglicherweise taten sie ihr ja sogar den Gefallen und töteten sie endlich.
Erschrocken über ihre eigenen Gedanken fuhr Elizabeth zusammen, rutschte vom Hocker und brachte hastig ihre Tasse zur Spüle.
»Gib Tony etwas Zeit«, sagte Susan und legte ihr eine Hand auf die Schulter.
»Das habe ich schon mal gehört«, seufzte Elizabeth, die Hand abschüttelnd. »Ich bin in meinem Zimmer.«
Ihre Atmung kam stoßweise, als sie sich in ihrem Schlafzimmer auf die Bettkante fallen ließ und die Fäuste in die Magengrube presste, um den Schmerz unter Kontrolle zu bringen. Es fühlte sich an, als würde sie innerlich verbrennen und äußerlich erfrieren. Die Wände schienen sich um sie herum zusammenzuziehen und drohten sie zu erdrücken.
Daniel war noch nicht mal drei Stunden fort, und die Sehnsucht nach ihm war schon so groß, dass sie keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Der einzige Gedanke, der sich wiederholte wie eine festhängende Schallplatte, war:Wie soll es jetzt nur weitergehen? Wie soll ich ohne ihn die nötige Kraft aufbringen, um weiterzumachen?
»Wo auch immer du jetzt sein magst, Danny, ich bete, dass du dort glücklich bist«, flüsterte sie und rollte sich an der Stelle, wo Daniel die Nacht zuvor gelegen hatte, zu einer Kugel zusammen. Eigentlich wollte sie nur kurz die Augen schließen, doch die Übermüdung siegte, und sie fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
2
Als Elizabeth erwachte, war es bereits früher Nachmittag. Mit schweren Gliedern und schlechtem Gewissen erhob sie sich. Am liebsten hätte sie einfach weiter geschlafen, hätte sich unter der Decke verkrochen und sich vor der Welt versteckt. Doch das konnte sie nicht, zumindest noch nicht. Noch gab es zu viel zu tun.
Wenn sie Daniels Mörder gestellt hatten, würde sie reichlich Zeit haben sich zu verkriechen.
Wahrscheinlich würde sie dann London den Rücken zukehren und irgendwo von vorne anfangen. Diese Stadt hatte ihr nicht mehr das Geringste zu bieten.
Genau genommen hatte die Welt ihr nichts mehr zu bieten. Vielleicht würde sie sich einfach in ein kleines, abgeschiedenes Cottage auf dem Land zurückziehen und den Rest ihres tristen, freudlosen Lebens damit zubringen, schwermütige Gedichte zu verfassen …
Aber noch war es nicht soweit. Sie würde das durchziehen, ganz egal wie langwierig und schmerzlich es auch war. Für Daniel würde sie stark bleiben, wenn schon nicht für sich selbst.
Sie sah auf die Uhr. Für den ersten Termin war es bereits zu spät, aber noch zu früh, um sich auf den Weg zum zweiten zu machen. Also holte sie ihren Laptop aus der Tasche, setzte sich damit auf das Bett und machte sich daran, den Artikel für Sir Thomas zu überarbeiten. Schließlich war der verleumderische Bericht über Daniel bereits vor über einer Woche im London Star erschienen. Die Veröffentlichung einer würdigenden Darstellung von Daniels Arbeit eilte, sonst würde er am Ende den Menschen doch noch als spielsüchtiger und korrupter Polizist in Erinnerung bleiben.
Wenn allerdings jemand wie Sir Thomas ein Loblied auf Daniel und seine Leistungen sang … Die Meinung eines achtbaren und für seine Wohltätigkeit geschätzten Mannes wie ihm wog doch sicherlich mehr als die einer Boulevard-Zeitung.
Mindestens ein Dutzend Mal setzte sie an, den Text zu lesen, doch jedes Mal brach sie nach wenigen Sätzen ab. Sie konnte sich einfach nicht konzentrieren, und immer, wenn sie Daniels Namen las, war es wie ein kleiner Tritt in den Magen.
Frustriert klappte sie den Rechner wieder zu. Sir Thomas würde sich noch etwas länger gedulden müssen. Oder sie würde ihm einfach mitteilen, dass sein Assistent George freie Hand hätte und den Text nach Hamiltons Vorstellungen abändern durfte. Wegen ihr konnte er auch seinen Namen als Autor darunter setzen. Vermutlich wäre das sowieso wirkungsvoller als ihr eigener unbedeutender Name oder irgendein Pseudonym.
Seufzend sah sie erneut auf die Uhr. Möglicherweise konnte sie sich doch schon auf den Weg zur Familie Orkafu machen. Auf dem Weg könnte sie einen Zwischenstopp in einem Musikladen einlegen, um einige von Daniels Lieblingsalben zu kaufen. Abgesehen von Margery besaß sie kaum Erinnerungsstücke von ihm, doch wenigstens seine Musik konnte sie hören. Vielleicht war es ihr ja vergönnt, dabei ein klein wenig seine Nähe spüren.
Bevor sie das Zimmer verließ, überprüfte sie im Spiegel den Sitz ihrer Eismaske und wappnete sich innerlich, sich den anderen zu stellen.
Riley saß mit seinem Laptop auf dem Schoß auf der Couch, während Susan im Schneidersitz auf dem Boden hockte und einen Stapel Zeitungen durchging. Beide waren offenbar in Recherchen vertieft.
Als Elizabeth zu ihnen stieß, sah Susan auf. »Hi«, sagte sie mit einem warmen Lächeln. »Geht es dir etwas besser?«
Elizabeth ignorierte die Frage. »Tut mir leid wegen des Termins um eins. Aber ich würde jetzt gerne zu den Orkafus fahren. Wäre einer von euch bereit, mich zu begleiten?« Selbst in ihren eigenen Ohren klang ihre Stimme wie eine maschinelle Bandansage.
»Nun …«, setzte Susan an, doch Riley fiel ihr schroff ins Wort. »Ich geh schon mit, keine Sorge.«
»Danke«, sagte Elizabeth. »Woran arbeitet ihr?«
»Ich durchforste die Nachrichten nach dem zehnten Mord«, erklärte Susan, während Riley den Rechner zuklappte und sich erhob. Mit gesenkten Augen schob er sich an Elizabeth vorbei und verließ das Zimmer. »Und Riley liest sich in das ThemaThuggeesein«, ergänzte Susan, dem Jungen missbilligend hinterher blickend.
»Hast du etwas über einen neuen Mord gefunden?«
»Vor ein paar Tagen ist zwar schon wieder ein Teenager bei einer Messerstecherei getötet worden, aber das hatte mit Sicherheit nichts mit unserem Fall zu tun. Es gab ziemlich viele Zeugen, die den Streit und die darauf folgende Schlägerei beobachteten.«
»Verstehe. Tony ist gerade mit Clark und Stokes beschäftigt?«
Susan nickte nur und wandte sich dann wieder ihren Zeitungen zu.
»Ich bin soweit.« Riley stand bereits mit Jacke und Rucksack in der Tür, also holte auch Elizabeth ihre Sachen. Ehe sie das Apartment verließen, ließ sie sich von Susan noch die Adresse der Familie Orkafu geben.
Als sie während der Taxifahrt einen größeren Musikladen passierten, bat Elizabeth den Fahrer kurz anzuhalten und auf sie zu warten. In weniger als zehn Minuten war sie zurück, denn sie hatte einem hilfsbereiten Verkäufer einfach die fraglichen Alben genannt, anstatt selbst auf Suche zu gehen.
Für den Rest der Fahrt starrte Elizabeth zum Seitenfenster hinaus, die Tüte mit den CDs so fest an sich gedrückt, als hinge ihr Leben daran. Es kam ihr vor, als hüllte sich die ganze Stadt in Trauer, als wüsste sie, dass einer ihrer Besten für immer gegangen war. Alle Farben waren über Nacht aus der Welt verschwunden. Dunkelgraue Wolken hingen unheilvoll am Himmel und drohten mit plötzlichem, heftigen Regen. Selbst die Menschen sahen in ihren Augen finster und feindselig aus.
Kims Worte auf der Beerdigung kamen ihr in den Sinn:Die Welt ist ohne dich nicht mehr die gleiche. Sie ist dunkler und kälter geworden.
Wie recht Daniels Schwester damit doch gehabt hatte.
Die Orkafus waren eine siebenköpfige Einwandererfamilie aus Uganda und lebten in einem kleinen Haus im Londoner Osten, in dessen Erdgeschoss sich auch ein Friseursalon befand, den Mrs Orkafu zusammen mit zwei ihrer Töchter betrieb.
Sie saßen auf farbenfrohen Holzstühlen im Wartebereich des Salons, umgeben von buntem Treiben und lauten Unterhaltungen. Eigentlich eine fröhliche, ausgelassene Atmosphäre, die aber nur dazu führte, dass Elizabeth sich noch erbärmlicher und einsamer fühlte.
Wie eine Gestrandete saß sie inmitten des Trubels auf ihrer eigenen trostlos grauen Insel. Ihre Finger umklammerten ihr neues Notizbuch, das Susan besorgt hatte und nun geschlossen auf ihren Knien lag.
Sie zählte mindestens vier eingerahmte und mit Blumen geschmückte Fotos von Mrs Orkafus Sohn Adam, der vor etwa acht Monaten im Alter von siebzehn Jahren erstochen worden war. Riley saß auf dem Stuhl neben Elizabeth, den Blick abwesend auf eines der Fotos geheftet.
»Adams Bruder Corbin war dabei, als es passierte«, berichtete Mrs Orkafu gerade. »Sie waren auf dem Weg ins Kino. Corbin ging kurz in einen Laden, um Süßigkeiten zu kaufen und als er wieder herauskam, lag Adam am Boden. Corbin hatte nichts gehört und niemanden gesehen. Es muss blitzschnell passiert sein.«
»Wissen Sie, ob Adam kurz vor seinem Tod jemandem die Freundschaft aufgekündigt hat?«, fragte Elizabeth. Ihre Stimme war leise und monoton.
»Adam war sein Freundeskreis sehr wichtig«, entgegnete Mrs Orkafu. Sie sprach mit einem weichen Akzent, und meist umspielte ein gütiges, aber auch trauriges Lächeln ihre Lippen. »Es hätte schon etwas sehr Schlimmes passieren müssen, damit Adam einem der Jungs die Freundschaft aufkündigt. Und das hätte er auf jeden Fall erwähnt.«
»Und anders herum? Könnte sich ein Freund von ihm abgewendet haben?«
»Er hat nichts in dieser Richtung erzählt. Wie gesagt, waren Adam seine Freunde sehr wichtig, und er hat für sie gekämpft. Zum Beispiel damals, als sein Freund Billy weggegangen ist, da hat Adam alles dafür getan, um in Kontakt zu bleiben, und das ist für Teenager nicht selbstverständlich. Wie sagt man? Aus den Augen aus dem Sinn, nicht wahr? Aber das galt nicht für meinen Sohn.«
»Könnte es denn einen Streit mit einem seiner Freunde gegeben haben?«
»Miss, Jungs in dem Alter streiten sich nun mal. Und am nächsten Tag? Da ist alles vergeben.«
»Gab es jemanden, den Adam als seinen Feind oder … oder Rivalen bezeichnete?«
»Nein«, schüttelte Mrs Orkafu mit weiten Augen den Kopf. »Ganz sicher hatte er keine Feinde. Er war ein lieber Junge und ein vorbildlicher Schüler.«
»Hatte er eine Freundin?«, schaltete sich Riley doch noch in das Gespräch mit ein.
»Ja, er ging mit einem Mädchen aus seiner Schule«, entgegnete Hannah, Adams ältere Schwester. Sie stand hinter ihrer Mutter und flocht ihr mit flinken Fingern kleine Zöpfchen. »Ihr Name ist Winona. Adam hatte sie richtig gern.«
»Hatte Adam Konkurrenz? Waren da noch andere, die auf Winona standen?«, fragte Riley weiter.
»Ich weiß nicht …«, sagte Mrs Orkafu, doch Hannah nickte heftig. »Ja, da bin ich mir sogar sehr sicher. Da war ein Junge, der auch auf Adams Schule war, und mein Bruder hatte immer Angst, der Typ könnte ihm Winny ausspannen. Und soweit ich das mitbekommen habe, sind die beiden jetzt wirklich zusammen.«
Riley warf Elizabeth einen selbstgefälligen Blick zu, bevor er fortfuhr. »Kennst du vielleicht auch noch seinen Namen, Hannah?«
»Oje.« Mit zwei Haarsträhnen ihrer Mutter in der Hand hielt das Mädchen inne. »Adam nannte ihn immer den Schleimer … Ich glaube, er heißt Stephen oder Steve.«
»Nachname?« Elizabeth hatte mittlerweile das Buch aufgeschlagen und damit begonnen, Notizen niederzuschreiben.
»Keine Ahnung.« Hannah hob die Schultern und widmete sich wieder dem Zöpfchen.
»Weißt du vielleicht sonst etwas über Steve, dass uns weiterhelfen könnte?«
»Naja, ich denke, er macht irgendeinen Kampfsport, weil Adam mal sagte, der Schleimer solle sich nur nicht einbilden, dass er Respekt vor ihm hätte, nur weil er einen schwarzen Gürtel hat.«
»Klingt, als hätten wir einen Gewinner«, murmelte Riley, was Elizabeth mit einem knappen Nicken bestätigte.
»Noch eine andere Frage«, sagt sie. »Wurde Adam bei dem An griff etwas gestohlen? Ein persönlicher Gegenstand?«
»Seltsam, dass Sie das fragen«, antwortete Mrs Orkafu. »Als wir seine Sachen erhielten, war alles dabei, seine Geldbörse, sein Handy, seine Uhr. Aber sein Talisman fehlte.«
Elizabeth sah auf. »Sein Talisman? So etwas, wie ein Glücksbringer?« Ihre Stimme war rau und zeigte das erste Mal einen Hauch von Emotion. Ihre linke Hand wanderte unbewusst die Brust hinauf zu der Stelle, wo sich Daniels silbernes Sonnenamulett befunden hatte, bevor es ihr vor einer Woche gestohlen worden war.
»Ja«, nickte Mrs Orkafu. »Ein Talisman, den er von seiner Großmutter bekam.« Sie schloss ihre Augen. »Der ihn beschützen sollte.«
»Wie sah er aus?«, wollte Elizabeth wissen.
»Genau so«, meldete sich Hannah und zeigte auf einen weißen, kugelförmigen Anhänger, den sie an einer Silberkette um den Hals trug. »Wir alle haben einen bekommen. Großmutter sagt, sie beinhalten ein Stück Heimat und damit ein Stück unserer Vorfahren, die über uns wachen.«
»Ich nehme an, Adam hat den Talisman immer getragen?«
»Ja, das hat er«, bestätigte Hannah.
»Danke, für Ihre Hilfe«, sagte Elizabeth abschließend. »Nur eins noch. Haben Sie Winonas Nachnamen und eventuell ihre Adresse? Wir würden versuchen, mit ihrer Hilfe mehr über diesen Steve herauszubekommen.«
»Sie heißt Winona Taylor«, antwortete Hannah. »Ihre Adresse kenne ich nicht, aber Adams Schule kann Ihnen da sicher weiterhelfen. Er ging auf die St. Andrew´s.«
»Danke«, sagte Elizabeth erneut und klappte das Buch zu. »Dürfen wir uns noch mal bei Ihnen melden, falls wir weitere Fragen haben?«
»Natürlich«, erwiderte Mrs Orkafu. »Wir tun alles, um zu helfen. Auch wenn es uns Adam nicht zurückbringt, so hoffen und beten wir doch, dass seine Mörder gefunden werden. Die Wunde wird niemals heilen, aber vielleicht hört sie dann auf zu pochen. Wie war der Name des Jungen, für dessen Familie Sie arbeiten?«
»Sein Name war Danny«, antwortete Riley leise.
Beim Klang seines Namens fuhr Elizabeth blitzartig in die Höhe und drängte, ohne sich zu verabschieden, zwischen den Stühlen hindurch zur Tür. Sie war schon fast auf der Straße, da hörte sie noch: »Sagen Sie seiner Familie bitte, dass wir für Dannys Seele beten.«
»Toller Auftritt«, bemerkte Riley, als er eine Minute später aus dem Laden kam und neben Elizabeth trat. Sie lehnte mit geschlossenen Augen und geballten Fäusten an der Hausmauer und konzentrierte sich darauf, gleichmäßig ein- und auszuatmen. »Hat sicher Eindruck gemacht.«
»Tut mir leid«, entgegnete sie seufzend. Ihr war schwindelig und übel, was kein Wunder war, hatte sie doch seit gestern früh kaum etwas zu sich genommen. »Hör mal, ich brauche dringend etwas zu essen. Wartest du kurz?« Ohne Rileys Antwort abzuwarten, stieß sie sich von der Wand ab und überquerte die Straße, um sich in einem kleinen Supermarkt ein Sandwich zu kaufen.
Da es in der Gegend, in der sie sich befanden, kaum Taxis gab, machten sie sich anschließend zu Fuß auf den Weg zu einer Bushaltestelle. »Das war vorhin echt clever von dir, nach einer Freundin und einem Rivalen zu fragen«, sagte Elizabeth nach einer Weile, während sie an ihrem Thunfischsandwich pickte.
Riley zuckte mit den Achseln. »War so ´ne Art Eingebung.«
»Denkst du, Mick kommt an das Schülerverzeichnis von St. Andrew´s heran?«
»Klar.«
Nachdem sie erneut einige Zeit still nebeneinander hergegangen waren, fragte sie plötzlich: »Warum bist du eigentlich noch hier, Riley?«
»Wenn du mich jetzt auch noch loswerden willst, musst du mich schon vor ein fahrendes Auto stoßen.«
Elizabeth ließ sich nicht provozieren. »Ich meine, warum hilfst du uns noch? Du hast Danny einen Gefallen geschuldet, nicht uns.« Sie schluckte schwer. »Und nun, da er fort ist … Du kannst doch jederzeit nach Hause gehen.«
Riley antwortete nicht sofort, doch dann meinte er: »Wer sagt, dass es daheim sicher ist?«
»Ist das wirklich der einzige Grund?«
»Nein.« Zum ersten Mal, seit dem Morgen, sah Riley ihr in die Augen. »Ich kann euch nicht einfach hängen lassen. Ich hab ihm doch mein Wort gegeben …« Er brach ab, als sei es ihm peinlich, darüber zu sprechen. Die Muskeln in seinem schmalen Gesicht spannten sich. »Meinen Leuten, also den Pavees, ist Ehre echt wichtig, weißt du. Man ist für seine Familie und für seine Freunde da, man lässt sie auf keinen Fall im Stich und Versprechen sind heilig. Das sind praktisch die Pfeiler, auf denen unsere Gemeinschaft gebaut ist. Ich habe Danny versprochen zu helfen. Und nur, weil … weil er jetzt weg ist, heißt das noch lange nicht, dass mein Ehrenwort nicht mehr gilt.«
»Verstehe«, sagte Elizabeth dankbar lächelnd.
»Außerdem«, fuhr der Junge in einem lockereren Ton fort, »erwartet mich meine Mom erst nächsten Freitag zurück. Die würde Augen machen, wenn ich schon jetzt aus Paris zurück wär.«
Als sie in die Wohnung zurückkamen, waren Susan und Wood nirgends zu sehen. Elizabeth ging direkt in ihr Zimmer, schloss die Tür hinter sich und legte eine der neuen CDs ein. Nachdem sie die Musik laut aufgedreht und ihre Schuhe ausgezogen hatte, sank sie auf das Bett.
Ein paar Minuten lang saß sie einfach nur da, dann nahm sie all ihren Mut zusammen und zog das Foto aus der Hosentasche. Sie hatte befürchtet, dass der Anblick von Daniels lachendem Gesicht die brennende Wunde in ihrer Brust noch weiter aufreißen würde, doch stattdessen schien er den Schmerz auf wundersame Weise ein klein wenig zu lindern.
So behutsam, als berührte sie tatsächlich Daniels Gesicht und nicht nur ein Foto, ließ sie ihre Fingerspitzen über das glatte Papier wandern. Sie legte sich zurück und rollte sich zusammen, das Foto auf Augenhöhe neben sich auf dem Kissen platziert.
Eine kühle Brise wehte durch das geöffnete Fenster herein und strich über ihre Wange. Elizabeth schloss fest die Augen und versuchte sich vorzustellen, dass es nicht der Wind war, den sie fühlte, sondern Daniels Berührung. Dass er neben ihr lag und leise den Song mitsang.
Doch so sehr sie sich auch anstrengte, es wollte ihr einfach nicht gelingen. Sie wusste, er war nicht da und würde es nie wieder sein. So einfach ließ sich ihr Verstand nicht austricksen.
Auch die Musik verfehlte die erhoffte Wirkung. Was sie hörte, war nur irgendein Song und in keiner Weise eine Verbindung zu Daniel. Alles, was sie spürte, war seine Abwesenheit. Die Leere, die er hinterlassen hatte, war um sie herum, genauso wie in ihr.
Sie hielt es nicht länger aus. Wenn sie weiterhin untätig liegen blieb, würde das unsägliche Nichts sie in den Wahnsinn treiben. Sie musste sich beschäftigen. Nur womit? Sir Thomas! Sie wollte ihn doch anrufen!
Eilends rappelte sich Elizabeth aus dem Bett und suchte ihr Handy.
Merkwürdig, dachte sie, während sie die Nummer wählte.Seit heute Morgen schwanke ich praktisch im Minutentakt zwischen blindem Aktionismus und der »Nichts-hören-nichts-sehen«-Einigel-Taktik hin und her.Einerseits hatte sie das dringende Bedürfnis, in Bewegung zu bleiben und sich zu beschäftigen, andererseits wollte sie nichts lieber, als sich vor der Welt zu verstecken und sich ihrem Elend hinzugeben. Vielleicht sollte sich endlich für eine Strategie entscheiden …
»Hamilton Anwesen«, meldete sich George in seiner üblichen steifen Art und riss sie aus ihren Gedanken.
»Guten Abend, George. Hier ist Elizabeth Parker. Ich würde gerne mit Sir Thomas sprechen.«
»Ich bedaure, Miss Parker, doch Sir Thomas hat einen Gast und ist momentan nicht abkömmlich.« Hörte sie da etwa eine gewisse Schadenfreude in seiner Stimme? »Darf ich etwas ausrichten?«
Einen kurzen Augenblick lang überlegte Elizabeth, ob sie es später erneut versuchen sollte, doch dann entschied sie, dass sie die Nachricht ebenso gut von George übermitteln lassen konnte.
»Könnten Sie Sir Thomas bitte wissen lassen, dass er, was meinen Artikel betrifft, freie Hand hat und er ihn nach eigenem Ermessen abändern darf? Auch was das Pseudonym angeht, hat er mein volles Einverständnis, egal welchen Namen er wählt.«
»Natürlich, Miss Parker. Ich werde Sir Thomas unterrichten. Dürfen wir denn bald wieder mit Ihrem Besuch rechnen?«
»Ich … ich weiß nicht. Im Moment … widme ich mich einem anderen Projekt.«
»Ich verstehe.«
»Aber bitte richten Sie Sir Thomas meine Grüße aus. Und sagen Sie ihm, dass ich für alles, was er für mich und Daniel Mason getan hat, aufrichtig dankbar bin.«
Sie beendete gerade das Gespräch, als es an der Tür klopfte. Da sie im Moment keinen der anderen sehen, geschweige denn mit ihnen sprechen wollte, tat sie so, als hätte sie das Klopfen nicht gehört, drehte die Musik lauter und legte sich wieder aufs Bett. Doch es half nichts. Als sie auch auf das zweite Klopfen nicht reagierte, wurde die Tür einfach geöffnet.
»Komm mit«, forderte Wood im Befehlston eines Drill-Sergeants. »Wir müssen uns unterhalten.«
»Nicht jetzt«, murmelte Elizabeth und rollte sich von ihm weg auf die Seite. Einer Diskussion mit Wood fühlte sie sich im Moment nicht gewachsen. Morgen Früh durfte er ihr gerne wieder Vorhaltungen machen, aber bis dahin würde sie sich mit lauter Musik und Daniels Foto in ihrem Zimmer verkriechen.
»Doch, jetzt«, ließ Wood nicht locker. Mit zwei langen Schritten stand er am Bett. »Hör dir an, was Riley zu sagen hat.«
»Riley?« Verwundert drehte Elizabeth den Kopf und sah zu Wood auf. Er war wieder gänzlich zu dem mürrischen und spröden Mann geworden, der sie nach dem Überfall im Krankenhaus aufgesucht und auf dem Yard verhört hatte. Und es war allein ihre Schuld. »Na schön«, seufzte sie, erhob sich und folgte ihm in den Wohnbereich, wo Riley und Susan bereits auf sie warteten und ihnen unbehaglich entgegen sahen.
»Sag es ihr«, forderte Wood den Jungen auf, während er sich neben Susan auf die Couch fallen ließ.
Elizabeth blieb mit verschränkten Armen vor dem Kamin stehen. »Was sollst du mir sagen?«, fragte sie, als Riley nur stirnrunzelnd auf seine Hände starrte.
»Ich habe Tony und Susan erzählt, dass ich noch nie von einem … einem Ruf der anderen Seite gehört habe und auch nichts dazu in meinen diversen Quellen finden konnte.« Seufzend blickte er auf. »Die Sache ist die, Bets: Meiner doch recht beträchtlichen Erfahrung nach liegt es an den Geistern selbst, wann es an der Zeit ist, hinüberzuwechseln. In der Regel ist das der Fall, wenn sie ihre offenen Angelegenheiten geregelt und somit ihren Frieden gefunden haben. Verstehst du, sie müssen sagen:Okay, ich bin jetzt soweit, damit sie gehen können. Und Danny … Danny war ganz sicher nicht soweit.«
»Was soll das heißen?«, flüsterte Elizabeth. »Er wurde gerufen. Von dem Morgen an, als mir das Amulett gestohlen worden war, wurde er gerufen. Das weißt du so gut wie ich.« Sie meinte seekrank zu werden. Ihr Kopf schwamm, und ihr Magen fühlte sich an, als würde er zwischen zwei Mühlsteinen zermahlen. Unter den Blicken der anderen ging sie zu einem Sessel und ließ sich auf der Kante nieder, die Fäuste in den Bauch gepresst. »Und Sir Thomas … Sir Thomas sagte, dass Geister, die sich zu lange dem Ruf widersetzen und das Zeitfenster verpassen, in alle Ewigkeit in dieser Welt festsitzen und zu einem verblassenden Schatten ihrer selbst werden. Er sagte, Dorian sei genau das passiert, und er wäre jetzt für immer von seiner Eleonor getrennt. Und gestern früh meinte Danny, dass der Ruf schwächer würde.« Kopfschüttelnd sah sie zu Riley. »Du musst dich irren!«
Anstelle des Jungen antwortete Wood: »Und was lässt dich glauben, dass ein greiser Antiquitätenhändler mehr von diesen Dingen versteht als Riley, der schon sein ganzes Leben lang mit Geistern zu tun hat?«
»Sir Thomas weiß solche Dinge!«, fuhr Elizabeth auf. »Er beschäftigt sich wahrscheinlich länger mit diesem Thema als Riley überhaupt auf der Welt ist. Er war es, von dem wir erfuhren, dass Geister bei Sonnenauf- und –untergang Substanz erhalten. Er hat eine Erklärung für den Ruf geliefert, wohingegen Riley noch nicht einmal von ihm gehört hatte!«
»Aber warum hast du seine Geschichte mit dem Ruf so einfach hingenommen und nicht hinterfragt?«, rief Wood. »Warum hast du nicht mit Riley drüber gesprochen? Warum hast du nicht mitmirgesprochen?«
»Weil Sir Thomas bisher mit allem Recht gehabt hatte!« Elizabeths Eispanzer war bis auf eine gefährlich dünne Schicht zusammengeschmolzen. Sie konnte ihre Tränen nicht länger zurückhalten. »Und mir lief die Zeit davon! Schließlich wurde der Ruf bereits schwächer und ich wusste doch nicht, ob es eine weitere Chance für Danny geben würde. Schon am nächsten Morgen hätte der Ruf völlig verschwunden sein können. Ich wollte … nein, ichkonntenicht riskieren, dass ihm die andere Seite auf ewig verwehrt bleibt, nur weil ich so egoistisch bin und ihn bei mir haben will. Das konnte ich doch nicht zulassen!« Der Eispanzer brach nun völlig zusammen und heftiges Schluchzen erschütterte ihren Körper.
»Du hättest mit uns reden müssen, Elizabeth.« Wood Stimme war jetzt leiser, aber noch immer zornig. »Du hättest mitDannyreden müssen! Du hattest kein Recht, so eine Entscheidung alleine zu treffen!«
»Aber er hätte doch nie und nimmer eingewilligt, zu gehen! Und das Risiko, ihn mit meinem Zögern zu so einem grausigen Schicksal zu verdammen, war einfach zu groß!«
»Bets«, meldete sich Riley nun wieder zu Wort. Im Gegensatz zu Wood klang er ruhig und sachlich, ja, sogar ein wenig mitfühlend. »Ich bin Geistern begegnet, die Jahrzehnte lang rumspukten, bevor sie ohne Probleme ins Licht gingen.«
»Sir Thomas sagte, dass das Zeitfenster vermutlich für jeden anders sei …«, warf Elizabeth ein.
»Das mag ja schon sein«, winkte Riley ab, »aber der Knackpunkt ist der, dass sie alle freiwillig gingen, und nicht gerufen wurden.«
»Aber Danny wurde gerufen! Bei jedem verdammten Morgengrauen! Und hätte ich ihn nicht gehalten, wäre er schon vor einer Woche fort gewesen. Danny vermutete, dass davor das Amulett den Ruf unterdrückt hatte, dass er aber von Anfang an da gewesen war. Könnte das nicht der Unterschied sein, Riley? Dass er eigentlich gar nicht hier sein sollte und es deshalb ein Zeitlimit für ihn gab?«
»Ich glaube, kein Geist sollte eigentlich hier sein, Bets. Deshalb suchen sie ja nach Erlösung. Und am Ende gehen sie alle ins Licht. Für manche dauert das nur eben länger als für andere. Ich habe noch nie von Hamiltonsschwindenden Schattengehört, geschweige denn bin ich einem begegnet. Ich persönlich denke, dass dieser Ruf, was immer es auch war, und woher er auch kam, nicht Dannys letzte Chance gewesen wäre, hinüberzuwechseln. So etwas wie ewige Verdammnis gibt es nicht, da bin ich mir ziemlich sicher.«
»Also denkst du, ich hätte ihn weiterhin halten sollen? Dass uns unbegrenzt Zeit zur Verfügung gestanden hätte?« Kopfschüttelnd biss Elizabeth auf ihre Unterlippe. »Aber ich konnte es doch nicht riskieren … Was, wenn du unrecht hast? Du sagst doch selbst, dass du noch nie von dem Ruf gehört hast, und doch war er da, das lässt sich nicht leugnen. Und neulich hast du gesagt, dass dir noch nie ein Geist wie Danny begegnet wäre, und du wusstest auch nicht, dass er mich dank des Amuletts überall finden konnte.« Sie schüttelte erneut den Kopf. »Du weißt vielleicht viel, aber nicht alles, Riley!«
»Wie dem auch sei«, schaltete sich Wood wieder ein. «Du hättest damit zu uns kommen und keine voreiligen Entscheidungen treffen sollen!«
»Glaubt ihr etwa, mir sei das leicht gefallen?« Elizabeth sprang auf und lief, die Fäuste noch immer in den Bauch gepresst, vor der Couch auf und ab. »Ich musste Danny gehen lassen! Meine große Liebe … Alles, wovon ich träumte, war mit Danny zusammen zu sein, und die Opfer, die dazu nötig gewesen wären, hätte ich ohne auch nur mit der Wimper zu zucken gebracht. Es war die schwerste Entscheidung meines Lebens, und ihr tut so, als hätte ich ihn leichtfertig fortgeschickt, weil er mir nichts bedeutete. Dabei war erallesfür mich!« Abrupt blieb sie stehen als wäre sie gegen eine unsichtbare Wand gelaufen. Hatte sie etwa gerade in der Vergangenheitsform von ihm gesprochen? »Egal wo du auch bist, du wirst immer die Welt für mich sein«, wiederholte sie kaum hörbar die letzten Worte, die sie an ihn gerichtet hatte.
Dann wirbelte sie auf dem Absatz herum und stürmte in ihr Zimmer.
Fast erwartete sie, dass ihr jemand folgte, Susan vielleicht, die ein paar unerwünschte tröstende Worte für sie parat hatte, doch zu ihrer Erleichterung kam ihr niemand nach. Eine Weile lehnte sie schwer atmend an der Tür, bevor sie sich abstieß und auf die Dachterrasse lief.
»Es tut mir so leid, Danny!« Keuchend klammerte sie sich an die Brüstung und lehnte sich leicht darüber. »Furchtbar leid. Ich war mir sicher, das einzig Richtige zu tun.« Eine alte Redensart kam ihr in den Sinn:Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten.
Hatte sie tatsächlich das Richtige getan? Warum war sie wirklich so schnell bereit gewesen, Hamiltons Geschichte vom Ruf der anderen Seite Glauben zu schenken und hatte keine Sekunde lang daran gezweifelt? Auch wenn der alte Herr offenkundig von der Geschichte überzeugt war, so konnte sie trotzdem nicht mehr als eine Theorie sein. Woher sollte er es denn mit Sicherheit wissen?
Die Wahrheit war, dass Elizabeth tief in ihrem Inneren darauf gewartet hatte. Auf dieses Ultimatum, dieses drohende Unheil, das ihr Daniel wieder wegnehmen würde. Von Anfang an hatte beständig die Sorge an ihr genagt, dass das alles viel zu schön war, um von Dauer zu sein. Dass ihnen keine zweite Chance, sondern nur ein Aufschub geschenkt worden war. Tief in ihrem Herzen hatte sie gewusst, dass der Tag kommen würde, an dem sie ihn erneut verlor. Hamiltons Geschichte war nur der Kiesel gewesen, der die Lawine ins Rollen gebracht hatte.
Aber die Geschichte war doch auch plausibel, und sie war ihr zum genau richtigen Zeitpunkt zugetragen worden, nämlich als der Ruf bereits schwächer geworden war. Also war es vielleicht doch die einzige Möglichkeit gewesen, Daniel zu retten.
Wie auch immer, die anderen hatten völlig recht: Wie hatte sie diese Entscheidung nur über Daniels Kopf hinweg treffen können? Elizabeth hätte es nie und nimmer für sich behalten dürfen, das war ihr nun klar. Zumindest Rileys Rat hätte sie einholen müssen. Er hätte die Sache objektiver betrachtet.
Nach der Beerdigung, als sie von Wood erfahren hatte, was Daniel alles vor ihr verheimlichte, hatte sie ihm eine Szene gemacht, weil er sie über den Ermittlungsstand im Dunklen gelassen hatte, nur um sie zu schützen. Sie war so wütend auf ihn gewesen!
Und dann hatte sie das Gleiche getan: Weil sie ihn beschützen wollte, hatte sie Geheimnisse vor ihm gehabt und ihn nicht in ihre Absichten eingeweiht. Nur dass die Konsequenzen ihrer Entscheidung tausendmal weitreichender waren und nicht mehr rückgängig gemacht werden konnten. Nun blieb ihr nichts anderes übrig, als zu lernen, mit ihrer Entscheidung zu leben.
Doch musste sie das tatsächlich?
Mit geweiteten Augen starrte sie in die Tiefe, auf den Verkehr und die Fußgänger. Der Wind wehte ihr Haarsträhnen ins Gesicht, die sie abwesend hinters Ohr strich.
Zwölf Stockwerke. Ganz sicher nicht hoch genug, damit man während des Falls das Bewusstsein verlor und den Aufprall nicht mehr mit bekam.
Dennoch, es wäre ganz leicht, geradezu ein Klacks. Nur über das Geländer beugen und sich fallen lassen. Fast, als könnte man fliegen. Es würde ganz schnell gehen, und in wenigen Augenblicken wäre sie in Daniels Armen.Es wäre so einfach, jetzt alles zu beenden. Den Schmerz nicht mehr zu fühlen …
Nein!
Angewidert trat sie einen Schritt zurück. So leicht würde sie sich nicht aus der Affäre ziehen. Sie musste helfen, die Mörder zur Strecke bringen. Für Daniel. Das war sie ihm schuldig, jetzt sogar noch mehr, nachdem sie ihm die Möglichkeit genommen hatte, selbst an den Ermittlungen teilzuhaben. Aber danach … danach würde sie weitersehen.
»Ich weiß, dass du das nicht gutheißt«, flüsterte sie. »Du möchtest, dass ich mein Leben lebe und ich verspreche dir, es zu versuchen. Aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, wie lange ich es schaffen werde ohne dich weiterzumachen. Ich brauche dich, Danny!«
Mit steifen Schritten ging sie zurück ins Zimmer und holte ihre Reisetasche aus dem Schrank. Hier war sie nicht länger willkommen, das war offensichtlich. Ihre eigenmächtige Entscheidung hatte sie nicht nur Daniel, sondern auch ihre Verbündeten gekostet.
Während sie mit mechanischen Bewegungen ihre Sachen in die Tasche packte, überlegte sie, wohin sie gehen sollte. Ihre Wohnung war keine Option, da die Thuggees sie dort mit Sicherheit aufspüren würden, und die vertraute Umgebung Oxfords war zwar verlockend, doch konnte sie von dort aus die Recherchen nicht weiterführen.
Ihr Blick fiel auf Daniels Foto, das noch immer auf dem Kissen lag. Da wusste Elizabeth, wohin ihr Weg sie führen würde.
3
»Maybe there’s a God above, but all I’ve ever learned from love, was how to shoot at someone who outdrew you.«Leise singend saß Elizabeth im Gras, die Augen geschlossen und den Kopf an die Rückseite des frisch gesetzten Grabsteins gelehnt. Ihre Wangen waren nass von den ungezählten Tränen, die gar nicht mehr versiegen wollten.
Seit Sonnenaufgang war sie auf dem Friedhof, der nur wenige Minuten von dem kleinen Hotel entfernt lag, in dem sie sich in der vergangenen Nacht ein Zimmer genommen hatte.
Es war bereits nach neun, doch noch immer lag ein morgendlicher Dunstschleier über der Stadt und das Gras war feucht vom Tau.
Nachdem es gegen Mitternacht im Penthouse still geworden war, hatte sich Elizabeth bepackt mit ihrer Reisetasche und Daniels Gitarrenkoffer hinausgeschlichen und von einem Taxi nach Highgate fahren lassen. Der Fahrer hatte ihr das Hotel empfohlen, das ziemlich genau in der Mitte zwischen Daniels Wohnung und dem Friedhof lag. Sie hatte ein winziges Zimmer bezogen und dort eine schlaflose Nacht verbracht, in der sie darüber nachgegrübelt hatte, wie sie die Recherchen alleine fortführen und ihre Ergebnisse gegebenenfalls an Wood weitergeben konnte. Ihr war durchaus bewusst, dass sie zwar ihren Beitrag leisten konnte, aber alleine nie imstande sein würde, dem Kult das Handwerk zu legen.
»And it’s not a cry that you hear at night. It’s not somebody who’s seen the light.«
Elizabeth konnte sich nicht erinnern, wann sie sich jemals zuvor so alleine und auf sich gestellt gefühlt hatte, wie in dieser nicht enden wollenden Nacht. Als es dann endlich zu dämmern begonnen hatte, war sie in Jeans und Sweatjacke geschlüpft, um bei Sonnenaufgang bei Daniel zu sein.
»It’s a cold and it’s a broken Hallelujah.«
»Also das mit der Gesangskarriere kannst du vergessen.«
Die Tränen wegblinzelnd öffnete Elizabeth die Augen und stöhnte innerlich auf, als sie Wood vor sich stehen sah. Was machte der denn hier? War sie noch nicht mal auf dem Friedhof vor seinen Vorwürfen sicher?
»Das ist Hallelujah von Leonard Cohen. Auf gewisse Weise war das unser Lied«, seufzte sie. Mit dem Handrücken wischte sie die Tränen von der Wange. »Und er hat mich nie singen gehört.«
»Das war wohl auch besser so«, erwiderte Wood trocken und ließ sich neben ihr nieder. Er trug eine schwarze Anzughose und ein schwarzes Poloshirt, was ihm ein wenig das Aussehen eines Geistlichen verlieh. »Was tust du hier, Elizabeth? Du weißt besser als jeder andere, dass er nicht hier ist.« Er klang kein bisschen anklagend, sondern überraschend liebenswürdig.
»Ich will ihm einfach nur nahe sein«, gab sie mit einem müden Schulterzucken zurück. »Aber egal was ich auch versuche, ich spüre seine Nähe nicht.«
»Tja, ich schätze andere Hinterbliebene können sich mit der Vorstellung trösten, dass ihre Lieben immer bei ihnen sind und über sie wachen. Sie sehen sie zwar nicht, aber sie sind sich doch sicher, ihre Anwesenheit zu spüren. Den Luxus hast du leider nicht.«
»Nein … scheinbar nicht«, flüsterte Elizabeth. »Und was machst du hier, Tony?«
»Na, ich habe dich gesucht.«
»Tatsächlich? Ich dachte du wärst froh, mich aus den Augen zu haben.«
Wood legte einen Arm um ihre Schultern. Eine Sekunde lang war Elizabeth geneigt, den Arm einfach abzustreifen, doch stattdessen blieb sie regungslos sitzen.
»Ich muss mich wohl mal wieder für meine ruppige Art entschuldigen«, sagte er und suchte ihren Blick. »Es tut mir leid, Elizabeth. Ich hätte nicht so auf dich losgehen dürfen. Das war nicht fair.«
Vor Überraschung blieb Elizabeth einen Moment die Luft weg. Dann sagte sie: »Nein, Tony. Ich bin es, die um Verzeihung bitten muss. Du hattest recht. Mit allem, was du gesagt hast.«
»Schon möglich.« Der Schatten eines Lächelns erschien auf seinem Gesicht, und er zuckte leicht mit den Schultern. »Aber das war noch lange kein Grund, so mit dir umzuspringen. Und ich denke, ich verstehe jetzt, warum du so gehandelt hast. Warum du glaubst, keine andere Wahl gehabt zu haben. Ich meine, ich bin nach wie vor der Ansicht, dass du es nicht für dich hättest behalten dürfen, vor allem nicht Danny gegenüber. Aber ich verstehe dich.«
»Hat Susan mit dir geredet?«
»Oh ja«, bestätigte er, ohne eine Miene zu verziehen. »Sehr lange.«
Nun huschte auch ein winziges Lächeln über Elizabeths Gesicht, bevor sie den Blick auf ihre Hände senkte. »Denkst du, er versteht es ebenfalls? Denkst du, er verzeiht mir?«
»Da bin ich mir ganz sicher.« Tröstend drückte er ihren Oberarm. »Er liebt dich, Elizabeth. Ganz egal, wo er jetzt auch ist und was du getan hast, er liebt dich. Und deshalb würde er dir alles verzeihen. Und außerdem … Wäre der Fall andersherum gelegen, bin ich überzeugt, Danny hätte nicht anders gehandelt. Ihr seid nämlich beide die gleichen Dickköpfe mit Beschützerkomplex.«
Elizabeth erkannte Wood kaum wieder. Vor allem nicht nach dem gestrigen Tag. So warmherzig und einfühlsam hatte sie ihn lediglich an jenem Abend erlebt, als ihr das Amulett gestohlen worden war. Susan schien einen ziemlich positiven Einfluss auf ihn haben.
Sie konnte nicht verhindern, dass sich neue Tränen einen Weg über ihr Gesicht bahnten. Erstaunlich, dass sie noch immer welche zustande brachte. Eigentlich müsste sie doch schon so ausgedörrt sein wie eine Trockenpflaume.
»Weißt du, was ich mir gerade vorstelle?«, fuhr Wood leise lächelnd fort. »Dass er jetzt, genau in diesem Moment, einen tollen Gig hat, mit Elvis Presley, Freddie Mercury und Jim Morrison.«
Elizabeth lachte auf, sie konnte einfach nicht anders. »Was für eine großartige Vorstellung!«
»Ja, nicht wahr?«, nickte Wood und rubbelte noch mal ihren Arm. »Ich habe hier etwas für dich.« Mit der freien Hand holte er ein geflochtenes, schwarzes Lederarmband aus seiner Hosentasche und reichte es ihr.
Zum zweiten Mal an diesem Morgen machte Wood sie sprachlos. Ohne sich zu bewegen, starrte sie auf das kurze Lederband, das sie sofort wiedererkannt hatte. Daniel hatte es bei dem Überfall getragen und somit auch in seiner körperlosen Gestalt.
»Nun nimm es schon«, drängte Wood. »Ich bin mir sicher, Danny will, dass du es hast.«
»Danke, Tony«, hauchte Elizabeth. Sie griff nach dem Band und legte es umgehend an, auch wenn es für ihr schmales Handgelenk viel zu weit war. »Danke!«
»Keine Ursache. Nur lass es dir nicht wieder klauen, okay? Und jetzt komm. Gehen wir nach Hause. Sue wartet bestimmt schon mit dem Frühstück.«
»Meinst du wirklich?«, fragte Elizabeth zögernd. »Ich bin nicht sicher, ob … nun, ob ich noch dazugehöre.«
»Ob du noch dazugehörst? Soll das ein Witz sein? Elizabeth, du bist das Herz der ganzen Sache. Sozusagen der Chef des Scooby-Doo Clubs.«
»Ehrlich?«
Wood fand wohl, dass diese Frage keine Antwort verdiente, denn er schüttelte nur augenrollend den Kopf und erhob sich. »Na los, die Pancakes werden kalt.« Auffordernd hielt er ihr eine Hand entgegen.
»Ich habe noch meine Sachen im Hotel …«
»Kein Problem, die holen wir auf dem Weg.«
Endgültig überzeugt ergriff Elizabeth seine Hand und ließ sich von ihm in die Höhe ziehen.
Bevor sie gingen, trat sie vor das Grab, auf dem noch immer Kränze und Gebinde von der Beerdigung lagen. Ganz vorne stand eine große Vase mit frischen, weißen Callas. Sie kniete sich nieder und zupfte die verwelkten Blüten aus den Gebinden.
»Sie haben einen schönen Stein ausgesucht, nicht wahr?«, sagte sie leise, als Wood neben sie trat. »Und auch die Inschrift ist perfekt.«
Daniels Familie hatte sich für einen schlichten, beinahe schwarzen Granitstein entschieden, auf dem neben seinem Namen und den Geburts- und Sterbedaten stand:
Die Menschen,
Deren Herz du berührtest,
Werden dich immer lieben
Und niemals vergessen.
Elizabeth erhob sich und warf eine Handvoll verwelkter Blumen unter einen Strauch. Sie küsste ihre Fingerspitzen, ehe sie den eingravierten, goldfarben hinterlegten Namenszug entlang strich. »Ich liebe dich, Danny«, flüsterte sie. »Jetzt und für immer.«
Auch Wood strich zum Abschied über die Oberkante des Steins und murmelte: »Machs gut, Kumpel. Und keine Sorge, ich passe gut auf sie auf.«
Dann wandten sie sich um und gingen zum Wagen.
»Woher wusstest du eigentlich, wo ich bin?«, wollte Elizabeth wissen, als sie in Woods silbernen Aston Martin stieg.
»Also bitte«, schnaubte er. »Ich bin Ermittler. Ein bisschen was darfst du mir schon zutrauen.«
Das konnte Elizabeth nicht beeindrucken. »Du hast Mick mein Handy orten lassen, oder?«
»Jup«, bestätigte Wood und fuhr vom Parkplatz. »Hat genau zehn Minuten gedauert. Wenn du das nächste Mal nicht gefunden werden willst, schalte es aus oder wirf es weg.«
»Ich werd´s mir merken.« Etwas später fragte sie. »Hattest du gestern bei Clark und Stokes Erfolg? Hast du einen Namen?«
»Ja.« Er knurrte beinahe. »DAC Stan Gilbertson.«
Elizabeth hatte das starke Gefühl, den Namen schon mal gehört zu haben. Aber wo und in welchem Zusammenhang? Sie kam einfach nicht darauf. »Für was steht DAC?«
»Deputy Assistant Commissioner.«
»Kennst du ihn?«
»Nur flüchtig. Ich habe mal kurz auf einer Tagung mit ihm gesprochen. Schmieriger Emporkömmling.«
»Jetzt hat Mr Nadelstreifen also einen Namen … Musstest du ihn aus Clark und Stokes herausprügeln?«
»Leider nein.« Wood klang ehrlich enttäuscht. »Richard Merton hat versprochen, mir Gilbertsons Akte zu besorgen.«
Nachdem sie Elizabeths Gepäck aus dem Hotel geholt hatten, fuhren sie Richtung Kensington und passierten dabei Camden. »Ich weiß, die Pancakes werden kalt«, sagte sie. »Aber Sandra Headways Laden liegt praktisch auf dem Weg und ich würde gerne kurz mit ihr reden.«
»Die Hexe?«, fragte Wood nach. »Die wollte ich mir sowieso mal ansehen. Sag aber Sue nicht, dass wir ohne sie dort waren, okay?«
Er parkte direkt vor dem Ladeneingang. Dem Halteverbotsschild am Straßenrand würdigte er dabei keines Blickes. Elizabeth fragte sich, ob er vielleicht vergessen hatte, dass er nicht im Dienst war. Möglicherweise war das aber auch einfach die angeborene Ignoranz reicher Leute, die Strafzettel nebenher aus der Portokasse bezahlten.
Es war ein seltsames Gefühl, ohne Daniel hierher zurückzukommen. Wood betrat als Erster den Laden und sah sich staunend in dem gold- und purpurfarbenen Sammelsurium magischer Utensilien um. »Wow.«
»Ja, wow … und irgendwo gibt es bestimmt auch Phönixfedern«, wiederholte Elizabeth Daniels Worte bei ihrem letzten Besuch und versuchte dabei, das intensive Déjá-vu Gefühl zu verdrängen. Sie drückte sie an Wood vorbei und trat an die Theke. »Sans?«, rief sie in das Hinterzimmer. »Hallo?«
»Ich bin hier, Elizabeth«, sagte eine warme Stimme, und sowohl Elizabeth als auch Wood fuhren erschrocken zusammen.
Direkt neben der Theke stand Sandra Headway, ein sehr zufriedenes Lächeln zur Schau tragend. Wie konnten sie die blonde Frau nur übersehen haben? Sans stand doch nur wenige Schritte von ihnen entfernt! Und sie sah wieder einmal aufsehenerregend aus, in ihrer geschnürten goldenen Korsage über einem cremefarbenen Spitzenoberteil sowie einem langen, freischwingenden Rock in der gleichen Farbe.
»Was …«, setzte Wood an, doch er verstummte, als Sandra auf Elizabeth zuging und sie in die Arme schloss.
»Was ist nur passiert? In dir ist so viel Schmerz und Trauer«, hauchte die Frau. Unbehaglich tätschelte Elizabeth Sandras Rücken, dann entließ die Hexe sie aus ihrer Umarmung und sah zu Wood. »Auch für dich tut es mir sehr leid. Du hast ebenfalls einen schmerzlichen Verlust erlitten.«
»Ja … aber«, versuchte Wood es erneut, doch Sandra war noch nicht fertig. »Ihr müsst daran glauben, dass alles auf dieser Welt aus einem bestimmten Grund geschieht. Ihr mögt es jetzt noch nicht verstehen, aber ihr müsst darauf vertrauen, auch wenn es schwerfällt. Ihr befindet euch auf einem prüfungsreichen Weg, den ihr nur mit vereinten Kräften meistern werdet. Doch wählt eure Verbündeten gut …« Ein verlegenes Lächeln trat auf ihr Gesicht. »Ich plappere schon wieder, nicht wahr? Entschuldigt bitte.« Kopfschüttelnd trat sie hinter die Theke. »Wie hat euch mein kleiner Zauber gefallen?«
Sowohl Elizabeth als auch Wood hingen in Gedanken noch immer Sandras Worten nach, deshalb fragte Elizabeth mit einiger Verspätung: »Welcher Zauber?«
»Na, mein Unsichtbarkeitszauber. Oder besser: Unscheinbarkeitszauber. Richtige Unsichtbarkeit gibt es nicht. Aber ich finde, das war schon ziemlich nah dran. Ich bin gerade dabei, den Zauber zu perfektionieren, wisst ihr?«
»Wie funktioniert das?«, wollte Elizabeth wissen, während Wood murmelte: »Unsichtbarkeitszauber! Das glaubt mir doch keiner!«
»Nun ja«, beantwortete Sandra die Frage. »Im Grunde ist es die Umkehrung des Attraktivitätszaubers, dessen Zeuge du neulich wurdest. Anstelle jedoch die positiven Attribute einer Person hervorzuheben, und damit die Aufmerksamkeit der Menschen in der näheren Umgebung auf sie zu lenken, wird die Aufmerksamkeit von der Person weggelenkt. Die Person wird vollkommen uninteressant, sodass die Menschen einfach über sie hinweg sehen. Und damit wird sie von ihrem Umfeld nicht mehr wahrgenommen.«
»Wie ein blinder Fleck im Gesichtsfeld«, sagte Elizabeth, was Sandra begeistert nickend bestätigte.
»Wie praktisch«, bemerkte Wood grimmig. »Vor allem für Taschendiebe und Einbrecher.«
»Oder hinterhältige Angreifer«, ergänzte Elizabeth leise.
»Oh nein!«, rief Sandra bestürzt. »Ich würde niemals zulassen, dass Magie für so etwas missbraucht wird. Als Zaubermächtige hat man eine Verantwortung!«
»Überaus beruhigend«, brummte Wood.
»Aber wie kann ich euch helfen? Habt ihr noch weitere Fragen wegen Ian?«
»Nun«, setzte Elizabeth verlegen an. »Es hat den Anschein, als seien wir mit dem Bhowanee-Kult auf der richtigen Spur, denn offenbar fühlt sich jemand durch uns bedroht. Die Frage ist nur, woher wissen die Täter, welcher Spur wir folgen?«
»Du willst wissen, ob ich mit jemandem über unsere Unterhaltung gesprochen habe«, zog Sandra den richtigen Schluss. »Nun, ich habe mich in der Tat mit ein paar Freunden darüber unterhalten. Ich konnte einfach nicht fassen, dass es hier einen Zirkel oder einen Kult geben sollte, der im Namen der Schwarzen so grausame Morde begeht. Das ist etwas, das die gesamte Hexengemeinschaft angeht. Es könnte das Gleichgewicht bedrohen.«
»Haben Sie mich dabei auch erwähnt?«
»Nicht mit Namen, nein. Nur, dass eine Ermittlerin mich darauf aufmerksam gemacht hat.«
»Wie haben Ihre Freunde auf die Geschichte reagiert?«, wollte Wood wissen.
»Sie waren genauso schockiert wie ich. Keiner von ihnen hatte davon gehört.«
»Und deshalb erzählten sie die schockierende Geschichte natürlich weiter«, meinte Wood. »Bis sie schließlich an der richtigen Stelle ankam, und jemand eins und eins zusammenzählte.«
»Glaubst du wirklich?« Sandra wirkte bestürzt. »Könnte ich damit eure Ermittlungen in Gefahr gebracht haben?«
»Na, zumindest erschwert«, seufzte Wood.
»Das tut mir ehrlich leid. Kann ich es irgendwie wieder gut machen? Ich könnte für euch die Runen befragen.«
Elizabeth horchte auf. »Tatsächlich? Das wäre ja …«
»Danke«, fuhr Wood schnell dazwischen. »Ein anderes Mal vielleicht. Wir müssen jetzt gehen.«
Damit legte er einen Arm um Elizabeths Schultern und schob sie Richtung Ausgang, doch sie tauchte unter seinem Arm hindurch und drehte sich wieder zu Sandra.
»Sans«, sagte sie mit vor Erregung bebender Stimme. »Können Sie Kontakt mit der anderen Seite aufnehmen? Mithilfe der Runen, meine ich. Oder gibt es dafür vielleicht einen Zauber?«
»Elizabeth!«, rief Wood.
»Nein«, sagte Sandra bedauernd. »Diese Art Magie praktiziere ich nicht. Sie ist gefährlich und bringt nur selten etwas Gutes hervor.«





























