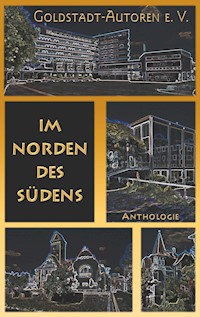Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Der Kleine Buch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein junger Millionär, ein krimineller Landschaftskultivator aus Barbados, zwei Busfahrer, das bestbezahlteste Call Girl der Stadt und ein ausgesetzter Säugling … Metertiefe Gruben finden sich im Park des jungen Millionärs und erdrückende Spuren in seiner High-Tech-Kubusvilla. Er selbst scheint unter dubiosen Umständen adoptiert worden zu sein. Nun fällt die Gier in seine kuriose meditative Existenz ein und alles gerät aus den Fugen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Gekonnt wird exotisches Obst in einer verrauchten Bar mundgerecht zerlegt. Kein Jahr später findet ein Busfahrer einen ausgesetzten Säugling und nimmt sich seiner an. Jonathan entpuppt sich als Wunderkind. Sein mathematisches Genie verhilft ihm zu Reichtum und lässt ihn gleichzeitig bluten. Neid und Gier, die Frage nach der Herkunft und der Glaube daran, dass einem von Bluts wegen etwas zusteht, werden ihm zum Verhängnis. Seine Vergangenheit holt ihn ein, die Geschehnisse in seiner Villa spitzen sich zu und machen ihn zum Täter und Opfer zugleich.
Die Autorin
Uschi Gassler, 1957 im oberfränkischen Kronach geboren, wohnt mit ihrer Familie im badischen Königsbach-Stein. Die gelernte Industriekauffrau arbeitet heute bei einem Kreditinstitut. Sie durchlief die Weltbild-Autorenschule und das Fernstudium Schule des Schreibens. Seit 2009 veröffentlicht sie Kurzkrimis. Gier ist dicker als Blut ist ihr erster Roman.
USCHI GASSLER
G I E RIST DICKER ALSB L U T
ROMAN
DER KLEINE BUCH VERLAG
Die Handlung des Romans ist frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen sowie realen Geschehnissen ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der DeutschenNationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unterwww.dnb.de abrufbar.
© 2015 Der Kleine Buch Verlag, KarlsruheProjektmanagement & Lektorat: Tatjana WeißKorrektorat: Natascha MatussekUmschlaggestaltung: Manuela Wirtz, www.manuwirtz.deUmschlagabbildung: Ying Feng Johansson / 123RF.comSatz & Layout: Beatrice Hildebrand
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes (auch Fotokopien, Mikroverfilmung und Übersetzung) ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt auch ausdrücklich für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen jeder Art und von jedem Betreiber.
ISBN 978-3-942637-80-0
Dieser Titel ist auch als Printausgabe erschienen:ISBN 978-3-942637-73-2
www.derkleinebuchverlag.de
www.facebook.com/DerKleineBuchVerlag
Für alle, die mir mit Geduld und Verständnis zur Seite standen.
VERLEUGNEST DU DEINE VERGANGENHEIT, TÖTEST DU DEINE ZUKUNFT.
PROLOG
Der Vater ein Mörder, die Mutter eine Schlampe – das Leben ist so ungerecht. Dieses niederschmetternde Wissen raubt ihm alle Kraft.
Er will damit nicht leben, will sterben.
Alles tut so weh.
Gesichter erscheinen vor seinen Augen, verbreiten Hektik, verschwimmen, verschwinden.
Die Schmerzen versiegen, er kann sich entspannen, sich erfreuen. Am vielen Geld – die Entschädigung für eine schicksalhafte Ungerechtigkeit. Das Geld, mit dem er sich alles kaufen kann, nur nicht seine Herkunft.
Stimmen wollen Zugang finden, zu ihm, zu seinen Gedanken. Wollen ihn herausholen aus seinem Kokon. Er lässt es nicht zu.
Er will heim, sein Haus wartet auf ihn.
Einsam, verwaist, so wie er.
Er braucht seine Höhle, wo er sich verkriechen kann, wo er sein kann, wie er ist.
Da steht jemand vor dem Tor, grinst, lehnt lässig am Heck eines roten Mustangs, raucht.
»Was willst du?«, schreit er den Eindringling an.
»Mit dir reden«, sagt der. Als wolle er um die verlorene Freundschaft buhlen, ihm Geld abluchsen.
Nicht mit ihm, nicht jetzt, zu spät.
»Komm rein«, sagt er dann. Es ist an der Zeit zu zeigen, was dem anderen niemals gehören wird.
Gier begleitet sie auf ihrem Rundgang. Eine unsägliche Gier.
Am Ende jagt er ihn fort, weidet sich an der Enttäuschung, der Bitterkeit, ja dem Hass im Gesicht des anderen.
Er ist berauscht von dem Wissen: Der wird niemals über diese Niederlage hinwegkommen.
Ihm egal.
Er will schlafen.
Nur noch schlafen.
Die Dunkelheit fängt ihn wieder ein.
I
Nichts ist vollkommen. Nicht einmal das Paradies. Denn dazu bedürfte es des strikten Verbots, Zeitungen aus der westlichen Wirtschaftswelt zu importieren.
Die hochstehende Sonne zeigte sich, wie sie in diesen Breitengraden nun einmal den Anstand hatte, von ihrer freundlichsten Seite. Eine zaghafte Brise wehte sanft vom Meer her durch die hochragenden Palmwipfel.
Von der Terrasse des kleinen Strandbungalows aus bot sich ein bezaubernder Blick auf das türkisblaue Meer.
Anton Romberg genoss diese Aussicht bereits viele Jahre. Sie war für ihn zur Selbstverständlichkeit geworden. Der freischaffende Handwerker hatte damals, als er ausgewandert war, noch beste Chancen gehabt, sich mit Energie und Ausdauer ein gutes Auskommen zu erarbeiten. Er hatte sich auf Barbados als Landschaftskultivator selbstständig gemacht. Hotels und Parkanlagen gab es reichlich, jeder war froh, einem kreativen Deutschen die Hege und Pflege des satten Grüns und der bunten Rabatten anvertrauen zu dürfen. Der Dollar rollte, Romberg konnte sich schon bald mitten im Karibikparadies den kleinen Bungalow bauen und selbst auf der faulen Haut liegen. Was seine Chancen bei den hiesigen Damen ungemein erhöhte und er weidlich ausnutzte.
Auch an diesem Samstagmorgen räkelte er sich im wohltuenden Schatten des riesigen Sonnenschirms, flankiert von zwei exotischen Schönheiten, die selbstverständlich irgendwann, wie schon so viele vor ihnen, ausgetauscht werden würden.
Er warf einen Blick auf seine wasserdichte Timex-Armbanduhr aus Edelstahl, mit Zifferblattbeleuchtung und ewigem Kalender, in Deutschland entwickelt und über zweihundert Dollar wert – verärgert runzelte er die Stirn.
Miguel war schon wieder einen Tag überfällig. Angestrengt lauschte er gegen die Geräuschkulisse der Natur an. Das Tuckern von Miguels altersschwachem Pick-up konnte er trotzdem nicht hören. Der stets müde wirkende, dickliche Postbote brachte es einfach nicht fertig, die Zeitungen aus dem fernen Deutschland pünktlich zu liefern. Romberg verachtete Miguels Übertreibungen, ständig redete er davon, wie überarbeitet er war. Am späten Vormittag erschien er schließlich und strahlte breit über das rotbackige Gesicht.
Ungeduldig bedankte sich Romberg, hastig überreichte er ein Trinkgeld. Es trieb ihn zurück auf die Terrasse und er versank in der Nachrichtenwelt seiner alten Heimat. Sog die Informationen und Berichte in sich hinein wie frische Brause.
Der Himmel war blau, die Sonne gleißend, die Hände an seinen Wangen und Schultern zart. Er schnippte mit den Fingern und ihm wurde ein fruchtiger Drink gereicht, er brauchte lediglich an dem Röhrchen zu saugen. Kälte drang an seine empfindlichen Zähne, ein kurzes Fuchteln mit der rechten Hand und das Glas verschwand wieder. Besser konnte es einem Mann nahe dem Rentenalter überhaupt nicht gehen.
Aber von einer Sekunde zur anderen schenkte er dem famosen Arrangement um sich herum keine Aufmerksamkeit mehr. Seine Augen hatten sich an den ausgeblichenen Lettern des bereits zwei Monate alten EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSANZEIGERS festgesaugt. Er umkrallte das Papier, als wolle er jemanden mit bloßen Fingern erwürgen.
Junges Mathematikgenie aus dem badischen Karlsruhe endgültig in Millionärskreisen etabliert. Näheres Seite 10.
Energisch warf er die Zeitung zur Seite. Er zerrte sich die exklusive Armani-Sonnenbrille von der Nase, schmiss sie achtlos auf die Ablage, richtete sich auf und schubste mit den Ellbogen rücksichtslos die jungen Frauen von der Kante.
Er ignorierte ihre fragenden Blicke, riss die Zeitung wieder an sich und Seite um Seite hektisch herum, stockte und begann, den gesuchten Artikel Zeile für Zeile zu verschlingen.
Wie ein Märchen mutet der plötzliche Reichtum des 23-jährigen Jonathan F. an.
Gerade 18 geworden, spielte er zum ersten Mal Lotto und gewann den Jackpot in Höhe von 7,4 Millionen Euro. Dem mathematikbegeisterten damaligen Abiturienten war das nicht genug. Er legte das Geld in gewinnbringenden Aktien an. Die wundersame Geldvermehrung nahm ihren Lauf.
Wie viel genau er heute besitzt, verrät der gut aussehende, scheue Student wohlweislich nicht. Dennoch ist sicher, er hat sich einen respektablen Platz in der Rangliste der deutschen Millionäre ergattert. Er schenkte seinen Eltern, einem Busfahrer und einer Schneiderin, eine komfortable Wohnung und ein neues Auto. Sich selbst gönnte er, neben zwei luxuriösen Fahrzeugen, eine extravagante Villa.
Der Suizid eines angeblichen Mitspielers, dessen Anteil er unterschlagen haben soll, ist für den jungen Millionär kein Thema. Er verweist lediglich auf das im Februar 2010 ergangene Gerichtsurteil, das ihn als alleinigen Gewinner bestätigt. Auf die Frage nach seinen Zukunftsplänen gibt der medienscheue Jungaktionär keine Auskunft.
Romberg starrte auf das schwarzweiße Foto der Villa.
Eine viel zu lange Zeit schon hatte er den kleinen Scheißer im Visier. Dabei wäre er froh, wenn er es schaffen würde, ihn zu vergessen, ihn samt seiner ach so fabelhaften Bilderbucheltern vollständig aus dem Gedächtnis zu tilgen.
Aber das, was er jetzt las, wühlte alles wieder auf.
Auch den Neid. Vor allem den Neid.
Bereits der damalige Bericht über die Klage des Arztsohns auf Beteiligung an den Millionen und das überraschend abschlägige Urteil hatten ihn aufgeschreckt, dennoch auch auf ein baldiges Ende dieses Märchens hoffen lassen. Gleichgültig, ob durch Verschwendungssucht oder Börsencrash.
Dem war anscheinend nicht so und er hatte weiß Gott nicht damit gerechnet.
Schlagartig verging ihm die Lust auf sein wunderbares Leben am prächtigen Meeresstrand, die zärtlich massierenden Hände der blutjungen Mädchen und die ganze Idylle der Karibikinsel, die er seit vielen Jahren so innig liebte. Er musste handeln und zwar unverzüglich. Sonst würde er niemals Ruhe finden. Er musste nach Deutschland zurückkehren, obwohl er sich vor vielen Jahren geschworen hatte, dieses Land nie wieder zu betreten. Energisch knüllte er die Zeitung zusammen, sprang auf und verschwand im Inneren des Bungalows.
* * *
Das Kind schläft tief und fest.
Eingekuschelt in einen tiefblauen, dicken Winteroverall, die Kapuze über das Köpfchen gezogen, lose zugedeckt mit einer gelben Fleecedecke, die mit kleinen braunen Bärchen bedruckt ist, lächelt es, als schwebe es durch einen süßen Traum, hält ein weißes Stoffentchen an sich gedrückt und lutscht an seinem Daumen.
So findet er das Kind.
Verlassen liegt es auf der hintersten Bank seines Busses, als er ihn nach der letzten Tour pünktlich eine Viertelstunde vor Mitternacht auf dem Parkplatz der Städtischen Verkehrsbetriebe abstellt. Er wundert sich schon lange nicht mehr darüber, was die Leute so alles liegenlassen, gleichgültig, ob wertvoll oder nicht.
Aber ein Kind ... Stocksteif steht er davor, denn er bezweifelt, dass dieses Kind einem Versehen zum Opfer gefallen ist.
Angestrengt versucht er, den Fahrgästen, die zuletzt aus dem Bus gestiegen sind, ein Gesicht zu geben. Versucht, sich an eine Frau zu erinnern, die möglicherweise ganz hinten gesessen hat und in Betracht kommen würde. Vergebens. Es hat nur eine trampelnde Horde lärmender Jugendlicher gegeben.
Das Kind liegt hier also schon länger. Unbeachtet. Wie alt das Kleine wohl ist? Vielleicht zwei, drei Monate? Er ist nicht in der Lage, das Alter des Kindes einzuschätzen, denn er hat mit Heranwachsenden nur dann zu tun, wenn er lärmende Schüler oder quengelnde Kleinkinder und deren genervte Mütter in seinem Bus herumkutschiert.
Seine Ehe ist kinderlos geblieben und sie haben einigermaßen gelernt damit zu leben, sie haben fast alles im Griff. Aber nun steht er hilflos vor dem schlafenden Kind.
So oft er auch über das Schicksal ausgesetzter Kinder gelesen hat, begreifen wird er niemals, was Menschen dazu treibt.
Reglos starrt er auf das kleine Bündel, und seine herumirrenden Gedanken suchen fieberhaft nach Möglichkeiten des richtigen Handelns. Zuerst muss das Kleine raus aus dem Bus. Die Heizung ist abgestellt und allmählich breitet sich Kälte aus. Außerdem kann das Kind jeden Moment aufwachen und losschreien. Wie soll er es dann beruhigen?
Er gibt sich einen Ruck und nimmt beherzt den kleinen Jungen hoch – irgendwie ist er sich sicher, einen Jungen vor sich zu haben –, trägt ihn hinaus in die kalte Nacht, verschließt den Bus umständlich, auf keinen Fall darf der Kleine ihm vom Arm rutschen, und stapft quer über den Parkplatz.
Eisiger Wind zerrt an seinen Ohren, womöglich ist es unter null Grad. Er drückt das Kind an sich, fummelt mit der freien Hand den privaten Schlüsselbund aus der Jackentasche und öffnet den von einer glitzernden Eisschicht überzogenen Golf Cabrio GT.
Behutsam legt er das Kind auf den Rücksitz. Hoffentlich erbricht es sich nicht auf die edlen Sportledersitze, huscht es ihm durch den Kopf. Das Auto ist sein ganzer Stolz, schließlich gehört es zur neuesten Generation seiner Art, bietet nicht nur 98 PS, sondern auch ein wenig Luxus wie Servolenkung, Bordcomputer und Radio mit CD-Player.
Er schnallt das Kleine an, so gut es eben geht, es wacht immer noch nicht auf. Ist ein Kind tatsächlich fähig, in solch einen tiefen Schlaf zu fallen? Hoffentlich fehlt dem Kleinen nichts, hoffentlich ist es nicht mit irgendwelchen Mitteln ruhiggestellt worden.
Hastig sucht er nach dem Eiskratzer.
Der unvermittelt zurückgekehrte Winter hat das Land fest in den Griff genommen, glatte Straßen beschert und die Leute, die voreilig ihre neue Frühjahrskollektion zur Schau gestellt hatten, im wahrsten Sinne eiskalt erwischt.
Endlich sind die Scheiben einigermaßen frei, er steigt ein und atmet den unverkennbaren Geruch ein, den nur ein Neuwagen auszudünsten vermag. Er startet den Motor, dreht die Heizung voll auf, legt den ersten Gang ein, umfasst das griffige Lederlenkrad. Aber wohin soll er fahren? Nach Hause?
Dorthin zieht es ihn zwar unweigerlich, aber er darf das Kind wohl kaum einfach mit nach Hause nehmen. Nicht mal für eine Nacht. Dann zur Polizei? Er denkt an die vielen Fragen, spürt seine bleierne Müdigkeit und verwirft die Idee. Es bleibt nur das Krankenhaus. Dort wird man sich um das Kind kümmern. Er wird seine Adresse hinterlassen und dann heimfahren.
Ja, so wird er es machen.
Er gibt Gas, der Motor röhrt auf, und er steuert quer durch die nächtlich ruhige Stadt hinüber zur Kinderklinik.
Markus schrak auf.
Nur einmal kurz eingenickt und schon hatte ihn die Erinnerung im Tagtraum vereinnahmt. Von jetzt auf nachher hatte sie ihn gepackt und zurückkatapultiert in den Moment, der ein neues Lebensglück eingeläutet und einen Schlussstrich gezogen hatte unter viele zermürbende Jahre voller quälender Hoffnungen, unerfüllter Wünsche und zweifelnder Gedanken. Es war dieser Moment, der Markus und Emma verholfen hatte, zu einer glücklichen Familie zu werden – mit all ihren Höhen und Tiefen. Vor allem Tiefen.
Markus hielt die Lider geschlossen, seufzte. Egal, er erinnerte sich immer gerne an jene eiskalte Aprilnacht.
Er atmete durch, öffnete die Augen und genoss die Stille, das satte Grün, das ihn umgab, und das stählerne Blau des wolkenlosen Himmels. Sie hatten es sich auf der kleinen Veranda ihres Schrebergartens am Rande der ehemaligen badischen Residenzstadt gemütlich gemacht. Er war rundum zufrieden und glücklich. Vor allem über die Fügung, endlich der etwas betuchteren Einwohnerschicht von Karlsruhe anzugehören. Das verdankten sie ihrem Sohn, den Emma geradezu vergötterte und der ihn überaus stolz machte.
Markus gönnte sich einen großen Schluck von der eiskalten Traubensaftschorle, das tat gut. Natürlich wäre jetzt auch ein kühles Pils nicht zu verachten, aber er musste ja noch fahren. Und gleich morgen früh hatte er wieder Schicht. Er war Busfahrer und seit über dreißig Jahren brachte er nun Menschen sicher an ihr Ziel.
Sein Blick schweifte hinüber zum Gartentor, wo der neue Passat Variant parkte. Mit allem Schnickschnack, den VW zu bieten vermochte und in einem dunklen Metallicgrün – so wie er ihn sich immer erträumt hatte. Trotz des Angebots, sich ein Auto nahezu ohne Preislimit aussuchen zu dürfen und trotz Jonathans unverständlichem Blick angesichts seines Wunsches nach einem Steilheck blieb er bei seiner Entscheidung. Zwar hätte ein Coupé wesentlich schneidiger gewirkt, aber Markus brauchte den Kombi, immerhin galt es, den Garten zu bewirtschaften.
»Markus, träumst du?« Emmas Frage riss ihn unsanft aus seinen Gedanken.
»Hm, ich dachte gerade an unser Glück. Alles ist gut geworden.«
Nach dem ganzen Zirkus, dachte er für sich weiter. Er wollte seine Frau nicht unnötig reizen, die schweigend in ihrem Schaukelstuhl vor- und zurückwippte. Er drehte das Radio lauter, das bisher leise im Hintergrund gelaufen war, und konzentrierte sich auf den Spielbericht des KSC.
Bis Emma unvermittelt von sich gab: »Glück – ja, wir hatten Glück. Und er? Ist er auch so glücklich wie wir? Manchmal zweifle ich daran.«
»Was redest du da!«
Mit einer energischen Handbewegung wischte Markus ihre Worte weg, er wollte sich jetzt den Fußballergebnissen zuwenden. Erst als der Reporter fertig war, knüpfte er an Emmas Gedanken an.
»Man kann es niemals jedem immerzu recht machen. Wir haben alles getan, damit er es gut hat. Und ich bin mir sicher, er weiß das zu schätzen. Sonst hätte er uns auch nicht so großzügig bedacht. Er hätte das Geld ja auch anders anlegen können.« Emma beugte sich vor, stoppte ihre Schaukelei.
»Markus, jetzt mal im Ernst. Würdest du dich glücklich fühlen, so wie er zurzeit lebt? So einsam in dem großem Haus? Ich habe das Gefühl, er hat sich das Haus nur gebaut, um sich zurückziehen und seiner Schwermut nachgeben zu können.«
»Ich bitte dich! Er ist dreiundzwanzig. Da ziehen die Kinder schon mal aus und bauen sich ihr eigenes Heim. Und mit seinem Geld konnte er sich eben diesen Kasten leisten. Er wird zur passenden Zeit eine passende Freundin finden. In der Uni laufen ja genug herum. Hab ein bisschen Geduld.«
»Hmm«, meinte Emma und begann wieder zu wippen. »Wie geht’s Albert?«, wechselte sie das Thema. »Du warst doch gestern bei ihm?«
Markus schnaufte hart durch. Ja, der gute alte Klingenstein. Ein pensionierter Gärtner und alter Freund.
»Die Operation ist gut verlaufen. Sie haben ihm einen Bypass gelegt. Er ist zuversichtlich, aber er wird eine Zeitlang ausfallen.«
Emma machte ein besorgtes Gesicht.
»Der arme Albert. Ob er überhaupt wiederkommen kann?«
»Keine Ahnung. Aber ich werde mir etwas einfallen lassen. Jonathan wird seinen Park kaum alleine in den Griff bekommen.«
»Vielleicht sollten wir eine Firma beauftragen?«
»Schatz, du weißt, das wird er nicht wollen. Ich werde mich um einen Ersatz für Albert kümmern. Versprochen. Sollen wir nicht lieber unseren nächsten Urlaub planen? Wir könnten zwischen Weihnachten und Silvester wieder auf Tour gehen. Vielleicht auf die Malediven. Schließlich gehe ich nächstes Jahr in Rente und muss anfangen, mich darauf einzustellen.« Markus grinste.
Das war ihm eben spontan eingefallen. Auf Emmas Reaktion war er nicht gefasst.
»Sag mal, geht’s dir zu gut? Wir sind gerade von unserer Mittelmeerkreuzfahrt zurückgekommen. Die Leute denken ja, wir wären größenwahnsinnig geworden.«
Beleidigt drehte Markus das Radio lauter. Er verstand überhaupt nicht, weshalb Emma immer noch so tat, als hätte es den Geldsegen nicht gegeben. Seiner Meinung nach musste man das Leben auskosten, solange es einem etwas bot. Wer wusste denn schon, wie lange man noch fit genug war, um reisen zu können? So viele Jahre hatten sie an allen Ecken und Enden gespart, jetzt durften sie genießen. Jonathan sah das genauso, denn die Fahrt auf der AIDA war ja schließlich eines seiner Geschenke an sie gewesen. Er erinnerte sich noch gut an die Zeit, als sie jeden Pfennig dreimal umdrehen mussten, bevor sie ihn in etwas genau Geplantes investieren konnten. Denn unmittelbar nach der Adoption waren sie in eine größere Wohnung umgezogen, obwohl Emmas Einkommen wegfiel. Dem Jungen sollte es gut gehen, er sollte ein schönes Zimmer bekommen und sich nicht vor den anderen Kindern blamieren müssen. Die Wohnung war nicht billig gewesen und Emma hatte der riesige rote Klinkerbau in der Stuttgarter Straße überhaupt nicht gefallen. Aber es gab einen kleinen, nach hinten gelegenen Balkon, einen akzeptablen Kellerraum und einen Wäschetrockenplatz auf dem Dachboden.
* * *
Emma atmete tief durch. Sie warf einen Blick hinüber zu dem auffälligen Bau. Sie konnte ihn von ihrem Garten aus sehen. Deshalb hatten sie damals auch die Gelegenheit beim Schopf gepackt und dieses Stückchen Land erworben, nachdem Jonie eingeschult und sie wieder arbeiten gegangen war.
Sie entspannte sich, lehnte sich zurück, fügte sich aufs Neue in die Rundung des Schaukelstuhls ein und reckte ihr Gesicht in die Sonne.
Selbstverständlich hatte sie sich mit einem Schlag wie im siebten Himmel gefühlt, als Jonie im Lotto gewann. Am liebsten hätte sie die ganze Welt umarmt, als er ihnen die neue Eigentumswohnung mit hundertzwanzig Quadratmetern kaufte. Es war ihr, als habe jemand ihr Herz von einem Betonklotz befreit, nachdem sie ihre Schulden tilgen und endlich ohne Geldsorgen zu leben beginnen konnten. Aber damals wie heute war ihr bewusst, jeder Reichtum findet sein Ende, sobald man unvernünftig wurde. Und deshalb warf sie niemals unnütz mit Geld um sich. Markus verstand das nicht.
Als Jonie weiterspekuliert und sich von heute auf morgen ein Grundstück gekauft hatte, war sie aus allen Wolken gefallen. Jetzt hingegen, wenn sie in die Villa kam, war sie unglaublich stolz auf ihren Sohn. Freilich mutete es seltsam an, wie er sich sein Leben gestaltete, aber Markus hatte wohl Recht, es war jetzt sein Leben und Jonie musste lernen, Verantwortung für sich selbst zu tragen. Ob er jedoch mit seiner derzeitigen Lebenseinstellung die richtige Partnerin finden würde, blieb dahingestellt. Emma konnte nur hoffen, dass er nicht auf eine hereinfiel, die es lediglich auf sein Vermögen abgesehen hatte. »Ach ja«, seufzte sie vor sich hin. Die Gedanken prasselten wie ein Platzregen auf sie ein.
Im Großen und Ganzen hatte es das Leben durchaus gut mit ihnen gemeint. Klar, es hatte ein paar wirklich schwere Jahre gegeben. Sogar ihre Ehe war einmal auf der Kippe gestanden. Das war eine harte Zeit gewesen.
Damals hatten Markus und sie auf Kinder gehofft. Medizinische Eingriffe samt zermürbender Untersuchungen und aufwendiger Therapien lehnten sie aber beide ab. Von den Kosten ganz zu schweigen.
Somit war nur noch der Gedanke an eine Adoption übrig geblieben. Leider hatte Markus dahingehenden Plänen überhaupt nichts Positives abgewinnen können, obwohl sie diese Art, an ein Kind zu kommen, wie eine Xanthippe verteidigte. Die Nerven hatten bei ihnen beiden blank gelegen und Emma hatte kaum bemerkt, wie sie mit ihrem Starrsinn fast ihre Ehe aufs Spiel gesetzt hätte. Nach einer wirklich harten Aussprache überwanden sie die Krise und konzentrierten sich wie besessen auf eine Zukunft ohne Kinder. Markus stürzte sich in sämtliche Schichten, die sich ihm anboten, um sein Gehalt mit Sonderzuschlägen gehörig aufzubessern und Emma arbeitete den ganzen Tag als Näherin bei einem Ettlinger Sportbekleidungshersteller und brachte ebenfalls gutes Geld nach Hause. Sie leisteten sich regelmäßig einen Urlaub im Bayerischen Wald oder in Kärnten. Sie hatten alles getan, um aus der Not eine Tugend zu machen. Bis der liebe Gott ihnen eines Nachts ein Geschenk vor die Füße gelegt hatte. Bis sie finanzielle Sicherheit und planbare Freizeit gegen schlaflose Nächte und ein nicht kalkulierbares Abenteuer eingetauscht hatten.
Emma warf ihrem Mann einen heimlichen Blick zu, betrachtete verstohlen sein markantes Profil. Selten war er glatt rasiert, meist beherrschte ein gepflegter Dreitagebart sein volles, freundliches Gesicht. Sein dichtes Haar trug er nackenlang und ihr gefiel seine Eitelkeit, die sich darin ausdrückte, Shampoos zu benutzen, die das aufkommende Grau unterdrückten. Warum nicht ein wenig Jugendlichkeit bewahren? Ja, ihr Markus war durchaus ein immer noch gut aussehender Mann. Zwar kein durchtrainierter Sportler und nicht übermäßig groß, aber mit viel Größe im Herzen. Und immer mit einer gewissen Melancholie in seinen dunkelblauen Augen.
Emma lächelte, griff nach ihrem Glas und nahm einen Schluck. Der Saft war schal vor Wärme, sie trank ihn artig leer und stieß erneut einen tiefen Seufzer aus. Schluss mit dem Grübeln und Sinnieren. Es wurde allmählich Zeit zusammenzupacken.
* * *
Lisa und Natalie waren waschechte Karlsruherinnen und seit dem Kindergarten beste Freundinnen. Schon ihre Eltern hatten viel Freizeit miteinander verbracht und so war es ganz selbstverständlich geworden, dass die beiden Mädchen wie Kletten aneinander hingen. Als Natalies Eltern die Karlsruher Innenstadt verließen und in den eher ländlich gelegenen Stadtteil Stutensee zogen, besuchten die Mädchen zwar verschiedene Grundschulen, aber es war klar, dass sie zusammen auf dasselbe Gymnasium gehen würden. Nach dem Abitur zogen sie zum Studium nach München. Lisa studierte Jura, Natalie Medizin.
Lisas langjährige intensive Beziehung zu Natalie hatte zu Schulzeiten bei einigen Mitschülern gehörig für Spott gesorgt, zumal Natalie aufgrund der Sorge um ihren leukämiekranken Bruder unmäßig zu naschen anfing und immer dicker wurde. Nur ein Junge aus ihrer Klasse hatte niemals verletzende Worte über die Lippen gebracht und stand immer bereit, ihnen Mathe und Physik zu erklären. Und in diesen Jungen hatte sich Lisa verknallt. Hoffnungslos.
Damals schon überaus gut aussehend hatte er sie mit seinen charmant klaren Augen, bei denen sie nie genau wusste, ob sie nun blau oder eher grün schimmerten, und seinem unergründlichen Blick, immer durchzogen mit einer Andeutung von Misstrauen, vom ersten Augenblick an vereinnahmt. Und mit seinen braunen Haaren, die er entgegen jeglicher Trends stets verwegen länger trug als die anderen, wurde es ihr maßlos erschwert, sich all die Jahre für andere Jungs zu interessieren. Aber bei ihm hatte sie auch nicht landen können. Zumindest nicht so, wie sie es sich erhoffte. Er war verschlossen, absolut introvertiert und brachte kaum ein Wort heraus, wenn sie ein Thema wählte, das nichts mit dem Schulstoff zu tun hatte. Im Abschlussjahr hätte sie auf einige Stunden verzichten können, wenn sie nicht dem Ehrgeiz verfallen wäre, dieselben Leistungskurse wie er zu besuchen. Aber nur so hatte sie es fertiggebracht, ihre Freundschaft zu festigen, damit sie bis heute anhielt. Zu mehr hatte es jedoch leider nicht gereicht.
Lisa saß in der Küche, löffelte ihren Joghurt und schaute verklärt durchs großzügige Dachfenster hinauf zum blassblauen Himmel. Sie hatte Jonathan schon seit dem Frühjahr nicht mehr gesehen, zu sehr war sie mit sich beschäftigt gewesen. Ob es ihm gut ging?
Natalie sagte etwas, aber Lisa nahm es gar nicht wahr.
»Hallo, Träumerin, aufwachen! Du schläfst ja mit offenen Augen.«
»Ich hab nicht geschlafen, ich esse!«
»Ja, ja, das sehe ich, der Becher ist schon lange leer, musst aufpassen, damit du nicht das Plastik ankratzt! Wenn du so dasitzt, gibt’s nur eine Erklärung: Hast mal wieder deine Gedanken an deinen Traumboy verschwendet! Wenn der nur mal ’ne Ahnung davon hätte!«
»Hat er doch – eigentlich ...«
Lisa versank in Unsicherheit.
»Du solltest mal Klartext mit ihm reden, sonst könnt ihr eure Hochzeit in den Wind schreiben.«
»Natalie! Schluss jetzt! Das wird schon noch, er überstürzt halt nichts. Vielleicht bin ich einmal froh darüber, dass er kein Weiberheld ist, trotz seines guten Aussehens.«
»Diesbezüglich würde ich mir ohnehin mal Gedanken machen.« Lisa kannte Natalies Einstellung zu gut. Für die Freundin tickte ein junger Mann nicht normal, wenn er nicht regelmäßig ein Mädchen abschleppte. Erfahrungen sammeln, nannte sie das. Natalie wünschte sich einen Mann mit Erfahrung, einen Mann, der wusste, was eine Frau von ihm erwartete. Lisa war gänzlich anderer Meinung und wollte sich darüber auch auf keine Diskussionen mehr einlassen.
Aber Natalie gab keine Ruhe: »Ich verzichte gern auf gutes Aussehen. Aber so einen Lahmarsch würde ich vermutlich wegjagen, wenn er mir den Hof machen würde.«
»Oh, Natalie! Wetten, du würdest das nicht? Du wärst froh, wenn dir überhaupt mal einer ... «
Nur ihrer schnellen Reaktion verdankte es Lisa, dass sie den patschnassen Lappen der Freundin nicht ins Gesicht geklatscht bekam, mit dem diese soeben noch am Herd herumgeschrubbt hatte.
»Ich warte eben auf den Richtigen!«, mokierte sich Natalie. »Vermögend, klug und Akademiker ist das Mindeste, was ich verlange. Aber auf keinen Fall einen Mathefreak, der ständig am Zählen ist. Ich kann mir lauschigere Stunden vorstellen.«
Lisa bückte sich nach dem Lappen, legte ihn vor sich auf den Tisch. »Bin ich froh, dass Jonies Zähltick dich derart abschreckt. Eine Konkurrentin weniger. Außerdem macht er das heute nicht mehr. Zumindest nicht in meiner Gegenwart.« Natalie kam an den Tisch, setzte sich.
»Also ich fand es damals schon beängstigend, wie er bei deiner Sechzehner-Party ständig beim Kartenspiel gewonnen hat.«
»Hat mir aber gefallen und die anderen haben ganz schön dumm geguckt!«
Wie so oft wurde Lisa wieder einmal in die Verteidigerrolle gedrängt. Ständig gaben ihr andere das Gefühl, für Jonie eintreten zu müssen. Na ja, bald würde sie ihre Rolle beruflich ausleben und konnte wenigstens Kapital daraus schlagen. Aber das war noch Zukunftsmusik. Jetzt musste sie sich mit Natalie auseinandersetzen, die bereits weiterstichelte.
»Und warum hast du ihm dann vor zwei Jahren nicht den Gefallen getan und bist mit ihm nach Baden-Baden ins Casino, als er dich eingeladen hatte?«
Lisa kniff die Lippen zusammen.
»Du warst zu feige! Stimmt’s?«, bohrte Natalie.
»Ja, weil ich vorausgeahnt hatte, was kommt. Karten zählen unter den Röntgenaugen von Aufpassern ist etwas anderes, als Partygäste zu bescheißen.«
»Das war dein Glück. Immerhin haben sie ihn erwischt. Mann, da hätte ich gerne Mäuschen sein wollen.« »Sei nicht so gemein. Er hat halt wissen wollen, ob es funktioniert. Immerhin hat er einiges abgeräumt. Dennoch war es eine gute Abschreckung, wer weiß, wohin ihn dieser Tick noch gebracht hätte.«
Natalie lachte schadenfroh auf.
»Sie haben ihn einfach rausgeschmissen!«
* * *
Der Montagmorgen bescherte trockene Saharawärme und versprach Freude all denen, die das Glück hatten, sich im Freibad abkühlen zu dürfen.
Thomas Anger lag nichts am faulen Herumliegen oder gar daran, seine empfindlich helle Haut schädlichen UV-Strahlen auszusetzen. Er hatte im Oktober einen Wanderurlaub in den Bergen samt Fotoseminar geplant. Darauf freute er sich bereits jetzt, das machte es ihm leichter, seinen Job im Autohaus Vollmer bei über dreißig Grad im Schatten durchzustehen.
Er schloss die Tür zum Verkaufsraum der Tankstelle auf, sah drüben in der Werkstatt und im Ausstellungsraum bereits eifriges Leben und bereitete sich auf den Tag vor.
Anger war ein typischer Junggeselle. Nächstes Jahr würde er vierzig werden und er hatte sich jetzt schon vorgenommen groß zu feiern. Das Gejammer der anderen fast Vierzigjährigen ließ ihn kalt. Zu seinem Geburtstag würde er seine ganzen Freunde und Bekannten einladen.
Er arbeitete nun schon einige Zeit in der Tankstelle des renommierten Autohauses im Karlsruher Stadtteil Rüppurr. Eigentlich hatte er einst seine Mitmenschen als Konditor und Bäcker beglücken wollen, aber eine Mehlstauballergie ließ seinen Traum gleich nach der Ausbildung platzen. Also war er zu seinem Onkel gezogen, der in Westfalen eine Maschinenfabrik besaß. Dort sattelte er um auf Maschinenbauer und erhielt einen festen Arbeitsplatz. Als sein Onkel vor acht Jahren seinen wohlverdienten Ruhestand antrat und das Unternehmen in fremde Hände fiel, entschied Anger, in seine alte Heimat zurückzukehren. Lutz Vollmer hatte zu der Zeit expandiert und eine zuverlässige Hilfskraft für die Tankstelle gesucht. Anger hatte nicht lange gezögert und seinen Entschluss bis heute nicht bereut.
Sein Boss zeigte seine Zufriedenheit, indem er ihm die Pflege der hochkarätigen Fahruntersätze seiner betuchten Kunden anvertraute. Bei diesem Service flossen reichlich Trinkgelder.
Die waren auch bitter nötig. Seit dem Erwerb einer Eigentumswohnung in der Nähe seiner Arbeitsstelle kam er schon mal in finanzielle Engpässe. Ein neues Auto war auch fällig.
Vor geraumer Zeit hatte Anger das Vertrauen eines jungen Neureichen gewonnen, der regelmäßig seine beiden fahrbaren Untersätze nicht nur zum Auftanken, sondern ebenfalls zur Wartung vorbeibrachte. Der Boss hatte erklärt, der junge Falkner würde beinahe neurotische Angst davor haben, plötzlich neben einem Auto stehen zu müssen, dessen Motor mitten in der Pampa seinen Geist aufgibt. Da sein Boss außerdem den Vater des Jungen persönlich kannte, durfte Falkner junior ihn zu jeder Zeit bei einem eventuellen Versagen der Autos zu Hilfe holen.
Deshalb wurde auch Anger zu Bereitschaftsschichten eingeteilt. Aber bisher hatte weder der Jeep noch der Porsche seinen Dienst versagt. Bei der exzellenten Wartung war das gewissermaßen selbstverständlich. Ein wenig Neid kam bei Anger schon auf, wenn er sich vor Augen hielt, wie das Ausfüllen eines läppischen Zettels mit noch läppischeren Zahlen ein Leben dermaßen veränderte. Ja, Glück musste man haben. Ohne Glück kam man zu nichts. Er füllte ja auch wöchentlich den Tippschein aus und was geschah? Ab und zu gab’s einen Dreier, sonst nichts. Aber er durfte die Hoffnung nicht aufgeben, vielleicht zeigte sich das Glück auch ihm eines Tages gnädig und dann würde er dem reichen Spund seinen Traum von Auto vorstellen: einen feuerroten Ferrari! Und nicht solch eine plumpe Karosse wie dieser schwarze Cherokee, den er nachher gleich als Erstes unter seiner Fuchtel haben würde. Blitzblank sollte er den Jeep polieren, ohne dass ein Kratzer zurückblieb. Was gab man nicht alles für eine zusätzliche Belohnung.
Manchmal kam er sich vor wie ein dressierter Hund, dem zur Honorierung einer guten Leistung ein Nascherle vor die Schnauze geworfen wurde. Der dann am Boden herumschnuffeln durfte, um nach der Belohnung zu suchen. Aber die Hoffnung durfte niemals sterben.
II
Im Klassenzimmer herrscht Stille.
Der Mathelehrer hat vor zwei Minuten den Raum verlassen und eine Horde halbstarker Abituranwärter ist eine ganze Pause lang sich selbst überlassen.
Trotzdem herrscht Stille. Ungewohnte Stille.
»Also, was ist?«, durchschneidet Robert Melchers vom Stimmbruch immer noch verschont gebliebene Stimme penetrant die gespannte Atmosphäre. Sein verächtlicher Blick klebt auf Jonathan.
Und mit ihm ein weiteres Dutzend Paar Augen. Ihre Besitzer umringen Jonathan und warten begierig auf seine Reaktion.
»Ich glaube«, sagt er, »die Zahlen kann man vorausberechnen.«
Sein Blick wandert unsicher über die fiesen Visagen seiner Klassenkameraden. Es haben sich nur die Jungs aufgebaut.
»Dr. Holder ist aber überhaupt nicht dieser Meinung. Und er hat wohl die fachlich höhere Kompetenz«, lästert Robert.
»Und unser Jona ist das Mathegenie«, meckert der schwabbelige Oskar Bohl dazwischen.
»Deshalb möchten wir jetzt wissen, wer Recht hat«, fordert Max, der seine lange Haarmähne stets im Nacken zusammengebunden trägt.
»Also, um die Diskussion endlich zum Abschluss zu bringen«, sagt Robert gedehnt und mit wichtigtuerischem Mienenspiel, »ich wette, dass die Zahlen nicht vorausberechnet werden können. Wer setzt dagegen?«
Stille.
»Was ist mir dir, Genie?«, höhnt Robert und gibt Jonathan einen Stoß in die Rippen.
»Ich wette nie.«
»Nicht mal, wenn du glaubst, du bist im Recht?«, fragt Max.
»Feigling!«, blafft Oskar.
Lisa steht im Türrahmen. Die Fröhlichkeit ihrer sanften Rehaugen trifft Jonathan mitten ins Herz.
»Also gut«, gibt er nach, während er seinen Blick kaum von dem Mädchen lösen kann. »Ich wette, dass ich die Zahlen für die nächste Lottoziehung vorausberechnen kann.«
»Was ist euer Einsatz?« Oskar stampft aufgeregt von einem Fuß auf den anderen.
»Nun«, überlegt Robert, »das Genie und ich zahlen jeder den halben Anteil am Schein, den wir bis aufs Äußerste ausreizen und lassen uns überraschen, was dabei herauskommt.«
»Nein, nein! So geht das nicht«, mault Oskar. »Was bietet ihr uns?«
»Gut! Wenn ich verliere, gewinnt logischerweise der Schein. Dann flattert dem Genius und mir ’ne Menge Geld in den Schoß und ich lade euch zu einem heißen Wochenende auf Mallorca ein, das ihr so schnell nicht vergessen werdet. Und was bietest du, Superhirn?«, wendet sich Robert herablassend an Jonathan.
»Ich verliere nicht.«
Warum er sich seiner Sache so sicher ist, vermag er nicht zu erklären. Vielleicht nur deshalb, weil er gewinnen muss. Alle wissen, dass er sich schon eine halbe Ewigkeit mit Analysen über die Zahlenreihen der Ziehungen beschäftigt. Er darf es sich nicht leisten, zu verlieren. Aber das ist bei einem Glücksspiel leicht gesagt.
»Ha! Höre sich das einer an. Ganz schön von sich eingenommen!«, höhnt Robert. »Trotzdem musst du uns deinen Einsatz sagen! Los!« Jonathan will sich kurzerhand abwenden und der Meute keine Möglichkeit geben, aus ihm noch mehr herauszuquetschen. Er hat sich ohnehin schon zu weit in diese Sache pressen lassen. Aber so leicht lassen sie ihn nicht davonkommen. Roberts Klaue krallt sich in Jonathans Schulter fest.
»Dein Einsatz!«, knurrt er scharf.
»Also gut«, sagt Jonathan, »falls ich verliere, mache ich euch jedem bis zu den Prüfungen die Matheaufgaben.«
»Na, das ist doch ein Angebot«, grölt Oskar, und die anderen lachen und klatschen sich vor Freude auf die Schenkel.
Drei Tage und drei Nächte brütet er über seinen Daten, die er in jahrelanger mühevoller Sisyphusarbeit zusammengetragen hat. Seit der Kindheit schon plagt ihn die Neugier, ob beim Glücksspiel nicht doch nachgeholfen werden kann, zumal er jede Woche das enttäuschte Gesicht seines Vaters sieht, wenn der aufs Neue einen Tippschein zerknüllt. Daher beginnt er, sich Auswertungen über die gezogenen Tippreihen zu besorgen und sich in Korrelationsanalysen zu vertiefen. Als er einen ausrangierten PC aus der Kanzlei seines Onkels bekommt, packt ihn das Fieber, selbst Programme zu entwickeln, bis er schließlich in der Lage ist, sein eigenes Optimierungsprogramm für die Suche nach den bestmöglichen Zahlen fertigzustellen. Eingesetzt hat er es noch nicht – bis heute. Und es spuckt sechs Zahlen aus. Sechs, elf, neununddreißig, vierzig, vierundvierzig und achtundvierzig. Seine Glückszahlen.
Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, ist ja klar, aber er lässt sich das nicht anmerken.
Weil er nur ein Kästchen ausfüllt, freut sich Robert umso mehr, seine vielen Zahlenreihen einsetzen zu können. Er überreicht ihm ein Blatt, auf dem sie stehen und überlässt ihm den Rest.
Robert vergisst aber, trotz mehrfacher Aufforderung, seinen Anteil zu begleichen. Solche Sachen vergisst er überhaupt immer sehr gerne. Letztendlich lässt er über Oskar ausrichten, das Geld am Montag zu zahlen.
Am Montag ist’s jedoch zu spät. Jonathan verweigert die Annahme von Roberts Einsatz. Denn am Samstagabend hat es in Strömen geregnet. Geldscheine.
Sieben Millionen und vierhunderttausend Euro.
Die Scheine fallen vom Himmel. Zu Tausenden. Sie beginnen zu glänzen und verwandeln sich zu seinen Füßen in goldene Münzen.
Stolz wie Dagobert Duck steht er mitten in einem Silo voll Gold.
Da hört er ein Jammern, ein Stöhnen. Dumpf aus der Tiefe.
Er sieht eine Hand vor seinen Füßen herausragen, sucht eine Schaufel. Es gibt keine. Nur Gold.
Glänzend. Geschmeidig. Kalt.
Und es regnet weiter, immer weiter. Es klirrt, prasselt, scheppert. Ein Höllenlärm. Goldstücke platschen dumpf auf seinen Schädel. Er fällt auf seine Knie und beginnt, mit bloßen Händen zu schaufeln. Er befreit einen Arm, eine Schulter und einen Kopf.
Es taucht Roberts schmerzverzerrte Fratze auf. Er hört seine Hilfeschreie, doch kommen sie nicht über dessen Lippen. Sie öffnen sich nicht einmal.
Gleich erstickt er. Erdrückt von unzähligen Münzen. Dieser geldgeile Scheißkerl.
Er hört ihn heiser und mit ungewohnt tiefer Stimme »Arschloch!« rufen und plötzlich ist es ihm egal. Soll Robert doch verrecken – einfach verrecken. Dieser gierige Scheißer wird niemanden mehr übers Ohr hauen oder sich an Problemen anderer aufgeilen.
Ein Schwall enormer Hitze fängt ihn ein. Das Gold schmilzt über ihm, schmilzt unter ihm, es wird heißer und heißer. Er strampelt, schlägt um sich und macht panische Hüpfer, um der breiigen Masse zu entkommen, die ihn unerbittlich aufsaugt wie kochender Morast.
Er fühlt das Glühen seines brennenden Körpers, den erstickenden
Druck auf seinen Lungen, kann kaum noch atmen.
Hustet.
Bevor er starb, wachte er auf.
»Shit!«, fluchte Jonathan.
Die Stimme rau, die Kehle verdorrt.
Eigentlich wollte er nur ein bisschen meditieren, in angenehmen Gedanken schwelgen, schon war er wieder in ein teuflisches Loch gestürzt.
Deep Purples Child in Time hämmerte rhythmisch und wild jaulend auf ihn ein. Was für ein Song. Uralt für seine Begriffe, trotzdem immer noch packend. Die Anlage war jedoch zu laut gestellt.
Jonathan badete regelrecht in Schweiß, war patschnass auf Stirn, Schläfen, im Nacken, am Rücken, er zwang sich, die Augen zu öffnen, brachte aber nur ein schwächliches Blinzeln zustande. Die Nachwehen des Albtraums hatten ihn weiter in der Gewalt, sein Puls raste.
Er lag rücklings im Zentrum seines quadratischen Glaspavillons, exakt auf dessen Längsachse, die Stirn nach Südosten gerichtet, die Arme und Beine ausgebreitet.
Er zwang sich, seine Lider zu öffnen, starrte auf die rubinroten Deckenlamellen und stieß hart die verbrauchte Luft aus seinem Körper. Sein Puls beruhigte sich, er fand sich endlich wohlbehalten und weich gebettet auf dem flauschigen, feuerroten Teppichboden wieder.
Der gläserne Pavillon war direkt an die Villa angebaut. Er enthielt keine Möbelstücke, hier befand sich Jonathans Meditationsbereich. Die blutroten, schweren Samtvorhänge hatte er meist zugezogen, ebenfalls die schützenden Lamellen an der Decke. Nur selten öffnete er das eine oder das andere, lediglich, wenn der Sternenhimmel prangte oder wenn er Lust bekam, das Grün seines Gartens zu genießen. Dabei war er der Natur gleichzeitig nah und blieb ihr doch fern. Das Klima in diesem Glasbau regulierte eine ausgefeilte Anlage.
Regelmäßig hielten ihm seine Eltern sein Einsiedlerleben vor. Sein Vater hatte ihm einmal sogar vorgeworfen, er wäre ein Gefangener seiner eigenen Lethargie, unfähig zu bemerken, wie sie ihn allmählich in die Tiefe riss. Jonathan ließ sich niemals reizen, gab seinem Vater keinen Anlass, weiterzubohren oder gar einen Besuch beim Psychiater vorzuschlagen. Nein, er ließ seine Eltern eben reden. Hauptsache er fand, eingehüllt in die Farbe der Liebe, wohltuende Geborgenheit. Sie trug seine Seele in angenehme Gefilde. Meistens.
Manchmal ging es auch schief, so wie eben. Dann verwandelten sich seine Träume in Albträume. Laut Therapeuten trug das Unterbewusstsein daran die Schuld, Jonathan hatte bereits viele lehrreiche Sitzungen diesbezüglich über sich ergehen lassen müssen. Dennoch hatte er bis heute nicht herausgefunden, mit welchen Mitteln sein Unterbewusstsein zu lenken wäre. Vielleicht würde er das ohnehin niemals fertigbringen, würde sich bis in alle Ewigkeit von ihm schikanieren lassen müssen.
Nein, er brauchte sich nichts vorwerfen, auch kein schlechtes Gewissen haben. Das Schicksal wusste schon, was es mit jedem Einzelnen trieb. So hatte es ihn gewinnen lassen und den anderen verlieren. Das war lange fällig gewesen und vor allem gerecht. Und dafür, dass dieser feige Arsch sich zugedröhnt mit einem Drogencocktail von der Autobahnbrücke gestürzt hatte, trug Jonathan keine Verantwortung. Jeder ist für seine Entscheidungen selbst verantwortlich.
Jahrelang hatten die Jungs aus der Klasse ihn immer wieder drangsaliert – allen voran Robert, dicht gefolgt von dessen Lakai Oskar. Als Nachwuchs sogenannter gehobener Kreise fühlten sie sich als etwas Besseres, sahen je nach Lust und Laune hämisch auf andere herab oder verhöhnten sie. Dummerweise kannte Jonathan diese beiden Aufwiegler bereits seit der Grundschule, wo er eigentlich ganz gut mit ihnen klargekommen war. Seit er jedoch seinen angeblichen Freunden sein Geheimnis preisgegeben hatte, zeigten sie ihm offen ihre Abneigung, demonstrierten ihm seine Minderwertigkeit. Denn im Gegensatz zu ihnen war er adoptiert.
Was bedeutete, keiner – nicht einmal er selbst – wusste, woher er kam, welcher Abstammung er war, welch ein Pack sich womöglich unter seine Vorfahren gemischt hatte. Der blanke Neid auf seine Intelligenz und seine wohlgeratene körperliche Ausstrahlung, wie seine Mutter zu sagen pflegte, kamen noch hinzu.
Jonathan schloss seine Augen. Vor sich sah er die Szene, die seine unbeschwerte Kindheit so drastisch beendet hatte.
Die Mama und ich – wir haben dich adoptiert.
Wie schlicht die Worte seines Vaters klangen. Worte, mit denen er versuchte, seine Liebe auszudrücken, die er einem fremden Kind geschenkt hatte. Eine Liebe, die ermöglichte, alles zu opfern, um das Kind anderer Leute aufzuziehen, es als sein eigen Fleisch und Blut anzuerkennen und in seine Familie zu integrieren. Ohne Rücksicht darauf, aus welchen Verhältnissen es stammte, welche Erbanlagen es in sich barg oder welche Umstände zu seiner Entstehung beitrugen. Adoptiveltern nehmen ein Kind in ihre Obhut und bieten ihm die Chance auf ein normales Leben.
Jonathan war zwölf, als er es erfuhr.
»Du bist nicht meine Mutter?«, hörte er seine zittrige Stimme fragen.
Seine Eltern saßen schweigend vor ihm, warteten mit feuchten Augen auf seine Reaktion.
Auf eine Reaktion, die ihn selbst überforderte.
Er erinnerte sich zu gut, wie seine Gedanken herumgeirrt waren, um sich der Tragweite dieses neuen, einschneidenden Wissens bewusst zu werden, bis er schließlich aufgeschaut, seiner Mutter tief in die erwartungsvollen Augen geblickt und gesagt hatte: »Aber nur du bist meine Mutter, meine eigene und richtige Mutter!« Und wie er ihr um den Hals gefallen und wie sogar sein Vater nähergekommen war und die kleine Familie umarmt hatte. Es waren Sekunden gewesen, wie sie in einem kitschigen Film nicht besser hätten dargestellt werden können. Ein paar Tage später sah alles ganz anders aus. Neues hatte ja bekanntlich immer gewisse Reize und so posaunte Jonathan nicht ohne gewissen Stolz diese Neuigkeit herum, ohne annähernd die Folgen zu erahnen, die ihn seine Vertrauensseligkeit kosten würden.
Was folgte, war eine schlimme Zeit. Überall sah er nur noch Mütter und Kinder – glücklich lachende und schäkernde Mütter mit ihren garantiert leiblichen Kindern –, sei es nach der Schule beim Abholen, auf der Straße, beim Spazierengehen oder im Fernsehen. Womöglich war er der einzige Adoptierte weit und breit. Seine Freunde begannen, hinter seinem Rücken herumzutuscheln und die Mädchen kicherten albern. Seine Mutter tröstete ihn zwar und meinte, das wäre normal und ginge bald vorüber. Er glaubte jedoch nicht daran, schloss mit seinen sogenannten Freunden ab und widmete sich anderen Interessen. Seit dieser Zeit fühlte er sich anomal und war nicht mehr bereit, seine Empfindungen mit anderen zu teilen.
Jonathan hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Wieder startete er den Versuch, sich aus seinen Gedanken zu befreien, blinzelte mit den Lidern, um die Schläfrigkeit zu verjagen, brachte behutsam Muskel um Muskel in Bewegung, schielte auf seine Armbanduhr. Erschrocken stellte er fest, dass er bereits mehr als zwei Stunden herumlag.
Ärgerlich verscheuchte er die enervierenden Tagträume, schüttelte energisch die zermürbenden Erinnerungen ab wie ein Hund, der sein triefnasses Fell von brackig stinkendem Wasser zu befreien versucht, und fand allmählich wieder zu sich selbst. Wasser, ja, Wasser! Er fühlte Trockenheit im Hals, auf seiner Seele und bekam Sehnsucht nach klarem sauberem Wasser. Es war Zeit, schwimmen zu gehen. Er rappelte sich auf, leichter Schwindel übermannte ihn, doch nur kurz, er ging ins Haus und stieg hinab, drei Etagen in die Tiefe.
Sein Reich lag über ihm, ein schützender Bunker, über dem rechtwinklig angelegten Pool, der mehr als die Hälfte des untersten Geschosses beanspruchte. Hier konnte er in das erfrischende Nass springen, so oft er wollte, konnte schwimmen und tauchen, keiner kam ihm in die Quere, keinem musste er Rechenschaft ablegen. Mit keinem seine Einsamkeit teilen. Heute trieb ihn Griegs Peer Gynt durchs Wasser, morgen würde er vielleicht ein Livekonzert von Rammstein auflegen. Je nach Lust und Laune wechselte er das Musikstück, wählte spontan zwischen Rock, Pop und Klassik.
So begann er meist seine Tage und so ließ er sie auch ausklingen. Sofern er abends nicht noch eine Joggingrunde drehte. Aber dazu musste sich vorzugsweise ein klarer Vollmond zeigen. Ihm gefielen die vom Mond beschienenen Straßen und Häuser, sie leuchteten dann, als hätte ein übermütiges Heinzelmännchen alles mit Phosphor übersprüht.
Die CD war am Ende, Stille füllte die Halle aus. Jonathans Gedanken hatten ihn schon wieder entführt und ließen ihn vergessen, rechtzeitig aus dem Wasser zu steigen. Er kannte jedes Musikstück auswendig und wusste, wann er seine Schwimmstunde beenden musste, um mit den Abschlussklängen fertig zu sein.
Er tauchte ein letztes Mal quer durch das Becken, zog sich an der Leiter empor und ging in den Umkleideraum. Kaum hatte er sich angezogen und den CD-Player und das Licht in der Halle ausgestellt, gellte der Rufton seiner Telefonanlage durch die Halle.
»Zum Teufel, wer ist das denn?«, schimpfte er vor sich hin.
Es war Samstag, inzwischen später Vormittag, er brauchte keine Termine einhalten und konnte ungezwungen den Tag verbringen, trotzdem fühlte er sich gestört, wenn das Telefon läutete. Es einfach abzustellen, brachte er auch nicht fertig.
In jeder Etage war in der Nähe des Treppenaufgangs eine Ladeschale für ein Funktelefon fest installiert. Dazu gab es jeweils einen Handapparat, den Jonathan sich immer leicht zugänglich bereitlegte. Auf dem Display zeigte sich eine ihm bekannte Nummer, seine Laune stieg beträchtlich.
»Lisa, hallo!«
»Hi, Jonie. Sorry, dass du mich gestern Abend nicht erreichen konntest. Warum hast du keine Nachricht hinterlassen? Was gibt’s?«
Ihre heitere Verfassung riss ihn mit und am liebsten hätte er gesagt: »Ich hatte Sehnsucht nach deiner Stimme.« Aber er sagte nur: »Ich wollte wissen, was deine neue Wohnung macht, ob dein Umzug inzwischen geklappt hat und – an welchem Wochenende du wieder nach Hause kommst. Vielleicht könnten wir uns treffen. Ist schon lange her ...«
»Das stimmt! Die Zeit rast, es sind schon wieder drei Monate vergangen. Aber ich war wirklich ziemlich beschäftigt. Ich habe nicht nur mit dem Umzug zu tun gehabt, sondern auch einen Job in einer großen Anwaltskanzlei bekommen. Auch hat es eine Weile gedauert, bis der neue Telefonanschluss funktioniert hat, dann ist auch noch mein Handy kaputt gegangen. Aber jetzt ist alles wieder im Lot.«
Lisas Redefluss störte Jonathan nicht, im Gegenteil, er hörte ihr einfach zu. Er hörte sie gerne reden, hatte richtig Nachholbedarf. Leider hatte sie sich angewöhnt, die wichtigsten Neuigkeiten mittels knapper SMS zu schicken, denen Jonathan überhaupt nichts abgewinnen konnte. Sicher, er war im Groben über ihre Aktivitäten informiert, das war aber schon alles. Deshalb wusste er auch von ihrem Plan, aus dem Studentenwohnheim auszuziehen, hätte aber nicht gedacht, dass sie so schnell eine passende Wohnung finden würde.
»Freut mich für dich, Lisa! Ich hoffe, die Wohnung ist okay und deine Anwaltskollegen sind freundlich?«
»Ja, ich arbeite wirklich gern in der Kanzlei. Und stell dir vor, Natalie hat beschlossen, mit mir die Wohnung zu teilen, was für uns beide natürlich finanziell günstiger ist.«
»Natalie?«, vergewisserte sich Jonathan, womöglich hatte er sie falsch verstanden.
»Ja, Natalie, meine Freundin. Du weißt doch, sie studiert Medizin.«
Natalie Böringer! Fett, plump, aufdringlich. Das einzig Sehenswerte an ihr war das schwarze naturgelockte Haar.
»Oh ... ja«, stammelte er.
Dass sich dieses Mädchen wieder in Lisas unmittelbarer Nähe aufhielt, gefiel ihm nicht. Dennoch versuchte er, sich nichts anmerken zu lassen.
»Das ist günstiger für euch, ist klar.«
Leider gelang es ihm nicht ganz, die Bitterkeit zu unterdrücken. Wie gern hätte er ihr die Wohnung finanziert, damit sie in der Lage gewesen wäre, diese allein zu nutzen.
»Ach!«, stieß Lisa plötzlich aus, »Natalie kommt, ich muss Schluss machen. Vielleicht fahre ich an einem der nächsten Wochenenden nach Hause. Ich melde mich dann. Okay?«
»Klar, bis dann.«
Jonathan schnaubte verärgert. Lisa beendete das Telefongespräch mit ihm, nur weil Natalie kam? Er schüttelte sich angewidert, trabte hinauf zur Garderobe, zog sich eine leichte Sportjacke über und holte den Porsche aus der Garage.
Ein bisschen herumkurven, ein bisschen Gedanken sammeln.
* * *
»Was war das denn?«, fragte Natalie, warf ihre Tasche ins Eck und setzte sich zu Lisa an den Esstisch. »Hat sich grad so angehört, als ob du wegen mir aufgelegt hast.«
»Nein, nein! Die Waschmaschine ist fertig, der Trockner schreit und die Kartons warten auch noch darauf, dass ich sie ausräume. Der Umzug macht mich echt fertig!«
Lisa fuhr sich durchs Haar und stöhnte laut auf, als läge die ganze Last der Welt auf ihren Schultern.
Natalie hingegen hatte stets die Ruhe weg. Und sie besaß die wundervolle Gabe, ihre innere Ruhe auch auf andere zu übertragen.
»Ja, ja, man glaubt gar nicht, was sich so alles ansammelt. Ich habe uns etwas zu Essen geholt, ein paar deftige Weißwürste und frische Semmeln.«
Lisa schnaufte nochmals hart durch.
»Essen klingt gut.« Wie auf Befehl knurrte ihr Magen.
»Mit wem hast du vorhin telefoniert?«
Extreme Neugierde gehörte zu Natalies größten Schwächen. Auch damit hatte sich Lisa schon lange abgefunden.
»Mit Jonie. Er rief gestern an, hat aber nicht auf den AB gesprochen.«
»Und – schmachtet er schon sehnsüchtig nach dir?«
»Er hat wegen des Umzugs nachgefragt und wann ich wieder komme.«
»Also doch schmachtende Sehnsucht.«
»Ach Quatsch, er braucht halt mal wieder jemanden zum Reden.«
»Und ...?«, bohrte Natalie, die sehr gut darin war, Lisas Gedanken zu lesen.
»Ich glaube, ich hab’ tatsächlich zu abrupt das Gespräch beendet, hoffentlich nimmt er’s nicht persönlich. Aber ich habe jetzt echt Hunger.«
»Mach dir keine Gedanken, für den ist doch alles heilig, was du tust und sagst.«
»Eifersüchtig?«, hänselte Lisa.
»Ganz sicher!« Natalie zog die Stirn kraus. »Ich versteh dich nicht. Was hat der Typ nur an sich, was andere nicht auch haben – vom Geld abgesehen?«
»Was er hat, was andere nicht haben – niemals haben werden? Mein Herz! Egal, wie du darüber denkst, egal, ob er’s jemals entdecken wird.«
* * *
Die Stadt hatte sich verändert. Anton Romberg stand unschlüssig vor der Fassade des Hotels, das er als ein gutgehendes renommiertes Familienunternehmen in Erinnerung hatte. Obwohl es schon immer mit der Konkurrenz der beiden Luxushotels direkt am Bahnhof zu kämpfen hatte. Aber die Zeiten wandeln sich – leider nicht immer zum Vorteil. Auch mit diesem Gebäude hatte die Zeit kein Erbarmen gezeigt. Lechzend nach einem auffrischenden Anstrich und neuen Fenstern, fristete es zwischen den anderen, noch armseliger dastehenden Jugendstilgebäuden sein Dasein. Einst prangte die Aufschrift Hotel Tiergartenblick in goldglänzenden Lettern über der breiten Eingangstüre, jetzt waren sie ausgebleicht und fast nicht mehr zu erkennen.
»Ist das wirklich noch ein Hotel?«, fragte Romberg den Taxifahrer und als dieser nickte, zahlte er, packte beherzt seine Koffer und marschierte durch die marode Eingangstüre auf den verwaisten Empfang zu.
Drinnen stellte er die Koffer ab, nahm die Sonnenbrille von der Nase und sah sich in der Lounge um. Das einstmals pompöse Mobiliar wirkte verschlissen, es roch staubig. Dem Parkettboden sah man seine edle Herstellung nicht mehr an.
Er beschloss, nach einer neuen Bleibe zu suchen.
Der blassrosa Vorhang hinter der Anmeldung bewegte sich und eine Frau tauchte auf, hochgewachsen und stocksteif. Bereits völlig ergraut und mit einer altmodischen Brille auf der Nase. Ihre flinken dunklen Augen musterten ihn streng von Kopf bis Fuß.
»Herzlich willkommen, mein Herr. Ich bin Josepha Manns. Sie möchten sicher ein Einzelzimmer mit Blick auf den Park? Es ist noch ein sehr schönes frei. Für Sie mache ich einen Sonderpreis.«
Er zögerte. Das einzige Argument, das ihn dazu bewegte, sich näher mit diesem Hotel zu befassen, war die bleierne Müdigkeit, die ihm nach dem langen Flug und der ätzenden Zugfahrt von Frankfurt bis hierher in den Gliedern steckte.
»Bevor ich mich entscheide, würde ich das Zimmer gern sehen«, sagte er und entzog sich einer voreiligen Zusage.
Er war angenehm überrascht, als sie im dritten Obergeschoss die lichtdurchflutete Suite betraten. Zwar herrschte auch hier veraltetes Flair, dennoch war die Luft frisch, es roch leicht nach Desinfektionsmitteln.
Romberg schürzte zufrieden die Lippen.
»Okay, ich nehme das Zimmer. Ich werde vorerst auf unbestimmte Zeit bleiben. Zum Frühstück wäre es mir recht, wenn ich die wichtigsten aktuellen Tageszeitungen auf dem Tisch liegen hätte. Ansonsten werde ich Ihnen ein ruhiger Gast sein.«
* * *
Es war Sonntagvormittag und er hatte sich in Schale geschmissen. Das Tor schloss sich hinter dem Porsche, Jonathan verließ sein Anwesen, sein Haus, und bog nach links auf die B 3 ein. Sein Haus! Wie angenehm das klang.
Erhaben thronte der strahlendweiße Kubus auf der sanften Anhöhe, die einen weitreichenden Blick auf Karlsruhe gewährte. Schon vor Jahren hatte Jonathan begonnen, nach einem Grundstück zu suchen, das seinen kritischen Anforderungen entsprach: Abgelegen sollte es sein und trotzdem einen direkten Straßenanschluss zur Stadt vorweisen, über einen alten Baumbestand verfügen als Basis für einen Park, ausreichende Weitläufigkeit besitzen, um absolute Einsamkeit zu gewährleisten, und es durfte nicht auf gleicher Ebene liegen wie die flache Fächerstadt.
Das Gebiet zwischen Durlach und Wolfartsweier war in sein Visier geraten, da hatte er noch nicht mal im Traum daran gedacht, mit achtzehn Jahren Lottomillionär zu werden. Aber die sieben Millionen und vierhunderttausend Euro genügten dennoch nicht, sein Traumhaus Realität werden zu lassen, den Lebensstandard der Eltern aufzupolieren und dann auch noch alles auf Dauer zu finanzieren. Also hatte er sich den Aktienmarkt vorgeknöpft, gewinnbringend spekuliert und dadurch tatsächlich eine sichere Basis schaffen können. Was wohl niemanden mehr überraschte, denn mittlerweile kannte ihn jeder aus seiner nächsten Umgebung als verschrobenen Zahlenfanatiker.
Mathematik und Geld bildeten fortan Jonathans unumstößliche Säulen, auf denen er sein Leben begründete. Der Ausspruch des Astronomen Johannes Kepler »Die Mathematik allein befriedigt den Geist durch ihre außerordentliche Gewissheit.« wurde zu seinem Leitmotiv.
Und dass mit Geld alles erreicht werden konnte, war ihm nicht erst bewusst geworden, als er den Stadtrat auf seine Seite zog, sondern bereits in jüngeren Jahren.
»Geld regiert d’Welt, mein lieber Junge«, hatte ihm einst Großvater Karl eingebläut. Er war Uhrmachermeister und damals bereits ziemlich betagt gewesen, hatte aber dennoch einen kleinen Laden in Pforzheim geführt und nicht nur Uhren, sondern auch allerlei Antiquitäten verhökert. Jonathan durfte ihm schon mit sieben in den Ferien und an den Wochenenden helfen. Großvater hatte stets darauf bestanden, ihm ein paar Mark zu geben, denn »nix isch umsonscht, nur der Tod, aber der koschtet’s Leben«, wie er zu belehren pflegte. Jonathan fand es zunächst peinlich, Geld anzunehmen für etwas, das ihm Spaß machte. Was sich jedoch legte, als er die angenehmen Seiten des Geldbesitzes kennenlernte. Als er mit siebzehn begann, selbst entwickelte Programme an eine Security-Firma teuer zu verkaufen, empfand er gar keine Skrupel mehr, die Hand aufzuhalten. Leider war der Großvater gestorben, kurz bevor Jonathan seinen Geldsegen einsackte.
Nachdem er die Riege der Millionäre erklommen hatte, war es ein Leichtes gewesen, sich seinen Traum zu erfüllen. Ohne größere Anstrengungen überzeugte er den Stadtrat, dass genau diese brach liegende Grünfläche im Kreuzungsbereich der Badener Straße und der Tiefentalstraße am besten für seine Kubusvilla geeignet sei. Dass das Gelände an zwei stark befahrenen Straßen lag und aus vielen, teilweise verwilderten Grundstücken bestand, die zudem noch unterschiedlichen Eigentümern gehörten, war ihm gleichgültig. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, dieses Gebiet unterhalb des Bergwaldes besitzen zu wollen. Und das schmackhafte Gebräu aus fließendem Geld und hartnäckigem Starrsinn hatte seinem Willen schließlich den Weg dazu geebnet.
Als er sein Traumhaus bezog, freute sich vor allem seine Mutter. Denn Jonathan war ein Fanatiker im Sammeln alter Dinge. Das, was andere froh waren, los zu sein, schleppte er nach Hause. Seine Mutter war oftmals am Verzweifeln gewesen und hatte ihm ans Herz gelegt, den Krempel fortzuschmeißen.