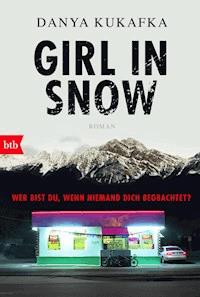
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ein eisiger Februarmorgen. Ein schreckliches Verbrechen. Auf dem Spielplatz der Grundschule von Broomsville entdeckt der Nachtwächter die Leiche der jungen Lucinda Hayes - unter einer dünnen Schneedecke begraben. Sämtliche Spuren hat der frisch gefallene Schnee verwischt. Niemand in der beschaulichen Kleinstadt am Fuße der Rocky Mountains bleibt von der Tat unberührt – nicht der Junge, der Lucinda verstohlen auf Schritt und Tritt gefolgt war und der sich nicht mehr an den Vorabend erinnern kann. Nicht die junge Frau, die sich nach dem perfekten Leben sehnt, das Lucinda scheinbar führte. Nicht der Polizist, der den Mord untersucht und den der Fall auffallend mitnimmt. Denn alle drei wissen: Nichts geschieht ohne Grund.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Ähnliche
Buch
Eine verschlafene Kleinstadt in Colorado. Ein schreckliches Verbrechen, das drei Menschen mit ihren geheimsten Ängsten konfrontiert und die Idylle des Ortes am Fuße der Rocky Mountains jäh entlarvt. Denn alle wissen: Nichts geschieht ohne Grund.
»So fesselnd wie Twin Peaks.«
The New York Times Book Review
»Einfach umwerfend.«
Paula Hawkins, »Girl on the Train«
»Dunkle Geheimnisse in einer amerikanischen Kleinstadt und ein Mord, der unerbittliche Nachforschungen nach sich zieht. Man kann das Buch nicht mehr weglegen!«
Marie Claire
»Einer der besten literarischen Spannungsromane.«
Bookpage
»Diese Geschichte geht einem nicht mehr aus dem Kopf.«
Wall Street Journal
Autorin
Danya Kukafka gilt als vielversprechendes Erzähltalent. Mit ihrem Debüt »GIRL IN SNOW« gelang der 24-Jährigen auf Anhieb ein Bestseller, der in mehreren Sprachen erscheint. Das Buch wurde für zahlreiche Preise nominiert (u. a. dem renommierten CWA John Creasey Dagger Award 2018) und wird als Amazon Prime Serie verfilmt werden. Danya Kukafka studierte an der New York University Creative Writing unter Colson Whitehead. Sie wuchs in Colorado auf und lebt heute in New York, wo sie als Lektorin in einem großen Verlag arbeitet.
Danya Kukafka
GIRL IN SNOW
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Eva Bonné
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Girl in Snow« bei Simon & Schuster, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung November 2018
btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2017 by Danya Kukafka
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by btb Verlag, München
Covergestaltung: semper smile, München
unter Verwendung eines Motivs von © plainpicture/Design Pics/Keith Levit; Eva Worobiec/Arcangel Images; Shutterstock/Julia Khimich
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Klü · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-19972-2V002www.btb-verlag.de
Für Doris Kukafka
ERSTER TAG
Mittwoch16. Februar 2005
Cameron
Als man ihm sagte, Lucinda Hayes sei tot, musste Cameron an ihre nackten Schulterblätter denken, wie sie ihre Wirbelsäule umrahmt hatten wie zwei starre Lungenflügel.
Der ganze Jahrgang musste in die Turnhalle kommen.
Die Lehrer standen am hinteren Ende des Spielfelds, tuschelten, schauten nervös auf ihre Uhren und reckten die Köpfe, um über die Menge hinwegzusehen. Cameron saß neben Ronnie in der obersten Ecke der Tribüne. Er kaute an seinen Fingernägeln und beobachtete das ganze Durcheinander. Die trockene, rissige Nagelhaut seines linken kleinen Fingers fing zu bluten an.
»Warum machen die das?«, fragte Ronnie. Ronnie putzte sich morgens nie die Zähne. Die Pickel an seinem Kinn waren weiß und prall gefüllt. Cameron lehnte sich zurück.
Mr Barnes, der Direktor der Highschool, stand auf der Mittellinie an einem Rednerpult und zupfte sich das Jackett zurecht. Die Schüler ließen Kaugummiblasen platzen, kicherten, rotteten sich zu Grüppchen zusammen oder schleiften mit quietschenden Schuhsohlen ihre Rucksäcke über den Hallenboden.
»Können alle mich hören?«, fragte Mr Barnes. Mit dem Jackenärmel wischte er sich den Schweiß von der Stirn und blinzelte ins Licht.
»Die Jefferson High hat eine Tragödie zu verkraften«, sagte er. »Heute Nacht mussten wir von einer unserer besten Schülerinnen Abschied nehmen. Mit großem Bedauern teile ich euch mit, dass eure Mitschülerin Lucinda Hayes verstorben ist.«
Eine Rückkoppelung, das Mikrofon quietschte.
In den darauffolgenden Tagen würde Cameron immer wieder an die Szene zurückdenken; dies war der Moment, in dem er sie verloren hatte. Die Leuchtstoffröhren unter der Hallendecke summten im Gleichtakt mit dem Gemurmel, das sich aus allen Ecken erhob. Wenn man für diesen Augenblick den passenden Song finden wollte, dachte Cameron, dann müsste es ein ganz leiser sein – eine zarte, betäubende Melodie, zu der man im eigenen Elend ertrinkt. Cameron nahm nur noch diese Musik wahr, sanft und niederschmetternd zugleich.
»Scheiße«, wisperte Ronnie. Die Musik wurde immer lauter, schwoll zu einem gleichmäßigen Rauschen an.
Nach sechs weiteren Sekunden bemerkte Cameron, dass niemand in der Halle mehr ein Gesicht hatte.
Er beugte sich zur Seite und kotzte über das Geländer.
Am Vorabend:
Mandelaugen schicken Blitze über den Rasen. Eine rosa Handfläche mit gespreizten Fingern klebt am Insektengitter in Lucindas Fenster. Hoch oben ziehen schnelle Wolken auf, graue, flatternde Laken vor mitternachtsblauem Samt.
»Die Schulkrankenschwester sagt, du hättest dich übergeben«, sagte seine Mutter, als sie ihn von der Schule abholte.
Mit der Spitze seines Winterstiefels schob Cameron die Krümel und Flusen im Fußraum des Minivans zu kleinen Hügeln zusammen. Seine Mutter trank einen Schluck Kaffee aus dem Thermobecher.
Nachdem die erste Aufregung verflogen war, hatten sich alle vor der Turnhalle versammelt und wild spekuliert. Die Jungs vom Baseballteam glaubten, sie wäre vergewaltigt worden. Ein paar blöde Mädchen behaupteten, sie hätte sich umgebracht. Das glaubte Ronnie auch. Wahrscheinlich hat sie das, meinst du nicht auch? Ständig hat sie in ihr Tagebuch geschrieben. Jede Wette, dass sie einen Abschiedsbrief hinterlassen hat … Mann, du hast mir auf die Schuhe gekotzt!
»Cameron«, versuchte seine Mutter es drei Straßen später noch einmal mit ihrer netten Stimme. Die nette Stimme konnte Cameron nicht ausstehen, sie war klebrig wie Sirup. Die Vorstellung, seine Traurigkeit könnte auf sie übergreifen, war unerträglich. Mom musste er aus der Sache raushalten.
»Ich weiß, es ist furchtbar. So etwas sollte einem jungen Menschen in eurem Alter nicht zustoßen. Schon gar nicht einem Mädchen wie Lucinda.«
»Mom. Hör auf.«
Cameron ließ den Kopf an die vereiste Seitenscheibe sinken und fragte sich, ob ein Stirnabdruck dasselbe wäre wie ein Fingerabdruck. Vermutlich waren die Köpfe der Menschen gar nicht so verschieden und Stirnabdrücke weniger individuell, es sei denn, man betrachtete sie unter dem Mikroskop. Aber wer würde sich dafür schon Zeit nehmen?
Er fragte sich, wie es wäre, jemanden durch eine Glasscheibe zu küssen. Einmal hatte er in einem Film gesehen, wie ein Mann seine Frau durch die Trennscheibe der Besucherzelle im Gefängnis küsste, und er hatte sich gefragt, ob es sich echt anfühlte. Er vermutete, dass es beim Küssen mehr um die Absicht ging als um die Berührung an sich, folglich war es wohl unwichtig, ob der eigene Speichel mit Glas in Kontakt kam oder mit fremdem Speichel.
Wie er so über Lippen nachdachte, fiel ihm Lucinda Hayes wieder ein. Sofort ärgerte er sich über sich selbst. Lucinda Hayes war tot.
Sie fuhren nach Hause, seine Mutter setzte ihn aufs Sofa und schaltete den Fernseher ein. Lenk dich ein bisschen ab. Sie wärmte ihm Hühnersuppe mit Nudeln aus der Dose auf, das Sirren der Mikrowelle übertönte den Nachrichtensprecher.
»Im Norden von Colorado hat sich am frühen Morgen eine Tragödie ereignet. Auf einem Spielplatz neben einer Grundschule wurde der Leichnam eines fünfzehnjährigen Mädchens entdeckt. Das Opfer, Lucinda Hayes, besuchte die neunte Klasse der Jefferson Highschool. Der Schulangestellte, der den grausigen Fund machte, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Lieutenant Timothy Gonzalez vom Broomsville Police Department hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.«
Vom oberen Bildschirmrand lächelte Lucindas Jahrbuchfoto aus der achten Klasse herunter. Ihr Gesicht war flach und verpixelt. Die Fernbedienung rutschte aus Camerons Hand auf den Sofatisch, der Deckel sprang ab, drei AAA-Batterien rollten über die Kante und fielen auf den Teppich.
»Cameron?«, rief seine Mutter aus der Küche.
Er kannte den Spielplatz und die Grundschule auch. Sie stand ganz in der Nähe der Sackgasse, in der er wohnte, auf halber Strecke zwischen seinem und Lucindas Zuhause.
Cameron schleppte sich in sein Zimmer am Ende des Flurs, bevor seine Mutter aus der Küche zurückkam. Er machte sich nicht die Mühe, das Licht einzuschalten, schob die Decke vom Bett und zog Skizzenbuch, Kohlestifte und Radierknetgummi aus dem Versteck unter der Matratze.
Er riss alle Seiten aus dem Buch, eine nach der anderen, und verteilte sie um sich herum am Boden. Nach einer Weile hatten seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt, und dann sah er nur noch Lucinda Hayes.
Auf den meisten Zeichnungen sah sie glücklich aus. Auf den meisten Zeichnungen schien die Sonne, sodass eine Gesichtshälfte heller war als die andere. Die linke, immerzu die linke. Auf den meisten Zeichnungen lächelte sie breit und wirkte längst nicht so schüchtern wie auf dem Jahrbuchfoto. Der Fotograf hatte sie nicht im richtigen Moment erwischt.
Lucindas Gesicht aus der Erinnerung zu zeichnen war überhaupt kein Problem für Cameron. Die hohen Wangenknochen. Die Fältchen an den Mundwinkeln, die verrieten, wie mühelos und zufrieden sie durchs Leben ging. Die langen Wimpern. Die meisten Zeichnungen zeigten sie lachend und mit geöffnetem Mund, man konnte die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen sehen. Cameron liebte diese Lücke. Sie ließ Lucinda irgendwie nackt aussehen.
Cameron drückte die Augen gegen seine Kniescheiben. Er wollte keine Zeichnungen von Lucinda mehr sehen, denn das Wichtigste hatte er vergessen: wie sie, die seit Jahren Ballettunterricht nahm, beim Rennen die Beine nach hinten warf. Wie ihre Haare sich über der Stirn kräuselten, wenn sie in der Hitze nach Hause lief. Wie sie nachmittags am Küchentresen saß, Musik auf ihrem knallrosa MP3-Player hörte und ihre weiß lackierten Fingernägel auf den Marmor klackten. Er hatte sich immer vorgestellt, dass sie Oldies hörte, denn das hätte zu ihr gepasst. Little bitty pretty one. Cameron hatte vergessen zu zeichnen, wie sie im Unterricht die Augen zusammenkniff, wenn sie etwas auf der Tafel nicht lesen konnte. Die Fältchen in ihren Augenwinkeln waren wie Jalousienlamellen, die sie hochgezogen hatte, um das Licht hereinzulassen.
Er wollte die Zeichnungen von Lucinda nicht mehr sehen, weil sie jetzt tot war und er anscheinend nur das Unwichtige festgehalten hatte. Eine verschmierte Iris in Kohle. Ein hastig skizzierter, zu schmaler kleiner Finger.
»Oh Gott, Cam«, flüsterte seine Mutter von der Schwelle aus. »Oh Gott.«
Sie betrachtete den Kreis aus Blättern und stützte sich mit beiden Händen im Türrahmen ab, als könnte sie jeden Moment zusammenbrechen. Ihr rosa geringelter Pullover sah unpassend und traurig aus, am liebsten wäre Cameron auf der Stelle mit ihr verschmolzen, um sie irgendwie jünger zu machen. Ihre ausgebreiteten Arme erinnerten ihn an früher, als er ein kleiner Junge gewesen war und sie im Keller Ballett getanzt hatte. Sie hatte Mozart in den Kassettenrekorder eingelegt und das verstaubte Fensterbrett als Stange benutzt. Sie hatte gemurmelt: Und eins und zwei und drei und vier. Jeté, jeté, pas de bourrée. Cameron hatte hinter dem Kellertreppengeländer gehockt und zugeschaut. Ihr alter Rücken war nie ganz gerade, die alten Zehen nie wirklich gestreckt; sie war wie ein Vogel mit gebrochenen Knochen. Der Anblick seiner tanzenden Mutter hatte ihn traurig gestimmt, denn sie war ihm so zerbrechlich und zerrissen erschienen und gleichzeitig so ausdrucksstark und glücklich. Wenn sie tanzte, sah sie aus wie sie selbst. Jedenfalls dachte Cameron das immer.
Er hätte seiner Mutter gern erklärt, wie leid ihm alles tat. Aber das ging nicht, zu entsetzt betrachtete sie seine Sammlung von Lucinda-Porträts.
Cameron ließ den Kopf wieder auf die Knie sinken und bewegte sich nicht, bis er ganz sicher sein konnte, dass sie gegangen war.
WORAN Cameron NICHTDENKENWOLLTE:
1. Den Revolver vom Kaliber .22, der unter dem Bett seiner Mutter in einer kleinen Kiste lag.
Gandhi war mit einer Beretta M1934 erschossen worden, drei Kugeln in die Brust. Lincoln starb durch eine .44er Taschenpistole von Deringer. Ein Jagdgewehr vom Kaliber .30-06 tötete Martin Luther King Jr., und John Lennon wurde mit einem Revolver des Kalibers .38 ermordet. Ronald Reagan war die einzige Berühmtheit, auf die mit einem .22er geschossen wurde, und er hat den Anschlag überlebt. Diesen Gedanken fand Cameron beruhigend, gerade so, als wäre die Waffe unter dem Bett, sollten er oder seine Mutter sie benutzen, weniger tödlich als beispielsweise eine Neun-Millimeter-Pistole.
2. Dr. Duncan MacDougall
Im Jahr 1907 behauptete Dr. Duncan MacDougall, die menschliche Seele wiege einundzwanzig Gramm. Cameron hatte die Zahl vor ein paar Jahren gelesen, kurz nach dem Tod seiner Großmutter Mary. Er hatte genau ausgerechnet, wo er sich befunden hatte, als sie gestorben war: in der Küche, wo er verkrustete Makkaroni von einem Teller gekratzt hatte. Seine Großmutter hatte gelebt, und dann plötzlich nicht mehr. Musste man das Gewicht der Seele nicht irgendwo abziehen? Nach Marys Tod hatte die Erde einundzwanzig Gramm weniger gewogen, und Cameron hatte einen Teller abgespült. Nichts hatte sich leichter angefühlt.
Jetzt versuchte Cameron auszurechnen, wo er sich am Vorabend aufgehalten hatte, als Lucinda auf dem Spielplatz gestorben war. Aber es war so hoffnungslos, als hätte er versucht, sich an das Frühstück vom Morgen zu erinnern. Die Antwort rückte in immer weitere Ferne, bis er irgendwann nicht einmal mehr sagen konnte, ob er Pancakes oder Pizza gegessen hatte oder ein Fünf-Gänge-Menü. Wenn man zu lange über eine Sache nachdachte, ließ sie sich nicht mehr klären.
3. Das STERNELFENHEIM. Wahrscheinlich war Lucinda jetzt dort, sie stand vor der blau gestrichenen Tür und wunderte sich, dass es einen so stillen Ort überhaupt geben konnte.
4. Die durchsichtigen Haare an Lucindas Schienbeinen, die sie beim Rasieren übersehen hatte.
Bevor Camerons Mutter ihn an dem Nachmittag abgeholt hatte, waren er und Ronnie zusammen zum Geschichtsunterricht gegangen. Ronnie trug seit Donnerstag dieselben Klamotten: eine flaschengrüne Trainingshose, ein weißes T-Shirt mit gelben Achseln und darüber eine offene, zu große Skijacke. Sein Kopf ragte oben aus dem Kragen heraus wie ein Schuhkarton auf einem dünnen Bleistift.
»Mann«, sagte Ronnie, »das ist doch echt verrückt.«
Am Ende des Korridors hatten sich Polizisten versammelt, von Weitem sahen sie aus wie Ameisen.
Cameron war seit einem Monat fünfzehn, aber er nahm keinen Fahrunterricht. Er würde niemals Auto fahren. Er wollte nicht herausgewunken werden und einem Polizisten in die Augen blicken müssen. Hey, würde der Beamte sagen, bist du nicht der Sohn von Lee Whitley?
Dass er seinem Vater so ähnlich sah, machte es nicht besser. Beide waren sie sehnig, beim Gehen schwangen ihre langen Arme weit aus. Sie hatten dieselbe Haarfarbe, hellbraun. (Cameron ließ seine Haare wachsen, weil sein Vater immer einen Bürstenschnitt getragen hatte.) Spitze Nase, blasser Teint, braune Augen. Schmale Schultern, die Cameron unter immer gleichen, weiten Kapuzenpullovern versteckte. X-Beine, die Knie zeigten leicht nach innen. Die Füße auch.
Früher hatten alle gesagt, Cameron lache wie sein Vater, aber daran erinnerte er sich nur ungern.
Auf dem Weg zur Geschichtsstunde redete Ronnie pausenlos, Cameron hörte weg. Ronnie Weinberg war Camerons bester – und einziger – Freund, weil beide keine Ahnung hatten, was man wann zu anderen Menschen hätte sagen können. Ronnie war eine Nervensäge, Cameron eher schüchtern. Von ihren Mitschülern wurden sie mehr oder weniger ignoriert.
Lucindas beste Freundin Beth DeCasio hatte vor langer Zeit entschieden, dass Ronnie stank und Cameron ein Spinner war. Die meisten Leute glaubten, was Beth DeCasio sagte. Einmal hatte Beth Mr O – Camerons Lieblingslehrer – erzählt, Cameron sei einer dieser Schüler, die irgendwann mit einer Waffe in der Schule aufkreuzten. Abgesehen von dem Ärger, den Cameron daraufhin mit der Schulleitung bekam – er musste zur Schulpsychologin, man rief bei ihm zu Hause an, Klassenkonferenzen wurden abgehalten –, wurde er vier Monate am Stück von demselben Albtraum gequält: Er brachte eine Waffe mit in die Schule und erschoss die anderen, ohne es zu wollen. Aber das war noch nicht einmal das Schlimmste. In seinem Traum musste er mit dem Wissen weiterleben, dass es nun unzählige Familien gab, die seinetwegen ein Kind verloren hatten. Seine Mutter war zu mehreren Gesprächen mit den Beratungslehrern in die Schule zitiert worden. Danach war sie vor Wut bebend nach Hause gekommen. Unbegründet und unprofessionell, so lautete ihr Urteil. Sie hatte Cameron einen Tee gekocht und ihm versichert, dass er so etwas nie tun würde.
Manchmal dachte Cameron immer noch daran zurück. Nicht, dass er irgendjemanden hätte erschießen wollen, aber dennoch, er fühlte sich wie das Gift in der Blutbahn der Schule.
Jetzt ging Beth DeCasio vor Cameron her. Sie hatte sich bei Kaylee Walker und Ana Sanchez untergehakt und trug Lila, Lucindas Lieblingsfarbe. Cameron musste an Lucindas Tagebuch denken, es hatte einen lila Samteinband und wurde von einem weißen Gummi zusammengehalten. Die Mädchen weinten. Ihre gekrümmten Schultern zuckten, sie hielten zerknüllte Taschentücher in der Hand.
Normalerweise verließ Lucinda zwischen 7:07 und 7:18 Uhr das Haus. Manchmal nahm ihr Vater, ein Anwalt, sich morgens frei und fuhr mit ihr zusammen zum Frühstück ins Golden Egg, aber das kam höchstens einmal im Monat vor. Cameron hatte alles ganz genau im Blick. Als er Lucindas Freundinnen vor der Vitrine mit den Sportpokalen weinen sah, wurde ihm klar, dass heute Morgen alles anders gewesen war, und er hatte es nicht bemerkt – keine Lucinda auf dem Gehweg, weder vor noch hinter ihm. Sie hatte sich nicht zum Zähneputzen übers Waschbecken gebeugt, sie hatte weder ein Croissant gegessen noch mit ihrer Mutter gestritten, sie hatte ihre Arme nicht in die enge gelbe Daunenjacke geschoben.
Beth, Kaylee und Ana taten Cameron wirklich leid, doch gleichzeitig war er der Ansicht, dass kein Mensch das Recht gepachtet hat, mehr als andere zu trauern. Ein Mädchen war gestorben, ein hübsches Mädchen, das war tragisch. Aber abgesehen davon gab es verschiedene Arten, seine Liebe zu zeigen, und nicht jeder tat es so auffällig und laut.
»Jede Wette, dass es was mit irgendeiner perversen Sexpraktik zu tun hatte?«, sagte Ronnie, als sie im Klassenzimmer ankamen. »Strangulation oder so. Sie hatte doch diesen Freund, den Fußballer. Zap. Der Penner sieht aus, als würde er auf perverse Sachen stehen.« Ronnie legte sich eine Hand an den Hals und verdrehte die Augen.
Ms Evans schaltete das Licht aus und startete einen Film über den Hundertjährigen Krieg.
Cameron hatte Angst im Dunkeln. Letztendlich spielte sich alles nur in seinem Kopf ab. Sobald er sich vergegenwärtigt hatte, welche Gefahren in der Dunkelheit lauerten, redete er sich alle möglichen Horrorszenarien ein und wieder aus: im Schlaf einen Schlaganfall zu erleiden und fortan gelähmt zu sein. Als Schlafwandler die Schublade mit den Steakmessern zu öffnen. Es gab so viele schreckliche Verletzungen, die der Körper sich zufügen konnte. Zu Hause im Bett steigerte Cameron sich manchmal in sein Elend hinein, bis er irgendwann vor Erschöpfung einschlief – oder das Insektengitter abmontierte, das Fenster öffnete und loslief. Keins von beidem verschaffte ihm echte Linderung.
»Verzeihung«, sagte eine schroffe Stimme von der Tür aus. Dieser Geruch … Camerons Vater hatte genau so gerochen. Tabak, Kaffee, rostiges Eisen. »Dürften wir bitte mit einem Ihrer Schüler sprechen?«
»Selbstverständlich«, sagte Ms Evans.
»Cameron Whitley?« Der Polizist zeichnete sich als dunkler Umriss vor dem neonbeleuchteten Flur ab. »Du müsstest bitte mitkommen.«
Jade
Ich habe eine Theorie: Schock lässt sich leichter vortäuschen als Trauer. Ein Schock ist weniger komplex, im Grunde handelt es sich bloß um aufgeblähte Überraschung.
»Soeben wurden weitere Einzelheiten bekannt gegeben«, sagt der stellvertretende Schulleiter und klatscht geschäftsmäßig in die Hände. »Das Opfer, Lucinda Hayes, war Schülerin der Jefferson High. Die Kinder der neunten Jahrgangsstufe haben sich gerade in der Turnhalle versammelt, wo Direktor Barnes ihnen die Nachricht überbringen wird. Am Freitag findet ein Trauergottesdienst statt. Im Sekretariat halten sich Seelsorger bereit. Wir möchten euch bitten, erhöhte Vorsicht walten zu lassen.«
Er marschiert aus dem Klassenraum, seine Hosenbeine erzeugen bei jedem Schritt ein Wischgeräusch.
Ich kneife mir in den Nasenrücken. Ich sehe bescheuert aus, aber wer tut das jetzt nicht? Die eine Hälfte der Klasse wirkt dermaßen bestürzt, dass es zum Fremdschämen ist, die andere fängt vor Freude zu zappeln an. So etwas Aufregendes passiert schließlich nicht alle Tage.
Ich versuche, mir vorzustellen, wie der Schock Zap steht, aber ich wage es nicht, mich umzudrehen.
Zap hat eine ganz eigene Art zu sitzen. Er lehnt sich weit zurück, spreizt die Beine und lässt seine Glieder fallen, wohin sie wollen. Dahinter steckt nicht Arroganz oder mangelnde Haltung, sondern Absicht. Zap macht es sich bequem.
Heute sitzt Zap in der vierten Reihe an dem kaputten Linkshänderpult am Fenster. Er trägt einen roten Pullover und eine Cordhose mit durchlöcherten Knien. Die Hosenbeine sind zu kurz, weil Zap im letzten Winter zwölf Zentimeter gewachsen ist. Seine Brillengläser sind beschlagen. Er ist in der beißenden Februarkälte zur Schule gelaufen.
Ich weiß das, ohne mich umzudrehen.
Den Rest erledigt meine Vorstellungskraft. Der Schock steht ihm ins Gesicht geschrieben. Zuerst nur schlecht, zu locker, aber das ändert sich. Der Schock wird Richtung Schultern wandern und weiter zu dem Muttermal auf der zweiten Rippe von unten und von dort aus weiter abwärts an Stellen, die ich nicht sehen kann.
Ein Schock ist bloß Trauer, die noch nicht tief drinnen angekommen ist.
Ich weiß natürlich längst, dass Lucinda Hayes tot ist.
Ich habe es noch vor der Schule erfahren, als ich ein Stück Aufbackstrudel aß. Ma schmeißt das Tütchen mit der weißen Glasur immer weg, damit wir nicht dick werden. Bei uns zu Hause ist der Strudel deshalb schlicht nur braun und hat schwarze Ofenrillen auf dem Rücken.
»Setzt euch, Kinder«, sagt sie und schnippt Zigarettenasche in die Spüle. Es zischt. Morgens sind die Falten in ihrem Gesicht tief wie Canyons.
Amy wankt an den Küchentisch und hievt ihre riesige Tasche auf meinen Platz. Vor Kurzem hat sie beschlossen, dass Schulranzen zu kindisch für Siebtklässlerinnen sind, seither benutzt sie eine Handtasche aus braunem Kunstleder. Die Mathebücher sind so schwer, dass Amy praktisch humpelt.
»Es ist wegen Lucinda«, sagt Ma. »Es tut mir so leid, mein Schatz. Sie ist … sie ist verstorben.« Sie seufzt mitleidig, was sie normalerweise nur für den Mann am Postschalter tut und für den Jungen in Amys Klasse, der schon zum zweiten Mal Krebs hat.
Amys Unterlippe bebt. Sie stößt einen schrillen, kehligen Heulton aus, springt auf und torkelt rückwärts gegen die Terrassentür. Sie dreht sich um, presst ihre gespreizten Finger mit den rosa lackierten Nägeln an die Scheibe. Ihre Hände sehen aus wie Seesterne.
Ma trägt eine Jogginghose. Sie drückt ihre Zigarette auf einem Pappteller mit Pizzaresten aus und kniet sich neben Amy, die am Boden zusammengesunken ist. Sie streicht ihr über den Kopf, entwirrt bei der Gelegenheit gleich unauffällig ein paar verfilzte Haarsträhnen.
»Es tut mir so leid, Schätzchen. Sicher wird es in der Schule auch noch mal verkündet.«
Mit Amy hat sie Mitleid, mit mir nicht. Ich habe noch nie so geweint wie Amy, mit abgehackten Schluchzern. Nicht, dass ich besonders tapfer oder gelassen wäre oder so. Ich empfinde für die anderen einfach nicht genug. Meine Ma weiß das. Sie wirft mir einen bösen Blick zu, Amy lässt den Kopf in ihre Armbeuge sinken. Eine dünne Spur aus Rotze läuft aus Amys Nase über Mas sommersprossige Haut.
»Meine Güte, Jade«, sagt Ma und mustert meinen Bauch, der unter einem zu kurzen Crucibles-T-Shirt herausquillt. Ich trage einen Armeeparka darüber, aber der steht weit offen. »Geh und zieh dir was Richtiges an. Heute bringst du deine Schwester zur Schule.«
Ich beuge mich über den Küchentresen und stütze beide Ellenbogen auf ein uraltes Telefonbuch.
Über Gefühle sollte man lieber nicht reden. Ich frage mich, wieso die Leute das überhaupt tun, denn am Ende sind die eigenen Gefühle doch wieder die falschen. Amy schluchzt, aber ich spüre nichts als eine seltsame Leichtigkeit, als hätte jemand das Gewicht aus meinen Beinen und die furchtbaren Gedanken aus meinem Kopf abgesaugt, und schon ist das Stechen in meinem Brustkorb weniger schmerzhaft. Ich weiß auch nicht.
Es ist so still.
»Bist du überhaupt normal?«, fragt Amy.
Die Madison Middle School erhebt sich als Betonklotz in der Ferne.
»Ich bin kein Mensch, ich bin ein Alien«, sage ich. »Überraschung!«
»Du bist ja nicht mal traurig.«
»Doch, bin ich.«
»Nein, bist du nicht. Ma sagt, du hast echte Probleme. Kein Mitgefühl, keine Selbstbeherrschung und sardische Tendenzen.«
»Es heißt sadistische«, korrigiere ich sie.
»Lucinda ist tot«, sagt sie, »und dir ist es egal.«
Amy schultert die Handtasche, ihr Leopardenprintmantel verrutscht. Amy trägt einen BH in Größe 65 A und sieht immer niedlich aus, egal, wie sie sich fühlt. Das liegt an der vorteilhaften Kombination von rotem Haar mit Unmengen von Sommersprossen, die Amys Wangen überziehen wie Sandkörner.
»Das ist echt krank, Jade«, sagt sie. Vor dem Wort »krank« hält sie kurz inne, als müsste sie überlegen. »Wir kennen sie, seit wir auf der Welt sind, und jetzt ist sie tot, und du tust nicht mal so, als würde es dir was ausmachen.«
Ich schiebe meine Zungenspitze in den Silberring an meiner Unterlippe. Ich tue das immer, wenn ich jemanden zum Schweigen bringen will. Es funktioniert jedes Mal.
Amy stapft weiter, schlingt sich die Arme um den Leib und unterdrückt die Schluchzer. Sie ist ja so eine Dramaqueen. Sie war gar nicht mit Lucinda befreundet, höchstens mit Lucindas kleiner Schwester Lex. Früher, als wir jünger waren, mussten wir einmal pro Woche zu den Hayes rüber. Lex und Amy haben im Untergeschoss stundenlang Prinzessin gespielt, Lucinda und ich saßen verkrampft schweigend in Lucindas Zimmer rum, bis Ma uns wieder abholen kam. Lucinda knüpfte Freundschaftsbänder, und ich las Comics. Wir ignorierten einander demonstrativ, während unsere kleinen Schwestern in ihre Fantasiewelt abtauchten. Damals waren Lex und Amy unzertrennlich, heute sehen sie sich nur noch, wenn Ma eine Verabredung einfädelt.
Ich frage mich, was Amy fühlen würde, wenn ich sterben müsste. Vielleicht würde sie ein paar Nächte in meinem Bett schlafen. Vielleicht würde sie eine Kuscheldecke aus meinen alten T-Shirts nähen und sie in eine Schachtel legen und eines Tages ihren Kindern zeigen, an deren sechzehnten Geburtstag. Möglicherweise wäre sie erleichtert. Auf einmal werde ich mir der drei Meter Abstand zwischen uns bewusst, der vier Gehwegplatten, die mich und Amy trennen. Ich gehe schneller, um sie einzuholen. Aber der Wunsch nach Nähe verschwindet, so schnell er gekommen ist, und zurück bleibt nur ein vager Hass. Er pulsiert in meinem Innern, an einer Stelle, an die ich nie ganz herankomme.
WAS MAN GERN SAGEN MÖCHTE UND NICHT SAGEN KANN, ES SEI DENN, MAN IST EIN ARSCHLOCH
Von Jade Dixon-Burns
AUSSEN. PINE RIDGE DRIVE, BROOMSVILLE, COLORADO, FRÜH AM MORGEN.
CELLY (17, krumme Haltung, schwarz gefärbte Haare) und ihre SCHWESTER (13, das genaue Gegenteil) gehen zur Schule. CELLY summt ein fröhliches, poppiges Lied.
SCHWESTER
Bist du überhaupt normal?
CELLY
Ich bin ein Alien – Überraschung!
SCHWESTER
Du bist nicht mal traurig.
CELLY
Nein, bin ich nicht.
SCHWESTER
Das ist krank.
CELLY
Wie kannst du vorgeben, traurig zu sein? Du kanntest sie kaum.
SCHWESTER
Wen interessiert, wie gut ich sie kannte? Wir sind doch hier nicht beim Beliebtheitswettbewerb.
CELLY
Das ganze Leben ist ein Beliebtheitswettbewerb. Du redest davon, wie traurig du bist, aber ich weiß genau, wie es ablaufen wird. Du wirst heute mit wissender Miene in die Schule gehen, dich von deinen hübschen kleinen Freundinnen umarmen lassen und ihnen erzählen, dass Lucinda dir vor fünf Jahren mal ihren Nagellack geliehen hat.
SCHWESTER geht schneller.
CELLY
Niemand wird es wagen, dir zu sagen, dass du Scheiße laberst. Deine hübschen kleinen Freundinnen werden dich belagern, jede will der Wunde am nächsten sein.
SCHWESTER biegt um die Ecke, rennt fast. CELLY ruft ihr nach.
CELLY (laut)
Du wirst dir ein Lächeln trotzdem nicht verkneifen können, die Lehrer werden dir keine Hausaufgaben aufgeben. Und jetzt erzähl mir noch mal, das Leben wäre kein Beliebtheitswettbewerb. Erzähl mir das, kleine Schwester. Los!
SCHWESTER springt die Treppenstufen zum Eingang hoch. CELLY bleibt unten stehen und sieht sie in der Schule verschwinden.
CELLY (leise)
Erzähl mir was von Traurigkeit.
Früher hing eine Sternenkarte unter der Decke von Zaps Kinderzimmer. Ich lag auf seinem Bett, habe mir das schwarze Nichts zwischen den Planeten angesehen und zu begreifen versucht, dass ein Zentimeter auf der Karte eins Komma sechs Millionen Kilometern in der Wirklichkeit entsprach. Ich habe mir vorgestellt, ich hätte einen unerschöpflichen Sauerstoffvorrat und würde durchs Weltall schweben. Auf diese Weise konnte ich glatt vergessen, wie oberflächlich und beschränkt das Leben auf der Erde war. Das denke ich jetzt, während ich versuche, die Mädchen vor dem Spiegel auszublenden. Ich frage mich, wie sich ein Leben im Weltall anfühlen würde, wie es wäre, in diesem luftleeren Raum ganz allein zu sein. Ohne Geräusche.
»Ich habe gehört, dass Zap nach Hause gegangen ist. Er hat niemandem was gesagt und ist einfach nach der ersten Stunde abgehauen.«
»Kein Wunder, sicher ist er am Boden zerstört.«
Ich drücke auf die Toilettenspülung, damit sie merken, dass ich auch hier bin. Es hilft nichts, sie machen einfach weiter, sie krähen wie die Hähne und würden selbst einen Zombie aus dem Schlaf reißen. Ich konzentriere mich auf die Schnürsenkel meiner klobigen schwarzen Stiefel, bis die Waschraumtür aufgestoßen wird. Vom Flur dringt das Geplapper in Fetzen herein, die Tür fällt wieder zu. Höhlenartige Stille.
Zap hat die Sternenkarte geliebt. Sein bevorzugtes Sternzeichen war die Waage, weil sie aussah wie ein Drachen. Angeblich hat ihn das an seine Kindheit in Paris erinnert. Er meinte, er wüsste noch genau, wie es an der Seine aussah. An schönen Sommertagen stand er am Ufer und ließ seinen rot-blau karierten Drachen steigen. Vor Jahren hat Zap mir mal eine Muschel geschenkt, die er bei einem Urlaub mit seinen Eltern an einem Strand der französischen Riviera gefunden hatte. Eines Tages verschwinden wir von hier, hat er gesagt. Die Welt ist riesig, du wirst schon sehen. Die Muschel ist beige und sieht aus wie ein Ohr. Früher lag sie unter meinem Kopfkissen.
Zap ist natürlich nicht sein richtiger Name. Eigentlich heißt er Édouard, mit Betonung auf der zweiten Silbe. Seine Eltern stammen aus Frankreich und sind im Alter von achtzehn Jahren in die Staaten gekommen. Sie haben sich im französischen Studentenverein von Yale kennengelernt und sind seitdem ein Paar – wahre Liebe. Mr Arnaud kauft auf dem Heimweg von der Arbeit regelmäßig Blumen für seine Frau, manchmal sieht man sie Hand in Hand spazieren gehen. Zaps Mutter ist wie ein Wesen aus dem Wald, zart und grünäugig.
Weil niemand »Édouard« richtig aussprechen kann, heißt er Zap, seit der vierten Klasse, als er in einem gelben Blitzkostüm in die Schule kam. Er hatte es aus einem riesigen Pappkarton gebastelt, in der Woche nach der Blitzflut von 1998, bei der in Longmont, einem Nachbarort von Broomsville, drei Menschen ertrunken sind. Zap hatte den Blitz gelb angemalt und an seine Hosenträger geklebt. Den ganzen Tag rannte er durch die Schule, rief zap, zap, zap und teilte kleine Schokoriegel aus. Er sei, erklärte er, eine Naturgewalt, aber eine, die nur Gutes wolle und keinen Schaden anrichte. Ich fand das super. Alle fanden das super. Nach der Schule standen Zap und ich auf der Wiese hinter dem Haus und sahen zu, wie die Wolken den Rückzug ins Gebirge antraten.
In dem Sommer brachte Mrs Arnaud uns Thermosflaschen mit Kakao in den Garten. Mr Arnaud holte die Campingausrüstung, und dann lagen wir im Schlafsack auf dem Rasen und beobachteten den Meteoritenregen. Die harten Grashalme bohrten sich von unten durch den Stoff. Leider war der Himmel in dieser Nacht bewölkt, aber das war uns egal. Die Schlafsäcke rochen wie das Haus der Arnauds, nach Waschmittel und Weihnachtskerzen. Wir lagen auf dem Rücken, und Zap gab sein nutzloses Wissen über den Weltraum zum Besten, zum Beispiel, dass von der Erde aus leider nur neunundfünfzig Prozent der Mondoberfläche zu sehen sind.
Als ich an Zap denke, wird mir schlecht. Ich beuge mich über die Kloschüssel und würge ein paarmal. Das Geräusch klingt übertrieben, gekünstelt. Jemand öffnet die Waschraumtür, hört mich, verschwindet wieder. Ich würge, aber es kommt nichts.
Ich stelle mich ans Waschbecken und spiele mit dem Gedanken, mir kaltes Wasser ins Gesicht zu spritzen. Aber ich trage zu viel Make-up, der Kajal würde verschmieren, es würde so aussehen, als hätte ich geweint. Völlig ausgeschlossen. Der schwarze Strich ist extra breit, was Ma nicht ausstehen kann.
Normalerweise meide ich Spiegel, aber heute hilft der Blick auf mein Äußeres, um mich neu zu verorten. Das ganze Universum hat sich verändert. Aber meine Oberarme sind noch immer teigig. Mein Teint ist kränklich weiß. Überall blühen die Pickel, trotz der verschreibungspflichtigen Medikamente und der monatlichen Besuche beim Dermatologen. Lass die Finger davon, sagt meine Mutter immer, aber ich mag es, wenn die Haut sich abschält. Ich mag es, wenn das rote, glänzende Fleisch zum Vorschein kommt.
Russ
Warum sind Sie Polizist geworden?
Er habe das, sagt Russ, schon als Kind entschieden. Eine unbeschreibliche Gewalttat sei der Auslöser gewesen, über die Einzelheiten wolle er nicht sprechen. Die Leute nicken höflich – ehrfürchtig, respektvoll, notgedrungen mitleidig –, aber Russ fühlt keine Genugtuung.
In Wahrheit ist Russ Polizist geworden, weil das Geld für ein Studium nicht reichte und er gehört hatte, es habe Vorteile, eine Waffe zu tragen.
Russ’ Telefon klingelt um 5:41 Uhr.
Hallo?, sagt er.
Auf seinen Zähnen ein schleimiger Film. Er hat geschlafen.
Russ, sagt der Lieutenant, die Stimme knisternd im Hörer, wir haben eine Leiche.
Russ hebt die getragenen Boxershorts vom Boden auf. Steigt hinein. Normalerweise klettert er, wenn er ins Bad will, über Ines hinweg, um für drei Sekunden ihre Wärme zu genießen, die verschwitzte, salzige Haut unter ihrem verschlissenen Baumwollshirt. Ines wacht nie auf davon, und wenn Russ anschließend unter der Dusche steht und sich mit billigem Waschgel einseift, hat er immer noch Gelegenheit, sich selbst zu verabscheuen.
Heute steigt Russ auf seiner Seite aus dem Bett.
Wir haben eine Leiche. Den Satz hat Russ nie zuvor gehört. Na ja, im Fernsehen. Oder im Kino. Und selbstverständlich hatte er ihn auch beim Bewerbungsgespräch im Kopf, auf der Polizeischule, während seiner Ausbildung in Broomsville. Damals schien der Job so vielversprechend, voller Möglichkeiten, da wusste Russ noch nicht, dass er neunzig Prozent seiner Arbeitszeit herumsitzen und warten würde, dass irgendein Auto fünf Meilen pro Stunde zu schnell fuhr.
Um 5:54 Uhr sitzt Russ im Streifenwagen, das Funkgerät rauscht. Es ist noch dunkel. Seine Hände sind taub, das mit Leder bezogene Lenkrad und der Steuerknüppel eiskalt.
Russ fährt sich mit der Zunge über die Zähne und bereut es sogleich. Zahnbelag. Für seine Mutter war das ein Schimpfwort, angewidert zog sie die Mundwinkel nach unten. Er hat wieder mal vergessen, sich die Zähne zu putzen.
6:03 Uhr, und Russ ist als Letzter da.
Die Leiche liegt auf dem Spielplatz neben der Grundschule. Fünf Streifenwagen stehen auf der Fahrbahnmitte herum, als hätte eine apokalyptische Flut sie aus den Parkbuchten gespült. Die roten Warnlichter von Feuerwehrautos und Krankenwagen zucken über die Kreuzung. Russ parkt an der Ecke, unter den Autoreifen knirscht der Schnee. Eine Schicht aus frischem Schneematsch bedeckt die Straße.
Fletcher, sagt einer, als Russ näher kommt. Er hat Monate gebraucht, sich an diese Anrede zu gewöhnen. Fletcher, das war immer sein Vater. Selbst nach dem ersten Dienstjahr kam es vor, dass er sich nicht angesprochen fühlte. Jemand rief: Fletcher!, und Russ tippte seelenruhig Protokolle ab.
Das Team hat sich um die kleine Drehscheibe auf dem Spielplatz versammelt. Alle sind verschlafen, reiben sich die müden Augen: Sergeant Capelli, Lieutenant Gonzalez, Detective Williams und die fünf Verkehrspolizisten. Sie bilden einen engen Kreis in der schwarzen Nacht, im Hintergrund steht ein Streifen Grau am Himmel, genau dort, wo später die Sonne aufgehen wird.
Detective Williams scheucht Russ vor sich her, ohne die Hände aus den Manteltaschen zu nehmen. Wozu er so lange gebraucht habe? Er müsse das sehen, wirklich übel, wie man sie aufgefunden habe. Gehen Sie, sehen Sie sich das an.
Die Leiche eines jungen Mädchens. Fünfzehn, vielleicht sechzehn Jahre alt. Sie liegt unter einer dünnen Schneedecke, im Flutlicht der Kriminaltechnik schimmert ihre Haut gelblich. An einer Seite des Kopfes sind Blut und Schnee zusammengeklumpt, das blonde Haar ist nur noch an wenigen Stellen zu erkennen. Ihr Genick ist gebrochen, der Hals seltsam verdreht. Die Augen des Mädchens sind geschlossen – post mortem, denkt Russ, jemand hat ihr mit einer hilflosen Bewegung den Schnee von der Stirn gewischt. Sie trägt einen lila Rock und eine schwarze Strumpfhose. Die Glitzerpartikel darin lassen den Stoff schimmern.
Später wird Russ Fotos des Mädchens sehen, sie wird ihn an seine ehemaligen Mitschülerinnen erinnern, an die Mädchen, an die er und seine Freunde beim Wichsen dachten, wenn sie am frühen Nachmittag allein zu Hause waren und ängstlich auf das Klappern des Garagentores horchten. Knabenhafte, schmale Hüften.
Lucinda Hayes, sagt jemand hinter ihm.
Detective Williams. Er legt Russ eine behaarte Hand auf die Schulter und fährt fort: Die Familie hat sie gestern am späten Abend vermisst gemeldet. Die Eltern haben ein Geräusch im Garten gehört und in ihrem Zimmer nachgeschaut, das Bett war leer. Die Beschreibung kommt hin. Wenn die Kollegen von der Rechtsmedizin hier fertig sind, werden Sie und die Jungs noch bleiben und den Fundort sichern. Danach sollten Sie sich mal in der Nachbarschaft umsehen. Klingeln Sie die Leute raus, stellen Sie ein paar Fragen.
Ist das Ihre erste Leiche?
Russ schweigt. Er betrachtet die Tote. Sie sieht nicht gerade friedlich aus. Er denkt an Ines, wie oft sie nachts die Position verändert. Ines hat sieben oder acht verschiedene Stellungen, die sie der Reihe nach einnimmt, sie ist ständig auf der Suche nach der bequemsten Haltung und kann sie niemals finden.
Die Leiche – Lucinda Hayes – erinnert Russ an seine Frau. Die Leiche weiß nicht so recht, wie sie liegen soll. Sie hat die Beine leicht gespreizt und sieht unzufrieden aus.
Russ war gerade erst einundzwanzig geworden, als er in den Polizeidienst eintrat. Nach der Schule hatte er drei Jahre damit zugebracht, auf dem Sofa seiner Eltern zu liegen, Liegestütze auf dem Teppich zu machen und aufs Älterwerden zu warten. Er besuchte ein paar Kriminologievorlesungen am örtlichen College, und nach dem Abendessen saß er mit seinem Vater zusammen, der Scotch trank und von früher erzählte. Er öffnete die Andenkenbox, nahm seine Dienstmarke und seinen alten Revolver heraus und redete, bis seine Wangen glühten. Als er in den Ruhestand ging, gab es die berüchtigten kalten Platten und billigen Sekt.
Bei den Einstellungstests schnitt Russ mittelmäßig ab: schriftliches Examen, mündliches Examen, psychischer Eignungstest, Fitnessprüfung. Danach ein Praktikum. Zwanzig Wochen lang folgte er einem älteren, erfahrenen Kollegen auf Schritt und Tritt.
Er wurde Lee Whitley zugeteilt, ein blasser, knochiger Officer, der unbeliebteste Kollege bei der Polizei von Broomsville. Er war seit vier Jahren im Dienst und so unscheinbar, dass hinter seinem Rücken darüber getuschelt wurde.
Russ lässt die Erinnerung nur selten zu. Und wenn es dann doch passiert, fragt er sich, ob er tief in seinem Herzen immer gewusst hatte, wie es mit Lee Whitley enden würde.
Sie waren einander gleich am ersten Tag von Russ’ Praktikum begegnet, vor dem Büro des Lieutenants. An einem trüben Nachmittag des Jahres 1988 war das gewesen. Damals toupierten die Frauen sich noch die Haare, Zigaretten galten als halbwegs unschädlich, die Leute trugen Moon Washed Jeans und weiße Turnschuhe mit dicker Sohle.
Lee war unglaublich dürr. Wenn er redete, wanderte sein Blick nach links unten. Breite Nase, X-Beine. Braune Augen mit stecknadelkopfgroßen Pupillen. Wenn ihm jemand scherzhaft auf den Rücken schlug, klang seine eingefallene Brust hohl.
Okay, sagte Russ. Mehr brachte er nicht heraus.
Okay, sagte Lee.
Russ klopfte ihm in jugendlicher Unbedarftheit auf die Schulter, Lee fing zu husten an und lächelte schelmisch. Er zerdrückte den Pappbecher in seiner Hand, ein Rinnsal aus Instantkaffee lief ihm über den Unterarm. Russ mochte ihn sofort, diesen räudigen Hund, der noch immer groß herauskommen wollte, während ihm braune Flüssigkeit vom Ellenbogen tropfte.
Und so fing es an. Sie waren ein seltsames, geniales Team. Schon nach ein paar Minuten war ihnen beiden klar, dass sie eine schwer zu fassende Einheit bildeten. Wie Seifenwasser auf einem Parkettboden – früher oder später würde jemand ausrutschen und fallen.
Wer hat sie gefunden?, fragt Russ einen der Verkehrspolizisten.
Der Hausmeister, antwortet der Polizist und zeigt mit dem Mittelfinger zu den Kollegen hinüber. Russ folgt seinem Blick, obwohl er bereits weiß, wen er zu sehen bekommen wird.
Den Hausmeister. Klar.
Ivan hat eine Hand in seinen Arbeitsoverall geschoben. In der anderen hält er eine Zigarette. Wenn Ivan seine mächtige Lunge entleert, ist die Luft ringsum doppelt belastet, mit Nikotin und schlechtem Atem. Die Zigarettenglut leuchtet in einem kräftigen Orange und hebt sich deutlich von dem Hintergrund aus schwarzen Uniformen ab. Der Schnee ist elend grau. Russ wundert sich kein bisschen über Ivans Anwesenheit auf dem Spielplatz, er weiß, dass Ivan nachts im Schulgebäude herumläuft. Ines hat Russ gebeten, seine Kontakte spielen zu lassen, Russ hat ihr den Gefallen getan. Ivan hat es nicht leicht.
Russ liebt seine Frau sehr. Die stille Ines. Ihren Bruder liebt er weniger, ehrlich gesagt wünscht Russ sich, Ivan würde sich einfach in Luft auflösen.
Er ist jetzt mit dem Leichnam allein. Russ hebt sich das Funkgerät an die Lippen und spricht hinein. Das Mikro ist ausgeschaltet. Bist du da?, murmelt Russ. Sein Blick ruht auf den Haaren des Mädchens, sie sehen aus wie blutiges Stroh. Kannst du mich hören? Russ hält sich das Funkgerät an die aufgesprungenen Lippen, aber ihm fällt nicht ein, was er sagen könnte. Ivan, der bedrohliche Testosteronriese, grinst schadenfroh und hält die glühende Zigarette zwischen seinen schlaffen Fingern wie eine Provokation.
Cameron
Du bist der Typ, der das tote Mädchen gestalkt hat, oder?«
Das Mädchen saß auf einem Stuhl mit kratzigem Polster, gleich vor Schuldirektor Barnes’ Büro. Cameron war gemeint.
»Wie bitte?«
»Du bist der, über den alle reden. Der Junge, der hinter dem toten Mädchen her war.«
Gelangweilt ließ sie den Kopf rückwärts an die Wand sinken. Cameron kannte sie vom Sehen, sie wohnte in der Nachbarschaft und war immer allein unterwegs. An den Taschen ihrer Jeans baumelten Ketten, ihre Augen waren schwarz umrandet. Schwarze, fettige Haarsträhnen verdeckten die eine Gesichtshälfte, den Bandnamen auf ihrem T-Shirt hatte Cameron noch nie gehört. Das Shirt war nachlässig abgeschnitten, über dem Hosenbund faltete sich eine weiße Speckrolle auf. Draußen war immer noch Winter, ihr musste kalt sein. Stirn und Kinn des Mädchens waren von Akne überzogen.
Sie zog eine strichdünne Augenbraue hoch. Cameron hätte die Geste erwidert, aber bei ihm bewegte sich die zweite Braue automatisch mit, und er wollte sich nicht lächerlich machen.
»Ist schon okay«, sagte sie. »Hab nur laut gedacht. Mir ist egal, wer du bist.«
»Oh«, sagte Cameron.
»Das tote Mädchen und ich haben auf dasselbe Kind aufgepasst.«
»Lucinda?«
»Kann sein. Was die hier machen, ist total illegal. Man darf Minderjährige nicht ohne das Einverständnis der Eltern befragen. Die denken vermutlich, sie könnten sich auf Seelsorge rausreden, weil kein Polizist mit im Raum ist, aber das ist Augenwischerei. Wir wurden von Polizisten aus der Klasse geholt! Reine Einschüchterungstaktik, wenn du mich fragst.«
Sie nickte, hochzufrieden mit ihrer Analyse. Ihre Augen waren kreisrund. Cameron hatte Lucindas Katzenaugen geliebt, die Augen dieses Mädchens waren das Gegenteil davon. Sie erinnerten ihn an runde, glasige Murmeln.
»Ich bin Jade«, sagte das Mädchen. »Wie der Stein. Ich gehe in die Elfte.«
»Das ist ein hübscher Name.«
»Ich hatte noch Glück«, sagte sie achselzuckend, »meine Schwester heißt Amethyst. Und du bist Cameron Whitley aus der Neunten. Du wohnst auch in Lucindas Straße. Alle machen sich Sorgen um deine psychische Verfassung, weil dein Vater dieser Polizist war, der …«
»Bitte nicht«, sagte Cameron.
»Ist das nicht schon ewig her?«
Cameron wünschte, er wäre ein besserer Gesprächspartner. Er unterhielt sich nur ungern mit anderen Menschen, meistens wusste er nicht, was er sagen sollte. Er war schon mit einfachen Fragen überfordert: Welche Antwort klang am besten, was wäre passend, womit würde sich der Zuhörer am wohlsten fühlen?
Er könnte Jade nach ihren Klamotten fragen. Oder woran sie heute Morgen als Erstes gedacht hatte. Oder warum ihre Eltern sie Jade genannt hatten. Der Name war selten, das gefiel Cameron. Er würde seinen Kindern später auch besondere Namen geben. Er könnte Jade nach ihrem Lieblingsfach fragen, aber das käme vielleicht zu streberhaft rüber. Er könnte sie fragen, ob sie schon mal verliebt gewesen war, aber selbst er wusste, dass das zu persönlich war.
»Hat es wehgetan?«, fragte er schließlich, weil Jade ihn kritisch und irgendwie fordernd ansah. Er zeigte auf den Silberring in ihrer Unterlippe.
»Ja, ein bisschen.«
»Oh.«
»Willst du mein Tattoo sehen?«
»Klar.«
Jade hielt ihm ihr linkes Handgelenk hin. Cameron sah die schwarze Silhouette eines Drachen, der auf der weißen Haut die Flügel spreizte. Über Jades blauen Pulsadern war die Tinte leicht verwischt.
»Ist das echt?«, fragte Cameron.
»Normalerweise sage ich Ja. Zu den meisten Leuten. Aber du machst ein Gesicht, als würde dich die Antwort wirklich interessieren. Nein, es ist nicht echt. Ich ziehe es jeden Morgen nach.«
Cameron wusste nicht genau, ob das mit dem Gesicht das Netteste oder das Gemeinste war, was man je zu ihm gesagt hatte.
»Und«, fragte sie, »bist du der Typ, der das tote Mädchen gestalkt hat?«
»Lucinda.«
»Ihr Name ist mir so was von egal.«
Cameron hatte etwas gegen das Wort. Gestalkt. Es gab viele Wörter für sein Verhältnis zu Lucinda, Wörter allerdings, die kaum jemand verstanden hätte. Pulsierend, hektisch, funkelnd, sehnsüchtig …
Die Tür zum Büro des Schuldirektors öffnete sich, eine Frau mit straff zurückfrisiertem Haar streckte den Kopf heraus.
»Jade?«, fragte sie. »Du kannst jetzt reinkommen.«
Jade sah Cameron an und verdrehte die Augen, als wären sie Verbündete. Sie stand auf, Cameron nahm den Geruch von fruchtigem Duschgel wahr. Plötzlich fiel ihm ein, dass er ebenfalls die Augen hätte verdrehen müssen, aber Jade hatte sich schon in Bewegung gesetzt und würde sich kaum noch einmal umdrehen.
Im Alter von zwölf Jahren hatte Cameron angefangen, sich nachts aus dem Haus zu schleichen und Statue zu spielen. Im Sommer nach der siebten Klasse hatte er gemerkt, dass sich das Insektengitter an seinem Kinderzimmerfenster ohne größere Kraftanstrengung entfernen ließ. Der Sprung auf den Pflanzkübel darunter war machbar, wenn man im richtigen Moment in den Knien federte.
Das Spiel begann nebenan bei den Hansens. Cameron stand stundenlang vor dem Haus auf dem Gehweg und schaute zu, wie sie Essen in der Mikrowelle aufwärmten oder sich stritten. Abends trug Mrs Hansen Lockenwickler wie eine Frau in einer TV-Serie aus den Fünfzigerjahren, Mr Hansen lief in Boxershorts durch die Zimmer. Michelangelo wäre entzückt gewesen über so viel schlaffe Haut, unter der sich die alten Knochen abzeichneten. Im Haus brannten alle Lampen, man konnte gar nicht anders, als hinzusehen. Der menschliche Blick richtet sich ganz reflexhaft auf die Lichtquelle, hatte Cameron im Atlas des menschlichen Körpers über die Netzhaut gelesen.
Während jenes ersten Sommers hatte Cameron sich langsam durch den Pine Ridge Drive gearbeitet. Wenn er absolut still stand, wurde er nicht gesehen. Cameron liebte die winzigen Details: Mrs Hansen bereitete Schonkost für ihren Mann zu, während Mr Hansen in einem Tontopf neben dem Kühlschrank Schokoriegel bunkerte.
Daneben wohnten die Thorntons. Einmal hatte Cameron sie beim Sex beobachtet, auf dem Küchentisch, als das Baby nebenan schlief. Auf den ersten Blick wirkten ihre Bewegungen grob und unkoordiniert, wie zwei kämpfende Hunde sahen sie aus, aber nach einer Weile fanden sie in einen gemeinsamen Rhythmus und schaukelten wie ein Boot. Danach stützte Mr Thornton sich auf die Ellenbogen und küsste seine Frau andächtig auf die Stirn. An manchen Abenden lief Mrs Thornton mit dem Baby im Arm durchs Wohnzimmer, während ihr Mann den kleinen, humpelnden Familienhund zum Zehnuhrspaziergang ausführte. Sobald er auf die Straße trat, war Cameron gezwungen, nach Hause zu gehen.
Während er auf die Vernehmung wartete, zog Cameron sein Lieblingsradiergummi aus der Hosentasche und knetete daraus Figuren. Mr O hatte es ihm gegeben und gesagt, es könne helfen, wenn er sich ENTWIRREN musste. Cameron benutzte es regelmäßig. Er versuchte, auf seinem Oberschenkel ein perfektes Quadrat zu formen.
Etwa zur selben Zeit, als Mr O die Klasse im Porträtzeichnen unterrichtete, begann Cameron, Lucinda zu beobachten. Plötzlich erkannte er Erdhügel in den Wangenknochen seiner Mitmenschen, Spinnenbeine in ihren Wimpern, und er lernte, das alles in verschiedenen Abstufungen von Grau wiederzugeben. Er liebte Lucindas Gesicht, das aus Schwüngen und sanft abfallenden Flächen bestand.
In seinen NÄCHTENALSSTATUE hatte er Lucinda oft studiert. Er hatte sich vorgestellt, eine Figur von Michelangelo zu sein, bis in alle Ewigkeit auf dem Papier erstarrt. Aber es war immer dasselbe – irgendwann hörte er sein Herz pochen oder seinen eigenen, zu lauten Atem. Und sobald die Stille durchbrochen war, wurde ihm klar, dass er noch existierte, egal, wie reglos er zu stehen versuchte.
Er wusste nie, wie lange er still gestanden hatte, und vielleicht war genau das der Sinn der Sache.
Am 11. Februar 2004, vor fast genau einem Jahr, hatte Lucindas Vater die Terrassentür aufgeschoben. Ich weiß, dass du da bist, schallte seine Stimme über den leeren Rasen. Ich weiß, du meinst es nicht böse, aber du musst jetzt gehen. Wenn du noch einmal hier auftauchst, rufe ich die Polizei. Cameron war durch den Pine Ridge Drive nach Hause gerannt und hatte sich mit dem Atlas desmenschlichen Körpers unter der Bettdecke versteckt. Er prägte sich die Funktionsweise der Nieren ein, wo eine ganz bestimmte Emotion ihren Ursprung zu haben schien: das Schuldgefühl.
Er hoffte sehr, dass die Polizei ihn nicht zu seinem letzten Auftritt in Lucindas Garten befragen würde. Cameron war ein schlechter Lügner, aber die Wahrheit – dass er Menschen am faszinierendsten fand, wenn sie sich unbeobachtet glaubten – konnte er niemandem erzählen. Er würde auch nicht behaupten können, dass er sich für seine nächtlichen Ausflüge hasste und dennoch nicht aufhören konnte. Er wollte gar nicht aufhören.
In Broomsville herrschte eine ganz bestimmte, unverwechselbare Atmosphäre, was wohl an den niedrigen, pastellfarbenen Häusern und den vielen Grünflächen lag. In der Top Ten der kinderfreundlichen Städte auf CNN hatte es für Platz fünf gereicht, was niemanden verwunderte. Broomsville war eine einzige verkehrsberuhigte Zone mit rechteckigen, von der Dürre in Colorado oftmals gebräunten Rasenstücken. Es gab hier keine weißen Gartenzäune, dafür aber gute öffentliche Schulen, es gab Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Sportangebot. Die Durchschnittsfamilie wohnte in einem beigefarbenen Haus, so wie Cameron und seine Mutter: zwei Etagen, vier Zimmer, hinter dem Fenster das Vorgebirge der Rocky Mountains. Die Einwohner von Broomsville fuhren Geländewagen, Pick-ups oder SUVs mit Aufklebern wie »BUSHCHENEY ’04!«.
Und über allem die Berge. Den Bergen entging nichts.
Die Luft in Colorado war so frisch, dass sie in der Nase stach. Einmal war eine Studienfreundin seiner Mutter aus Florida zu Besuch gekommen und gleich am ersten Tag umgekippt. Sie litt an der Höhenkrankheit, Camerons Mutter musste den Notarzt rufen. Die Sanitäter zogen der Freundin Bluse und BH aus und schoben ihr Plastikschläuche in die Nase, damit sie leichter atmen konnte. Sie lag rücklings auf dem Wohnzimmerteppich, ihre nackten Brüste rutschten zur Seite. Cameron versuchte, nicht hinzusehen.
Nach ein oder zwei Tagen ging es ihr besser, sie war sogar fit genug für kleinere Wanderungen durchs Vorgebirge. Der Duft von Colorado im Sommer war einzigartig; es roch nach Kiefernnadeln, die den harten Winter überstanden hatten, nach der trockenen roten Erde, die alle Hänge bedeckte.
Vom BAUM aus war der Pine Ridge Point gut zu sehen, und nicht zuletzt deswegen hatte Cameron sich für diese bestimmte Espe entschieden. Man konnte sich an die glatte weiße Rinde schmiegen und die Plateaus unterhalb der Klippe studieren. Sein Vater hatte ihn zum ersten Mal mit hinaufgenommen, als er sechs Jahre alt war.
Die Sonne ging unter. Viele Naturerscheinungen blieben unbeachtet – Schneeflocken, die ein Fensterbrett streifen, oder Fingernägel, die sich in eine Mandarinenschale graben. Trotzdem verstand Cameron, warum die Leute um den Sonnenuntergang so viel Aufhebens machten. Der Sonnenuntergang am Pine Ridge Point gab ihm das Gefühl, menschlich zu sein, zurückgeworfen auf das eigene, fehlbare Selbst.
Pine Ridge Point war eine Klippe, die im perfekten Neunziggradwinkel über einen Stausee hinausragte. Auf dem Stausee gab es keine Wellen. Er lag so still und friedlich da wie eine Blutlache unter einer frischen Wunde.
Auf der anderen Seite der Klippe – abseits des Wassers – lag Broomsville. Die malerischen Häuschen, die zischenden Rasensprenger in den Vorgärten. Der Kontrast zu den wilden Rockies hätte größer nicht sein können. Von der Klippe aus konnte man die ganze Stadt überblicken, sogar Camerons Straße war zu sehen, ein winziger Pine Ridge Drive. Von dort oben sah Broomsville wie eine Spielzeugstadt voller Plastikmenschen aus. Camerons Hand konnte alles nach Lust und Laune verschieben.





























