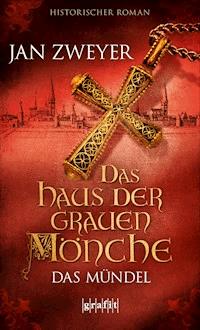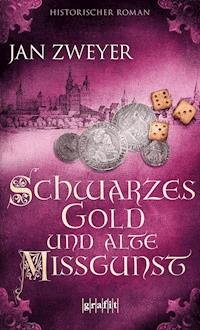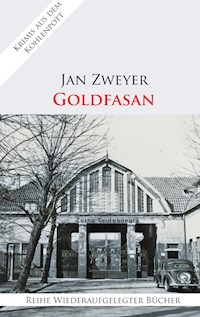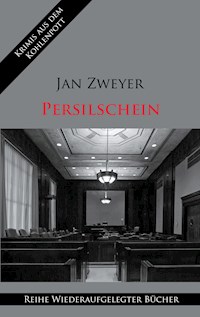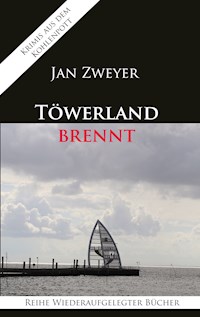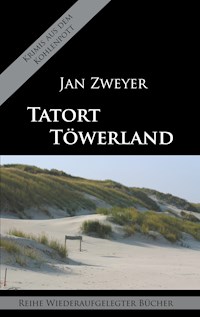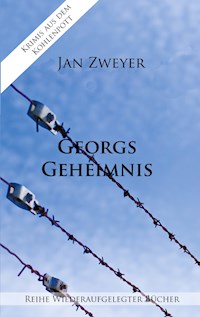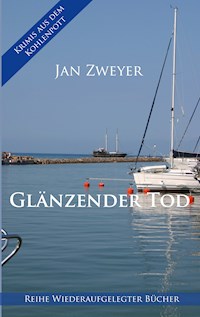
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Suche nach einem für tot erklärten Kunsthändler führt Versicherungsdetektiv Jean Büsing durch halb Europa - und zwischen die Fronten von Kunstmafia und Geheimdiensten. Im Zentrum des Interesses: ein Schatz aus der Antike.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Autor
Jan Zweyer wurde 1953 in Frankfurt am Main geboren. Mitte der Siebzigerjahre zog er ins Ruhrgebiet, studierte erst Architektur, dann Sozialwissenschaften und schrieb als ständiger freier Mitarbeiter für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Er war viele Jahre für verschiedene Industrieunternehmen tätig. Heute arbeitet Zweyer als freier Schriftsteller in Herne.
Nach zahlreichen zeitgenössischen Kriminalromanen hat er sich mit der Goldstein-Trilogie Franzosenliebchen, Goldfasan und Persilschein das erste Mal historischen Themen zugewandt. Es folgte die von Linden-Saga, eine Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet (bisher fünf Bände, zuletzt: Schwarzes Gold und Alte Missgunst, Ein Königreich von kurzer Dauer, beide Grafit-Verlag).
In der Reihe Wiederaufgelegter Bücher werden verlagsseitig vergriffen Texte von Jan Zweyer als Buch und eBook neu veröffentlicht. Der Originaltext unterliegt jetzt den neue Rechtschreibregeln. Inhaltliche Veränderungen wurden nur in Ausnahmefällen vorgenommen.
Die Hauptpersonen
Jean-Paul Büsing, freiberuflicher Versicherungsdetektiv, hat einen neuen Auftrag
Claudia Weber hat sich von ihm scheiden lassen
Bastian Büsing, einziger Sohn der beiden, hat Probleme
Marlene Schneider, Oberstaatsanwältin, hat Informationen
Dr. Heinz Dermöller hat eine Führungsposition in einer Versicherungsgesellschaft inne
Gerd Tillmeier, Kunsthändler, hatte einen Segelunfall
Joszef Jaronka hat den Unfall definitiv nicht überlebt
Sonja Tillmeier, geborene Jaronka, hat eine Kunstgalerie
Gyula Jaronka und Lászlo Jaronka, Brüder von Sonja, hatten nur einmal Glück im Leben
Géza Narócy, Freund der Familie Jaronka, hat nicht viel zu sagen
Maria Hadju, ungarische Polizistin, hat mehrere Morde aufzuklären
Jussuf Barachi, Wiener Kunsthändler, hat Humor
Andreas Huber hat die Geschäfte Barachis zu führen
Steininger, Staatsschützer aus Wien, hat viel Ärger
Slobodan Mirkovac, Händler, hat eine Münzsammlung
UTINAM·EA·MODESTA·SUPELLEX·TIB·O·SEVSO·
MULTOS·PER·ANNOS·SERVENTUR·
ET·QUOQUE·LIBERIS·TUIS·USUI·SIT
The Times (London, 30.8.2000, Seite →):
Kunstauktion gescheitert?
(Eigener Bericht) Eine von dem bekannten Londoner Auktionshaus Sotheby’s geplante Versteigerung wertvoller Antiquitäten musste kurzfristig abgesagt werden. Wie unser Reporter aus zuverlässiger Quelle erfahren hat, soll es sich bei den Verkaufsobjekten um Teile eines antiken Geschirrs handeln. Ein Richter hatte gestern in einem nicht-öffentlichen Schnellverfahren entschieden, die Sammlung dürfe so lange nicht zum Verkauf gelangen, bis die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse geklärt seien. Anscheinend sind Zweifel an der Echtheit der Herkunftszertifikate aufgekommen. Daher hatte das Kulturministerium interveniert und das Verfahren angestrengt. Die Sammlung wurde vorläufig beschlagnahmt.
Londoner Kunsthändler sagten, es hieß, dass der Wert der zur Versteigerung kommenden Sammlung einige Millionen Pfund betrage. Auf Anfragen unserer Redaktion entgegnete Tom Bailery, Sprecher des Auktionshauses, dass es erklärte Geschäftspolitik seines Hauses sei, Gerüchte dieser Art weder zu bestätigen noch zu dementieren. Bailery wörtlich: »Der Name Sotheby’s stand schon immer für Diskretion. Und daran wird sich nichts ändern.« Bailery gab jedoch bekannt, dass Sotheby’s im Namen des Besitzers Einspruch gegen den Beschluss des Gerichts einlegen werde. »Die Dokumente wurden von uns geprüft«, sagte der Sprecher des Auktionshauses. »Nach unserer Meinung sind sie über jeden Zweifel erhaben.« Darüber wird nun das Hauptverfahren zu entscheiden haben.
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Dritter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Erster Teil
1
Mozart brachte mir ein Ständchen. Ich drehte mich auf die andere Seite und zog mir die Decke über die Ohren.
Die Erinnerung an die gestrige Nacht drängte sich mir in mein Bewusstsein. Ich hatte Claudia, meine Ex, getroffen. Und wie immer, wenn ich Claudia traf, war es um Bastian gegangen. Unser fast neunzehnjähriger Sohn war so ungefähr das einzig Brauchbare, was aus unserer kurzen Beziehung hervorgegangen war. Und wie immer, wenn es um Bastian ging, hatte es Streit gegeben.
Ich zog die Decke noch ein Stück höher und bemühte mich, das Gedudel zu ignorieren. Vergeblich. Mozart spielte weiter. Vorsichtig blinzelte ich mit dem linken Auge. Es war taghell. Der Funkwecker blinkte mir die Uhrzeit entgegen. Zehn vor elf. Die ersten Takte der ›Kleinen Nachtmusik‹ wiederholten sich penetrant. Meine Hand tastete auf dem Nachttisch herum, fegte die halb volle Seltersflasche auf den Boden und fand das Mobiltelefon.
Stöhnend richtete ich mich auf. »Ja?«
»Sind Sie dran?«
Es dauerte einen Moment, bis ich die Stimme zuordnen konnte. »Wer sonst?«
»Liegen Sie etwa noch im Bett?«
Ich schluckte eine ungehörige Bemerkung herunter. »Um was geht es?«
»Um eine Lebensversicherung über drei Millionen.«
»Viel Geld.«
»Das sehen wir auch so. Deshalb brauchen wir Ihre Hilfe. Wann können Sie hier sein?«
Es dauerte einen Moment, bis ich mich gedanklich so weit sortiert hatte, dass ich mir meine Pläne für den Tag vergegenwärtigen konnte. »Nicht vor zwölf.«
»Dann bis um zwölf.« Dermöller legte auf.
Langsam schraubte ich mich aus dem Bett und schlurfte ins Badezimmer. Helles Sonnenlicht durchflutete den Raum. Mit beiden Händen stützte ich mich auf die Kante des Waschbeckens und warf einen Blick in den Spiegel. Was ich sah, gefiel mir nicht besonders. Ein Gesicht undefinierbaren Alters – dabei bin ich erst siebenundvierzig –, einen nackten Körper, den als trainiert zu bezeichnen bei unvoreingenommenen Beobachtern Lachsalven auslösen würde, einen Dreitagebart mit Wachstumslücken und einen recht stattlichen Bierbauch. Mir fielen bei dieser Inspektion alle meine guten Vorsätze ein, die ich mit schöner Regelmäßigkeit in den Neujahrsnächten fasste und die bereits am nächsten Morgen erfolgreich verdrängt waren: weniger trinken, gesünder ernähren und vor allem mehr Bewegung.
Das lauwarme Wasser der Dusche tat gut. Zwanzig Minuten später war ich so weit wiederhergestellt, dass ich mich in die Öffentlichkeit wagen konnte.
Ich beschränkte mein Frühstück auf eine Tasse koffeinfreien Kaffee, verschloss die Tür zu meinem Appartement und stieg unten auf der Straße in meinen Mercedes, um Dermöller von der Versicherungsgesellschaft, die mir meinen Lebensstandard sicherte, in Essen aufzusuchen.
Ich bin Versicherungsagent und wohne in der Nähe des Revierparks Gysenberg in Herne. Natürlich bin ich nicht so ein Klinkenputzer, der anderen Leuten Policen, die sie nicht brauchen, aufschwatzt. Mehr ein Versicherungsdetektiv. Natürlich auch nicht so ein Detektiv, wie er aus amerikanischen Kriminalgeschichten bekannt ist. Ich laufe nur selten nachts im Trenchcoat auf Schuhen mit Gummisohlen durch dunkle Stadtviertel und zücke meine 45er. Ich habe gar keine 45er. Genau genommen besitze ich überhaupt keine Waffe. Und keine Schuhe mit Gummisohlen. Ich bevorzuge Lederschuhe, am liebsten handgefertigt.
Auf meiner Visitenkarte steht auch nur deshalb ›Versicherungsagent‹, weil mir keine bessere Berufsbezeichnung eingefallen ist. Eigentlich hatte ich Architekt werden wollen. Hätte auch fast geklappt, wenn es da nicht ein Fach gäbe, dem schon Heerscharen zukünftiger Baumeister zum Opfer gefallen sind: Statik. Warum, zum Teufel, müssen Architekturstudenten die Kräfteverteilung in einem achtgeschossigen Hochhaus berechnen können, wenn es darauf spezialisierte Ingenieurbüros gibt?
Lassen wir das. Mein Job ist es nun, großen Versicherungsgesellschaften unnötige Ausgaben zu ersparen. Ich will es so erklären: Ein Hausbesitzer versichert mit seiner Hausratversicherung nicht nur das Mobiliar, sondern auch eine Modelleisenbahnsammlung für über einhunderttausend Mark. Unwahrscheinlich? Nein, in Deutschland werden ständig Sammlungen in irrwitziger Höhe versichert. Also, dieser Hausbesitzer versichert seine Modelle, darunter auch einige sehr rare, sehr gesuchte und sehr teure. Nun wird in sein Haus eingebrochen. Rein statistisch betrachtet, findet in Deutschland alle drei bis vier Minuten ein Einbruch statt. Es kann also jeden jederzeit treffen. Bei diesem Einbruch werden neben allerlei anderen Wertgegenständen auch genau diejenigen Lokomotivmodelle gestohlen, die ganz besonders wertvoll sind.
Die Versicherungsgesellschaft fragt sich natürlich, warum der Einbrecher neben dem ganzen Schmuck, dem Silberbesteck und dem anderen Gerümpel ausgerechnet und nur die wertvollen Lokomotivmodelle mitgehen lässt. Woher weiß der Einbrecher, welche besonders wertvoll sind? Zufall? Nie im Leben.
Natürlich gehe ich nicht jedem kleinen Versicherungsbetrug nach. Der neue, helle Teppichboden, den der beste Freund angeblich volltrunken mit Rotwein ruiniert hat, interessiert mich nicht. Ich habe mich auf die Dinge spezialisiert, in denen es im Schadensfall um viel Geld geht.
Ich arbeite freiberuflich. Mein Honorar ergibt sich aus einer Mischung aus Fixum und Erfolgsprämie. Und ich bin, in aller Bescheidenheit, nicht nur gut, ich bin sehr gut. Der Beste. Zumindest im Ruhrgebiet.
Zwei, drei Aufträge im Quartal. Damit komme ich gut zurecht und ich kann den Rest der Zeit mit Schachspielen, Museumsbesuchen und in italienischen Restaurants verbringen.
Im Übrigen: Ich hasse Trenchcoats. Aber ich liebe meine dunkelbraune Lederjacke, Modell Kampfpilot 1917, über alles. Sie ist schon über zwanzig Jahre alt und ziemlich speckig. Gerade deshalb trage ich sie so gern.
Ach ja, ich heiße Jean-Paul Büsing.
2
Die Versicherung AG residierte in einem der Hochhäuser in der Essener City. Ich parkte meinen Wagen in der Tiefgarage und fuhr mit dem Lift in die 20. Etage.
Wie immer bewachte Eleonore Wittig das Büro Dermöllers. Sie saß schon hier im Vorzimmer, als ich begann, für diesen Laden zu arbeiten. Ihr Alter war kaum zu schätzen – irgendwas zwischen fünfunddreißig und fünfzig. Sie trug schon immer dunkelblaue oder schwarze Kostüme und eine weiße, an den Rüschen gestärkte Bluse. Da ich sie nie mit einer anderen Bluse angetroffen hatte, musste sie Dutzende desselben Typs in ihren Schränken horten.
Sie schenkte mir die Andeutung eines Lächelns, als ich das Büro betrat, und unterbrach ihre Arbeit am Computer.
»Guten Tag, Herr Büsing«, sagte sie. »Herr Dermöller erwartet Sie schon.« Leise ergänzte sie: »Er ist wütend, weil Sie sich verspätet haben.«
Ich sah auf meine Armbanduhr. Kurz nach eins. Es musste einige Zeit her sein, dass der Chef der Schadensregulierung der Versicherung AG die frühere Bundesstraße 1 benutzt hatte. »Ich stand im Stau.«
Eleonore Wittig nickte verstehend und schaute auf die Verbindungstür zu Dermöllers Büro. »Er hat Kopfschmerzen und ist heute etwas gereizt.«
Seit sie mir vor zwei Jahren, als Dermöller mal nicht sofort Zeit für mich gehabt hatte, überraschend ihre Lebensgeschichte erzählt hatte, betrachtete sie mich als einen engen Vertrauten. Sie hatte eine katholische Internatsschule besucht und war fest entschlossen gewesen, in einen Orden einzutreten. Dann wurde ihr Vater pflegebedürftig und Jesus musste auf seine neue Braut verzichten. Nach einer Odyssee durch verschiedene Firmen war sie schließlich bei der Versicherung AG gelandet. Dermöller, damals noch ein kleiner Abteilungsleiter, hatte sie als Sekretärin eingestellt, obwohl sie außer Krankenpflege und einem Schnellkurs in Schreibmaschine und Steno keine formalen Qualifikationen aufweisen konnte. Sie hatte sich als zielstrebig und tüchtig erwiesen und ihren Chef bei seinem Aufstieg loyal begleitet. Eleonore Wittig verzichtete auf ein Privatleben, wenn man von den Besuchen der Messe freitags und sonntags absah. Sie kam vor ihrem Chef morgens ins Büro und verließ es erst, lange nachdem er abends gegangen war. Weil sie vermutlich unverrückbare moralische Prinzipien über vorehelichen und sonstigen Geschlechtsverkehr pflegte, hatte sie keinen Partner gefunden und ihr Herz Gott, Dermöller und der Versicherung AG verschrieben.
Sie stand auf und öffnete die Tür zum Chefzimmer. »Kaffee wie immer?«
Ich nickte und betrat das Allerheiligste.
»Sagten Sie nicht zwölf Uhr?«, begrüßte mich Dr. Heinz Dermöller in einem Ton, der Eleonore Wittigs Vermutung über seinen Gemütszustand bestätigte.
»Ich sagte: nicht vor zwölf. Zwölf sagten Sie.«
»Tatsächlich?« Dermöller winkte ab und zeigte auf die Sitzgruppe in einer Ecke des Büros, das angesichts seiner Größe auch als Turnhalle hätte dienen können. »Nehmen Sie Platz. Kaffee?«
»Frau Wittig hat mich bereits gefragt.«
»Sicher.« Er fixierte mich mit einem prüfenden Blick. »Harte Nacht gehabt, was?«
»Kommt darauf an, was Sie unter hart verstehen. Für mich war es eher normal.«
»Das spricht nicht gerade für Sie.«
»Diskutieren wir meinen Lebenswandel oder wollen Sie mir einen Auftrag anbieten?«
Eleonore Wittig und der Kaffee ersparten ihm eine Antwort. Dermöller wartete, bis die Sekretärin das Büro wieder verlassen hatte. Dann begann er: »Herr Büsing, wir haben ein Problem.« Er blätterte in einem Aktenordner, der vor ihm auf dem Tisch lag.
»Dachte ich mir. Sonst wäre mein Besuch bei Ihnen ja überflüssig.« Ich nippte an dem Heißgetränk.
»Sie sagen es.«
Mein Gastgeber suchte weiter in seinen Unterlagen. Ich wartete geduldig und bestaunte zum wiederholten Mal die Fotos von Feuerwehruniformen, mit denen der Amateurfotograf Dermöller die Wände seines Büros geschmückt hatte. Der Direktor sammelte Feuerwehrautos. Nicht die Modelle. Nein, die richtigen, großen. Die noch vor einigen Jahren im Einsatz gewesen waren. Mehrere Mercedes, MAN und einen alten Hanomag nannte er sein eigen. Zur Unterbringung seiner Sammlung hatte er überall in Nordrhein-Westfalen Scheunen angemietet und in seiner kargen Freizeit fuhr er seine Schätze ab.
Endlich fand mein Gegenüber das gesuchte Schriftstück. »Im März 1998 hat ein Gerd Tillmeier bei uns eine Lebensversicherung über drei Millionen Mark abgeschlossen.«
Ich zitierte mich selbst: »Viel Geld.«
»Begünstigte war Tillmeiers Frau Sonja.« Dermöller griff zu einem schwarzen Ledertäschchen und kramte eine Pfeife hervor, die er umständlich reinigte und mit Tabak stopfte.
Ich versuchte meinen empörtesten Gesichtsausdruck. »Und?«
Dermöller ignorierte mein Mienenspiel, steckte die Pfeife an und machte dabei Geräusche, die an ein kleines Kind erinnerten, das mit seiner Holzeisenbahn spielt. Dann schickte er Qualmwolken in das Zimmer. »Tillmeier ist verschollen.« Der Direktor deutete auf die Pfeife. »Stört Sie doch nicht?«
»Nicht weniger als sonst.«
Dermöller lachte. »Ich verspreche Ihnen, dass ich, sollte ich Sie jemals zu Hause aufsuchen, dort nicht rauchen werde.«
Das befriedigte mich nicht im Geringsten, da ich nicht beabsichtigte, Dermöller zu mir einzuladen. Ohne großen Erfolg wedelte ich mit der Linken den Rauch fort. »Was heißt, er ist verschollen?«
»Tillmeier hat mit einem Schwager einen Segeltörn auf der Nordsee unternommen. Dabei sind sie anscheinend in einen Sturm geraten. Das Boot wurde einen Tag später vor Juist auf einer Sandbank gefunden. Den Schwager, beziehungsweise das, was von ihm übrig geblieben war, entdeckten Wattwanderer nach vier Wochen im Gestänge einer der Bojen vor Cuxhaven. Tillmeier blieb verschwunden.« Dermöller hüllte sich erneut in Rauchwolken. »Vor einem Vierteljahr ist die Ehefrau des Vermissten an uns herangetreten, um die Versicherungssumme zu kassieren.«
»Aber wie kann sie sich sicher sein, dass ihr Mann tot ist?«
»Sie hat ihn für tot erklären lassen.«
Ich stutzte. »Wann hat dieser Segelausflug stattgefunden?«
»Im April 1998.«
»Ich dachte immer, eine Todeserklärung könne erst nach Jahrzehnten erfolgen?«
»Ich auch. Bis unsere Hausjuristen mich aufgeklärt haben. Bei allgemeiner Gefahrenverschollenheit kann…«
»Bei was?«
»Allgemeiner Gefahrenverschollenheit. Das ist der juristische Fachbegriff. In diesen Fällen – Weltumsegler, Taucher oder Bergsteiger, die einfach verschwinden – kann bereits nach einem Jahr der Antrag auf Todeserklärung gestellt werden. Bei Seeverschollenheit nach sechs Monaten und bei Luftverschollenheit bereits nach drei. Und das hat Sonja Tillmeier getan. Sonst dauert das mindestens zehn Jahre. Wir haben das Verfahren geprüft, glauben Sie mir. Rechtlich ist nichts zu beanstanden. Gerd Tillmeier wurde für tot erklärt. Deshalb müssen wir zahlen.«
Ich verstand angesichts der klaren Rechtslage nicht ganz, warum ich dann in Dermöllers Büro herumsaß und schlechte Luft einatmete. »Wenn das alles so eindeutig ist, warum …«
Dermöller stand auf und machte ein paar Schritte. »Ich sagte, die Rechtslage sei klar. Natürlich haben wir vorsichtig einige Erkundigungen eingeholt. Der Kriminalpolizei kam einiges seltsam vor. Deshalb hat sie auch länger ermittelt als in solchen Fällen üblich. Es gab Anhaltspunkte, dass für den Tod des Schwagers eine Kopfverletzung ursächlich war. Man hat Wasser in der Lunge des Toten gefunden. Das bedeutet, dass er noch lebte, als er ins Meer stürzte. Aber die Kopfverletzung … Es fehlte jeder Beweis. Außerdem war der Sturm, in den die Julia geraten ist …« Er nahm wieder Platz.
»Julia?«
»Der Schiffsname. Fachleute haben uns bestätigt, dass ein Hochseesegler wie die Julia normalerweise einen Sturm dieser Stärke unbeschädigt übersteht, wenn der Skipper mit seinem Schiff umgehen kann. Tatsächlich waren die Schäden am Schiff minimal. Gesunken ist es jedenfalls nicht.«
»Konnte Tillmeier denn mit dem Schiff umgehen?«
»Was weiß ich. Auf jeden Fall segelte er regelmäßig. Und das seit mehr als zehn Jahren.«
Mein Kaffee war kalt geworden. »Sie vermuten also Versicherungsbetrug?«
Dermöller hob die Schultern. »Wie sagten Sie eben? Drei Millionen sind viel Geld.«
»Verstehe.«
Ich brauchte nicht lange nachzudenken. »Wenn ich beweisen kann, dass Tillmeier noch lebt, die üblichen fünfzehn Prozent. Dreihundert Fixum am Tag zuzüglich Spesen.«
»Einverstanden.« Doktor Dermöller erhob sich und reichte mir die Hand. »Frau Wittig hat für Sie Kopien unserer Unterlagen vorbereitet. Viel Glück.«
Das wünschte ich mir auch.
Er begleitete mich zur Tür. »Und Herr Büsing, bitte denken Sie an ordentliche Spesenquittungen. Diese ewigen Auseinandersetzungen mit unserer Rechnungsprüfung hängen mir zum Hals raus.«
Auch dem konnte ich nur zustimmen.
3
Auf dem Weg zurück nach Herne klingelte mein Handy. Bastian war dran.
»Paps, kann ich dich sprechen? Heute Abend?«
Bei mir gingen alle Alarmlampen an. Wenn mich mein Sohn nicht beim Vornamen, sondern ›Paps‹ nannte, hatte er Probleme. Diese hießen entweder Geldmangel, Beziehungsstress oder Ärger mit seiner Mutter nebst Anhang. Genau in der Reihenfolge. Claudia hatte mir gestern etwas von Flausen Bastians erzählt, die ich ihm in den Kopf gesetzt hätte und für die ich verantwortlich wäre. Drei Minuten später war aus einem Wortgeplänkel ein handfester Streit geworden und nach weiteren fünf Minuten saß ich allein in der Bochumer Kneipe, in der wir uns getroffen hatten. »Worum geht es denn?«
Mein Sprössling zögerte lange mit einer Antwort: »Es geht vor allem um Ronnie.«
Also handelte es sich diesmal um Nummer drei der Hitliste. Ronald Weber, genannt Ronnie, war der Stiefvater von Bastian und mein offizieller Nachfolger in Claudias Bett. Der Kerl war mir zuwider. Nicht deshalb, weil er meine Ex bumste. Ich war auch während unserer Ehe nicht der einzige Mann in Claudias Leben gewesen und es hat mir nie besonders viel ausgemacht. Zudem war ich als Gatte auch keine Idealbesetzung in dem Trauerspiel Ehe gewesen. Für unsere Trennung drei Jahre nach Bastians Geburt war ich mindestens so verantwortlich wie Claudia. Aber ausgerechnet Ronnie? Der Kerl war ein schrecklicher Pedant. Einer dieser Menschen, die ihr Leben an Uhr, Zollstock und ewig geltenden Prinzipien ausrichten. Einer, der mitten in der Nacht aufsteht, das vergessene Glas vom Wohnzimmertisch wegräumt, um anschließend das hohe Lied der Ordnungsliebe zu singen. Vermutlich hatten ihn diese Anlagen dazu befähigt, zum Oberstleutnant in irgendeiner Bundeswehrverwaltung in Münster aufzusteigen. Ich verachtete ihn. Trotzdem hatte ich mich während der ersten Jahre nach unserer Trennung bemüht, in Bastians Gegenwart nicht schlecht über Ronnie zu reden. Doch diese Rücksichtnahme hatte sich inzwischen als unnötig erwiesen. Bastian hasste seinen Stiefvater. Und Ronnie hasste ihn vermutlich ebenso.
»Was ist los?«, wollte ich wissen.
»Geht es um sieben? Bei dir?«
Ich seufzte. »Gut. Um sieben.«
»Danke.«
»Bis dann.«
Mein Magen meldete sich. Zum Frühstücken war es schon zu spät und für das Abendessen noch zu früh. Ich beschloss, die Unterlagen, die ich von Dermöller erhalten hatte, im Kleinen Café in Herne bei Tee und Kuchen durchzusehen und Bastian später zum Essen einzuladen.
Als ich den Bienenstich vertilgt hatte, griff ich zu den Papieren. Sie enthielten nichts Ungewöhnliches. Gerd Tillmeier hatte die Lebensversicherungspolice im Januar 1998 unterschrieben. Sie wurde gültig zum 1. März. Die monatliche Versicherungsprämie belief sich auf über eintausend Mark. Nicht gerade wenig. Tillmeier, der am 3. Mai 1956 geboren worden war, hatte die Routinefragen der Gesellschaft nach Krankheiten negativ beantwortet. Als Beruf war ›Galerist‹ eingetragen. Begünstigte war seine Frau Sonja Tillmeier, heute 36 Jahre alt, geborene Jaronka und aus Polgárdi in Ungarn stammend. Das Ehepaar wohnte in Recklinghausen. Ich blätterte weiter. Die Akte enthielt den Beschluss des Amtsgerichtes Recklinghausen vom 13. April 2000, in dem Gerd Tillmeier auf Antrag seiner Ehefrau für tot erklärt wurde. In der Begründung ging das Gericht ausführlich auf die Umstände ein, die wohl zum Tod des Vermissten geführt hatten – das hatte mir Dermöller schon auseinander gesetzt. Trotzdem las ich den Text sorgfältig durch. An einer Passage blieb ich hängen. Die enthielt einen Hinweis auf die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die einen Anfangsverdacht auf Fremdverschulden beim Tod des Schwagers Tillmeiers, Joszef Jaronka, begründeten. Allerdings hatte die zuständige Staatsanwaltschaft in Aurich das Verfahren fünf Monate später wieder eingestellt. Das Gericht führte aus, es gäbe keinen sachlichen Zweifel am Tod des Vermissten mehr. Deshalb müsse nach Paragraph … Bla, bla, bla. Den Rest schenkte ich mir.
Ich bestellte mir noch einen Earl Grey und meine Gedanken schweiften ab. Ich dachte an Marlene. Ich griff zum Handy und wählte ihre Dienstnummer. Irgendwann musste die Angelegenheit in Ordnung gebracht werden. Warum nicht jetzt?
»Schneider«, meldete sie sich.
»Jean hier.«
Schweigen.
»Marlene?«
Immer noch Schweigen.
»Bist du noch da?«
»Du hast vielleicht Nerven!«
Gott sei Dank. Sie sprach noch mit mir. »Ich verstehe ja, dass du sauer bist, aber …«
»Nichts aber! Du bist alt genug, um zu wissen, dass man Verabredungen einhält oder rechtzeitig absagt. Ich stehe den halben Tag in der Küche, gebe mir alle erdenkliche Mühe, deinen verwöhnten Gaumen zu befriedigen, und dann lässt du mich mit dem Fünf-Gänge-Menü einfach sitzen. Ich habe Stunden auf dich gewartet.«
»Es tut mir Leid, aber ich konnte wirklich nicht.«
»Es gibt Telefone! Vermutlich auch bei dir in Herne.« Sie legte auf.
Ich drückte die Wahlwiederholung. »Ich habe Blumen geschickt, um mich zu entschuldigen«, sagte ich hastig.
»Vier Tage später!«
»Ich war im Ausland. Ich kam nicht dazu, zu telefonieren.«
»Und als du wieder in Deutschland warst?«
»Habe ich die Blumen …«
»Blumen, ja. Unsere Verabredung war vor vier Wochen. Weshalb hast du zwischenzeitlich nicht angerufen?« Marlenes Stimme klang schon weniger wütend.
»Ich habe mich geschämt«, gestand ich.
»Das könnte ein Anfang sein.«
Mit Marlene Schneider verband mich eine alte Freundschaft. Wir waren in Arnsberg zusammen zur Schule gegangen, hatten uns dann während der Studienjahre aus den Augen verloren und vor fast zwei Jahrzehnten zufällig bei einer Demonstration gegen den Nato-Nachrüstungsbeschluss in Bonn wiedergetroffen. Marlene stand damals gerade vor dem zweiten juristischen Staatsexamen, ich vor der Aufgabe meines Studiums. Seitdem trafen wir uns, früher sehr zum Ärger von Claudia, mehr oder weniger regelmäßig. Die beiden hatten sich von Beginn an nicht verstanden. Claudia hat mir nie abgenommen, dass Marlene und ich nur wie Bruder und Schwester und nicht wie Mann und Frau miteinander umgingen.
»Hat es dir die Sprache verschlagen?« Sie schien versöhnt.
»Ich lade dich zum Essen ein, einverstanden?«
»Wann?«
»Am Wochenende?«
»Freitag oder Samstag?«
»Samstag.«
»Einverstanden. Italienisch. Ich komme nach Herne. Und jetzt sag, was du willst. Du willst doch etwas von mir, oder?«
Für Marlene war ich wie ein offenes Buch.
»Ich brauche einen Bericht der Staatsanwaltschaft Aurich von 1998.«
»In welcher Angelegenheit? Hast du das Aktenzeichen?«
Ich schilderte ihr den Vorfall.
»Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Aber verlass dich nicht darauf, dass ich die Unterlagen bis Samstag habe. Es bleibt doch bei Samstag?«
»Versprochen.«
»Hoffentlich.« Sie legte auf.
Erleichtert atmete ich durch und orderte einen Brandy. Marlene war nach Bastian zurzeit die wichtigste Person in meinem Leben, und das nicht nur deshalb, weil sie mir als leitende Oberstaatsanwältin jenseits aller Dienstvorschriften schon häufig Unterlagen besorgt hatte, an die ich sonst nie herangekommen wäre.
»Ihr Brandy, bitte sehr.«
»Danke.«
Ich schlürfte an dem Getränk und schmeckte die Spirituose für einen Moment auf der Zunge. Sie brannte leicht und wärmte den Gaumen beim Schlucken.
Dann rief ich Sonja Tillmeier an. Ich stellte mich als Vertreter der Versicherung AG vor und verabredete mich mit ihr in ihrem Recklinghäuser Geschäft für den nächsten Morgen.
Bastian war wie immer unpünktlich. Das hatte er von mir. Er kam fast eine Stunde zu spät. Ich schluckte eine unpassende Bemerkung herunter und ließ ihn eintreten. Er war gut gekleidet. Vor zwanzig Jahren nannten wir solche Typen Popper. Im Wohnzimmer schmiss er sich auf eines der Sofas und sah sich um.
»Du hast in letzter Zeit ja gut verdient.«
Ich blieb im Türrahmen stehen. »Wie kommst du darauf?«, fragte ich erstaunt.
»Neue Möbel.«
»Neue …?« Dann dämmerte mir etwas. »Wann warst du denn das letzte Mal hier?«
»Ostern.«
»Oh.«
Bastian deutete mein Erschrecken richtig. »Macht nichts. Du scheinst ja wirklich viel zu tun gehabt haben. Außerdem kann ich dich ja jederzeit anrufen.«
Ich war ihm für sein Verständnis dankbar, wurde aber das Gefühl nicht los, dass er nicht aufrichtig war.
»Möchtest du etwas trinken?«
»Hast du ein Bier?«
Als ich mit zwei Flaschen Pils aus der Küche zurückkam, beugte sich Bastian gerade über meine Schallplattensammlung. »Cool Jazz, Klassik und französische Chansons. Deinen Musikgeschmack würde ich nicht gerade auf der Höhe der Zeit nennen.«
»Das liegt an deinem Großvater«, murmelte ich. Meine Mutter hatte in den frühen fünfziger Jahren in Arnsberg eine ebenso stürmische wie kurze Liaison mit einem belgischen Besatzungssoldaten gehabt, von dem ich den Vornamen, die Liebe zu gutem Essen und die Affinität für alles Frankophile geerbt hatte. Obwohl ich meinen Vater nie kennen gelernt hatte.
»Unten im Schrank sind die Oldie-CDs«, sagte ich.
»Immer noch kein Techno?«
»Kein Techno. Ich mag dieses monotone Gestampfe nicht.«
Sein Blick sprach Bände. So musste ich als Siebzehnjähriger meine Mutter angesehen haben, als sie mir die Vorzüge deutschen Liedgutes erklären wollte.
Er kramte in meiner Sammlung und legte eine Scheibe der Kinks auf. »Die Anlage ist auch neu«, stellte er fachmännisch fest. »War sicher nicht billig.«
»Nicht so teuer wie deine«, bemerkte ich sarkastisch. Schließlich hatte ich beide HiFi-Anlagen bezahlt.
Bastian lachte. Er drehte die Lautstärke etwas höher und setzte sich neben mich auf das Ledersofa. Ich goss die Gläser voll, prostete ihm zu und sah ihn erwartungsvoll an.
»Was würdest du dazu sagen, wenn ich die Schule schmeißen würde?« Bastian zog es vor, mit der Tür ins Haus zu fallen.
Ich bemühte mich, gelassen zu bleiben. »Vermutlich das Gleiche wie deine Mutter. Kommt nicht infrage.«
»Du hast Recht.«
»Womit?«
»Sie hat sich sinngemäß genauso ausgedrückt.«
»Schade. Ich hatte schon gehofft, dich überzeugt zu haben.«
Bastian lachte wieder. Dann wurde er ernst. »Ich habe gesternmit Mama und Ronnie über meine Pläne gesprochen.«
»Sie waren begeistert, oder?«
»Waren sie.«
»Dann lass hören.« Ich lehnte mich zurück und versuchte, mich für das Kommende zu wappnen. Ganz gelang mir das nicht.
Als Bastian zwölf war, hatte er Chemiker werden wollen. Dazu angeregt hatte ihn ein Chemiebaukasten, den ich ihm zum Geburtstag geschenkt hatte. Der durch sein erstes Experiment ausgelöste Zimmerbrand musste von der Feuerwehr gelöscht werden.
Mit sechzehn hatte sich Bastian, nachdem er eine Formel-eins-Übertragung im Fernsehen gesehen hatte, den Mercedes seines Stiefvaters ausgeliehen. Er hatte zum Nürburgring gewollt. Auf dem Weg dorthin rammte er in einer Kurve einen Porsche, den ein Fünfzehnjähriger steuerte, der dasselbe Ziel gehabt hatte. Sie verbrachten anschließend gemeinsam mehrere Wochen in einem Krankenhaus in der Eifel. Immerhin bewahrten ihn die erlittenen Verletzungen vor einem Wochenendarrest, da der Richter irrigerweise annahm, diese Erfahrung würde ihm eine Lehre sein.
Im letzten Herbst hatte mich nachts ein Anruf der Polizei von Kalkutta erreicht. Bastian und einer seiner Freunde waren während einer, wie sie es nannten, soziologischen Exkursion durch die Elendsquartiere der indischen Hafenstadt ausgeraubt worden und nur knapp mit dem Leben davongekommen. Claudia und ich wähnten die beiden damals auf Mallorca.
Jetzt hielt ich mich an meinem Bierglas fest und wartete gespannt.
»Ich habe vor, mich selbstständig zu machen.«
»Aha.« Das hörte sich nicht sehr gefährlich an. »Womit?«
»New Economy.«
»Hm.« Ich hatte darüber gelesen, bisher aber angenommen, nur potenzielle Nobelpreisträger könnten sich in dieser Branche behaupten. Und die Zensuren meines Sohnes waren alles andere als berauschend. Ich nahm einen großen Schluck. »Was genau habe ich mir darunter vorzustellen?«
Diese Frage war ein Fehler. Bastian erklärte mir eine geschlagene Stunde seine Geschäftsidee. Ich hörte Internet, Java-Script und HTML, verstand aber kein Wort. Bastian war so in Fahrt, dass er auch nicht aufhörte zu reden, als ich zwischendurch in die Küche ging, um Bier im Kühlschrank nachzulegen.
»Na, was hältst du davon?«, fragte er mich, als er geendet hatte. Die Kinks hatten längst aufgehört zu spielen.
»Klingt interessant«, antwortete ich vorsichtig. »Wie willst du das finanzieren?«
»Mit Omas Erbe.«
Schlagartig wurde mir klar, welchen Verlauf Bastians gestrige Unterhaltung mit Claudia und Ronnie genommen haben musste. Claudias Mutter hatte meinem Sohn einen namhaften Geldbetrag hinterlassen, der bis zu seinem einundzwanzigsten Lebensjahr in festverzinslichen Wertpapieren angelegt war und der Finanzierung seines Studiums dienen sollte. Bisher hatte Claudia allen Forderungen Bastians, damit aus seiner Sicht unverzichtbare Investitionen in eine Südamerikareise, ein leistungsstarkes Motorrad oder ein Cabrio zu tätigen, widerstanden. Oberstleutnant Ronald Weber war ohnehin der Auffassung, Bastian solle sich sein Studium durch eigene Arbeit finanzieren und das Geld seiner Oma für ein Reihenhaus mit Gartenzwergen sparen.
»Hast du gestern auch das Erbe erwähnt?«
»Natürlich.«
»Und dann hat es Krach gegeben«, stellte ich fest.
»Es ist mein Geld.«
»Noch nicht. Erst in knapp zwei Jahren. Also, was ist passiert?«
»Ein Wort gab das andere. Ronnie hat mich angebrüllt. Dann habe ich ihn einen kleinbürgerlichen, verknöcherten Spießer genannt.«
Ich musste grinsen. Sein Stiefvater war ein kleinbürgerlicher, verknöcherter Spießer. »Und dann?«
»Er hat mich rausgeworfen.«
Das ging zu weit. »Wo sind deine Sachen?«
»Unten im Wagen. Ich wusste nicht, ob ich …«
»Meine Rotweinvorräte sind tabu, wenn ich nicht hier bin. Größere Feiern nur nach Absprache. Und du räumst deine Sachen selbstständig und ohne dreimalige Aufforderung auf. Einverstanden?«
»Einverstanden. Was ist mit der Schule?«
»Wir reden in ein paar Tagen darüber. Bis dahin schleppst du dich in den Unterricht. Jeden Tag. Machen wir den Deal?«
Er nickte.
»Gut. Eigentlich wollte ich dich zum Essen einladen. Jetzt habe ich keine Lust mehr auszugehen. An der Pinnwand im Flur hängt das Angebot vom Chinesen. Der liefert ins Haus. Such dir was aus. Ich nehme das scharfe Schweinefleisch mit verschiedenen Soßen. Vorher rufe ich deine Mutter an, damit sie weiß, wo du steckst. Und hol mir bitte noch ein Bier aus dem Kühlschrank.«
4
Die Kunstgalerie Tillmeier befand sich im Erdgeschoss eines Fachwerkhauses in einer Nebenstraße der fußläufigen Zone der Recklinghäuser Innenstadt. Eine Messingglocke an der Eingangstür signalisierte, dass ich den Laden betreten hatte. Es befanden sich schon Kunden in dem Geschäft, sodass ich Gelegenheit hatte, mich umzuschauen.
Die Galerie handelte nicht nur mit Kunst, sondern auch mit Antiquitäten. In der einen Ecke waren moderne Grafiken zu finden, in einer großen Glasvitrine warteten zahlreiche Porzellanpuppen auf Interessenten und in Regalen stand Geschirr zur Schau. An den Wänden hingen Ölgemälde, keines war für weniger als zweitausend Mark zu haben. Die Namen der Künstler waren mir fremd. Allerdings besagte das nicht viel, da ich von Malerei nur wenig verstand. Ich konnte Picasso von Rembrandt unterscheiden, das war es aber schon fast. Mein Interesse galt der Fotografie und, mit Abstrichen, der Bildhauerei.
Eine schwarzhaarige Frau von ungefähr dreißig beriet ein älteres Paar, das sich für ein Kaffeeservice interessierte.
Der Mann drehte mit Kennerblick eine Tasse nach der anderen um und prüfte kritisch deren Boden. »Und das ist wirklich Meißen 1898?«, fragte er zum wiederholten Mal.
Geduldig erklärte die Schwarzhaarige ihren Kunden den Stempel der Porzellanmanufaktur und verwies auf die Expertise, die die Echtheit der Antiquität bescheinigte. Nach einigem Hin und Her verließen die beiden den Laden, ohne etwas gekauft zu haben.
»Kann ich Ihnen helfen?«, wandte sich die junge Frau an mich. Sie sprach mit leichtem Akzent.
»Frau Tillmeier?«
Sie nickte.
»Mein Name ist Büsing. Wir haben telefoniert.«
»Sie kommen von der Versicherung AG?« Sie musterte mich verstohlen. Vermutlich entsprachen meine verwaschenen Jeans und die speckige Lederjacke nicht ihren Erwartungen.
»Richtig.«
»Können Sie sich ausweisen?«
»Ich kann Ihnen meinen Personalausweis zeigen, wenn Sie möchten.« Ich kramte vergebens in der linken Innentasche meiner Jacke. Auch rechts blieb die Suche erfolglos. »Aber vielleicht genügt es, wenn ich Ihnen sage, dass es um die Lebensversicherung Ihres Mannes geht. Sie können natürlich auch bei der Gesellschaft nachfragen. Die Nummer ist …« Mein Ausweis fand sich in der Hose. »Bitte, hier.«
Sonja Tillmeier warf nur einen flüchtigen Blick auf das Dokument. »Danke. Kommen Sie.«
Wir gingen durch einen kleinen Flur und betraten ein modern eingerichtetes Büro, das in einem auffälligen Gegensatz zum Sammelsurium des Verkaufsraumes stand. Sie zeigte auf einen der Freischwinger und setzte sich selbst auf ein schwarzes Ledersofa gegenüber. »Um was geht es? Ich nahm an, dass alles geklärt ist.«
»Wir haben schon noch einige Fragen.«
Sie zog die Augenbrauen hoch. »Noch mehr Fragen? Ich habe einem Ihrer Kollegen zwei Stunden lang Rede und Antwort gestanden, Dutzende Seiten eines Formulars ausgefüllt und den Gerichtsbeschluss beglaubigen lassen, in dem der Tod meines Mannes amtlich festgestellt wird – was wollen Sie noch?« Sie hielt ihre Erregung nur mühsam zurück.
»Würden Sie mir bitte erzählen, was Sie über das Unglück wissen?«
Sie seufzte tief und sagte dann nach einem Moment: »Na gut. Mein Mann und mein Bruder wollten segeln …«
»Entschuldigen Sie«, unterbrach ich. »Dürfte ich mir einige Notizen machen?«
»Natürlich.«
»Könnten Sie mir ein Stück Papier leihen? Ich habe mein Notizbuch im Wagen liegen gelassen«, erklärte ich.
»Auch das.« Sie holte mir das Gewünschte vom Schreibtisch. »Wo war ich …«
»Sie sagten, dass Ihr Mann und Ihr Bruder segeln wollten.«
»Es war an einem Wochenende im April. Mein Bruder Joszef war bei uns zu Besuch, er hatte einen Geschäftstermin in Düsseldorf.«
»Was machte Ihr Bruder beruflich?«
Sie sah mich überrascht an. »Meine Brüder haben eine Spedition besessen. In Ungarn«, setzte sie hinzu. »Bis zu Joszefs Tod.«
»Sie haben mehrere Geschwister?«
»Ja.«
»Und alle leben in Ungarn?«
»Ja.«
»Wo?«
»In Polgárdi.« Sie stutzte. »Aber was hat das mit dem Tod meines Mannes zu tun?«
Ich winkte ab. »Nichts, verzeihen Sie.« Meine Neugier führte bisweilen zu Unhöflichkeit. Andererseits hatte ich schon öfter die Erfahrung gemacht, dass auch scheinbar Unwichtiges zu einem späteren Zeitpunkt bedeutsam werden konnte. »Bitte erzählen Sie weiter.«
»Gerd und Joszef waren beide begeisterte Segler. Mir liegt weniger daran. Ich werde sehr leicht seekrank. Deshalb bin ich nur bei sehr schönem Wetter und im Sommer mitgefahren. Aber nie im Frühjahr oder Herbst.«
»Verstehe.«
»Wir haben vor Jahren ein Segelboot gekauft, gebraucht, das aber meistens ungenutzt im Jachthafen Greetsiel lag. Das letzte Mal war ich 1995 auf dem Boot, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt …« Sie sprach nicht weiter.
»Die Julia?«
»Genau. Da mein Bruder häufiger in Westdeutschland zu tun hatte, fuhren mein Mann und er öfter an die Küste. An jenem Wochenende wollten sie nach Norderney und …« Das Telefon schellte. »Einen Moment.« Sie ging zum Schreibtisch und meldete sich. Dann sah sie zu mir herüber. Nach einigen Sekunden sagte sie: »Nein, nicht jetzt. Es geht nicht. Ich gehe zum anderen Apparat.« Sie drehte sich zu mir hin: »Ich bin gleich wieder da«, und verließ das Büro.
Ich stand auf, um mir etwas die Beine zu vertreten. Der Freischwinger war zwar schick, aber für jemanden mit meinem Körpergewicht fürchterlich unbequem. Ich machte ein paar Schritte und sah mich um. Zwei gerahmte Fotografien, die auf dem Schreibtisch standen, weckten mein Interesse. Auf einer war Sonja Tillmeier mit einem hoch gewachsenen, blonden und braun gebrannten Mann vor einem Segelschiff zu sehen. Meine beiden großen Lieben – Sonja und Julia stand quer über das Bild geschrieben. Der Gebräunte war wahrscheinlich Gerd Tillmeier. Ich griff zu dem anderen Foto. Darauf war Sonja Tillmeier mit drei Männern und einer älteren Frau abgelichtet. Die Ähnlichkeit zwischen den fünfen war nicht zu übersehen: vermutlich ihre Brüder und ihre Mutter. Ich hörte Schritte im Flur. Eilig stellte ich das Foto wieder auf seinen Platz und setzte mich.
»Bitte entschuldigen Sie«, sagte Sonja Tillmeier. »Darf ich Ihnen etwas anbieten? Einen Kaffee vielleicht?«
Ich verneinte.
»Gerd und Joszef segelten also gegen Mittag los«, fuhr die Frau endlich fort.
»Von Greetsiel?«
»Ja. Es ist nicht sehr weit von dort bis nach Norderney. Sie hätten es vor der Dunkelheit bequem bis zu ihrem Ziel geschafft, wenn das Wetter nicht umgeschlagen wäre. Mein Mann war ein sehr erfahrener und vor allem sicherheitsbewusster Segler. Er wäre kein unkalkulierbares Risiko eingegangen.«
»Als die beiden in See stachen, da war das Wetter gut?«
»Na ja, es war regnerisch. Und etwas windig. Aber, wie gesagt, mein Mann kannte die Nordsee. Sie müssen in einen plötzlich aufgezogenen Sturm geraten sein. Und dann …« Sie sah durch mich hindurch. »Gerd wurde nie gefunden.«
Ich zog es vor, das nicht zu kommentieren.
»Joszef haben wir nach Hause überführt. Für Gerd habe ich eine Grabstätte gekauft. Auf dem Nordfriedhof. Es hat auch eine Trauerfeier gegeben, am leeren Grab. Vielleicht finden sie ihn ja noch … Trotzdem. Ich brauche einen Ort, um mit meiner Trauer fertig zu werden. Können Sie das verstehen?«
Konnte ich.
Ihre Augen wurden feucht. »Mehr kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Was wurde aus dem Boot?«
»Der Julia? Ich habe das Schiff nicht mehr gesehen. Ich habe es verkauft.«
»An wen?«
»Der Verwalter des Jachthafens hat mir ein großzügiges Angebot gemacht.«
Ich stand auf. »Vielen Dank, dass Sie so freundlich waren und mir Ihre Zeit geopfert haben.«
»Ich hoffe doch, dass dies die letzte Befragung dieser Art war.« Sie reichte mir ihre Hand.
»Vermutlich.« Überzeugt war ich von meiner Antwort selbst nicht.