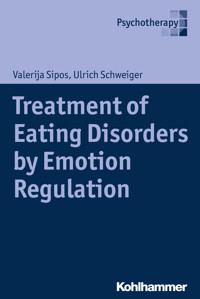Valerija Sipos/Ulrich Schweiger
Dieses Buch beruht auf drei Jahrzehnten Arbeit mit unseren Patientinnen und Patienten an zahlreichen Kliniken wie dem Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, der Fachklinik Furth im Wald, an der Psychosomatischen Klinik Roseneck in Prien am Chiemsee und der Universität zu Lübeck. Die vielfältigen Einflüsse, Anregungen, Begegnungen und Forschungsergebnisse aus einem der faszinierendsten Forschungsgebiete der Menschheit fließen in diesem Buch zusammen. Wir bedanken uns deshalb vor allem bei allen Patientinnen und Patienten für den Erfahrungsschatz, den wir mit ihnen teilen durften – und den wir an andere Menschen, die Rat, Hilfe und Zuspruch benötigen, hiermit gerne weiterschenken möchten. Wir sind der festen Überzeugung, dass das Wissen, das in diesem Buch steckt, für jeden Menschen wichtig ist. Es stellt eine Art psychotherapeutische Hausapotheke dar.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort - Risiken und Nebenwirkungen unseres Denkapparats
1. Einführung
Das Gehirn ist ein Werkzeug mit Nebenwirkungen
Und ewig dreht sich das Grübelkarussel
2. 5,8 Millionen Kilometer Leitungsbahnen – Was ist eigentlich besonders am menschlichen Gehirn
Teil 1 – Grundlegendes
3. Warum können sich Kühe nicht am Kopf kratzen? Eine evolutionäre Perspektive auf die Entwicklung von Gehirn und Verhalten
4. Das kannst du nicht vergessen – das Gedächtnis und seine Tücken
5. Hätte ich doch den Lottoschein abgegeben – kontrafaktisches Denken
6. Denken über das Denken – Metakognition
7. Crashtest – wie unser Gehirn Zukunft simuliert
8. Um Regeln einzuhalten, müssen wir sie brechen
9. Werteorientiertes Verhalten – Leuchttürme für das eigene Leben
Übung
Fallen und Nebenwirkungen von Werteorientierung
10. Das brauche ich, da will ich hin – über Ziele
Ziele leben davon, konkret zu sein
Ziele brauchen Flexibilität
Es kommt anders, als man denkt
Ziele erfordern Fokussierung
11. So bin ich eben – angeborene spontane Verhaltenstendenzen
12. Ist doch klar, woher das kommt – wie wir Gründe und Ursachen vertauschen
13. »Mind the Gap« – über Aufmerksamkeitslenkung
14. Schnelles Denken, langsames Denken: die Zwei-Prozess-Theorie des Denkens
Folgen im Alltag
15. Macht es sich das Gehirn zu leicht? Wie Daumenregeln in die Irre führen
Satisficing – einfache Kosten-Nutzen-Rechnung
Schubladendenken – wie das Gehirn in Schlagzeilen denkt
Entscheidung aus einem wichtigen Grund: One Reason Decision Making
Und noch mehr Daumenregeln
16. Glück ist nicht normal – über Emotionen
Ärger und Wut
Furcht und Angst
Ekel
Scham
Trauer
Schuld
Eifersucht
Misstrauen
Hoffnungslosigkeit
Einsamkeit
Kränkung
Liebe
Freude
Stolz
17. Das Drama von Wunsch und Wirklichkeit – über kognitive Fusion
18. Kann ich mir beim Denken zusehen und gleichzeitig Ratatouille kochen?
Teil 2 - Risiken und Nebenwirkungen der Gehirnfunktion im Alltag
19. Ich will dazugehören! Über Gruppen und Ausschluss
20. Glück kommt selten allein – über Glück und Unglück
21. Liebe ist eine Himmelsmacht – unser Bedürfnis nach Paarbeziehung
22. Die letzte Million – warum materieller Erfolg nicht glücklich machen muss
23. Planst du noch oder machst du dir schon Sorgen
24. Pass auf dich auf! Wie Vorsicht uns in Gefahr bringen kann
25. Vom Säbelzahntiger gebissen – über den Fluch des Erinnerns
26. Positives Denken – daran kann man nur scheitern
27. Du verstehst mich nicht – wie Nebenwirkungen unseres Denkens Beziehungen stören
28. Streifen verrutscht – über schwere körperliche Erkrankung
Teil 3 - Psychische Störungen als Nebenwirkung evolutionärer Anpassungsprozesse
29. Das macht mir ganz schön Angst!
30. Ich will keinen Dreck – über Zwangsstörungen
31. Mehr als Blues – über Depression
32. Es ist zum Kotzen – über Essstörung
33. In Geiselhaft – über Substanzabhängigkeit
34. In Watte gepackt – über dissoziative Störungen
Teil 4 - Wie kann man Risiken und Nebenwirkungen der Gehirnfunktion begrenzen?
35. Gnothi seauton – über Selbsterkenntnis
36. Gut, dass wir mal darüber reden – über Kommunikation
37. Ich will das nicht – über Akzeptanz
38. Bitte einen Schritt zurücktreten! Über Achtsamkeit
Achtsamkeitsübungen erlernen
Fakten zu Achtsamkeitsübungen
Fünf-Sinne-Übungen
Achtsamkeit im Alltag
Atem-Meditation
Geh-Meditation
Body-Scan
Aufmerksamkeitstraining
Detached Mindfulness
39. Die Bombe entschärfen – über Defusion
40. Wenige Dinge richtig tun – über Fokussierung
41. Dazu habe ich keine Lust – über den Aufbau von Aktivitäten
42. Auf den Spuren der Ameisen – über Altruismus
43. Zusammenfassung und Ausblick
44. Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Vorwort
Risiken und Nebenwirkungen unseres Denkapparats
Sie haben in den letzten 24 Stunden sicherlich mehrere Tausend Gedanken gehabt. Die meisten davon sind schon wieder verschwunden, ohne dass Sie sich daran erinnern können, aber einige haben Sie festgehalten. Manche Gedanken und Vorstellung lösen bei Ihnen Freude oder Hoffnung aus, andere quälen Sie möglicherweise. Wenn Sie jetzt annehmen, dass diese Gedanken Sie als Person ausmachen, dann liegen Sie definitiv falsch. Und wenn Sie annehmen, dass das, was da denkt, nämlich Ihr Gehirn, ausschließlich in Ihrem persönlichen Interesse arbeitet, dann wird es gefährlich.
1. Einführung
Eine der interessanten, aber sicherlich auch strittigsten neuen Ideen zum Verständnis von Depressionen ist: Psychische Störungen sind eine Nebenwirkung dessen, was unser Denkapparat besonders gut kann – vergangene Erlebnisse auswerten, planen, seine Aufmerksamkeit ganz spezifisch auf etwas richten, das Verhalten anderer Menschen beobachten und Hypothesen dazu bilden, was in ihnen vorgeht.
Überspitzt gesagt: Wer depressiv ist, ist gerade nicht »geistig gestört« – sondern verfügt über ein hoch entwickeltes, feinfühliges, aktives Gehirn. Er oder sie leidet aber unter den Nebenwirkungen, die dieses Instrument hat.
Damit auch besonders sensible Menschen mit ihrem Denkapparat umgehen können, ohne zu erkranken, kommen wir nicht darum herum, den Beipackzettel für das menschliche Gehirn sorgfältig zu lesen und zu verstehen – so schwer er zu lesen sein mag: Es lohnt sich!
Denn es gibt eine gute Nachricht: Wer die Arbeitsweise seines Denkapparates kennt und die Möglichkeiten des Denkens richtig einschätzt, kann lernen, mit den Risiken und Nebenwirkungen umzugehen. Das ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie wir uns im durchaus nicht ungefährlichen Großstadtverkehr bewegen: Wer Fahrrad fährt oder ein Auto benutzt, hat auch ein ganzes Repertoire von Verhaltensweisen, um sich vor Schaden zu schützen. Und das wirkt: Durch Verkehrsschulungen, Verkehrsleitzentralen und Verbesserungen der Sicherheitsvorrichtungen im Auto ist die Zahl der Toten und Verletzten in den vergangenen Jahren erheblich zurückgegangen.
Etwas Ähnliches brauchen wir auch für unseren Denkapparat: einen guten Plan für den Umgang mit diesem Werkzeug und ein gutes Verständnis von unfallträchtigen Situationen.
Die Funktion des menschlichen Gehirns zu verstehen, ist eine der wichtigen Aufgaben des 21. Jahrhundert. Es geht hier nicht nur um unsere Gesundheit, sondern insgesamt um das erfolgreiche Zusammenleben von Menschen und ihre Kooperation in kleinen oder größeren Gruppen. Dazu müssen wir zunächst einmal umdenken: Wir müssen uns von der naiven Annahme verabschieden, dass das Gehirn ein guter Freund ist, der uns unter allen Umständen das Richtige rät und Gutes für uns tut.
Das Gehirn spielt manchmal regelrecht verrückt und muss wieder eingefangen werden. Manchmal verrennt es sich in Sackgassen und verschweigt, dass es auch einen Rückwärtsgang gibt. Strategien zum Umgang mit Nebenwirkungen des Denkens stehen mittlerweile im Mittelpunkt mehrerer moderner Psychotherapiemethoden, von denen hier im Buch die Rede sein wird.
Bei dem, was wir in diesem Buch vorstellen, handelt sich in großen Teilen um Neuland in der modernen psychologischen Forschung und Hirnforschung. Vieles ist kontrovers, nicht abschließend diskutiert oder bewiesen. Woche für Woche kommen neue Erkenntnisse der Forschung dazu, die das Verständnis der Wirkungsweise des Gehirns zu einer veritablen Wanderbaustelle macht. Trotzdem gibt es bereits handfeste Ergebnisse.
Unser Buch wendet sich an Menschen, die etwas für ihre psychische Gesundheit tun wollen, weil sie selbst von Angst, Depression oder anderen Problemen betroffen sind, ihr Partner oder Freunde an einer psychischen Störung leiden oder weil sie einfach neugierig sind. Mann und Frau erfahren in dem Buch viel Neues, was sie schon immer über das Denken und Fühlen – ihr Gehirn – wissen wollten und nicht in der Schule gelernt haben, aber im Alltag so dringend brauchen können.
Das Gehirn ist ein Werkzeug mit Nebenwirkungen
Unser Umgang mit psychischen Erkrankungen wird oft von Mythen beherrscht. Mythen halten sich dann besonders gut, wenn sie einen wahren Kern haben. Mythen führen jedoch in die Irre. Betrachten Sie mit uns folgende immer wiederkehrende – und daher wichtige – Mythen beispielsweise zur Volkskrankheit Depression.
Mythos 1:Die schlechte Stimmung ist das Problem.
Schlechte Stimmung ist das Symptom Nr. 1 in der Diagnostik. Patienten fühlen sich erleichtert, wenn die Stimmung wieder gut ist. Tatsächlich ist das Problem nicht vorbei, wenn die Stimmung wieder gut ist. Bestimmte psychologische Merkmale von Depression, beispielsweise die Neigung zu Grübeln, ist dann bei vielen Betroffenen immer noch da.
Mythos 2:Es ist der Stress.
Stressbelastung und ihre neurobiologischen Folgen erhöhen das Risiko für depressive Zustände erheblich. Aber ist Stress der Schlüssel? Dass es sich um einen Mythos handelt, sieht man daran, dass die Konsequenzen, die Menschen aus dieser Annahme ziehen, in die Irre führen. Menschen mit Depression haben oft schon ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten. Sich in depressiven Zuständen zurückzuziehen und darauf zu warten, »dass sich der Akku wieder auflädt«, hat oft paradoxe Folgen und macht die Depression schlimmer. Außerdem zeigt die Forschung, dass viel von dem Stress hausgemacht ist: Grübeln, Sorgen, ungeschicktes zwischenmenschliches Verhalten, Perfektionismus. All das verursacht bei den Betroffenen Stress, ist aber nicht durch Vermeidung zu bewältigen.
Mythos 3:Es sind die schlechten Gene.
Es gibt eine ganze Reihe von Genen, die zum Risiko, depressiv zu werden, beitragen. Aber die Effektstärken für jedes einzelne Gen sind sehr klein, und es handelt sich um Genotypen, die auch bei Gesunden häufig sind. Auch wenn die 25 Prozent der Menschen, die irgendwann in ihrem Leben eine schwere Depression erleiden, auf eigene Kinder verzichten würden, ergäbe sich keine Veränderung des Depressionsproblems. Außerdem sind die möglichen Nachteile dieser Gene offensichtlich ausbalanciert durch Vorteile für andere Träger derselben Gene – und zwar in Form von günstigen Verhaltenseigenschaften. Dies führt dazu, dass die Risikogene in ihrer Frequenz erhalten bleiben.
Mythos 4:Depressive denken zu wenig optimistisch.
Eine pessimistische Sicht auf die eigene Person, die Welt und die Zukunft und negative Bewertungen sind die Markenzeichen einer Depression. Wenn Sie sich nun sagen: »Ich bin ab jetzt optimistischer und bewerte Dinge positiver!«, dann werden Sie feststellen, dass sich das irgendwie falsch anfühlt. Auch völlig gesunde Menschen sind immer wieder pessimistisch. Keine falschen Hoffnungen zu hegen, ist sogar ein Zeichen von Weisheit. Tatsächlich steckt hinter Depression ein Verhaltensprogramm, das es Menschen ermöglicht, sinnlos gewordenes Verhalten nicht weiterzuführen.
Neue Ideen sind also gefragt.
Und ewig dreht sich das Grübelkarussel
Viele psychische Probleme wie Grübeln, Sorgen, posttraumatische Störungen oder zwischenmenschliche Konflikte sind Nebenwirkungen von Dingen, die unser Gehirn besonders gut kann, nämlich erinnern, planen und vorstellen. Wer sein Gehirn gerne nutzt, sollte besser auch über die Nebenwirkungen Bescheid wissen!
Wir möchten, dass Sie genau verstehen, wie es zu diesen Nebenwirkungen kommt. Und wie Sie diese Nebenwirkungen verhindern, bevor sie enstehen. Hierzu müssen wir uns zunächst mal Funktionen und Arbeitsweisen des Gehirns genauer anschauen. Sobald man versteht, wozu die Aspekte des Denkens, Fühlens und Verhaltens gut sind, erschließt sich auch die Problemseite, die Nebenwirkungen.
Dazu erläutern wir das Thema der Fehlfunktionen und Nebenwirkungen mit einer großen Zahl von Fallbeispielen. Diese Beispiele stammen aus unserer jahrelangen beruflichen Arbeit mit der Behandlung von psychisch kranken Menschen, der Beratung von gesunden Menschen, der Ausbildung von Studierenden der Medizin und der Psychologie, Ärzten, Psychotherapeuten, der Leitung von Selbsterfahrungsgruppen, der Psychotherapieentwicklung und der Psychotherapieforschung.
Alle Beispiele, Personen, Namen, Abläufe und Orte sind frei erfunden, wie es so schön im Abspann des TV-Krimis heißt. Gleichzeitig sind alle Puzzleteile, aus denen Fallbeispiele zusammengesetzt sind, wahr und unserer beruflichen und persönlichen Erfahrung entnommen. Wir hoffen, dass viele der Leser ihre eigenen emotionalen Erfahrungen und Denkweisen wiedererkennen werden und sich dadurch bereichert fühlen.
Wenn Sie unser Buch bis zum Ende lesen, werden Sie ein neues kritischeres Verständnis Ihres eigenen Denkens und Erlebens entwickelt haben und ein aufgeklärteres, von Mythen befreites Verständnis von psychischen Störungen bei anderen oder bei sich selbst entwickeln.
2. 5,8 Millionen Kilometer Leitungsbahnen – Was ist eigentlich besonders am menschlichen Gehirn?
Die Nebenwirkungen des menschlichen Gehirns haben etwas mit seinen Besonderheiten zu tun. Der Mensch ist einerseits ganz eng mit anderen Wirbeltieren verwandt, andererseits hat er ein besonders großes Frontalhirn. Es macht unsere Stärke als Spezies aus. Insgesamt befähigt uns das Frontalhirn zu einer langen Liste von Fertigkeiten und Verhaltensweisen, die selbst die engsten Verwandten des Menschen im Tierreich nicht aufweisen oder nur erheblich schlechter beherrschen:
• Sprache
• Abstraktes Denken
• Problemlösen
• Mathematik
• Wissenschaft
• Rekonstruktion der Vergangenheit mit der Möglichkeit, auch alternative Verlaufsmöglichkeiten von Ereignissen zu konstruieren (kontrafaktisches Denken)
• Räumliches Vorstellungsvermögen
• Komplexe Handlungsplanung
• Kunst, Kultur, Spiritualität
• Konstruktion von Werkzeugen und Technologie
• Konstruktion komplexer gesellschaftlicher Strukturen
• Einfühlungsvermögen in die Handlungsplanung anderer, kritische Auseinandersetzung mit den Handlungen anderer
• Kritische Selbstreflexion eigener Handlungen, kritische Reflexion der Handlungen anderer mit lange wirksamen Einflüssen auf das eigene Verhalten (nachtragend oder dankbar sein, anderen etwas verzeihen)
Eigentlich alles prima, oder? Was wollen wir Autoren denn? Doch bei so viel Glanz nützlicher Konsequenzen und möglicherweise Stolz, die »Krone der Schöpfung« zu sein, dürfen wir uns nicht blenden lassen. Wenn unser Gehirn, diese wunderbare Konstruktion der Evolution, so makellos und wunderbar millionenfach schneller und besser als jeder Computer funktioniert, den die Menschheit bisher konstruiert hat – warum kommt es dann zu folgenden Aussetzern, die so dramatische Wirkungen haben, dass sie uns lähmen können, die Lebensqualität zerstören und manche Menschen sogar aus Verzweiflung den Tod suchen lassen. Folgende Erfahrungen sind einzigartig für den Menschen:
• Er kann noch Jahrzehnte später an psychischen Folgen von Vernachlässigung, ungerechter Behandlung oder traumatischen Erfahrungen leiden. Selbst dann wenn der Kontext dieser Erfahrungen längst vergangen ist und eine Wiederholung sehr unwahrscheinlich oder unmöglich ist, verharrt das Gehirn in einem Alarmzustand. Zwar bilden auch Tiere traumatische Erinnerungen. Diese werden aber nur aktiviert, wenn der konkrete Stimulus wahrgenommen wird. Beim Menschen genügt die Vorstellung, dass sich etwas wiederholen könnte.
• Der Mensch kann an Dingen leiden, die außerhalb seiner individuellen oder kollektiven Erfahrung liegen, beispielsweise der Vorstellung, für Fehler im Jenseits durch die Hand Gottes – Himmel oder Hölle – bestraft zu werden.
• Eine besonders verzwickte Eigenschaft, die im Tierreich nicht nachweisbar ist: Der Mensch kann an Dingen leiden, bevor sie eintreten, beispielsweise der Vorstellung, an einem Unfall, an einer Infektion oder an einer Tumorerkrankung zu sterben, der Vorstellung, den Arbeitsplatz zu verlieren oder sich durch schlechte Leistungen zu blamieren und deswegen ausgeschlossen zu werden, oder der Vorstellung, von seinem Partner betrogen oder verlassen zu werden. Diese Gedanken können selbst dann Leiden verursachen, wenn es nicht die kleinsten Anzeichen dafür gibt, dass sie Wirklichkeit werden. Wie heißt es doch so treffend: Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft!
Schon mal gefühlt? Kennt jeder – oder?
• Zudem kann der Mensch an seinen Entscheidungen aus der Vergangenheit leiden. Wenn Dinge scheitern oder nicht den erwünschten Ausgang nehmen, kann er sich vorstellen, dass andere Entscheidungen damals zu einem besseren Ergebnis geführt hätten. Dann kommt unentwegt das »Ach, hätte ich doch bloß …!« Ein Mensch fragt sich beispielsweise, warum er so töricht war, vor 20 Jahren genau diesen Partner geheiratet zu haben – das kennt auch fast jeder Verheiratete – oder diesen Beruf gewählt zu haben oder die Aktien von General Motors anstatt die von Apple gekauft zu haben. Hierüber kann man viele Stunden, Tage, Nächte nachgrübeln. Auch hier gibt es einen wunderbaren Spruch: Hätte, hätte – Fahrradkette!
• Ein Mensch kann aber noch mehr: Er kann an Dingen leiden, die außerhalb dessen sind, was er wahrnehmen oder sicher wissen kann, beispielsweise daran, was er vermutet, dass andere über ihn denken, welche Emotionen sie in Bezug auf ihn empfinden oder welche ihn betreffenden Planungen sie haben, welche Intrigen sie gerade verfolgen. Diese Vorstellungen können auch das Verhalten dramatisch beeinflussen.
Eine der artistischsten Leistungen des Gehirnes in Sachen Nebenwirkungen: Menschen gehen enorme Risiken ein, wenn sie sich dadurch versprechen, zu Macht, Reichtum oder großer Liebe (oder am besten allem zusammen) zu gelangen. Sie gehen diese Risiken überraschenderweise selbst dann ein, wenn keine dieser Belohnungen wahrscheinlich oder konkret in Sicht ist. Allein die bloße Vorstellung dieser Belohnung ist Anreiz genug. Die Menschen führen Kriege aus religiöser oder politischer Überzeugung und sind bereit, dafür das Leben anderer auszulöschen und sogar das eigene zu opfern. Einige sprengen sich sogar selbst in die Luft, um ins Paradies zu kommen.
Allen Menschen gemeinsam ist, dass sie zu allen Zeiten und in allen Kulturen ein großes Spektrum von Verhaltensweisen entwickelt haben, die dazu dienen, sich abzulenken, zu vergessen, sich »wegzubeamen«. Hierzu trinken sie Alkohol oder nehmen Drogen, sie stürzen sich im Wingsuit senkrecht von Hochhäusern und Gipfeln, reiten auf einem Brett extrem hohe Wellen. Kurz: Sie nehmen erhebliche Gesundheitsrisiken in Kauf, um Zeiträume zu haben, in denen sie nicht denken müssen.1
3. Warum können sich Kühe nicht am Kopf kratzen? Eine evolutionäre Perspektive auf die Entwicklung von Gehirn und Verhalten
Das Organ Gehirn steuert alle Körperfunktionen und das Verhalten. Psychische Funktionen und Verhaltensprogramme sind wichtige Werkzeuge, die der Anpassung an die Umwelt und dem Überleben der Spezies dienen. Jedes dieser Werkzeuge ist durch einen langen evolutionären Prozess geformt. Dass psychische Funktionen und Verhaltensprogramme so sind, wie sie sind, lässt deshalb den Rückschluss zu, dass sie für die Träger dieser Funktionen überwiegend nützlich waren und zu einer besseren langfristigen Anpassung geführt haben als andere vorhandene Varianten. Jede Anpassung hat aber auch ihre Nachteile. Ganz offensichtlich ist das bei Körpermerkmalen. Ihre vier Beine ermöglichen es der Kuh jeden Tag, etwa 18 Stunden lang auf Grasland zu laufen oder zu stehen und zu grasen. Aber sie kann sich nicht am Kopf kratzen und hat große Schwierigkeiten, Fliegen zu vertreiben. Das Fell eines Bären ermöglicht ihm, in einer sehr kalten Umgebung im Winter zu überleben, es macht ihn aber gleichzeitig anfällig für Parasiten. Ähnliche Prinzipien gelten für Verhaltensprogramme, Emotionen und kognitive Werkzeuge. Sie haben in einem definierten Kontext klare Vorteile, aber sie haben alle ihre Achillesferse. Deshalb gehen wir diese Funktionen mit Ihnen Schritt für Schritt durch, helfen Ihnen die Hauptfunktion zu verstehen, erklären die Nebenwirkungen und illustrieren diese wenn immer möglich durch konkrete Fallbeispiele in Form von Erfahrungen einzelner Menschen.
Jede Anpassung hat ihren Preis. Das gilt auch für die Gehirnfunktionen.
Eine wissenschaftliche Theorie der Evolution durch natürliche Selektion wurde bereits vor etwa 150 Jahren von Charles Darwin vorgestellt. Eine evolutionäre Betrachtung von Verhaltensphänomenen wurde hingegen erst in den 1980er Jahren zu einem wichtigen Bereich der Psychologie.2 Unstrittig ist seitdem, dass auch das menschliche Denken, Fühlen und Verhalten den Gesetzmäßigkeiten der Evolution unterliegen. Psychische Funktionen können deshalb als »evolvierte Adaptationen« betrachtet werden, also als durch einen evolutionären Prozess geprägte Merkmale, die der immer besseren Anpassung des Menschen an seine Umwelt dienen. Wenn wir von einer modularen Organisation der psychischen Funktionen im Gehirn ausgehen, dann unterliegt jedes dieser Module diesem Prozess.
Auch wenn dies seit über dreißig Jahren bekannt ist, gibt es weiterhin eine Reihe von populären Missverständnissen oder fehlerhaften Schlussfolgerungen zur evolutionären Perspektive auf Verhalten:
Die evolutionäre Betrachtungsweise bedeutet, dass menschliches Verhalten genetisch determiniert ist und seine Merkmale nicht verändert werden können. Offensichtlich werden bestimmte Verhaltensprogramme vererbt. Wie dies genau geschieht, haben wir nach wie vor nicht gut verstanden. Klassisch genetische3 und epigenetische Faktoren4 spielen eine Rolle. Das tatsächliche Verhalten ist aber das Produkt einer Wechselwirkung von Veranlagung und Umwelt und wird durch langfristige Lernprozesse modifiziert. Die evolutionäre Betrachtungsweise schließt in keiner Weise aus, dass menschliche Entscheidungen ebenfalls durch Werte, bewusste Abwägung oder auch Zufälle geprägt sind. Angesichts unseres fehlenden Verständnisses der genauen neurobiologischen Mechanismen, die bewussten Entscheidungsprozessen zugrunde liegen, ist es auch verfrüht, einem »Determinismus« das Wort zu reden, der die Möglichkeit von bewusster Abwägung – also das Handeln aus freier Entscheidung – in Abrede stellt.
Wenn ein Merkmal »evolutionär« entstanden ist, dann stellt es vermutlich eine optimale Lösung dar
4. Das kannst du nicht vergessen – das Gedächtnis und seine Tücken
Menschen haben ein außerordentlich gutes Gedächtnis. Sie können in ihrem Langzeitgedächtnis riesige Wissenssysteme (mehrere Sprachen, botanisches Wissen, geographisches Wissen, historisches Wissen, technisches Wissen, psychologisches Wissen, biomedizinisches Wissen, dieses Buch …) speichern und dieses Wissen zur Anwendung bringen. Das Management großer Wissenssysteme durch unser Gehirn ist keineswegs eine Errungenschaft der Neuzeit und hängt nicht vom Vorhandensein von Computern oder der Schrift ab. Auch in menschlichen Populationen, die als Jäger und Sammler leben, verfügen Menschen über detailliertes Wissen und können dies weitergeben. Erfahrene, traditionell lebende australische Aborigines können über tausend Pflanzenarten voneinander unterscheiden, sie wissen, welche Pflanzen essbar, nutzbar und welche giftig sind und wie man durch Zubereitung bestimmte toxische Pflanzen doch essbar machen kann. Die Ureinwohner im heutigen Peru domestizierten vor etwa achttausend Jahren Wildkartoffeln und entwickelten im Laufe der Zeit durch Züchtung eine enorme Diversität dieser Nutzpflanzen mit über tausend verschiedenen Subtypen. Sie schützten sich dadurch in offensichtlich extrem effektiver Weise vor Hungersnöten, die durch Pflanzenerkrankungen ausgelöst wurden.
Aber – angesichts solcher Leistungen – wo sind da jetzt Nebenwirkungen? Sie tarnen sich erfolgreich, beschützt durch unsere Unkenntnis. Es gibt eine ganze Reihe von Missverständnissen über das Gedächtnis. Das wichtigste ist die Annahme, das Gedächtnis würde, jedenfalls wenn man aufmerksam ist, wie eine Videokamera oder ein Voice-Recorder funktionieren und man könne dann bei Bedarf diesen Film wieder und wieder quasi abspielen. Das ist leider nicht richtig. Das menschliche Gedächtnis ist »rekonstruktiv«: Wenn wir uns erinnern, setzt unser Hirn alle verfügbaren Komponenten zusammen. Wenn etwas fehlt, wird es ergänzt – selbst wenn es in der Wirklichkeit nicht vorhanden war. So können unsere Erinnerungen fehlerhaft werden, ohne dass wir es selbst merken.
Inhalte auf einer Computerfestplatte kann man löschen beziehungsweise überschreiben, auch wenn sie sehr wichtig sind. Informationen im Gehirn können ebenfalls verloren gehen. Vergessen im Gehirn funktioniert aber vor allem dann, wenn die Inhalte wenig relevant erscheinen, nicht mit Emotionen verbunden sind oder nicht mehr regelmäßig abgerufen werden. Es gibt ein Vergessen durch Zeit und es gibt ein gezieltes Vergessen, wenn wir wissen, wir brauchen diese Information in Zukunft nicht mehr. Eine Reservierungsnummer für Theaterkarten beispielsweise, die wir nur einmal benötigen, werden wir uns kurz merken und dann vergessen. Was im Gegensatz zum Computer gar nicht funktioniert, ist, ein bedeutsames, aber unangenehmes Ereignis gezielt zu vergessen. Gedankenunterdrückung hat meistens sogar einen paradoxen Effekt. Inhalte, die man am liebsten nicht wahrhaben oder vergessen möchte, drängen sich regelmäßig wieder auf. Akzeptanz von unangenehmen oder unerwünschten Dingen ist deshalb der bessere Weg, innere Distanz zu finden, als Nichtwahrhabenwollen.
Daniel Schacter hat die Problemseiten des Gedächtnisses mit seinem »Konzept der sieben Sünden« sehr trefflich beschrieben (Schacter, 1999, 2003):
• Vergänglichkeit: Die Erinnerung an Details von Ereignissen nimmt mit der Zeit ab. Sie geht dabei nicht im strengen Sinn verloren. Es ist vielmehr schwieriger, auf sie zuzugreifen, und es kommt zu Interferenzphänomen. Neuere ähnliche Information interferiert mit alter Information und umgekehrt.
• Geistesabwesenheit: Menschen verlegen ihre Schlüssel oder vergessen Verabredungen, weil sie im Moment der Enkodierung der Information ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet haben.
• Blockierung: Gedächtnisinhalte können blockiert sein. Am eindrucksvollsten ist das beim Zungenspitzenphänomen. Man sieht beispielsweise eine Person, weiß genau, ich kenne diese Person, aber uns liegt der Name »auf der Zunge«. Das Charakteristische ist, dass die Lenkung der Aufmerksamkeit auf etwas anderes dann oft dazu führt, dass der Name oder das Wort plötzlich auftaucht.
• Fehlattribution: Eine besondere Rolle spielt hier die Verwechslung der Quelle einer Information. Angenommen, man kennt jemanden aus einem anderen Kontext. Wenn die Polizei einem mehrere Fotos von möglichen Tätern eines Verbrechens vorlegt, bei dem man nur sehr unscharfe Wahrnehmungen machen konnte, kann es sein, dass diese bekannte Person dann für den Täter gehalten wird. Fehlattribution ist eine wichtige Quelle von fehlerhaften Zeugenaussagen in Prozessen.
• Suggestibilität: die Bereitschaft oder Empfänglichkeit für suggestiv übermittelte Informationen. Informationen aus »autoritativen« Quellen, von wichtigen Personen oder Leitmedien zum Beispiel können die eigene Erinnerung beeinflussen, wenn dort behauptet wird, dass es in bestimmter Weise »gewesen sein muss«.
• Anfälligkeit gegen Vorurteile: Gegenwärtige Emotionen und Einstellungen beeinflussen, was und wie es erinnert wird. Erinnerungen werden leichter wiedergefunden, wenn sie in einem ähnlichen emotionalen Zustand enkodiert wurden, der auch gegenwärtig vorhanden ist. Ein Erwachsener, der sich zufrieden fühlt, wird sich vermehrt an angenehme Situationen aus seiner Kindheit erinnern, selbst wenn diese Situationen nicht repräsentativ für seine Kindheit waren. Ein Erwachsener, dessen vorherrschende Emotion Scham ist, wird möglicherweise rasch auf Situationen in seiner Kindheit und Jugend zurückgreifen können, in denen er sich beschämt fühlte.
• Persistenz: Manche Erinnerungen drängen sich in Momenten zwanghaft auf, in denen man sie sich nicht wünscht. Sie bleiben beharrlich – persistent – im Vordergrund. Man sitzt mit seiner Familie in angenehmer Atmosphäre am Tisch und wird plötzlich von einer intensiven Erinnerung an ein 40 Jahre zurückliegendes Ereignis aus der eigenen Kindheit überwältigt, bei dem der eigene Vater beim Abendessen einen heftigen Wutausbruch hatte und alle Familienmitglieder beschimpfte.
5. Hätte ich doch den Lottoschein abgegeben – kontrafaktisches Denken
Alle Lebewesen, die über ein zentrales Nervensystem verfügen, haben vermutlich auch ein Gedächtnis. Eine menschliche Besonderheit ist das kontrafaktische Denken. Menschen können sich nicht nur erinnern, sie können sich auch alternative Varianten vergangener Ereignisse vorstellen. Das nennt man kontrafaktisches Denken, weil wir dabei eine mentale Simulation vornehmen, die entgegengesetzt zu den Fakten ist, also zu dem, was wirklich passiert ist. Wenn man einen Auffahrunfall hatte und mit einem Schaden von dreitausend Euro zurechtkommen muss, hat man sehr wahrscheinlich kontrafaktische Gedanken: Wenn ich rechtzeitig gebremst hätte oder langsamer gefahren wäre oder der Fahrer vor mir rechtzeitig den Blinker gesetzt hätte, wäre sicher nichts passiert. Wenn ich fünf Minuten früher losgefahren wäre oder zuhause geblieben wäre, wäre ich gar nicht in diese Situation geraten. Man stellt sich zudem vor, was man mit den dreitausend Euro alles hätte machen können, und dass man das jetzt nicht mehr kann. Doch das ist nicht die einzige Möglichkeit: Sie können sich auch vorstellen, dass Sie sich möglicherweise schwer verletzt hätten, wenn Sie noch später gebremst hätten, und somit ja noch richtig Glück hatten. Diese verschiedenen Varianten können uns in ein ganz schönes Dilemma bringen, aus dem man wieder in die Realität zurückfinden muss.
Die positive Seite dieser Fähigkeit ist: Menschen können so ihr Verhalten flexibel halten und ihr Verhaltensrepertoire erweitern. Wir können unser Verhalten korrigieren. Betrachten Sie folgendes Beispiel: Sie fragen Ihre Partnerin (aus einer Verunsicherung heraus und nicht aus einem benennbaren Beziehungsproblem) zum zweiten Mal am selben Tag: »Hast du mich eigentlich noch lieb?« Sie sagt: »Das stört mich, wenn du mir Fragen, die ich klar beantwortet habe, zweimal stellst!« Sie werden dann vermutlich sagen: »Tut mir leid, ich wollte dich nicht ärgern!« Sie werden denken: »Es war ungeschickt von mir, ich hätte die Frage nicht wiederholen sollen«, und werden vermutlich in Zukunft hierauf verstärkt achten. In diesem Fall hilft uns kontrafaktisches Denken: Wir können das Verhalten, das sich mit einem Partner nicht bewährt, ändern.
Eine Falle beim kontrafaktischen Denken besteht darin, dass wir ja tatsächlich nach dem Ereignis klüger sind als vorher. Wir verfügen über Informationen, die wir vorher nicht hatten, zumindest wenn das Ereignis auf unser Fehlverhalten zurückgeht. Die retrograde Logik legt uns aber auch nahe, dass man das alles nicht nur vorher hätte wissen können, sondern auch vorher hätte wissen sollen. Kontrafaktisches Denken führt also unmittelbar zu Emotionen, die nach gegenwärtigem Stand der Forschung nur Menschen haben, nämlich Reue und Bedauern. Man fragt sich: »Warum habe ich mich so verhalten und nicht anders?«, »Warum habe ich keine andere Entscheidung getroffen?« Kontrafaktisches Denken tritt dabei in eine ungünstige Wechselwirkung mit Perfektionismus, also dem Streben, jede Fehlermöglichkeit aus dem eigenen Leben fernzuhalten (Sirois, Monforton, & Simpson, 2010).
Eine weitere Falle: Wir nehmen an, dass die alternativen Verhaltensmöglichkeiten genauso leicht zugänglich gewesen wären oder auch tatsächlich langfristig den erhofften Effekt gehabt hätten. Alternatives Verhalten ist aber nur dann nützlich, wenn das negative Ereignis tatsächlich Folge des eigenen Verhaltens war und nicht einfach nur zufällig stattgefunden hat. Immer fünf Minuten früher loszufahren, ist beispielsweise keine nachhaltige Strategie, um Unfälle zu verhindern. Weniger nah auf den Vordermann auffahren hingegen schon. Was uns aber immer völlig verborgen bleibt, ist der langzeitige Verlauf eines alternativen Verhaltenspfades. Dieser Pfad wurde ja tatsächlich nicht begangen. Deshalb kann man nicht wissen, welche Probleme, Schwierigkeiten, Unfälle, aber auch zusätzliche nicht vorhergesehene glückliche Momente auf diesem Weg aufgetreten wären.
Um besser zu verstehen, worum es geht, hier ein Beispiel:
◼ Der 48-jährige Stefan ist Wissenschaftler und Arzt. Nach der Facharztausbildung, die er mit 33 Jahren abgeschlossen hatte, ging er mit seiner Frau und den beiden Töchtern in die USA und verbrachte zwei Jahre an einem renommierten Forschungsinstitut. Er genoss das Leben an der Ostküste, arbeitete erfolgreich an einem wissenschaftlichen Projekt, hatte aber doch Heimweh. Zudem glaubte er, dass sich seine beiden Töchter in der Heimat in der Schule leichtertun würden und er für sie in Deutschland sehr viel einfacher ein Studium finanzieren könnte. Deshalb freute er sich über das Angebot, an seine alte Universität zurückzukehren, und nahm es an.
Tatsächlich hatte sich an seiner alten Arbeitsstätte viel verändert, und er wurde dort das Opfer von intensivem Mobbing durch einen neuen leitenden Mitarbeiter. Dies führte dazu, dass er nach zwei Jahren kündigte und an eine andere Universität und in einen anderen Arbeitsbereich wechselte, in dem er erneut erfolgreich war. Seine akademischen Ziele erreichte er so erst auf Umwegen und mit Verzögerung.
Stefan hatte über viele Jahre, immer wenn er mit Schwierigkeiten konfrontiert war, den Gedanken: »Wäre ich doch in den USA geblieben, es war ein Fehler zurückzukommen, ich bin selbst schuld.« Dabei spürte er ein intensives Gefühl von Bedauern. Wenn man ihn dazu befragt, zeigt er sich völlig davon überzeugt, dass er es in den USA besser gehabt hätte. ◼
Stefan betreibt kontrafaktisches Denken. Er hat eine wichtige und wohlüberlegte Lebensentscheidung getroffen, die für ihn leider nicht die erwünschten Konsequenzen hatte. Er befand sich unerwartet in einer ausgeprägt misslichen Situation, die er geschickt bewältigte, dafür aber einen hohen Preis zahlte. Stefan konnte vorher nicht wissen, was ihn erwarten würde. Jetzt stellt er nachträglich eine ausführliche mentale Simulation an, in der er genau durchgeht, wie sich eine alternative Entscheidung ausgewirkt hätte.
Die Simulation der Ergebnisse ist grundsätzlich ein wichtiges Instrument der menschlichen Entscheidungsfindung. Mentale Simulation ermöglicht die Abwägung von Möglichkeiten, ohne Energie in die Handlung selbst zu investieren. Wenn ein Ingenieur beispielsweise eine Computersimulation des Crashverhaltens eines neuen Automodells macht, kann das später sehr viel Geld sparen.
Das Leben kennt jedoch keine Generalproben, Wiederholungen von Aufführungen oder Crashtests. Menschen können ihr Verhalten nur in der Gegenwart verändern, ganze Lebensabschnitte können aber nicht zur Probe gelebt und wiederholt werden. Das Gehirn ist an dieser Stelle kein Freund. Der problematische Aspekt an der mentalen Simulation bei Stefan ist, dass er einen real erlebten vergangenen Lebensabschnitt mit einem fiktiven Lebensweg vergleicht. Doch weder er noch jemand anderer können wissen, wie Stefans Weg verlaufen wäre, wenn er in den USA geblieben wäre, ob es dort tatsächlich weiter für ihn überwiegend förderliche Umstände gegeben hätte. Ein Lebensweg lässt sich eben nicht so simulieren.
6. Denken über das Denken – Metakognition
Menschen können nicht nur inhaltlich denken, sie können auch über ihr eigenes Denken kritisch reflektieren und haben spezifisches Wissen über die Eigenschaften ihrer Gedanken und ihres Wissens. Man weiß beispielsweise, dass man den Namen eines Menschen kennt, den man gerade gesehen hat, auch wenn man ihn nicht sofort wiederfindet. Man sagt dann: »Der Name liegt mir auf der Zunge.« Man kann beim Ausfüllen der Steuererklärung den Gedanken haben »Schäuble beraubt mich!« oder beim Anblick eines Fotos von Scarlett Johannsen »Ich möchte mich so gerne mit ihr verabreden« und gleichzeitig erkennen, dass diese Gedanken unsinnig und kindisch sind und sicher nicht handlungsleitend sein können. Oder man weiß nach dem einmaligen Durchgehen einer Liste von zwanzig neuen französischen Worten: »Diese Worte kann ich noch nicht, ich muss sie noch mehr üben, um sie sicher wiedergeben zu können.«
Metakognition dient also der Organisation des Wissens und der Lernprozesse. Metakognition funktioniert über weite Strecken hochgradig automatisiert. Ein wichtiges Beispiel ist das Verwerfen von unsinnigen Gedanken, das häufig unbemerkt bleibt.
Metakognition kann aber auch langsam, anstrengend und bewusst sein, beispielsweise, wenn ich darüber nachdenke, ob ich eine verletzende Äußerung meines Vorgesetzten, die dieser in einem emotional erregten Zustand getätigt hat, aufgreifen und ansprechen oder besser ignorieren soll. Diese Form von Metakognition ist ein wichtiger Gegenstand des Austausches zwischen Menschen, die hierüber zusammen beraten können (Shea, et al., 2014). Um klug handeln zu können, müssen wir unsere Gedanken mit anderen zusammen diskutieren und kritisch überprüfen!
Die menschliche Fähigkeit zu dieser Form von Metakognition ist ein extrem wichtiges Instrument des planerischen Handelns. Sie ist aber auch mit Nebenwirkungen belastet. Ich kann mir ganz sicher sein, die PIN-Nummer meiner zweiten Kreditkarte zu wissen, und sie deshalb dreimal falsch eingeben, bis die Karte gesperrt ist. Ich kann mir ganz sicher sein, dass ein bestimmtes Gerücht falsch ist, und es stimmt doch. Ich kann mir ganz sicher sein, auf eine Prüfung vorbereitet zu sein, alles ausreichend zu wissen, und trotzdem durchfallen. Und umgekehrt: Ich kann mir ganz sicher sein, dass ich nichts weiß, und eine Prüfung trotzdem bestehen. Ein bestimmter metakognitiver Stil ist ein charakteristisches Merkmal der eigenen Persönlichkeit. Introvertierte Menschen misstrauen gerne ihrem Wissen oder hoffen, durch erneutes Nachdenken doch noch Lösungen zu finden, während extrovertierte Menschen ihr Wissen manchmal überschätzen, schnelle Entscheidungen treffen und bei spezifischen Problemen nicht ausreichend nachdenken.
◼ Hannah ist eine 18-jährige Frau, die die zwölfte Klasse eines Gymnasiums besucht. Hannah ist eine gute Schülerin, dabei eher ängstlich. Sie hat wenig Zutrauen dazu, wie viel sie weiß, deswegen betreibt sie regelmäßig einen sehr hohen Aufwand vor Prüfungen. Nach der Prüfung ist sie immer sicher, nicht bestanden zu haben. Ihre Freundinnen nehmen sie nicht mehr ernst. Einige haben sich abgewandt, weil sie glauben, von Hannah belogen zu werden. ◼
7. Crashtest – wie unser Gehirn Zukunft simuliert
Mentale Simulation bezeichnet die menschliche Fähigkeit, sich eigenes Verhalten, Verhalten anderer Menschen und Ereignisse in der Zukunft vorzustellen, verschiedene Verhaltensmöglichkeiten und ihre möglichen Konsequenzen durchzugehen (Szpunar, Spreng, & Schacter, 2014). Mentale Simulation nutzt im Gehirn die gleichen Systeme, wie sie auch von Gedächtnis und kontrafaktischem Denken genutzt werden.
Mentale Simulation ist die Grundlage von menschlicher Handlungsplanung in Situationen, in denen mehrere Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und es von Vorteil ist, nicht einfach nur zu reagieren. Sie ist also die Grundlage für die menschliche Fähigkeit, differenziert und geplant zu handeln.
◼ Die 25-jährige Annabell ist eine fröhliche, optimistische junge Frau, die sich immer sicher ist: »Es wird schon gut gehen!« Nach dem Abitur, das sie mit sehr guten Noten abschloss, machte sie zunächst eine Banklehre. Sie hatte nicht groß darüber nachgedacht, sondern war der Empfehlung ihres Vaters gefolgt. Außerdem arbeitete auch eine sehr gute gleichaltrige Freundin dort. Während der Banklehre machte sie dann die Erfahrung, dass die Arbeit in einer Bank überhaupt nicht ihren Wünschen entsprach. Das, was ihr Vater, der ebenfalls Bankkaufmann ist, über seine Lehrzeit berichtet hatte, konnte sie in keiner Weise wiederfinden. Annabell brach die Lehre ab, begann ein Medizinstudium und steht jetzt kurz vor dem Abschluss. Sie hat sich vorgenommen, in Zukunft besser zu planen, bevor sie sich eine Tätigkeit aussucht. Im Moment fragt sie sich, ob sie nach dem Staatsexamen eine Facharztweiterbildung im Bereich Dermatologie oder Innere Medizin machen soll. Sie hat schon einige etwas ältere Kommilitoninnen, die bereits mit der Weiterbildung angefangen haben, nach ihren Erfahrungen befragt und macht jetzt in den Semesterferien Famulaturen in den beiden Bereichen. Sie versucht herauszufinden, wie es sich anfühlt, in diesen Bereichen zu arbeiten, welchen speziellen Herausforderungen und Schwierigkeiten man gegenübersteht und was die besonders interessanten Aspekte der Arbeit sind. ◼
Die Entscheidung, einen bestimmten Beruf zu ergreifen, kann ja nur zu einem sehr beschränkten Ausmaß auf eigene Erfahrung gestützt werden. Ich kann nicht zur Probe eine Banklehre machen oder Medizin studieren. Deshalb folgen die Menschen natürlicherweise Heuristiken. Heuristiken (von griechisch heuriskein, auffinden) bezeichnen einfache praktische Techniken und Regeln zur Problemlösung, die bei begrenztem Wissen und knapper Zeit zu akzeptablen Ergebnissen führen. Heuristiken sind weder optimal noch perfekt, aber ungemein nützlich (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011).
Annabell dachte: »Was meinem Vater Erfolg und Freude gebracht hat, kann auch für mich nicht falsch sein. Außerdem bin ich ein Glückskind, und es ist bei mir bisher alles gut gegangen.« Diese Heuristik zu nutzen war in keiner Weise »falsch« und vermutlich erheblich besser, als völlig zufällig zu wählen. Annabell hat aber ihre Fähigkeit zu mentaler Simulation nicht ausreichend genutzt und hat in der Folge zunächst einen Beruf erlernt, der ihr nicht zusagte. Sie hat diese Erfahrung jedoch ausgewertet und nutzt für die nächste anstehende Entscheidung (Facharztausbildung) sinnvolle Strategien, die mentale Simulation unterstützen: Sie befragt eine größere Zahl von Menschen, die gerade unmittelbar eine bestimmte Erfahrung machen, und sie macht Praktika, um sich möglichst nahe an die Situationen heranzubringen, die für sie zur Auswahl stehen. Auch wenn diese Strategien erheblich besser an die gegenwärtige Situation angepasst sind, bleibt es doch eine mentale Simulation, das heißt Annabell kann nicht vorwegnehmen, wie sie sich in einem bestimmten Tätigkeitsfeld fühlen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei ihrer Wahl bleibt, ist allerdings bei dem jetzt eingeschlagenen Vorgehen deutlich höher.
Mentale Simulation stützt sich auf das Gedächtnis und ist dabei durchaus kreativ (Schacter, et al., 2012; Szpunar, Addis, McLelland, & Schacter, 2013). So können wir uns auch Dinge vorstellen, die wir noch nicht erlebt haben. Beispielsweise hat der Schriftsteller Karl May Landschaften und Kulturen beschrieben, die er nie selbst gesehen oder erlebt hat. Wie kein anderer prägte er mit seinen Erzählungen das Bild vieler Deutscher von »dem Indianer« (Eddy, 2014).
Mentale Simulation funktioniert allerdings hauptsächlich auf verbaler oder bildlicher Grundlage. Es ist fast unmöglich, Erfahrungen, die auf Berührung (Somatosensorik), eigenen Bewegungsabläufen (Propriozeption), Geschmack oder Geruch beruhen, vorwegzunehmen, wenn wir sie noch nie vorher selbst erlebt haben. Wenn ein Mensch noch nie eine sexuelle Begegnung hatte, kann er oder sie sich nicht zutreffend vorstellen, wie sich Sexualität anfühlt. Wenn ein Mensch noch nie geschwommen ist, kann er lange anderen Menschen beim Schwimmen zusehen und darüber spekulieren, wie es sich anfühlen mag. Wenn ein Mensch noch nie eine Avocado gegessen hat, kann er sich nicht vorstellen, wie eine Avocado schmeckt.
Viel einfacher ist es hingegen, einen Reiseweg zu planen. Auch wenn ich noch nie mit dem Zug von München nach Venedig gefahren bin, kann ich trotzdem aufgrund von Fahrplaninformationen, Reiseführern und Informationen sehr gut planen, dass ich morgens um 7:35 Uhr am Hauptbahnhof auf Gleis 11 in den Eurocity steigen muss, in welchen Städten der Zug auf dem Weg halten wird, welche Landschaften ich unterwegs sehen werde, um wie viel Uhr ich im Bahnhof Santa Lucia ankommen werde, welche Gebäude ich dann in einem kurzen Fußweg erreichen kann. Eine derartige Planung wird mit großer Sicherheit funktionieren, aber es ist ebenfalls nicht möglich, vorwegzunehmen, wie es für mich auf der Ebene des emotionalen Erlebens sein wird.