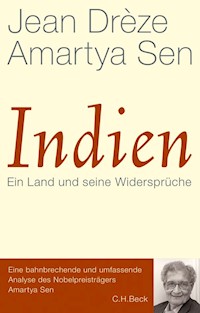![Gleichheit? Welche Gleichheit?. [Was bedeutet das alles?] - Amartya Sen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/32e556237fddc5b0a09ee8e253e7550a/w200_u90.jpg)
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek – [Was bedeutet das alles?]
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Am 22. Mai 1979 hielt der spätere Nobelpreisträger und indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Sen in Stanford einen Vortrag, der unser Denken über Entwicklungshilfe und Verteilungsgerechtigkeit nachhaltig erschüttern sollte: Mit Bezug auf die Gerechtigkeitstheorie des Philosophen John Rawls führte er seine These aus, dass es nicht um die Verteilung von Gütern oder Geld (z. B. in der Entwicklungshilfe), sondern um die Chancen gehen solle, die jeder einzelne zur Verwirklichung seiner Lebensträume vorfindet. Dieser einflussreiche klassische Aufsatz wird hier erstmals in deutscher Übersetzung mit Kommentar und einem einführenden Nachwort veröffentlicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 75
Ähnliche
Amartya Sen
Gleichheit? Welche Gleichheit?
Aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von Ute Kruse-Ebeling
Reclam
2019 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Copyright © Amartya Sen (1979)
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2019
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961463-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019614-4
www.reclam.de
Inhalt
Gleichheit? Welche Gleichheit?1
Auf die Frage: »Welche Gleichheit?« [»equality of what?«] haben uns moralphilosophische Diskussionen eine breite Palette an Antworten geboten.* In dieser Vorlesung werde ich mich auf drei bestimmte Arten von Gleichheit konzentrieren, nämlich auf (i) die utilitaristische Gleichheit, (ii) die Gleichheit des Gesamtnutzens und (iii) die Rawls’sche Gleichheit. Ich werde zeigen, dass alle drei Ansätze jeweils ernsthafte Schwächen aufweisen und dass sich, obwohl sie auf recht unterschiedliche und gegensätzliche Weise scheitern, nicht einmal auf der kombinierten Grundlage der drei eine angemessene Theorie aufbauen lässt. Abschließend werde ich versuchen, eine alternative Formulierung für Gleichheit vorzustellen, die, wie mir scheint, deutlich mehr Beachtung verdient als sie bisher erhalten hat, und ich werde es mir nicht nehmen lassen, ein wenig Werbung für sie zu machen.
Zunächst eine methodologische Frage: Angenommen, jemand behauptet, dass ein bestimmtes moralisches Prinzip Schwächen aufweist: Was kann die Grundlage für eine solche Behauptung sein? Es dürfte mindestens zwei verschiedene Möglichkeiten geben, eine solche Kritik zu begründen, abgesehen von einem direkten Abgleich mit unseren moralischen Intuitionen. Die eine Möglichkeit bestünde darin, die Konsequenzen des Prinzips zunächst anhand von Einzelfällen zu überprüfen, in denen die Folgen der Verwendung des Prinzips sehr deutlich werden, und dann diese Konsequenzen auf ihre Vereinbarkeit mit unseren Intuitionen zu prüfen. Ich werde eine solche Kritik eine Fall-Konsequenzen-Kritik [case-implication critique] nennen. Die andere Möglichkeit wäre, sich vom Allgemeinen nicht zum Besonderen, sondern vom Allgemeinen zum noch Allgemeineren zu bewegen. Man kann die Stimmigkeit bzw. Kohärenz des Prinzips anhand eines anderen Prinzips prüfen, das als grundlegender anerkannt wird. Solche vorrangigen Prinzipien werden in der Regel auf einer recht abstrakten Ebene formuliert und decken sich häufig mit irgendwelchen sehr allgemeinen Verfahren. Zum Beispiel damit, was man vernünftigerweise annehmen könnte, dass es unter dem als-ob-Nichtwissen des Rawls’schen »Urzustandes« gewählt worden wäre – einem hypothetischen Anfangszustand, in dem Menschen darüber entscheiden, welche Regeln sie beschließen wollen ohne zu wissen, wer sie sein werden – so als ob sie zu jeder beliebigen Person der Gemeinschaft werden könnten.* Oder damit, welche Regeln Richard Hares Anforderung der »Universalisierbarkeit« erfüllen und entsprechend die »gleichen Interessen, die die Inhaber aller Rollen in der Situation haben, gleich gewichten«.* Ich werde eine Kritik, die auf einem solchen Ansatz basiert, eine Vorrangiges-Prinzip-Kritik [prior-principle critique] nennen. Beide Ansätze können bei der Beurteilung der moralischen Ansprüche jeder dieser Arten von Gleichheit verwendet werden und werden hier in der Tat auch Verwendung finden.
1. Utilitaristische Gleichheit
Die utilitaristische Gleichheit ist jene Gleichheit, die sich aus dem utilitaristischen Konzept des Guten ableiten lässt, das auf Verteilungsprobleme angewandt wird. Der einfachste Fall ist vielleicht das »reine Verteilungsproblem«: Es besteht darin, einen gegebenen homogenen Kuchen unter einer Gruppe von Personen aufzuteilen.* Jede Person erhält mehr Nutzen, je größer ihr Anteil am Kuchen ist, und sie erhält nur aus ihrem Anteil des Kuchens einen Nutzen; ihr Nutzen erhöht sich mit abnehmender Tendenz, je größer ihr Anteil wird. Das utilitaristische Ziel besteht in der Maximierung der Gesamtsumme an Nutzen ohne Rücksicht auf die Verteilung, doch das erfordert die Gleichheit des Grenznutzens aller – wobei der Grenznutzen der Nutzenzuwachs ist, den jede Person aus einem weiteren Kuchenstück erhalten würde.* Gemäß einer Interpretation verkörpert diese Gleichheit des Grenznutzens die Gleichbehandlung der Interessen aller Personen.*
Ein wenig komplizierter stellt sich die Position dar, wenn die Gesamtgröße des Kuchens nicht unabhängig von seiner Verteilung ist. Doch selbst dann erfordert die Maximierung der Gesamtnutzensumme, dass Transfers bis zu dem Punkt vorgenommen werden, an dem der Grenznutzengewinn der Gewinner dem Grenznutzenverlust der Verlierer gleichkommt, und zwar nach Berücksichtigung der Auswirkung des Transfers auf die Größe und Verteilung des Kuchens.*In diesem größeren Rahmen tritt die besondere Art der Gleichheit, auf die der Utilitarismus beharrt, nachdrücklich zutage. Richard Hare hat behauptet, »die gleiche Gewichtung der gleichen Interessen aller Parteien« führe »zum Utilitarismus« – und würde somit die Anforderung des vorrangigen Prinzips der Universalisierbarkeit erfüllen.* In ähnlicher Weise macht John Harsanyi kurzen Prozess mit den Nicht-Utilitaristen (einschließlich des hier Vortragenden, wie ich hinzufügen möchte), indem er für den Utilitarismus eine alleinige Fähigkeit beansprucht, »eine unfaire Ungleichbehandlung« zwischen »den gleichermaßen dringenden menschlichen Bedürfnissen einer Person und einer anderen Person«* zu vermeiden.
Die moralische Bedeutung bzw. Wichtigkeit von Bedürfnissen basiert nach dieser Interpretation ausschließlich auf dem Begriff des Nutzens. Das kann man infrage stellen, und da ich dies in der Vergangenheit wiederholt getan habe,* werde ich mich nicht scheuen, es auch in diesem besonderen Zusammenhang zu tun. Doch bevor ich auf dieses Thema zu sprechen kommen werde, möchte ich zunächst das Wesen der utilitaristischen Gleichheit untersuchen, ohne – fürs Erste – infrage zu stellen, dass die moralische Bedeutung vollständig auf den Nutzen gegründet wird. Selbst wenn der Nutzen die einzige Grundlage der Bedeutung darstellt, bleibt immer noch die Frage, ob die Größe des Grenznutzens, ungeachtet des Gesamtnutzens, den die Person genießt, ein angemessenes Maß für die moralische Bedeutung ist. Natürlich ist es möglich, eine Metrik in Bezug auf Nutzenmerkmale so zu definieren, dass die Nutzenskala jeder Person so mit der jeder anderen koordiniert wird, dass die gleiche gesellschaftliche Bedeutung einfach als gleicher Grenznutzen »skaliert« wird. Wenn davon ausgegangen wird, dass interpersonelle Nutzenvergleiche, d. h. Nutzenvergleiche zwischen Personen, keinen deskriptiven Gehalt haben, dann kann dies in der Tat als ein natürlicher Ansatz betrachtet werden. Unabhängig davon, wie man zu den relativen gesellschaftlichen Bedeutungen gelangt, würden dann die Grenznutzen, die jeder Person zugeschrieben werden, einfach diese Werte widerspiegeln. Dies kann explizit durch eine entsprechende interpersonelle Skalierung* oder implizit dadurch erreicht werden, dass die Nummerierung der Nutzen Entscheidungen in Situationen der als-ob-Ungewissheit widerspiegelt, die mit dem »Urzustand« verbunden sind, unter der zusätzlichen Annahme, dass Nichtwissen als gleiche Wahrscheinlichkeit, irgendeine der möglichen Personen zu sein, interpretiert wird.* Es ist hier nicht der Ort, um auf die technischen Details dieser Art von Übung einzugehen, doch im Wesentlichen besteht sie darin, ein Skalierungsverfahren so zu verwenden, dass die Messungen der Grenznutzen automatisch als Indikatoren für die gesellschaftliche Bedeutung bestimmt werden.
Dieser Weg zum Utilitarismus mag auf wenig Widerstand stoßen, doch er ist hauptsächlich deshalb nicht umstritten, weil er so wenig aussagt. Problematisch wird es jedoch, sobald davon ausgegangen wird, dass Nutzen und interpersonelle Vergleiche dieser verschiedenen Nutzen irgendeinen unabhängigen deskriptiven Gehalt haben, wie dies Utilitaristen traditionell behauptet haben. Es könnten dann Konflikte zwischen diesen deskriptiven Nutzen und den entsprechend skalierten, im Wesentlichen normativen Nutzen auftreten, in Bezug auf die man »gezwungen« ist, Utilitarist zu sein. Im Folgenden werde ich mich nicht mehr weiter zum Utilitarismus mittels entsprechender interpersoneller Skalierung äußern und stattdessen wieder zur Untersuchung der traditionellen utilitaristischen Position zurückkehren, die davon ausgeht, dass Nutzen einen interpersonell vergleichbaren deskriptiven Gehalt hat. Die Frage, wie sich die moralische Bedeutung auf diese deskriptiven Merkmale beziehen sollte, muss dann ausdrücklich gestellt werden.
Die Position kann sowohl aus der Perspektive des vorrangigen Prinzips als auch aus dem Blickwinkel der Fall-Konsequenzen untersucht werden. John Rawls verwendete in seiner Kritik, die er der Darstellung seiner eigenen alternativen Gerechtigkeitskonzeption voranstellte, überwiegend das vorrangige Prinzip. Dabei ging es hauptsächlich um die Akzeptierbarkeit im »Urzustand« und folgte der Argumentation, dass sich Menschen in der angenommenen Situation des als-ob-Nichtwissens nicht dafür entscheiden würden, die Nutzensumme zu maximieren. Doch Rawls erörterte auch die Gewalt, die der Utilitarismus unseren Begriffen von Freiheit und Gleichheit antut. In Erwiderung auf Rawls’ Argumente haben einige die Notwendigkeit, Utilitarist zu sein, noch einmal bekräftigt, indem sie den zuvor diskutierten »Skalierungs«-Pfad einschlugen, der – meiner Ansicht nach – nicht dazu geeignet ist, um Rawls’ Kritik zu begegnen. Doch ich muss gestehen, dass ich der Verlockung des »Urzustandes« ausgesprochen gut widerstehen kann, da mir sehr unklar zu sein scheint, was genau in einer solchen Situation gewählt würde. Es ist außerdem alles andere als offensichtlich, dass eine prudentielle Wahl2 unter als-ob-Ungewissheit eine angemessene Grundlage für moralische Urteile in Nicht-Urzuständen, d. h. in realen Zuständen bzw. Lebenslagen liefert.* Ich glaube jedoch, dass Rawls’ direktere Kritiken in Bezug auf Freiheit und Gleichheit sehr stark bleiben.
Sofern man sich mit der Verteilung von Nutzen befasst, folgt unmittelbar, dass der Utilitarismus einem im Allgemeinen wenig Unterstützung bieten würde. Selbst die winzigste Vergrößerung der Gesamtnutzensumme würde aus dieser Sicht eklatanteste Ungleichheiten in der Verteilung überwiegen. Dieses Problem wäre unter bestimmten Annahmen vermeidbar, insbesondere in dem Fall, in dem jeder dieselbe Nutzenfunktion aufweist. Im reinen Verteilungsproblem würde das utilitaristische Beste mit dieser Annahme die absolute Gleichheit der Gesamtnutzen aller Personen erfordern.*
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:


![Elemente einer Theorie der Menschenrechte. [Was bedeutet das alles?] - Amartya Sen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5df4ddfeaeb24b710a4ec3405de1e09b/w200_u90.jpg)
![Rationale Dummköpfe. Eine Kritik der Verhaltensgrundlagen der Ökonomischen Theorie. [Was bedeutet das alles?] - Amartya Sen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/38c3f8dccd4ec02244a3dfcedf330c1b/w200_u90.jpg)