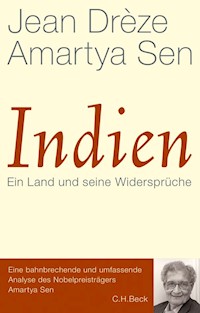10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Drei Kinder streiten darüber, wem von ihnen eine Flöte gehören sollte. Das erste Kind hat Musikunterricht gehabt und kann als einziges Flöte spielen. Das zweite ist arm und besitzt keinerlei anderes Spielzeug. Das dritte Kind hat die Flöte mit viel Ausdauer selbst angefertigt.
Mit diesem Gleichnis eröffnet Amartya Sen, einer der wichtigsten Denker unserer Zeit, sein Buch über die Idee der Gerechtigkeit. Es ist John Rawls gewidmet und grenzt sich doch von der wirkungsmächtigsten Gerechtigkeitstheorie des 20. Jahrhunderts ab. Wer eine weitere abstrakte Diskussion der institutionellen Grundlagen einer gerechten Gesellschaft erwartet, der wird enttäuscht sein. Wer sich hingegen darüber wundert, was diese Theorien eigentlich zur Bekämpfung real existierender Ungerechtigkeiten beitragen, der wird großen Gewinn daraus ziehen.
Sen nämlich stellt die Plausibilität solcher Anstrengungen der reinen Vernunft in Frage. Seine Theorie der Gerechtigkeit ist weniger an der Ausformulierung einer ethisch perfekten Gesellschaft interessiert als an Argumenten, deren Maßstab die konkrete Überwindung von Ungerechtigkeit ist. Sen eröffnet Perspektiven, die dem westlichen Denken meist fehlen. Seine Kenntnis der hinduistischen, buddhistischen und islamischen Kultur ist wundervoll eingewoben in das Buch und prägt den ganzen Charakter seines Philosophierens. Die Vernunft sucht die Wahrheit, wo immer sie sich finden lässt – und wie der Autor dieses außergewöhnlichen Werkes entdeckt sie auf ihrer weiten Reise viele gangbare Wege zu einer gerechteren Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
AMARTYA SEN
Die Idee derGerechtigkeit
Aus dem Englischen von Christa Krüger
C.H.BECK
Zum Buch
Ist Gerechtigkeit ein unerreichbares Ideal, oder kann sie uns in der Realität zu praktischen Entscheidungen führen und unser Leben verbessern? Amartya Sen entwickelt in seinem faszinierenden Buch eine Alternative zu den vorherrschenden Theorien der Gerechtigkeit. Sie haben zwar in einzelnen Bereichen viel geleistet, so Sen, uns im Ganzen aber in die falsche Richtung gelenkt. Seine eigene Theorie orientiert sich nicht an den Luftschlössern idealer Gerechtigkeit, sondern an der Beseitigung von herrschenden Missständen und nimmt dazu eine Fülle von drängenden aktuellen Fragen – von der Lage der Frauen bis zur globalen Gerechtigkeit – in den Blick. Amartya Sen, Nobelpreisträger für Ökonomie, ist einer der weltweit führenden öffentlichen Intellektuellen, und sein Weitblick, sein Scharfsinn und seine eindringliche Humanität treten in diesem wichtigen Buch besonders deutlich hervor.
„Ein wahrhaft globales philosophisches Panorama, das seinesgleichen sucht – indische Weisheiten werden mit westlicher Philosophie in Beziehung gesetzt, reale Geschichten mit abstrakten Gedankenexperimenten und theoretischen Debatten verknüpft. Kaum jemand vermag es wie Sen, solche Diskussionen klar und knapp darzustellen und dies zugleich mit einer Prise Ironie und dem Ernst zu verbinden, den dieses Thema erfordert. Deshalb ist dies ein wichtiges und wuchtiges Buch von einem der großen Geister unserer Zeit.“
Rainer Forst, Die Zeit
„Auch wenn Sens Argumentation durchaus aufs Globale zielt, betont er vor allem die Wichtigkeit der 'praktischen Realisierbarkeit' von konkreten Maßnahmen zur Behebung manifester Ungerechtigkeit. Und wer seine Grundthesen in Handlungsanweisungen ummünzen möchte, könnte, kurz gefasst, auch sagen: think global, act local.“
Katharina Granzin, taz
„Überhaupt gehört die ungeheure Sicherheit, mit der Amartya Sen kulturelle und konzeptionelle Unterschiede zur Kenntnis nimmt, nie der Versuchung nachgibt, sie zu vereinheitlichen, und doch keinen Zweifel daran hegt, dass sie in einen vernünftigen allgemeinen Diskussionszusammenhang zu bringen sind, zu den beeindruckendsten Qualitäten des Buches.“
Christoph Möllers, Süddeutsche Zeitung
„Ich glaube, dies ist der wichtigste Beitrag zum Thema seit John Rawls’ ‚Eine Theorie der Gerechtigkeit‘. … Sens Buch verdient die größtmögliche Leserschaft.“
Hilary Putnam
Über den Autor
Amartya Sen ist Professor für Philosophie und Professor für Ökonomie an der Harvard Universität. 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie, 2020 wurde ihm der Friedenspreis des deutschen Buchhandels zuerkannt. Zu seinen zahlreichen Büchern gehören „Ökonomie für den Menschen“ und „Die Identitätsfalle“ (dt. erschienen bei C.H.Beck). Er gilt als einer der einflussreichsten Denker der Gegenwart.
In Erinnerung an John Rawls
INHALT
Vorwort
Danksagung
Einleitung
ERSTER TEILDIE ANFORDERUNGEN DER GERECHTIGKEIT
1. Vernunft und Objektivität
2. Pro und kontra Rawls
3. Institutionen und Personen
4. Stimme und kollektive Entscheidung
5. Unparteilichkeit und Objektivität
6. Geschlossene und offene Unparteilichkeit
ZWEITER TEILFORMEN DES ARGUMENTIERENS
7. Standort, Relevanz und Illusion
8. Rationalität und die Anderen
9. Die Pluralität unparteiischer Gründe
10. Verwirklichungen, Folgen und Handeln
DRITTER TEILMATERIALIEN DER GERECHTIGKEIT
11. Leben, Freiheiten und Befähigungen
12. Befähigungen und Ressourcen
13. Glück,Wohlergehen und Befähigungen
14. Gleichheit und Freiheit
VIERTER TEILÖFFENTLICHER VERNUNFTGEBRAUCH UND DEMOKRATIE
15. Demokratie als öffentliche Vernunft
16. Die demokratische Praxis
17. Menschenrechte und globale Imperative
18. Gerechtigkeit und die Welt
ANHANG
Anmerkungen
Personenregister
Sachregister
VORWORT
«In der kleinen Welt, in der Kinder leben», sagt Pip in Charles Dickens’ Roman Große Erwartungen, «gibt es nichts, was sie so feinsinnig aufnehmen und empfinden wie Ungerechtigkeit.»[1] Pip wird wohl Recht haben: Nach seiner demütigenden Begegnung mit Estella erinnert er sich lebhaft an die «launenhaften und gewalttätigen Zwangsmaßnahmen», die er als Kind von der Hand seiner eigenen Schwester erdulden musste. Aber auch Erwachsene nehmen offenkundiges Unrecht deutlich wahr. Nicht die Erkenntnis, dass die Gerechtigkeit auf der Welt unvollkommen ist – vollkommene Gerechtigkeit erwarten nur wenige von uns –, treibt uns zum Handeln, sondern die Tatsache, dass es in unserer Umgebung Ungerechtigkeiten gibt, die sich ausräumen lassen und die wir beenden wollen.
Das ist greifbar genug in unserem täglichen Leben mit den Unbilligkeiten und Unterdrückungen, die uns zu schaffen machen und mit gutem Grund ärgern, aber es gilt auch für wahrgenommene Ungerechtigkeiten im weiteren Umkreis unserer Lebenswelt. Ohne einen Gerechtigkeitssinn, der ihnen sagte, dass manifeste Ungerechtigkeiten überwunden werden können, hätten die Pariser sehr wahrscheinlich die Bastille nicht gestürmt, hätte Gandhi das Weltreich, in dem die Sonne nicht unterging, nicht herausgefordert, Martin Luther King nicht zum gewaltlosen Widerstand gegen die weiße Übermacht im «Land der Freien und der Heimat der Mutigen» aufgerufen. Sie versuchten nicht, eine vollkommen gerechte Welt zu erstreiten (selbst wenn Einigkeit darüber bestünde, wie sie aussehen würde), sondern sie wollten klares Unrecht beseitigen, so weit sie konnten.
Unrecht zu erkennen, dem man abhelfen kann, ist nicht nur ein Beweggrund für unser Nachdenken über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, sondern auch zentral für die Theorie der Gerechtigkeit – das möchte ich in diesem Buch zeigen. In der hier vorgelegten Untersuchung wird die Feststellung von Ungerechtigkeit oft genug als Ausgangspunkt für kritische Diskussion fungieren.[2] Aber warum sollte sie nicht auch ein guter Endpunkt sein, könnte man fragen.Warum müssen wir über unseren Sinn für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit hinausgehen? Wozu brauchen wir eine Theorie der Gerechtigkeit?
Um die Welt zu verstehen, reicht es nicht, einfach nur unmittelbare Wahrnehmungen zu registrieren. Zum Verstehen gehört unvermeidlich Nachdenken. Wir müssen «studieren», was wir fühlen und zu sehen scheinen, und wir müssen fragen, was diese Wahrnehmungen anzeigen und wie wir ihnen angemessen Beachtung schenken können, ohne von ihnen überwältigt zu werden. Eine dieser Fragen bezieht sich auf die Zuverlässigkeit unserer Gefühle und Eindrücke. Das Gespür für Ungerechtigkeit könnte als ein Signal dienen, das uns in Bewegung setzt, aber ein Signal muss kritisch untersucht werden, und eine Schlussfolgerung, die lediglich auf Signalen beruht, muss auf ihre Solidität hin geprüft werden. Adam Smith war überzeugt, dass ethische Gefühle wichtig sind, aber das hielt ihn nicht davon ab, nach einer «Theorie der ethischen Gefühle» zu suchen; er bestand darauf, dass ein Gefühl von Unrecht einer durchdachten kritischen Prüfung ausgesetzt werden muss, damit deutlich wird, ob es Grundlage für eine nachhaltige Verurteilung sein kann. Das Gleiche gilt für die Neigung, jemanden oder etwas zu rühmen; auch sie ist kritisch zu prüfen.*1
Wir müssen darüber hinaus fragen, welche Arten des Vernunftgebrauchs bei der Beurteilung der ethischen und politischen Konzepte von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zum Einsatz kommen sollen. Auf welche Weise kann die Diagnose einer Ungerechtigkeit oder dessen, was sie verringern oder beseitigen würde, objektiv sein? Wird Unparteilichkeit in einem besonderen Sinn verlangt, etwa das Absehen von den eigenen erworbenen Ansprüchen? Ist es auch nötig, gewisse Einstellungen zu überprüfen, selbst wenn sie nicht mit erworbenen Ansprüchen zusammenhängen, sondern ortsgebundene Vormeinungen und Vorurteile spiegeln, die in der durchdachten Konfrontation mit anderen, nicht im gleichen Provinzialismus befangenen Denkweisen vielleicht nicht standhalten? Welche Rolle spielen Rationalität und Vernünftigkeit für das Verständnis dessen, was Gerechtigkeit fordert?
Diese Probleme und einige in engem Zusammenhang damit stehende allgemeinere Fragen werden in den ersten zehn Kapiteln behandelt, und anschließend befasse ich mich mit möglichen Anwendungen der Theorie: mit der kritischen Einschätzung der Grundlagen für Urteile über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit (das können Freiheiten, Befähigungen, Ressourcen, Glück, Wohlergehen oder andere sein), mit der besonderen Relevanz diverser Erwägungen, die in die Rubrik Gleichheit und Freiheit einzuordnen sind, mit dem offenkundigen Zusammenhang zwischen dem Streben nach Gerechtigkeit und dem Verständnis von Demokratie als «Regierung durch Diskussion» und mit der Natur, Durchführbarkeit und Tragweite der Menschenrechte.
Welche Art von Theorie?
Die Überlegungen, die in diesem Buch präsentiert werden, zielen auf eine Theorie der Gerechtigkeit in einem sehr weiten Sinn. Sie soll klären, wie wir verfahren können, wenn wir Fragen der Erweiterung von Gerechtigkeit und Beseitigung von Ungerechtigkeit in Angriff nehmen wollen; sie hat nicht das Ziel, Antworten auf die Frage nach dem Wesen vollkommener Gerechtigkeit zu bieten. Darin unterscheidet sie sich deutlich von den Theorien der Gerechtigkeit, die in der gegenwärtigen politischen und Moralphilosophie das Feld beherrschen. Vor allem drei Unterschiede verdienen besondere Beachtung – in der Einleitung werden sie ausführlicher behandelt.
Der erste Unterschied: Eine Theorie der Gerechtigkeit, die als Basis für den Gebrauch der praktischen Vernunft dienen kann, muss zeigen können, wie tatsächliche Versuche zur Verminderung von Ungerechtigkeit und Beförderung von Gerechtigkeit einzuschätzen sind; sie sollte sich nicht ausschließlich auf die Charakterisierung vollkommen gerechter Gesellschaften konzentrieren, wie es in den Theorien der Gerechtigkeit der politischen Philosophie von heute häufig geschieht. Es gibt Zusammenhänge zwischen diesen beiden verschiedenen Zielsetzungen, aber trotzdem sind sie analytisch voneinander entkoppelt. Das Ziel, auf das sich dieses Buch konzentriert, hat zentrale Bedeutung für Entscheidungen über Institutionen,Verhaltensweisen und andere Determinanten der Gerechtigkeit; und die Ableitung solcher Entscheidungen muss die wichtigste Aufgabe einer Theorie der Gerechtigkeit sein, die als Richtlinie für praxisorientierte Überlegungen dienen soll. Die Behauptung, dass diese vergleichende Arbeit erst möglich sei, nachdem die Aufforderungen der vollkommenen Gerechtigkeit geklärt wurden, diese Behauptung ist nachweislich ganz und gar falsch (im Kapitel 4, «Stimme und kollektive Entscheidung», wird der Nachweis geführt).
Der zweite Unterschied: Manche Fragen der vergleichenden Beurteilung von Gerechtigkeit können zufrieden stellend geklärt werden, und mittels durchdachter Argumente ist dann Einigung zu erzielen, aber es gibt womöglich auch Vergleiche, in denen Meinungsverschiedenheiten über konkurrierende Erwägungen nicht völlig beigelegt werden können. Hier wird die These aufgestellt, dass mehrere verschiedene Gründe der Gerechtigkeit nebeneinander bestehen können, die alle kritischer Überprüfung standhalten, aber zu unterschiedlichen Folgerungen führen.*2 Vernünftige, in entgegengesetzte Richtungen weisende Argumente können von Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Traditionen stammen, aber auch innerhalb einer einzigen bestimmten Gesellschaft und sogar in derselben Person vorkommen.**3
Um mit dem Konflikt zwischen einander widerstreitenden Ansprüchen umgehen zu können, brauchen wir eine vernünftige Auseinandersetzung mit anderen und mit uns selbst; die Haltung, die man «bindungslose Toleranz» nennen könnte und die bequeme Lösungen wie «Sie haben Recht in Ihrer Gemeinschaft und ich in meiner» bietet, ist dazu nicht geeignet. Vernunftgebrauch und unparteiische Überprüfung sind entscheidend. Aber auch nach der gründlichsten kritischen Untersuchung können einander widerstreitende und konkurrierende Argumente übrig bleiben, die durch unparteiische Überprüfung nicht auszuräumen sind. Im Folgenden werde ich mehr dazu sagen, möchte aber an dieser Stelle schon betonen, dass die Notwendigkeit des Vernunftgebrauchs und der kritischen Prüfung keinesfalls dadurch in Frage gestellt wird, dass womöglich einige konkurrierende Prioritäten die Konfrontation mit der Vernunft überdauern. Die Pluralität, mit der wir dann enden, wird das Resultat des Vernunftgebrauchs, nicht des Verzichts auf vernünftiges Denken sein.
Der dritte Unterschied: Dass es Ungerechtigkeiten gibt, die sich beseitigen lassen, kann gut mit Übertretungen von Verhaltensregeln zusammenhängen und nicht mit institutionellen Mängeln (Pips in Große Erwartungen geschilderte Erinnerung an die Gewalttätigkeit seiner Schwester war nur dies, aber keine Verurteilung der Institution Familie). Gerechtigkeit ist letzten Endes verbunden mit der Lebensführung von Menschen und nicht nur mit der Eigenart der Institutionen in ihrer Umgebung. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich viele der wichtigsten Theorien der Gerechtigkeit übermäßig auf die Frage, wie «gerechte Institutionen» einzurichten sind, und gestehen Verhaltensmustern nur eine untergeordnete, nebensächliche Rolle zu. Zum Beispiel ergibt John Rawls’ mit Recht berühmter Ansatz der «Gerechtigkeit als Fairness» ein einziges Set von «Gerechtigkeitsgrundsätzen», die ausschließlich auf die Einrichtung «gerechter Institutionen» zielen (um die Grundstruktur der Gesellschaft festzulegen) und verlangen, dass das Verhalten von Menschen vollkommen den Bedingungen für das angemessene Funktionieren dieser Institutionen entspricht.[3] Ich behaupte dagegen, dass diese übermäßige Konzentration auf Institutionen (während vorausgesetzt wird, dass das Verhalten hinreichend makellos ist), statt auf das Leben, das Menschen führen können, einige entscheidende Mängel hat.Wird Gerechtigkeit unter Konzentration auf dieses Leben beurteilt, ergeben sich daraus weit reichende Folgen für die Natur und die Reichweite der Idee der Gerechtigkeit.*4
Das Umdenken in der Theorie der Gerechtigkeit, das in diesem Buch versucht wird, hat – so behaupte ich – unmittelbaren Bezug zur politischen und praktischen Philosophie. Aber ich habe auch versucht, darzustellen, welche Relevanz die hier präsentierten Argumente für einige der Auseinandersetzungen haben, die zur Zeit im Rechtswesen, der Ökonomie und der Politik ausgetragen werden; und wenn man optimistisch ist, könnte man sogar sagen, dass die Theorie in der Praxis Auswirkungen auf Debatten und Entscheidungen über politische Maßnahmen und Programme hat.**5
Die Sicht aus einer komparativen Perspektive, die deutlich über den engen – und einengenden – Rahmen des Gesellschaftsvertrags hinausgeht, kann hier nützlich sein.Vergleichende Einschätzungen der Erweiterung von Gerechtigkeit treffen wir ständig, ob wir nun gegen Unterdrückung vorgehen (etwa gegen Sklaverei oder Unterjochung von Frauen) oder gegen systematische medizinische Unterversorgung (gegen das Fehlen medizinischer Einrichtungen in Teilen Afrikas oder Asiens oder das Fehlen allgemeiner Krankenversicherungen in den meisten Ländern der Welt einschließlich der USA) protestieren oder ablehnen, Folterung als zulässige Verhörmethode anzusehen (Folter wird in der Welt von heute noch immer bemerkenswert häufig eingesetzt – manchmal sogar in Staaten, die als Stützen des globalen Establishments gelten), oder ob wir uns gegen die stillschweigende Duldung von chronischem Hunger wenden (zum Beispiel in Indien trotz der Abschaffung von Hungersnöten).*6 Oft genug mögen wir uns einig sein, dass manche Veränderungen (zum Beispiel die Beendigung der Apartheid) Ungerechtigkeit verringern werden, aber selbst wenn alle derartigen übereinstimmend befürworteten Veränderungen erfolgreich durchgeführt sind, werden wir immer noch nicht von einer auch nur annähernd vollkommenen Gerechtigkeit sprechen können. Praktische Sachverhalte scheinen nicht weniger als theoretische Überlegungen eine ziemlich radikale neue Richtung in der Analyse der Gerechtigkeit zu fordern.
Öffentlicher Vernunftgebrauch und Demokratie und globale Gerechtigkeit
Auch wenn Gerechtigkeitsgrundsätze im hier vorgelegten Ansatz nicht im Hinblick auf Institutionen, sondern im Hinblick auf Leben und Freiheiten der betroffenen Menschen definiert werden, haben Institutionen dennoch für die Förderung von Gerechtigkeit zwangsläufig eine wichtige instrumentelle Rolle. Institutionen kommen auf viele verschiedene Arten ins Spiel. Sie können unmittelbar dazu beitragen, dass Menschen in der Lage sind, ihr Leben im Einklang mit den Werten zu führen, die sie mit Grund hochschätzen. Institutionen können Möglichkeiten zu öffentlicher Diskussion bieten (dazu gehört nicht nur, dass tatsächlich Räume für Diskussionen nach Information geschaffen werden, sondern auch, dass Redefreiheit und Recht auf Information garantiert sind) und unterstützen damit unsere Fähigkeit zur kritischen Prüfung der Werte und Prioritäten, die wir in Erwägung ziehen.
In diesem Buch wird Demokratie am öffentlichen Vernunftgebrauch gemessen (Kapitel 15–17), das heißt, als «Regierung durch Diskussion» verstanden (eine Vorstellung, die John Stuart Mill sehr gefördert hat). Aber Demokratie muss auch allgemeiner gesehen werden, im Rahmen ihrer Fähigkeit, durchdachtes Engagement zu fördern, indem sie für mehr Informationen sorgt und interaktive Diskussionen möglich macht. Demokratie ist nicht nur anhand formal existierender Institutionen zu beurteilen, sondern ihr Maß ist die Vielfalt der Stimmen aus unterschiedlichen Bereichen, die tatsächlich gehört werden können.
Auch das Streben nach Demokratie auf globaler Ebene, nicht nur innerhalb eines Staates, kann durch diese Betrachtungsweise geprägt werden. Verlangt das Konzept nicht lediglich, dass einige spezifische Institutionen eingerichtet werden (etwa eine globale Regierung oder globale Wahlen), sondern vielmehr, dass öffentlicher Vernunftgebrauch ermöglicht und gefördert wird, dann kann die Aufgabe, globale Demokratie und globale Gerechtigkeit auf den Weg – nicht zur Vollkommenheit – zu bringen, als außerordentlich einleuchtende Idee gelten, die grenzübergreifendes Handeln überzeugend anzuregen und zu beeinflussen vermag.
Die europäische Aufklärung und unsere globale Erbschaft
Was kann ich über die Vorformen des Zugangs sagen, den ich hier zeigen möchte? Diese Frage werde ich in der Einleitung ausführlicher behandeln, weise aber hier schon darauf hin, dass die Analyse der Gerechtigkeit, die ich in diesem Buch vorlege, auf Gedankengänge zurückgreift, die in der Phase intellektueller Unzufriedenheit während der europäischen Aufklärung besonders aktuell waren. Um Missverständnisse zu vermeiden, muss ich jedoch zur Klärung ein paar einschränkende Bemerkungen hinzufügen.
Die erste Einschränkung: Dass dieses Buch der Tradition der europäischen Aufklärung verpflichtet ist, heißt nicht, dass sein Hintergrund ausgesprochen «europäisch» wäre. Vielmehr hat es, verglichen mit anderen Arbeiten zur Theorie der Gerechtigkeit, einige unübliche – manche sagen wahrscheinlich: exzentrische – Züge insofern, als ich mich ausführlich auf Ideen aus nicht-westlichen Gesellschaften, vor allem, aber nicht nur, aus der indischen Geistesgeschichte, beziehe. In Indiens intellektueller Vergangenheit sowie in einer ganzen Reihe anderer nicht-westlicher Gesellschaften finden sich ausgeprägte Traditionen logischen Argumentierens anstelle von Glaubenssätzen und unreflektierten Überzeugungen. Wenn sich die gegenwärtige – weitgehend westliche – politische Philosophie im Allgemeinen und Theorien der Gerechtigkeit im Besonderen fast ausschließlich auf westliche Literatur konzentrieren, verraten sie damit, so möchte ich behaupten, eine gewisse provinzielle Beschränktheit.*7
Ich behaupte jedoch nicht, dass im Bereich der politischen Philosophie eine radikale Dissonanz zwischen «westlichem» und «östlichem» (oder generell nicht-westlichem) Denken besteht. Westliche Denkrichtungen sind untereinander so verschieden wie östliche, und die Vorstellung von einer einheitlichen «Westfront» gegen «durch und durch östliche» Prioritäten wäre pure Phantasie.**8 Solche in zeitgenössischen Diskussionen nicht selten anzutreffenden Meinungen liegen mir sehr fern. Ich behaupte vielmehr, dass in vielen verschiedenen Teilen der Welt gleichartige oder eng verwandte Vorstellungen von Gerechtigkeit, Fairness, Verantwortung, Pflicht, vom Guten und vom Rechten herrschen, die den Argumenten aus der westlichen Literatur zu größerer Tragweite verhelfen können, und ich behaupte, dass die Ubiquität dieses Denkens in den dominanten Traditionen des gegenwärtigen westlichen Diskurses oft übersehen oder als nebensächlich behandelt wird.
Einige Gedanken im Indien des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts, zum Beispiel die Lehre Gautama Buddhas (des Agnostikers, der den «Pfad der Erkenntnis» ging) oder der Philosophen aus der Lokayata Schule (die sich der unerbittlichen Überprüfung aller traditionellen Glaubenssätze verschrieben), scheinen vielen kritischen Schriften der führenden Köpfe in der europäischen Aufklärung eher nahe zu stehen als zu widersprechen. Aber wir müssen nicht um jeden Preis entscheiden wollen, ob Gautama Buddha als ein vorauseilendes Mitglied der europäischen Aufklärungsliga anzusehen ist (sein Ehrenname bedeutet in Sanskrit «aufgeklärt»); auch die weit hergeholte These, dass die europäische Aufklärung auf einen aus der Ferne wirkenden Einfluss asiatischen Denkens zurückgehen könnte, müssen wir nicht ernsthaft erwägen. Dass zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlichen Teilen der Welt vergleichbare intellektuelle Auseinandersetzungen stattgefunden haben, ist keine allzu verstörende Erkenntnis. Da bei der Beschäftigung mit ähnlichen Fragen häufig einigermaßen verschiedene Argumente zum Einsatz kommen, könnten uns jedoch womöglich wichtige Anhaltspunkte für das Nachdenken über Gerechtigkeit entgehen, wenn wir uns mit unseren Untersuchungen an regionale Grenzen halten.
Ein interessantes, nicht belangloses Beispiel ist die folgenreiche Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Konzepten von Gerechtigkeit in der frühen indischen Rechtslehre – die Unterscheidung zwischen niti und nyaya. Niti bezeichnet die Korrektheit von Institutionen und Verhalten, während nyaya erfasst, was entsteht und wie es entsteht, und besonders darauf achtet, welches Leben Menschen tatsächlich führen können. Der Unterschied zwischen beiden Konzepten, auf dessen Bedeutung die Einleitung ausführlich eingehen wird, hilft uns, zu begreifen, dass es zwei Arten des Gerechtseins gibt, die verschieden, wenn auch nicht unabhängig voneinander sind, und dass die Idee der Gerechtigkeit beide berücksichtigen muss.*9
Meine zweite klärende Bemerkung bezieht sich darauf, dass die Autoren der Aufklärung sich nicht einstimmig geäußert haben.Vielmehr teilten sich die führenden Philosophen, die das radikale Denken der Aufklärung prägten, in zwei Gruppen, zwischen denen eine substantielle Dichotomie hinsichtlich ihrer Auffassung von Gerechtigkeit bestand (in der Einleitung mehr dazu). Ein Ansatz konzentrierte sich auf das Erkennen vollkommen gerechter sozialer Abmachungen und hielt die Charakterisierung «gerechter Institutionen» für die Haupt- – und oft die einzige kenntlich gemachte – Aufgabe der Theorie der Gerechtigkeit. Diese Theorie wurde auf unterschiedliche Weise in die Idee eines hypothetischen «Gesellschaftsvertrags» eingewoben, im 17. Jahrhundert von Thomas Hobbes und später vor allem von John Locke, Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant vertreten. Die gegenwärtige politische Philosophie ist vorwiegend dem kontraktarischen Ansatz verpflichtet, vor allem seit einer bahnbrechenden, 1958 veröffentlichten Arbeit von John Rawls – «Justice as Fairness» –, die seiner definitiven Entscheidung für diesen Ansatz in seinem klassischen Buch Eine Theorie der Gerechtigkeit vorausging.[4]
Im Gegensatz dazu wählten eine Reihe anderer aufklärerischer Philosophen (zum Beispiel Smith, Condorcet, Wollstonecraft, Bentham, Marx, John Stuart Mill) eine Vielzahl anderer Ansätze, mit denen sie ein gemeinsames Interesse verfolgten: Sie wollten verschiedene Möglichkeiten vergleichen, wie Menschen ihr Leben führen können, Möglichkeiten, die von Institutionen, aber auch tatsächlichen Verhaltensweisen, sozialen Interaktionen und anderen signifikanten Determinanten beeinflusst werden. Mein Buch stützt sich in hohem Maß auf diese alternative Tradition.*10 Die analytische – und ziemlich mathematische – Theorie kollektiver Entscheidungen, deren Anfänge auf Condorcets Arbeiten im achtzehnten Jahrhundert zurückgehen, die aber in ihrer jetzigen Form von Kenneth Arrow um die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelt wurde, gehört zu dieser zweiten Richtung. Entsprechend angepasst, kann die Theorie kollektiver Entscheidungen erheblich dazu beitragen, dass Fragen zur Verbesserung von Gerechtigkeit und zum Ausräumen von Ungerechtigkeit in der Welt geklärt werden.
Der Ort der Vernunft
Bei allen Unterschieden sind sich die beiden Traditionen der Aufklärung – die kontraktarische und die komparative – doch auch in vielen Punkten ähnlich. Dazu gehört das Vertrauen auf vernünftiges Denken und die Forderung nach öffentlicher Diskussion. Auch wenn dieses Buch sich vorwiegend auf die zweite Tradition und nicht auf den kontraktarischen Ansatz Kants und anderer bezieht, verdankt es seinen Antrieb zum guten Teil der elementaren Erkenntnis Kants, die Christine Korsgaard folgendermaßen beschreibt: «Vernunft in die Welt zu bringen, wird zur Aufgabe der Moralität, nicht der Metaphysik, und zur Last wie zur Hoffnung der Menschheit.»[5]
Wie weit vernünftiges Denken eine zuverlässige Basis für eine Theorie der Gerechtigkeit schaffen kann, ist natürlich selbst ein Streitgegenstand. Das erste Kapitel dieses Buchs befasst sich mit der Rolle und Reichweite des Vernunftgebrauchs. Ich widerspreche der Überzeugung, dass man sich für Bewertungen unmittelbar auf Emotionen oder Psychologie oder Instinkte verlassen könne und nicht auf durchdachte Einschätzung angewiesen sei. Impulse und mentale Einstellungen bleiben jedoch wichtig, da wir gute Gründe haben, sie bei unserer Beurteilung von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit der Welt zu berücksichtigen. Hier besteht kein unversöhnlicher Konflikt zwischen Vernunft und Gefühlen, so behaupte ich, und wir haben sehr überzeugende Gründe, die Relevanz von Gefühlen einzuräumen.
Auch aus einer anderen Richtung kommt Kritik an der Zuverlässigkeit vernünftigen Denkens; diese Kritik wird damit begründet, dass Unvernunft die Oberhand in der Welt hat und dass es unrealistisch sei, anzunehmen, die Welt werde sich nach dem Diktat der Vernunft richten. Kwame Anthony Appiah hat in einer freundlichen, aber entschiedenen Kritik an meiner Arbeit auf einem verwandten Gebiet erklärt: «Auch wenn man die Möglichkeiten der Vernunft so weit fasst, wie Sen es gerne tun würde – und das ist ein Projekt, dessen Anspruch ich bewundere –, wird Vernunft uns doch nicht ganz zum Ziel führen. Wenn Sen sich den Blickwinkel der individuellen vernünftigen Person zu eigen macht, muss er die Augen von der alles durchdringenden Unvernunft abwenden.»[6] Appiahs Beschreibung der Welt ist sicherlich zutreffend, und seine Kritik, die sich nicht gegen die Konstruktion einer Theorie der Gerechtigkeit richtet, nennt gute Gründe, warum die praktische Wirkung vernünftiger Diskussionen über verworrene soziale Themen (etwa die Identitätspolitik) mit Skepsis zu betrachten ist. Unvernunft hat Macht und Widerstandsfähigkeit und kann die Wirksamkeit vernunftgeleiteter Antworten auf schwierige Fragen weitgehend blockieren.
Diese besondere Skepsis gegenüber der Reichweite der Vernunft kann und soll (wie Appiah deutlich sagt) jedoch kein Grund gegen den bestmöglichen Vernunftgebrauch sein, wenn es um die Idee der Gerechtigkeit oder eine andere sozial relevante Vorstellung, etwa Identität, geht.*11 Auch unserem Versuch, uns gegenseitig zur kritischen Prüfung unserer jeweiligen Folgerungen zu bewegen, entzieht diese Skepsis nicht den Boden. Wir müssen ebenfalls bedenken, dass nicht immer «Unvernunft» sein mag, was Vertretern anderer Meinungen als klares Beispiel von Unvernunft erscheint.**12 Vernunftgeleitete Diskussionen können widerstreitende Positionen berücksichtigen, die anderen wie «unvernünftige» Vorurteile vorkommen, ohne es immer zu sein. Es besteht kein Zwang, alle vernunftgeleiteten Alternativen außer genau einer auszuschließen – auch wenn das manchmal angenommen wird.
Der springende Punkt hier ist jedoch, dass Vorurteile im typischen Fall Trittbrettfahrer einer Art von Argumentation sind – auch wenn es sich um schwache und willkürliche Argumente handeln mag.Tatsächlich neigen auch sehr dogmatische Personen dazu, Gründe irgendwelcher Art, womöglich sehr grobe, zur Bekräftigung ihrer Dogmen zu präsentieren (hierher gehören rassistische, sexistische, von Klassen- und Kastengeist geprägte Vorurteile und auch andere Spielarten einer auf primitiven Argumenten beruhenden Bigotterie). Unvernunft bedeutet meistens nicht, dass man etwas ohne jede Überlegung tut, sondern dass man sich auf ein sehr primitives und mangelhaftes Denken verlässt. Hier besteht Hoffnung, denn schlechtem Vernunftgebrauch kann mit besserem begegnet werden. Also gibt es Handlungsspielraum für eine vernunftgeleitete Auseinandersetzung, auch wenn viele Menschen sich mindestens anfangs, sogar wenn sie dazu herausgefordert werden, weigern mögen, in die Auseinandersetzung einzutreten.
Nichts, das einer jetzt schon vorhandenen Allgegenwart der Vernunft in jedermanns Denken gleichkäme, ist wichtig für die Argumente in diesem Buch. Eine solche Voraussetzung ist unmöglich und unnötig. Die Behauptung, dass Menschen sich auf ein bestimmtes Vorhaben einigen würden, wenn sie frei und unparteiisch denken könnten, setzt natürlich nicht voraus, dass sie jetzt schon so weit sind oder auch nur sein möchten. Das wichtigste Ziel ist es, zu untersuchen, welche vernünftigen Argumente das Streben nach Gerechtigkeit verlangen würden – dabei muss eingeräumt werden, dass es mehrere verschiedene vernünftige Positionen geben kann. Diese Denkübung ist durchaus verträglich mit der Möglichkeit, sogar der Gewissheit, dass nicht alle zu einer bestimmten Zeit bereit sind, sich auf eine solche kritische Prüfung einzulassen.Vernunftgebrauch ist auch oder besonders in einer Welt voller «Unvernunft» für das Verständnis von Gerechtigkeit entscheidend.
*1 Smiths klassisches Buch The Theory of Moral Sentiments erschien 1759, vor 250 Jahren, und die letzte – die sechste – überarbeitete Fassung wurde 1790 veröffentlicht. In der Einleitung zur Jubiläumsausgabe von 2009 (Penguin Books) kommentiere ich die Besonderheit von Smiths moralischem und politischem Engagement und seine fortdauernde Bedeutung für die Welt von heute.
*2 Isaiah Berlin und Bernard Williams haben sich ausführlich und überzeugend mit der Wichtigkeit der Wertepluralität befasst. Pluralitäten können in einer bestimmten Gemeinschaft bestehen oder sogar in einer einzelnen Person, sie spiegeln nicht zwangsläufig die Werte «verschiedener Gemeinschaften». Jedoch können auch Unterschiede in den Wertvorstellungen von Menschen in verschiedenen Gemeinschaften signifikant sein (vergl. dazu die wichtigen Beiträge von Michael Walzer, Charles Taylor und Michael Sandel).
**3 Karl Marx zum Beispiel erläuterte, dass es sowohl Gründe für die Abschaffung der Ausbeutung der Arbeitskraft (im Zusammenhang mit dem Recht auf das Produkt der eigenen Anstrengung) wie für eine Zuteilung nach dem Maß der Bedürftigkeit (im Zusammenhang mit den Forderungen der Verteilungsgerechtigkeit) gibt. In seinem letzten substantiellen Text, Kritik des Gothaer Programms (1875), erörterte er dann den unvermeidlichen Konflikt zwischen diesen beiden Prioritäten.
*4 Die «Befähigungsperspektive», die seit einiger Zeit genauer untersucht wird, passt genau zu dem Verständnis von Gerechtigkeit, das sich an der Lebensführung und den Freiheiten orientiert, die für Personen tatsächlich erreichbar sind. Siehe Martha Nussbaum und Amartya Sen (Hg.), The Quality of Life (Oxford: Clarendon Press, 1993). Reichweite und Grenzen dieser Perspektive werden in den Kapiteln 11–14 untersucht.
**5 Zum Beispiel hat die «offene Unparteilichkeit» (siehe Kapitel 6), die zulässt, dass sich Stimmen aus der Nähe und auch aus der Ferne zur Gerechtigkeit von Gesetzen äußern (nicht nur aus Gründen der Fairness gegen andere, sondern auch zur Vermeidung von Provinzialismus, wie Adam Smith in Theorie der ethischen Gefühle und in den Vorlesungen über Rechts- und Staatswissenschaften dargelegt hat), unmittelbare Relevanz für einige aktuelle Auseinandersetzungen im Supreme Court der USA; davon handelt das Schlusskapitel (18) dieses Buchs.
*6 Ich hatte das Privileg, auf Einladung des Speakers Somnath Chatterjee am 11. August 2008 vor dem indischen Parlament über «The Demands of Justice» zu sprechen. Der Vortrag war die erste Hiren Mukerjee Memorial Lecture, die in Zukunft jährlich im Parlament gehalten wird. Die ungekürzte Fassung des Vortrags ist in einer vom indischen Parlament veröffentlichten Broschüre zugänglich, und eine gekürzte Version mit dem Titel «What should Keep Us Awake at Night» wurde in The Little Magazine, Bd. 8, Heft 1 und 2 (2009) abgedruckt.
*7 Kautilya, der altindische Autor von Schriften zur politischen Strategie und politischen Ökonomie, gilt, wenn er überhaupt wahrgenommen wird, gelegentlich als «der indische Machiavelli». Das ist in mancher Hinsicht nicht überraschend, da beider Ideen über Strategie und Taktik gewisse Ähnlichkeiten aufweisen (trotz profunder Unterschiede in vielen anderen – oft wichtigeren – Bereichen), aber amüsant ist, dass ein indischer Theoretiker der politischen Strategie aus dem vierten vorchristlichen Jahrhundert als Lokalversion eines im fünfzehnten nachchristlichen Jahrhundert geborenen europäischen Autors präsentiert werden muss. Darin kommt selbstverständlich keinerlei plumpe Behauptung über eine geographische Hackordnung zum Vorschein, sondern nur die Tatsache, dass westliche Intellektuelle (und dank der globalen Dominanz westlicher Bildung Intellektuelle in der heutigen Welt überhaupt) kaum mit nicht-westlicher Literatur vertraut sind.
**8 In meinem Buch The Argumentative Indian (London und Delhi: Penguin; New York: FSG, 2005) habe ich die These vertreten, dass es keine durch und durch östlichen, auch keine durch und durch indischen Prioritäten gibt, da in der Geistesgeschichte dieser Länder Argumente sehr unterschiedlicher Denkrichtungen zu finden sind.
*9 Die Unterscheidung zwischen nyaya und niti hat nicht nur innerhalb eines Staates, sondern über Staatsgrenzen hinweg Bedeutung; siehe dazu meinen Vortrag «Global Justice», den ich auf dem World Justice Forum in Wien im Juli 2008 gehalten habe; Sponsoren dieses Forums waren die American Bar Association, die International Bar Association, Inter-American Bar Association, Inter-Pacific Bar Association und Union Internationale des Avocats. Er gehört zum «World Justice Program» der American Bar Association und wurde in Global Perspectives on the Rule of Law, hg. v. James J. Heckman, Robert L. Nelson, Lee Cabatingan (New York: Routledge, 2009) veröffentlicht.
*10 Das wird mich jedoch nicht davon abhalten, auch Erkenntnisse des ersten Ansatzes zu nutzen und von der Aufklärungsarbeit zu profitieren, die die Werke von Hobbes und Kant sowie – in unserer Zeit – von John Rawls leisten.
*11 Tatsächlich gibt es überzeugende Beweise dafür, dass interaktive öffentliche Diskussionen helfen können, den Widerstand gegen die Vernunft zu schwächen. Siehe das empirische Material dazu in Development as Freedom (New York: Knopf, und Oxford: Clarendon Press, 1999) [Ökonomie für den Menschen, übersetzt von Christiana Goldmann (München: Hanser, 2000)] und Identity and Violence: The Illusion of Destiny (New York: Norton, und London: Penguin, 2006) [Die Identitätsfalle, übers. von Friedrich Griese, München: C.H.Beck, 2007].
**12 James Thurber stellte fest, dass abergläubische Menschen vielleicht nicht unter Leitern durchgehen mögen, während wissenschaftliche Geister, die «sich dem Aberglauben widersetzen», vielleicht eigens «nach Leitern Ausschau halten und mit Vergnügen unter ihnen durchgehen». Aber «wenn Sie lange genug nach Leitern suchen und unter ihnen durchgehen, wird Ihnen ein Unglück zustoßen.» (James Thurber, «Let Your Mind Alone!» New Yorker, 1. Mai 1937).
DANKSAGUNG
Mein Dank für die Hilfe bei der Arbeit am hier vorgelegten Buch gilt in erster Linie John Rawls, der mich dazu angeregt hat, auf diesem Gebiet zu forschen. Er war mir über Jahrzehnte hinweg ein wunderbarer Lehrer, und seine Ideen wirken immer noch in mir nach, auch wenn ich mit einigen seiner Folgerungen nicht einverstanden bin. Dieses Buch ist seinem Andenken gewidmet, nicht nur, weil ich viel von ihm gelernt habe und für seine Freundschaft dankbar bin, sondern auch, weil er mich ermutigt hat, meinen Zweifeln nachzugehen.
Ich habe Rawls kennen gelernt, als ich 1968–69 von der Universität Delhi als Gastprofessor an die Universität Harvard kam und gemeinsam mit ihm und Kenneth Arrow ein Seminar hielt. Arrow hatte ebenfalls großen Einfluss auf dieses Buch und viele meiner früheren Arbeiten. Prägend waren nicht nur ausführliche Diskussionen über Jahrzehnte hin, sondern ich ziehe auch Nutzen aus der analytischen Form der modernen Theorie kollektiver Entscheidungen, die er begründet hat.
Das Buch, das ich hier vorlege, entstand in Harvard, meinem Hauptwohnsitz seit 1987, und am Trinity College in Cambridge, vor allem in den sechs Jahren zwischen 1998 und 2004, als ich dorthin zurückging – als Master des wunderbaren College, an dem ich fünfzig Jahre vorher angefangen hatte, über philosophische Fragen nachzudenken. Damals stand ich besonders unter dem Einfluss von Piero Sraffa und C. D. Broad, und Maurice Dobb und Dennis Robertson machten mir Mut, meinen Neigungen zu folgen.
Dieses Buch kam nur langsam zustande, weil sich meine Zweifel und konstruktiven Gedanken nur sehr allmählich herausschälten. In diesen Jahrzehnten hatte ich das Glück, von vielen Menschen Kommentare, Vorschläge, Fragen, Kritik und Ermutigung zu hören, die alle sehr nützlich für mich waren, und die Liste derer, denen ich Dank schulde, ist nicht kurz.
Zuerst gilt mein Dank für Hilfe und Rat meiner Frau Emma Rothschild, deren Einfluss im ganzen Buch spürbar ist.Wie sehr Bernard Williams mein Denken in philosophischen Fragen geprägt hat, wird den Lesern deutlich sein, die mit seinen Schriften vertraut sind. Sein Einfluss ergab sich über viele Jahre hin im «Plausch unter Freunden» und auch aus einer produktiven Phase, in der wir gemeinsam eine Aufsatzsammlung über die utilitaristische Sicht und ihre Grenzen planten, herausgaben und einführten (Utilitarianism and Beyond, 1982).
Zu meinem Glück hatte ich Kollegen, die mit mir instruktive Gespräche über politische und Moralphilosophie führten. Großen Dank für viele erhellende Gespräche schulde ich außer Rawls auch Hilary Putnam und Thomas Scanlon.Viel gelernt habe ich auch in Unterhaltungen mit W. V. O. Quine und Robert Nozick, die leider beide nicht mehr leben. Gemeinsam mit Kollegen Kurse zu geben war ebenfalls eine ständige dialektische Schulung durch meine Studenten und natürlich auch meine Mit-Dozenten. Robert Nozick und ich haben fast ein Jahrzehnt lang jedes Jahr einen gemeinsamen Kurs gegeben, mehrmals zusammen mit Eric Maskin, und beide haben mein Denken beeinflusst. Mehrmals habe ich auch gemeinsam mit Joshua Cohen (vom nicht so weit entfernten Massachusetts Institute of Technology), Christine Jolls, Philippe Van Parijs, Michael Sandel, John Rawls, Thomas Scanlon und Richard Tuck unterrichtet und mit Kaushik Basu und James Foster, wenn sie zu Gast in Harvard waren. Diese gemeinsamen Kurse waren eine reine Freude und außerdem noch sehr nützlich für mich, da ich meine Ideen, oft in Streitgesprächen mit meinen Mit-Dozenten, weiter entwickeln konnte.
Alles, was ich schreibe, profitiert von der Kritik meiner Studenten, und dies Buch ist keine Ausnahme. Besonders dankbar bin ich für die Dialoge mit Prasanta Pattanaik, Kaushik Basu, Siddiqur Osmani, Rajat Deb, Ben Fine, Ravi Kanbur, David Kelsey und Andreas Papandreou, viele Jahrzehnte lang und später dann mit Stephan Klasen, Anthony Laden, Sanjay Reddy, Jonathan Cohen, Felicia Knaul, Clemens Puppe, Bertil Tungodden, A. K. Shiva Kumar, Lawrence Hamilton, Douglas Hicks, Jennifer Prah Ruger, Sousan Abadian und anderen. Fruchtbar waren auch Diskussionen über andere, aber verwandte Themen mit meinen Studenten, unter anderen Sourin Bhattacharya, Luigi Spaventa, meine erste studentische Hilfskraft, D. P. Chandhuri, Kanchan Chopra, Luca d’Agliano, John Wriglesworth,Yasumi Matsumoto, Martin Sandbu, Madoka Saito, Rama Mani, Eoghan Stafford, Nirvikar Singh und Jonathan Riley.
Die Freuden und Vorteile der Lehre reichen für mich zurück bis in die 1970er und 1980er, als ich in Oxford gemeinsam mit Ronald Dworkin und Derek Parfit, später auch mit G. A. Cohen Kurse gab – wild gestritten hätten wir, erzählte mir ein Student. Meine angenehmen Erinnerungen an diese streitlustigen Diskussionen wurden vor kurzem lebhaft aufgefrischt, als Cohen in seiner Liebenswürdigkeit im Januar 2009 am University College London ein faszinierendes Seminar über das Hauptthema dieses Buchs organisierte. Erfreulich viele Teilnehmer waren nicht einer Meinung mit mir, Cohen (natürlich) gehörte dazu, aber auch Jonathan Wolff, Laura Valentis, Riz Mokal, George Letsas und Stephen Guest, deren Kritik aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehr hilfreich für mich war (Laura Valentis war so freundlich, mir nach dem Seminar noch zusätzliche Kommentare zu schicken).
Auch wenn eine Theorie der Gerechtigkeit in erster Linie zur Philosophie gehören muss, benutzt dieses Buch doch außerdem Ideen aus einer ganzen Reihe anderer Disziplinen. Eine Quelle, aus der ich viel geschöpft habe, ist die Theorie kollektiver Entscheidungen. Meine Interaktionen mit anderen, die in diesem weiten Feld arbeiten, sind zu zahlreich, als dass ich sie hier in einer kurzen Aufzählung abhandeln könnte, aber den Nutzen, den ich aus der Zusammenarbeit mit Kenneth Arrow und Kotaro Suzumura gezogen habe – wir sind die Herausgeber des Handbook of Social Choice Theory, der erste Band ist erschienen und der zweite überfällig –, möchte ich doch besonders erwähnen, und ich möchte betonen, wie hoch ich die Arbeit und die Führungsrolle von Jerry Kelly,Wulf Gaertner, Prasanta Pattanaik und Maurice Salles auf diesem Gebiet schätze – vor allem ihre visionäre Kraft und ihren unermüdlichen Einsatz für die Zeitschrift Social Choice and Welfare. Dank schulde ich auch Patrick Suppes, John Harsanyi, James Mirrlees, Anthony Atkinson, Peter Hammond, Charles Blackorby, Tapas Majumdar, Robert Pollak, Kevin Roberts, John Roemer, Anthony Shorrocks, Robert Sugden, John Weymark und James Foster für den Gewinn, den ich aus meiner langen Verbindung und ausführlichen Diskussionen mit ihnen über Social-choice-Probleme in der einen oder andere Form ziehen konnte.
Anhaltenden Einfluss auf mein Denken über Gerechtigkeit, vor allem im Zusammenhang mit Freiheit und Befähigung, hatte Martha Nussbaum. Ihre Arbeit, verbunden mit ihrem hohen Engagement für die Entwicklung der «Befähigungsperspektive», hat viel zu den Fortschritten beigetragen, die in der letzten Zeit auf diesem Gebiet erreicht wurden; dazu gehören Schriften über die Verbindung zwischen dieser Perspektive und den klassischen Aristotelischen Ideen der «Fähigkeit» und des «gelungenen Lebens» oder «Wohlergehens», und Arbeiten, die den Capability-Aspekt in Zusammenhang mit der menschlichen Entwicklung, mit Genderstudies und Menschenrechten bringen.
Die Relevanz und die Anwendung der Befähigungsperspektive wird seit einigen Jahren von einer Gruppe hochqualifizierter Forscher untersucht. Ihre Schriften haben mich stark beeinflusst, aber sie alle namentlich zu nennen, würde den Rahmen dieser Danksagung sprengen. Wenigstens einige muss ich erwähnen: Sabina Alkire, Bina Agarwal,Tania Burchardt, Enrica Chiappero-Martinetti, Flavio Comim, David Crocker, Séverine Deneulin, Sakiko Fukuda-Parr, Reiko Gotoh, Mozaffar Qizilbash, Ingrid Robeyns und Polly Vizard. Ein enger Zusammenhang besteht auch zwischen der Befähigungsperspektive und dem neuen Arbeitsgebiet «menschliche Entwicklung», das mein verstorbener Freund Mahbub un Haq eröffnet hat und das Paul Streeten, Frances Stewart, Keith Griffin, Gustav Ranis, Richard Jolly, Meghnad Desai, Sudhir Anand, Sakiko Fukuda-Parr, Selim Jahan und andere ausbauen. Die Zeitschrift Journal of Human Development and Capabilities ist hier besonders zu nennen, aber auch Feminist Economics hat großes Interesse an diesem Gebiet, und Gespräche mit ihrer Herausgeberin Diana Strassmann über die Beziehung zwischen der feministischen Sicht und dem Befähigungsansatz waren für mich immer anregend.
Am Trinity College war ich in Gesellschaft exzellenter Philosophen, Juristen und anderer an Rechtsproblemen Interessierter und hatte Gelegenheit zu Gesprächen mit Garry Runciman, Nick Denyer, Gisela Striker, Simon Blackburn, Catharine Barnard, Joanna Miles, Ananya Kabir, Eric Nelson und ab und zu mit Ian Hacking (der manchmal an sein altes College zurückkam, wo wir uns in den 1950ern als Studenten kennen gelernt und miteinander diskutiert hatten). Ich hatte auch die wunderbare Möglichkeit, mit hervorragenden Mathematikern, Naturwissenschaftlern, Historikern, Rechtstheoretikern und Humanwissenschaftlern zu sprechen.
Viel gewonnen habe ich aus Gesprächen mit etlichen anderen Philosophen, unter anderem (zusätzlich zu den schon Erwähnten) mit Elizabeth Anderson, Kwame Anthony Appiah, Christian Barry, Charles Beitz, Isaiah Berlin, der verstorben ist, mit Akeel Bilgrami, Hilary Bok, Sissela Bok, Susan Brison, John Broome, Ian Carter, Nancy Cartwright, Deen Chatterjee, Drucilla Cornell, Norman Daniels, Donald Davidson, der nicht mehr lebt, John Davis, Jon Elster, Barbara Fried, Allan Gibbard, Jonathan Glover, James Griffin, Amy Gutmann, Moshe Halbertal, dem verstorbenen Richard Hare, Daniel Hausman,Ted Honderich, Susan Hurley, die nicht mehr lebt, Susan James, Frances Kamm, dem verstorbenen Stig Kanger, Erin Kelly, Isaac Levi, Christian List, Sebastiano Maffetone, Avishai Margalit, Alastair Mc-Leod, David Miller, dem verstorbenen Sidney Morgenbesser, mit Thomas Nagel, Carol Nicholson, Sari Nusseibeh, der verstorbenen Susan Moller Okin, Charles Parsons, Herlinde Pauer-Struder, Fabienne Peter, Philip Pettit, Thomas Pogge, Henry Richardson, Alan Ryan, Carol Rovane, Debra Satz, John Searle, mit Judith Shklar, die nicht mehr lebt, Quentin Skinner, Hillel Steiner, Dennis Thompson, Charles Taylor und Judith Thomson.
In Rechtsfragen habe ich viel profitiert von Diskussionen mit Bruce Ackerman, Justice Stephen Breyer, Owen Fiss, Herbert Hart, Tony Honoré, Anthony Lewis, Frank Michelman, Martha Minow, Robert Nelson, Justice Kate O’Regan, Joseph Raz, Susan Rose-Ackerman, Stephen Sedley, Cass Sunstein und Jeremy Waldron. Genau genommen waren die Dewey Lectures (über «Well-Being, Agency and Freedom»), die ich 1984 im Fachbereich Philosophie der Universität Columbia hielt, der Beginn der Arbeit an diesem Buch, und sie kamen mit einer Reihe Philosophievorlesungen (über «Justice») an der Universität Stanford zum Abschluss, aber ich habe meine Argumente zu Theorien der Gerechtigkeit auch an verschiedenen Law Schools getestet. Mehrere Vorlesungen und Seminare an den Law Schools von Harvard,Yale und der Universität Washington gaben mir dazu Gelegenheit, und außerdem hielt ich im September 1990 die Storrs Lectures (über «Objectivity») an der Yale Law School, im September 1998 die Rosenthal Lectures (über «The Domain of Justice») an der Law School der Northwestern Universität und im September 2005 an der Cardozo Law School eine Vorlesung über «Human Rights and the Limits of Law».*1
In der Ökonomie, auf die ich mich in meinem Werdegang zunächst konzentrierte und die erhebliche Bedeutung für die Idee der Gerechtigkeit hat, habe ich viel gelernt aus regelmäßigen Diskussionen in vielen Jahrzehnten mit George Akerlof, Paul Anand, Amiya Bagchi, dem verstorbenen Dipak Banerjee, Nirmala Banerjee, Pranab Bardhan, Alok Bhargava, Christopher Bliss, Samuel Bowles, Samuel Brittan, Robert Cassen, dem verstorbenen Sukhamoy Chakravarty, Partha Dasgupta, Mrinal Datta-Chaudhuri, Angus Deaton, Meghnad Desai, Jean Drèze, Bhaskar Dutta, Jean-Paul Fitoussi, Nancy Folbre, Albert Hirschman, Devaki Jain, Jocelyn Kynch,Tapas Majumdar, Mukul Majumdar, Stephen Marglin, Dipak Mazumdar, Mamta Murthi, Luigi Pasinetti, dem verstorbenen I. G. Patel, der verstorbenen Surendra Patel, Edmund Phelps, K. N. Raj,V. K. Ramachandran, Jeffrey Sachs, Arjun Sengupta, Rehman Sobhan, Barbara Solow, Robert Solow, Nicholas Stern, Joseph Stiglitz und Stefano Zamagni.
Sehr hilfreich waren auch die Gespräche mit Isher Ahluwalia, Montek Ahluwalia, dem verstorbenen Peter Bauer, Abhijit Banerjee, Lourdes Beneria, Timothy Besley, Ken Binmore, Nancy Birdsall, Walter Bossert, François Bourguignon, Satya Chakravarty, Kanchan Chopra, Vincent Crawford, Asim Dasgupta, Claude d’Aspremont, Peter Diamond, Avinash Dixit, David Donaldson, Esther Duflo, Franklin Fisher, Marc Fleurbaey, Robert Frank, Benjamin Friedman, Pierangelo Garegnani, Louis Gevers und W. M. Gorman, die nicht mehr leben, Jan Graaff, Jean-Michel Grandmont, Jerry Green, Ted Groves, Frank Hahn, Wahidul Haque, Christopher Harris, Barbara Harris White, dem verstorbenen John Harsanyi, James Heckman, Judith Heyer, dem verstorbenen John Hicks, Jane Humphries, Nurul Islam, Rizwanul Islam, Dale Jorgenson, Daniel Kahneman, Azizur Rahman Khan, Qaiser Khan, Alan Kirman, Serge Kolm, Janos Kornai, Michael Kramer, dem verstorbenen Jean-Jacques Laffont, Richard Layard, Michel Le Breton, Ian Little, Anuradha Luther, dem verstorbenen James Meade, John Muellbauer, Philippe Mongin, Dilip Mookerjee, Anjan Mukherji, Khaleq Naqvi, Deepak Nayyar, Rohini Nayyar, Mahesh Patel, Thomas Piketty, Robert Pollak, Anisur Rahman, Debraj Ray, Martin Ravallion, Alvin Roth, Christian Seidl, Luigi Spaventa, Michael Spence, T. N. Srinivasan, David Starrett, S. Subramanian, Kotaro Suzumura, Madhura Swaminathan, Judith Tendler, Jean Tirole, Alain Trannoy, John Vickers, William Vickrey, Jorgen Weibull, Glen Weyl und Menahem Yaari.
Sehr gewinnbringend waren auch Gespräche über andere, eng mit der Gerechtigkeit zusammenhängende Themen, die ich über Jahre hinweg geführt habe mit Krishna Ahooja-Patel, Jasodhara Bagchi, Alaka Basu, Dilip Basu, Seyla Benhabib, Sugata Bose, Myra Buvinic, Lincoln Chen, Martha Chen, David Crocker, Barun De, John Dunn, Julio Frenk, Sakiko Fukuda-Parr, Ramachandra Guha, Geeta Rao Gupta, Geoffrey Hawthorn, Eric Hobsbawm, Jennifer Hochschild, Stanley Hoffmann, Alisha Holland, Richard Horton, Ayesha Jalal, Felicia Knaul, Melissa Lane, Mary Kaldor, Jane Mansbridge, Michael Marmot, Barry Mazur, Pratap Bhanu Mehta, Uday Mehta, Ralph Miliband, der nicht mehr lebt, Christopher Murray, Elinor Ostrom, Carol Richards, David Richards, Jonathan Riley, Mary Robinson, Elaine Scarry, Gareth Stedman Jones, Irene Tinker, Megan Vaughan, Dorothy Wedderburn, Leon Wieseltier und James Wolfensohn. Der Teil des Buches, der von Demokratie in ihrer Beziehung zur Gerechtigkeit handelt (Kapitel 15–17), geht auf meine drei Vorlesungen über «Democracy» an der School of Advanced International Studies (SAIS) der Johns Hopkins Universität auf ihrem Campus in Washington DC zurück, die ich 2005 gehalten habe. Diese Vorlesungen waren Resultat einer von Francis Fukuyma unterstützten Initiative Sunil Khilnanis; von beiden habe ich sehr nützliche Vorschläge erhalten. Die Vorlesungen führten zu anderen Diskussionen auf den SAIS-Zusammenkünften, die ebenfalls sehr nützlich für mich waren.
Das neue Harvard «Program on Justice,Welfare and Economics», dessen Leiter ich fünf Jahre lang war, vom Januar 2004 bis Dezember 2008, verschaffte mir wiederum eine wunderbare Gelegenheit zum Meinungsaustausch mit Studenten und Kollegen, die an ähnlichen Problemen auf anderen Gebieten interessiert sind. Der neue Programmdirektor Walter Johnson führt diesen Austausch fort und erweitert ihn, und ich habe mir erlaubt, der Gruppe in meinem Abschiedsvortrag zu schildern, worum es mir in diesem Buch geht; daraufhin hörte ich viele ausgezeichnete Fragen und Kommentare.
Erin Kelly und Thomas Scanlon haben große Teile des Manuskripts gelesen und eine Reihe von Vorschlägen gemacht, die außerordentlich wichtig waren. Ich bin ihnen sehr dankbar für ihre Hilfe. Auch hatte ich das große Glück, mehrere Jahrzehnte lang mit Sudhir Anand zusammenzuarbeiten; aus den regelmäßigen Diskussionen, die ich mit ihm über Themen dieses Buches führte, habe ich viel für mein Verständnis der Forderungen der Gerechtigkeit gewonnen.
Die Kosten für Forschung und Assistenten wurden zum Teil von einem Fünfjahresprojekt über Demokratie übernommen, das am Centre for History and Economics des Kings College, Cambridge, durchgeführt wird, dazu kamen in den Jahren 2003–2008 Gelder von der Ford Foundation, der Rockefeller Foundation und der Mellow Foundation und anschließend aus einem neuen von der Ford Foundation unterstützten Projekt «India in the Global World», das sich besonders auf die Relevanz der indischen Geistesgeschichte für gegenwärtige Fragen konzentriert. Für diese Unterstützung bin ich sehr dankbar und voller Anerkennung für die hervorragende Arbeit Inga Huld Markans, die diese Projekte koordiniert hat. Ich hatte auch das Glück, mit außergewöhnlich fähigen und einfallsreichen Forschungsassistenten zu arbeiten, die hohes Interesse an dem Buch entwickelt haben und zahlreiche sehr produktive Kommentare gaben, die mir halfen, meine Argumente und ihre Darlegung zu verbessern. Großen Dank schulde ich Pedro Ramos Pintos, der über ein Jahr mit mir gearbeitet und bleibenden Einfluss auf das Buch genommen hat, sowie Kirsty Walker und Afsan Bhadelia, die jetzt mit mir arbeiten, für ihre hervorragende Hilfe und ihren intellektuellen Einfluss.
Die Originalausgabe dieses Buches wurde von Penguin und für Nordamerika von Harvard University Press veröffentlicht. Michael Aronson, mein Lektor bei Harvard, hat eine Reihe exzellenter allgemeiner Vorschläge gemacht. Die beiden anonymen Gutachter des Manuskripts gaben bemerkenswert hilfreiche Kommentare, und da ich mit Detektivarbeit herausgefunden habe, dass es Frank Lovett und Bill Talbott waren, kann ich ihnen sogar namentlich danken.
Meine Dankbarkeit für die Arbeit Stuart Proffitts von Peguin Books kann ich kaum in Worte fassen; er hat zu jedem Kapitel – praktisch zu jeder Seite des Buchs – unschätzbare Kommentare gegeben und Vorschläge gemacht und mich dazu gebracht, viele Abschnitte des Manuskripts umzuschreiben, damit sie klarer und verständlicher werden. Auch sein Rat zur generellen Anordnung des Buchs war unentbehrlich. Ich kann mir gut vorstellen, wie erleichtert er gewesen sein muss, als er dieses Buch endlich aus der Hand geben konnte.
Amartya Sen
*1 Die Dewey Lectures wurden hauptsächlich von Isaac Levi arrangiert, die Storrs Lectures von Guido Calabresi, die Rosenthal Lectures von Ronald Allan und die Rosenthal Lecture von David Rudenstine. Die Diskussionen mit ihnen und ihren Kollegen waren ein großer Gewinn für mich.
EINLEITUNG
Ein Zugang zur Gerechtigkeit
Ungefähr zweieinhalb Monate vor dem Sturm auf die Bastille in Paris, mit dem die Französische Revolution begann, sagte Edmund Burke im Parlament in London: «Es ist ein Ereignis eingetreten, über das man kaum sprechen und unmöglich schweigen kann.» Das war am 5. Mai 1789. Burkes Rede hatte nicht viel mit dem aufkommenden Sturm in Frankreich zu tun. Ihr Anlass war ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs gegen Warren Hastings, den Generalgouverneur der britischen East India Company, die seit ihrem Sieg in der Schlacht bei Plassey (am 23. Juni 1757) britische Herrschaft und britisches Recht in Indien durchsetzte. In seiner Anklage gegen Warren Hastings berief sich Burke auf die «immergültigen Gesetze der Gerechtigkeit», die der Gouverneur «gebrochen» habe. Die Unmöglichkeit zu schweigen ist in vielen Fällen zu beobachten, wenn uns eine offenkundige Ungerechtigkeit so aufbringt, dass wir unseren Zorn kaum in Worte fassen können. Und doch verlangt jede Analyse der Ungerechtigkeit auch eine klare Sprache und eine genau durchdachte Überprüfung.
Burke schien allerdings nicht gerade um Worte verlegen: Er zählte beredt nicht ein einzelnes Vergehen, sondern eine große Menge Missetaten von Hastings auf und präsentierte anschließend eine Reihe ganz verschiedener Gründe gleichzeitig, die alle zeigen sollten, dass es notwendig war, Klage zu erheben gegen Warren Hastings und gegen die Art, wie sich die britische Herrschaft in Indien entfaltete.
Ich klage Warren Hastings an, schwere Vergehen und Verbrechen begangen zu haben.
Ich klage ihn an im Namen der im Unterhaus versammelten Abgeordneten Großbritanniens, deren Vertrauen er missbraucht hat.
Ich klage ihn an im Namen aller Bürgerlichen Großbritanniens, dessen Nationalcharakter er entehrt hat.
Ich klage ihn an im Namen des Volkes von Indien, dessen Gesetze, Rechte und Freiheiten er zerrüttet, dessen Besitz er zerstört, dessen Land er verwüstet und ausgedörrt hat.
Ich klage ihn an namens und kraft der immergültigen Gesetze der Gerechtigkeit, gegen die er verstoßen hat.
Ich klage ihn an im Namen der menschlichen Natur selbst, die er in beiden Geschlechtern, allen Altersstufen, Ständen, Lebenslagen und Lebensverhältnissen grausam gekränkt, verletzt und unterdrückt hat.[1]
Kein Anklagepunkt wird hier als der eine schlagkräftige, entscheidende Grund für eine Amtsenthebung von Warren Hastings hervorgehoben. Vielmehr präsentiert Burke eine Sammlung unterschiedlicher, klar voneinander getrennter Gründe.*1 Auf dieses Verfahren der «Mehrfachbegründung», die Methode, die ein ganzes Bündel verschiedener Argumente für eine Verurteilung einsetzt, ohne eine Verständigung über die Rangordnung ihrer Überzeugungskraft anzustreben, werde ich noch zurückkommen. Es geht mir dabei um die Frage, ob wir uns auf eine einzige Richtlinie für Missbilligung geeinigt haben müssen, damit wir zum vernünftigen Konsens kommen, wenn es um die Diagnose eines Unrechts geht, das dringend der Korrektur bedarf. Vorläufig ist es wichtig – und zentral für die Idee der Gerechtigkeit –, festzuhalten, dass wir etwas auf sehr unterschiedlichen Grundlagen als eindeutig ungerecht empfinden können und trotzdem nicht einen bestimmten besonderen Grund einhellig als das durchschlagende Argument für die Diagnose verstehen.
Unmittelbarer deutlich wird diese allgemeine Feststellung vielleicht an einem Beispiel aus jüngster Zeit, aus dem Jahr 2003, als die US-Regierung die Entscheidung traf, den Irak mit Truppen zu überziehen. Solche Entscheidungen kann man auf verschiedene Weisen beurteilen, aber der springende Punkt hier ist, dass der Möglichkeit nach eine ganze Reihe unterschiedlicher, divergierender Argumente zum selben Schluss führen können – in diesem Fall zu der Überzeugung, dass die Koalition unter Führung der Vereinigten Staaten eine falsche Politik verfolgte, als sie den Krieg im Irak anfing.
Sehen wir uns die unterschiedlichen, jeweils sehr überzeugenden Argumente an, mit denen die Entscheidung für die Irak-Invasion kritisiert wurde.*2 Erstens kann man die Invasion als einen Fehler verurteilen, weil man es für notwendig hält, dass eine globalere Einigung, vor allem mittels der Vereinten Nationen, erzielt wird, bevor ein Land seine Armee rechtmäßig in ein anderes Land einmarschieren lassen kann. Ein zweites Argument könnte sich darauf konzentrieren, dass derartige militärische Entscheidungen, die zwangsläufig viele Menschen der Gefahr aussetzen, Gesundheit, Land und Leben zu verlieren, erst getroffen werden sollten, nachdem genaue Informationen über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Massenvernichtungswaffen im Irak eingeholt wurden. Ein drittes Argument kann sich auf die Demokratie als «government by discussion» berufen (die bekannte Formulierung, die oft John Stuart Mill zugeschrieben wird, aber vorher schon von Walter Bagehot verwendet wurde) und hervorheben, dass die verzerrten Informationen und bewusst falschen Behauptungen, zum Beispiel über die angebliche Verbindung Saddam Husseins mit den Anschlägen vom 11. September oder mit Al Qaida, die dem US-amerikanischen Publikum zugemutet wurden, politische Bedeutung haben, da sie es den Bürgern Amerikas erschwerten, die Kriegserklärung der Regierung richtig einzuschätzen. Ein viertes Argument schließlich könnte keinen dieser drei Kritikpunkte, sondern vielmehr die Folgen der Intervention für das entscheidende Kriterium halten: Würde sie Ruhe und Ordnung in das besetzte Land bringen, und hätte man erwarten können, dass sie die Gefahr von globaler Gewalt und globalem Terrorismus verringern und nicht verstärken würde?
Alle diese Überlegungen sind ernst zu nehmen, und sie verbinden sich mit sehr verschiedenen Bewertungskriterien, von denen keines leichter Hand als unwichtig oder belanglos für die Einschätzung von derartigen Handlungen abgewiesen werden kann. Und im Allgemeinen führen sie vielleicht nicht zum selben Ergebnis. Aber wenn sich, wie in unserem Beispiel, zeigt, dass alle brauchbaren Kriterien die gleiche Diagnose eines schwerwiegenden Fehlers ergeben, dann ist dieses spezifische Ergebnis nicht darauf angewiesen, dass eine Rangfolge der Bewertungskriterien festgelegt wird. Um nützliche, robuste Beschlüsse über Handlungen zur Korrektur zu fassen, braucht man keine willkürliche Reduktion vielfältiger und potentiell widersprüchlicher Prinzipien, bis nur noch ein einziges übrig bleibt, das alle anderen Bewertungskriterien annulliert. Das gilt für die Theorie der Gerechtigkeit ebenso wie für jedes andere Teilgebiet der praktischen Vernunft.
Vernunftgebrauch und Gerechtigkeit
Eine Theorie der Gerechtigkeit ist notwendig, wenn es um die durchdachte Auseinandersetzung mit einem Thema geht, über das man, wie Burke sagte, kaum sprechen kann. Manchmal wird behauptet, dass Gerechtigkeit gar nichts mit vernünftiger Argumentation zu tun hat, sondern vielmehr mit einer angemessenen Sensibilität und dem richtigen Gespür für Ungerechtigkeit. Es ist verlockend, in dieser Richtung zu denken. Wenn wir zum Beispiel auf eine Hungersnot stoßen, scheint es natürlich zu sein, dagegen zu protestieren, statt komplizierte Überlegungen über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit anzustellen. Und doch wäre eine Katastrophe nur dann ein Fall von Ungerechtigkeit, wenn sie hätte verhindert werden können, vor allem dann, wenn die Zuständigen versäumt hätten, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Logisches Denken in der einen oder anderen Form ist unvermeidlich, wenn man von der Beobachtung einer Tragödie zur Diagnose einer Ungerechtigkeit kommen will. Darüber hinaus sind Fälle von Ungerechtigkeit womöglich viel komplexer und subtiler als die Bewertung einer sichtbaren Katastrophe. Unterschiedliche, zu disparaten Schlüssen führende Argumente könnten auftauchen, und Evaluierungen von Gerechtigkeit könnten alles andere als geradlinig sein.
Oft sind nicht empörte Protestierer, sondern gelassene Hüter von Recht und Ordnung daran interessiert, vernünftige Begründungen zu vermeiden. Die Geschichte zeigt, dass Regierende, die unsicher hinsichtlich der Beweggründe ihrer Handlungen waren oder nicht bereit, die Grundlage ihrer Politik genau zu prüfen, immer gern Zurückhaltung geübt haben. Berühmt ist der Rat, den Lord Mansfield, ein mächtiger englischer Richter aus dem 18. Jahrhundert, dem neu ernannten Gouverneur einer Kolonie gab: «Überlegen Sie, was Ihrer Meinung nach die Gerechtigkeit fördert, und handeln Sie dementsprechend. Aber begründen Sie es nie, denn Ihr Urteil wird vermutlich richtig sein, aber Ihre Gründe sicherlich falsch.»[2] Das mag ein guter Rat für taktvolles Regieren sein, aber eine Garantie, dass das Richtige getan wird, ist es ganz sicher nicht. Es verhilft den Betroffenen auch nicht zur Einsicht, dass Gerechtigkeit geübt wird (und dies ist, wie ich später erörtern will, Teil des Unternehmens, Entscheidungen über Gerechtigkeit nachhaltig zu machen).
Zu den Erfordernissen einer Theorie der Gerechtigkeit gehört es, für die Diagnose von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit die Vernunft ins Spiel zu bringen. Seit Jahrhunderten versuchen in unterschiedlichen Teilen der Welt Verfasser von Schriften über die Gerechtigkeit, das intellektuelle Fundament zu schaffen, auf dem sich das Denken von einem allgemeinen Gerechtigkeitssinn zu spezifischen vernünftigen Diagnosen von Ungerechtigkeit und zur Analyse von Wegen zur Förderung der Gerechtigkeit weiterbewegen kann. Überall auf der Welt gibt es lange – und überraschende – Traditionen des Nachdenkens über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, aus denen erhellende Anregungen für die Begründung der Gerechtigkeit zu gewinnen sind; im Folgenden sollen sie geprüft werden.
Die Aufklärung und eine grundsätzliche Divergenz
Auch wenn soziale Gerechtigkeit schon seit sehr langer Zeit in der Diskussion ist, hat das Thema während der Europäischen Aufklärung im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert, angeregt durch das politische Klima der Veränderung und auch durch den sozialen und wirtschaftlichen Wandel in Europa und Amerika, besonderen Aufschwung genommen. Die führenden dem radikalen Denken des Zeitalters verbundenen Philosophen, die sich mit der Gerechtigkeit befassen, vertreten zwei grundsätzliche und divergierende Denkrichtungen. Der Unterschied zwischen ihnen ist weit weniger beachtet worden, als er verdient, glaube ich. Ich werde mit dieser Dichotomie beginnen, weil die spezifische Auffassung von der Theorie der Gerechtigkeit, die ich in diesem Buch vorstellen möchte, auf ihrem Hintergrund besser verständlich werden kann.
Ein Denkansatz, den im siebzehnten Jahrhundert Thomas Hobbes entwickelte und in seiner Nachfolge Jean-Jacques Rousseau und andere auf unterschiedliche Weise weiterführten, konzentrierte sich auf die Vorstellung von Institutionen, die gerechte Regelungen für eine Gesellschaft sichern. Dieser Ansatz, der ideale Institutionen zum Maßstab und Garanten für Gerechtigkeit macht – man könnte ihn «transcendental institutionalism», transzendentalen*3 Institutionalismus nennen – hat zwei deutliche Merkmale. Erstens konzentriert er sich auf vollkommene Gerechtigkeit und nicht auf einen Vergleich von mehr oder weniger Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Er versucht nur, soziale Charakteristika zu bestimmen, die an Gerechtigkeit nicht zu übertreffen sind, und deshalb befasst er sich nicht mit dem Vergleich machbarer Gesellschaften, die womöglich alle das Ideal der Vollkommenheit verfehlen. Ziel ist eine abstrakte Identifizierung «des Rechten», nicht das Auffinden von Kriterien für die Unterscheidung zwischen ungerechteren und weniger ungerechten Alternativen.
Zweitens konzentriert sich der transzendentale Institutionalismus bei seiner Suche nach Vollkommenheit vorwiegend auf das richtige Verständnis der Institutionen und nicht unmittelbar auf die tatsächlichen Gesellschaften, die am Ende entstehen. Die Eigenart der Gesellschaft, die sich aus einer beliebigen Gruppierung von Institutionen ergibt, hängt zwangsläufig auch von nichtinstitutionellen Faktoren ab, etwa vom tatsächlichen Verhalten und den sozialen Interaktionen der Menschen. Wenn eine auf ideale Institutionen zielende Theorie überhaupt auf wahrscheinliche institutionelle Folgen eingeht, macht sie spezifische Annahmen über soziales Verhalten, die zur Funktionsfähigkeit der ausgewählten Institutionen beitragen.
Beide Merkmale stehen im Zusammenhang mit dem Denkmodell des Gesellschaftsvertrags, das Thomas Hobbes angeregt und John Locke, Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant[3] weiterentwickelt hatten. Ein hypothetischer «Sozialkontrakt», der – so die Annahme – frei gewählt wurde, soll eine ideale Alternative zu dem Chaos bieten, das womöglich andernfalls eine Gesellschaft kennzeichnen würde, und die Verträge, die in erster Linie von den Autoren erörtert wurden, befassten sich überwiegend mit der Auswahl von Institutionen. Daraus ergaben sich Theorien der Gerechtigkeit, die sich auf eine transzendentale Definition der idealen Institutionen konzentrierten.*4
Man muss hier jedoch festhalten, dass diese Vertragstheoretiker auf ihrer Suche nach vollkommenen Institutionen manchmal auch sehr erhellende Analysen der moralischen oder politischen Gebote für sozial angemessenes Verhalten durchgeführt haben. Das gilt besonders für Immanuel Kant und John Rawls, die beide zum transzendentalen Institutionalismus beigetragen haben, denen wir aber auch weit reichende Analysen der Anforderungen von Verhaltensnormen verdanken. Auch wenn sie ihr Hauptaugenmerk auf die Institutionenwahl richteten, können ihre Analysen allgemeiner gefasst als auf «Regeln konzentrierte» (arrangement-focused) Annäherungen an Gerechtigkeit verstanden werden, wobei die Regeln nicht nur angemessene Institutionen, sondern auch angemessenes Verhalten betreffen.*5 Offensichtlich besteht ein radikaler Gegensatz zwischen einer auf Regeln konzentrierten Vorstellung von Gerechtigkeit und einem auf Verwirklichung ausgerichteten Verständnis des Begriffs: Dieses muss sich zum Beispiel mit dem tatsächlichen Verhalten von Menschen befassen und wird nicht voraussetzen, dass alle sich ideal verhalten und den entsprechenden Regeln unterwerfen.
Eine Reihe anderer aufklärerischer Theoretiker wählte im Gegensatz zum transzendentalen Institutionalismus eine Vielfalt komparativer, auf soziale Verwirklichung (das heißt, auf die Wirkung tatsächlicher Institutionen, tatsächlichen Verhaltens und anderer Einflüsse) ausgerichteter Ansätze. Verschiedene Versionen dieses komparativen Denkens finden sich zum Beispiel bei Adam Smith, dem Marquis de Condorcet, Jeremy Bentham, Mary Wollstonecraft, Karl Marx, John Stuart Mill und anderen innovativen Denkern im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert. Auch wenn die genannten Autoren sehr unterschiedliche Vorstellungen von den Anforderungen der Gerechtigkeit hatten und ganz verschiedene Wege zur vergleichenden Betrachtung von Gesellschaften einschlugen, kann man doch ohne große Übertreibung sagen, dass sie alle ihre Analysen nicht auf die «über die Realität hinausgehende» Suche nach einer vollkommenen Gesellschaft beschränkten, sondern sich mit dem Vergleich von Gesellschaften befassten, die schon bestanden oder verwirklicht werden konnten. Für Autoren, die im Interesse an Verwirklichung Vergleiche anstellten, war es oft in erster Linie wichtig, sichtliches Unrecht aus der Welt zu schaffen.
Der Abstand zwischen den beiden Ansätzen, dem transzendentalen Institutionalismus auf der einen und dem auf Verwirklichung konzentrierten Vergleich auf der anderen Seite, ist beträchtlich. Die Hauptrichtung der gegenwärtigen politischen Philosophie hält sich in ihren Untersuchungen zur Theorie der Gerechtigkeit vorwiegend an die erste Tradition, den transzendentalen Institutionalismus. John Rawls, der bedeutendste politische Philosoph unserer Zeit (seine Ideen und folgenreichen Beiträge sind Gegenstand des zweiten Kapitels in diesem Buch)*6, ist das eindrucksvollste Beispiel dafür. Rawls’ «Grundsätze der Gerechtigkeit» in seinem Werk Eine Theorie der Gerechtigkeit sind ausschließlich auf vollkommen gerechte Institutionen bezogen, obwohl er die Normen des rechten Verhaltens auch – sehr erhellend – im politischen und moralischen Kontext untersucht.**7
Auch etliche der anderen herausragenden gegenwärtigen Theoretiker der Gerechtigkeit haben – vereinfacht gesagt – die Richtung des idealistischen Blicks auf Institutionen eingeschlagen – ich denke hier zum Beispiel an Ronald Dworkin, David Gauthier oder Robert Nozick. Ihre Theorien, die verschiedene, aber jeweils wichtige Erkenntnisse über die Anforderungen einer «gerechten Gesellschaft» vermitteln, haben ein gemeinsames Ziel: die Bestimmung gerechter Regeln und Institutionen, auch wenn sie diese Ordnungsgefüge (arrangements) in sehr verschiedenen Formen identifizieren. Die Charakterisierung vollkommen gerechter Institutionen ist ins Zentrum moderner Theorien der Gerechtigkeit geraten.
Der Ausgangspunkt
Anders als die meisten modernen Theorien der Gerechtigkeit, die sich auf die «gerechte Gesellschaft» konzentrieren, ist dieses Buch ein Versuch, die Realisierungsvergleiche zu überprüfen, die Fortschritte oder Rückschritte der Gerechtigkeit ins Visier nehmen. In dieser Hinsicht reiht es sich nicht in die starke, philosophisch höher angesehene Tradition des transzendentalen Institutionalismus ein, sondern es ist eher der anderen Tradition verbunden, die ungefähr um die gleiche Zeit oder kurz danach Gestalt annahm und für die Smith, Condorcet, Wollstonecraft, Bentham, Marx, Mill und andere stehen. Dass ich den gleichen Ausgangspunkt habe wie diese voneinander sehr verschiedenen Denker, heißt allerdings nicht, dass ich im Wesentlichen mit ihren Theorien übereinstimme – was sich von selbst verstehen sollte, da sie schon untereinander nicht einig waren, und sobald wir über den gemeinsamen Ausgangspunkt hinausgehen, müssen wir auch Zielorte ins Auge fassen.*8 Der Rest des Buches wird den Weg dorthin untersuchen.


![Elemente einer Theorie der Menschenrechte. [Was bedeutet das alles?] - Amartya Sen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5df4ddfeaeb24b710a4ec3405de1e09b/w200_u90.jpg)
![Rationale Dummköpfe. Eine Kritik der Verhaltensgrundlagen der Ökonomischen Theorie. [Was bedeutet das alles?] - Amartya Sen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/38c3f8dccd4ec02244a3dfcedf330c1b/w200_u90.jpg)
![Gleichheit? Welche Gleichheit?. [Was bedeutet das alles?] - Amartya Sen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/32e556237fddc5b0a09ee8e253e7550a/w200_u90.jpg)