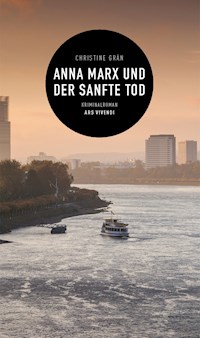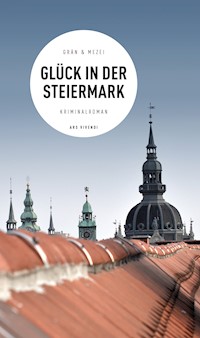
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Martin Glück, frisch geschieden und immer noch als "Springer" eingesetzt, landet in der Abteilung "Leib und Leben" im Landeskriminalamt Graz. Die traditionelle Abneigung der Steirer gegen alles Wienerische macht dem Chefinspektor zu schaffen, aber Graz zeigt sich nach seiner Ankunft - mitten im Steirischen Herbst - von seiner aufregenden Seite. Mehrere mysteriöse Todesfälle im Hilmteichviertel halten nicht nur die städtische Kulturszene in Atem. Glück freundet sich mit Gigi an, Mimin am Schauspielhaus, die ihn mit den heißesten Informationen aus dem "Intrigantenstadl" versorgt. Eine Reise in die Südsteiermark bringt die beiden nicht nur einander näher, sondern Glück auch ein großes Stück weiter in seinen Ermittlungen. Liebe, Hass, Rache, Angst: Viele Wege führen zum Verbrechen - und seiner Aufklärung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grän & Mezei
Glück in der
Steiermark
Kriminalroman
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage Februar 2019)
© 2019 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Dr. Felicitas Igel
Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg
Motivauswahl: ars vivendi
Coverfoto: john krempl / photocase
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-998-2
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
GLOSSAR
Die Autorin
Kapitel 1
»An Weana sog i nix!«
Das war deutlich. Ganz kurz flammt in Martin Glück der altbekannte Jähzorn auf, aber dann muss er wider Willen lachen. Darüber würde sich seine Anti-Aggressionsbetreuerin in Wien sicher freuen. Das Komische aus jeder Situation herauszufiltern, war ihr Rat gewesen, den er erst für Nonsens gehalten hatte. Aber hier, auf Abwegen im oststeirischen Apfelland und mangels Navi gestrandet in einem Ort namens Floing, da siegte das Lachen über die Wut.
Er hat ja einiges über die Abneigung der Steirer gegen die Hauptstädter gehört. Aber dass dieser Mann, den er ganz freundlich nach dem Weg gefragt hat, von seinem Traktorhochsitz geradezu herabspuckt, er werde einem Wiener keine Auskunft geben, überrascht ihn dann doch. Er setzt gerade an, ihm zu erklären, dass er Kriminalbeamter und auf dem Weg nach Graz sei, da unterbricht ihn der Landwirt, der immer noch grimmig das Wiener Autokennzeichen von Martins Käfer Cabrio beäugt: »Jetzt foast halt amol umi bis zum Marterl, dann links aufi und nocha rechts obi. Dann bist glei in Anger und nocha in Weiz, also eh scho fost in Graz.« Von seiner Wortlava erschöpft, lüftet der Bauer den Hut und rattert mit Traktor samt Apfelladung davon.
***
Die neuen Kollegen im Landeskriminalamt lachen schallend über Martins Apfellanderlebnis. »Hast wenigstens Floing bei Anger bei Weiz kennengelernt«, prostet man ihm zu.
»Willkommen in der wilden Steiermark, Martin! Schön, dass du da bist, um uns aus der Scheiße zu helfen. Hat man dir eh gesagt, dass bei uns ein aggressives Darmvirus grassiert, das die halbe Abteilung lahmgelegt hat. Dann hat sich auch noch ein Kollege in den Vaterschaftsurlaub verabschiedet. Da nehmen wir sogar einen Wiener zur Not. Der nächste Mord gehört dir, Chefinspektor!«
Martin freut sich, wieder einmal ganz offiziell in Sachen Mord ermitteln zu dürfen, auch wenn er vorerst nur als Springer eingesetzt wird. Hauptsache, er ist aus seinem Strafkammerl in Wien, in das man ihn verbannt hatte, herausgekommen. Zwangsurlaub, Kammerl und Bagatellfälle waren die Folge einer Schlägerei gewesen. Genau genommen hat nur Martin zugeschlagen. Gar nicht so fest eigentlich, aber die falsche Zielperson. Seine Faust landete im Gesicht seines Chefs, aus Eifersucht, weil er ihn Arm in Arm mit seiner Frau – inzwischen Ex-Frau – Larissa erwischte. Der Zwangsurlaub, den er danach am Wörthersee verbrachte, war ja sehr schön, vor allem wegen Lily Prokop, Kärntner Kollegin und inzwischen ein bisserl mehr. Sein Wiener Kellerbüro weniger. Obwohl er von dort aus trotzdem heimlich zwei Morde rund um eine Erbschaft aufgeklärt hat.
Er glaubt, dass es ihm gefallen wird in Graz. Eine Stadt von bezaubernder Gemütlichkeit, und nah genug bei Klagenfurt, um Lily oft zu besuchen. Eine kleine zentral gelegene Wohnung, offenbar auch nette Kollegen. Jedenfalls die, die vom Team übrig sind. Martin war echt überrascht, als man ihm an seinem ersten Arbeitstag eröffnete, man werde nach Dienstschluss eine kleine Willkommensfeier für ihn ausrichten. Der Chef persönlich hat dann einen jungen Uniformierten mit hundert Euro losgeschickt, um »fünf ordentliche Flaschen Wein« zu kaufen. Als der Polizist kurz darauf mit mehreren Doppelliterflaschen »Platscher Perle« zurückkam, und dem Oberst stolz siebzig Euro Wechselgeld in die Hand drückte – »ich hab für viel weniger Geld viel mehr Wein gekriegt« – wäre Martin als Vorgesetzter wohl explodiert. Oberst Hannes Lammer lachte nur und sandte einen weinkundigen Mitarbeiter aus. Und so genießen sie jetzt einen südsteirischen Sauvignon Blanc vom berühmten Weingut Skoff und Brote mit Verhackertem.
Nachdem die wichtigsten persönlichen Fragen – Verheiratet? Kinder? – mit »Nein, geschieden, keine Kinder« abgehakt sind, kommen die neuen Kollegen zum Wesentlichen: »Warst schon einmal in der Südsteiermark?« Als Martin auch dies verneint, macht sich Verwunderung breit. »Die steirische Toskana, was heißt: schöner als die Toskana! Da musst unbedingt hin. Gerade jetzt im Herbst ist die richtige Zeit für die Steirischen Weinstraßen.«
Hat er auch vor und sich schon entsprechend eingelesen. Er muss nur noch mit Lily einen gemeinsamen Termin finden. Außerdem will er sich ein paar Kulturevents im Steirischen Herbst zu Gemüte führen, Jazz vor allem. Hannes Lammer, ebenfalls Jazzfan, der noch dazu selbst Saxofon spielt, gibt ihm gleich ein paar Tipps. »Wennʼst Lust hast, kannst ja mit mir ins Café Stockwerk gehen, das ist der legendäre Jazzkeller in Graz!«
So willkommen hat Martin sich selten gefühlt. Vielleicht am ehesten in seiner Kindheitssommerfrische »Villa Romana« am Wörthersee, deren Besitzerin seine erste pubertäre und natürlich platonische Liebe war. Wahrscheinlich wird ihn Romana auch in Graz besuchen. Die Stadt hat ein Spielcasino.
»Ah, mein neuer Chef – aus dem schönen Wiieen!« Fast böse schaut er drein, der blasse, rotblonde Mann Mitte dreißig, der auf Martin zugeht. »Ich bin Felix Wagner, und Ihnen als Partner zugeteilt«, sagt er ohne Begeisterung und reicht Martin die Hand. Vorsichtiges Händeschütteln, die Wagnerische fühlt sich kalt an.
Ein Wienerhasser, denkt Martin. Wäre ja zu schön gewesen, wenn sie alle nett wären. »Na ja, so eng würde ich das mit dem Chef nicht sehen«, Martin zwingt sich zu einem freundlichen Lächeln und reicht Wagner ein Weinglas, das dieser mit den Worten ablehnt, dass er keinen Wein trinke. Auch gut, denkt Martin. »Wir werden als Partner zusammenarbeiten. Außerdem kennen Sie sich hier aus, und ohne Sie bin ich sicher aufg’schmissen.«
»Freilich sans des als Wiiieener.« Sagt es, dreht sich um und geht zurück in sein Büro.
»Der mag di schon amal net, weil seine Frau mit einem aus Wien auf und davon ist«, flüstert ein Kollege Martin zu. Schon verständlich, aber Martins Hochstimmung hat trotzdem einen Dämpfer bekommen. Auf einmal vermisst er seinen Wiener Kollegen Fassl. Sie waren ein gutes Team und irgendwie auch Freunde. Hier ist er noch ein Fremder, obwohl sie sich alle Mühe geben, ihm Graz schmackhaft zu machen. Eine Stunde später löst sich die kleine Gesellschaft auf, und er ist ganz froh darüber. Jetzt will er in seine neue Wohnung, Lily anrufen und dann einen gemütlichen Abend mit Dizzy Gillespie und dessen Jazztrompete verbringen.
Als er am Paulustor ins Freie kommt, begrüßt ihn ein strahlender Herbstabend. Da können seine Bleibe auf Zeit in der Burggasse, Lily und Gillespies Trompete ruhig noch etwas warten. Er beschließt, einen Spaziergang über die Sporgasse und das »Bermudadreieck« zwischen Färbergasse, Mehlplatz und Glockenspielplatz zu machen und sich dann irgendwo in einen Gastgarten zu setzen.
Das Viertel ist ein beliebter abendlicher Treffpunkt der Grazer, das weiß er noch von früher. Kleine Bars, Bistros, jede Menge Esslokale. Dem Wetter geschuldet drängen sich hier jede Menge Leute. Martin bekommt Lust dazuzugehören. Er stellt sich an eine Bar am Glockenspielplatz und will ein Glas Weißwein ordern. Doch vom Gasthof gegenüber riecht es verlockend nach Backhendln oder Wiener Schnitzeln, also wandert er ins Glöckl Bräu, setzt sich an den letzten freien Tisch draußen und bestellt Bier und steirischen Backhendlsalat.
Das Gold der Steiermark muss man mögen, und er tut es. Passt aber auf, dass Hemd und Jacke von der grünschwarzen Flüssigkeit verschont bleiben. Kernölflecken gehen nur in der Sonne wieder weg, das ist sogar bis nach Wien vorgedrungen. Das Gösser-Bier schmeckt herrlich, und während er dasitzt und die allerletzten Sonnenstrahlen genießt, betrachtet er die Vorübergehenden. Viele junge Leute, Graz ist eine Universitätsstadt. Als er selbst noch Student war, hat er oft einen Freund in Graz besucht und ist mit ihm durch die einschlägigen Studentenlokale gezogen, wo man sich ein Bier und als Höhepunkt des kulinarischen Luxus eine serbische Bohnensuppe oder einen Djuvec-Reis im Winterbierhaus geleistet hat. Er erinnert sich, dass das ganz in der Nähe vom Glockenspielplatz war, in der Bürgergasse. Das Bermudadreieck war damals nicht so hip wie heute. Die Stadt hat sich herausgeputzt, zumindest in dieser Ecke.
Nach einem weiteren Bier zahlt er und beschließt spontan, erstens sein altes Stammlokal aufzusuchen und zweitens Robert, den Freund von damals, anzurufen. Martin schlendert vom Glockenspielplatz durch die enge Abraham-a-Santa-Clara-Gasse hinauf in die Bürgergasse. Da irgendwo muss es sein. Aber nirgends entdeckt er ein Schild, das auf das Winterbierhaus hinweist. Zweimal geht er die Bürgergasse hinauf und wieder zurück. Vergeblich. Das Beisl aus seiner Jugend scheint verschwunden. Als er an einem alten Palais mit dem Schild Hotel zum Dom vorbeikommt, beschließt er nachzufragen. In einem Hotel wird man ja wohl auch einem Wiener Auskunft geben.
»Winterbierhaus?«, fragt die Frau an der Rezeption. »Ja, da stehn Sʼ eh mittendrin in der Schank.«
Martin erfährt, dass es schon vor Jahren geschlossen wurde und sich jetzt das Hotel in dem Palais befindet.
Er bedankt sich und macht sich auf in die Burggasse, zu seinem neuen Zuhause. Die barocken Häuser, von schäbig bis herausgeputzt, erkennt er wieder. Ein Vierteljahrhundert ist’s her, seit er mit Robert um die Ecken gezogen ist. Er hat den Kontakt zum Studienfreund verloren. Irgendwer hat ihm erzählt, dass Robert Facharzt für Rheumatologie geworden ist und die Tochter seines Universitätsprofessors geheiratet hat. Na, das wird er schon noch im Detail erfahren.
Inzwischen ist er bei dem Biedermeierhaus angekommen, in dem sich seine vorübergehende Bleibe befindet. Es ist nur teilweise renoviert, der Eingangsbereich gehört nicht dazu, da bröckelt der Putz, aber sein Appartement im zweiten Stock ist picobello.
Angeblich wohnen in dem Haus nur Theaterleute. Das Stadttheater hat die Wohnungen pauschal angemietet und stellt sie den Schauspielern zur Verfügung, die für ein, zwei Saisonen am Schauspielhaus engagiert sind. Und mittendrin in der Künstlerkolonie jetzt auch Martin Glück. Irgendwer in seiner Abteilung in Wien kennt jemanden am Grazer Theater, der Martin dort eine zufällig freistehende Wohnung vermittelt hat. So ist das in Österreich: Du musst jemanden kennen, der jemanden kennt …
Wein und Bier, das herzliche Willkommen und die Freude auf die nächsten Wochen in Graz haben ihn übermütig gemacht. Er versucht, die zwei Stockwerke auf einem Bein hinaufzuhüpfen – Relikt aus seiner sportlichen Jugendzeit, als er jede Gelegenheit fürs Training nutzte. Nach einer Etage muss er sich allerdings eingestehen, dass das mit fast sechsundvierzig nicht mehr so leicht ist wie damals. Egal, jetzt steht er vor seiner Wohnung, und gleich wird er sich aufs Sofa schmeißen, eine seiner gelegentlichen Zigaretten rauchen und Lily in Klagenfurt anrufen. Nach ein paar kleineren und größeren Missverständnissen rund um die heiklen Themen Eifersucht und Selbstbestimmung herrscht im Moment wieder Waffenstillstand. Er müsste sich halt öfter bei ihr melden.
Gerade steckt er den Schlüssel ins Schloss, als er aus der Nebenwohnung Frauenstimmen hört.
»Ich liebe ihn, aber ich mag ihn nicht!« In pathetischem Bühnendeutsch.
Immerhin ein Satz, den er unterschreiben kann, wenn er an seine Ex denkt. Viel zu lange hat er Larissa geliebt, ohne sie zu mögen. Aber von Beziehungsdramen hat er mehr als genug.
»Sei froh, dass du den selbstverliebten Macho-Arsch los bist.« Eine zweite Stimme von nebenan.
»Aber er hat mich sooo verletzt …«
Martin will nichts mehr hören und dreht den Schlüssel um, als die Tür zur Nachbarwohnung aufgeht.
»Ja hallo, guten Abend! Sie müssen der Kommissar aus Wien sein«, begrüßt ihn die Frau, die herauskommt.
»Kommissar gibtʼs keinen«, kontert Martin.
»Ah, ein Kottan-Fan mit Humor! Gefällt mir. Willkommen in der Kasperlburg! Übrigens, ich bin Gigi Altenbacher.«
»Kasperlburg?«
»Die Grazer nennen dieses Haus die Kasperlburg, weil hier lauter Schauspieler, also Kasperln, wohnen. Na ja, und jetzt auch ein echter Kommissar. Oh, Pardon, wie heißt das im richtigen Leben?«
»Ach, ich bin einfach der Martin, Martin Glück.«
Gigi Altenbacher lächelt ihr Gegenüber entwaffnend an, dann nimmt sie ihn an der Hand, was ihn schon erstaunt. Schauspielerin halt, er schätzt sie auf irgendwas zwischen dreißig und vierzig. Sie ist nicht unattraktiv, nur ziemlich klein und durchtrainiert.
»Kommen Sie doch rein, dann lernen Sie gleich Ihre neuen Nachbarinnen kennen.« Gerade als Martin, der Lily anrufen wollte und von Frauenproblemen nichts wissen will, zögernd den ersten Schritt in Richtung Nachbarwohnung tut, schallt es dort heraus: »Scheißmänner!!« Er weicht erschrocken zurück.
»Keine Angst, wir haben noch keinen gefressen. Wir sind bloß einer Kollegin bei ihrem Liebeskummer beigestanden. Wieder einmal!«, seufzt Gigi Altenbacher. »Aber wenn Sie dabei sind, können wir wenigstens über was anderes reden. Tun Sie uns doch den Gefallen!«
Tatsächlich wechseln die Frauen das Thema, als Martin kommt. Statt über Beziehungskrisen und böse Männer reden sie jetzt über die neuesten Kulturevents in Graz und über die bevorstehende Nestroy-Premiere am Schauspielhaus. Dazu gibt es Weißwein und belegte Brote von Frankowitsch, den kennt Martin noch von früher.
»Kennen Sie den Lumpazivagabundus?«
»Natürlich!«, sagt Martin, obwohl er sich an die Schullesung mit verteilten Rollen nur noch sehr vage erinnern kann.
»Was halten Sie davon, wenn Leim in der Burka auftritt, Zwirn eine revolutionäre Frau ist, die Leim die Burka vom Leib reißt, und Knieriem ein It-Girl, das erschossen wird?«
Martin ist mit dieser Frage eindeutig überfordert. Waren das nicht männliche Handwerker in dem Stück? Und warum die Burka? Zeitgeist? Protest? Provokation? Na, auf jeden Fall beschließt er, dieser Inszenierung fernzubleiben. »Kann ich mir nicht so richtig vorstellen«, erscheint ihm eine diplomatische Antwort. Die ohnehin untergeht in den sehr konträren Meinungen der Frauenrunde.
»Er ist verrückt, verrückt, verrückt!«
»Das gibt einen Skandal!«
»Sei doch nicht so bieder! Der Prader ist echt cool, wie er den guten alten Nestroy aufmischt.«
»Ein Spinner ist er!«
»Wir sprechen von Emanuel Prader, dem Regisseur, der den Lumpazivagabundus in Graz inszeniert.« Gigi Altenbacher lächelt Martin entschuldigend an. »Natürlich will er einen Skandal. Deshalb macht erʼs ja. Wie der Claus Peymann. Wenn die Leutʼ sich im Steirischen Herbst nicht über was aufregen, haben die Organisatoren was falsch gemacht.«
»Also, das mit der Burka finde ich zu arg«, unterbricht eine Blondine. »Da steigen vielleicht noch die Muslime auf die Barrikaden. Noch dazu, wenn die Burka-Trägerin nachher nackert ist.«
»Dafür wird der Prader noch erschossen, das sag ich euch.«
»Blödsinn. So arg ist das gar nicht. Wenn der erschossen wird, dann von seiner Ehefrau.«
»Oder von seiner Geliebten, der Mara«, mischt sich nun die Liebeskranke ein. »Man sollte überhaupt alle untreuen Männer erschießen.«
»Da hätten Sie dann viel Arbeit, Martin.« Gigi lacht. Martin findet, dass sie ein nettes Lachen hat.
»Na, bitte nicht! Gut, dass ich geschieden bin.« Gigi wirft ihm einen Blick zu, der eine Sekunde zu lang dauert und ihn kurz irritiert.
Dann ist er wieder ganz Kriminalist. Was, wenn diese Provokation mit der Burka wirklich ins Auge geht? Sie sollten bei der Premiere jedenfalls ein Auge auf das Theater haben. Er wird mit Oberst Lammer darüber reden. Also, wenn ich die Mara wäre, hätte ich den Prader längst umgebracht. Der ist mindestens dreißig Jahr älter, verheiratet und behandelt sie wie einen Schuhfetzen.«
»Gʼschieht ihr recht. Sie will sich eh nur ihrem großen Durchbruch entgegenvögeln, unsere Mitzi Bohnstingl aus Birkfeld. In der Hoffnung, dass doch einmal eine große Rolle für sie abfällt.«
»Mitzi Bohnstingl? Echt, so heißt Mara Sibelius im wahren Leben?«
»Ich schwörʼs. Hab ihren Pass gesehen.«
Das Lachen von Maras Kolleginnen und ein langer Blick von Gigi begleiten Martin, als er die Damenrunde verlässt und in seine Wohnung geht. Es ist kurz vor Mitternacht und viel zu spät, um Lily anzurufen. Morgen ist auch noch ein Tag.
***
Schriftsteller, Journalisten, Künstler, alles, was in Graz Rang und Namen hat, trifft sich im Santa Clara, hat Robert ihm am Telefon erzählt. Da Martin sich weder von Schickimickis noch von kulinarischen Inszenierungen beeindrucken lässt, hält sich seine Ehrfurcht in Grenzen. Wahrscheinlich ein modernes, ungemütliches Restaurant mit undefinierbaren Batzerln auf dem Teller, die man mit der Lupe suchen muss! Etwas ganz nach dem Geschmack seiner Ex Larissa. Trotzdem ist er jetzt auf dem Weg in das Edelgasthaus, um sich dort mit dem Jugendfreund zu treffen. Es liegt in der Nähe vom ehemaligen Winterbierhaus in der Bürgergasse. Also quasi um die Ecke von Martins Wohnung.
Beinahe übersieht er den Eingang zum Restaurant, der versteckt in der ehemaligen Hofeinfahrt eines Palais aus dem siebzehnten Jahrhundert liegt. Martin mag alte Häuser und deren Geschichte und Geschichten, somit bröckelt sein Widerstand gegen das Lokal, das er nicht kennt, schon ein bisserl. Richtig beeindruckt ist er vom Santa Clara, als er es betritt. Bistrotische und Thonetsessel, ein großer alter Holzofen, eine Vitrine mit vielen mediterranen Vorspeisen und ein Bierbrunnen in einem Felsen. Das alles unter einem herrlichen Kreuzgewölbe.
Robert winkt ihm von einem Ecktisch im hinteren Teil des Restaurants. Der Jugendfreund hat sich kaum verändert, ein paar graue Strähnen im blonden Haar lassen ihn höchstens etwas soignierter wirken und eher wie das aussehen, was er heute ist: Univ.-Prof. Dr. Robert Hebenstreit, angesagter Internist und Rheumatologe.
»Martin! So weit ist Wien von Graz entfernt, dass du fünfundzwanzig Jahre brauchst, um herzukommen? Na ja, wenn du mit deinem alten Käfer gefahren bist, kann ichʼs verstehen, dass es länger dauert.« Ein Vorwurf mit Augenzwinkern, gefolgt von einer herzlichen Umarmung.
Nachdem sie einander versichert haben, dass sie kaum gealtert sind, empfiehlt Robert französischen Rotwein, von dem man hier ganz besonders erlesene Flaschen habe. Martin entscheidet sich aber erst einmal für Bier, er ist durstig.
Eine Stunde später sitzen die Freunde vor leer gegessenen Tellern und einer Flasche Cocalières 2012 und lassen die Vergangenheit auferstehen. Hin und wieder unterbrochen durch Bärbel Schwender, Chefin des Santa Clara, die mit immerwährendem, mildem Lächeln nachschenkt. »Ich hab die Bärbel noch nie nicht lächeln sehen, und ich komm schon viele Jahre her. Ist sozusagen mein zweites Wohnzimmer«, erzählt Robert.
»Da du so ein bekannter Arzt bist in Graz, triffst du hier sicher jede Menge deiner Schickimicki-Patienten«, sagt Martin halbernst. So ganz frei von Neid ist er nämlich nicht, der Chefinspektor. Immerhin hat der Freund im Gegensatz zu ihm sein Studium beendet, eine steile Karriere hingelegt und Frau, Kinder, Hund und vermutlich ein schönes Haus vorzuweisen. Von alldem hat er nix. Andererseits liebt Martin seinen Beruf, und das mit den Frauen klappt bei ihm halt nicht so. Entweder liebt er sie, mag sie aber nicht – wie Larissa. Oder er mag sie, liebt sie aber nicht – wie Lily.
»Ach, weißt du, Rheuma ist nicht unbedingt ein schickes Fach«, unterbricht Robert Martins frauenphilosophische Gedanken. »Da hätt ich Schönheitschirurg werden müssen. Außerdem essen und trinken hier nicht die Seitenblicke-Promis, davon gibt es in Graz gar nicht so viele, sondern richtige Künstler. Der Handke war schon hier, der Wolf Biermann und auch der Peter Turrini. Da drüben sitzt übrigens der Emanuel Prader mit seiner Frau, ein berühmter deutscher Filmregisseur, der in Graz zum ersten Mal inszeniert. Den Lumpazivagabundus.«
Martin dreht sich diskret um und begutachtet den in der Kasperlburg viel diskutierten Prader. Nicht unbedingt ein Geschenk Gottes an die Frauen. Prader ist nicht mehr der Jüngste und trägt Bauch. Das mindestens einen Knopf zu weit geöffnete Hemd gibt den Blick auf weiße Brusthaare frei, und seine langen grauen Haare trägt er zu einem Zopf gebunden. Er hat ihn sich irgendwie attraktiver vorgestellt. Aber Macht und Einfluss scheinen auch sexy zu machen.
Plötzlich erhebt sich die Frau an Praders Seite, schreitet durch das Lokal, greift sich von der Theke eine Flasche Olivenöl und steuert auf Martins und Roberts Nebentisch zu, wo zwei junge Frauen sitzen.
Mit den Worten »Dafür, dass du meinen Mann vögelst« gießt sie einer der beiden Frauen den Inhalt der Flasche über den Kopf. Die Olivenölgetränkte braucht ein paar Sekunden, dann stürzt sie sich auf die Täterin, fasst sie an den üppigen Locken und zerrt daran. Die Angreiferin rächt sich mit einer Ohrfeige und will ihrerseits Haare ausreißen, rutscht jedoch an geölten Strähnen ab. Ein paar Gäste sind geschockt, andere lachen, zwei zücken ihr Handy und filmen; Bärbel Schwender hält sich erschrocken die Hand vor den Mund. Jetzt geht es Schlag auf Schlag: eine weitere Ohrfeige für die Jüngere, begleitet wird der Kampf der Furien von Kraftausdrücken wie »alte Hex«, »Fotze«, »blede Dudl«, »Schastackn«, »Pissnelke«, »Regiematratze«.
Prader scheint die Szene eher zu amüsieren, er greift nicht ein, sondern beobachtet sie mit zynischem Grinsen. Robert sieht seinen Freund fragend an. Martin reicht es jetzt, er geht dazwischen. Trennt die Frauen und bekommt Olivenöl ab, und das auf sein teuerstes Sakko! »Schluss jetzt, sonst muss ich die Polizei rufen. Obwohl, genau genommen ist die ja schon da. In meiner Person. Will jemand Anzeige erstatten?«
Die Frauen sehen einander hasserfüllt an, schütteln aber beide den Kopf. Emanuel Prader legt drei Hunderterscheine auf den Tisch. Zur Wirtin: »Das müsste reichen – für die Zeche und das Olivenöl.« Zu den Frauen: »Ihr hättet euch wenigstens die Kleider vom Leib reißen können, dann wäre es lustiger gewesen. Und schade um das gute Öl ist es auch!«
Steht auf, packt seine Frau unsanft am Arm und zieht sie nach draußen. Zurück bleibt die geölte Frau, die das Handtuch der Wirtin dankbar entgegennimmt. Sie drapiert es um ihre Haare, zahlt und verlässt mit ihrer Begleiterin das Lokal. Erst ist es ganz still im Gewölberaum, dann kommt Gelächter auf, einige kommentieren die eben gesehene Aufführung.
Robert bestellt noch zwei Gläser Rotwein. »Na, das nenn ich Entertainment. Das Ölopfer war übrigens Mara Sibelius, Schauspielerin und angeblich die Geliebte des Starregisseurs. Und die Frau mit der Flasche war die eifersüchtige Gattin. Der Klatsch besagt, dass sie ihrem untreuen Mann schon ein paarmal gedroht hat, seine Weiber umzubringen.«
»Aber bitte nicht, während ich in Graz bin.« Martin prostet seinem Freund zu. »Ich hab lieber komplizierte Fälle.«
Robert lacht. »Der Meisterdetektiv in der Provinz. Na wart’s einmal ab. Wie du siehst, haben wir hier einiges zu bieten.«
Kapitel 2
Sie sieht aus wie ein Boxer nach einem brutalen Kampf. Hämatome um Augen und Wangen, Schwellungen rund um die Nase, die dick verklebt ist. Aus dem Tropf neben ihrem Bett sickert im Zeitlupentempo Flüssigkeit in ihre Vene. Die Infusion gegen etwas auszutauschen, das garantiert tötet, dieser Gedanke ist mir natürlich gekommen. Aber sie liegt ohnehin schon da wie auf dem Silbertablett. Wehrlos.
Sie schläft mit offenem Mund, dem leichte Schnarchgeräusche entweichen. So friedlich sieht sie aus mit ihrer neuen Nase, Modell »griechisch«. Na ja, eine Schönheit war sie ja wohl nie. Eher der intellektuelle Typ. Eine Schmeißfliege war sie, eine, die sich im Dreck der anderen suhlte. Vergangenheitsform. Ja, diese grammatikalische Nuance ist durchaus angebracht. Denn Steffi Hütter wird diese Nacht nicht überleben. Weil sie bestraft werden muss. Es ist alles ihre Schuld. Nicht meine. Ich setze mich nur zur Wehr, das ist mein gutes Recht. Ich tue es ja nicht gern. Es ist nicht so, dass ich Spaß am Töten hätte, oh nein. Es ist eine Notwendigkeit, das Gebot der Stunde. Du hast immer die Wahl, hat ein Therapeut zu mir gesagt, du musst dich nur für das Richtige entscheiden. Yes, Sir, genau so. Das Richtige ist, Steffi Hütter zu töten.
Zweiter Gedanke: Luft spritzen, aber im Halbdunkel des Zimmers scheint mir diese Version zu riskant. Und nun, vor ihrem Bett, entscheide ich mich für das Einfache. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass es immer die beste Wahl ist. Mit einem Griff ziehe ich ihr den Polster unter dem Kopf weg. Sie stöhnt ein bisschen, aber nicht laut und nicht lang, denn jetzt drücke ich ihr den Polster aufs Gesicht, schnell, schwer und kompromisslos. Von Schmerz – und Schlafmittel betäubt, bleibt ihr nur ein gedämpftes Stöhnen, das niemand außer mir hören kann. Ihre Beine zucken, aber auch nur kurz, und sie hat keine Kraft, sich mit den Armen gegen diesen Angriff zu wehren. Ihr geht die Luft aus. Ich zähle leise bis dreißig und halte den Druck noch aufrecht, als sie schon hinüber sein muss. Den Blick habe ich immer auf die Tür gerichtet, sollte die Krankenschwester auf die Idee kommen, nach der Patientin zu schauen, würde ich das Kissen ganz schnell wieder unter Steffis Kopf schieben. Aber die Schwester sitzt im Bereitschaftszimmer und schaut sich auf ihrem iPad eine Netflix-Staffel an. Mit Kopfhörern. Und ihre Runde dreht sie erst, wenn die Folge zu Ende ist. »Safe«, eine englische Thriller-Serie. Wenn das nicht irgendwie ironisch ist …
Ich nehme den Polster von ihrem Gesicht und lege ihn wieder unter Steffis Kopf. So friedlich liegt sie da. Und so tot. »Gute Reise«, flüstere ich ihr ins Ohr, bevor ich mit leisen Schritten zur Tür gehe, sie vorsichtig öffne und dann hinaushusche in den Flur, der um vier Uhr morgens so still ist wie ein Friedhof.
***
Mara steht auf der Terrasse und raucht. Sie ist nervös, und sie hat Angst, obwohl der Professor sie mit vielen Worten, von denen sie nur die Hälfte verstand, beruhigt hat. Die Vaginalstraffung per Laser sei ein harmloser medizinischer Eingriff, schonend, beinahe schmerzfrei. Ein Routineeingriff, und auf ihren ausdrücklichen Wunsch wird sie während der Behandlung sogar in einen kurzen Dämmerschlaf versetzt. Davon erwacht, könne sie ohne Weiteres nach Hause fahren. Mit dem Taxi. Nur fünf Tage müsse sie auf Geschlechtsverkehr verzichten, sagte der Professor mit einem Augenzwinkern. Er ist wirklich sehr nett, denkt Mara, und er hat ihr auch erlaubt, einen Abend vorher in der Klinik einzuchecken. Gegen einen Aufpreis von dreihundert Euro. Den wahren Grund, warum sie nicht in ihrer Wohnung übernachten wollte, hat sie ihm natürlich nicht verraten: die eifersüchtige Ehefrau, diese alte Furie, die sie im Santa Clara tätlich angegriffen hat. So was von peinlich, die Olivenöl-Attacke, und dass sie sich dann noch geohrfeigt haben, war auch nicht gerade oscarreif.
Am Ende blieb ihr nur der Rückzug mit öligen Haaren und roter Wange, und sie hat genau gesehen, dass die Wirtin und die anderen Gäst’ das Ganze zu allem Überfluss noch witzig fanden. Irgendwer hat mit dem Handy gefilmt, und irgendwer wird es der Zeitung stecken, Skandal, Skandal, was aber eigentlich, denkt Mara, für ihre Schauspielkarriere gar nicht so schlecht wär. Hauptsache, man kommt ins Gespräch. Nur hat sie jetzt ein bisserl Angst vor der Gisela Prader. Die weiß, wo die Geliebte ihres Mannes wohnt. Weshalb Mara es vorzog, einen Tag früher in die Hilmteichklinik zu fahren. Zufällig war grad ein Zimmer frei, obwohl sie nur zehn Betten haben. Ist halt ein kleines, feines Haus. Und der Professor gehört zu den Besten in Österreich, weshalb so viele Promis zu ihm pilgern.
In diesem Moment wünscht sich Mara allerdings, sie wär in ein Hotel gegangen. Dann könnte sie jetzt ein Flascherl Sekt aus der Minibar öffnen. Alles wegen der Nerven, sie ist halt hypersensibel. Aber um die Zeit noch eine Schlaftablette einzuwerfen, wenn ihr OP-Termin um acht Uhr morgens ist, wär auch ein Blödsinn. Apropos Blödsinn: Die Vaginalstraffung macht sie nur Emanuel zuliebe. Weil der sich beschwerte, sie habe eine Vagina wie ein Güterbahnhof. Nicht sehr charmant, der Herr, und sie musste sich schwer zusammenreißen, um ihm nicht entgegenzuschleudern, dass seine »Lok« einfach zu winzig sei. Nein, das hat sie ihm nicht gesagt, denn er ist der große Regisseur aus Deutschland, und sie die kleine Schauspielerin aus Graz. Na ja, aus Birkfeld eigentlich, aber das macht sich nicht so gut in der Vita. In Birkfeld war es, dass sie mit siebzehn geschwängert wurde und ihre katholische Mutter sie zwang, das Kind auszutragen. Sie haben es dann zur Adoption freigegeben, Mara machte die Matura nach und schrieb sich in die Schauspielschule ein.
Kinderkriegen ist nicht gut für die Vagina. Daher wird jetzt der Güterbahnhof verkleinert. Drei Sitzungen à fünfhundert Euro, dann kann sie vielleicht auch bei mickrigen Lokomotiven was fühlen. Irgendwas. Statt immer nur bühnenreif zu stöhnen. Emanuel ist tatsächlich der erste Mann, der sich darüber beschwerte. Er sagt immer, was er denkt. Weshalb ihn alle hassen, außer seiner eifersüchtigen Ehefrau und Mara Sibelius, Schauspielerin mit einem Ehrgeiz, der über die Grazer Bühne weit hinausgeht.
Emanuel hat ihr eine Rolle in seinem Stück versprochen – und was hat sie bekommen? Einen Satz auf der Bühne, beinah eine Statistenrolle. »Schau Schatzerl, es waren schon alle Rollen besetzt, als du, als wir …« Als ob er nicht der Herrgott wär als Starregisseur. Und wie er immer versucht, den Slang zu imitieren, Edelsteirisch, und rauskommt so ein g’schissenes Münchnerisch mit Wiener Einschuss.
Mara zündet sich aus Wut noch eine Zigarette an und fährt zusammen, als sie Schritte hört. Die Furie, die sie sogar hier aufgespürt hat? Aber so früh am Morgen?
Zum Glück ist es nur Alma irgendwas, den Nachnamen hat sie vergessen. Die hat es offenbar schon hinter sich, denn ihre Kinnpartie ist gerötet und geschwollen. Alma trägt zwei Kaffeebecher in der Hand. »Ich hab Sie hier stehen sehen, Sie können wohl auch nicht schlafen. Wollen Sʼ vielleicht auch einen Kaffee? Schwarz ohne Zucker.«
Mara nimmt den Becher dankend an und schlürft den heißen Kaffee in kleinen Schlucken. Alma trinkt mit Strohhalm. »Fadenlifting mit einer kleinen Fettabsaugung am Kinn«, erklärt sie. »Winziger Eingriff, morgen früh werd ich entlassen. Und Sie? Weshalb sind Sie hier? Wir sind ja gewissermaßen Kolleginnen, hab ich gehört. Ich bin auch Schauspielerin.«
Aber nicht an der Grazer Bühne, denkt Mara. Sie lächelt und murmelt etwas von einer Modellierung des Venushügels, das klingt nicht so peinlich.
»Wie reizend«, sagt Alma, »haben Sie denn vor, in einem Porno mitzuspielen?«
Uui, das war böse. Mara ahnt nicht, dass ihr Gegenüber genau dies schon einmal getan hat, allerdings vor einer Ewigkeit. »Gewiss nicht! Ich bin an der Grazer Bühne, und ich spiele in dem neuen Stück von Emanuel Prader. Und Sie?«
Alma lächelt ein wenig schmerzverzerrt. »Ach, mit Bühnenpräsenz kann ich zurzeit nicht aufwarten. Ich hab in ein paar Filmen mitgespielt, übrigens auch in einem, in dem Emanuel Regie führte. Damals war er noch nicht so ein … Starregisseur.«
Muss Jahrzehnte her sein, denkt Mara. Sie schätzt ihr Gegenüber auf vierzig bis fünfzig, selbst wenn man die Schönheits-OPs berücksichtigt. Man muss den Frauen auf den Hals schauen – oder auf die Hände. »Emanuel ist ja so waaaahnsinnig begabt. Aber natürlich menschlich schwierig wie so viele Genies.«
»Hat er immer noch den Hang zu sehr jungen Schauspielerinnen?«
War das eine Fangfrage? Mara stellt ihre Kaffeetasse auf die Brüstung. »Ich weiß nicht«, sagt sie vorsichtig. »Im Übrigen ist seine Frau vor ein paar Tagen nach Graz gekommen.«
»Ha, so was hat ihn ja noch nie aufgehalten.« Alma geht einen Schritt auf Mara zu und sagt leise: »Nehmen Sie sich vor der Furie in Acht. Die ist schon mal mit einem Messer auf eine Konkurrentin losgegangen.«
Mara lacht und – sie weiß nicht, warum? – erzählt die Szene aus dem Santa Clara. In Vergangenheitsform und mit einem Schuss Selbstironie klingt sie sogar witzig. Alma versucht ein Lachen, aber das tut weh. »Männer«, sagt sie, »sind es nicht wert, dass wir uns ihretwegen unters Messer legen. Ich habe meinen vor Kurzem verlassen. Und dabei dachte ich, dass er der Richtige ist. Gut aussehend, beste Manieren, ein Mann von Welt. Und was macht er? Verjubelt seine Erbschaft in Spielcasinos. Und betrügt mich mit einer alten Frau, nur weil die Blunzn noch mehr Geld hat als ich.«
»Pfui Teufel.« Mara ist bereit, Alma den Satz mit den Pornos zu verzeihen. Und sie sagt ihr die Wahrheit, so von Schauspielerin zu Schauspielerin: »Ich geh mit jedem mit, der mich in meiner Karriere weiterbringt.«
Alma scheint zu verstehen, zumindest sieht sie nicht schockiert aus. »Tja, es war immer schon ein hartes Geschäft. Und es wird nicht leichter, wenn man sich den Vierzigern nähert.« Sie greift sich vorsichtig ans Kinn: »Deshalb die kleinen Korrekturen. Sie sind sehr diskret hier, und Professor Leitner ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Und so ein nobler Mensch.«
»Der wär doch was für Sie!« Für mich wär er zu alt, denkt Mara und ignoriert die Tatsache, dass ihr Regisseur auch nicht jünger ist. Männer, die ihre Karriere nicht fördern, fallen aus ihrem Beuteschema. Mit Anatol Hofer gibt sie sich nur ab, weil der als Theaterkritiker was zu sagen hat. So ein langweiliger Mensch, und dass er wahnsinnig in sie verliebt ist, macht ihn auch nicht interessanter. Man muss ihn sich nur warmhalten irgendwie. Sie schaut auf die Uhr: »War nett, mit Ihnen zu plaudern, Alma, und danke für den Kaffee. Ich solltʼ jetzt aber wirklich auf mein Zimmer. Mich seelisch auf den Eingriff vorbereiten. Ich hab ein bisserl Angst, wissen Sie.«
»Ist angenehmer als beim Zahnarzt.« Alma lächelt die jüngere Ausgabe ihrer selbst mit aller Freundlichkeit an, derer sie fähig ist. So ein berechnendes kleines Luder, denkt sie, und dass es nicht angenehm ist, in diese Art Spiegel zu sehen. Sie winkt Mara zu, die die Tür zur Terrasse schließt. Alma bleibt noch draußen und schaut in den Himmel, der sich auf die Morgendämmerung vorbereitet. Ihr Kinn schmerzt von dem Lächeln, das sie Mara geschenkt hat. Als Nächstes, denkt Alma, sind ihre Oberarme dran, sie hat mit dem Professor schon darüber gesprochen. Gegen das wabbelnde Truthahnfett hilft nur die Liposuktion. Örtliche Betäubung, dann werden ganz feine Kanülen eingesetzt, um die Fettzellen zu lösen und dauerhaft abzusaugen. Anschließend wird die überschüssige Haut entfernt, sodass ein paar feine Narben an den Unterarmen bleiben. Plus Schwellungen und Hämatomen in den ersten Wochen. Dafür kann sie danach wieder ärmelfreie Kleider tragen, das ist es doch wert, oder?
Almas Kaffee ist kalt. Sie schüttet den Rest über die Brüstung und geht zurück in ihr Zimmer. Sie wird ein Schmerzmittel nehmen und sich wieder ins Bett legen. Nachdenken über das Leben im Allgemeinen und im Besonderen. Dazu gehört, dass sie endlich den Mann fürs Leben finden will. Edgar war es ganz offensichtlich nicht. Gute Manieren und schlechte Angewohnheiten. Ein Spieler, der die Roulettekugel jeder Frau vorgezogen hat. Sie hat eine Weile gebraucht, um zu begreifen, dass die Spielerei kein Spaß war, sondern bitterer Ernst. In den paar Monaten, in denen sie zusammen waren, hat Edgar fast seine gesamte Erbschaft verzockt, und danach wäre Almas Geld dran gewesen. Nein, da hat sie doch lieber die Notbremse gezogen. Und er hat es ihr leicht gemacht, der gute Edgar Siebers von Adelmauseder. Hat in Baden-Baden mit einer Bankierswitwe angebändelt, deren Geschmeide blendete. Wenn sie mal ehrlich ist: Da war kaum Schmerz, nur ein Hauch von gekränkter Eitelkeit. Alma legte ihm eine Abschiedsszene hin, die filmreif war. Warf ihm dann noch seinen Verlobungsring vor die Füße. Das fiel ihr leicht, weil er sowieso eine Fälschung war. Kein Zweikaräter, sondern Bergkristall, sie hat den Ring vorsichtshalber prüfen lassen. Typisch Edgar, nein, es ist wirklich nicht schade um ihn. Aber sie trägt ihm auch nix nach. War halt ein charmanter Gauner, und er schickt ihr immer noch Botschaften, in denen er seine Liebe beteuert. Zu Almas Geburtstag kamen vierzig rote Rosen. Stil hat er schon, nur leider keinen Charakter.
Die Schmerztablette beginnt zu wirken, sie macht auch schläfrig. Alma liegt im Trainingsanzug auf ihrem Bett und starrt an die Decke. Alles wird gut, denkt sie, und dass sie auch noch den Mann finden wird, der in jeder Hinsicht perfekt zu ihr passt. Schließlich ist sie noch nicht alt, mit achtundvierzig gerade in der Blüte des Lebens. Und dank Sissys Erbe hat sie genug Geld, um alle Verfallserscheinungen zu eliminieren. Der gute Professor, vielleicht hat Mara recht, der wär doch was für sie. Schön ist er nicht, aber was ein Mann nicht schöner ist als ein Aff, das kann er durch andere Vorzüge ausgleichen. Geld zum Beispiel. Und was für ein Geld sie sparen könnt, wenn er sie immer umsonst behandeln würde …
Am Kaffeeautomaten im Flur trifft Mara Schwester Inge, die ihr von dieser »wahnsinnig geilen Krimiserie« erzählt. Netflix sei Dank, dass sie die anstrengenden Nachtschichten überlebt, doch die sind halt besser bezahlt als der Tagesdienst. Die Schwester ist jung und sehr hübsch und passt insofern in eine Schönheitsklinik, weil die Schiachen ja keine gute Reklame wären. Mara schätzt, dass sie etwa im gleichen Alter sind, und sie haben sich von Anfang an gut verstanden, weil Schwester Inge Mara von ihrer bisher einzigen Fernsehrolle in einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung erkannt hat. Ein Fan! Mara träumt von der Zeit, in der sie in Graz oder Wien nicht mehr auf die Straße kann, ohne von Fans verfolgt zu werden.
Sie erzählt Inge von ihrer Angst vor dem Eingriff und dass sie gar nicht richtig zugehört habe, als der Professor ihr das Prozedere erklärte.
Inge beruhigt sie: »Es tut nicht weh. Sie führt ein Gerät in die Scheide ein, das Wärme abgibt und mikroskopisch kleine Löcher in die Haut schießt. Dadurch aktiviert sich die Kollagenneubildung des Gewebes, und das Scheidenepithel wird erneuert. Das Scheidengewebe zieht sich zusammen und wird straffer. Wenn sie dich in den Dämmerschlaf versetzt, wachst du hinterher auf und spürst höchstens ein leichtes Ziehen.«
Mara kann mit den Informationen wenig anfangen. »Wieso sie? Ich dachte, das macht der Professor?«
Inge geht ins Schwesternzimmer und schaut auf den OP-Plan. »Nein, das macht Dr. Markovic, sie hat da große Erfahrung. Deutschland, England, Saudi-Arabien – die Frauen kommen von überallher. Wenn die Vaginalstraffung nicht ausreicht, rät sie zur operativen Verengung des Vaginaleingangs. Da bist du dann aber für acht Wochen außer Gefecht, und es kostet eine Kleinigkeit.«
Auch das hat ihr der Professor erzählt, denkt Mara, nur nicht, dass Dr. Markovic sie behandeln würde. Die Russin mit der Leidensmiene, sie hat sie im Vorübergehen gesehen und Schwester Inge gefragt, die gerade zum Dienst kam. Der Gedanke, dass die Russin zwischen ihren Beinen rummacht, ist ihr irgendwie unangenehm. »Acht Wochen kein Sex! Das ist schon der Hammer. Das macht ja kein Mann mit!«
Meiner schon, denkt Inge. Seit sie Nachtschichten schiebt, ist das eheliche Liebesleben eingeschlafen. Peter arbeitet in der Finanzlandesdirektion, und wenn sie nach Hause kommt, macht er sich auf den Weg in die Arbeit. Gerade noch Zeit für einen Kaffee und ein Busserl. Für einen kurzen Augenblick beneidet sie die Schauspielerin für deren exotisches, erotisches Leben. Wenn genug Geld für eine Eigentumswohnung zusammen ist, wird sie die Nachtschichten aufgeben. Weniger Geld, dafür mehr Sex.
Mara entscheidet sich, nun endgültig in ihr Zimmer zu gehen. Kein Kaffee mehr und keine Schwester Inge, die gerne tratscht. Das geht ihr irgendwann auf die Nerven, weshalb sie sich jetzt verabschiedet und Inge einen schönen Feierabend wünscht. Was komisch klingt um diese Uhrzeit, denn draußen wird es hell, und die Notlichter im Flur erlöschen.