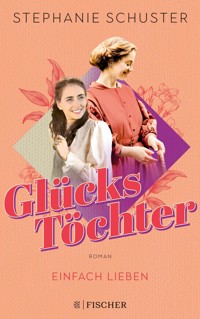9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Glückstöchter-Diologie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Eine Reise durch sechs Jahrzehnte: Anna und Eva, verbunden durch ihr tiefes Verständnis zur Natur, aber getrennt durch ein schicksalhaftes Geheimnis. Der erste Band der neuen Serie von Bestseller-Autorin Stephanie Schuster (»Die Wunderfrauen«) München, 1976: Minze, Vanille und Rosenholz … Für Eva ist die Welt voller Gerüche – und diese sind für sie die Basis aller Gefühle. Besonders Pflanzen und deren heilende Wirkung begeistern sie. Ein Pharmazie-Studium scheint genau das Richtige für Eva zu sein, und sie stürzt sich voller Neugier in das wilde, freie Schwabinger Studentenleben. Doch dann findet Eva etwas heraus, das ihre ganze Welt infrage stellt. Gut Dreisonnenquell im Voralpenland 1910: Wenn Anna Lindenblüten pflückt, die zartgrünen Blätter des Frauenmantels sammelt oder ganz einfach mit den Händen in der Erde arbeitet, fühlt sie sich frei. Als Tochter des bekannten Botanikers Christoph von Quast, möchte sie die Geschicke des Guts weiterführen und die Pflanzenzucht übernehmen. Doch als ihr Vater wieder heiratet, muss sie erfahren, dass sie in seinen Zukunftsplänen nicht auftaucht ... Band 1 »Glückstöchter. Einfach leben« Band 2 »Glückstöchter. Einfach lieben« erhältlich ab Frühjahr 2024
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 641
Ähnliche
Stephanie Schuster
Glückstöchter
Einfach leben
Über dieses Buch
München, 1976: Minze, Vanille und Rosenholz … Für Eva ist die Welt voller Gerüche – und diese sind für sie die Basis aller Gefühle. Besonders Pflanzen und deren heilende Wirkung begeistern sie. Ein Pharmazie-Studium scheint genau das Richtige für Eva zu sein, und sie stürzt sich voller Neugier in das wilde, freie Schwabinger Studentenleben. Doch dann findet Eva etwas heraus, das ihre ganze Welt infrage stellt. Gut Dreisonnenquell im Voralpenland 1910: Wenn Anna Lindenblüten pflückt, die zartgrünen Blätter des Frauenmantels sammelt oder ganz einfach mit den Händen in der Erde arbeitet, fühlt sie sich frei. Als Tochter des bekannten Botanikers Christoph von Quast, möchte sie die Geschicke des Guts weiterführen und die Pflanzenzucht übernehmen. Doch als ihr Vater wieder heiratet, muss sie erfahren, dass sie in seinen Zukunftsplänen nicht auftaucht. Eine Reise durch sechs Jahrzehnte: Anna und Eva, verbunden durch ihr tiefes Verständnis zur Natur, aber getrennt durch ein schicksalhaftes Geheimnis.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Stephanie Schuster lebt mit ihrer Familie und einer kleinen Schafherde auf einem gemütlichen Bio-Hof in Oberbayern. Sie arbeitete viele Jahre als Illustratorin, bevor sie selbst Romane schrieb – zuletzt die Bestseller-Serie »Die Wunderfrauen«. Sie engagierte sich in der Anti-Atomkraft- und Friedensbewegung, in einem »Eine-Welt-Laden« und setzte sich für fairen Handel ein.
Inhalt
Motto
Widmung
Prolog
Annas Tonkaalmbuch
Eva
Anna
Illustration Maulbeere
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Illustration Ward’scher Kasten
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Annas Tonkaalmbuch
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Evas vegetarisches Paradies-Menü
Vorspeise
Hauptspeise
Nachspeise
Zum Kaffee oder Tee
Danksagung
Leseprobe
Anna
Versuchen, stets mutiger zu sein, als man ist.
Natürlich für meinen allerliebsten Thomas und unsere weiter wachsende Wunderfamilie
Zur Erinnerung an meine Schwägerin und Freundin Monika Schuster (1963–1993), die der Figur Maja als Vorbild diente
Prolog
Oktober 1918
Niemand hatte es ihr zugetraut, nicht einmal sie selbst. Und schon gar nicht, dass sie eines Tages allein mit ihrer Tochter mitten in der Natur leben und das Wetter zu lesen verstehen würde wie die Geschichte in einem Buch. Anna von Quast lehnte in der Tür ihres Hauses, das in eintausenddreihundertzwanzig Metern Höhe thronte, und schnupperte in die Luft. Wo gestern noch ein Hauch von Wärme gehangen hatte, roch es heute nach Schnee. Ihr Blick schweifte über die Bäume, die die Kuhweide nach Süden hin begrenzten, hinauf ins lichter werdende Blau der Alpenkette. Der Jochberg verschwand bereits im Dunst, und auch über dem felsigen Gipfel des Rabenkopfs, der sich majestätisch wie die Rückenlehne eines Throns hinter ihr erhob, schwebten Wolken. Zeit, den Rosenkohl zu ernten, dachte sie, bevor er unter dem Weiß unauffindbar sein würde. Anna betrachtete ihren Garten, der ihr ganzer Stolz war. Unmöglich, dass hier oben überhaupt etwas außer Gras wuchs, hatte es von allen Seiten geheißen, und erst recht kein Rosenkohl. Aber der war nicht ihr einziger Erfolg in diesem Jahr gewesen. Feldsalat, Karotten, Kartoffeln, sogar Ackerbohnen und Spinat hatte sie geerntet. Auf dem Hang, wo vorher Büsche, Gestrüpp und Gras wild gewachsen waren und auf dem man sich nur mit Steigeisen hatte halten können, hatte sie Terrassen für Kräuter, Obst und Gemüse angelegt und ein kleines Paradies erschaffen. Ihren Garten Eden. Sie betrachtete ihre stark gebräunten Hände voller Schwielen. Kaum vorstellbar, dass das dieselben Hände waren, mit denen sie noch vor wenigen Jahren Klavier gespielt hatte. Abwegig, ein völlig aberwitziges Unterfangen wäre das, hatte jeder gesagt, dem sie von der Tonkaalm erzählte. Hier oben, wo der Winter manchmal schon im Sommer anfing und bis in den nächsten Mai dauerte, könnte man sich bloß bis zum Ende der Weidezeit aufhalten, geschweige denn überleben. Und genau das hatte Anna herausgefordert, denn schließlich wusste sie viel über Pflanzen und Tiere, hatte durch ihren Vater, der ein bekannter Pflanzenjäger war, sozusagen das Wissen in die Wiege gelegt bekommen. Aber Wissen und Können waren zweierlei. Das hatte sie gleich nach dem ersten Unwetter gespürt, das ihr die kostbare Saat samt der Erde weggespült hatte. Im Tal, erst recht in den Gewächshäusern, war der Mensch der Bestimmer, hier oben war man den Widrigkeiten der Natur ausgesetzt. Daran war Anna beinahe zerbrochen, als sie vor sieben Jahren herzog und völlig allein auf sich gestellt angefangen hatte. Sie ging nach draußen und strich über den Stamm des Tonkabaums, der entlang der Hauswand wuchs und nun das Dach überragte. Wenn sie am Verzweifeln gewesen war, hatte er ihr stets Trost gespendet. Als kleines Pflänzchen hatte ihr Vater ihn von einer seiner Reisen mitgebracht und ihrer Mutter zu Annas Geburt geschenkt. Das war vor achtundzwanzig Jahren gewesen. Seiner südamerikanischen Heimat entrissen, trotzte der Schmetterlingsblütler der rauen Witterung der bayerischen Voralpen, genau wie sie. Tossa muhte hinter dem hölzernen Weidezaun. Wahrscheinlich suchte sie wieder ihr Kalb, obwohl es vermutlich dicht hinter ihr stand. Auch Helene quäkte. Zurück in der Stube, hob Anna ihre Tochter aus dem Wäschekorb, der ihr als Bett und Laufstall diente, zog ihr das Strickjäckchen an, setzte ihr die Haube auf und band sie sich nach Art der afrikanischen Bäuerinnen auf den Rücken. Helene strampelte und stemmte sich dagegen. Seit sie sich selbst bewegen konnte, verlangte sie Freiheit und mochte es nicht mehr, stundenlang eng am Körper getragen zu werden. Doch außerhalb des Hauses war es für die Kleine noch zu gefährlich, jedenfalls, solange sie nicht trittsicher war und wie ein Geißlein das Gleichgewicht halten konnte. Über das Gezeter hinweg schlüpfte Anna aus den Holzpantinen, schnürte sich die Bergstiefel und stimmte eine Melodie an, ein Lied ihres Liebsten, der im Gegensatz zu ihr wirklich singen konnte.
Auf einem Baum ein Kuckuck, simsalabim, bamba saladu saladim, auf einem Baum ein Kuckuck saß …
Die weiteren Strophen waren nicht gerade kindgerecht, handelten von Tod und Wiedergeburt. Helene gefiel es trotzdem, sie beruhigte sich, brabbelte mit, und sobald sie nach draußen traten, juchzte sie sogar. Dort gab es so viel zu entdecken, für sie schien jeder Tag ein Abenteuer. Besonders die Hühner im Gehege, das sie vor Adler und Fuchs schützte, gefielen ihr, und sie klatschte in die kleinen Hände, als Anna ihnen ein paar Weizenkörner zuwarf. Die Welt mit ihrem Zusammenspiel brachte nicht nur ihre Tochter zum Staunen. Wenigstens sie beide waren hier oben fern vom Tal in Sicherheit. Anna stellte eine ihrer selbstgetöpferten Schüsseln neben sich, ging in die Hocke und fing an, die kleinen Kohlköpfe von den Strünken zu drehen. Groß waren sie nicht. Die grünen Röschen hätten besser noch eine Weile gehabt. Aber lieber so als gar nichts. Zumindest würden auch sie ihre Vorräte bereichern und helfen, die nächste Zeit zu überstehen, wenn der Wind den Schnee auf ihr Beet trug. Hoffentlich kehrte vorher ihr Liebster heim.
Als wollte man ihnen ihr gemeinsames Glück nicht gönnen, war auch er einberufen worden, um die Heimat zu verteidigen. Seit fünf Monaten und acht Tagen hatte Anna nichts mehr von ihm gehört. Jeden Abend, wenn Helene schlief, schrieb sie ihm, erzählte, was sie erlebt hatte, aber auch, was ihr durch den Kopf ging und womit sie sich beschäftigte. Hin und wieder zeichnete sie etwas, besonders dann, wenn es ihr nicht gelang, ihre Gedanken in Worte zu fassen, und sie sich auf diese Weise besser ausdrücken konnte. Mit jeder Faser ihres Seins vermisste sie ihn. Manchmal glaubte sie, vor Sehnsucht zu ersticken. Bald, bestimmt in einem unerwarteten Moment, wenn sie gerade nicht nach ihm Ausschau hielt, würde er von Kochel durch die Rappinschlucht oder von der Jachenau, je nachdem, von wo er sich zu ihnen durchschlagen konnte, heraufsteigen und von weitem seinen Hut oder jetzt die Soldatenmütze schwenken. Wie damals, als sie schon glaubte, für immer allein zu sein. Erschöpft würde er sein, aber zum Glück unverletzt, dem Krieg zum Trotz. Jeden Tag und besonders in den Nächten, wenn die Kleine sie weckte und ihr Fläschchen verlangte, flehte sie darum. »Sag mal Pa-pa.« Anna zeigte oft auf die gerahmte Fotografie von ihm. Mama konnte Helene bereits sagen. »Mamamamam« bedeutete aber auch, dass sie Hunger hatte. Seit dem Sommer stillte Anna nicht mehr. Vermutlich von der vielen Arbeit und weil sie kaum zur Ruhe kam, war ihre Milch versiegt. Jetzt musste Tossa Helene miternähren. Anna hatte einen Stoffbeutel genäht, eine Art Büstenhalter, wie er vor ein paar Jahren für die Frauen als Alternative zum Korsett wieder in Mode gekommen war. Diesen Beutel zog sie der Kuh über das Euter, um ihre Zitzen zu verbergen, damit das Kalb ihrer Tochter etwas von der kostbaren Milch übrig ließ. Erneut hörte sie Tossa muhen, diesmal klang es weiter entfernt. Klagend, gegen Ende fast schon schrill, so als hätte sie Schmerzen und Anna das Melken versäumt. Normalerweise antwortete das Kalb, doch es blieb still. Merkwürdig. Da stimmte etwas nicht. Anna vergewisserte sich, dass die Knoten im Tuch, das Helene hielt, fest waren und suchte die Weide ab. Als sie über die Buckelwiese bergab lief, nahmen ihr vereinzelte Nebelschwaden die Sicht. »Tossa, Too-ssa!« Sie rief nach der Kuh. Auch Helene auf ihrem Rücken gab ein paar Laute von sich, es klang wie »Sasa«. Was für eine Freude, nun konnte sie auch das. Nur schade, dass ihr Mann das nicht miterlebte. Anna hangelte sich am Holzzaun entlang, bei dem die Querbalken kunstvoll mit Weiden an die Pfosten geflochten waren, bis sie unten am Weg das Gatter erreichte. Es stand offen. Manchmal vergaßen Wanderer beim Aufstieg zum Rabenkopf, es wieder zu schließen, doch um diese Jahreszeit, Ende Oktober, verirrte sich selten jemand hier herauf. Für einen Augenblick stockte ihr das Herz. War es vielleicht ihr Liebster? Dass er es endlich zu ihr geschafft hatte? Nein, keine Menschenseele weit und breit, außer ihr und dem Kind. Anna sah sich um und entdeckte endlich die grau Gehörnte. Sie stand weiter unten am Abhang, streckte den Kopf vor und muhte abermals durchdringend laut. Anna folgte dem Pfad dicht am Berg entlang, rechts von ihr fiel das Gelände steil ab. Auf einem bewachsenen Vorsprung, ein paar Meter die Felsen hinauf, erblickte sie jetzt auch das Kalb. Offenbar hatte es sich mit dem Halsriemen in einem Ast verfangen und kam nicht los. Wie war es nur dahingelangt? Es röchelte, bekam kaum mehr Luft, seine Zungenspitze lugte aus dem Maul. Was sollte sie tun? Erst ihre Tochter ins Haus zurückbringen und danach zu dem Kalb hochklettern, um es zu befreien? Aber das konnte für das Tier zu spät sein. Vorsichtig trat sie auf das Geröll. Die Steine waren rutschig, manche gerieten unter ihren Sohlen in Bewegung und kullerten in den Nebel hinab. Anna kam ins Wanken. Sie beugte sich vor, krallte sich an das Gestrüpp, das sie auf der Bergseite zu fassen bekam. Schnell tastete sie nach ihrer Tochter, die keinen Mucks von sich gab. War sie eingeschlafen? »Gleich, Loretta, ich bin gleich bei dir«, sprach sie auf das Kalb ein, je näher sie kam, damit es sich nicht erschreckte. Schließlich hatte sie es erreicht, umschlang es und hielt sich an ihm fest, bis sie selbst sicher stand. Sie riss an dem Halsriemen, zog ihn kurz noch mal fester zu, um den Dorn der Schnalle aus seinem Loch zu lösen. Kurz hielt auch sie die Luft an, dann war es geschafft. Das Kalb schüttelte sich, als wollte es lästige Fliegen loswerden, glitt mit einem Vorderbein aus und schwankte. Hastig hielt sich Anna an der Kiefer fest. Um ein Haar wären sie alle drei abgestürzt. Als sie mit Kalb und Kind kehrtmachen wollte, stand plötzlich Tossa da. Die Kuh war ihnen auf dem schmalen Grat, der kaum für ein Paar Füße breit genug war, gefolgt. Nun gab es kein Vor und Zurück.
Mein Liebster,
stell Dir vor, Helene kann sich fortbewegen. Du würdest staunen, wie sie das macht. Sie schiebt sich sitzend, die Beinchen angewinkelt wie ein kleiner Frosch, vorwärts. Noch dazu in was für einer Geschwindigkeit!
Sie kaut ständig auf der Veilchenwurzel herum, die ich ihr um den Hals gehängt habe, ich glaube, der erste Zahn bricht durch.
Mit der Sauberkeit klappt es schon viel besser, ich muss nur noch mehr auf ihre Laute achten und sie vor allem richtig deuten. Sie sagt mir nämlich, wann sie muss. Nur darf ich diesen Moment nicht verpassen. Denn dann geht es gleich los. Gar nicht so leicht bei allem, was sonst noch erledigt gehört. Doch es würde mir das lästige Auskochen der Windeln ersparen.
Apropos: Die Früchte des Tonkabaums sollen, zwischen die Wäsche gelegt, einen angenehmen Duft verbreiten, behauptete Alexander von Humboldt. Nur leider hat unser Baum mit den gefiederten Blättern auch heuer nicht getragen. Macht nichts, die Wäsche duftet sowieso von ganz allein nach frischer Bergluft. (Falls ich sie nicht draußen in der Kälte vergesse und sie am Ofen wieder auftauen muss.)
Alles, was von diesem Erntejahr übrig geblieben ist, habe ich eingeweckt, und das ist einiges. Der Winter kann kommen, und es wird für uns drei reichen. Falls das Heu knapp wird, können wir ein paar Leintücher voll von der Fiedleralm holen, das habe ich organisiert. Der jährliche Tanz von Hof zu Hof fiel heuer leider aus, weil die Fiedlerbuben ebenfalls eingezogen worden sind.
Im Haus duftet es nach Schafgarbe, Kamille, Frauenmantel, Pfefferminze und vielem mehr. Ich hab auch Wegerichwurzeln gesammelt. Gleich beim letzten Neumond. Die helfen gegen Schwellungen jeder Art und auch bei Knochenbrüchen. Unsere Winterapotheke. Wir sind gewappnet. Die Ringelblumen, die heuer ums Haus herum gewachsen sind, habe ich in Öl eingelegt. Wusstest Du, dass die Ägypter die Calendula als Verjüngungsmittel verwendeten? Ich werde mich täglich damit salben, damit ich für Dich frisch bleibe, bis Du endlich zurück bist.
Friesenegger, Du weißt schon, der Hausierer, hat mir vor vierzehn Tagen Lebensmittel, insbesondere Weizen, Salz und Wolle (Überraschung: Ich will Dir was stricken), aber leider keine Post von Dir mitgebracht. Was der Mann alles in seiner Kraxe auf dem Buckel heraufschleppen kann, trotz seiner siebenundsechzig Jahre! Er behauptet, dass die Alliierten bereits im August die Frontlinie in Frankreich durchbrochen hätten. Hier oben kriege ich ansonsten nichts mit. Früher hat mir Franz Marc ab und zu von den Neuigkeiten aus dem Tal berichtet, wenn er zum Malen heraufstieg, aber das ist leider vorbei. Seine Pferdeskizze von Komet, die er mir geschenkt hat, habe ich in die Stube über seine Wandmalerei gehängt. Marcs Beerdigung war schon letztes Jahr, sagte Friesenegger, seine Frau hat seinen Leichnam aus Verdun nach Kochel überführen lassen. Bitte, mein Liebster, ich bange um Dich, und ich will auch weiter tapfer sein, aber lass mich nicht das Gleiche wie Maria Marc durchmachen! Da ich nichts von Dir höre, ist das, was der Hausierer sagt, ein Hoffnungsschimmer. Der Krieg ist bald vorbei, und Du kehrst zurück … für immer.
Ich arbeite an neuem Geschirr mit Schlickmalerei, weiß noch nicht, ob es gelingt. Schicke Dir Zeichnungen oder, noch besser, Du schaust Dir das Getöpferte in Wirklichkeit an.
So, nun noch ein letzter Vers eines Gedichts von Goethe. »Eins und Alles«, das Dich trösten soll bei allem, was Du gerade ertragen musst:
Es soll sich regen, schaffend handeln,
erst sich gestalten, dann verwandeln!
Nur scheinbar steht’s Momente still.
Das Ewige regt sich fort in allen:
Denn alles muss in Nichts zerfallen,
wenn es im Sein beharren will.
Aus: Annas Tonkaalmbuch
Eva
München, Februar 1976
Am Brunnen, aus dem unter einer Abdeckung die riesige grünblaue Skulptur einer Schlange ragte, blieb sie stehen und sah sich um. Als sie sicher war, dass sie niemand beobachtete, hob sie ihr Handgelenk an die Nase, schloss die Augen und sog den Duft ihrer eigenen Haut bis zum Ellenbogen ein. Das neutralisierte ihren Geruchssinn, verbannte alles, was sie zuletzt eingeatmet hatte, in ihr Gedächtnis und schenkte ihr Kraft und Raum für Neues. Drei Minuten noch, dann war auch das akademische Viertel ausgeschöpft, und Eva käme wirklich zu spät. Nur weil sie sich länger als beabsichtigt bei dem alten Herrn Blei aufgehalten hatte, dem sie im Auftrag der Apotheke, in der sie neben dem Studium arbeitete, die Medikamente nach Hause brachte. Diesmal hatte sie seine Einladung zum Tee nicht ausschlagen können, auch wenn in der verwinkelten Altbauwohnung mehr als tausend Gerüche steckten, die Eva bedrängten und ihr alle etwas erzählen wollten. Dabei musste sie sich auf den Kunden konzentrieren, der froh wirkte, dass sie sich Zeit nahm, weit ausholte und sich in Anekdoten aus seiner Jugend verlor. Als sie sich endlich lossagen konnte, war sie in die vollbesetzte Tram gestiegen und bis nach Großhadern gefahren, wo die Pharmazie mit der Toxikologie und der Tiermedizin als Teil der Münchner Universität untergebracht war. Falls sie sich jetzt nicht beeilte, würde sie die letzte Stunde der Arzneimittellehre verpassen, ihr Lieblingsfach, das heute zum Ende des Wintersemesters im Labor stattfand. Oder sie würde nur einen schlechten Platz weit hinten mit ramponierten Geräten bekommen. Die Nase noch an ihrer Haut, atmete Eva tief aus und ein und wappnete sich. Dann hob sie den Rucksack, den sie sich aus ihrer alten Lieblingsjeans genäht hatte, auf die Brunnenabdeckung, zog die Sachen, die sie gleich brauchen würde, heraus und stopfte dafür Winterjacke, Schal und Mütze hinein. Anders als in ihrem Heimatort, der kurz vor Garmisch sechshundertachtundachtzig Meter über dem Meeresspiegel lag und in dem sich noch der Schnee türmte, taute es in München seit ein paar Tagen. Die Sonne schien und wärmte. Vereinzelt hatten Cafés sogar schon Tische rausgestellt, und tatsächlich schlürften ein paar Hartgesottene das erste Kännchen Kaffee an der frischen Luft. Es roch nach Frühling, stellte Eva fest, wobei das für sie ein Potpourri aus unzähligen Düften bedeutete. Hastig schlüpfte sie in den Kittel, schulterte ihren Rucksack und presste den wertvollen Rundkolben an sich, den sie sicherheitshalber lieber selbst mitbrachte. Sie spurtete los, hastete die breite Treppe nach oben. Von weitem sah sie, wie zwei Männer auf der Empore mit einer Anlegeleiter hantierten. Erst glaubte sie, Handwerker würden auf umständliche Weise eine Lampe reparieren, doch die Leiter war viel zu kurz, um die Decke zu erreichen. Einer der Männer wirkte mit seinem blonden Vollbart wie ein bayerischer Nikolaus. Er war barfuß, trug eine ausgefranste Jeans und ein Unterhemd mit einem aufgemalten Peace-Zeichen.
»Beeil dich, Milo«, hörte sie ihn rufen, während er die Leiter hielt. Der andere, in bunt geringeltem Rolli zu heller Schlaghose, trug eine Hornbrille, schwarz wie seine schulterlangen Haare. Ungeachtet seines Kameraden, dem vor Anstrengung die Adern am Hals und an den Armen hervortraten, stieg er gemächlich Sprosse für Sprosse die Leiter nach oben und versuchte dabei, eine Papierrolle zu öffnen. Fehlte nur noch ein Trommelwirbel, und die Artistennummer wäre perfekt. Jemand kicherte. Weitere Studenten blieben stehen, um zuzuschauen. War das ein Happening? Seit neuestem fand Kunst überall statt. Hoffentlich kam Eva zügig an den Leuten vorbei, die sich jetzt auf der Treppe stauten. Doch gerade als sie die letzte Stufe erreichte, stolperte sie, der Rundkolben glitt ihr aus der Hand und schlitterte mit seinen drei Hälsen über den Boden, drehte sich wie ein Eisstock um die eigene Achse und landete zwischen den Beinen des Gladiators im Unterhemd. Er wankte, ließ die Leiter los. Die Leute lachten laut, als wäre ihr Missgeschick Teil des Happenings. Der bunt Geringelte stürzte, fiel auf seinen Spezl, die Leiter obendrauf. Zuletzt segelte der mittlerweile ausgerollte Papierbogen herab. Es schepperte und krachte.
Eva hastete zu ihnen. »Das wollte ich nicht. Seid ihr verletzt?« Sie wusste nicht, wo sie anpacken sollte. Bei den schmutzigen Füßen oder den wuscheligen Haaren? Sie hob die Leiter von dem Kuddelmuddel aus Hintern, Beinen, Armen, möglichst ohne einen von ihnen anzulangen, und spürte sie doch. Endlich hatten sich die Männer voneinander befreit und sich aufgerappelt. Niemand sonst war ihnen zur Hilfe geeilt, im Gegenteil, die Menge applaudierte, löste sich dann schnell wieder auf, als wäre die Show zu Ende und man wollte dem Sammelhut entgehen. Eva merkte, wie ihr Gesicht zu glühen anfing. Im Kontrast zu ihrem Kittel leuchtete sie bestimmt so dunkelrot wie eine Stichflamme aus Lithiumchlorid. Über die Kerle gebeugt, war ihr der Duft der beiden in die Nase gestiegen, den sie sich sofort eingeprägt hatte. Der von der Leiter Gestürzte verströmte einen Hauch von Sandelholz mit einer Prise Vanille. Der andere, der vollbärtige Kraftprotz, der sie angegrinst und ihr die Hand entgegengestreckt hatte, damit sie ihm aufhalf, roch nach Moschus, vermischt mit Minze, vielleicht von einem Kaugummi. Beides löste in ihr ein Bauchkribbeln aus, was sie irritierte. Eva ignorierte seine Hand, hob stattdessen die Hornbrille auf, auf die sie fast getreten war, und gab sie dem Dunkelhaarigen. Samt dem Glas, das herausgefallen, aber zum Glück unbeschädigt war. Das würde leicht zu reparieren sein, und da sich keiner ernsthaft weh getan hatte, stahl sie sich davon.
»Hey, Moment, wo willst du denn so schnell hin?« Der Friedensapostel hechtete ihr nach und hielt sie am Kittel fest. »Erst bringst du uns fast um, und dann willst du dich, mir nichts, dir nichts, aus dem Staub machen? Fürs Protokoll: Name, Telefonnummer?«
Eva mochte es nicht, festgehalten zu werden, und riss sich los. »Ihr wollt mich anzeigen? Aber ich hab mich doch entschuldigt. Es war ein Unfall, und es tut mir echt leid.«
»Trotzdem.« Auf einmal klang er sehr förmlich, verschränkte die Arme und baute sich vor ihr auf. »Also, wie heißt du?« Hellblaue Augen in seinem behaarten Gesicht funkelten sie an.
»Klein, Eva«, sagte sie, die Telefonnummer ihres Elternhauses würde sie ihm nicht ohne weiteres geben. Ihr war das Ganze mehr als peinlich. Sie machte erneut kehrt und spürte, wie ihr jemand jetzt auf die Schulter tippte.
»Warte, hiergeblieben.« Sie wich der Berührung aus, als hätte sie einen elektrischen Schlag bekommen. Sollte sie ihnen einfach irgendeine Nummer nennen, damit sie sie endlich in Ruhe ließen? Ihren richtigen Namen wussten sie schon, es wäre ein Leichtes, übers Sekretariat auch den Rest herauszufinden. Warum hatte sie nicht von Anfang an gelogen? Jetzt war es zu spät. »Du hast deine Blumenvase vergessen.« Der Wuschelkopf hatte die Brille mit nur einem Glas aufgesetzt und hielt ihr den Rundkolben entgegen.
Wie durch ein Wunder war er ganz geblieben. Eva atmete auf. Sonst wären sechzig Mark und damit sechs Stunden Arbeit futsch gewesen. »Ihr seid anscheinend keine Naturwissenschaftler.«
»Natur schon, aber statt Wissenschaft eher freie Liebe«, antwortete der Barfüßige und zog einen Mundwinkel schief. »Ich bin Udo und das ist …« Er zeigte auf seinen Freund.
»Milo, stimmt’s?«, rutschte ihr heraus.
»Eigentlich Maximilian Leopold.« Im Gegensatz zu Udo blieb er ernst, was ihr gefiel. »Aber für dich bin ich natürlich auch Milo.« Wieder flatterte etwas Unbekanntes durch ihren Körper. Als sie ihm den Rundkolben abnehmen wollte, ließ er ihn los. Sie sprang vor, glaubte schon, das Gefäß würde nun doch zerschellen, aber Udo fing es gekonnt auf. Die beiden Komiker hatten anscheinend mehrere Nummern parat. Schnell entriss sie ihnen den Kolben, drückte ihn an sich und lief weiter.
»Wir sehen uns, Kleineva«, rief Udo ihr nach. »Auf unserer Party!« Auf welcher Party, fragte sie sich. Das letzte Mal hatte man sie in der Grundschule eingeladen, und das auch nur gezwungenermaßen, weil die Mutter des beliebtesten Jungen der Klasse zugleich eine Stammkundin ihrer Eltern war. Gerade als jemand die Tür von innen zuziehen wollte, schlüpfte Eva ins Labor.
»Ach, welch Ehre, das Fräulein Klein beehrt uns heute auch mit seiner Anwesenheit.« Professor Hacker erntete einige Lacher. Nach drei Semestern und gründlichem Aussieben der Erstis hatte er sich offensichtlich ihren Namen gemerkt. Sie huschte an seinem Pult vorbei, auf dem er bereits einige Geräte für eine Versuchsreihe aufgebaut hatte, und hoffte, dass er ihre Verspätung schnell vergaß. Weit gefehlt. »Da Sie meine Einleitung zu unserer letzten Vorlesung verpasst haben, nehme ich an, dass Sie bereits die Bestandteile von Cremes kennen?«
»Äh, ja, Cremes sind Zwei-Phasen-Systeme, hydrophil und lipophil.« Sie bereitete sich jedes Mal gründlich vor, lernte den Stoff aus den Büchern und Unterlagen auswendig. Noch dazu war Kosmetik und Salbenherstellung ihre Leidenschaft, für die ihr nur die Theorie und die wissenschaftliche Grundlage fehlten. Deswegen hatte sie Pharmazie als Studienfach gewählt. Eva hielt ihre Tasche und den Rundkolben hoch und schlängelte sich durch die Reihen an den anderen vorbei. Jasmin winkte ihr. Sie war meistens ihre Laborpartnerin und hatte ihr auch heute wieder einen Platz in der vierten Reihe frei gehalten.
»Und das heißt?« Offenbar wollte Hacker ihr Wissen testen und herausfinden, ob sie nicht nur auswendig lernte, sondern auch begriff, von was sie sprach.
Eva blieb am Rand der dritten Reihe stehen und wandte sich um. »Cremes bestehen aus Wasser und Fett.«
»Und wie würden Sie bei der Herstellung vorgehen?«
»Ich würde die hydro- und lipophilen Anteile abwiegen und im Wasserbad schmelzen, bis beide die exakt gleiche Temperatur haben.« Sie hoffte, genug ausgefragt worden zu sein, hangelte sich zu ihrem Platz durch und legte ihre Sachen ab.
Doch der Professor ließ nicht locker. »Sind Sie nicht die Nase unter uns, die angeblich zehntausend Gerüche unterscheiden kann?« Eva zog die Schutzbrille aus ihrem Rucksack und sah sich um. Erst als Stille einkehrte und alle Blicke auf sie gerichtet waren, wurde ihr klar, dass er sich weiterhin mit ihr unterhielt und tatsächlich sie meinte.
»Zehntausend? Das ist nichts Außergewöhnliches, so viele Gerüche nimmt durchschnittlich jeder Mensch im Laufe seines Lebens wahr. Das Einprägen und Wiedererkennen der Duftmoleküle ist die Kunst. Für alles, was riecht, gibt es nur vage Umschreibungen, aber keine genauen Bezeichnungen, darum fällt den meisten die Unterscheidung schwer.« Bisher hatte sie noch nie von ihrer Gabe gesprochen, noch dazu vor Leuten, die sie, wenn überhaupt, nur vom Sehen kannte.
»Soso, wir haben also eine Künstlerin in unseren Reihen, welch Ehre.« Erneut erntete er einige Lacher. »Dann kommen Sie her, Fräulein Klein, und zeigen uns, was Sie draufhaben«, forderte Hacker sie auf. »Wollen wir mal sehen, ob sich Wissenschaft und Kunst vertragen. Mischen Sie uns eine Creme, sagen wir für den Hausgebrauch, wenn Ihnen das nicht zu banal erscheint.« So viel Aufmerksamkeit, und gleich zweimal hintereinander, war sie nicht gewohnt. Ihr Herz schlug bis zum Hals, als sie nach vorne ging. Sie schluckte dagegen an und besann sich auf das, was sie bereits konnte. Und das war keine Kosmetikherstellung nach Vorschrift oder nach Lehrplan, aber dafür nach Gefühl. Schon als Kind hatte sie es geliebt, mit Düften zu experimentieren und ihre Freundinnen wie Jasmin, aber auch Familienmitglieder in »Evas Salon« mit selbst angerührten und oftmals angebrannten Ölen und Cremes mehr oder weniger zu verwöhnen. Im Studium ging es hingegen um den Verstand, nicht ums Gefühl, und das forderte sie heraus. Kurz dachte sie noch mal an den Unfall mit dem Rundkolben. War sie vielleicht doch nicht die Unscheinbare, für die sie sich selbst hielt? Das Landei, das gegen den Willen der Eltern in der Stadt studierte? Vermutlich hätten Udo und Milo mit jeder Frau, die ihnen etwas zwischen die Beine warf, geflirtet. War es überhaupt ein Flirt gewesen, oder hatten sie sie bloß auf den Arm genommen? Eva kannte sich mit dem Anbaggern nicht aus, und wenn, dann schwärmte sie für Mädchen, die stets schöner, größer oder klüger waren als sie. Aber die beiden Jungs hatten etwas Besonderes an sich gehabt, so viel stand fest. Würden sie sich wiedersehen? Warum hatte sie es versäumt, sie zu fragen, was sie studierten?
»Sie machen es spannend mit Ihrer Kunst.« Der Professor schaute auf seine Armbanduhr, die er trug, obwohl Schmuck im Labor nicht erlaubt war.
»Für welchen Zweck soll die Creme sein? Sie sagten Hausgebrauch, aber für was für einen Typ?« Eva straffte sich und konzentrierte sich auf die Aufgabe.
»Schlagen Sie etwas vor.«
»Für Sie vielleicht? Ihre Haut neigt zu Rötungen, Sie haben schuppige Hände, bestimmt von der vielen Reinigung und der mangelnden Pflege. Ich wüsste etwas, das Ihr Hautbild verbessert.«
»Oha, eine Analytikerin sind Sie auch noch! Fehlt nur, dass Sie auch meine Träume deuten.« Rasch vergrub der Professor seine Hände in den Kitteltaschen, als wollte er sie vor weiterer Inspektion verbergen. »Los, machen Sie, einen Versuch ist es wert.« Eva nickte und begann. Hoffentlich zitterten ihre Finger nicht, dachte sie noch, wenn sie gleich etwas vorführte, aber dann begab sie sich in ihre innere Duftbibliothek, schritt die Räume ab, die in allen Farben für sie leuchteten, und blieb vor einem bestimmten Regal stehen. Sollte sie ihr Publikum schnell betören oder mit Raffinesse beeindrucken? Was würde den Professor überzeugen? Nachdem sie sich für ein Rezept entschieden hatte, öffnete sie den Laborschrank mit den Aromen und wählte die Zutaten aus. Auf einmal war sie in ihrem Element und vergaß alles um sich herum. Aus dem Kühlschrank im Labor holte sie, was sie brauchte, wog alles sorgfältig ab und schmolz Lanolin, Bienenwachs und Kakaobutter in einem Wasserbad.
»Lassen Sie uns bitte in Ihren Kopf sehen und hören, was Sie vorhaben«, bat Hacker und riss sie aus ihren Gedanken. »Das Ganze soll kein Stummfilm sein.«
»Natürlich.« Sie straffte sich. »Ich werde dreißig Gramm Jojobaöl in das Fett tropfen«, sagte sie und tat es. Den Duft liebte sie besonders. Ihren Kommilitonen ging es ähnlich, sie kamen aus den Reihen nach vorne, umringten das Pult und schnupperten. Eva wusste den Wohlgeruch noch zu steigern, erhitzte Orangenblüten in einem Topf und rührte sie in das geschmolzene Fett. Diesem Aroma erlag so gut wie jeder. Selbst ihre Oma, die manchmal ein richtiger Griesgram sein konnte und lieber ihre eigenen Süppchen kochte, heiterte sie jedes Mal mit nur einem Hauch davon auf. Eva nahm die Creme von der Herdplatte und rührte so lange weiter, bis die Masse abgekühlt war. »Bitte sehr. Mein Jojobarahm. Wenn er völlig kalt ist, wird er fester, aber zum Probieren …« Sie reichte Hacker ein Holzstäbchen, damit er sich etwas von der Creme auf die Hand auftragen konnte.
Er winkte ab. »Leider bin ich gegen Orangen allergisch.«
»Darf ich dafür mal?«, meldete sich Jasmin, deren Gesicht mehr Mitesser als Sommersprossen zierten. Und auch die anderen drängten vor, um einen Klecks ihrer Creme zu ergattern. Bald wirkte der Topf wie ausgeschleckt. Sämtliche Nasen, Hände, Arme, einfach alles an sichtbarer Haut ringsum glänzte. Doch die Prüfung schien noch nicht zu Ende zu sein.
»Was unterscheidet Cremes von Salben, Fräulein Klein? Und wie bewahrt man sie auf?«
Da brauchte sie nicht lange zu überlegen, das hatte ihr Meitl, der Apotheker, eingebläut. »Eine Salbe wird zur Heilung verwendet, eine Creme zur Pflege. Ohne chemische Zusätze sollten beide verschlossen vor Licht und Luft geschützt werden, damit sie sich länger halten und die Essenzen nicht verduften.«
Hacker nickte, seine Miene verriet jedoch nichts. Er machte sich eine Notiz in seinem Minispiralblock, den er in der Brusttasche seines Kittels trug, was, wie man munkelte, ein gutes Zeichen war. Bei den Kommilitonen, die bereits geprüft worden waren, hatte sich das jedenfalls bestätigt.
»Echt stark«, sagte Jasmin, als sie das Labor verließen. »Du hast es drauf, Eva. Kannst du noch mehr so Zeug?« Sie wohnten nur ein Dorf auseinander, kannten sich seit der fünften Klasse vom Gymnasium und unterhielten sich, anders als mit den meisten anderen, ohne Anstrengung auf Bayerisch.
»Kommt drauf an.« Eva zuckte mit den Schultern. Mit ihrer Gabe hatte sie sich bisher eher als Außenseiterin gefühlt und sie lieber verschwiegen.
»Weißt du vielleicht auch was gegen meine Pickel? Ich hab schon alles durch, Kinderarzt, Hautarzt, Psychologe. Sogar die Pille hab ich eine Zeitlang genommen, aber genützt hat’s nichts, im Gegenteil. Außer dass ich zehn Kilo zugenommen habe, bin ich nicht mal entjungfert worden, leider.« Ihre Mundwinkel zuckten.
Eva sagte nichts dazu, obwohl in ihren Gedanken kurz ein Bild von ihrem ersten Mal aufblitzte. Und Jasmin war damals sogar auf derselben Feier gewesen, aber solange sie nicht genauer nachfragte, würde sie nichts preisgeben. Beste Freundinnen waren sie nie geworden. Eher ihren Müttern zuliebe hatten sie sich auch im Studium verbündet.
»Es heißt, wenn man schwanger wird, ändert sich der Hormonhaushalt und damit die Haut. Aber ich will erst beruflich weiterkommen, bevor ich auf ewig Hausfrau werde und am Kochtopf versauere. Noch dazu interessiert sich eh kein Kerl für mich, solange ich aussehe wie ein Streuselkuchen.«
»Hast du es mal mit Heilkleie probiert?«
»Ist das so ein Esoterikkram, der nur mit Zauberspruch funktioniert?«
»Nein«, Eva lachte, »das ist Weizenkleie in Kombination mit Kamille und geschrotetem Leinsamen.«
»Geschrotetem was? Das klingt gefährlich. Wo krieg ich so was her? Im Jagdfachhandel?«
»Eher im Reformhaus. Hast du trockene oder fettige Haut?« Sie befragte sie so, wie sie es von Meitl gelernt hatte, auch wenn sie ihr Hautbild sah und es selbst beurteilen könnte. Aber sie war keine Ärztin, sondern entschied erst, wenn die Diagnose gestellt war.
»Sehr trocken, manchmal schuppt meine Haut wie die vom Hacker, und ich kann gar nicht aufhören zu kratzen. Deswegen finde ich deine Creme auch so super.« Jasmin roch noch mal an ihren Händen.
»Verstehe. Am besten löst du morgens und abends eine Handvoll Weizenkleie und geschroteten Leinsamen zusammen mit dreißig Tropfen Kamillentinktur in einer Schüssel mit lauwarmem Wasser auf, reibst dir damit das Gesicht ein und lässt es ein paar Minuten einwirken, bevor du es wieder abwäschst.«
»Ein paar Minuten! Weißt du, was morgens bei uns los ist, wenn ich zu lange im Bad brauche? Mein Bruder tritt die Tür ein.« Jasmin blieb stehen. »Hey, was soll das? Welcher Idiot hat das denn gemacht?« Sie waren in der Aula auf der Höhe des Schwarzen Bretts angelangt, an dem ein riesiges Papier klebte, das alle anderen Informationen verdeckte. »Ist neuerdings etwa das Aushängen verboten? Wie soll ich denn jetzt Minkis Junge loswerden?« In großen Streifen riss sie das weiße Papier herunter, bis ihr Zettel zwischen den vielen anderen wieder sichtbar wurde:
Drei allersüßeste getigerte Halbangorakätzchen zu verschenken.
»Warte.« Eva fiel der kleine Schriftzug ins Auge, der in der Mitte des ansonsten unbedruckten Plakats gestanden hatte. Mit der abgerissenen Hälfte, die bereits auf dem Boden lag, setzte sie ihn wieder zusammen. Das war doch das Manifest von Udo und Milo. Sie hatte geglaubt, es ginge um etwas Politisches oder Künstlerisches, keine Angst vor der weißen Leinwand oder einen Aufruf zur nächsten Anti-Atom-Kundgebung, aber es war eine Einladung zu einer Faschingsfeier für morgen, Samstag, an dem zugleich ihr zweiundzwanzigster Geburtstag war. Wie in Studentenkreisen üblich, hatten sie offenbar auch gegen das Diktat der Rechtschreibung Widerstand geleistet und gänzlich auf Großbuchstaben verzichtet:
zwangloser maskenzwang:
komm als du selbst
oder für was du dich hältst
bring was zu mampfen mit
oder den neuesten hit
für gesöff sorgen wir
von der kaulbachstraße vier
Also diese Party hatten sie vorhin gemeint und sie sogar persönlich eingeladen. Udo und Milo wohnten anscheinend in Maxvorstadt. Die Kaulbachstraße verlief zwischen Leopoldstraße und Englischem Garten und verband Maxvorstadt mit Schwabing. In den Pausen streifte Eva manchmal vom Odeonsplatz in das Künstlerviertel mit seinen besonderen Villen bis zur Kunstakademie. Dabei hielt sie nach den Nordfenstern in den Dachgeschossen Ausschau, hinter denen sie Ateliers vermutete. Meistens landete sie auf der Suche nach alten Pflanzen- oder Medizinbüchern in einem der Antiquariate, die es dort neben vielen Buchhandlungen und Buchbindereien gab. Richtig fündig war sie noch nicht geworden. So ein Buch, wie es ihr vorschwebte, gab es vielleicht auch gar nicht in Wirklichkeit. Jedenfalls hatte sie es bisher noch nicht entdeckt. Dennoch liebte Eva es, in alten Bildbänden mit farbigen Illustrationen zu blättern, sich den unvergleichlichen Duft einzuprägen, der in gebrauchten Büchern so manches Schicksal konserviert hatte. Oft kaufte sie einen Roman oder ein Fotobuch nur wegen eines besonderen Lesezeichens oder der Zeitungsausschnitte, die der Vorbesitzer zwischen den Seiten hinterlegt hatte, und entblätterte über den Buchinhalt hinaus noch ein weiteres Leben – das des Vorbesitzers. In Schwabing hatte es früher legendäre Künstler- und Studentenfeste gegeben, wie es in einem Stadtführer hieß. Auch die Studentenproteste 1962 waren von dort ausgegangen und hatten sich danach deutschlandweit verbreitet. Rebellion! Wo Künstler waren, war etwas los. Und vor allem würde sie Milo und Udo wiederbegegnen. »Wollen wir zusammen zu der Party gehen?« Sie deutete mit dem Kinn auf die Papierstücke, die sie noch immer aneinanderhielt und die für sie jetzt so etwas wie eine persönliche Einladung waren.
»Morgen Abend?« Jasmin schaute kurz drauf. »Ich weiß nicht. Das ist bestimmt wieder so eine Ratschfete, auf der nur über Weltpolitik diskutiert und kaum getanzt wird. Oder es geht erst nach Mitternacht los, wenn alle ordentlich zugedröhnt sind.« Sie wusste nicht, dass Eva Geburtstag hatte – so gut wie niemand wusste das. »Außerdem muss ich packen. Wir fahren Sonntagfrüh für sechs Wochen in die Toskana.«
»Sechs Wochen? Lernst du gar nicht?« Gleich nach den Semesterferien im März standen Klausuren an, auf die sich Eva, neben ihrem Job in der Apotheke und allem anderen, was ihre Eltern ihr zu Hause aufdrückten, gründlich vorbereiten wollte. Zudem wartete im Sommer das erste Staatsexamen auf sie. Dafür musste sie sich noch anmelden und ihre Geburtsurkunde vorlegen, das durfte sie nicht vergessen. Es gab viel zu tun.
»Komm doch mit nach Italien«, schlug Jasmin vor. »Meine Eltern hätten bestimmt nichts dagegen. Wir beide, das wär’s! Wir könnten ein bisschen rumfahren, ich krieg bestimmt das Auto. Meinetwegen auch zusammen lernen, wenn du unbedingt willst«, ergänzte sie, als Eva auf all die Vorschläge nicht reagierte. »Siena, Arezzo, Florenz. Warst du schon mal dort?«
Eva verneinte, die Toskana kannte sie bloß aus Beschreibungen, insbesondere aus der Biographie über Leonardo da Vinci, der neben so vielem anderen auch Botaniker gewesen war. Ihre Familie machte nie Urlaub, höchstens, wenn sie Verwandte in Norddeutschland besuchten, aber das war meistens eher anstrengend als entspannend oder inspirierend. Dabei wohnten sie so nah an den Alpen, und bis nach Italien war es kaum mehr als ein Katzensprung.
»Allein die italienischen Gassen, wie es da überall riecht, das wäre doch was für dich. Und im März ist es dort schon viel wärmer als hier, da blüht alles.«
»Ich wusste gar nicht, dass du so naturverbunden bist.«
Jasmin grinste. »Meine Eltern haben mir nicht umsonst diesen Namen gegeben. Aber du hast recht, ich fand Pflanzen bis zum Abi, ehrlich gesagt, stinklangweilig. Bei mir im Zimmer ist sogar der Kaktus vertrocknet. Aber als ich bei einem Praktikum ein Blatt von einer Linde unterm Mikroskop gesehen habe, da hat’s mich gepackt. Sonst hätte ich vielleicht gar nicht mit Pharmazie angefangen. Du weißt echt nicht viel von mir und ich nicht von dir, aber das könnten wir ändern.«
»Ich überleg’s mir und sag dir Bescheid.« Nach zwei Jahren, die sie zusammen studierten, war es das erste Mal, dass sich Jasmin, abgesehen von gemeinsamen Nachmittagen in der Bibliothek, wo sie nebeneinander lernten, außerhalb der Uni mit ihr treffen wollte. Eva lag es auf der Zunge, sie zu fragen, ob sie zu ihrem Geburtstag käme, dann könnten sie, wenn sie nicht zu der Party gingen, alles besprechen und für die Reise planen. Andererseits würde sich Jasmin bestimmt wundern, warum sie sie nicht früher eingeladen hatte, und würde wissen wollen, wer sonst noch käme. Aber Eva feierte nicht, jedenfalls nicht mit Freunden. Ihre Oma würde einen Kuchen backen, und wenn nicht gerade wieder ein Streit in der Luft läge, würden ihre Eltern sie mit einem Ausflug überraschen und mit ihr irgendwo abends essen gehen. Vorausgesetzt, es war noch ein Restaurantgutschein im Rabattheft übrig. »Wir telefonieren, ja? Jetzt muss ich rennen, damit ich den Garmischer Zug erwische.«
»Ich muss noch zum Kieferorthopäden.« Jasmin verzog das Gesicht.
»Ist es heute so weit?«
»Leider.« Jasmin nickte. Nach mehreren gescheiterten Versuchen mit herausnehmbaren Zahnklammern bekam sie heute eine festinstallierte Spange, um die Schiefstellung ihrer Schneidezähne zu beheben.
»Dann viel Glück!« Eva verabschiedete sich, stopfte die Zettel samt Kittel und Kolben in den Rucksack und zog wieder ihre Wintersachen an. Es regnete, als sie loslief, und obwohl es erst kurz nach drei war, hatte sich der Himmel verdunkelt. Graupelschauer fiel, als sie den Bahnhof erreichte. Was hatte sich nur von gestern auf heute an ihr oder mit ihr verändert, fragte sie sich auf der Heimfahrt nach Murnau. Auf einmal hatte sie das Gefühl, eine richtige Freundin zu haben und vielleicht noch mehr. Der Schnellzug war voll besetzt. Sie schob sich an tropfenden Regenschirmen und Pfützen vorbei durch die Gänge. Nach einigem Suchen fand sie einen freien Platz im letzten Waggon. Sie hob einen Stapel Zeitungen vom Sitz, wollte ihn in das Gepäckfach über dem Fenster legen, als ihr einfiel, dass sie noch etwas Kniffliges für ihren Vater brauchte und vielleicht auf einer der Seiten fündig werden könnte. Sie quetschte ihre Füße zwischen die vollen Einkaufstaschen der Mitreisenden ihr gegenüber. Lauch ragte heraus, aber auch eine Papiertüte mit Gebäck verströmte ihren Duft. Evas Magen knurrte, sie freute sich aufs Abendessen. Was für ein Tag, dachte sie, und starrte hinaus in die vorbeiziehende Landschaft. Bald tauchte der Starnberger See in seiner dunkelblauen Pracht auf. Evas eigene Umrisse spiegelten sich im Fenster. Sie lächelte sich an und fand sich schön. Sie, die bisher wahrscheinlich nicht mal bemerkt worden war, fiel plötzlich anderen auf. Woher wusste der Professor, dass sie eine Nase war, wie man Parfümeure insbesondere in Frankreich, dem Land der Düfte, nannte?
Die Reise in die Toskana, aber besonders auch die Party klang verlockend und nach Abenteuer. Sollte sie mit zwei völlig Unbekannten feiern oder lieber mit Jasmin in Urlaub fahren und eine Freundin fürs Leben gewinnen? Maskenzwang. Wenn ja, als was sollte sie sich verkleiden, wie zog man sich als sich selbst an? Andererseits vermutete sie, dass Jasmins Einladung nicht beinhaltete, dass sie kostenlos in der Ferienunterkunft wohnte und aß. Sollte Eva ihre Eltern um Unterstützung bitten? Sie stöhnten sowieso schon bei jeder Extraausgabe fürs Studium, die sie verlangte. Wenigstens durfte sie das, was sie in der Apotheke verdiente, sparen oder für sich selbst ausgeben, und manchmal steckte ihr Oma Betzi etwas zu. Aber für so lange Zeit in Italien würde selbst das nicht reichen.
Die Frau gegenüber stand auf, wollte anscheinend aussteigen, machte jedoch keine Anstalten, an Eva vorbeizugehen. »Wie lange, Fräulein, haben Sie noch vor, auf meinem Gemüse herumzutrampeln?« Ihr üppiger Busen strapazierte den obersten Knopf des Lodenmantels, als sie sich zu ihr herabbeugte.
»Oh, Verzeihung.« Eva hatte nicht gemerkt, dass sie auf einem Henkel der Plastiktasche stand, und hob die Schuhe. Die Frau schüttelte den Kopf, murmelte etwas über die verzogene Jugend von heute und bugsierte sich beim Halt in Tutzing voll bepackt hinaus. Den Rest der Fahrt konnte Eva ihre Beine ausstrecken. Sie blätterte den Merkur, die Süddeutsche und sogar die Frankfurter Allgemeine durch und dachte sich ein Rätsel aus.
Kaum war sie zu Hause angekommen, wurde sie wie üblich von ihrer Familie in Beschlag genommen. Freitagnachmittags herrschte Hochbetrieb im Friseursalon Klein, den ihre Familie seit mehr als fünfzig Jahren in Murnau betrieb. Er lag im Zentrum am Obermarkt mit direktem Blick in die Alpen und befand sich in einem der bunt verzierten Häuser im Biedermeierstil. Die malerische Kulisse des Ortes zog viele Touristen auf dem Weg zum Skifahren an. Kaum war sie durch die Tür getreten, tauchte Eva in eine Vielzahl von Gerüchen ein, die ihr von Kind an vertraut waren. Haarspray, Rasierschaum, Dauerwellenlotion, Shampoo, vermischt mit den Ausdünstungen der Kunden, und dann noch der unverwechselbare Familiengeruch der Kleins, der über allem schwebte.
»Ach, Eva, da bist du ja endlich. Hast du an mein Herzmittel gedacht?« Ihre Mutter stand am Empfangstresen und legte das Buch für die Terminvergabe zurück in die Schublade. Eva setzte den Rucksack ab und zog die Schnur auf, zögerte jedoch kurz, als sie das Glas mit den Tabletten ertastete.
»Nun gib schon her.« Mit den künstlichen Nägeln, die heute orange leuchteten, griff ihre Mutter zwischen ihre Sachen. Pfeffer, Mandel, Mandarine, Bergamotte, die würzig-blumige Zusammensetzung ihres Parfüms, das sie seit Jahren benutzte, stieg Eva in die Nase. Zusammen mit der Wirkung auf ihrer Haut erzeugte es den Mamaduft, der Eva je nach ihrer Laune Halt gab oder sie von ihr entfernte. Meistens war ihre Mutter das Gegenteil von Nonchalance, wie das Eau de Toilette hieß. Obwohl Cordula Klein selten glücklich wirkte, gab sie ihr Bestes als Friseurgattin, musste sich dafür aber dem Regiment ihres Mannes und vor allem ihrer Schwiegermutter unterordnen. Gerade viele jüngere Kundinnen schätzten ihre Art der Verwöhnung, wobei sie über sich selbst hinwegsah und sich selbst kaum etwas gönnte. Gesundheitlich war ihre Mutter ein Wrack. Eine Krankheit jagte die nächste. Sie lechzte nach dem Herzmedikament wie ein Verhungernder nach einem Stück Brot. Kaum hatte sie den Deckel des Glases aufgeschraubt, schob sie sich zwei Tabletten in den Mund und schluckte sie trocken hinunter. Sie klopfte sich auf die Brust, als würden die Pillen so an die richtige Stelle fallen. Augenblicklich schien die Wirkung einzusetzen, ihre Mutter strich sich eine blondierte, hochtoupierte Strähne aus der Stirn und atmete auf. »Puh, das war höchste Eisenbahn, mir war schon den ganzen Tag schwummrig, und die Schmerzen waren kaum auszuhalten. Was täte ich nur ohne dich. Danke, mein Kind.« Sie drehte das Glas in der Hand, wie um nach dem Preis zu sehen. »Was kosten die? Hast du einen Mitarbeiterrabatt gekriegt?«
»Das machen wir nachher«, erwiderte Eva knapp. Auch wenn sie soeben Zeugin einer Art Wunderheilung geworden war, nagte das schlechte Gewissen an ihr. Es war zwar erwiesen, dass Traubenzucker bei Kreislaufproblemen und Unterzuckerung half, aber ihre Mutter glaubte, dass sie ihr ein echtes Herzmittel mitgebracht hatte, womöglich sogar Nitroglycerin. Und zwar vom Apotheker Meitl in seinem Hinterzimmer auf traditionelle Weise mit Mörser und Stößel hergestellt – als ob das bei so einer explosiven Mischung ginge. Sie hatte ständig etwas, mal waren es rote Flecken am Hals, die sich in Ekzeme verwandelten und auf schlimmere innere Verletzungen oder eine unheilbare Krankheit hindeuteten. Dann bekam sie irgendeine Allergie, und die gesamte Familie änderte aus Rücksichtnahme den Speiseplan, bis ein neues Leiden das alte ablöste. Seit einiger Zeit machte ihr das Herz zu schaffen, doch weder die Ärzte, die ihre Mutter in regelmäßigen Abständen konsultierte, noch die Heilpraktiker, die sie im gesamten Landkreis aufstöberte, konnten etwas finden oder ihr zumindest eine zufriedenstellende Diagnose anbieten. Aus medizinischer Sicht war Cordula Klein auch mit vierundvierzig immer noch topfit. Aber wehe, einer in der Familie nahm ihre Leiden nicht ernst. Zuletzt hatte sie Eva gebeten, Meitl zu fragen, ob er nicht ein Mittel für sie wüsste. Einerseits ehrten sie dieses Zutrauen und diese Anerkennung ihres Berufswunsches, denn ihre Eltern und auch Oma Betzi hätten es lieber gesehen, sie würde eine Friseurlehre machen, um eines Tages den Salon in der vierten Generation weiterzuführen, andererseits wusste sie nicht, wie sie dem Apotheker dieses Anliegen vortragen sollte. Ohne Rezept konnte er nicht einfach ein Herzmittel herstellen oder herausgeben. Also hatte sich Eva mit Traubenzuckertabletten beholfen, die sie mit einem gedruckten Etikett versah. Das Etikettieren war nämlich auch Teil ihrer Arbeit. Hoffentlich rief ihre Mutter Meitl nie an und bedankte sich persönlich, dann flöge sie auf.
Eine neue Kundin drängte in den Salon. »Grüß Gott, Frau Bingerl. Waschen, schneiden, legen, wie immer? Nur hereinspaziert.« Ihre Mutter ließ Eva stehen und führte die Dame zu einem freien Platz, wo sie ihr aus Pelzmantel und Fuchsschwanzhut half. Im Friseursalon Klein waren die Abteilungen wie in der Kirche getrennt. Rechts die Männer und links die Frauen – mit der Besonderheit, dass man sich in den Spiegeln an den Wänden gegenseitig beobachten konnte. Abgesehen davon, dass durch dieses Spiegeln im Spiegel der Klein’sche Salon unendlich wirkte wie in einem Kabinett des Oktoberfestes, hatte es hier schon so manches Mal über den ersten Blickkontakt gefunkt. Die Hochzeitsfotos, die an der Wand neben der Garderobe klebten, an die ihre Mutter nun die toten Tiere der Kundin hängte, zeugten davon. Eva musterte sich kurz im erstbesten Spiegel. Äußerlich sah sie unverändert aus. Was hatte sie erwartet? Dass sie sich verwandelt hatte, nur weil sie einmal aus der Masse herausgestochen war? Da waren immer noch die widerspenstigen dunkelbraunen Locken, die sie mit zwei Spangen aus dem Gesicht hielt. Dazu die viel zu kleinen Augen und der zu kleine Mund im Verhältnis zu ihrer großen Nase – als ob sie überhaupt erst der Grund für ihre Gabe war.
»Hallo, Papa.« Ihr Blick traf auf den ihres Vaters, der gegenüber einen Herrn bediente. Ungewöhnlich für einen Friseurmeister, fiel Ludwig Klein nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch wegen seiner Glatze auf. In der Pubertät, als all seinen Freunden Haare am Körper wuchsen, verlor er die am Kopf, auch die Wimpern und Augenbrauen, aus bisher ungeklärten Gründen. Früher war Eva das Aussehen ihres Vaters peinlich gewesen. Wenn sie jemanden von der Schule mit nach Hause brachte, fühlte sie sich einer Erklärung schuldig, bis sie festgestellt hatte, dass es sowieso jeder in ihrem Umfeld wusste. Immer wenn sie als Jugendliche beim Bürsten Haare verlor, bekam sie Angst, dass auch sie diese seltsame Krankheit geerbt hatte. Doch der Arzt und auch ihre Eltern versicherten ihr, dass das nicht der Fall war. Zu besonderen Anlässen oder bei eisigen Temperaturen trug ihr Vater Perücken in verschiedenen Formen und Farben, so wie andere Leute einen Hut, aber bei der Arbeit zierte seinen glatten Kopf meistens nur die goldene Sportbrille mit den getönten Gläsern und dem doppelten Nasensteg. Ludwig, auch genannt Lucki, schien unter seinem Makel nicht zu leiden, jedenfalls kam es Eva so vor, und ihre Mutter hatte ihn schon ohne Haare kennengelernt. Es gäbe sonst keinen, der so wandlungsfähig sei, betonte er stets.
»Grüß dich, mein Schatz.« Mit Schere und Kamm in der Hand drückte er Eva einen Kuss auf die Wange. Lavendel und Tabak von der Raucherei – wie immer registrierte sie seinen Geruch. »Na, wieder mal Mamas Leben gerettet?«, flüsterte er ihr ins Ohr.
»Mehr oder weniger.« Eva wusste, dass er es wusste, auch wenn keiner offen aussprach, was ihrer Mutter wirklich fehlte beziehungsweise nicht fehlte.
»Wie war’s in der Uni?« Er machte mit dem Haarschnitt weiter, bewegte die Schere so rasend schnell, dass seine Finger am Hinterkopf des Kunden fast verschwommen wirkten.
»Ganz gut. Ich hab ein Neues, willst du’s hören?« Sie trat näher an ihn heran und sagte das Rätsel auf. »Nach einer Sauftour kehrt ein Mann heim, findet ein Fünfmarkstück auf dem Gehsteig und hebt es auf. Obwohl der Mond nicht zu sehen ist und keine der Straßenlaternen ringsum brennt, hat er es schon von weitem entdeckt. Wie ist das möglich?«
»Knifflig.« Ihr Vater lugte über den Brillenrand auf sie hinunter und zog die Haut über den Augen hoch, an der Stelle, wo bei anderen die Brauen saßen. Der Denksport mit Knobelaufgaben war ihre gemeinsame Leidenschaft, die nur sie beide teilten.
»Hatte er eine Taschenlampe dabei?«, mischte sich der Kunde, Herr Weber, ein – Zimmerermeister und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr. Eva verneinte, als ginge es bei dem Rätsel um eine Tatsache.
»Ich denk drüber nach«, sagte ihr Vater. »Gib mir etwas Zeit.« Das war’s. Besonders angestrengt hatte er sich nicht, normalerweise war er, egal, was er zu tun hatte, schneller. Dabei lag die Lösung auf der Hand. »Bevor ich’s vergesse, Eva, das Schuppentonikum ist aus. Kannst du heute noch ein neues ansetzen, damit wir am Dienstag wieder welches haben?« Sie nickte, wollte gleich loslegen, da trat Oma Betzi hinter einer Trockenhaube vor und breitete die Arme aus. Mit ihrer Größe von einem Meter dreiundfünfzig war sie leicht zu übersehen.
»Wickerl, jetzt lass das Engelchen doch erst mal heimkommen und ausruhen nach der anstrengenden Woche voll Studiererei. Dieses München hat bis jetzt noch jeden fertiggemacht.« Trotz ihrer siebenundsiebzig Jahre mischte Oma Betzi noch im Salon mit, und zwar wortwörtlich. Sie rührte die Tönungen und Dauerwellenlotionen an. Die Farb’ von der Klein Betzi hält am längsten, hieß es im Ort, und viele kamen extra von weit her, um sich nur von ihr persönlich ondulieren zu lassen. Selbst wenn etwas danebenging und Oma sich die Hände verätzte, zog sie keine Gummihandschuhe an. Die hatte es früher auch nicht gegeben, und damals hätten sie sogar noch mehr mit Bleiche gearbeitet. Nur auf der blanken Haut, behauptete sie, könnte sie spüren, wann die Mischung stimmte. Und von wegen Chemie – alles, was es auf der Welt gab, war Natur und von der Menschheit, der Krone der Schöpfung, beherrschbar, davon war sie, allein schon wegen ihres katholischen Glaubens, überzeugt.
»Was ist mit der Atombombe und dem Plastikmüll, dem Kunstdünger und der ganzen Umweltverschmutzung?«, hatte Eva sie mal gefragt. Damit provozierte sie auch ihre Mutter, die sowieso dachte, sie ginge eines Tages auf die Barrikaden, was immer das auch bedeuten sollte.
»Aus Staub sind wir gemacht, und zu Staub werden wir«, hatte ihre Oma erwidert.
»Da hilft nur ein Staubsauger«, hatte ihr Vater eingeworfen und damit die Diskussion abgerundet. Auch wenn Eva bei vielem nicht mit ihrer Oma übereinstimmte, liebte sie Betzi sehr und verzieh ihr die verbohrten Ansichten. Hauptsache, sie redeten. In vielen Familien, so hatte sie mitbekommen, war das nicht der Fall. Jetzt beugte sich Eva vor und begrüßte ihre kleine, mollige Oma. Trotz des ätzenden Geruchs vom Dauerwellenmittel, der sie umhüllte, roch Eva Veilchen, so als ob die Blümchen auf ihrer Kittelschürze lebendig wären. Das lag an den Guttis, die sie in der Tasche hatte und den ganzen Tag über lutschte. Ihre Dritten störte so viel Zucker ja nicht. »Sag mal, hast du genug gegessen?« Das war Betzis Hauptsorge, ohne einen Stapel Butterbrote durfte sie das Haus morgens nicht verlassen. Eva frühstückte nämlich nie. Gleich nach dem Aufstehen fiel es ihr schwer, sich für etwas zu entscheiden, die Auswahl und die Vielzahl an Gerüchen waren einfach zu groß und die Zeit zu knapp. »Ich mach noch Windbeutel für die Feier am Sonntag, falls welche aus deiner Klasse kommen.« Vergeblich hatte Eva ihrer Oma schon oft erklärt, dass es in der Uni so etwas wie Klassen nicht mehr gab.
»Wir sind unter uns«, sagte sie.
Oma hielt sie mit ihren bunt verfärbten Fingerkuppen ein wenig von sich weg und sah zu ihr auf. »Dann lade doch wenigstens ein paar Freunde von früher ein.«
»Und an wen denkst du da speziell?«
»Na, den Lederer Robert zum Beispiel.« Das war der Sohn aus dem Blumenladen gegenüber. »Ein schneidiger junger Mann ist der und so fleißig.« Schneidig, dieses Wort aus dem Mund einer Friseurin war ein echtes Kompliment. »Ich weiß noch, wie du mit ihm Hochzeit gespielt hast.«
»Das hättest du wohl gern, und für üppigen Blumenschmuck in der Kirche wäre durch die Lederers auch schon gesorgt.« Eva lachte. »Mit dem Robbi hab ich seit der Grundschule nichts mehr zu tun gehabt, ich weiß gar nicht, was der heute macht.«
»Ich schon, seine Mutter war neulich zum Auffrischen hier und dabei …«
»Oma, bitte, du musst mich nicht verkuppeln.«
Betzi drückte ihre Brille, die ihre Augen stark vergrößerte, fester auf die Nase und wackelte mit dem Kopf, dass ihre langgezogenen Ohrläppchen durch die schweren Hänger wie Kirchenglocken schwangen. »Ich will doch nur, dass du was erlebst. In deinem Alter bin ich jedes Wochenende tanzen gegangen.«
»Du warst doch schon mit achtzehn verheiratet und hast mit neunzehn Papa gekriegt.«
»Na, siehst du, dann wird’s Zeit. Bloß studieren oder mit uns alten Leuten deinen Geburtstag feiern, das ist doch nichts.«
»Betzi, mir pressiert’s, und mein Haar ist schon fast trocken.« Eine Kundin drängte.
Oma drehte sich um. »Sofort, Gusti.« Eva kannte auch diese Kundin, es war die Leiterin der Murnauer Bücherei. Mit der Leseausweisnummer zweiunddreißig war sie eine der ersten Nutzerinnen, gleich als die Bücherei in ihrer Grundschulzeit eröffnet wurde. Da die Kinderbuchabteilung aus kaum mehr als ein paar Regalfächern bestand, durch die sie sich bald komplett durchgelesen hatte, durfte sie mit Ausnahmegenehmigung der Leitung auch alles andere ausleihen.
»Überfordern gibt’s beim Lesen nicht, nur Langeweile, und die schaffen wir mit hoffentlich guten Büchern ab«, war Frau Hebeisens Meinung.
»Du, ich muss weitermachen, die Gusti hat gleich ein Rendezvous, und ich will nicht schuld sein, falls es mit ihrer neuen Flamme nichts wird.« Oma zwinkerte und schnappte sich eine Sprühflasche. »Wir besprechen nachher alles Weitere – haarklein.«
»Wie auch sonst? Sag mal, nur noch kurz, hast du alle Faschingssachen aufgehoben, also auch die von euch früher?« Betzi liebte Verkleiden. Egal, was Eva sich als Kind für ein Kostüm wünschte, sie hatte es ihr, manchmal bis spät in die Nacht, genäht.
»Alles nicht, aber das meiste liegt noch auf dem Speicher, in der alten Reisetruhe deines Urgroßvaters.« Ignaz Klein, so wurde es ihr erzählt, hatte sich von Frankreich bis nach Amerika als Friseur durchgeschlagen und war dann irgendwann wieder in die Heimat zurückgekehrt, um die bayerische Haarkunst, die hauptsächlich aus Flechtfrisuren bestand, mit seinen internationalen Erkenntnissen zu revolutionieren. Ein Bubikopf für die Frau war Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts neumodischer Schnickschnack, den nur die wenigsten wagten. Erst in den 1920er Jahren setzte er sich in der Großstadt und schließlich auch auf dem Land durch. Von ihren Kinderkostümen würde Eva keins mehr passen, aber vielleicht fand sie etwas Originelles zwischen den alten Gewändern, das sie für die Party verwenden konnte.
»Beetz-iii?« Frau Hebeisen rollte mit ihrem Stuhl aus der Reihe und drängelte erneut.
»Jaja, bin schon bei dir.« Eva blickte ihrer Oma hinterher, wie sie geschickt in ihren vorne von gekreuzten Riemchen gehaltenen und hinten offenen Absatzpantoffeln wie eine Diva à la Sophia Loren zurückstakste. Dort feuchtete sie das papieren wirkende Büchereileiterinnenhaar noch mal an, um es dann auf Wickler zu drehen. Dass Oma bei ihrer Statur ihren Vater, der heute eins neunzig war, zur Welt gebracht hatte, war ein Phänomen, das nicht nur ihr Rätsel aufgab. Damals, 1919, hätte er noch in einen Maßkrug gepasst, hatte Betzi erklärt, als sie sie nach der Geburt gefragt hatte.
»Eva? Schön, dich zu sehen.« Frau Hebeisen winkte sie zu sich. »Ich darf doch noch du sagen, oder?« Sie wartete die Antwort nicht ab, sondern redete weiter. »Du warst schon lange nicht mehr bei mir.« Sie meinte wohl die Bücherei, bei ihr zu Hause war Eva noch nie gewesen. »Dabei haben wir jetzt auch Bestseller, Heinrich Böll, Christa Wolf, aber auch Alice Schwarzer, Der kleine Unterschied. Vielleicht interessiert dich das?« Eva lächelte aus Höflichkeit. Sie fand es müßig, ihr zu erklären, dass sie als Studentin Zugang zu weitaus größeren Bibliotheken hatte. Das Schwarzer-Buch hatte sie sich gleich im letzten Jahr, als es erschienen war, gekauft und längst gelesen.
»Soso, ich verstehe, mit der Hauptstadt lässt sich natürlich nicht konkurrieren.« Sie lächelte unter den quadratischen Brillengläsern, die wie zwei rosa getönte Fenster wirkten. »Du bist sicher sehr dankbar für alles, oder, Eva?« Dankbar wofür, was meinte sie? Dass sie als Kind von einfachen Leuten studieren durfte? Das war ein harter Kampf gewesen und hatte sie eine Menge Überzeugungskraft gekostet.
Doch Oma ließ ihr keine Zeit nachzuhaken. »Mei, unser Engelchen ist aber auch fleißig, sie schleppt sich an den Büchern noch den Rücken krumm.«
»So soll’s auch sein. Sag, Eva, eine andere Frage, hättest du geschwind Zeit, mir eine Gesichtsmaske aufzulegen? Die letzte neulich hat meine sensible Haut so beruhigt. Ich bin gleich auf einem Konzert und krieg doch immer diese roten Flecken, wenn ich nervös bin.« Das klang, als hätte sie selbst einen Auftritt.
»Aber Gusti, wir schließen in zwanzig Minuten«, lenkte Oma ein, »und das Engelchen ist müde.«
»Passt schon, Oma. Ein Peeling für Frau Hebeisen, selbstverständlich.« Nach diesem Tag war so etwas für Eva ein Klacks. Sie stieg über ein Föhnkabel, umrundete einen Rollwagen voller Kämme, Bürsten und Scheren und wollte durch die Seitentür in die Wohnung verschwinden.
»Warte, Eva.« Ihr Vater hielt sie auf. »Ist es überhaupt Nacht?« Sie musste kurz überlegen, was er meinte. »Na, dein Rätsel«, half er ihr auf die Sprünge. »Der Heimkehrer hat das Geldstück von weitem gesehen, weil es hell war.«
»Richtig.« Sie grinste.
»Respekt.« Herr Weber nahm den Hut von der Ablage, drehte ihn auf dem Kopf, weil er ihm nun, nach dem Haarschnitt, etwas zu groß zu sein schien, und klopfte ihrem Vater auf die Schulter. »Auf die Lösung wäre ich nie gekommen.«
»Pfirti, Helmut.« Ihr Vater zwinkerte dem Kunden zu und geleitete ihn hinaus. »Moment. Willst du meins nicht hören?« Er kam zu Eva zurück.
»So schnell. Ich dachte, du musst dir erst was überlegen.«
»Voilà, ich hab schon eins vorbereitet.« Er fing an, die Haare, die in allen Schattierungen am Boden lagen, zusammenzukehren.
»Na dann, schieß los.« Eva verschränkte die Arme und lauschte gespannt.
Er stützte sich auf den Besen und sagte: »Du kannst es kaum erwarten, es endlich zu erwischen, und fieberst mit aller Macht darauf hin, aber dann, kaum dass du es kriegst, willst du es sofort wieder loswerden. Was machst du?«
»Vielleicht das Staatsexamen? Aber das schaffe ich hoffentlich, und außerdem will ich das dann auch behalten.«
»Falsch.« Er schüttelte den Kopf.