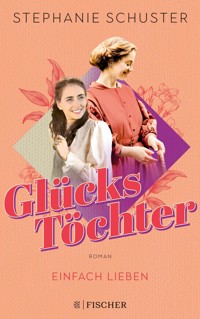
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Glückstöchter-Dilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Zwei Frauen zwischen Vergangenheit und Zukunft In den bayerischen Alpen 1911: Auf einer abgeschiedenen Alm, umgeben von grünen Weiden und wild wachsenden Pflanzen, ist Anna auf sich allein gestellt. Mit ihrem botanischen Wissen und ihrer Töpferkunst versucht sie sich ein neues Leben aufzubauen. Allerdings ist sie den Widrigkeiten der Natur ausgeliefert und muss erst lernen, damit umzugehen. Dennoch ist sie voller Zuversicht ... München, Ende der bunten 1970er Jahre: Eva hat ein besonderes Talent, mit ihrer feinen Nase kann sie unendlich viele Gerüche unterscheiden und sich merken. Sie führt ein unkonventionelles Leben in einer grünen WG und gründet zusammen mit ihren Freunden einen der ersten Bioläden. Bei der Suche nach ihrer wahren Herkunft bekommt sie Hilfe von unerwarteter Seite, und dann wird plötzlich ihr Leben gleich mehrfach auf den Kopf gestellt … Der Abschluss der »Glückstöchter«-Serie von Bestseller-Autorin Stephanie Schuster (»Die Wunderfrauen«) Mehr von Stephanie Schuster: Die Wunderfrauen - Alles, was das Herz begehrt Die Wunderfrauen - Von allem nur das Beste Die Wunderfrauen - Freiheit im Angebot Die Wunderfrauen - Wünsche werden wahr Glückstöchter - Einfach leben Glückstöchter - Einfach lieben
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 769
Ähnliche
Stephanie Schuster
Glückstöchter
Einfach lieben
Über dieses Buch
In den bayerischen Alpen 1911: Auf einer abgeschiedenen Alm, umgeben von grünen Weiden und wild wachsenden Pflanzen, ist Anna auf sich allein gestellt. Mit ihrem botanischen Wissen und ihrer Töpferkunst versucht sie sich ein neues Leben aufzubauen. Allerdings ist sie den Widrigkeiten der Natur ausgeliefert und muss erst lernen, damit umzugehen. Dennoch ist sie voller Zuversicht ...
München, Ende der bunten 1970er Jahre: Eva hat ein besonderes Talent, mit ihrer feinen Nase kann sie unendlich viele Gerüche unterscheiden und sich merken. Sie führt ein unkonventionelles Leben in einer grünen WG und gründet zusammen mit ihren Freunden einen der ersten Bioläden. Bei der Suche nach ihrer wahren Herkunft bekommt sie Hilfe von unerwarteter Seite, und dann wird plötzlich ihr Leben gleich mehrfach auf den Kopf gestellt …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Stephanie Schuster lebt mit ihrer Familie und einer kleinen Schafherde auf einem gemütlichen Bio-Hof in Oberbayern. Sie arbeitete viele Jahre als Illustratorin, bevor sie selbst Romane schrieb – zuletzt die Bestseller-Serie »Die Wunderfrauen«. Sie engagierte sich in der Anti-Atomkraft- und Friedensbewegung, in einem »Eine-Welt-Laden« und setzte sich für fairen Handel ein.
Inhalt
[Motto]
[Widmung]
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Anna
Eva
Epilog
Rezepte
Annas Ziegenfrischkäse
Evas Lippenbalsam
Annas Zahnputzpulver
Evas kleines Duftaroma-Lexikon von A–Z
Nachwort und Danksagung
[Inhaltshinweis]
Manche Rätsel löst man besser mit dem Herzen als mit dem Verstand.
Wie immer für meinen allerliebsten Thomas und unsere große Wunderfamilie.
Diesmal besonders auch für Winona, Ida, Lia und James.
Anna
Mai 1911
Auf dem Berg wartete der Garten, den sie schon immer in sich trug. Bienen summten, Hummeln brummten, Blütenduft erfüllte die Luft. Obst reifte und Gemüse gedieh in einer unendlichen Vielfalt an Farben und Formen. Eine Augenweide. In Kochel angekommen, stieg Anna aus dem Zug und wechselte als Erstes das Schuhwerk, tauschte die selbst geknüpften Sandalen gegen die Schnürstiefel. Mehrmals krempelte sie die Wollstrümpfe über dem Schaft, damit sie nicht dauernd rutschten, und schlüpfte in ihre Strickjacke. Der Morgen war kühl, aber wenigstens regnete es nicht. Die Gipfel waren weiß verhangen, und in den Senken hielt sich noch der Schnee. Trotzdem versprach der Tag sonnig zu werden – Anna hoffte es jedenfalls. Beim Bäcker und in einem Kolonialwarenladen kaufte sie sich ein paar Essensvorräte, nur so viel, wie mit einigem Umschichten in den Koffer passte. Und auch bloß das Nötigste, besser, sie sparte. Für das, was sie sich vorgenommen hatte, brauchte sie jeden Pfennig. Jetzt, wo sie völlig auf sich gestellt war, umso mehr. Von wegen teilen. Was mir gehört, gehört dir. Bennis weiche Stimme klang ihr noch in den Ohren, als stünde er neben ihr. Zugleich versuchte sie die abschätzigen Blicke der Einheimischen zu ignorieren, die sie, wie auch schon die anderen Fahrgäste im Zug vorhin, in ihrem luftigen Reformkleid musterten.
»Schau dir das Stadtfräulein an. Is des a Zuagreiste?«
»Koan Huat und koane Handschuah. Naa, naa, ausgschamt. Als ob’s noch im Nachtgewand wär«, hörte Anna sie tuscheln. Sie hätte besser gleich ihr Dirndl anziehen sollen, dann würde sie weniger auffallen. Sei’s drum. Über solch ein Gerede war sie längst hinaus. Sie trug das, was ihr gefiel, und hielt ihre Locken lieber mit einem gewebten Band aus der Stirn, als sie unter einen Hut zu zwängen, den sie sehr wohl besaß. Das auf dem Monte Verità selbst gefilzte kostbare Stück ruhte gefaltet im Koffer. Sollten sich die Leute doch das Maul zerreißen, dem hielt sie stand. »An halberten Liter vom Essig und vom Distelöl, bittschön«, verlangte sie in breitestem Bayerisch, als sie an der Reihe war, und brachte damit die Ratschkathln zum Verstummen. Über der Ladentheke hing eine schuppige grün angemalte hölzerne Schlange, an der allerlei Schleifen und Bänder aufgefädelt war. Diesem bunten Tand konnte Anna nicht widerstehen und kaufte ein bisschen hier- und davon, außerdem ein paar Tüten mit Samen. Pastinake, Rote Bete, Feldsalat und etliches mehr. Einiges davon würde sie vorziehen müssen, anderes wollte sie sofort im Freien aussäen. Nachdem sie sich mit einem Vergelt’s Gott verabschiedet hatte, biss sie draußen gleich in eine Butterbreze, lief hinüber zum Brunnen, wo sie ihren Durst löschte und ihre Glasflasche auffüllte. Heimat hier bin ich wieder! Anna atmete tief aus und ein. Sie war zurück, nur zweieinhalb Fahrstunden mit der Kutsche oder einem Kraftwagen von Wessobrunn entfernt, wo sie aufgewachsen war. Sie dachte an Humboldt, ihren Kater, an Komet, ihren Leutstettener Hengst, den sie zurückgelassen hatte, und an all die anderen Tiere auf Dreisonnenquell und fragte sich, wie es ihnen wohl ging. Dazu noch die Pflanzen, besonders die Maulbeerbäume fielen ihr ein, die waren bis zum Tod ihres Vaters, der alles verändert hatte, eigentlich in ihrer Obhut gewesen. Obwohl es erst acht Monate her war, kam es ihr wie eine Ewigkeit vor. Sie verließ die Talstraße und folgte einem Pfad, den ein Holzpfeil wies, zum Rabenkopf steil bergauf. An einem Zaun angekommen, hob sie ihren Koffer darüber und wand sich selbst durch eine Lücke. Es war eine Verschachtelung aus Brettern, die extra für die Wanderer gebaut worden war. Wie das Eck eines Labyrinths, so eng, dass kein Almvieh daraus entkommen konnte. Mit einfachen Mitteln erfinderisch sein – solche Konstruktionen hatten ihr schon immer gefallen. Im Dunst, der den Berg umhüllte, konnte Anna die rotbraunen Kühe kaum erkennen. Sie weideten irgendwo zwischen den Bäumen und Sträuchern, nur das Bimmeln ihrer Glocken war von überall zu hören. Dieses Morgenkonzert begleitete sie noch eine ganze Weile weiter auf ihrem Weg nach oben. Bald wurde es beschwerlicher. Sie stieg durch einen Hohlweg, der einem ausgetrockneten Flussbett glich, kraxelte über Felsbrocken und Kiesel. An den Seiten ragten Wurzeln aus der Erde. Wasser rauschte. Das musste der Pessenbach sein, der sich hinter der Anhöhe eine neue Schlucht gegraben hatte. Ihr fiel ein, wie sie als Kind hier heraufgeklettert war. Damals hatten die Steine fast unüberwindbar groß gewirkt. Dennoch hatte sie keinerlei Erschöpfung gespürt, oder daran gedacht, dass ihr die Kraft ausgehen und sie es nicht bis zum Ziel schaffen könnte. Vielmehr war sie sogar um ihre Eltern herumgetänzelt, immer wieder rauf und runter gehüpft. Voller Freude über die gemeinsame Zeit, in der sie Mamá und Papá ganz für sich haben würde. Denn nur auf der Tonkaalm waren sie als Familie allein gewesen. Schnurgerade führte der Hohlweg nach oben, wie ein umgedrehter Tunnel, der kein Ende nehmen wollte. Zudem musste Anna noch den schweren Koffer schleppen, sie schleifte ihn über das Geröll oder warf ihn voran, wenn er ihr beim Klettern im Weg war. Seine Seiten verkratzten, und der Inhalt wurde ordentlich durchgeschüttelt. Nicht mehr lange und er würde auseinanderfallen und sie ihre Sachen auf dem Arm tragen müssen. Wie praktisch wäre jetzt ein Rucksack, um die Hände freizuhaben und besser balancieren zu können, oder auch eine Kraxe aus Holz, wie sie Bergbauern benutzten. Anna keuchte und musste sich zwingen weiterzugehen. Verflixt und zugenäht – zu zweit wäre alles leichter! Aber es hatte nicht sein sollen. Besser, sie schaute nur auf die Stiefelspitzen und nicht nach oben, sonst schaffte sie es nie hinauf. Lange Schritte, krumme Knie, kommt man rauf, man weiß nicht wie. Mit diesem Kinderreim hatte ihre Mutter sie angespornt. Und vor allem nicht an ihn denken. Kaum hatte Anna am Lago Maggiore ihre Lungenschwäche auskuriert und wieder Hoffnung geschöpft, war er aufgetaucht. Benjamin Tardini. Ein Tessiner Bergbauernsohn inmitten der reichen Kurgäste, die hauptsächlich aus Deutschland kamen. Sie verliebte sich in ihn und glaubte, es beruhe auf Gegenseitigkeit. Bis dahin stammte alles, was sie über Liebe und Leidenschaft wusste, aus Büchern oder Gesprächen. Romantik würde sowieso bloß in Romanen vorkommen, hatte sie bis dahin gedacht, und selbst wenn es so etwas tatsächlich gab, dann war das etwas, das nur anderen passierte. Doch dann hatte es sie selbst mit voller Wucht getroffen. Benni schien der Mensch zu sein, nach dem sie sich schon immer gesehnt hatte. Durch ihn wurde alles leicht und frei. Auf einmal gab es nichts Wichtigeres, als dass sie beide zusammen waren – am liebsten rund um die Uhr –, was aber unmöglich war, da er als Bauer viele Verpflichtungen hatte. Und auch sie war auf dem Monte Verità eingebunden, so nahm sie sämtliche Anwendungen wahr, um ihre Genesung voranzubringen. Sie legte sich mit den anderen Kurgästen nackt in die Sonne, die im Tessin bereits im März und April eine große Kraft entfaltete, um sich zu stärken, und wandelte über Morgentau, was die Durchblutung förderte. Zusätzlich half Anna beim Obstbaumschnitt und beim Bestellen der Beete, um sie für die Aussaat vorzubereiten. Deshalb war ihre Haut bereits jetzt im Mai gebräunt, als hätte sie schon einen ganzen Sommer im Freien verbracht. Zusätzlich hatte sie Töpferkurse gegeben, wofür ihr Ida Hofmann, die die Naturheilanstalt leitete, einen Rabatt auf den Aufenthalt gewährte. Benni war meist bis kurz vor Morgengrauen bei Anna geblieben, und wenn sie sich nicht liebten, dann redeten sie und schmiedeten Pläne für ihre gemeinsame Zukunft. Von einem autarken Leben hatten sie geträumt – nur sie beide, für immer. Und dann? Mit einem Mal war alles aus gewesen! Was stimmte nicht mit ihr, dass er sie so unvermittelt fallengelassen hatte? Im letzten Moment hatte er sich umentschieden, konnte oder wollte nicht weg von daheim. Anders als Anna hatte er seine Eltern noch, insbesondere seine Mutter, die er anscheinend mehr liebte als sie. Alles, was Anna hingegen von ihren Eltern geblieben war, war die Tonkaalm, hoch über dem Kochelsee, unterhalb des Rabenkopfes. In ihrer Erinnerung ein Paradies. Aber ob das heute noch so war, musste sie erst noch herausfinden. Sie graute sich ziemlich vor dem, was ihr bevorstand. Wie sah es dort oben wohl inzwischen aus, ganze elf Jahre später? Stand das Haus noch, oder war es längst zusammengefallen? Was würde sie vorfinden? Ein mulmiges Gefühl machte sich in ihr breit. Würde sie es schaffen, allein zu leben und sich selbst zu versorgen? Die Zeiten, einfach in den Speisesaal zu gehen und sich aus dem Regal zu bedienen, waren vorbei. Alles, was sie fortan zum Leben brauchte, musste sie selbst erzeugen, den Rest dazukaufen und den Berg hinauftragen. Von Obst und Maronen wie in der Heilanstalt, konnte sie sich auf der Alm jedenfalls nicht ernähren. Was sie ernten wollte, musste sie zum Wachsen bringen. Das hieß den Boden vorbereiten, die Saat vorziehen und auf Keime hoffen. Pflanzen, gießen, düngen, harken, vor Unwetter und Schädlingen schützen. Sich tagein, tagaus kümmern, bis etwas einen Ertrag lieferte. Das fing schon beim Brot an. Dafür müsste sie erst einmal Getreide anbauen – aber bis sie das würde ernten können, wäre sie längst verhungert. Und Mehl hinaufzuschleppen und in großen Mengen zu horten, war schwierig. Es verdarb viel zu schnell oder würde eine Mäuseplage hervorrufen, wie sie aus Dreisonnenquell wusste. Außerdem hatte sich Zenzi, die Köchin, oft über die Motten beklagt, die aus den Säcken aufgeflogen waren wie aus einem Bienenkorb, obwohl auf dem Gut tagtäglich gebacken und das Mehl schnell verbraucht worden war. Hoffentlich funktionierte der Ofen auf der Alm noch! Es war ein gusseiserner, daran erinnerte sie sich und auch daran, wie sie mit ihrer Mutter Bratäpfel mit Marmelade gefüllt und darin gebraten hatte. Backen und Kochen bedeutete Brennholz besitzen, außerdem wollte sie nicht frieren. Anders als im Tessin würden die Frühlingsnächte in Bayern besonders in dieser Höhe sicher noch kalt sein. Das Baumfällen und Holzhacken hätte Benni übernommen. Nun hing alles an ihr allein. Lan-ge Schrit-te, krum-me Knie …. Immerhin verstand sie etwas von der Pflanzenzucht, und in den letzten Wochen und Monaten hatte sie viel dazugelernt. Und bis auf den Ringfinger, dem unwiderruflich ein Stück fehlte, war sie robust und wiederhergestellt. Zudem besaß sie noch genügend Geld, um sich ein neues Zuhause zu schaffen und ihrer künstlerischen Leidenschaft, dem Töpfern, nachzugehen. Nein, sie brauchte weder Benni noch sonst jemanden! Sie trotzte allem und jedem. Anna blieb stehen, suchte in ihrer ledernen Jagdtasche nach einem Schnäuztuch, um sich die Stirn und den Nacken trocken zu wischen. Dabei fiel ihr die Karte in die Hand: Die beste List ist Lust zur Last, hatte Gusto Gräser, der Mitbegründer des Monte Verità, in seiner schnörkeligen Schrift darauf geschrieben. Den selbst ernannten Naturapostel hatte sie im Zug getroffen und sich mit ihm auf der Fahrt durch den Gotthardtunnel über Künstlergemeinschaften unterhalten. Überall auf der Welt entstanden moderne Lebensformen, die Menschen sehnten sich zurück zur Natur oder zumindest nach einem Ausgleich zu ihrem Alltag. Auch wenn für Anna vieles, was sie von Gräser gehört oder auch selbst auf dem Berg der Wahrheit erlebt hatte, neu gewesen war, so stellte sich heraus, dass es das alles doch schon mal gegeben hatte. So wie sich Geschichten zu jeder Zeit neu erfanden, aber nicht aus dem Nichts auftauchten. Womöglich war auch sie gerade selbst nur Teil einer Geschichte, die gerade irgendjemand irgendwem erzählte oder in einem Buch las, ob morgen oder im nächsten Jahrhundert.
Eva
1977
Der Duft von gerösteten Kürbis- und Sonnenblumenkernen, Haselnüssen und Cashews erfüllte die Küche. Dazu vibrierte der Fußboden von der Musik, die aus dem Keller hinaufdrang. Reggae. Eva hatte ebenfalls das Radio auf volle Lautstärke gestellt. Als She’s always a woman erklungen war, hatte sie den Regler hochgedreht. Diesen Song mochte sie sehr, besonders die Zeile, in der es hieß, dass diese Frau ihrer Zeit voraus war, sie niemals aufgab, sie nur ihre Meinung änderte.
Galt das auch für einen Abtreibungstermin? Gegen den durchdringenden Rhythmus von Bob Marley, der das gesamte Haus an diesem frühen Freitagvormittag zum Wackeln brachte, kam Billy Joel nicht an und Eva zu keinem klaren Gedanken. Bevor ihr von der Doppelbeschallung die Ohren abflogen, schaltete sie den Radiorekorder lieber aus. Außerdem hatte es geklingelt. »Ecki, kannst du aufmachen?«, brüllte sie und stampfte auf den Boden. Wenn sie so zum Essen rief, klappte das mühelos, und ihr Mitbewohner, der eigentlich Manuel Eckberger hieß und gerade unten im Mediraum an seiner Psychologie-Hausarbeit über Selbsterkenntnis schrieb, hechtete in Sekunden die Treppe hoch. Eva rüttelte und schüttelte die verschiedenen Pfannen, die auf dem alten Wamslerherd standen, damit nichts anbrannte, und lauschte. Nichts – weder Schritte noch Geräusche im Flur. Vermutlich hatte sie sich getäuscht, und von der lauten Musik dröhnten ihr bloß die Ohren. Sie streute verschiedene Gewürze über die Nüsse, scharfe und süße. Eckis geliebtes Chilipulver, nicht zu vergessen. Eine Prise bloß, die trotzdem im Mund explodierte. Jetzt brauchte sie nur noch die Haferflocken kurz mitzurösten. Selbst gemachte aus unbehandelten Körnern. Das Quetschen hatte Milo zum Glück gestern Abend noch übernommen. Einen ganzen Sack voll. Wie sämtliche Zutaten stammte der Hafer aus ökologischem Landbau, der keine chemischen Spritzmittel einsetzte. Naturbelassen schrieb Eva mit auf die Etiketten, und genau das war auch ihr Verkaufserfolg und eine echte Alternative zu den herkömmlichen Lebensmitteln aus dem Supermarkt. Sie schüttete die Flocken in die Pfannen, rührte weiter um und schmeckte alles ab. Dabei konnte sie nicht widerstehen und naschte ein paar Löffel mehr. Köstlich. Seit sie schwanger war, hatte sie nicht nur ständig Hunger, sie roch auch intensiver denn je. Allein am Duft erkannte sie, wann die Mischung stimmte. Einatmen bedeutete, einen Geruch wahrzunehmen, doch für Eva waren Riechen und Leben schon immer eins gewesen. Beim Einatmen registrierte sie den Duft, beim Ausatmen ordnete sie ihn zu. Mittlerweile kannte sie die Rezepte für Milos Knusperknäuschen, Majas Lieblingsnektar, Udos Goldmund, Eckis Superkraft und ihre Sorte namens Evas Feigenblatt zwar auswendig, trotzdem wollte sie zur Sicherheit die Rezepte überprüfen. Die Stammkundschaft, die sie jeden Samstag auf dem Obermenzinger Wochenmarkt aufsuchte, würde sich sofort beschweren, wenn sie etwas abänderte. Mit dem Schürhaken zog sie einen Eisenring der Ofenplatte zur Seite und warf ein weiteres Holzscheit in die Glut. Dann schob sie die Pfannen an den Rand der Platte, wo es weniger heiß war, und nahm die Zettel, die gleich neben dem WG-Plan hingen, von der Pinnwand. Auch Majas Rezept war darunter. Obwohl sie nicht mehr dabei war, verlangten die Kunden nach wie vor auch ihre Sorte – und überhaupt stieg die Nachfrage. Deshalb boten sie seit neuestem zusätzlich den 13ner Traumbeutel an. Dieses Müsli hatten Eva, Milo und Ecki zusammen entwickelt. Benannt nach den dreizehn Zutaten, die es enthielt. Die Anspielung auf Sigmund Freuds Traumdeutung war Eckis Idee. Es enthielt nicht einfach nur von allen anderen Sorten ein bisschen, sondern darüber hinaus noch einen großen Anteil an Kokosflocken und ölhaltigem Bitterkakao, den Eva mit Honig abmilderte. Sie strich über Majas Zettel und ihre sich gleichmäßig nach rechts neigenden Buchstaben, die wirkten, als hätte ihre liebste Freundin es immer noch auf ein Fleißbildchen in Schönschrift abgesehen. Eva holte Luft, um den Schmerz in ihrer Brust zu dämpfen. Sie sehnte sich so sehr nach Maja, vermisste sie mit jeder Minute mehr. Wäre sie hier, würde sie ihr bestimmt bei dem, was ihr bevorstand, beistehen und auch bei all den anderen Sorgen, die Eva sich machte. Aber Maja war fort. Und Eva noch immer traurig und wütend zugleich. Doch auch wenn es schmerzte, es half nichts, sie musste ohne sie zurechtkommen. Wenn Lieben doch einfacher wäre!
Tun zu können, was man gerne tut, bedeutet Freiheit. Das gerne zu tun, was man tut, bedeutet Glück. Zu ihrem Lieblingsnektar-Rezept hatte Maja ein Zitat geschrieben – von Henry David Thoreau, einem der ersten bekannten amerikanischen Aussteiger des neunzehnten Jahrhunderts. Sein Buch Walden war Kult und in ihrer WG als zerfleddertes Exemplar durch die Zimmer gewandert. Als Eva es fertig gelesen hatte, war sie sofort nach unten gelaufen, um mit Udo und Maja darüber zu diskutieren, die beim wöchentlichen Hausputz gewesen waren.
Für Udo dachte Thoreau nicht radikal genug. »Von wegen, Selbstversorger im Wald. Der hat’s doch recht bequem gehabt.« Er ließ den Schwamm ins Waschbecken fallen, schlüpfte aus den rosa Gummihandschuhen, schnappte sich das Buch, das Eva in der Hand hielt und faltete den Zeitungsausschnitt auf, den jemand reingelegt hatte. Eva liebte solche Ergänzungen in Büchern. Eine Abbildung zeigte das Innere eines Blockhauses mit den typisch amerikanischen Schiebefenstern. Ein Ofen, ein Schaukelstuhl, ein Schreibpult und ein Bett standen darin.
»Was spricht dagegen, es sich in der Natur gemütlich einzurichten?« Maja rollte den langen Flurteppich ein. »Ich finde es sehr radikal, wenn man sich aus der Gesellschaft mit ihren Erwartungen rauszieht und ein Leben in Einsamkeit wagt.«
»Was hat das mit der Natur zu tun?«, warf Udo ein. »Wenn der Ami wenigstens im Freien oder von mir aus in einem Zelt oder einem Baumhaus gelebt hätte.« Er widmete sich wieder den Badezimmerarmaturen.
»Er hat das Haus selbst gebaut, listet sogar alles auf, was er dafür gebraucht hat«, wandte Eva ein. Hatte Udo das Buch überhaupt gelesen? »Außerdem geht es um eine erfundene Figur, die nicht mit dem Autor gleichzusetzen ist.« Gern hätte sie ein paar Lieblingsstellen vorgelesen, hatte sich einiges markiert, was gar nicht so leicht gewesen war, da bereits andere vor ihr Sätze unterstrichen und Anmerkungen an den Rand geschrieben hatten. Sie setzte sich auf die unterste Treppenstufe. »Das Buch ist mehr ein Gedankenspiel, eine Utopie.«
»Du sagst es, Eva, doch wie wäre es zur Abwechslung mal mit etwas Konkretem, etwas, das wirklich etwas verändert? Nicht immer bloß ein Was-wäre-wenn oder Stell-dir-vor …«
»Du meinst so etwas wie ein sauber glänzendes Badezimmer?« Maja zog Udo auf und besänftigte ihn wieder. Normalerweise steigerte er sich bei solchen Gesprächen so weit rein, bis er alles in Frage stellte, und nur Maja schaffte es jedes Mal, ihn wieder zu beruhigen. »Ich mag solche Utopien aus Büchern. Man kann sich rauspicken, was einem gefällt, und damit seine eigene Erfahrung machen. Auch wenn wir nie so stark wie Pippi Langstrumpf sein werden, so können wir es doch versuchen. Oder, Eva?«
»Du willst ein Pferd hochheben?« Zuzutrauen wäre es ihrer einen Meter dreiundsechzig großen Freundin. Sie half ihr, den schweren Teppich zum Ausklopfen in den Garten zu schleppen, wo sie ihn im Schnee ausbreiteten.
»Ist gerade keins da zum Ausprobieren.« Maja lachte. »Dafür kann ich wie Pippi beim Wischen tanzen.« Sie schlüpfte aus den Birkenstockpantoffeln und den selbst gestrickten bunten Socken, kippte den Eimer mit dem Putzwasser auf den Boden. Eva sprang auf die Treppe. Sofort stand der gesamte Flur unter Wasser. Maja stieg auf zwei Wurzelbürsten und zog einen großen Kreis wie eine Schlittschuhläuferin. Das ließ sich Udo nicht entgehen, und auch er tänzelte mit dem Schrubber samt Wischlappen durch den Flur. Barfuß war er sowieso das ganze Jahr über. Und schwupp war auch Eva dabei, schnappte sich die Rückenbürste aus dem Bad und versuchte, über den Boden zu skaten. Der Vorteil einer WG – sie konnten tun und lassen, was sie wollten! Zumal sie noch in einem frei stehenden Haus wohnten und zwischen ihnen und den nächsten Nachbarn ein großer Garten lag. Leider war es nicht nur beim Spaß geblieben. Kurz danach setzten Maja und Udo ihre Vorhaben in die Tat um. Ohne Eva einzuweihen, zogen sie ihr eigenes Ding durch und entglitten ihr. Udo hatte sein Leben mit einer Protestaktion riskiert, und Maja war vor über einem Monat über den Landweg nach Indien aufgebrochen. Zuletzt hatte sie ihr Anfang Januar geschrieben:
Du solltest die Gesichter der Leute sehen, die wunderschönen Frauen, wie sie riesige Mengen an Brennholz auf dem Kopf tragen und welche Schicksale sich hinter ihren Augen abzeichnen. Nirgends spüre ich das Leben so deutlich wie hier.
Das klang, als wäre es ihr mit Eva langweilig gewesen. So reimte sie es sich beim Lesen jedenfalls zusammen. Laut des Datums und im Vergleich mit dem Stempel auf den vielen Marken, hatte der Brief aus Delhi zwei Wochen gebraucht.
Seither waren noch mal zwei Wochen vergangen, ohne dass sie wieder etwas von Maja gehört hatte. Rasch verdrängte Eva den Gedanken an ihre Liebste, und auch Udos Zustand versuchte sie auszublenden. An dem, was er getan hatte, fühlte sie sich mitschuldig. Besser, sie konzentrierte sich wieder auf das Müslimachen, schnitt für ihre eigene Sorte die getrockneten Feigen klein, verrührte sie mit den Haferflocken und Rosinen in einer Schüssel und streute etwas Zimt, eine Prise Kardamom und Anis darüber. Von wegen WG-Projekt. Am Ende blieb doch alles an ihr hängen, sie hatte sogar die Biochemie-Vorlesung geschwänzt, damit sie es schaffte. Und vom Grübeln hielt sie die Arbeit auch nicht ab, wie sie nun feststellte. Nachdem sie sich heute Morgen wieder übergeben hatte und ihr Kreislauf rebellierte, beschloss sie, zu Hause zu bleiben. Meistens legte sich die Übelkeit im Laufe des Vormittags wieder und machte großem Hunger Platz. So wie jetzt. Doch wie sollte sie nur ihr inneres Chaos beseitigen? Nächste Woche war es so weit, bei örtlicher Betäubung würde Helga Knaup, eine Starnberger Ärztin, eine Ausschabung vornehmen. Danach dürfte Eva aber nicht Auto fahren. Sie musste also jemanden einweihen, denn allein in der S-Bahn sitzen wollte sie in dem Zustand auch nicht. Aber wen? Udo und Milo wussten noch nichts davon. Eva hatte sich erst selbst klar werden wollen, bevor sie es ihnen sagte. Würden sie versuchen, es ihr auszureden, oder ihr bedingungslos beistehen? Seit Anfang Januar war Udo auf Reha in Bad Heilbrunn und Milo nach seiner Arbeit als Fotograf fast jeden Abend bei einer politischen Versammlung. Beide hatten eine andere Ausrede oder Verpflichtung, oder wie man es nennen sollte, und so übernahm sie stellvertretend für alle die Vorbereitungen für den Wochenmarkt. In Udos Müsli fehlten noch die Mandelblättchen. Sie schüttete sie in eine freigewordene Eisenpfanne und gab etwas Öl dazu. Dann schlug sie ihr Teedrogenbuch auf, wählte einen Begriff und sagte dazu auswendig und laut auf, was sie für die nächste Klausur wissen musste. »Rosae pseudofructus, die Hagebutte.« Nicht nur die lateinischen Namen, sondern auch die Stammpflanzen, die Pflanzenfamilien, und wofür man sie anwendete, sollte sie kennen. »Sie hilft bei Vitamin-C-Mangel, mit Hilfe der Malve wird die rote Farbe verstärkt.« Auf dem Ofen qualmte es, aber es war nur ein Öltropfen, der verdampfte. Weiter. Die nächste Droge. Sie musste mehr Walnüsse knacken, fiel ihr ein, das waren eindeutig zu wenige für Majas Mischung. Apropos, Walnuss. Eva suchte die Stelle im Buch. Die Walnuss, genau, da stand es, lateinisch juglans regia. Sie sagte es mehrmals vor sich hin, setzte den Nussknacker an und pulte die Kerne aus den Schalen. Das hätten sie gestern auch alle zusammen vorbereiten können, aber da hatte wie üblich keiner mehr Lust gehabt. Eva eingeschlossen. Als sie nach den Vorlesungen in der Uni und den Medizinlieferungen im Auftrag der Apotheke heimgekommen war, war sie so erledigt gewesen, dass sie wie eine Omi beim Fernsehen auf dem Sofa einschlafen war, was Milo und Ecki amüsiert hatte. Aber zurück zu juglans regia. »Walnussbaumblätter helfen als Tee bei Magen-Darm-Katarrh und zur Blutreinigung.« Jetzt hatte sie es intus. Und was war mit dem Huflattich? Die kleinen gelben Blüten hatte sie vor Augen und roch sie auch, aber ihre Verwendung wollte ihr nicht einfallen. Zum Gurgeln bei Halsschmerzen vielleicht? Oder galt das eher für den Eukalyptus, logisch, aus ihm stellte man Hustenbonbons her. Sie spickte ins Buch. Sekretolytisch und motorisch. Also schleimlösend und die Bewegung steuernd. Aber was bedeutete das genau? Ach, wenn sie doch bei der Prüfung anstelle von Fragebögen echte Pflanzen vorgelegt bekäme – die könnte sie sofort am Geruch unterscheiden und zuordnen. Dazu bräuchte sie nur ihre innere Duftbibliothek abzurufen. Eva seufzte. Mist, jetzt waren die Mandelblättchen doch angekokelt. Rauch stieg aus der Pfanne auf. Rasch leerte sie alles auf einen Teller und wendete es. Nichts mehr zu machen, die Unterseite war schwarz. Sie musste sie wegwerfen und noch mal von vorne anfangen. Der Gestank war unerträglich und erinnerte sie wieder an den Inhalt des Rattankoffers, den man ihr mitgegeben hatte, als sie adoptiert worden war. Ein paar Kinderkleider, kleine, altmodische Schuhe und das Tagebuch ihrer Großmutter Anna von Quast. Jedenfalls vermutete Eva, dass sie ihre Großmutter war. Obwohl sie erst wenige Seiten ihrer Notizen entziffert hatte, war es jedes Mal, als tauchte sie in eine andere Welt ein. Klare Bergluft, wilde Tiere und Herdenvieh, seltene Blumen und ein karger Boden, dem alles, was man zum Existieren brauchte, mit viel Schweiß abgetrotzt werden musste. Das alles noch dazu vor über sechzig Jahren. Anna hatte erst in Wessobrunn und dann auf einer Alm gelebt, nicht weit von Evas alter Heimat Murnau. Auch wenn sie von einer Tonkaalm noch nie gehört hatte. In den Einträgen hatte Anna ein Kind namens Helene erwähnt, das sie 1918 zur Welt gebracht hatte. Eine Helene von Quast war wiederum in Evas Geburtsurkunde als ihre leibliche Mutter angegeben. Demnach wäre Helene heute neunundfünfzig und hätte sie 1954, mit sechsunddreißig Jahren, bekommen. Relativ spät für damalige Verhältnisse – aber Eva hatte keine Ahnung von den Umständen. Vielleicht war das Alter einer der Gründe gewesen, weshalb ihre Mutter sie nicht hatte haben wollen. Möglicherweise hatte sie noch mehr Kinder, und Eva, als ihr letztes, war eins zu viel gewesen? Sämtliche Varianten hatte sie sich schon ausgemalt, so sehr sie auch dagegen ankämpfte, es nicht zu tun. Wozu sich mit etwas auseinandersetzen, was sie nicht ändern konnte? Andererseits wollte sie wissen, was damals geschehen war, auch wenn damit die Angst einherging, dass die Wahrheit nur schwer zu verkraften sein könnte. Eva öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen, und streifte mit dem Ellbogen den Teller. Er rutschte vom Tisch und zerschellte klirrend auf den Fliesen. Die verkohlten Mandeln flogen in alle Richtungen. Zitternd starrte Eva auf das Durcheinander. Plötzlich war ihr alles zu viel. Ihr Leben erschien ihr allein schon kompliziert genug, wie sollte sie es da mit einem Kind schaffen? Nein, ihr Entschluss war gefasst. Nächste Woche um diese Zeit würde sie nicht mehr schwanger sein.
»Huhu, Eva.« Eine picklige Stirn unter einer Kapuze ragte über das Fenstersims. Jasmin, ihre ehemalige Mitstudentin, stand draußen im Schnee. »Ich hab schon tausendmal geklingelt.« Sie klang heiser, drückte sich ihr Tuch fester an den Hals. »Ich dachte schon, es ist wirklich keiner da, und ihr habt nur vergessen, die Musik auszumachen.« Nach wie vor wummerte Reggae in Dauerschleife aus dem Keller.
»Warte, ich mach dir auf.« Eva versuchte, sich wieder zu fassen, vergewisserte sich schnell, dass sonst nichts anbrannte, und stieg über das Desaster am Boden. Als sie die Haustür aufzog, fiel eine große Korbtasche herein, und lauter kleine Dosen purzelten in den Flur. Auf dem Fußabstreifer stapelte sich noch mehr Zeug. »Was bringst du denn alles mit?«, fragte Eva, als Jasmin wieder um die Hausecke bog.
»Na, meine Sachen. Den Webrahmen und meine Didgeridoos hab ich schon in eurer Garage gebunkert.« Sie räusperte sich, als ihre Stimme versagte, und wegen ihrer festen Zahnspange lispelte sie leicht. »Wenigstens da war offen. Freddy musste wieder los, er hat mir bei der Herfahrt im Bus mit seinem Jehovaroller geholfen.« Sie meinte so ein Nachziehwägelchen, wie es alte Leute oder die Zeugen Jehovas hatten, und Freddy war vermutlich einer aus Jasmins Clique. »Schön warm bei euch.« Sie trat in den Flur und rieb sich die Hände. »Das war vielleicht eine Fahrt, und was es für unfreundliche Leute gibt. Das Karma in Deutschland ist dermaßen verseucht.« Nun musste auch sie gegen Bob Marley anschreien. Jasmin zog sich die Kapuze vom Kopf, befreite sich vom Fransentuch, das sie noch zusätzlich umgeschlungen hatte, und schlüpfte aus dem Bundeswehrparka, bei dem sie, wie viele andere auch, die Deutschlandfahne am Ärmel mit einem Peacezeichen übermalt hatte. Perlen glitzerten an türkisfarbenen Haaren. »Ich zieh doch heute bei euch ein.«
Das war Eva neu. Durch Udos und Majas Abwesenheit standen zwar momentan zwei Zimmer leer, aber davon, dass Jasmin ihre Mitbewohnerin werden wollte, hatte sie noch nichts gehört. »Wissen Ecki und Milo Bescheid?«
»Na klar. Ecki hat’s mir an Silvester angeboten, und hier bin ich.«
Dunkel erinnerte sich Eva, dass Jasmin gegen Mitternacht mit Ecki rumgeknutscht hatte und mit ihm in seinem Zimmer verschwunden war. »Und was ist mit Lutz?« Soviel sie wusste, waren Jasmin und er ein Paar und hatten zumindest bis jetzt zusammen mit anderen direkt an der Isar in Zelten gelebt.
»Der ist Geschichte, noch dazu halte ich die verdammte Kälte im Freien nicht mehr aus.« Sie stellte die klobigen Moonboots an die Garderobe, machte aber keine Anstalten, den dicken Pullover, den sie über einem dünnen Rolli trug, abzulegen. »Das ständige Schwemmholzsammeln, nur damit ich keine Frostbeulen kriege. Dazu die vielen Intrigen untereinander.« Dafür dass sie heiser war und die laute Musik übertönen musste, redete sie ziemlich viel. »Du glaubst ja nicht, was abgeht, wenn man Tag und Nacht aufeinander hockt.«
»Willst du nicht noch eine Schicht ausziehen?« Eva war nur in T-Shirt und Latzhose, bei offenen Türen heizte der Wamslerherd das gesamte Erdgeschoss.
»Ich wärme mich erst mal auf.« Jasmin stieg über ihre Sachen, breitete die Arme aus und drehte sich mit klimpernden Flechten um sich selbst. »Ah, bei euch ist es herrlich! Kochst du gerade? Was gibt’s denn? Oder wird das ein Kuchen?« Sie schnupperte. »Hier riecht’s wie in einer Backstube. Mir ist alles recht, ich hab nämlich noch nicht viel gegessen heute.«
»Weder noch.« Eva hatte keine Lust, die Gastgeberin zu spielen. »Ich mach gerade die Müslis für den Wochenmarkt.«
»Richtig, deshalb wollte ich auch mit dir reden. Kann ich meinen Schmuck an eurem Stand mit anbieten? Ich bin nämlich total pleite.« Sie sammelte die vielen scheppernden Dosen, den Silberdraht und die Zange ein und warf alles in die Korbtasche zurück. Wie selbstverständlich ging sie auf löchrigen Strümpfen an Eva vorbei die Treppe hoch.
Eva schaute ihren nassen Fußspuren hinterher. Anscheinend waren die Mondtreter nicht mehr dicht. Wer war als Nächstes mit Putzen dran? Milo? »Und wie willst du die Miete bezahlen?« Zurzeit machte Jasmin eine Ausbildung an der Heilpraktikerschule, die ihre Eltern finanzierten.
»Das hab ich mit Maja schon geregelt, sie ist so ein Schatz.« Auf dem Treppenabsatz wandte sie sich um.
»Hast du Kontakt zu ihr?«
»Natürlich. Wir telefonieren ständig. In der Bücherei gibt’s einen Apparat, wo man sich anrufen lassen kann. Aber unter uns, ganz ehrlich, ich könnte es keine fünf Minuten in diesem Land aushalten – das schmutzige Wasser und diese Stehklos. An der Isar durften wir wenigstens die öffentlichen Toiletten von der Stadt benutzen, die sind zwar ohne Beleuchtung, aber mit Waschbecken und Türen zum Abschließen. Maja gefällt’s in Indien, sie will sogar noch weiter nach Sri Lanka und später in den Himalaya reisen. Ach so, ganz vergessen, ich soll Grüße ausrichten.« Das hieß, Maja blieb länger als drei Monate. Davon hatte Eva nichts gewusst. Mit Jasmin hatte Maja offenbar eine deutlich engere Beziehung als mit ihr. Na und? Obwohl die Eifersucht an ihr nagte, machte sich nun auch Trotz in ihr breit. Sollten sie doch machen, was sie wollten! War nicht einer ihrer gemeinschaftlichen Grundsätze, tolerant zu sein? Und das war täglich aufs Neue zu erkämpfen. »Eva, sei doch so nett, und bring die Hutschachtel mit rauf, auf der ›wichtig‹ steht. Da sind meine Klangschalen und die Räucherstäbchen drin.« Eva hatte nicht vorgehabt, Jasmin bei überhaupt irgendwas zu helfen. Eigentlich war sie in der Küche beschäftigt. Aber sie tat ihr den Gefallen, schließlich lebten sie ab jetzt zusammen. »Nein, nicht die, die runde«, dirigierte Jasmin von der Treppe aus, »oder nimm gleich alle beide, wenn’s geht.« Eva glaubte, Blei zu stemmen, als sie die Schachteln anhob. Sie spürte ein Stechen in ihrem Unterleib, und unwillkürlich dachte sie an das ungeborene Kind und fragte sich, ob sie es damit verletzt hatte. Was für eine grausame Vorstellung. Aber war es nicht das, was sie wollte? Es wegmachen, es auslöschen? Auf diese Weise würde sie sich alles weitere sparen. Doch was hatte sie dann noch? Sie strich sich über den Bauch, bis der Schmerz nachließ, packte dann die runde Hutschachtel am Griff, klemmte sich die andere unter den Arm und lud beide oben in Majas Zimmer ab, das Jasmin bereits inspizierte.
»Huch, hier steht ja noch alles voll. Hat Maja das etwa so hinterlassen?« Sie nahm etwas Selbstgetöpfertes aus dem Bücherregal, schlenkerte es in einer Hand, als wollte sie es gleich fallen lassen. »Wohin damit?«
Die Vase war aus Tonwülsten geformt und ziemlich klobig, aber von Maja gemacht und damit einmalig schön. Eva nahm sie ihr ab und presste sie an sich.
»Das Bett und der Schrank müssen raus. Ich schlaf in einer Hängematte. Das Regal kann bleiben.« Mit schräggelegtem Kopf schaute Jasmin die Bücher durch. »Siddharta wollte ich sowieso mal lesen, und, ach, die Yogananda-Biographie hat sie auch? Spitze. Weißeln müsst ihr nicht, ich häng sowieso alles zu.« Maja hatte das Zimmer hellgrün gestrichen. Grün in allen Nuancen war ihre Lieblingsfarbe – zumindest bis zuletzt. Vielleicht hatte sich das auch geändert. Die Kante zur Decke war mit einer Borte aus Kartoffeldruck verziert, so wie früher in alten Bauernhäusern. »Die Muster sind hübsch, sie erinnern mich an meine Silberschmuckentwürfe. Das Bild gefällt mir auch.« Sie meinte das Temperagemälde mit einer rothaarigen Frau, die voller Hingabe an einer Heckenrose roch. Im Kunstkurs ihrer Ausbildung zur Erzieherin hatte Maja dieses Gemälde eines Präraffaeliten kopiert. Auch wenn die Gesichtszüge leicht verschoben waren, so schien die Frau eine Art Selbstporträt zu sein. Wenn Eva es ansah, stieg ihr sofort der feinherbe Duft in die Nase, der Maja immer umgab.
»Und warst du eigentlich bei der Starnberger Ärztin?« Jasmin faltete ein großes Fransentuch auseinander und hielt es an die Wand.
Auch wenn das überraschend kam, nickte Eva. »Danke für die Empfehlung, Doktor Knaup ist sehr nett und einfühlsam.« Von Jasmin hatte sie die Adresse erhalten, als in einer hitzigen Frauenrunde über die neue Reform des Paragraphen 218 diskutiert wurde. Nun durfte man nur abtreiben, wenn man vergewaltigt worden oder das Ungeborene schwer geschädigt war. Es sei denn, jemand war bereit zu bescheinigen, dass man sich in einer sozialen Notlage befand. Den meisten Frauen ging diese Lösung nicht weit genug. Sie wollten selbst bestimmen – nach dem Motto Mein Bauch gehört mir! Und sie verlangten völlige Straffreiheit nach einem Abbruch. Ob Jasmin bereits selbst abgetrieben hatte, wusste Eva nicht. Man redete viel und überall mit, aber allzu persönlich wurde es dabei nie. »Dann hast du’s schon hinter dir?«, fragte Jasmin.
»Nein, erst am Donnerstag«, gestand Eva ihr. Ohne, dass sie es zurückhalten konnte, flossen auf einmal Tränen. Sie schniefte. »Verdammte Scheiße aber auch.«
»Du armes Haselmäuschen. Na, komm mal her, Schwester.« Jasmin warf das Tuch zur Seite, zog Eva an sich und drückte sie fest. Sie roch nach Altkleidern und abgestandenem Wasser, stellte Eva fest, was hauptsächlich von ihren verfilzten Haarsträhnen ausging. Früher hatte sie mit Jasmin eher den Geruch von Pferd und Weichspüler verbunden, weil ihre Eltern eine Wäscherei betrieben. Sie kannten sich seit dem Gymnasium, waren nur zwei Dörfer entfernt voneinander aufgewachsen, hatten sich aber erst im Studium enger angefreundet. Eva fühlte sich ein bisschen wie von einem muffigen Plüschteddy umarmt. Trotzdem tröstete es sie, und es tat gut, dass sie ihr Vorhaben laut ausgesprochen hatte wie einen pharmazeutischen Begriff.
»Lass uns am Wochenende was Schönes zusammen machen«, schlug Jasmin vor, »damit du abgelenkt bist.«
»Das bin ich auch so. Aber du kannst von mir aus gerne mit an den Stand morgen Vormittag kommen. Ist eh besser, wenn wir zu zweit sind, dann kann sich jede mal kurz abseilen.« Früher hatte sie den Müsliverkauf mit Maja gemacht, aber in den letzten Wochen war sie meistens allein gewesen. »Ecki hat ein Selbstfindungsseminar, und Milo ist auf einer Hochzeit.«
»Wer heiratet denn?«
»Keine Ahnung, ist von seiner Arbeit aus. Als Fotograf wird er von seinem Chef ständig irgendwohin geschickt. Und ansonsten muss ich lernen.« Von all dem anderen, was Eva umtrieb, ganz zu schweigen.
Anna
Endlich tat sich eine Lichtung auf, die Sonne beschien eine Wiese, die saftig grün leuchtete. Schmetterlinge schwirrten zwischen Veilchen und Huflattich umher. Auf einem sonnigen Fleck entdeckte sie sogar schon einen Stengelenzian. Anna legte eine Pause ein, erleichterte sich hinter einer Fichte und setzte sich anschließend auf einen bemoosten Stamm, um sich auszuruhen. Sie war ganz außer Puste. Offenbar musste sie sich an solch eine Anstrengung erst wieder gewöhnen. Vermutlich war sie in der Hoffnung, dass sie so rascher oben wäre, zu schnell losgegangen. Als sich ihr Atem beruhigt hatte, trank sie einen Schluck Wasser, aß Rosinen und eine Karotte und biss schließlich noch in einen verschrumpelten Apfel, den sie einer Frau am Bahnsteig, noch in Bellinzona, abgekauft hatte. Jelmini, eine alte Apfelsorte aus dem Tessin, wenn sie sich nicht täuschte, die rot gestreift war und angenehm süßsauer schmeckte. Außer dem Krach, den sie selbst beim Essen veranstaltete, war es still ringsum. Kein Mensch befand sich in ihrer Nähe, so nahm sie jedenfalls an. Almen gab es mehrere in der Gegend, doch sie lagen weit auseinander, so viel sie sich erinnerte. Sie gähnte. In den letzten Wochen war sie mit sehr wenig Schlaf ausgekommen, stellte sie nun fest. Was gäbe sie jetzt für ein Bett, um sich auszustrecken. So eines, wie sie es in der Casa Selma gehabt hatte. Wo würde sie auf der Tonkaalm schlafen? Bevor sie noch müder wurde, raffte sie sich auf und beschloss, langsamer und in einem gleichmäßigeren Tempo weiterzugehen. Nach einer Weile stellte sie fest, dass ihr Herz nicht mehr wie vorhin raste, obwohl der Weg nicht weniger steil blieb. Er wand sich durch den Wald, mal nach rechts, mal links hinauf. Kurve um Kurve. Anna orientierte sich an den rotweißen Kreisen, die der Alpenverein in mühsamer und gewissenhafter Kleinarbeit überall in den Bergen auf Baumstämme und Steine gemalt hatte. So hatte es ihr Vater damals erklärt, und sie war als Kind eifrig dabei gewesen, diese Zeichen als Erste auf dem Weg nach oben zu entdecken. Die Markierungen boten den Wanderern Sicherheit, selbst wenn der Pfad durch Regen, Schnee oder Steinschlag nicht mehr zu erkennen war. Wer den Zeichen folgte, blieb auf dem Weg und konnte sich nicht verlaufen, hatte Papá ihr eingeschärft. Außerdem wurde so die Natur vor übereifrigen Bergsteigern geschützt, die gern abseits der Routen seltene Blumen als Trophäen pflückten. Blumen, die sowieso vertrockneten und später im Tal dann achtlos weggeworfen wurden. Besonders das Edelweiß, das der Alpenverein als Symbol nutzte, war dadurch fast ausgerottet worden. Anna freute sich auf ihr neues Zuhause. Sie sehnte sich nach der in sich geschlossenen kleinen Welt, die die Alm in ihrer Vorstellung war. Wenn sie diesen Aufstieg schaffte, so sagte sie sich vor, dann würde ihr auch alles andere gelingen. Auch wenn sie dort bestimmt hart arbeiten musste, um es am Ende des Tages gemütlich zu haben. Sobald das Feuer prasselte, das Essen auf dem Ofen dampfte und ein Tee duftete, würde sie ihrer Kunst nachgehen und sich in ihre Ideen vertiefen. Ein Lied kam ihr in den Sinn, vielmehr der Bruchteil einer Melodie. Um einen Hansl ging es, dem jemand antwortete. Ein Singsang wie ein Gespräch, das ihre Mutter ihr vorgesungen hatte, damit sie durchhielt. Hansl fragte Gretl – wen sonst? Oder umgekehrt? Richtig, die Gretl verlangte etwas vom Hansl. Anna versuchte, das Lied einzufangen, summte laut vor sich hin und wiederholte die Melodie mit jedem Schritt, bis sie ihr schließlich ganz einfiel.
Geh, mei Hansl, auf die Alm, derma fanga Kiah und Kalm, geh, mei Hansl, wos i di bitt. Na, mei Gretl, heit mog i no nit.
»Warum mog der Hansl ned, Mamá?«, hatte sie damals ihre Mutter gefragt. Und gemeinsam hatten sie sich lauter Gründe überlegt – und schwupp die Alm erreicht. Auch jetzt trieben Anna die Gedanken an das Lied ein Stück voran. Sie schwitzte, setzte den Koffer ab und wischte sich über die Stirn. Dann zog sie die Strickjacke aus und band sie sich um die Hüfte. Bergschafwolle, selbst gesponnen und gestrickt, ein bisschen kratzig, aber dafür wasserabweisend wie feinster Loden. Die Jacke roch nach dem Lanolin einer ganzen Schafherde und war mollig warm. Erneut nahm sie den Koffer auf, hängte sich ihre Tasche über die Schulter. Manchmal waren ihre Eltern und sie ein Wochenende lang auf der Alm geblieben, aber oft auch nur ein paar Stunden. Das letzte Mal dort oben war sie zehn Jahre alt gewesen – vor zwölf Jahren also. Wenn sie gewusst hätte, was danach geschehen sollte, hätte sie sich alles besser eingeprägt und wahrscheinlich jeden Augenblick noch mehr genossen. Doch damals hatte sie nicht geahnt, dass ihre Mutter wieder schwanger gewesen war und ihr der Weg für ein weiteres Mal zu beschwerlich sein würde. Auch nicht, dass sie kurz nach der Geburt sterben würde, genauso wie das Kind, Annas kleiner Bruder. Und nun war auch Vater seit letztem Sommer tot, und Anna eine Waise. Abgesehen von ihrer neuen Stiefmutter und ihrem Stiefbruder, der in Kiel bei der Kaiserlichen Flotte angeheuert hatte, war ihre einzige noch lebende Verwandte eine greise Großtante in Sachsen. Ihr hatte sich Papá widersetzt, als er ihre Mutter, eine Bürgerliche, heiratete – Gesine, einzige Tochter eines Wirts aus Garmisch, die er im Vorgarten des Gasthofes kennengelernt hatte, wo sie arbeitete. Wieder und wieder hatte sich Anna als Kind diese Geschichte erzählen lassen. Jeder Elternteil schmückte sie anders aus und variierte sie, hatte Anna mit den Jahren festgestellt. Ihr Vater war gerade erst von seinen Reisen als Pflanzenjäger zurückgekehrt. Es hätte lange gedauert, bis er das schöne und stolze Fräulein Hornsteiner zu einem Spaziergang überreden konnte. Viele Male war er nach Garmisch gefahren und hatte sich bei der Familie einquartiert, bis er ihr Herz gewann. Ihre Mutter hatte hingegen behauptet, sie wäre diejenige gewesen, die ihn eingeladen hätte. Den Blumenbaron, wie man ihn in der Gegend nannte, der ihr von Anfang gefiel. Damals hatte sie noch Schauspielerin werden wollen, und er, als Mann von Welt, hatte bestimmt schon viele Aufführungen gesehen und verstand etwas von dieser Kunst, so hoffte Gesine es jedenfalls. Das Theater blieb ein Traum von ihr, denn kaum hatten sie sich verlobt und geheiratet, kam auch schon Anna zur Welt. Von da an verpflichtete sich Gesine ganz der Familie und vor allem ihrem Mann, half ihm bei der Gutsverwaltung und begleitete ihn zu gesellschaftlichen Verpflichtungen, was nach ihrem Tod Anna, noch ein Backfisch, übernommen hatte. Auch wenn ihre Mutter ihr zuliebe die Schauspielerei aufgegeben hatte, so hatten sie sich gemeinsam die schönsten Spiele ausgedacht. Einmal hatten Mamá und sie sich so verkleidet, dass die Dienstboten sie für Besucher hielten und sie zum Warten in den Pavillon führten, wo sie ihnen Tee servierten, weil die Herrschaft unauffindbar war. Was für ein Spaß! Anna, als kleiner dicker Herr, mit Melone auf dem Kopf, im viel zu langen Schwalbenschwanzanzug, die Weste mit einem Kissen ausgestopft, und Mamá als Gesandter des Prinzregenten mit aufgeklebtem Bart und schmalziger Stirnlocke. In den letzten Jahren war Anna so eng mit ihrem Vater verbunden gewesen, dass sie die Zeit mit ihrer Mutter fast vergessen hatte. Dabei war sie immer bei ihr geblieben – so kam es Anna jetzt mit jedem Schritt vor, mit dem sie sich weiter nach oben kämpfte.
Sie verließ den Kiesweg und folgte einem engen Pfad durch den Wald. In der Ferne glaubte sie noch den Bach rauschen zu hören, oder vielleicht war es auch nur der Wind, der durch die Blätter fuhr? Vereinzelt sangen Vögel, und Anna versuchte, sie zu erkennen und zuzuordnen. War das das Schnarren einer Drossel? Es knackte unter ihren Sohlen, als sie weiterging. Der Waldboden war mit Tannennadeln übersät. Eine Spitzmaus huschte an ihr vorbei. Fast war es, als würde sie sich ans andere Ende der Welt begeben. Ein Ende, das für sie ein Neuanfang werden sollte. Plötzlich, und ohne dass sie es bemerkt hatte, endete der Weg. Anna blieb am Hang stehen und wandte sich um. Wurzeln, Laub und Steine, aber kein Pfad oder auch nur eine schmale Spur zeichnete sich dazwischen ab. Sie suchte an den Baumstämmen nach einem Hinweis, nach der Alpenvereinsmarkierung oder irgendeinem Zeichen, dass hier jemals ein Mensch vorbeigekommen war. Nichts. Was sollte sie inmitten eines bayerischen Urwalds tun? Sie ging ein Stück zurück, um herauszufinden, wo sie falsch abgebogen war. Doch nichts als Wald umschloss sie. Wieder, wie schon so oft in ihrem Leben, kam sie sich ziemlich einfältig vor. Ohne Plan und ohne Bergführer einfach loszumarschieren, mit dem Vertrauen, dass sie den Weg schon selbst finden würde. Warum hatte sie vorhin im Laden keine Landkarte erstanden? Nicht mal einen Kompass besaß sie. Sie schnaufte erst mal durch. Sich zu ärgern oder sich zu beklagen, half jetzt auch nicht weiter. Sie schaute zum Himmel, um abzuschätzen, wo die Sonne stand. Die Tonkaalm lag südlich, das wusste sie, sonst würde dort gar nichts wachsen. Und die Sonne hatte noch nicht ihren höchsten Punkt erreicht. Das erkannte sie auch an den Schatten, die sich noch deutlich auf dem Waldboden abzeichneten. Es musste kurz vor Mittag sein, etwa zehn oder elf Uhr. Sie konnte nicht genau einschätzen, wie viele Stunden sie bereits gegangen war, aber vermutlich waren es eher zwei als drei. Noch hatte sie Zeit, den Aufstieg zu schaffen, egal wie lang er dauerte. Noch musste sie nicht fürchten, von der Dämmerung eingeholt zu werden, und das Wetter hielt auch stand. Doch was, wenn sie sich weiter irrte? Wenn sie sich komplett verlief und überhaupt keinen Weg mehr fand. Sollte sie auf einen Baum klettern, um sich einen Überblick zu verschaffen? Weit konnte es doch nicht mehr sein. Am besten sie kehrte um und versuchte, die letzte Markierung zu finden. Vorher wollte sie sich die Stelle, wo sie sich befand, einprägen, damit sie merkte, wenn sie im Kreis lief. Sie sah sich nach etwas um, was sie später wiedererkennen würde. Ein großer Stein oder ein besonderer Baum. Doch alles wirkte auf einmal zu ähnlich oder nicht augenfällig genug. Sie sammelte ein paar flache Steine und schichtete sie unter einer Fichte aufeinander. Dabei scheuchte sie einen Hasen auf, der sich unter den Wurzeln, die wie Finger verschränkt waren, gekauert hatte. »Tut mir leid, das wollte ich nicht.« Sie schaute ihm nach, wie er davonhoppelte und verschwand. So nah war sie einem wilden Tier noch nie gewesen. Gab es hier noch mehr? Rehe, Füchse oder sogar Wölfe? Anna entfernte sich etwas von der markierten Stelle und drehte sich um. Wenn ihn niemand vorher umstieß, würde sie den Steinturm wiederfinden. Mit frischem Mut beschloss sie, weiter hochzusteigen, da huschte etwas an ihr vorbei. Eine Eule?
»Ja, Fräulein, hast du dich verirrt?« Ein graubärtiger Mann, der eine Flinte über der Schulter trug, stand auf einmal neben ihr, als wäre er aus dem Nichts aufgetaucht. Womöglich wäre sie fast erschossen worden, wenn er es auf den Hasen abgesehen hatte.
Dennoch freute sich Anna, ihn zu sehen. »Kann man wohl sagen, Grüß Gott. Ich bin vom Weg abgekommen. Wissen Sie, wo der ist?«
»In de’ Berg’ duzn mir uns«, sagte er auf Bayerisch. »Wo willst denn hin mit deinem Kofferl? Zum Bahnhof nunter?«
»Naa, do kumm i grod her.« Auch sie sprach im Dialekt. »Ich will zur Tonkaalm.«
»So, so, da hast du noch ein hartes Stückerl vor dir. Was willst du denn da droben? Falls du auf eine Bewirtung hoffst, muss ich dich enttäuschen, die Tonkaalm ist nicht mehr bewohnt.«
»Das ändert sich, ich zieh dort ein. Ich bin die Besitzerin, die Anna von Quast.«
»Dachte ich es mir doch, dass ich dich, vielmehr Sie, gnädiges Fräulein, kenn’, die Tochter vom Blumenbaron, gell? Das letzte Mal, als ich Erna gsehng hob …«, nun siezte er sie wieder, »waren Sie aber erst so groß.« Mit der Handkante zeigte er auf eine Stelle oberhalb seiner Knie.
Diese Begegnung musste aber dann schon wesentlich länger her sein, dachte Anna und lächelte. Ein Glück, hier war ein Mensch, der sie kannte und ihr hoffentlich weiterhalf. »Bleiben wir doch beim Du, wenn’s recht ist. Und du bist?« Ihr gefiel der Brauch, dass man sich in den Bergen duzte, und die adligen Gepflogenheiten hatte sie sowieso längst abgelegt.
»Der Fiedler Paul, uns gehört die Alm im Kessel unterhalb der Pessenbacher Schneid.« Er zeigte durch das dunkle Grün hindurch nach oben.
»Richtig, die Fiedleralm, ich erinnere mich. Beim Auf- oder Abstieg haben meine Eltern und ich euch besucht. Dann hat’s Himmel und Erde gegeben, köstlich.« Zweierlei Apfelsorten, aber nur dem Namen nach. Die Frucht vom Baum, also Himmel, in Form von Apfelmus, und zerstampfte Erdäpfel, also Kartoffeln, vermischt zu einer Speise.
»Das Fräulein Baronesse, wie nett.« Mitten im Wald, noch dazu am Hang machte er eine leichte Verbeugung und reichte ihr zugleich die Hand.
»Einfach Anna, das genügt.«
»Dann bin ich der Paul. Meine Meta wird sich freuen. Komm mit.« Wie selbstverständlich leitete er sie quer durch den dichten Wald, und bald erreichten sie einen Kessel, wo ein grün gestrichenes Häuschen stand, das sich durch Farbe und Form kaum von der Umgebung abhob. Eine kräftige Frau mit einem silbergrauen Dutt öffnete die Fensterläden und staunte, als sie zu zweit ankamen. »Die Baronesse von Quast mag bestimmt eine Pause bei uns einlegen und mit uns essen.« Er sprach die Einladung aus, und seine Frau fügte sich. Sie wirkte nicht ganz so beschwingt wie Paul, nachdem sie erfahren hatte, wer sie war. Anna war froh, sich etwas ausruhen zu können, und duckte sich unter dem niedrigen Türstock durch in die vollgestellte Stube. In den Ecken hockte noch der Schnee, jedenfalls roch es so. Meta Fiedler, eine Frau um die sechzig, brachte den Kanonenofen in Gang, den sie auch zum Kochen benutzte.
»Wir bereiten alles für die Sommeralm vor, wenn unsere Kühe raufsteigen.« Paul hängte die Schrotflinte an die Wand.
»Die rotbraune Herde auf der ersten Wiese unten, ist das eure?«, fragte Anna.
»Ja, unsere Murnau-Werdenfelser.« Er nickte. »Die sind robust und bestens für alle Arbeiten geeignet.«
»Und wunderschön dazu«, ergänzte Anna. Sie hatte Kühe immer schon gemocht. Paul erwiderte nichts. Dass man Nutztieren Schönheit zusprach, war ihm, wie den meisten, offensichtlich fremd. So viel wusste Anna noch aus Wessobrunn von den Bauern, wenn sie sich als Apfel-Anna um die Obstbäume gekümmert hatte. Den Grund für diese Distanz vermutete sie darin, dass man die Tiere auch schlachten musste. Wozu sich mit etwas anfreunden, wovon man sich bald wieder trennte?
Vom Aufstieg erhitzt, fror sie nun, als sie zwischen Dosen und aufgestapelten Kisten auf der Bank Platz nahm, die sich durch den halben Raum zog. Das schien Meta zu bemerken, wortlos gab sie ihr eine Decke. Dann schlug sie ein halbes Dutzend Eier in eine Eisenpfanne, rührte Milch und Gewürze hinein und stellte schließlich das dampfende Omelett zusammen mit Brot und Käse auf den Tisch. Die Fiedlers murmelten ein kurzes Gebet, und dann zogen beide aus einem Futteral, das unter der Tischplatte befestigt war, einen hölzernen Löffel. Anna sollte sich einen von ihren Buben nehmen.
»Dann seid ihr auch zum ersten Mal in diesem Jahr oben?« Möglichst unauffällig wischte sie den Löffel mit ihrem Kleid sauber, bevor auch sie sich aus der Pfanne bediente.
Wieder war es nur Paul, der sprach, obwohl Anna sich extra an Meta wandte. »Ja, von Mai bis zum September. Den Hof haben wir an unseren Ältesten übergeben, den Winter über leben wir unten im Austrag. Jetzt verirrt sich noch selten jemand zu uns, du bist die erste heuer. Die Sommerfrischler treibt es meistens erst Mitte Juni rauf, und dann gibt’s bei uns eine Brotzeit.«
Meta schenkte dampfenden Kaffee ein. Jedenfalls meinte Anna es der Farbe nach. Er roch aber nicht so. Hauptsache heiß! Sie wärmte sich die Finger an der Tasse und nippte am Gebräu. »Was ist das für eine Sorte?«
»Aus Bucheckern und Eicheln. Die sammeln wir im Herbst, rösten, trocknen und mahlen sie wie Bohnenkaffee. Schmeckt’s?«
»Ja, danke.« Der Kaffee war gallenbitter, sie wusste nicht, wie sie aus Höflichkeit den gesamten Inhalt der Tasse hinunterzwingen sollte.
»Und wie geht’s deinem Herrn Papá?« Paul betonte Papá genauso auf der letzten Silbe, wie sie es immer getan hatte.
»Er ist letztes Jahr gestorben.« Anna erzählte von der Hochzeit und seinem plötzlichen Tod. Paul und Meta kondolierten ihr.
Meta drückte sogar Annas Hand. Für einen kurzen Moment hellte sich ihr Gesicht auf, so als wäre sie erleichtert, als sie davon erfuhr. Was ging hier vor? »Und die Alm, wie geht’s mit der weiter?« Endlich sprach auch sie. Sie klang mürrisch.
»Die habe ich geerbt und möchte dort oben leben«, erklärte Anna.
»Als Dirndl allein da droben? Respekt!«, sagte Paul.
»Was genau willst du denn da oben machen?«, fragte Meta.
»Na, einfach dort leben. Erst mal schau ich nach dem Rechten, und dann will ich einen Garten anlegen, und ich hoffe, bald etwas zu ernten.« Anna erzählte von ihren Plänen.
»Du willst in dieser Höhe etwas pflanzen?« Paul lachte laut auf. »Ich kann mich nicht erinnern, dass das schon mal jemandem wirklich gelungen ist.«
Dafür erhielt er von Meta einen Stoß mit dem Ellbogen.
»So lass sie doch. Nichts ist unmöglich, bevor man es nicht versucht hat.« Sie wandte sich wieder an Anna. »Willst du auch Viecher halten?«
»Nein, erst mal nicht.« So weit konnte sie noch nicht denken, zunächst musste sie allein zurechtkommen. Zur Not kann ich mich an euch wenden, wenn ich darf, oder?«
»Selbstverständlich. Wir Almerer halten zusammen, mit Rat und Tat.«
»Vielleicht könnt ihr mir auch mit Brennholz aushelfen? Gegen Bezahlung natürlich. Ich weiß nicht, was oben noch liegt, aber ein Vorrat kann nicht schaden.«
»Das kann der Severin machen, unser zweiter Bub, der ist Zimmerer. Ich schick ihn dir in den nächsten Tagen mit einer Fuhre hoch.«
Anna bedankte sich, hob die immer noch heiße Tasse, um auf gute Nachbarschaft anzustoßen. »Wenn ich heute noch meine Alm erreichen will, muss ich jetzt aber aufbrechen.« Möglichst unauffällig leerte sie das Getränk in eine Blechwanne, die neben ihr auf dem Boden stand. Als sie die Tür öffnete und zurückblickte, erkannte sie, dass Wäsche darin lag. Zu spät. »Ich hoffe, ihr besucht mich auch mal auf eine Brotzeit?«, sagte sie schnell, um der Peinlichkeit entgegenzuwirken. Damit stellte sie etwas in Aussicht, von dem sie nicht wusste, ob sie es einlösen konnte.
»Gern, oder Meta?« Paul begleitete sie hinaus und wandte sich erneut an seine Frau, die stumm nickte und, ohne sich zu verabschieden, im hinteren Teil des Hauses verschwand. »Lass doch den Koffer da, den kann unser Bub mitbringen«, schlug er vor. »Das Trumm hindert dich doch bloß nachher beim Klettern.«
Anna lehnte ab. »Danke, aber das ist alles, was ich besitze, und das brauche ich.« Das Sonnenlicht blendete sie, als sie ins Freie trat. Vor ihr erhob sich der Gipfel, an dem sie seitlich hinaufmusste.
»Wenn der Schnee sich nicht gelöst hat, sind dort noch befestigte Stufen.« Zur Sicherheit erklärte ihr Paul den genauen Weg. Den Steig hinauf, dann bis zum Kreuz der Pessenbacher Schneid und dann wäre sie schon am Rabenkopf, den sie umrunden müsste, um zur Tonkaalm zu gelangen. »Also dann, auf bald.«
»Wart. Ich hab noch was für dich.« Meta schleppte einen vollen Buckelkorb herbei und leerte die Kartoffeln, die sich darin befanden, in einen Kübel. »Hier, nimm den. Dann hast du die Hände frei.« Der Koffer passte genau hinein, und auch ihre Umhängetasche hatte noch Platz. Die Fiedlerbäuerin half Anna beim Einstellen der Ledergurte, damit sie den Korb einigermaßen bequem auf dem Rücken tragen konnte.
»Danke. Was bin ich schuldig?«
»Nichts. Der gehört sowieso euch, den haben wir uns vor ein paar Jahren geliehen. Ach, und hier«, Meta nahm zwei Handvoll Kartoffeln und schichtete sie um die Sachen herum. »Magst du auch noch einen Liter Milch dazu?«
Den nahm Anna gern, sie wusste nur nicht, wie sie den transportieren sollte. In ihrer Flasche vielleicht? Aber dann hätte sie kein Trinkwasser mehr. Doch dafür wusste Meta ebenfalls etwas. Sie brachte ihr die Milch in einer Blechkanne, die bereits ein paar Beulen hatte, klemmte ein Pergamentpapier unter deren Deckel, damit nichts hinausschwappte, und stellte sie mit in den Korb.
Beschwingt und gestärkt, erklomm Anna die Stufen den Steilhang hinauf und erreichte die Pessenbacher Schneid, wie Paul es beschrieben hatte. Einen breiten, grasgrünen Sattel, auf dem ein großes Holzkreuz stand. Der weite Blick über die Alpenkette und bis in die Täler hinab belohnte sie für die Strapaze. Links von ihr erhob sich die Benediktenwand, und vor ihr lag das Karwendelgebirge. Anna atmete tief ein und aus. Ja, hier wollte sie sein! Frei und glücklich. Die Vergangenheit, ob gut oder schlecht, lag tief unter ihr und war spitzmauseklein. Sie kehrte der Benediktenwand den Rücken und umrundete einen Felshang auf einem fußbreiten Pfad, der kaum zu erkennen war. Immer wieder unterspülten Rinnsale den Weg, und Anna klammerte sich an alles, wo sie Halt fand. Ein falscher Tritt und sie würde abstürzen. Wie sollte ein Fahrzeug hier heraufgelangen? Wie eine Fuhre mit Holz? Nur allein auf Schusters Rappen kam man hier vorwärts.
Und auf einmal lag sie vor ihr, die Tonkaalm. Anna beschleunigte ihre Schritte, flog förmlich über die Buckelwiesen dahin. Einen Schlüssel besaß sie nicht, aber sie wusste noch, wo einer versteckt war, und hoffte, dass er dort noch lag. Ihre Stimmung trübte sich, als sie näher kam. Das Haus war alles andere als heil. Dachschindeln fehlten. Die Läden vor den Fenstern hingen schief oder waren herausgerissen. Eine Scheibe war zerbrochen. Sogar die Haustür hatte jemand aus den Angeln gehoben. Anna fiel das merkwürdige Verhalten der Fiedlerbäuerin ein. Hatte sie geahnt, was Anna vorfinden würde? Aber warum hatte sie sie dann nicht gewarnt oder sie sogar abgehalten? Einzig der Tonkabohnenbaum, der der Alm ihren Namen verlieh, stand noch da und trug kleine grüne Blätter. Mittlerweile reichte er ihr bis zur Brust. Zuletzt war er bloß ein Pflänzchen gewesen, das ihre Mutter, die es von Annas Vater zu ihrer Geburt geschenkt bekommen hatte, sorgsam gehegt und gepflegt hatte, damit der Schmetterlingsblütler, der aus den Tropen stammte, überlebte. Zögernd trat Anna über die Schwelle ins Haus. Drinnen schaute es noch schlimmer aus. Die Möbel waren umgeworfen, das Geschirr aus den Schränken gerissen, vieles zerbrochen, die Scherben verteilt. Überhaupt war der Fußboden mit allem Möglichen übersät. In einer Ecke scheuchte sie eine Kröte auf, hob sie hoch und trug sie nach draußen. Unter der Eiche, die neben dem Heustadel wuchs,




























