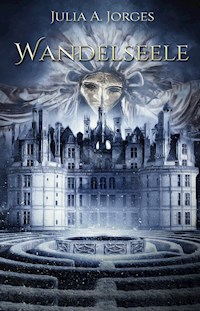Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thriler, Krimi und Mystery
- Sprache: Deutsch
Titus Volkmer muss mitansehen, wie sein kleiner Sohn von einer weiß gekleideten Frau gepackt wird. Gleich darauf nimmt ihm eine vorbeifahrende Straßenbahn die Sicht. Als die Gleise wieder frei sind, fehlt von dem Jungen und dessen Entführerin jede Spur. Die Fahndung der Polizei bleibt ohne Ergebnis. Weitere Kinder verschwinden, und immer wieder taucht die weiße Frau auf. Sie löst tödliche Unfälle und Wahnvorstellungen aus. Gibt es einen Zusammenhang zwischen ihrem Erscheinen und der sengenden Hitze dieses Ausnahmesommers? Auf der verzweifelten Suche nach ihrem Sohn folgen die Eltern der Spur der Verwüstung, die die weiße Frau hinterlässt, und geraten in eine Welt jenseits ihrer Vorstellung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia A. JorgesGLUTSOMMER
In dieser Reihe bisher erschienen
7001 Stefan Melneczuk Marterpfahl
7002 Frank W. Haubold Die Kinder der Schattenstadt
7003 Jens Lossau Dunkle Nordsee
7004 Alfred Wallon Endstation7005 Angelika Schröder Böses Karma
7006 Guido Billig Der Plan Gottes7007 Olaf Kemmler Die Stimme einer Toten
7008 Martin Barkawitz Kehrwieder7009 Stefan Melneczuk Rabenstadt
7010 Wayne Allen Sallee Der Erlöser von Chicago
7011 Uwe Schwartzer Das Konzept7012 Stefan Melneczuk Wallenstein
7013 Alex Mann Sicilia Nuova
7014 Julia A. Jorges Glutsommer
7015 Nils Noir Dead Dolls
Julia A. Jorges
GLUTSOMMER
THRILLER
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Mario HeyerUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-298-1
Ich bin der Schatten, der zwischen den Zweigen spielt,
bin das Dunkel, das unter den Steinen schläft,
bin die Stille im Herzen des Waldes.
Und wenn die Sonne sinkt, nenn mich Nuit.
1
Eigentlich, dachte Mona, während sie den leise dahinplätschernden Bachlauf entlangschritt, hatten sie beide einiges gemeinsam. So begradigt das ursprünglich wilde Bett der Raute, so geradlinig war mit den Jahren ihr Leben geraten.
Wann genau sich der Rundgang – über Eckberg, der Raute folgend, durch die Felder, den Wald und zurück zu ihrer Wohnung in der Lilienfeldsiedlung – zur festen Gewohnheit gemausert hatte, wusste Mona nicht mehr und es interessierte sie auch nicht. Wichtig war nur, dass sie ihn zweimal täglich absolvierte, jeweils zwischen neun und elf Uhr, und dann noch einmal nachmittags von drei bis fünf. Er half, ihr inneres Gleichgewicht zu bewahren, das allein zählte.
Nur während der zweimal zwei Stunden, in denen sie einen Fuß vor den anderen setzte, in ihren Wanderschuhen, die sie sommers wie winters trug (eine teure, aber lohnende Investition, zu der ihr Gerlind geraten hatte – die höheren Mächte mögen sie selig haben), erlaubte sie ihren Gedanken, ebenfalls umherzuschweifen. Daheim lief der Fernseher, musste laufen, und die huschenden Bilder und das Dauermurmeln der Stimmen lullten ihr Bewusstsein angenehm ein. Denn das Denken war eine zwiespältige Angelegenheit. Fing man einmal damit an, verselbstständigte sich der Ursprungsgedanke, fächerte sich auf, bildete Abzweigungen, die einander überkreuzten und um die Vorfahrt stritten. Manche führten in Sackgassen, manche spannen sich endlos weiter und andere – das waren die, die mitunter zur Qual wurden – bissen sich in den eigenen Schwanz wie Hunde und kreisten um sich selbst, bis Mona schwindlig wurde. Dagegen half das Fernsehen.
Viele ihrer Gedanken befassten sich mit nicht-greifbaren Dingen und einige mit dem Wetter, das zumeist wenig Bemerkenswertes an sich hatte. Das Wetter war wie es war, und meist war es mittelmäßig. Mehr oder weniger nass, kalt oder warm, ein bisschen Nebel und Wind, heiter bis wolkig. Natürlich gab es Ausreißer, aber die relativierten sich bald wieder. Seit einiger Zeit jedoch hatte das Wetter sein zuverlässiges Mittelmaß verlassen. Dem zugrunde lag eine Trockenphase, die bereits so lange anhielt, dass der Pegel der Raute stark abgesunken war. Der Feuergraben hinter dem Wehr, der sich noch im letzten Jahr als eigenständiger kleiner Bach präsentierte, führte schon lange kein Wasser mehr. Die Blauen und Grünen, sonst regelmäßig in den Uferbereichen der Raute zugegen, ließen sich kaum noch blicken. Mona rätselte, ob sie sich an andere, wasserreichere Orte zurückgezogen hatten, doch ihr fielen keine im nahen Umkreis ein. Allerdings wusste sie nicht, welche Wegstrecken die Kleinen zurückzulegen imstande waren und ob sie dies ausschließlich in ihrem angestammten Element taten oder sich auch trockenen Fußes fortbewegten. Über kurze Distanz war das sicher möglich, den Grünen sowieso. Wenn der Frühnebel über dem Renaturierungsgebiet hing, hatte Mona beide Arten dort tanzen sehen, im morastigen Überschwemmungsbereich der Raute.
Die Orangefarbenen, Gelben und Roten nahmen dagegen Überhand. Überall auf den Feldern und Wiesen trieben sie sich herum und fügten die ausgetrocknete Auenlandschaft ihrem Besitz hinzu. Flink huschten sie hinter Grasbüschel und die breiten, knorrigen Stämme der Weiden, die das Wasser feldwärts säumten, doch Monas Augen waren scharf und ebenso flink und vermochten sie fast immer zu erfassen, bevor sie sich verbargen.
Eben wieder. In der geschwärzten Höhle, die ein Blitz in den stattlichen Baum geschlagen hatte, ohne ihn vollständig zu vernichten. Frisches Grün trieb aus mehreren Stellen unterhalb der schrecklichen Verwundung aus, und auch ein Teil der Äste stand noch im Saft. Die Wurzeln der Weide reichten tief genug, um sich ihren Anteil an Wasser zu verschaffen. Flüstern tönte aus dem hohlen Stamm und brach ab. Mona spitzte die Ohren. Am Klang der geraunten Worte war etwas, das sie stutzen ließ. Weiß, hörte sie, in der eigentümlichen Sprache der Kleinen, gehaucht in ehrfurchtsvollem Tonfall von einem und wie ein Echo von anderen weitergetragen. Weiß wird kommen. Mehr nicht, denn nun wussten sie, dass sie belauscht wurden. Wie schon viele Male zuvor fragte Mona sich, ob ihr die angedeuteten Geheimnisse mit Absicht verraten wurden oder ob ihre Zuhörerschaft dem Zufall entsprang. Letzteres wäre ihr lieber. Denn falls nicht, würde ihr damit eine Verantwortung aufgebürdet, die weit über die Sorge für ihre eigene Person hinausging, an der sie schon schwer genug trug, und das war nichts, was Mona sich für ihre verbleibenden Lebensjahre wünschte – Verantwortung für andere zu tragen. Womöglich für eine ganze Welt, die ihr nach all der Zeit immer noch so fremd war.
2
„Papa?“
Titus wollte eben die Heckklappe zuschlagen. Jetzt hielt er inne, die Kiste mit Altglas zwischen Arm und Körper geklemmt. „Was denn?“
„Wer ist das?“
„Hm?“ Titus blickte sich um, sah aber niemanden. Er schloss den Kofferraum, damit die Hitze nicht ins angenehm temperierte Wageninnere drang, bevor er die Tür hinter dem Beifahrersitz öffnete und sich zu Keno beugte. Sein Sohn schaute an ihm vorbei zu den Wertstoffcontainern. „Wen meinst du, Keno?“, fragte Titus leicht ungeduldig. Eine Wespe schwirrte in seine Richtung, genauer gesagt auf die leeren Flaschen und Gläser zu. Auf einem davon, an dem außen Marmelade klebte, ließ sie sich nieder.
„Na, die Frau da hinten.“ Keno zeigte auf das Feld jenseits des Fußwegs hinter den Containern.
Titus entdeckte noch immer nichts. Er hätte seine durch den Schweiß verrutschte Brille hochgeschoben, hätte er die Hände frei gehabt. Eine zweite Wespe erhob Anspruch auf die süßen Reste. Vorsichtshalber lehnte Titus die Autotür an. „Bin gleich wieder da“, sagte er. Keno nickte, ohne ihn anzusehen. Starr hing sein Blick an dem Feld, wo über dem reifenden Weizen die Luft in der Mittagssonne flimmerte.
Während Titus sich bemühte, nicht von erbosten Insekten gestochen zu werden, polterte und zerbarst das Altglas von zwei Wochen im leeren Container. Titus klappte die Box zusammen und ging zum Auto zurück, wo Keno von innen die Hände gegen die Scheibe presste. Nur der Gurt hinderte ihn daran, auch noch die Nase dagegen zu drücken. Kopfschüttelnd wandte Titus sich erneut um und erkannte endlich, was Keno schon viel früher aufgefallen war: eine einzelne Person, die sich dunkel gegen die allumfassende Helligkeit abhob.
Als er die Box neben Schwimmsachen, Luftmatratze und Picknickdecke im Kofferraum verstaute, war die Person nahe genug herangekommen, um sie anhand des Vierbeiners, der vor ihr herlief, als Frau Müller mit ihrer Dalmatinerhündin Lola zu identifizieren. Keno besaß wirklich Augen wie ein Luchs! Oder seine eigenen waren schlechter geworden … Seit dem achtzehnten Lebensjahr lag Titus’ Kurzsichtigkeit bei minus drei Komma acht Dioptrien, ohne Brille ging in der Ferne gar nichts. Dafür war seine Nahsicht ausgezeichnet, was ihm in der Praxis zugutekam. Bisher war ihm keine Verschlechterung seiner Sehkraft aufgefallen, aber die Routinekontrolle war ohnehin fällig, und so nahm er sich vor, recht bald einen Termin zu vereinbaren.
Schwitzend ließ er sich hinters Steuer fallen und startete den Motor. Welch einen Segen doch die Klimaanlage darstellte. „Bereit fürs Freibad, Großer?“, fragte er über die Schulter.
Keno antwortete nicht, sondern starrte immer noch vor sich hin. Hatte er sich einen Infekt eingefangen? Er war doch sonst nicht so abwesend, war immer voll da und sprühte vor Energie. Ausgerechnet jetzt, da Titus vorübergehend den Hausmann mimte. Nicht dass ihn die ungewohnten Aufgaben überfordert hätten; Keno morgens wecken, Brote schmieren und ihn zum Kindergarten bringen – kein Problem. Ebenso wenig, ihn nachmittags abzuholen, ein bisschen zu spielen und das Abendbrot zuzubereiten. Aber ein krankes Kind zu pflegen wäre eine ganz andere Herausforderung. In dem Fall konnte er seine Pläne vergessen. Dabei wollte er unbedingt noch den Schuppen streichen, nachdem Larissas Urlaub ohnehin verschoben worden war. Titus seufzte. Er freute sich selbst auf das Schwimmbad und hatte Keno ausnahmsweise schon nach dem Mittagessen vom Kindergarten abgeholt, weil es jetzt noch nicht so voll sein würde wie später. Oder ab morgen, wenn die Sommerferien begannen.
Er wedelte mit der Rechten vor dem Gesicht des Jungen herum. „Erde an Keno, hast du Lust aufs Schwimmen?“
„Man darf nicht schwimmen, wenn man grad gegessen hat“, sagte Keno in dem altklugen Tonfall, den er sich im Verlauf des letzten halben Jahres angewöhnt hatte.
Titus grinste. Von wegen krank. Wahrscheinlich war es völlig normal für einen Vierjährigen, sich ab und zu in der eigenen Gedankenwelt zu verlieren. Daran merkt man, dass du zu wenig Zeit mit deinem Sohn verbringst, konnte er Larissa hören, ihren unterschwelligen Vorwurf, als wäre es seine Schuld, dass sie diejenige war, die sich in erster Linie um Keno kümmerte. Dafür brachte er den Löwenanteil des Einkommens nach Hause. Bisher hatte das prächtig funktioniert. Und nach dieser Woche würde sie hoffentlich zufriedengestellt sein, was seine väterlichen Pflichten betraf.
„Stimmt“, pflichtete er bei. „Aber bis wir angekommen sind, uns einen Liegeplatz gesucht und uns umgezogen haben, ist garantiert genug Zeit vergangen.“ Beim Ausparken sah er im Spiegel, wie Keno winkend die Hand hob. Sonderbar. Frau Müller, die mit Sohn und Schwiegertochter – oder waren es Tochter und Schwiegersohn? – ebenfalls im Neubaugebiet Karolinenviertel wohnte, hatte für Kinder nichts übrig und verscheuchte sie, wenn sie Lola streicheln wollten. Vielleicht war sie bloß enttäuscht, selbst keine Enkel zu haben. „Du winkst Frau Müller zu? Ich dachte, du magst sie nicht.“
Keno schüttelte heftig den Kopf. „Der doch nicht, Papa! Der anderen.“
„Aha.“ Titus, der weit und breit keine andere Frau sah, ließ es darauf beruhen, zumal er sich nun darauf konzentrieren musste, zwischen den abgestellten Fahrzeugen zu wenden. In einer Viertelstunde würden sie im Freibad sein. Während er durch die Dreißigerzone tuckerte, kam ihm ein Gedanke. „He, Großer, hast du Lust, Ich sehe was, was du nicht siehst zu spielen?“ Begeistert stimmte Keno zu. „Dann würde ich sagen“, erklärte Titus gut gelaunt, „dass jetzt ich dran bin: Was ist grün und gelb und steht an der Straße?“
3
Benjamin legte das Werkstück, an dem er gerade feilte, vor sich auf den Tisch und zog ein kariertes Baumwolltuch aus der Kitteltasche, mit dem er sich den Schweiß von der Stirn wischte. Er hatte den Sommer noch nie gemocht, aber diesen verabscheute er regelrecht. Sogar den kühlen Luftzug der Klimaanlage, der ihn für gewöhnlich störte, vermisste er inzwischen. Sie war schon seit Montag kaputt und hätte eigentlich unverzüglich instandgesetzt werden sollen. Zum dritten Mal an diesem Vormittag verließ Benjamin seinen Platz, um sich in den Toilettenräumen eine kurze Auszeit zu gönnen. Während er zwischen den Tischen, an denen seine acht Kollegen ihrer Arbeit nachgingen, hindurchschritt, fragte er sich, ob ihnen die Temperaturen genauso zu schaffen machten wie ihm. Herbert Vogts feucht glänzender Stiernacken ließ darauf schließen. Aber keiner der anderen Zahntechniker war zum Chef zitiert worden, weil er unkonzentriert arbeitete, Benjamin schon. Dabei war es nur bedingt seine Schuld, dass seine sonst so akkurate Arbeit schleppend voranging und ihm ein so unglaublich dummer Fehler unterlaufen konnte. Das Gerüst der Frontzahnbrücke war ihm während des Schleifens zerbrochen. Leider ließ Herr Veckendorf die ausgefallene Klimaanlage nicht als mildernden Umstand gelten und schien im Gegenteil zu missbilligen, dass man ihn darauf hinwies.
Im Waschraum hielt Benjamin Hände und Unterarme in den kalten Wasserstrahl, um seinen Blutkreislauf herunterzukühlen. Er war sich der Ineffizienz dieser Maßnahme bewusst – spätestens eine Viertelstunde, nachdem er seinen Platz wieder eingenommen hatte, würde ihm genauso heiß sein wie zuvor. Aber für den Moment war das Gefühl herrlich.
Auf dem Rückweg wurde sein Blick auf nahezu magische Weise von Yvonne Mai angezogen, deren Kopf sich über die Arbeitsfläche beugte. Noch immer hatte Benjamin sich nicht an ihre neue Frisur gewöhnt. Anstelle des dunkelblonden Pferdeschwanzes, mit dem er sie vor zwei Jahren, als sie im Dentallabor Veckendorf anfing, kennenlernte und der ihre hohe, Intelligenz ausstrahlende Stirn betonte, trug sie seit drei Wochen einen kastanienbraunen Bobschnitt mit Pony. Sie schaute nicht auf, als Benjamin vorbeiging. Was hatte die 32-Jährige zu der Veränderung bewogen? Zufällig hatte Benjamin vorletzte Woche Teile eines Gesprächs zwischen ihr und einer anderen Kollegin mitbekommen und herausgehört, dass sich die hübsche Ex-Blondine von ihrem Freund getrennt und bereits eine neue Wohnung gefunden hatte. Für den Umzug suchte sie dringend Helfer, und Benjamin, von der eigenen Courage überrascht, hatte sich angeboten. Gemeinsam mit Yvonnes bester Freundin und einem mit ihr befreundeten Pärchen hatten sie Yvonnes Möbel und Umzugskisten aus der alten Wohnung im schicken östlichen Stadtgebiet von Braunschweig in die nicht ganz so hippe Wohngegend in Ohlfeld befördert, wo Yvonne eine kleine Zweizimmerwohnung gemietet hatte.
Insgeheim hatte Benjamin gehofft, zum Dank auf einen Kaffee eingeladen zu werden, aber er wurde enttäuscht. Dennoch schien Yvonne ihn nicht durchweg unsympathisch zu finden, drehte sich nicht weg, wenn er versuchte, mit ihr ins Gespräch zu kommen, hatte immer einige freundliche Worte für ihn übrig. Vielleicht war sie auch bloß besonders höflich. Oder sie hatte Mitleid mit ihm, der immer am Rand des Geschehens stand, wenn sich die Kollegen in der Mittagspause oder bei Betriebsfeiern unterhielten. Sie konnte ja nicht wissen, dass ihr Bedauern fehl am Platz war, da Benjamin die Rolle des stillen Beobachters durchaus gefiel. Gespräche über Wochenendaktivitäten interessierten ihn ebenso wenig wie die Urlaubsplanungen seiner Kollegen oder was deren Sprösslinge so trieben. Und falls, was selten geschah, einmal doch etwas aufs Tapet kam, das ihn hellhörig werden ließ, mischte er sich in die Unterhaltung ein. Leider hatte meist niemand die Geduld, ihm längere Zeit zuzuhören, wenn er sich über Themen wie Energieeffizienz und neue Technologien ausließ. Vielleicht fiele die Reaktion anders aus, würde er von seiner Nebenbeschäftigung berichten – immerhin hatte er es darin sogar zu einem gewissen Grad an Bekanntheit gebracht –, aber so weit wollte er sich den Kollegen gegenüber doch nicht offenbaren.
Als der Feierabend kam und Yvonne zu ihrem Auto ging, fasste Benjamin sich ein Herz und eilte ihr nach. „Hallo, Yvonne.“
Sie warf ihm einen Seitenblick zu, ohne ihre Schritte zu verlangsamen. „Benjamin, hi.“ Auch das mochte er an ihr, dass sie ihn korrekt bei seinem Vornamen nannte. Ihm behagte weder das knappe „Ben“ noch das alberne „Bennie“, mit dem ihn hin und wieder Kollegen oder Bekannte ansprachen.
„Es ist sehr heiß heute“, sagte er zu Yvonne, als sie vor deren rotem VW-Fox standen. „Ich hoffe, die Klimaanlage wird bald repariert.“
„Stimmt.“ Sie seufzte und wühlte in ihrer Handtasche, bis sie nach einigem Kramen und Klimpern ihren Autoschlüssel zutage beförderte. Ein silbern glänzender Anhänger befand sich daran und noch mehrere weitere Schlüssel. Ob einer zu einem Fahrradschloss gehörte? Sie kam allerdings stets mit dem Auto zur Arbeit, was Benjamin, der bei nahezu jeder Wetterlage den Drahtesel nutzte, schade fand. Sportlich genug wirkte Yvonne allemal. „Wolltest du etwas Bestimmtes?“, fragte sie. „Ich würde nämlich gern in den Genuss meiner Klimaanlage kommen.“
Er hatte sich die Worte zurechtgelegt, seit mehreren Tagen schon, aber jetzt bekam er sie nicht über die Lippen. Sein Blick hing an den ärgerlichen Ponyfransen, die ihre schöne Stirn verdeckten. „Warum warst du beim Friseur?“, platzte er heraus.
Sie schaute ihn an, öffnete den Mund – und schloss ihn wieder.
Benjamin wurde immer nervöser. Schnell, er musste der offenbar unpassenden Fragestellung eine elegante Wendung geben! „Nun … Ein Kurzhaarschnitt trägt sich natürlich angenehmer bei diesen Temperaturen. Außerdem lässt er die Haare voller wirken.“
Yvonne äußerte sich auch dazu nicht. Stattdessen öffnete sie die Fahrertür und stieg ein. Der Motor brummte und Yvonne hob die Hand zum angedeuteten Gruß. Benjamin glaubte, ein Kopfschütteln zu erkennen, war sich aber nicht sicher. Während er zum Fahrradstellplatz schlenderte, überlegte er, warum das Gespräch einen so unbefriedigenden Verlauf genommen hatte. Er hatte beabsichtigt, Yvonne für kommenden Sonnabend zu einem Ausflug in den Botanischen Garten oder an den Langen See einzuladen mit Besuch eines Cafés oder einer Eisdiele zum Abschluss. Selbstverständlich war er sich im Klaren darüber gewesen, dass sie auch ablehnen konnte, aber dass er nicht einmal so weit kam, überhaupt zu fragen, damit hatte er nicht gerechnet.
Wütend hieb er mit der Faust auf den Fahrradlenker. Warum hatte er diese ungeschickte Frage nach ihrer Frisur gestellt. Vielleicht war sie selbst nicht damit zufrieden oder sie wollte über ihre Motivation nicht reden. Was jetzt? Sollte er sie anrufen, sich entschuldigen? Er besaß ihre Mobilfunknummer, die sie ihm im Vorfeld des Umzugs ausgehändigt hatte, aber er telefonierte nicht gern und würde es auf diesem Wege womöglich nur noch schlimmer machen.
Auf halbem Weg nach Hause fällte er seine Entscheidung. Morgen lag ein äußerst wichtiger Termin vor ihm, für den er sich einen Tag Urlaub genommen hatte. Viel hing von dessen Verlauf ab, nicht nur für ihn. Aber am Freitag würde er Yvonne bitten, sich mit ihm zu treffen, direkt und ohne Umschweife. Sie war die einzige Person, von der er sich vorstellen konnte, ihr Zutritt in sein Leben zu gewähren.
4
Angenehm kühl sprenkelte das Wasser über Titusʼ Füße, bevor es in der durstigen Erde versickerte. Die Installation eines Bewässerungssystems für die Beete hatte sich als wahrhaft vorausschauende, zeitsparende Entscheidung herausgestellt. Allein die Rasenfläche musste er noch von Hand sprengen, andernfalls würde vom edlen Rollrasen nur ein verbrannter Filzteppich übrig bleiben. Was er in diesem Sommer schon in den Garten ihrer neu gebauten Stadtvilla gepumpt hatte, darüber dachte Titus lieber nicht nach. Die Zisterne für das Regenwasser war seit Monaten leer. Also Leitungswasser. Die Nachberechnung würde saftig ausfallen, aber das musste man für ein gepflegtes Grün in Kauf nehmen. Zumindest, solange nicht das Trinkwasser rationiert wurde wie in einigen Landkreisen im Norden. Hier in Braunschweig bezogen sie das Wasser aus den Harzer Talsperren, das würde noch eine Weile reichen. Und irgendwann musste es schließlich regnen. Titus blickte zum wolkenlosen Himmel auf und verzog das Gesicht. Dass er sich im Juni Regentage wünschte, damit hätte er noch vor einigen Wochen nicht gerechnet.
Für Keno hingegen war alles großartig. Fast den ganzen Tag spielte er draußen – eingecremt und mit Sonnenhut –, und jeder Abend hielt eine herrliche Dusche im Freien bereit. Er flitzte hin und her, wich dem Wasserstrahl aus oder sprang mitten hinein. Mehrfach rutschte er auf dem nassen Gras aus, was seine Begeisterung noch steigerte. Titus betrachtete seinen Sprössling mit ebensolchem Stolz wie das satte, von nur ganz wenigen gelben Stellen befleckte Grün, das die nackten kleinen Füße malträtierten.
„Hast du allmählich genug?“ Die Antwort des Jungen bestand darin, lachend davonzurennen. Titus sah ihm lächelnd nach, als er eine Hand auf seinem Rücken spürte.
Larissa legte die Arme um ihn. „Es ist spät. Ich bringe Keno ins Bett.“
„Wenn du ihn vom Wasser wegbekommst.“ Titus drehte sich zu ihr um und gab ihr einen Kuss. „Man sollte meinen, nach all der Planscherei im Schwimmbad wäre er allmählich müde.“
„Ist doch immer so“, entgegnete Larissa. „Keno! Zeit, die Zähne zu putzen, komm bitte!“
„Noch ein bisschen!“
„Das hattest du schon. Du kannst morgen weiterspielen.“ Larissas Stimme duldete keinen Widerspruch, und tatsächlich trottete Keno, wenn auch Grimassen schneidend, zu ihr.
Titus fand, seine eigenen Ansagen klangen nicht weniger entschieden, dennoch reagierte Keno auf sie oft störrisch. Sicher nicht ungewöhnlich, wenn ansonsten die Mutter das Kind umsorgte, dennoch gab es ihm einen kleinen Stich, seine Autorität so infrage gestellt zu sehen. Larissa rubbelte Keno mit dem Badetuch ab, dann schob sie ihn durch die Terrassentür ins Wohnzimmer. „He, Großer“, rief Titus ihm nach. „Ich komme gleich noch zum Gutenachtsagen.“ Seine kurz getrübte Stimmung hob sich wieder. Er hatte es wirklich gut getroffen. Wenn sie nachher mit einem Glas Wein in den neuen, extrabequemen Lounge-Sesseln säßen, würde es noch besser werden. Larissas gute Laune verhieß einen angenehmen Abend. Es schien ihr zu gefallen, dass momentan sie diejenige war, auf die man sehnsüchtig wartete, für die gekocht und die abends mit Begeisterung empfangen wurde. Titus betrachtete ihren Rollentausch eher als interessante Erfahrung. Er freute sich auf ihren gemeinsamen Urlaub, der Samstag endlich begann, und darauf, einen Großteil der Verantwortung für Kind und Haushalt wieder in Larissas geübte Hände zurückzulegen.
„Warst du heute in der Praxis?“
Die Frage traf Titus unvorbereitet, als er nach dem Gute-Nacht-Ritual auf die Terrasse trat. Er ließ sich nichts anmerken. „Ich musste noch die Quartalsabrechnung erledigen.“
Larissa blätterte weiter in dem Reiseprospekt auf ihrem Schoß. Ihre zur Schau gestellte Gleichgültigkeit alarmierte ihn. „Aurelia hat nämlich deinen Wagen auf dem Parkplatz gesehen. Ich dachte, für die Abrechnung ist Frau Langenfeld verantwortlich.“
„Stimmt schon“, entgegnete er. „Aber ich bin verpflichtet, wenigstens einen Blick darauf zu werfen.“ Sie schlug weiter die Seiten um. Er fühlte Ärger in sich aufsteigen, der mit seinem schlechten Gewissen konkurrierte. Dieses ewige Misstrauen! „Ich hole uns ein Glas Wein, er müsste jetzt die richtige Temperatur haben.“
Larissa brummte etwas, das Zustimmung sein mochte oder Missbilligung. Wie dem auch sei, er wollte den Riesling probieren, den er vorhin in den Kühlschrank gestellt hatte, also beeilte er sich, in die Küche zu kommen – auch um zu überlegen, wie er Larissa besänftigen könnte. Am Ende wäre die Wahrheit doch das Beste? Nein, das würde Fragen und endlose Vorhaltungen nach sich ziehen. Was zu Variante B führte, ihr die Wahrheit weiterhin zu verschweigen, auf der eben ausgesprochenen Erklärung zu beharren und diese mit Details zu unterfüttern, die ihre Glaubhaftigkeit erhöhten. Freilich mit dem Risiko, Larissa könnte dennoch etwas anderes argwöhnen – und dieser spezielle Verdacht wäre zweifellos belastender für ihre Ehe als der Vorwurf, mit seinem Tun am heutigen Vormittag ein altes Versprechen gebrochen zu haben. Trotzdem … Solange die Chance bestand, sie zu überzeugen, sollte er nicht vorschnell beichten. Das war keine Feigheit, er nahm Rücksicht auf die Gefühle seiner Frau so wie jeder anständige Ehemann. Und wenn sie bei Marla Langenfeld nachfragte? Nun, dann hatte die sich eben im Datum geirrt.
Als er sich mit den gefüllten Gläsern durch den Insektenschutzvorhang schob, legte Larissa den Katalog beiseite und blickte Titus entgegen. Noch immer flackerte das Misstrauen in ihren Augen. Wortlos nahm sie ihr Glas entgegen und betrachtete so konzentriert den Inhalt, dass Titus sich fragte, ob ein Stück Kork oder ein Insekt hineingeraten wäre. Als er sich eben erkundigen wollte, brach Larissa das Schweigen: „Und, bist du wenigstens fertig geworden mit deinen Rechnungen?“
Stellte sie ihn auf die Probe oder wollte sie mit ihrer Frage das Thema zu einem versöhnlichen Abschluss bringen? Manchmal wurde er nicht schlau aus ihr, auch nach zwölf Jahren Ehe nicht. „Bin ich.“ Er setzte sich ihr gegenüber auf seinen Platz. „Obwohl ich einen Teil von Frau Langenfelds Arbeit miterledigen musste – das, was letzte Woche nicht mehr rausging. Sie hat sich nämlich kurz vor ihrem Urlaub krankgemeldet. Karpaltunnelsyndrom. Wenn ich Pech habe, fällt sie länger aus.“
Jetzt nickte Larissa und ihr Blick bekam etwas Mitfühlendes. Sicher erinnerte sie sich daran, wie unangenehm Schmerzen im Handgelenk sein konnten, und bei ihr war es nur eine Sehnenscheidenentzündung gewesen. Deutlich forscher sprach Titus weiter. „Schlussendlich bin ich derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass alles seine Richtigkeit hat. Also denk bitte nicht jedes Mal, ich würde dich belügen, nur weil ich dir nicht sofort Meldung erstatte.“ Er schob seine Hand über den Tisch.
Sie machte keinen Rückzieher, als sich ihre Finger berührten. „Du weißt, das hast du dir selbst zuzuschreiben.“
„Ich weiß. Und es tut mir unendlich leid – das weißt du. Du sagst, du hast mir verziehen. Stimmt das wirklich?“ Er sah sie eindringlich an. „Sag mir, was ich tun muss, um dein Vertrauen zurückzugewinnen.“
Das Eis in ihrem Blick schmolz. „Ist schon gut“, sagte sie leise. „Du hast nichts falsch gemacht … Doch, schon, aber das ist lange her. Weißt, du, Aurelia hat so eine Art, Dinge mitzuteilen …“
„Aurelia ist sicher eine gute Freundin, aber sie dramatisiert in der Tat gern“, sagte er und streichelte ihre Hand, die sich zu kühl anfühlte für die immer noch siebenundzwanzig Grad, die das Außenthermometer anzeigte. Er hob sie an seine Lippen und hauchte einen Kuss darauf. „Schluss mit den trüben Gedanken, lass uns den schönen Abend genießen.“
„Du hast recht“, seufzte sie. „Manchmal bin ich wohl etwas überempfindlich.“
Sie redeten über den Urlaub nächste Woche und steigerten so ihre Vorfreude darauf. Allmählich verebbte das Gespräch, die Schönheit des Sommerabends nahm sie beide gefangen. Ein Zauber schien in der Luft zu liegen. Es duftete nach den Blüten der zwei Rosenstöcke, die Larissa gepflanzt hatte, eine rote Sorte und eine weiße, ihr ganzer Stolz. Die Auswahl der Umrandung, die verhindern sollte, dass Keno sich an den Dornen verletzte, war weniger gut getroffen gewesen; schon im zweiten Jahr fiel der Buchsbaum einem Schädling zum Opfer und musste durch einen kleinen Zaun ersetzt werden.
Dämmerung senkte sich über den Garten und verhüllte die Blüten der dunkleren Rose, die der weißen leuchteten umso prächtiger. Titus wandte den Kopf, um den Flug eines dunklen Punktes zu verfolgen, der die Dolden des Schmetterlingsflieders neben der Terrasse anvisierte. Nach und nach gesellten sich immer mehr etwas über hummelgroße Punkte hinzu. Der taumelnde Flug erinnerte an das Schwirren von Kolibris.
„Sind das Nachtfalter?“ Larissa erhob sich und ging hinüber. Sie sah hinreißend aus in ihrem bauchfreien Top und den Shorts. Titus war stolz darauf, dass sie ihre Figur nach Schwangerschaft und Geburt so schnell wiedererlangt hatte. Seine acht Jahre jüngere Frau war noch genauso ein Hingucker wie damals, als sie sich kennenlernten.
„Das sind ja Käfer!“, stellte Larissa fest. „Sie sehen aus wie kleine Maikäfer, nur heller.“ Nachdem sie die Insekten eine Weile beobachtet hatte, kehrte sie zurück zu Titus, der keine Lust gehabt hatte aufzustehen, und deutete auf sein Smartphone. Wie immer hatte sie ihres irgendwo im Haus abgelegt. „Schau mal nach, was das für welche sind.“ Gehorsam machte er sich an die digitale Suche, während Larissa sich neben ihn setzte und ihr Weinglas über den Tisch zu sich heranzog.
„Aha!“, triumphierte er nach wenigen Klicks. „Da haben wir es. Gerippter Brachkäfer. Mit dem Maikäfer verwandt und allgemein auch als Torkel- oder Junikäfer bekannt. – Na, noch haben wir Juni.“ Er las den Artikel still bis zum Ende, dann legte er das Smartphone beiseite und betrachtete nachdenklich die schwärmenden Insekten. „Wenn sie in so großer Zahl schlüpfen wie in diesem Jahr, können sie zur Plage werden, weil sie junge Blätter fressen. Sie schwärmen, paaren sich und sterben. Die Larven verbleiben zwei Jahre im Boden und knabbern bevorzugt an Graswurzeln.“ Mit gerunzelter Stirn ließ er den Blick über die sauber umrandete Grünfläche mit den im Dämmerlicht unsichtbaren vergilbten Flecken schweifen. „Kein Wunder, dass der Rasen an manchen Stellen so mickrig ist. Wenn die Wurzeln kaputt sind, hilft alles Wässern nichts.“
Larissa legte die Hand auf seinen Arm. „Das Gras erholt sich schon wieder. Ich finde das traurig. Die Käfer warten Jahre in der dunklen Erde und wenn sie endlich schlüpfen, leben sie nur, um Hochzeit zu feiern, und gehen anschließend zugrunde.“
„Die Weibchen leben etwas länger, weil sie erst noch Eier legen“, ergänzte Titus. „Frauen haben es eben überall besser, selbst bei den Insekten.“
Larissa boxte ihn auf den Oberarm. „Das glaubst du doch selbst nicht.“
Er bekam ihre Hand zu fassen und drückte sie. „Nicht mehr, seit ich bei Kenos Geburt dabei war.“ Einer der Käfer prallte gegen Titus’ Brillenglas. Mit einem weiteren Klack fiel er auf den Tisch und blieb reglos liegen. Titus stupste ihn mit dem Finger an, aber er war tot. „Kamikaze-Käfer wäre ebenfalls eine passende Bezeichnung.“ Er hob den Körper auf und warf ihn ins benachbarte Beet. Dann sah er seine Frau an. „Wie gut, dass wir nicht sterben, sobald unser biologischer Auftrag erfüllt ist. Und statt eines flüchtigen Akts im Vorbeiflug haben wir jede Menge Zeit dafür.“
Larissa kicherte. Er beugte sich zu ihr und drückte seine Lippen auf die Mulde über ihrem rechten Schlüsselbein. Ihr Parfüm fiel ihm auf. Das neue, das er ihr erst kürzlich geschenkt hatte, ein würziger, sinnlicher Duft. Sie musste es aufgelegt haben, nachdem sie Keno ins Bett gebracht hatte. Ihre Hand hatte ihre Kühle verloren, als sie seinen Nacken streichelte. „Lass uns reingehen.“
Dagegen gab es nichts einzuwenden, und so kehrten sie der Gartenidylle den Rücken und überließen die Junikäfer ihrem so bedeutungsvollen wie vergänglichen Treiben.
5
Der Anruf überraschte Titus bei der Gartenarbeit. Weil zur selben Zeit die Glocke der Eliaskirche ihr Mittagsgeläut anstimmte, überhörte er beinahe das Telefon, das in der Tasche seiner über den Zaun gehängten Arbeitsjacke steckte. Der Kindergarten war dran, Keno habe sich übergeben und Herr Dr. Volkmer solle seinen Filius umgehend abholen. Titus wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn und betrachtete die erst halb abgeernteten Himbeersträucher. Immerhin hatte er eine ausreichende Menge zusammengepflückt, einen Kuchen zu belegen, aber um auch Marmelade zu kochen, wie von Larissa geplant, würde es nicht reichen.
Titus eilte ums Haus und stellte die Schüssel mit seiner Ausbeute in eine schattige Ecke des Carports, danach schaufelte er das Sandspielzeug aus dem Buggy und schob diesen am Auto vorbei. Bis zur Kita Eckberg waren es nur zehn Minuten Fußweg, und unter den gegebenen Umständen erschien ihm der Kinderwagen als das geeignetere Transportmittel. Zum Glück hatten sie ihn noch nicht weggegeben, obwohl Keno mit seinen vier Jahren schon etwas zu groß dafür war. Titus zog das Gefährt auf den Gehweg, rückte seine Sonnenbrille in Sehstärke zurecht und steuerte eiligen Schritts den nahegelegenen Feldweg an.
Im gleißenden Sonnenlicht glich das Feld einem Backofen, über dem die Luft flimmerte. Eine Brise fuhr über die offene Landschaft, aber sie war trocken und heiß wie Wüstenwind und brachte keine Erleichterung. Winzige Staubkörnchen prickelten auf Titus’ Armen und Gesicht. Das Zirpen der Grillen verschmolz für Sekunden mit dem Summen der Hochspannungsleitungen, deren Trasse den Weg kreuzte, über dessen Schotterbett der leichte Buggy hüpfte. Hundert Meter voraus unterbrachen die Gleise der erst in jüngster Zeit verlängerten Straßenbahnlinie 4 den Weg, weitere hundert Meter dahinter begann schon Eckberg.
In einigem Abstand, parallel zu Titus, lief ein Fußgänger. Jemand, der querfeldein seinen Vierbeiner Gassi führte? Unwillkürlich ging Titus langsamer und bemühte sich zu erkennen, wer das war. Eine Frau, hochgewachsen, schlank – und offenbar ohne Hund unterwegs, was ihren Abstecher ins Weizenfeld noch kurioser erscheinen ließ. Sie trug ein fließendes weißes Kleid, so lang, dass es mit den Ähren zu verschmelzen schien. Blondes Haar fiel ihr wie ein Schleier über die Schultern. Sie glitt förmlich durch das Getreide, und Titus wurde klar, dass diese gleichmäßige Bewegung seine Aufmerksamkeit zuerst gefesselt hatte. Anscheinend bemerkte die Frau, dass sie beobachtet wurde, denn sie blieb stehen und blickte zu ihm herüber. Die Distanz war zu groß, um in dem hellen Oval Gesichtszüge auszumachen, dennoch war sich Titus nahezu sicher, sie noch nie in der Siedlung gesehen zu haben. So eine wäre ihm aufgefallen. Die Frau im Hippiegewand wandte sich ab und entfernte sich im rechten Winkel vom Feldweg. Titus widerstand der Versuchung, ihr hinterherzuschauen, bis sie verschwunden war, schließlich hatte er es eilig. Dessen ungeachtet musste er sich nun zum raschen Ausschreiten zwingen. Ihm war ein wenig schwindlig, vielleicht weil er während der Gartenarbeit Essen und Trinken vergessen hatte.
Zwanzig Minuten später befand er sich mit Keno auf dem Heimweg.
„Papa, ich will laufen!“ Kaum dass er es ausgesprochen hatte, rutschte Keno schon aus dem Sitz des Buggys und rannte voraus.
Titus ließ ihn gewähren. Eigentlich hätte Keno auch im Kindergarten bleiben können, so rasant wie er sich erholt hatte. Aber wozu mit Frau Mahlmann diskutieren, und außerdem: Sicher war sicher. Das Handy klingelte. „Mach langsam, Großer! Stopp vor den Schienen!“
„Ja, Papa.“ Keno wusste, dass er ohne Mama oder Papa das Rasengleis keinesfalls überqueren durfte, und er hielt sich daran. Er war ein vernünftiger Junge.
Titus schaute auf das Display: Stefan Schulze, seine Urlaubsvertretung.
„Schönen guten Tag, werter Kollege“, meldete sich Stefan in gewohnt gut gelaunter Weise. „Tut mir leid, dich in deinem wohlverdienten Urlaub zu stören, aber da ich wusste, dass du diese Woche zu Hause bist, dachte ich …“
„Kein Problem“, unterbrach Titus ihn. „Was gibt es denn?“
„Ein Herr Schellberger war vorhin hier. Etwas stimme mit seiner neuen Krone nicht. Konkreteres war ihm nicht zu entlocken.“ Stefan seufzte. „Er will niemandem sonst in seinen Mund schauen lassen, nur dich, den gut bezahlten Zahnarzt seines Vertrauens. Seine Worte.“
Bei Nennung des Namens „Schellberger“ klingelten bei Titus die Alarmglocken. Ein Privatpatient, seines Zeichens ehemaliger Generalmajor der Bundeswehr und aufgrund seiner Zahnarztphobie ein heikler Fall, der in jeder Hinsicht ein Höchstmaß an Fingerspitzengefühl erforderte. Mit viel Überzeugungsarbeit und noch mehr Zeitaufwand war es Titus gelungen, ihn in seinen Stuhl zu bekommen und auch darin zu halten, für bislang sechs Sitzungen, in denen er das verfallende Zahngebäude des Herrn Schellbergers nach und nach in vorzeigbaren Zustand versetzte. Wenn sich der Patient nun notgedrungen in die Hände eines Kollegen begab, würde das – sollte irgendetwas nicht exakt so laufen, wie Herr Schellenberger es von „seinem“ Zahnarzt gewohnt war – den mühsam erkämpften Erfolg zunichtemachen. Zwar hatte Titus absolutes Vertrauen in Stefans fachliche Kompetenz, aber er wusste auch, wie überlastet er und sein Praxisteam waren, weil sie die Patienten zweier im Urlaub befindlicher Kollegen mitversorgen mussten. Und natürlich wollte er Herrn Schellberger nicht als Patienten verlieren. Aber genau das könnte geschehen, käme dieser zu dem Schluss, Herrn Dr. Volkmer sei ein Behandlungsfehler unterlaufen, weil ihm die neu eingesetzte Krone Ungemach bereitete.
„Ja, er ist ein nicht ganz einfacher Patient“, sagte Titus. „Ich rufe ihn an, sobald ich zu Hause bin.“
„Deine Frau wird nicht begeistert sein, solltest du die Praxis ausnahmsweise öffnen.“
Nein, begeistert reagieren würde Larissa gewiss nicht, wenn sie gegen viertel vor sieben aus dem Büro nach Hause kam und er ihr, statt eines Aperitifs, Keno in die Hand drückte. Der Babysitter war für halb acht bestellt, damit sie mal wieder gemeinsam essen gehen konnten, anschließend wollten sie ins Kino. Zumindest das Essen müsste ausfallen, und Larissa wäre mit Sicherheit so sauer, dass auch der Kinobesuch auf der Kippe stünde. Blieb nur, Herrn Schellberger auf morgen zu vertrösten im Vertrauen darauf, dass Keno keinen Rückfall erlitt. Es würde mit Sicherheit kein leichtes Telefonat werden, aber auch ein Generalmajor a. D. Schellberger konnte nicht erwarten, dass Titus sofort Gewehr bei Fuß stand, wenn er pfiff.
Keno hatte in sicherer Entfernung zu den Gleisen angehalten und widmete sich der Aufgabe, Blätter von einem am Wegesrand wachsenden Strauch abzureißen, während er auf Titus wartete. Ein Staubkorn oder kleines Insekt landete trotz Sonnenbrille in dessen rechtem Auge. Das Telefon ans Ohr gepresst, kramte Titus in der Kinderwagentasche nach Papiertüchern, beförderte jedoch nur einige gemalte Kunstwerke Kenos, Puzzleteile, eine fast leere Kekspackung sowie zwei stumpfe Buntstifte ans Licht. Am Boden der Tasche stieß er endlich auf ein loses, aber immerhin unbenutztes Taschentuch und versuchte mit dessen Hilfe, das Objekt aus dem tränenden Auge zu fischen.
„Papa!“
„Gleich“, rief er zurück. Keno war ein Stück ins Feld gelaufen. Das machte nichts, solange er auf dieser Seite der Schienen blieb, in dem heuer nur mickrig gewachsenen Weizen würde er nicht gleich verloren gehen. Stefan erzählte von einer geplanten Fortbildung.
„Papa?“ Etwas in Kenos Stimme ließ Titus das Telefongespräch vergessen. Er blickte auf, immer noch blinzelnd, und rückte die hochgeschobene Brille an ihren Platz. Diesmal dauerte es eine Weile, bis er seinen Sohn entdeckte. Ein beträchtliches Stück vom Weg entfernt ragten Schultern und sein blonder Schopf aus dem Getreide. Keno hüpfte auf und ab. Jetzt hob er die Hand und wies auf den nächsten der in regelmäßigen Abständen gepflanzten Hochspannungsmasten jenseits der Straßenbahnschienen. „Papa!“
„Titus? Bist du noch da?“
Titus antwortete nicht. Sein Sehvermögen hatte sich so weit geklärt, dass er erkannte, was Kenos Aufregung verursachte: Junikäfer. Ein Schwarm von beeindruckenden Ausmaßen, bestimmt doppelt so groß wie der gestern im Garten gesichtete. Was hatte der Artikel behauptet? Die Käfer flögen nur in den Abend- und Nachtstunden? Nun, diese hier waren auch mitten am Tag hellwach. Auch schwirrten sie nicht ziellos umher, sondern bildeten so etwas wie einen Formationsflug, einen nahezu perfekten Kreis. Ein faszinierendes Naturschauspiel, wert, ein Foto davon zu machen. „Bin gleich bei dir, Großer, warte!“, rief er hinüber zu seinem Sohn, der zum Glück gehorsam stehen geblieben war.
Ohne den Blick von Keno und den Käfern zu wenden, murmelte Titus eine Entschuldigung in sein Smartphone und verabschiedete sich von Stefan. In dem kurzen Moment, den er brauchte, um die Kamerafunktion zu aktivieren, löste sich zu seinem Bedauern der Zusammenhang der Käferwolke auf und die Tiere stoben in alle Himmelsrichtungen davon, als habe sie jemand aufgescheucht. Keno? Aber der befand sich noch immer am selben Platz und winkte ihnen zum Abschied nach.
Aber nein, das Winken galt einer Person. Jemand stand auf der anderen Seite des Gleisbetts. Der Schwarm musste sie bis eben verdeckt haben – die große, dünne Frau von vorhin, deren flachsblonde Strähnen und weißes Kleid im gleißenden Sonnenlicht ineinanderflossen. Auf dem Kopf trug sie eine Art Kranz. Unvermittelt fiel Titus die Wink-Szene von gestern ein, die für ihn unsichtbare Frau, und aus irgendeinem Grund fühlte er sich beunruhigt.
„Keno! Komm jetzt her!“
Keno hörte ihn nicht. Er stapfte durch das Getreide in Richtung der Frau und damit geradewegs auf die nahen Gleise zu.
„Bleib stehen, Keno!“ Titus stopfte das Smartphone in die Hemdtasche und rannte am Rand des Rasengleises entlang, um Keno den Weg abzuschneiden. Aber der Junge war schneller. Ohne sich umzusehen oder auf Titus’ Rufe zu reagieren, lief er auf die Schienen. Die Frau gegenüber streckte ihm ihre Hände entgegen. „Keno!“ Seine Stimme bebte vor Angst um Keno und Zorn auf die Frau und ihr verantwortungsloses Verhalten.
Diesmal hörte Keno ihn und drehte sich um. Im selben Moment durchschnitt das Klingeln der nahenden Tram die Luft. Erschrocken schlug Keno die Hände vor den Mund, als ihm klar wurde, in welcher Gefahr er schwebte. Aber statt vor- oder zurückzulaufen, blieb er wie erstarrt stehen. Da überwand die Frau mit einer schnellen, gleitenden Bewegung den Abstand zu Keno und ergriff ihn. Ebenso rasch und geschmeidig machte sie kehrt und zog ihn mit sich.
Als sie das jenseitige Feld erreichte, blieb sie stehen und wandte sich um. Titus prallte zurück. Intuitiv hatte er eine junge Frau erwartet, nun erkannte er seinen Irrtum. Ein vertrockneter Kranz aus geflochtenen Ähren, darunter ein hageres Gesicht, durchzogen von tiefen Furchen. Fahle Haut, aus der ihn schwarze Augen anblickten, die wie im Schnee liegende Kiesel wirkten. Ein Schauder überlief Titus angesichts der Leere darin. Wie die Augen von Stofftieren. All diese Teddys, Hündchen und Häschen – trotz ihrer geballten Niedlichkeit konnte er sie nicht leiden, sie erinnerten ihn an etwas, dessen er sich nicht erinnern wollte. Ein Kälteschauer kroch über seine nackten Arme und rieselte den Rücken hinab. Für einen Moment war ihm, als könnte er durch den Körper der Alten das dahinterliegende Weizenfeld sehen. Abrupt kehrte sie ihm den Rücken zu und entfernte sich. Kenos bleiches Gesicht lugte über ihre Schulter, sein Mund aufgerissen zu einem lautlosen Schrei.
Schrilles Klingeln und das Kreischen von Bremsen brachen den Bann. Mit einem Satz nach hinten brachte Titus sich in Sicherheit vor der aus Richtung Eckberger Wendeschleife kommenden Bahn.
Am Rande seines Bewusstseins bemerkte er, dass der Fahrer eine wütende Geste in seine Richtung machte. Die wenigen Sekunden, die die Tram brauchte, um an ihm vorbeizufahren, dehnten sich zu einer kleinen Ewigkeit. Als diese endete, war das Feld gegenüber verlassen, keine Spur von der Frau und Keno. Titus drehte sich in alle Richtungen, bis ihm schwarz vor Augen wurde.
Gegen Benommenheit und Schwindel ankämpfend, rappelte er sich zwischen zerknickten Stängeln hoch und griff nach seiner Brille, die neben ihm lag. Er mühte sich auf die Beine und suchte den noch immer leeren Horizont ab. Wie lange hatte seine Bewusstlosigkeit gedauert? Seine Hände zitterten, als er auf die Uhr schaute. Zum Zeitpunkt von Stefans Anruf war es genau halb eins gewesen. Sie hatten eine Weile miteinander gesprochen, dann war er Keno hinterhergerannt. Jetzt zeigte die Uhr zwölf Minuten vor eins, weit konnten die Frau und sein Sohn also nicht gekommen sein. Eilig, wenn auch noch immer etwas unsicher, schritt er über die Schienen zu der Stelle, wo er sie zum letzten Mal gesehen hatte. Niedergedrückte Getreidehalme, die ihren Fluchtweg markiert hätten, fand er nicht, aber vermutlich war sie zum Feldweg gelaufen. Etwas daran kam ihm seltsam vor, aber er konnte nicht klar denken. Sein Kopf schmerzte und das Licht blendete ihn, als litte er unter einem furchtbaren Kater.
Er griff zum Smartphone und wählte die 110. „Mein Sohn ist entführt worden.“ Er merkte, dass er schrie. Es gelang ihm, seine Stimme einigermaßen unter Kontrolle zu bringen und die Fakten herunterzurattern, dann beendete er das Gespräch. Ohne auf das Eintreffen des Streifenwagens zu warten, rannte er, einem Impuls folgend, in die Richtung, in die er mit Keno unterwegs gewesen war, in der schwachen und verzweifelten Hoffnung, richtig zu liegen und die Entführerin und seinen Sohn doch noch einzuholen.
6
„Hm?“ Ludger Claaßen hatte den Worten seines Kollegen nur mit halbem Ohr zugehört. Er war damit beschäftigt, den unaufhörlichen Strom der Fahrzeuge zu verfolgen, die in einigen Metern Entfernung vorbeirauschten. Metall und glänzende Lackierungen reflektierten das Sonnenlicht. Die gelb markierten Fahrspuren im Baustellenbereich waren schmal, dennoch überschritten viele die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Eben bretterte ein 3er-Hassan-Porsche mit bestimmt 90 Sachen vorbei. Claaßen grunzte und runzelte die Stirn, was den Schweißperlen, die sich darauf gesammelt hatten, einen Weg eröffnete, über die Zornesfalten in seine Augen zu rinnen. Die Hitze, diese verdammte Hitze war schuld, dass alle durchdrehten, noch mehr als sonst. Obwohl ein Großteil der Fahrzeuge mit Klimaanlage ausgestattet sein dürfte. Höchste Zeit, dass es sich ein bisschen abkühlte, und zwar möglichst bald, nicht erst, wenn die Uhren auf Winterzeit umgestellt wurden. Falls die bis dahin nicht abgeschafft war, wogegen er nichts einzuwenden hätte. Zum jetzigen Zeitpunkt deutete allerdings nichts auf ein baldiges Ende des Extremsommers hin.
Er blickte zu seinem Nebenmann. Hatte er den Polen eben richtig verstanden? Claaßen genehmigte sich einen weiteren Schluck aus der Wasserflasche, bevor er nachfragte: „Was setzen die ein?“
„Einen Elfenbeauftragten“, verkündete Lobowski, laut genug, um gegen das an- und abschwellende Verkehrsrauschen anzukommen, und leise genug, es die anderen, die ein Stück entfernt im Schatten der Laderaupe standen, nicht hören zu lassen. Seine Aussprache war undeutlich, weil er den Mund voll hatte. Irgendwas mit Salami, scharfe, knofihaltige Polen-Salami, tippte Claaßen. Vielleicht auch ungarisch, das konnte man nicht so genau wissen. Inzwischen hatte Lobowski den Bissen hinuntergewürgt, und in Kombination mit seiner bierernsten Miene gab es keinen Zweifel, dass er das Gesagte genauso meinte und Claaßen nicht bloß verarschte.
Claaßen schwenkte die verbliebene Flüssigkeit in der Flasche. Zwei hatte er noch im Kühlrucksack, das sollte hoffentlich reichen, wenn er bis vier malochte. „Und was soll das sein?“ Sich über den Mund wischend, unterdrückte er halbherzig einen Rülpser.
Lobowski stopfte den Rest seiner Stulle in den Mund, leckte sich die Finger und griff nach seiner Thermoskanne. Warmer Tee, verrückt. Seelenruhig schenkte er sich ein. „Nicht gehört? Straßenbaubehörde Hannover schickt jemanden, der mit den Wila, den Elfen, Kontakt aufnimmt. Wegen der vielen Unfälle.“
„Schwachsinn.“ Claaßen verzog den Mund zu einem Grinsen und trank den Rest der anderthalb Liter. Ein Vakuum entstand, das dünne Plastik knackte in seiner Hand. Er warf die leere Flasche in den Rucksack und angelte das Handtuch heraus, um sich den Schädel zu trocknen. Das kühle Frottee verursachte eine leichte Gänsehaut auf dem schütter bewachsenen Haupt. „Scheißhitze“, wiederholte er laut das zuvor Gedachte. „Drehen alle am Rad.“
Lobowski schlürfte seinen Tee. Dampfte das Zeug etwa? „Wenn übliche Methoden nichts bringen, ist es nicht verkehrt, ungewöhnliche Wege zu beschreiten.“
„Klar, solange es auf Kosten des Steuerzahlers geht.“ Claaßen winkte Ron heran, der eben ein längeres Gespräch mit Bauleiter Hagedorn beendet hatte. Der Junge konnte sie gleich mal aufklären, was als Nächstes anstand. Gern wäre Claaßen noch ein Weilchen sitzen geblieben. Hier an der Böschung ließ es sich aushalten. Die letzten Überbleibsel des Wassers, das der Sprengwagen vor einer Stunde gegen den mörderischen Staub versprüht hatte, stiegen in Form von Verdunstungskühle vom Boden auf. Schon schlurfte Ron zu ihnen herüber. Stöhnend ließ er sich auf den Ersatz-Tieflöffel fallen. Herrje, Bürschchen, komm erst mal in mein Alter, lag es Claaßen auf der Zunge.
„Dauert noch.“ Der junge Kollege nahm den Helm ab und fuhr sich mit den Fingern durch den Stoppelhaarschnitt. Er zögerte kurz, dann schob er die Hand in die Tasche der Sicherheitsweste. Als er eine Lucky aus der hervorgezogenen Packung schüttete und ansteckte, rümpfte Claaßen die Nase. Vor drei Jahren hatte er sich das Rauchen abgewöhnt, auf dringendes Anraten seines Hausarztes. Nichtraucher sind die Schlimmsten, hieß es. Das traf wohl zu; am liebsten hätte er – auch nach diesem nicht ganz unerheblichen Zeitraum – jedem, der sich in seiner Nähe eine Kippe anzündete, eine verpasst. Besonders jetzt, wo Hitze und stehende Luft den Gestank nach Abgasen, Asphalt und Rauch schier unerträglich machten. Teufel auch, ein buddhistischer Mönch hätte unter diesen Bedingungen zu einem gewissen Maß an Aggressivität geneigt.
Die Vorstellung eines fetten, grinsenden Buddhas mit Kippe im Mundwinkel half Claaßen, heiter und gelassen auf die unbeabsichtigte Provokation zu reagieren. Man musste die Dinge mit Humor nehmen. Die soeben verkündete Neuigkeit des Polen besaß ohne Frage Unterhaltungswert. „Die von der Baubehörde haben jetzt einen Elfenflüsterer eingestellt“, teilte er Ron mit.
Zu Claaßens Enttäuschung blieb der Knalleffekt aus. „Ich weiß. Heißt übrigens Elfenbeauftragter. Auf Island ist das die amtliche Bezeichnung.“
Noch so ein Experte. Hatten die zwei Wikipedia gefrühstückt? „Mag ja sein, aber wir sind hier in Deutschland. Ich glaube nicht, dass das bei uns ein zugelassener Beruf ist. Demzufolge kann es auch keine offizielle Bezeichnung geben.“ Claaßen, der seine Wortschöpfung ziemlich originell fand, schmollte.
„Wie auch immer. Ich halte das Ganze sowieso für einen Witz.“ Ron zuckte mit den schmächtigen Schultern.
Lobowski schaltete sich ein. „Für euch ist alles Blödsinn. Ihr habt nie nachgedacht, was Unfälle verursacht?“
„Doch, sicher“, sagte Claaßen. „Überhöhte Geschwindigkeit, übermüdete Fahrer. Dazu diejenigen, die während der Fahrt am Handy rumspielen oder an sich selbst.“
Ron lachte. „Stimmt. Aber, selbst wenn was Wahres dran ist – bei dem Wetter haben die Elfen bestimmt keinen Bock, auf der A2 herumzurennen. Die sind alle zum Schwimmen im Baggersee.“
Claaßen stellte sich Elfen beim Baden im Lehrter See vor, mit Badekappen, unter denen spitze Ohren hervorlugten, was ihn wider Willen amüsierte.
Dadurch ermuntert hob Ron die Arme zu einer beschwörenden Geste. Mit hohler Stimme verkündete er: „Es sind die Toten, sie dulden nicht, dass die Lebenden hier gehen.“ Vermutlich mal wieder eins seiner Herr-der-Ringe-Zitate. Als Fantasy-Fan hätte Ron eigentlich begeistert sein müssen von der Elfensache, aber ganz so versponnen war er offenbar doch nicht. Aus irgendeinem Grund stieß das Claaßen sauer auf, weshalb er den Jungspund stirnrunzelnd zurechtwies: „Darüber macht man keine Scherze.“
Betreten schaute Ron zu Boden. „War nicht so gemeint. Ich finde es ja auch absurd, dass sich eine Behörde auf so was Esoterisches einlässt.“
Lobowski räusperte sich. „Macht ruhig Witze. Gibt zwischen Himmel und Erde mehr Dinge als was man sieht.“ Er bekreuzigte sich.
Ron hatte aufgeraucht und schnippte die Kippe beiseite. „Verträgt sich das eigentlich? Katholisch sein und der Glaube an Elfen und so was? Ich meine, du bist doch Katholik, oder, Adam?“ Der Pole nickte.
Claaßen trat die Glut aus. „Pass auf, wo du die Dinger hinwirfst! Fehlte noch, dass es anfängt zu brennen.“
Lobowski nickte. „Habt ihr von Waldbränden in Ostdeutschland gehört? Inzwischen gelöscht, aber knapp war das.“
„Schweden soll auch ganz schlimm sein“, sagte Claaßen. „Und vergiss nicht Griechenland. Fast hundert Tote, bei lebendigem Leib geröstet.“
Ron seufzte. „Ist ja gut, Mann. Ich hätte sie ausgetreten, wenn du mir nicht zuvorgekommen wärst. Ihr müsst nicht gleich hysterisch werden.“ Er deutete den Fahrbahnrand hinunter. Auf der für den übrigen Verkehr gesperrten rechten Spur kam ein Dienstfahrzeug der Autobahnmeisterei in Sicht und näherte sich auffallend langsam. Beinahe im Schritttempo rollte der Wagen an ihnen vorüber. Der Beifahrer schaute auf sie herab. Rundes Gesicht, bartlos, darüber dichte, dunkle Locken. „Ist er das? Der Elfenbeauftragte?“ Ron hob grüßend eine Hand, der Typ im Wagen nickte und schaute weg.
„Etwas zu jung für Gandalf“, witzelte Claaßen, als das Fahrzeug vorbei war. „Eher ne Art Hobbit. Was meinst du, Ronny?“ Ob der Junge darauf antwortete und was er sagte, bekam Claaßen nicht mit, weil seine Aufmerksamkeit jäh von etwas anderem in Anspruch genommen wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite der Autobahn, wo der Verkehr wie gewöhnlich floss, stand jemand. Ungläubig kniff Claaßen die Augen zusammen. Eine Frau, auf dem Seitenstreifen. Nein, auf der rechten Spur, wenn er es richtig erkannte! Scheiße. Er setzte an etwas zu sagen, um seine Kollegen darauf hinzuweisen, die sich weiterhin unterhielten, als wäre nichts, und merkte, dass er kein Wort rausbekam. Luft holen konnte er auch nicht. Seine Hand fuhr an die Kehle. Lobowski neben ihm sah ihn erschrocken an und öffnete den Mund.
Keine Worte, stattdessen ein ohrenbetäubendes Quietschen. Reifen, die bis aufs Äußerste und darüber hinaus beansprucht wurden. Ein dumpfer Aufprall, das widerwärtige Kreischen reißenden Metalls, eine Sekunde Stille. Aber es war nicht vorbei, noch einmal quietschte und krachte es, eine Hupe ging los. Ein dritter Knall, vielleicht auch ein vierter oder fünfter, Claaßen hätte es nicht beschwören können, alles ging ineinander über und steigerte sich zu einem infernalischen, alle anderen Sinne überlagernden Lärm. Instinktiv hatte Claaßen sich schon mit dem ersten Krachen geduckt und den Kopf mit den Armen geschützt. Als das Ärgste vorüber war, wurde ihm zweierlei bewusst. Er hatte die ganze Zeit keine Luft bekommen und rang jetzt keuchend um Atem. Und auch ohne hinzusehen wusste er, dass die A2 gerade weitere Opfer gefordert hatte.
7
Larissa schob den Teller beiseite und winkte die Bedienung zu sich. „Auch einen Kaffee?“, fragte sie Aurelia.
Ihre Kollegin und Freundin schaute auf die Uhr. „Eine Viertelstunde haben wir noch … also ja.“ Sie lachte. „Wir sind schon zwei verrückte Hühner, bei dieser Hitze etwas Warmes zu trinken.“
„Nach dem Essen brauche ich einfach meine Tasse Kaffee“, erwiderte Larissa. „Was ich dich neulich schon fragen wollte: Weißt du, wie es mit der Turmpassage weitergeht? Ein paar Geschäfte haben noch geöffnet, der Rest sieht ziemlich trist aus. Schade, dass die Innenstadt immer mehr verwaist.“ In ihrer Handtasche brummte das Telefon. „Warte mal, da kommt ein Anruf.“
Als sie ihre eigene Festnetznummer angezeigt sah, verspürte sie einen Adrenalinschub. War etwas mit Keno? Aber wahrscheinlich hatte Titus bloß vergessen, was er einkaufen sollte, beruhigte sie sich, während sie das Smartphone ans Ohr hielt.
Das Gespräch dauerte nur Sekunden, dann sprang Larissa auf, das Telefon an die Brust gepresst. Unter den alarmierten Blicken Aurelias hastete sie zu den Toiletten. Mit knapper Not schaffte sie es in eine Kabine, wo sie das Gerät auf den Spülkasten knallte. Gleich darauf klatschte ihr Mittagessen – Pancakes mit Heidelbeeren – in die Schüssel. Unter Tränen würgte und spuckte sie, bis ihr Magen nichts mehr hergab, und ignorierte das Klopfen an der Tür und Aurelias besorgte Fragen. Sie riss Klopapier von der Rolle, wischte sich das Gesicht ab. Sie musste sofort nach Hause. Oder besser zuerst noch mal ans Telefon, vielleicht hatte sie sich verhört und alles stellte sich als Irrtum heraus. Die kurz aufgeblitzte Hoffnung schwand im nächsten Moment, als sie daran dachte, wie ihr Mann eben um Fassung gerungen hatte. Sie hatte kaum seine Stimme erkannt. Als sie sich einigermaßen im Griff hatte, verließ sie die Kabine.
„Ist was passiert?“, fragte Aurelia. „Du bist ja kreidebleich.“
Larissa bekam keinen Ton heraus. Ja, es war etwas passiert. Gerade eben war ihre heile Welt wie eine Seifenblase zerplatzt.
Larissa zog die Decke ein Stück höher. Sie fröstelte, trotz der Wärme, die sie sogar hier unten im schattigen Wohnzimmer in den letzten Tagen als zunehmend drückend empfunden hatte. Seit Stunden war sie nicht von der Couch aufgestanden. Irgendwann hatte sie aufgehört, die Tränen mit dem Taschentuch zu trocknen und die Nase zu putzen, entsprechend feucht fühlte sich die Decke unter ihren Händen an. Ihre Weinkrämpfe waren zu vereinzeltem Schluchzen herabgesunken.
„Möchtest du etwas trinken? Für die Nerven.“ Von weither drang die Frage an ihr Ohr. Ohne den Blick von ihren Handrücken zu heben, schüttelte sie den Kopf. Aus dem Augenwinkel bekam sie mit, wie Titus aufstand und sich einen Drink einschenkte. Wie sollte Alkohol ihr dabei helfen, mit dem Verlust ihres Kindes klarzukommen? So sehr konnte sie sich gar nicht betrinken, dass der grauenhafte Schmerz in ihrem Innern nachließ. Ohne Unterlass quälte sie die Frage, wo Keno in diesem Augenblick war. Vermisste er seine Mutter und seinen Vater und ging es ihm ansonsten gut? Hatte er Angst? War er vielleicht gar nicht mehr am Leben, nachdem er Grauenhaftes durchlitten hatte? In Endlosschleife rotierten die schlimmsten Vorstellungen durch ihren erschöpften Geist.
Titus ließ sich wortlos neben sie fallen. Vorhin hatten dort Frau Möhle und auf dem Sessel gegenüber Herr Sommer vom Kriseninterventionsteam gesessen, nachdem die Polizisten gegangen waren. Gemeinsam mit ihnen hatten Titus und sie den Text für die WhatsApp-Gruppe formuliert, mittels derer sie Nachbarn und Freunde informierten. Binnen Kurzem verbreitete sich die Nachricht und zog immer weitere Kreise. Sollte Keno irgendwo gesehen werden, würde man ihn anhand des angehängten Fotos sofort erkennen und entweder seine Eltern oder gleich die Polizei kontaktieren. Wegen der Vielzahl an eingehenden Botschaften hatte Titus schließlich eine weitere Nachricht gepostet, in der er sich für die Anteilnahme bedankte und darum bat, von reinen Mitgefühlsbekundungen abzusehen, damit nicht der eine, entscheidende Fingerzeig unterging in der Masse der teilweise im Sekundentakt eintreffenden Benachrichtigungen.
Anfangs hatten diese Larissa geholfen, die Situation zu ertragen, auch wenn ihre Nerven zum Zerreißen gespannt waren. Mit jedem Signal hoffte sie auf die Entwarnung eines Bekannten, der Keno irgendwo aufgelesen hatte, hinter jedem Anruf erwartete sie die Entführerin, die sich mit einer Lösegeldforderung meldete. Jede Summe wäre sie bereit zu zahlen, und wenn sie alles verkaufen mussten, könnte sie nur ihren Sohn wieder in die Arme schließen. Doch es ging weder eine Erpresserbotschaft ein noch die ersehnte erlösende Nachricht. Frau Möhle und ihr Kollege verabschiedeten sich mit dem Hinweis, laut Statistik des Bundeskriminalamts würden fünfundneunzig von hundert vermissten Kindern nach kurzer Zeit wiederauftauchen, und an diese nüchterne Aussage klammerte sich Larissa wie an ein Heilsversprechen.
Als sie wieder unter sich waren, hatte Titus noch einmal sämtliche Maßnahmen aufgezählt, die in diesen Momenten getroffen wurden, um Keno zu finden. Am liebsten hätte er mitgesucht, statt tatenlos herumzusitzen, aber Larissa allein lassen wollte er anscheinend auch nicht. Ihr ging es genauso, gern hätte sie irgendetwas getan, aber sie war ehrlich genug, sich einzugestehen, dass sie in ihrem derzeitigen Zustand niemandem eine Hilfe wäre. Es blieb ihnen beiden nichts anderes übrig, als auf die rasch zusammengestellte Suchstaffel zu vertrauen, die seit dem Nachmittag die Felder zwischen Lilienfeldsiedlung, Eckberg, Auenheim und Süderrode durchkämmte, unterstützt von einem Dutzend Fährtenhunden. Auch jetzt, nach Einbruch der Dunkelheit, wurde die Suche nach Keno fortgesetzt. Helfer der Freiwilligen Feuerwehr waren mit Suchscheinwerfern in den Forstgebieten Süderroder und Eckberger Holz unterwegs. Aus der Luft nahmen Hubschrauber mit Infrarotkameras die Gegend ins Visier. Immer wieder klang das Geräusch der Rotorblätter zu ihnen herüber.
Larissas Kopf ruckte hoch. Sie blickte hinaus in den Garten, wo sie zwischen den solarbetriebenen Laternen eine Bewegung gesehen hatte. „Keno!“, rief sie, die Stimme heiser vom vielen Weinen, und wollte aufspringen. Sie verhedderte sich in der Decke und wäre gestürzt, hätte Titus sie nicht aufgefangen.
„Beruhige dich, ich sehe nach.“ Sanft drückte er sie zurück auf die Couch und schritt durch die breite Doppeltür auf die Terrasse. Larissas schaute ihm voll verzweifelter Hoffnung hinterher. Ihr Blick streifte den leuchtenden Schmetterling im Blumenkübel. Kenos Lieblingslaterne. Die verbogenen Flügel rührten daher, dass er trotz Verbot damit gespielt hatte. Manchmal hatte Larissa deshalb mit ihm geschimpft. Sie schluckte, als ihr schon wieder die Tränen kamen. Sinnlose Wut auf sich selbst stieg in ihr auf. Was half es Keno, wenn sie weinte oder hysterisch wurde wie heute Mittag? Zuerst im Café – sie wäre nicht heil nach Hause gekommen, hätte Aurelia sie nicht mehr oder weniger gepackt und ins Auto gesetzt –, dann als Titus ihr alles erzählte. Vor dem bereits eingetroffenen Polizisten und seiner Kollegin war sie zusammengebrochen, weinend, schreiend. Natürlich hatten die Beamten Verständnis gezeigt. Fragen hatte sie dennoch beantworten müssen. Fragen, deren Sinn sich ihr nicht gleich erschlossen hatte. Ob Titus Kenos leiblicher Vater sei. Ja doch, wer sonst, sie waren seit zwölf Jahren verheiratet! Ob es Familienangehörige gäbe, die Keno ohne Wissen der Eltern zu sich geholt hätten oder zu denen er auf eigene Faust aufgebrochen sein könnte? Fassungslos hatte Larissa den Kopf geschüttelt. Ihr Sohn wuchs in geordneten Verhältnissen auf. Da gab es keine entfernten Onkel oder Tanten, die ihn aus einer Laune heraus verschleppten. Außerdem war Keno von einer völlig Fremden entführt worden, das hatte Titus den Beamten doch längst mitgeteilt! Die Frau war mit Keno auf dem Arm geflohen. Wie kam die Polizei auf die Idee, er sei weggelaufen?
In Larissas Kopf schwirrten die Fragen wie aufgescheuchte Bienen. Vielleicht sollte sie doch eine der Tabletten nehmen, die der herbeizitierte Hausarzt für sie dagelassen hatte, sonst würde sie die ganze Nacht kein Auge zu tun. Aber wie konnte sie schlafen, während ihr kleiner Junge irgendwo dort draußen in der Dunkelheit war. Andererseits musste sie bei Kräften sein für den Fall, dass Keno zurückkam. Vielleicht hatte der Albtraum schon bald ein Ende, vielleicht hatte er sich befreien können und irrte irgendwo umher. Dann würden ihn die Polizisten und freiwilligen Helfer ganz bestimmt finden, wahrscheinlich noch in dieser Nacht. Es war nicht kalt, es gab keine wilden Tiere. Aber Straßen, die Auffahrt zur Autobahn, Bahnschienen … Erneut spülte Verzweiflung wie eine schwarze Woge über sie hinweg.
Titus kam herein, schloss die Terrassentür und schüttelte den Kopf. „Komm, Schatz, ich bringe dich nach oben. Du musst dich ausruhen.“ Er beugte sich zu ihr, um ihr aufzuhelfen. „Und ich auch. Es bringt doch nichts, wenn wir morgen vor Übermüdung keinen klaren Gedanken fassen können.“
„Wir können doch sowieso nichts tun“, brach es aus ihr heraus.