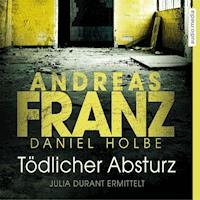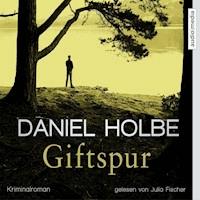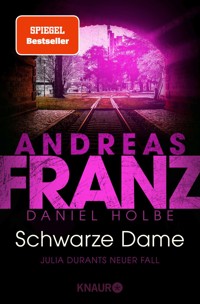9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Sabine-Kaufmann-Krimi
- Sprache: Deutsch
Wenn Dürre Mensch und Tier bedroht und der Fluss Nidda sich rot färbt … Im 8. Teil der Krimireihe um die hessischen Kommissare Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach machen die Bestseller-Autoren Daniel Holbe und Ben Tomasson ein hochaktuelles Thema zum Mittelpunkt ihres Kriminalromans: Wassermangel – und das mitten in Deutschland. Und es gibt unerwarteten Beistand aus Frankfurt: Kult-Kommissarin Julia Durant greift ein! Immer tiefer sinkt der Grundwasserspiegel im hessischen Vogelsberg. Die Dürre bedroht nicht nur die Natur, sondern auch Existenzen in der hessischen Provinz. Für die Betreiber eines Landschaftsbaubetriebs ist klar: So kann es nicht weitergehen – sie gründen eine Bürgerinitiative. Und wollen ein Zeichen setzen, um auf die drohende Naturkatastrophe aufmerksam zu machen: Das Wasser soll rot wie Blut aus den Leitungen ihrer Mitmenschen kommen. Doch für die jüngeren Mitglieder ist die Aktion nicht drastisch genug. Als es zu heftigem Streit innerhalb der Gruppe kommt, beschließt einer der Initiatoren, den ursprünglichen Plan allein umzusetzen und das Wasser im Speicher in Frankfurt heimlich mit Lebensmittelfarbe einzufärben. Kurz darauf findet man ihn erschlagen in der Nidda. Und das Wasser ist blutrot ... Raffiniert, originell und hochspannend liefern die Bestseller-Autoren Daniel Holbe und Ben Tomasson auch in "Glutstrom", dem 8. Fall für das Ermittlerduo Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach, klassische und hochaktuelle Krimi-Spannung für "Tatort"-Fans. Die brisante und hochspannende Krimi-Reihe aus Hessen ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Giftspur - Schwarzer Mann - Sühnekreuz - Totengericht - Blutreigen - Strahlentod - Schlangengrube - Glutstrom
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Daniel Holbe / Ben Tomasson
Glutstrom
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Immer tiefer sinkt der Grundwasserspiegel im hessischen Vogelsberg, Dürre bedroht die Natur und die Menschen, die von ihr leben. Schließlich gründen die Inhaber eines einheimischen Betriebs eine Bürgerinitiative, um ein Zeichen zu setzen: Sie wollen das Wasser im Speicher in Frankfurt heimlich mit Lebensmittelfarbe einfärben, damit es rot wie Blut aus den Leitungen der Verbraucher fließt.
Doch vor allem die Jüngeren finden die Aktion nicht medienwirksam genug. Als es zu heftigen Streitigkeiten innerhalb der Gruppe kommt, beschließt einer der Initiatoren, den ursprünglichen Plan allein umzusetzen. Kurz darauf findet man ihn erschlagen in der Nidda. Und das Wasser ist blutrot ...
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Nachruf
Die Handlung dieses Buches ebenso wie die Akteure und deren Verstrickungen sind frei erfunden. Sogar die Ortschaft Eichelsborn sowie ihre Bewohner und ansässigen Betriebe gibt es nur in unserer Fantasie. Alle anderen Schauplätze sind real.
Ebenso real ist der Grundwasserraubbau im Vogelsberg. Durch die immer extremer werdenden Dürrephasen spitzt sich diese Problematik für Quellen, Bäche, Forst- und Landwirtschaft dramatisch zu.
1
Immer wieder holte sie den Zettel hervor und betrachtete ihn lächelnd, während sie über das Messegelände zum Parkplatz ging, auf dem die Mitarbeiter ihre Fahrzeuge abstellen durften. Die Aussteller in der Nähe der Hallen, die Mädchen, die nur schmückendes Beiwerk waren, im hinteren Bereich. Ein studentischer Ausschuss hatte die Einrichtung von Frauenparkplätzen für die Messehostessen gefordert, aber irgendein reaktionärer Hohlkopf hatte das Anliegen abgebügelt, ehe es überhaupt den Entscheidungsträgern vorgelegt worden war.
Der Typ, der ihr den Zettel gegeben hatte, war total süß gewesen. Schlaksig, mit braunen gelockten Haaren, die in alle Richtungen vom Kopf abstanden. Der Bartwuchs spärlich und die Brille aus der Mode gekommen, aber das Lächeln so ehrlich und der Blick aus den braunen Augen so warm, dass sie am liebsten ihren Stand verlassen hätte, um irgendwo einen Kaffee mit ihm trinken zu gehen.
Aber sie brauchte den Job. In ein paar Wochen würde sie ihr Studium in Frankfurt beginnen, und dann wollte sie sich ganz aufs Lernen konzentrieren. Den Sommer über arbeitete sie, damit sie es während des Semesters nicht musste. Ihre Mutter war Krankenschwester, alleinerziehend. Ihren Vater kannte sie nicht. Das Geld war knapp, die Mutter konnte ihr nichts dazugeben.
Ärztin wollte sie werden. Die Leidenschaft für das Helfen hatte sie von ihrer Mutter geerbt, aber sie würde nicht wie sie in einem schlecht bezahlten Beruf arbeiten. Das Abitur hatte sie mit guten Noten abgelegt und einen Studienplatz bekommen. Aber um das Studium zu schaffen, musste sie sich voll und ganz darauf konzentrieren.
Der Job bei der Hessischen Landwirtschaftsmesse war ein Glücksfall. Nirgends verdiente man als ungelernte Kraft so leicht und schnell Geld wie auf einer Messe. Sie konnte viele Stunden am Stück arbeiten und brauchte nicht viel zu tun. Nur den Kunden Kaffee und Kekse oder alkoholische Getränke anzubieten und freundlich zu lächeln. Die eigentliche Arbeit erledigten die Verkäufer.
Ihr fiel das nicht schwer. Die Kunden, die sich für das Angebot der Saatgutfirma interessierten, waren überwiegend Landwirte. Gemütliche, freundliche Menschen, keine Bonzen und Angeber, wie sie es schon auf anderen Messen in Frankfurt erlebt hatte. Allerdings waren auch selten attraktive junge Männer darunter.
Die Laternen im hinteren Bereich des Parkplatzes waren ausgefallen. Sie blieb stehen und verstaute den Zettel sorgfältig in der Handtasche, ehe sie weiterging. Erkennen ließ sich in dieser dunklen Ecke ohnehin nichts mehr, und mittlerweile konnte sie den Zettel auch mit geschlossenen Augen vor sich sehen. Oben stand die Telefonnummer. Darunter befand sich eine Zeichnung. Sie zeigte einen Mann mit lachendem Gesicht, der einen dicken Blumenstrauß in der ausgestreckten Hand hielt.
Es gefiel ihr, weil es so schön altmodisch war. Viele junge Leute hatten mittlerweile ein Handy. Sie selbst besaß keins, weil sie ihr Geld lieber sparen wollte, und der junge Mann hatte ebenfalls keins. Das war der erste Punkt gewesen, über den sie gemeinsam gelacht hatten.
Sie hatte versprochen, ihn anzurufen, wenn die Messe vorbei war, und das würde sie auch tun.
Irgendwo hinter ihr waren Schritte auf dem Schotter zu hören. Sie drehte den Kopf, konnte aber nichts erkennen. Nur zwei dunkle Schemen, die sich in ihre Richtung bewegten. Groß und breitschultrig, zwei Männer, die sich unterhielten. Sicherlich würden sie zu den teuren Limousinen im beleuchteten Bereich gehen.
Sie ging weiter, registrierte aber dann, dass die Schritte näher kamen. Erneut wandte sie den Kopf nach hinten.
Die beiden Männer strebten direkt auf sie zu.
Mit einem Mal hatte sie ein blödes Gefühl und beschleunigte ihren Gang, doch mit den hochhackigen Schuhen und dem engen Rock, den sie für ihren Job tragen musste, hatte sie kaum Bewegungsspielraum. Trotzdem eilte sie, so schnell sie konnte, zu ihrem Auto. Im Laufen fischte sie die Fahrzeugschlüssel aus der Handtasche.
Der Wagen gehörte ihrer Mutter. Ein in die Jahre gekommener dunkelblauer Golf, ohne Schnickschnack, aber zuverlässig. Sie lief darauf zu und stocherte mit dem Schlüssel im Türschloss, als sie ihn erreicht hatte. Die beiden Männer tauchten neben ihr auf, als sie gerade die Wagentür öffnete.
Das Licht der Innenbeleuchtung fiel auf ihre Gesichter, und sie seufzte erleichtert auf.
»O Gott«, hauchte sie. »Ich dachte schon …«
Die beiden waren kurz vor Messeschluss an ihrem Stand gewesen, hatten Champagner getrunken und mit ihr geflirtet. Zwei junge Männer, ungefähr im selben Alter wie der Typ, der ihr den Zettel gegeben hatte, allerdings sehr viel selbstbewusster und männlicher. Beide sorgfältig frisiert, der eine blond, der andere dunkel, beide trotz der späten Stunde glatt rasiert. Breites Lächeln, strahlend weiße Zähne, blitzende Augen.
Die Männer hatten sie eingeladen, nach Messeschluss etwas mit ihnen trinken zu gehen, aber sie hatte abgelehnt. Sie wollte nach Hause und die schmerzenden Füße hochlegen. Die hochhackigen Schuhe waren die Hölle, und davon abgesehen hatte sie ihr Herz gerade eben erst an einen anderen jungen Mann verschenkt.
Die beiden hatten das akzeptiert, und man hatte sich freundlich verabschiedet.
Der Blonde verschränkte die Arme auf der Wagentür. »Was hast du gedacht?«, fragte er mit leisem Spott in der Stimme.
Der Dunkelhaarige kam um die Tür herum und strich ihr mit dem Daumen über die Wange.
Ihr wurde mulmig. Die Erleichterung, die sie eben noch verspürt hatte, wich jäher Angst.
Was taten die beiden auf dem Mitarbeiterparkplatz?
»Wir haben gar keine Telefonnummern ausgetauscht«, sagte der Dunkelhaarige.
Sie versuchte, auf Abstand zu gehen, doch der Mann stand so dicht vor ihr, dass sie sich nicht bewegen konnte, und hinter ihr war die Wagentür.
»Bitte.« Sie tauchte unter seinem Arm hindurch und entfernte sich ein Stück vom Wagen.
Der Dunkelhaarige leckte sich die Lippen und kam mit langen Schritten auf sie zu. »Du bist so eine Wildkatze, die will, dass man sie zähmt, stimmt’s?«
Sie wich weiter zurück. Was sollte sie tun? Wegzulaufen hatte keinen Sinn, mit ihren hochhackigen Schuhen käme sie nicht weit. Sie könnte die Schuhe ausziehen, aber mit den dünnen Strümpfen auf dem scharfkantigen Schotter hätte sie ebenfalls keine Chance. Die Männer waren auf jeden Fall schneller und stärker als sie.
»Bitte. Ich möchte einfach nur nach Hause.«
»Sicher.« Der Dunkelhaarige streckte wieder die Hand aus. Diesmal strich sein Daumen über ihre Unterlippe.
Sie machte einen Schritt rückwärts, stieß aber mit dem Rücken gegen die breite Brust des zweiten Mannes, der im Dunkeln hinter sie getreten war. Er packte ihre Handgelenke und zerrte ihr die Arme auf den Rücken.
Sie tat genau das, was sie im Selbstverteidigungskurs gelernt hatte. Sie schrie laut um Hilfe und hob das rechte Bein, um dem Blonden den Absatz auf den Fuß zu rammen.
Es funktionierte nicht. Der Blonde hatte ihren Angriff vorausgesehen und zog den Fuß zurück. Der Dunkelhaarige schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht und gleich darauf mit dem Handrücken erneut. Der Schrei erstickte in ihrer Kehle. Sie schmeckte Blut auf den Lippen, und ihre Wangen brannten.
»Versuch das nicht noch mal«, drohte der Dunkelhaarige. »Sonst müssen wir dir wehtun.«
Er griff ihr in den Ausschnitt, riss die Bluse auf und knetete ihre Brüste mit beiden Händen. Dann presste er seine Lippen auf ihre und schob ihr die Zunge zwischen die Lippen. Seine rechte Hand verschwand von ihrer Brust und schlängelte sich unter ihren kurzen Rock. Sie spürte seine Finger zwischen den Beinen. Ungeduldig zerrte er an ihrer Strumpfhose, bis der Stoff mit einem trockenen Geräusch nachgab.
Mit dem Knie spreizte er ihre Schenkel. Sein Mund löste sich von ihrem. Stattdessen schob er ihr die Finger in den Mund und rieb mit dem Daumen über ihre Wange. Sie sah, wie er sich an seiner Hose zu schaffen machte und spürte seinen heißen Atem an ihrem Ohr.
Im nächsten Moment war er in ihr.
2
Die Welt ist am Arsch.« Josef, den sie hier alle nur Jojo nannten, nahm einen kräftigen Schluck aus der Flasche und reckte sie hoch. Über ihm wölbte sich das Stahlgerüst der Mainbrücke. Dahinter war das fahle Licht der flach stehenden Sonne im Morgennebel zu sehen. Vor ihm ragte die Frankfurter Skyline auf wie eine Reihe schwarzer Zähne, die das Ufer säumte. Ein gefräßiges Fischmaul, das alle verschlang, die sich nicht anpassten, mitliefen, bis an den Rand ihrer Kräfte gingen.
Jojo war darüber hinausgegangen, und das Fischmaul hatte ihn wieder ausgespuckt. Deshalb lebte er jetzt hier. Dreckiger Schlafsack, schmutzige Klamotten, verfilzte Haare, die gesamte Habe verstaut in zwei großen Supermarkttaschen in einem alten Einkaufswagen. Einmal in der Woche ging er in die Unterkunft, um zu duschen. Ansonsten war er lieber draußen, wo ihn niemand bevormundete.
Seinen gut bezahlten Job hatte er verloren, weil er den Mund nicht gehalten hatte. Das war seine Schwäche. Wenn er ein Unrecht sah, musste er protestieren. Allerdings hörte ihm schon lange niemand mehr zu. Nur die Leute im Park, wenn er auf eine der Bänke stieg, um die verheerende Politik anzuprangern. Und die drei anderen, die wie er die Nacht unter der Brücke verbracht hatten.
Sie waren früh wach geworden, weil die schweren Fahrzeuge der Müllabfuhr über die Brücke gefahren waren. Das Vibrieren der Stahlträger übertrug sich und riss jeden aus seinem unruhigen Schlaf. Der erste Griff galt bei allen der Flasche, aber nur Jojo war aufgestanden. Die anderen hatten sich wieder in ihre Schlafsäcke eingemummelt. Sie wollten seine Tiraden nicht hören. Keiner wollte das.
Jojo nahm noch einen Schluck und schlenderte am Ufer entlang, um seinen Kreislauf in Schwung zu bringen. Die anderen hatten ja recht. Was scherte sie die Klimaerwärmung, der Welthunger, die Energiekrise, die Seuche? Sie waren aus dem System gefallen. Keiner von ihnen würde besonders alt werden. Das Leben auf der Straße machte gleichgültig.
Aber Jojo war noch nicht lange genug unten. Sein Kämpferherz schlug noch. Er wollte zurück in die Gesellschaft. Er wollte die Menschen warnen vor den biblischen Plagen, die über das Land hereinbrechen würden, wenn sie nicht endlich handelten. Die Zeichen waren eindeutig.
Jojo kippte den restlichen Wodka hinunter und warf die leere Flasche in den nächsten Mülleimer. Die feuchte Morgenkälte kroch unter seine Kleider, die er in Schichten trug. Er fröstelte.
Um sich aufzuwärmen, ging er noch ein Stück am Wasser entlang. Dann blieb er wie angewurzelt stehen.
Natürlich wusste er, wie die Folgen übermäßigen Alkoholkonsums aussahen. Früher oder später gingen wesentliche Teile des Gehirns zugrunde, und irgendwann bekam man Halluzinationen. Er hatte nur nicht geglaubt, dass es so schnell passieren könnte. War er schon derart am Ende?
Was er sah, konnte jedenfalls nur eine Ausgeburt seiner Fantasie sein.
Hunderte nackter Kinderleichen trieben auf dem Wasser des Mains, die Gliedmaßen von sich gestreckt, die weit geöffneten Augen blicklos in den Morgenhimmel gerichtet, der gerade in einem satten Goldton erglühte. Und mitten zwischen all den Kindern ein erwachsener Mann in einem blauen Overall, mit wirren Haaren, zerzaustem Bart und ausgestreckten Armen wie der gekreuzigte Jesus.
Vielleicht war das auch ein Zeichen. Die Welt war am Arsch, aber holen würden sie zuerst ihn.
3
Nadine Engel schob den Medikamentenwagen über den Flur und blieb vor der letzten Tür auf der rechten Seite stehen. Das großformatige Foto, das an der Tür befestigt war, zeigte das Alte Schloss Büdesheim, einen dreiflügeligen Bau mit Spitzdach, schwarzen Dachschindeln und rotem Fachwerk. Darunter klebte ein Schild mit der Aufschrift »Frau Roswitha Rösler aus Schöneck« in Schriftgröße dreißig.
Nadine klopfte sacht an die Tür und drückte die Klinke hinunter. Die alte Frau Rösler war eine ihrer liebsten Bewohnerinnen. Freundlich und dankbar, immer mit einem stillen Lächeln auf den Lippen. Die Realität war ihr entglitten, sie lebte in einer Fantasiewelt, aber ihre Augen waren noch wach, und sie suchte den Kontakt zu den Menschen um sich herum.
»Ach, nein. Nicht schon wieder.« Nadine stöhnte leise. Roswitha Röslers Bett war leer.
Nadine warf einen Blick ins Bad, doch dort war die alte Dame nicht. Also hatte sie sich wohl wie so oft auf den Weg gemacht. Zu ihrem Sohn, der doch schon vor zwanzig Jahren bei einem Verkehrsunfall gestorben war, oder zu ihrem Mann, der seit dreißig Jahren nicht mehr lebte. Aber das wusste Roswitha Rösler nicht mehr. Sie wollte, so wie immer, einfach nur nach Hause.
Nadine schob den Medikamentenwagen ins Stationszimmer, wo ihre Kollegin Lina Papierkram erledigte.
»Frau Rösler ist schon wieder weggelaufen«, sagte Nadine. »Ich gehe sie suchen.«
Lina schüttelte den Kopf. »Wir sollten lieber die Polizei rufen.«
Nadine sah die Kollegin bittend an. »Vor den Beamten in Uniform hat sie Angst, das weißt du doch.« Roswitha Rösler hatte im Krieg schlimme Dinge erlebt, und die Polizisten von heute erschienen ihr in ihrer Verwirrung ebenso bedrohlich wie damals die Wehrmacht, die ihre Eltern verfolgt hatte, weil sie Juden in ihrem Haus versteckt hatten.
Lina seufzte tief. »Also gut. Dann kümmere ich mich um die Medikamente. Aber wenn du sie in einer halben Stunde nicht gefunden hast, rufen wir die Polizei.«
»Ich beeile mich.« Nadine stürmte aus dem Stationszimmer. Roswitha war vermutlich zur Nidda gelaufen. Sie liebte den Fluss, und das Haus, in dem sie früher mit ihrer Familie gewohnt hatte, stand direkt an der Nidda. Allerdings nicht hier in Bad Vilbel, sondern in Klein-Karben. Schöneck war Roswithas Geburtsort, in Klein-Karben hatte sie nach ihrer Hochzeit gewohnt, bis sie allein nicht mehr zurechtgekommen war. Nun war das Altenzentrum in Bad Vilbel ihr Zuhause.
Nadine öffnete die Tür des Wohnbereichs mit dem Wandschalter. Die meisten Bewohner waren dazu nicht mehr in der Lage, doch Roswitha brachte es immer wieder fertig, den Bereich zu verlassen. Es war nicht gut, wenn sie allein draußen herumlief, aber man konnte die alten Leute ja nicht einsperren.
Nadine benutzte den Hinterausgang des Altenzentrums und lief durch das kleine Waldstück hinter dem Haus. Das Russenwäldchen, so hieß es. Nadine hatte keine Ahnung, wie es zu diesem Namen gekommen war.
Der Weg war eher ein Trampelpfad, aber gut zu erkennen. Dahinter kam die Straße, dann der Bahndamm. Das war das eigentliche Problem. Der Weg zur Nidda war nicht weit, nur knapp dreihundert Meter, wenn man in direkter Linie durch den Wald, über das Brachland und die Wiese ging. Aber die Straße und der Bahndamm waren das Problem, denn Demenzpatienten wie Roswitha Rösler ahnten nichts von der Gefahr, die von herannahenden Autos und S-Bahn-Zügen drohte.
»Ach du meine Güte!« Nadine blieb fast das Herz stehen. Roswitha Rösler kam tatsächlich von der Nidda aus auf sie zugelaufen und erklomm gerade den Bahndamm. Ihre halblangen grauen Haare waren zerrauft, ihr dünnes Nachthemd flatterte um den schmalen Körper. An den Füßen trug sie braune Filzpantoffeln.
»Frau Rösler!« Nadine überquerte rasch die Straße und rannte ihr entgegen.
Die alte Frau ruderte mit den Armen.
Nadine war noch etwa hundert Meter entfernt.
»Frau Rösler! Kommen Sie!«, rief sie, doch die alte Dame blieb mitten auf den Schienen stehen. Sie drehte sich zurück in Richtung Fluss und schien plötzlich zur Salzsäule erstarrt.
Nadine hörte das Geräusch eines herannahenden Zugs. Der Bahnhof war nicht weit entfernt, aber an dieser Stelle hatte die Bahn bereits ordentlich Tempo aufgenommen. Der rote Zug der S6 mit der großen Glasfront rollte beängstigend schnell auf die alte Dame zu.
Roswitha Rösler drehte sich wieder zu Nadine um. Sie schien den Zug gar nicht zu bemerken, aber der Lokführer hatte die alte Frau entdeckt. Das Warnsignal schallte laut über die Wiesen, und die Bremsen des Zugs kreischten.
Nadine wusste, dass er nicht rechtzeitig zum Stillstand kommen würde, und auch sie selbst würde Roswitha nicht schnell genug erreichen, um sie von den Schienen zu holen. Sie sah, wie die S-Bahn auf die alte Frau zuraste.
»Nein!« Nadine schlug die Hände vor die Augen. Sie wollte das Drama nicht mit ansehen.
Die Bremsen kreischten, bis der Zug in einiger Entfernung zum Stehen kam. Dann war es totenstill.
Nadine drehte sich zur Seite und nahm die Hände herunter. Bloß nicht zur Unfallstelle sehen! Das Bild würde sie nie wieder aus dem Kopf bekommen!
Sie fuhr zusammen, als ein Finger sie an der Schulter berührte.
»Schwester.«
Nadine wandte sich um und blinzelte. Vor ihr stand Roswitha Rösler, augenscheinlich unverletzt.
»Frau Rösler! Gott sei Dank! Ich dachte, Sie schaffen es nicht.«
Erst jetzt bemerkte sie den Gesichtsausdruck der alten Frau. Roswitha Rösler sah aus, als hätte sie in den Schlund der Hölle geblickt. Ihre Augen waren weit aufgerissen, und ihre Hände zitterten.
»Der ganze Fluss ist voller Blut«, krächzte sie. »Und mittendrin schwimmt ein Toter.«
Nadine nahm die alte Dame in den Arm. Das war gewiss der Schock darüber, dass sie beinahe von der S-Bahn erfasst worden wäre.
»Schwester.« Roswitha Rösler machte sich von ihr los. »Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Da treibt ein Toter in der Nidda, und alles ist voller Blut.«
»Ja, Frau Rösler.« Nadine griff nach der Hand der alten Frau. »Kommen Sie. Wir gehen zurück in Ihr Zimmer.«
Roswitha Rösler versteifte sich. »Wir müssen die Polizei rufen.«
»Natürlich, Frau Rösler.« Nadine seufzte leise. Es würde ein hartes Stück Arbeit werden, die alte Frau wieder zu beruhigen. Sie deutete auf einen Mann in blauer Uniform, der aus Richtung der S-Bahn über die Wiese auf sie zukam. »Aber jetzt sagen wir erst mal dem Lokführer, dass er sich keine Sorgen machen muss, weil Ihnen nichts passiert ist, nicht wahr?«
4
Die Morgenluft schmeckte nach Tau, und das, obwohl sie sich mitten in der Innenstadt befand. Julia Durant war viel zu früh wach gewesen und hatte nach endlosem Herumwälzen entschieden, eine Laufrunde zu drehen. Es war noch nicht einmal sechs Uhr, als sie die Wohnungstür hinter sich geschlossen hatte und auf dem Weg die Treppe hinunter mit den ersten Dehnbewegungen begann.
Im leichten Trab erreichte sie den nahen Holzhausenpark. Bald würde der Berufsverkehr sich verdichten und an den Knotenpunkten der Stadt zum Erliegen kommen. Doch für den Moment genoss sie die Stille, die ersten Vogelstimmen, die erwachten, ihren Herzschlag und den Rhythmus ihrer Füße auf dem befestigten Untergrund.
Kaum hatte sie den ersten Kilometer hinter sich, meldete sich ihr Handy. Die Nummer gehörte zum Kriminaldauerdienst. Na toll, dachte Durant. In zwei Stunden hätte sie ohnehin Dienstbeginn gehabt. Aber das Verbrechen hielt sich nun mal nicht an irgendwelche Pläne.
»Hallo?« Sie keuchte.
»Guten Morgen«, meldete sich die Stimme vom KDD. Sie klang leicht heiser. »Es gibt zu tun. Ein Riesenchaos! Haben Sie schon die Verkehrsmeldungen gehört?«
Durant verneinte. Im Folgenden berichtete die Kollegin ihr von einem verunglückten Transporter auf der Flößerbrücke. Noch während die Kommissarin sich fragte, wo genau die Mordkommission ins Spiel kam, der sie immerhin angehörte, kam die Stimme auf den Punkt: »Ein Techniker vor Ort will festgestellt haben, dass an dem Wagen manipuliert wurde. Ein potenzieller Mordversuch also. Ohne den Segen der Kripo wird da kein Handgriff mehr getan, und was das für die Rushhour bedeutet, können Sie sich ja vorstellen.«
Die Kommissarin blickte an sich hinab. Super, dachte sie. Aber das Polizeipräsidium war nur einen Katzensprung entfernt, und in ihrem Büro befand sich etwas zum Überziehen. »Ich bin unterwegs«, sagte sie daher.
Julia Durants Vater war Pastor gewesen, aber man musste nicht bibelfest sein, um von dem Bild, das sich von der Brücke aus bot, ergriffen zu sein. Die zehn Plagen des alten Ägyptens. Tote Erstgeborene. Flüchtige Gedanken, die sofort wieder von dem Hupkonzert zerrissen wurden. Von überlegen grinsenden Radfahrern und Rollern, die sich ihre Wege durch die Absperrung erkämpften. Deren Gesichtsausdrücke allesamt erstarrten, sobald sie die nackten Babykörper erblickten, die sich an den Uferseiten gefangen hatten. Manchen fehlte ein Arm oder ein Bein, ein Teil trieb mit dem Kopf nach unten, andere schienen einen mit aufgerissenen Augen direkt anzublicken. Der fensterlose Mercedes Sprinter mit dem Logo und Schriftzug einer Firma, von der Durant noch nie gehört hatte, schien mit der Brüstung der Brücke verschmolzen zu sein. Die Flößerbrücke wurde von einem grünen Pylonenpaar getragen, und genau von einem solchen war der Transporter zum Stehen gebracht worden. Es musste ein verzweifeltes Manöver gewesen sein. Die Schiebetür war aufgerissen, eine der Flügeltüren ebenfalls. Die Kommissarin suchte sich ihren Weg in Richtung zweier uniformierter Kollegen und ließ sich auf den neuesten Stand bringen.
»Da wurde vermutlich an der Bremsleitung rumgefummelt«, wusste der ältere der beiden, ein schlanker Mittvierziger mit Pockennarben und hoher Stirn. Er deutete in Richtung des Fahrzeugs. Es lag schräg genug, dass man ein Stück des Unterbodens erkennen konnte, aber nicht genug für eine eindeutige Diagnose. »Die Feuerwehr wollte nämlich wissen, wie viel Öl ausgelaufen ist«, erklärte der Beamte weiter, »also haben wir mal druntergeschaut. Öl und Kühlwasser sind ausgelaufen, aber die Bremsanlage scheint völlig leer gewesen zu sein. Der Fahrer hat es vermutlich zu spät bemerkt. Mit Karacho auf die Brücke, und dann hat er die Kontrolle verloren.« Er hob die Schultern. Mitgefühl ließ er dabei kaum welches erkennen.
»Die Kriminaltechniker sind unten am Ufer und sammeln die Puppen ein«, sagte der Jüngere. Ein kleiner geratenes Exemplar Mann mit strahlend blauen Augen und modelhaften Zügen. Er dürfte kaum Mitte zwanzig sein. »Was für eine Szene, ey. Das müsste man eigentlich filmen.«
Julia Durant blickte sich um. Überall standen Schaulustige und hatten ihre Smartphones im Anschlag. Manche heimlich, andere ganz offen und ohne jedes Schuldbewusstsein. An Handyvideos dürfte es also kaum mangeln. Sie war gespannt, welches Revolverblatt die erste Schlagzeile mit biblischer Phrase veröffentlichen würde. Schon allein der Gedanke daran, jeden Ermittlungsschritt im Fokus der Öffentlichkeit tun zu müssen, bereitete ihr größtes Unbehagen.
Sie nahm das Fahrzeug in Augenschein. Die zerschmetterte Windschutzscheibe. Den schlaff herabhängenden Gurt, der weder zerschnitten noch eingeschnappt war. Der Fahrer war demnach nicht angeschnallt gewesen. Sosehr ihr die mögliche Antwort widerstrebte, fragte sie: »Was ist denn mit dem Fahrer?«
Die Antwort kam von dem Älteren: »Wird im RTW wieder aufgepäppelt. Mann, was hat der einen Schutzengel gehabt!«
Julia erreichte den Rettungswagen just in dem Augenblick, als jemand den Motor startete und eine schwarze Rußwolke aus dem Auspuff drang. Sie hastete nach vorn, und ihre Handfläche traf gerade noch das Seitenblech am Heck. Sofort flammten die Bremslichter auf, und ein Lockenkopf lugte aus dem Beifahrerfenster. »Geht’s noch?«
»Durant, Mordkommission«, keuchte sie und wollte gerade ihren Ausweis herausfummeln, als der Mann sagte: »Hier ist doch gar niemand tot. Und wenn Sie uns nicht aufhalten, bleibt das auch so.«
»Ist das also der Fahrer?«, wollte sie wissen.
»M-hm.«
»Ist er bei Bewusstsein?«
»Nein. Er hat Unterkühlungen, und seine Lunge war voller Wasser. Aber wir kriegen ihn durch. Nur müssen wir jetzt los …«
Wie auf Kommando begann das Blaulicht aufzublitzen.
»Hatte er einen Ausweis bei sich?«
»Nichts dergleichen.«
Durant ließ den Wagen fahren. Sie musste sich wohl oder übel gedulden. Ein Schatten huschte durch ihre Erinnerungen. Körperlich mochte der Mann zu retten sein. Aber was, wenn das Gehirn zu lange von der Sauerstoffversorgung abgeschnitten war? Wenn nicht viel mehr als eine Hülle blieb … Sie wischte die Vorstellung beiseite und stieg hinab in Richtung Ufer.
Auf einer Bank, eingehüllt in eine golden glänzende Rettungsdecke, hockte ein unrasierter Mann mit glasigem Blick. Neben ihm türmten sich zwei Supermarkttüten und ein Schlafsack. Ein Obdachloser also. Umso erstaunter war die Kommissarin, als er mit klarer Stimme und ohne eine von Kälte und Alkohol ermüdete Zunge zu ihr sprach.
»Mordkommission?«, wiederholte er. »Ist der Mann etwa tot?«
»Nein. Aber wir können ein Verbrechen derzeit nicht ausschließen. Bitte schildern Sie noch einmal, was genau passiert ist. Ach ja«, Durant warf einen Blick auf seine schmutzigen Hände, die nervös mit den Fingern spielten, »und zuallererst bräuchte ich Ihren Namen.«
»Jojo Reichelt. Also eigentlich Josef, aber niemand nennt mich hier so.«
»Hier?«
Er zuckte mit den Achseln, die Decke knisterte. »Na ja, hier unten eben. Unter uns. Sie haben sich’s ja bestimmt schon gedacht. Ich wohne hier.«
»Ja, der Gedanke ist mir gekommen.« Die Kommissarin lächelte. Offenbar schämte er sich, aber er machte auch kein Geheimnis aus dem Offensichtlichen. Und wie bei allen Obdachlosen steckte auch hinter diesem Mann eine Geschichte, der man vielleicht Gehör schenken sollte. Doch dann waren da diese vielen Puppen. Sie seufzte. »Deshalb waren Sie also so schnell zur Stelle? Sie haben dem Fahrer vermutlich das Leben gerettet.«
Jojo nickte nur.
»Erzählen Sie es mir bitte noch einmal so genau wie möglich?«
»Was denn? Warum ich hier unten hause oder wie ich den Typen aus dem Wasser gefischt habe?«
Julia Durant zwinkerte. »Zuerst das Zweite, wenn’s recht ist. Danach spendiere ich uns gerne einen Kaffee und höre mir auch das andere an.«
»Abgemacht.« Jojo grinste breit. Seine Zähne waren weder gelb noch lückenhaft. Entweder war er noch nicht lange obdachlos, oder er hatte sich noch nicht aufgegeben. Er nahm die Decke von den Schultern, faltete sie hastig und ließ sie in einer der Plastiktüten verschwinden. Dann stand er auf und machte zwei Schritte in Richtung Ufer.
»Von dem Knall hab ich nichts mitbekommen«, schilderte er. »Ich meine, der Verkehrslärm, daran gewöhnt man sich. Es erwartet ja keiner, dass so was passiert. Aber dann diese Puppen, mein Gott, ich hab gedacht, das sind alles Kinderleichen. Ist natürlich Quatsch, aber im ersten Moment …« Er schüttelte sich. »Na ja. Dann hab ich mittendrin diesen großen Körper gesehen. Nur ein paar Meter entfernt, bäuchlings, den Kopf unter Wasser. Da hab ich nicht lange gefackelt. Hätte ja auch einer von uns sein können. Ich hab ihn rausgeholt und dann halt Erste Hilfe und so. Brustmassage. Kennen Sie ja sicher.«
»Und Sie offenbar auch«, sagte Durant anerkennend.
»Klar. Hab den Lehrgang genauso gemacht wie Sie.« Seine Augen blitzten auf. »Aber haben Sie nicht etwas von Kaffee gesagt?«
Julia Durant schmunzelte. »Zuerst noch ein paar Details. Was war mit der Massage? Haben Sie ihn wiederbelebt?«
»Nein. Ich hab’s versucht, aber die Sanitäter sind ziemlich schnell gekommen und haben das Ganze übernommen. Seitdem sitze ich hier. Die Decke habe ich von ihnen, aber Sie verraten mich nicht, okay?«
»Kommt drauf an.« Durant kniff die Augen zusammen und beobachtete den Mann sehr genau, als sie ihre nächste Frage stellte. »Haben Sie vielleicht sonst noch etwas, was niemand wissen sollte?«
Jojo zuckte kaum merklich. »Was denn zum Beispiel?«
»Ich will Ihnen da nichts unterstellen, und Sie hätten auch nichts zu befürchten, aber der Verunglückte hatte weder Ausweis noch Führerschein bei sich. Wissen Sie da vielleicht …«
»Nein! Nicht jeder Penner ist auch ein Dieb! Und Sie können gerne meinen Kram durchsuchen.«
»Tut mir leid, falls ich Sie verärgert habe. Berufsrisiko. Aber es wäre sehr wichtig für uns.«
»Wie gesagt«, Jojos Hand machte eine einladende Geste, »ich habe nichts zu verbergen. War es das?«
Durant spürte, dass er aufrichtig verletzt war. »Kaffee und Frühstück?«, fragte sie daher.
Sie fanden einen Bäcker, der zu dieser frühen Stunde bereits Rührei, Speck und Kaffeespezialitäten anbot. Der Laden war unerwartet voll. Zuvor hatte die Kommissarin den Uniformierten ein paar Anweisungen gegeben, was als Nächstes zu tun war.
»Was sollen wir denn mit den ganzen Puppen machen?«, hatte sich der Beamte mit der Modelfigur erkundigt. Das strahlende Blau schien ein wenig eingetrübt zu sein bei der Vorstellung, Hunderte Babypuppen aus dem Uferdickicht zu befreien oder ihnen bis sonst wohin nachzujagen.
»Im Wasser lassen können wir sie leider nicht«, antwortete Durant, die selbst ein wenig überfragt war. Gab es jemanden, der ein Schleppnetz bereithielt? Sie ordnete an, zuerst die Wasserschutzpolizei zu informieren. Danach Feuerwehr, DLRG, THW, was auch immer. »Wir selbst konzentrieren uns vor allem auf den Uferbereich«, betonte sie. Denn irgendwo musste es doch einen Hinweis auf die Identität des Unglücksfahrers geben. Portemonnaie, Ausweis, Führerschein. Auftragspapiere. Es sei denn, der Main hatte diese Hinweise verschluckt.
Nun lauschte sie bei heißem Cappuccino einer traurigen Geschichte. Einer Spirale, die sich, einmal in Bewegung gesetzt, nicht mehr hatte aufhalten lassen.
»Zwei Jahre ist das her«, schloss Jojo seine Erzählung ab. Eine Geschichte, die mit seinem Job beim hiesigen Wasserversorger ihren Anfang genommen hatte. Eine Firma, die wie jeder Konzern auf Gewinnmaximierung aus war. Die sich den Zeichen der Zeit widersetzte, den trockenen Sommern und dem sinkenden Grundwasserpegel. Jeder Widerstand wurde unterdrückt, jedes Aufbegehren abgeschmettert. »Das ist dasselbe wie mit dem Strom«, sagte Jojo. »Für die meisten kommt der noch immer aus der Steckdose, und um alles Weitere will sich kaum wer Gedanken machen. Beim Wasser ist es dasselbe Spiel. Solange es hier das Klo runtergeht, interessiert es doch niemanden, dass oben im Vogelsberg das Trinkwasser im Sommer wochenlang per Tankwagen rangekarrt werden muss. Die Leitungen aus dem Vogelsberg sind uralt, genau wie die Abnahmeverträge. Nur, dass der Bedarf vor hundertfünfzig Jahren hier noch ein ganz anderer war. Das ist alles nicht mehr zeitgemäß – nein, es ist sittenwidrig! Aber jeder, der da querkommen will, wird mundtot gemacht oder aussortiert.« Jojos Miene verdüsterte sich. »Fristlose Kündigung mit fadenscheiniger Begründung. Da machst du gar nix. Und weil sich jeder in der Branche kennt, findest du auch nicht so schnell was. Dann platzt der erste Kredit, die Miete geht nicht mehr, und zack bist du ein Sozialfall.«
Durant schluckte hart. Die Bilder in ihrem Kopf rauschten vorbei wie ein Strudel. Das war der passende Begriff. Ein Strudel, wie er sich auch Josef Reichelt gegriffen und ihn gnadenlos hinabgezogen hatte, bis er am Mainufer gestrandet war.
5
Ralph Angersbach lag ausgestreckt im weißen Sand. Über ihm brannte die Sonne Australiens. Das Meer schwappte in gleichmäßigen Wellen auf den Strand. Nur die Alarmsirene störte, die in regelmäßigen Abständen ertönte. Angersbach hatte keine Ahnung, was sie ihm sagen wollte. Hai-Alarm? Oder ein Krokodil?
Widerwillig schlug er die Augen auf und blickte auf eine weiße Zimmerdecke. Neben ihm auf dem Nachttisch erklang erneut der Handywecker.
»Ach.« Ärgerlich streckte Ralph die Hand aus und wischte über das Display. Der Alarmton verstummte. Angersbach rollte sich wieder auf den Rücken und seufzte. Nur ein Traum. Er war gar nicht in Australien.
Ralph schüttelte über sich selbst den Kopf.
Wer hätte gedacht, dass ihm dieses Land so gut gefallen würde? Nach der Hochzeit seiner Halbschwester Janine mit dem Australier Morten hatte er gar nicht wieder zurückgewollt. Und das nicht nur, weil ihm vor dem langen Flug gegraut hatte. Aber irgendwann war der Urlaub zu Ende gewesen.
Ralph hatte Janine versprochen, dass er wiederkommen würde, und er hatte es ernst gemeint. Seine schlimmste Befürchtung war wahr geworden. Janine wollte in Zukunft mit Morten in Australien leben. Doch Angersbach fand die Vorstellung plötzlich gar nicht mehr so schrecklich. Natürlich war es schade, dass Janine nun so weit von ihm entfernt wohnte und sie sich nur noch selten sahen. Aber er freute sich auf weitere Besuche.
Er streckte den Arm zur anderen Seite aus und stellte fest, dass die zweite Hälfte des Doppelbetts leer war. Wieder seufzte er. Er hätte Sabine gerne mit einem Kuss geweckt und sie in den Arm genommen, aber sie war meist viel früher wach als er, auch ohne sich dafür einen Wecker zu stellen. Wenn er aufstand, absolvierte sie schon ihre morgendliche Joggingrunde. Immerhin, auf dem Rückweg brachte sie frische Brötchen mit. Trotzdem hätte er lieber jede einzelne Minute des Tages mit ihr verbracht. Schließlich war es nicht die Regel, dass sie bei ihm war.
Nach wie vor lebte sie in Wiesbaden und arbeitete beim LKA, und zumindest auf absehbare Zeit würde sich daran auch nichts ändern. Zu frisch war ihre Beziehung, zu groß die Angst davor, dass es nicht halten würde. Sie hatten beide schlechte Erfahrungen gemacht, und sie waren keine großen Beziehungskünstler.
Aber im Moment hatte Sabine Urlaub. Eigentlich hatten sie wegfahren wollen. Nicht nach Australien, dafür reichte die Zeit nicht, aber vielleicht in die Eifel oder ins Elsass. Sie hatten schon von lauen Sommerabenden auf einer gemütlichen Terrasse mit einem guten Wein und leckerem Essen geträumt, aber dann hatte sich herausgestellt, dass Ralph arbeiten musste. Es war Sommerzeit, Ferienzeit, und im Präsidium hatten die Kollegen mit Familie und Kindern Vorrang.
Bisher hatte Ralph das nie gestört. Nur in diesem Jahr hätte er es sich anders gewünscht. Im letzten Sommer hatte ihre Beziehung noch in den Kinderschuhen gesteckt, und sie hatten lieber nicht über einen Urlaub zu zweit nachgedacht. Auch deshalb, weil die Reise zu Janines Hochzeit teuer gewesen war. Aber in diesem Sommer …
Angersbach warf die Bettdecke beiseite. Statt mit dem Schicksal zu hadern, sollte er sich lieber an dem freuen, was er hatte. Er ging ins Bad, erledigte seine Morgentoilette und sprang kurz unter die Dusche. Dann setzte er Kaffee auf und deckte den Tisch. Weil Sabine noch nicht zurück war, nahm er sein Smartphone zur Hand und entdeckte, das Janine ihm ein Video geschickt hatte.
»Krasser Scheiß«, hatte sie dazugeschrieben, »was bei euch in Deutschland so abgeht. Ein ganzer Fluss voller Kinderleichen.« Dahinter lachten drei Smileys Tränen.
Angersbach runzelte die Stirn und startete das Video. Es stammte offenbar von einer Drohne, jedenfalls befand sich die Kamera in luftiger Höhe über einem Fluss. Und darin schwammen tatsächlich zahllose nackte Kinder.
Ralph stoppte das Video und machte sich fluchend auf die Suche nach seiner Lesebrille. Er hatte sich das Ding im letzten Jahr schließlich angeschafft, weil er die kleinen Buchstaben einfach nicht mehr entziffern konnte, aber er hasste die Sehhilfe und verlegte sie ständig. Jetzt allerdings sehnte er die Brille dringend herbei.
Während er im Wohnzimmer die Zeitschriftenstapel auf dem Couchtisch beiseiteschob, hörte er die Wohnungstür. Gleich darauf stand Sabine Kaufmann hinter ihm.
Sie trug ein enges pinkfarbenes Top, eine schwarze Sporthose und weiße Laufschuhe. Die halblangen blonden Haare hatte sie am Hinterkopf zusammengebunden. Um den rechten Arm trug sie eine Manschette, in der sich ihr Handy befand. Die passenden Bluetooth-Kopfhörer steckten in ihren Ohren.
»Suchst du was?« Sabine legte ihm die Hände auf die Schultern und küsste ihn. Sie musste sich dazu recken, und Ralph musste sich ein wenig hinunterbeugen.
»Meine Lesebrille«, sagte er, nachdem sie sich von ihm gelöst hatte.
»Da drüben.« Sabine deutete auf das Regal mit dem Holzelefanten. »Vielleicht solltest du dir eine zweite zulegen«, spottete sie. »Damit du etwas siehst, wenn du nach der jeweils anderen suchst.«
»Ha, ha.« Ralph schnappte sich die Brille und ging zurück in die Küche. Er nahm das Handy und startete das Video neu. Sabine trat hinter ihn.
»Was ist das denn?«
»Das hat mir Janine geschickt.«
Sabine beugte sich weiter vor. »Sind das wirklich Kinder?«
Ralph kniff die Augen zusammen. Trotz der Lesebrille war das Bild nicht richtig scharf. »Nein. Das sind Puppen, oder?«
»Stimmt.« Sabine Kaufmann klang erleichtert. Sie nahm Ralph das Handy aus der Hand und textete eine Nachricht an Janine. »Wo ist das? Und wo hast du das her?«
Die Antwort kam binnen Sekunden. »Ffm. Von Jo. Gruß Mo.«
Angersbach verdrehte die Augen. Er wusste nicht mehr, wer diesen Unsinn aufgebracht hatte. Mo und Jo. Vielleicht war es Janine gewesen, vielleicht auch Mortens Freund John. Die beiden hatten zusammen in Berlin Jura studiert. John war ein cooler Surfertyp, einer, zu dem so etwas passte. Aber Janine war auch gerne cool.
Jedenfalls hatte es sich eingebürgert. »Mo« war Janines Ehemann Morten. Und »Jo« war Johann Gründler, Ralphs Vater. Zwei coole Socken. Angersbach war der Einzige in der Familie, der nicht cool war. Zum Glück konnte man »Ralph« nicht abkürzen, und bisher war niemand auf die Idee gekommen, stattdessen seinen Nachnamen zu verhunzen. Das hätte ihm überhaupt nicht gefallen. Sollte jemals irgendjemand »Angie« zu ihm sagen, würde er demjenigen den Hals umdrehen.
Während Ralphs Gedanken abschweiften, tippte Sabine schon wieder auf seinem Handy. »Wo hat Jo das her?«
»KA«, lautete die Antwort von Mo, für den Digital-Dinosaurier Angersbach zusätzlich mit einer Figur versehen, die ihre Arme zu beiden Seiten ausstreckte. »Musst du Janine fragen. Aber die duscht gerade.«
»Thx«, tippte Sabine. Sie gab Ralph das Handy zurück und zog ihr eigenes aus der Armmanschette. Es war neuer, schneller und besser als Ralphs Gerät. Rasch gab sie ein paar Stichworte in das Suchfenster ein und bekam gleich darauf eine ganze Reihe von Ergebnissen.
»Schwerer Unfall am Main« oder Ähnliches titelten die seriösen Online-Zeitungen. Bei den reißerischen Blättern hieß es: »Frankfurt erlebt biblische Plagen« oder »Endzeitstimmung unter der Flößerbrücke«. Die auflagenstärkste Zeitung hatte einen Aufmacher über drei Zeilen in Blutrot: »Jojo, 38, obdachlos: ›Ich dachte, das sind alles Kinderleichen, und dazwischen der gekreuzigte Jesus‹«.
Sabine klickte zurück zu einer seriöseren Berichterstattung.
»In den frühen Morgenstunden verunglückte der Kleintransporter einer Frankfurter Spedition«, las sie den zugehörigen Text vor. »Der Wagen geriet aus bisher ungeklärter Ursache ins Schlingern und kippte um. Aus den aufgesprungenen Türen ergoss sich die Ladung in den Main. Es handelt sich um etwa zweihundert Babypuppen. Der Fahrer wurde aus der Kabine geschleudert und landete mitsamt den Puppen im Wasser. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.«
Kaufmann tippte auf ein Foto und zoomte es groß. »He. Das ist ja Julia!«
Angersbach legte sein Handy auf den Küchentisch und nahm Sabine das Smartphone aus der Hand. Sie hatte recht, die Frau war tatsächlich Julia Durant. »Warum ermittelt die Mordkommission denn bei einem Unfall?«
Ehe Sabine etwas antworten konnte, begann sein Handy zu klingeln. Angersbach tippte auf den grünen Hörer. »Ja?«
»Bayer, KDD«, meldete sich eine weibliche Stimme am anderen Ende. Ralph kannte sie nicht. Die Kollegen beim Kriminaldauerdienst wechselten häufig, und Angersbach hatte meist nur am Anfang einer Ermittlung mit ihnen zu tun.
»Was gibt es?«
»Eine Leiche in einem Fluss.«
Ralph blinzelte und schaute auf Sabines Smartphone, das er immer noch in der Hand hielt. Hatten die Zeitungen nicht etwas von Verletzungen und einem Transport ins Krankenhaus geschrieben? »Ich dachte, der Mann hat überlebt?«
»Äh.« Die Kollegin vom KDD war verwirrt. »Hier steht, er ist tot.«
»Okay.« Also doch ein Mord? Das würde erklären, weshalb Julia Durant vor Ort war. Aber warum informierte man ihn? Der Transporter war in Frankfurt verunglückt, und bei Tötungsdelikten galt das Tatortprinzip. Selbst wenn der Tote aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen stammte, war Ralph nicht zuständig. Vielleicht gab es ein Amtshilfeersuchen, weil jemand aus Gießen oder den umliegenden Gemeinden befragt werden sollte?
»Das muss eine fürchterliche Sauerei sein«, sagte die Kollegin. »Das ganze Blut im Wasser. Ich hoffe bloß, da schwimmen nicht noch mehr Tote. Ein einziger Mann kann doch gar nicht so viel Blut verlieren.«
Ralph hatte das deutliche Gefühl, den Faden verloren zu haben.
»Entschuldigung. Können wir noch mal von vorn anfangen? Über welchen Toten reden wir? Wo wurde er gefunden? Und was ist das mit dem vielen Blut?«
»Habe ich das nicht gesagt? Verzeihung. Ich bin neu hier.« Die Kollegin räusperte sich. »Also. Heute Morgen wurde in Bad Vilbel eine tote männliche Person in der Nidda entdeckt, ganz in der Nähe eines Seniorenzentrums. Die Meldung kam von einem Lokführer der S-Bahn. Er musste einen Nothalt einlegen, weil eine verwirrte Seniorin auf den Schienen stand. Sie hat behauptet, einen toten Mann im Fluss gesehen zu haben, der in seinem eigenen Blut schwimmt. Die Pflegerin dachte, die alte Frau hätte sich das nur eingebildet, aber der Lokführer hat trotzdem nachgesehen. Und da war dann wirklich eine Leiche.«
Ralph fühlte sich ebenfalls verwirrt. Er spulte die Routinen ab, damit die Kollegin es nicht bemerkte. »Spurensicherung und Rechtsmedizin sind informiert?«
»Ja. Schon auf dem Weg.«
»Gut. Wir kommen.« Angersbach beendete das Gespräch und drehte sich zu Sabine um, die hinter ihn getreten war.
»Wohin?«
»Nach Bad Vilbel. Da treibt eine männliche Leiche in der Nidda. In ihrem eigenen Blut.« Er gab Sabine das Smartphone zurück und steckte sein eigenes Handy ein.
»Ach. Arbeit«, seufzte Sabine.
Angersbach, der die Hand schon nach den Wagenschlüsseln ausgestreckt hatte, hielt in der Bewegung inne. Er hatte tatsächlich vergessen, dass sie ja gar nicht gemeinsam ermitteln konnten. Das war sein Fall, Sabine und er gehörten nicht mehr zur Mordkommission Bad Vilbel. Sie war jetzt beim LKA, und er musste daher einen Kollegen aus dem Gießener Präsidium mitnehmen. Dazu hatte er allerdings überhaupt keine Lust, und der Kommissariatsleiter würde es ihm nicht übel nehmen, wenn er die Sache allein erledigte. Auch außerhalb der Ferien herrschte Personalnotstand. Alle hatten bereits mehr als genug zu tun. Und momentan war ohnehin kaum jemand da.
»Willst du mitfahren?«, fragte er.
Sabine zauderte. »Das ist nicht mein Revier. Ich habe da nichts verloren.«
»Du könntest ja im Wagen warten. Oder in deiner alten Heimat einen Kaffee trinken gehen. Dann hätten wir wenigstens die Fahrt für uns.« Es widerstrebte Ralph, auf die wenige gemeinsame Zeit zu verzichten, die ihnen noch blieb, bis Sabines Urlaub vorbei war.
»Okay.« Ein Lächeln erschien auf Sabines Gesicht. »Ich springe nur rasch unter die Dusche und ziehe mich um.«
6
Sabine Kaufmann schaute aus dem Wagenfenster auf die vorüberziehende Landschaft. Sanfte Hügel, grüne Wälder, Wiesen und Felder. Das Getreide stand hoch. Überall waren die riesigen Erntemaschinen mit ihren breiten Schneidwerken zu sehen, die Schneisen in die Reihen der reifen Pflanzen schlugen, eingehüllt in dichte Wolken gelben Staubs. Traktoren mit Anhängern bevölkerten die Straße, hoch beladen mit Korn. Angersbach, der das mobile Blaulicht aufs Wagendach geklemmt hatte, fluchte ausgiebig, während er ein ums andere Mal zum Überholen ansetzte.
Kaufmann lächelte versonnen. Ausgerechnet Bad Vilbel. Hier hatte damals alles angefangen. Sie hatte sich vom Frankfurter Morddezernat zur Dezentralen Ermittlungsgruppe nach Bad Vilbel versetzen lassen, um bei ihrer Mutter zu wohnen, die an Schizophrenie erkrankt war. Ralph war ebenfalls nach Bad Vilbel gewechselt, weil er nach dem Tod seiner Mutter nicht nur deren Haus in Okarben, sondern auch seine Halbschwester Janine »geerbt« hatte, um die er sich kümmern musste. Damals war Janine noch keine engagierte Sozialpädagogikstudentin gewesen, verheiratet mit einem netten australischen Anwalt, sondern eine jugendliche Rebellin, die beinahe wegen ein paar Drogenexperimenten in ernste Schwierigkeiten geraten wäre. Ralph und Sabine hatten sie in letzter Sekunde davor bewahrt, im Rahmen einer Razzia verhaftet zu werden. Sabine hatte gerne geholfen, obwohl Angersbach und sie damals nicht die besten Freunde gewesen waren.
Sie lachte leise in sich hinein. Ralph Angersbach. Der alte Stoffel. Starrköpfig, unnachgiebeig und immer mit dem Feingefühl einer Dampfwalze unterwegs. Ein komischer Typ, hatte sie damals gedacht, mit seinem Wettergesicht, der Wuschelfrisur und der abgewetzten Jacke. Und diesem Ungetüm von einem Wagen. Ein Lada Niva, schon damals in die Jahre gekommen, dunkelgrün und mit der schlechtesten Federung, die Sabine je erlebt hatte. Von den Unmengen an Diesel, die er schluckte, und den tiefschwarzen Rußwolken, die er ungefiltert absonderte, gar nicht zu reden.
Kaufmann hatte sich damals gerade ihr erstes Elektroauto angeschafft, einen Renault Twizy. Ein Zweisitzer, klimaschonend und platzsparend. Ein Spielzeugauto in Ralphs Augen, der an Spott nicht gespart hatte. Die beiden Autos waren jahrelang ihr bevorzugtes Streitthema gewesen. Und nun saß sie erneut in diesem Lada Niva, der gerade knapp dem Todesurteil durch den TÜV entgangen war, und fühlte sich pudelwohl. Nicht, weil die Federung mittlerweile besser geworden wäre. Man spürte immer noch jedes Schlagloch, und Angersbach fuhr nach wie vor ruppig. Aber es störte sie nicht mehr. Weil Ralph neben ihr saß, den sie heute mit anderen Augen sah und der eine neue Rolle in ihrem Leben spielte. Der grobe Klotz war gar nicht so grob, wie er sich gab. Das war nur seine Angst davor, verletzt zu werden. Als Heimkind hatte er diesbezüglich schlechte Erfahrungen gemacht. Tief im Inneren war er ein sanfter Riese. Ein Fels in der Brandung, bei dem sie sich geborgen fühlte. Mehr, als sie es je zuvor bei einem Mann erlebt hatte.
Ralph bog um die nächste Kurve, und Sabine wurde jäh von einer anderen Erinnerung eingeholt. Unweit von hier stand das Sühnekreuz. Der Ort, an dem man ihre Mutter erhängt an einem Baum gefunden hatte. Das war jetzt fünf Jahre her, aber der Schmerz steckte immer noch wie ein Stachel in ihrer Seele. Nach wie vor hatte sie es nicht geschafft, sich wirklich mit dem Tod ihrer Mutter auseinanderzusetzen, und sie würde es auch heute nicht tun. Sie hatte sich nach Wiesbaden zum LKA versetzen lassen, um der Erinnerung zu entgehen. Ein wenig hatte der Abstand geholfen. Doch von allein würden die Dämonen der Vergangenheit nicht weichen, das wusste sie.
Angersbach warf ihr einen kurzen Blick zu. »Alles okay?«
»Hm. Ich habe nur gerade an Hedi gedacht.«
Ralph schaltete etwas zu ruppig in einen höheren Gang und gab einen unverständlichen Laut von sich. Sanfter Riese hin oder her, über Gefühle zu reden zählte nach wie vor nicht zu seinen Stärken.
»Das war eine schlimme Sache damals«, brachte er schließlich heraus.
»Ja.« Kaufmann, die ebenfalls nicht weiter darüber grübeln wollte, schob den Gedanken beiseite. Sie näherten sich dem Ortseingang von Bad Vilbel.
Ralph Angersbach drosselte das Tempo und setzte den Blinker.
Er hatte Okarben und Kloppenheim hinter sich gelassen, war über die hochgelegenene B3 gefahren. Rechter Hand Felder und am Horizont der Taunus, linker Hand Dortelweil. Dann ein Blick in die Senke, wo die Nidda floss. Eine rote S-Bahn kroch vorbei. Vor ihnen zeichnete sich die Skyline Frankfurts ab.
Er nahm die Ausfahrt Massenheim. Passierte den ersten Kreisel, auf dem ein grau-rotes Mahlwerk stand. Eine Erinnerung an die Industrie der Stadt, ebenso wie der übernächste Kreisel, auf dem man ein Stück des gesprengten Schornsteins der alten Ziegelei wiederaufgebaut hatte. Die Gegend war ihm vertraut, er war diese Strecke schon so oft gefahren. Und doch veränderte Bad Vilbel sich. Er wollte den Blinker setzen, den Kreisel in Richtung Riedweg verlassen, wo auch die Polizeistation war.
»Geradeaus«, sagte Sabine und deutete auf die Unterführung der Bahnlinie.
Er folgte ihr, wenn auch ein wenig irritiert. »Aber das ist doch falsch«, sagte er, als sie ihn auf der anderen Seite rechts in die Baustelle leitete. Am Bahndamm wurden Bäume gefällt. Überall rot-weiße Absperrungen. Ampeln regelten den Verkehrsfluss. Schotterberge und eine blaue Schutzwand, die entlang der Gleisanlagen führte. Ralph erinnerte sich, von den umfassenden Bauarbeiten an der Strecke gehört zu haben.
»Am nächsten Kreisel fährst du raus in Richtung Südbahnhof.«
Er schüttelte den Kopf. »Da kommen wir aber nicht rüber, höchstens zu Fuß. Die Nidda ist auf der anderen Seite.«
Sabine lachte auf. »Aber der Heilsberg ist hier. Vertrau mir, ich habe da schließlich gewohnt. Ein paarmal zickzack noch und wir sind direkt da.«
»Hmpf.« Er wollte nicht streiten, auch wenn er sich im Recht fühlte.
Er bog scharf nach links in den Berkersheimer Weg. Eine enge Einbahnstraße. Links Häuser, rechts Schrebergärten. Dann eine Baustelle und kein Weiterkommen. »Toll. Und jetzt?«
Er sah, dass auch Sabine ins Stocken geriet. Sie deutete nach vorn. »Wir sind die Polizei. Wir dürfen da durch. Ich weiß genau, dass es hier eine kleine Unterführung gibt.«
Der Lada machte einen Hüpfer, Ralph kurvte durch den abgesperrten Bereich. Keiner schien sich daran zu stören, niemand sprang ihnen wütend gestikulierend vor die Motorhaube. Dann ließen sie die Häuser hinter sich. Der Weg wurde schlechter, aber folgte immer noch den Gleisen. Vielleicht hatte sie ja doch recht. Sie hatte hier gelebt, während er nur ein Gast gewesen war.
»Da drüben ist die Nidda!«, verkündete sie.
Ralph erkannte nur die Oberleitungen. Es war mittlerweile ein Feldweg, den sie entlangrumpelten. Überall Schotterberge und Baumaschinen.
»Lass uns umdrehen«, presste Ralph hervor. Die Straße stieg an, plötzlich war sie so hoch, dass man über die Bahnschienen ans Ufer blicken konnte. Rot-weißes Flatterband, uniformierte Polizeibeamte, Feuerwehrleute, Rettungskräfte und weiß gekleidete Spurentechniker. Zwei Streifenwagen, ein RTW, zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, die Busse der Kriminaltechnik, einige Zivilfahrzeuge und ein Leichenwagen parkten aufgereiht am Straßenrand.
»Siehst du.« Sabine atmete auf. »Manchmal muss man einfach vertrauen. Da vorne rechts runter.«
Durch tief ausgefahrene Furchen polterten sie in Richtung der Bahn. Zahlreiche Schilder gemahnten, unbefugtes Parken auf Privatgelände zu unterlassen. Das Betreten war ebenfalls untersagt. Doch Ralph hatte eine ganz andere Sorge. Der Weg endete abrupt an einer Leitplanke. Dahinter vier Paar Schienen. Wenigstens gab es keine Schutzwand mehr. Die Fahrzeuge und Kollegen waren zum Greifen nah und doch unerreichbar.
»Na toll«, knurrte er. Doch Sabine war längst aus dem Lada gesprungen. Sie sah nach links und dann nach rechts. Er stieg ebenfalls aus und schnappte nach Luft.
»Bist du lebensmüde? Du willst doch nicht ernsthaft …«
»Komm schon. Man kann ewig weit schauen, und da kommt nirgendwo ein Zug. Die Kollegen warten auf uns.«
Wären sie über den Riedweg gefahren, würde auch keiner mehr auf sie warten, dachte Ralph verbissen. Doch er sagte nur: »Du bist echt verrückt.«
»Genau das magst du doch an mir.«
Schon war Sabine Kaufmann über die Absperrung geklettert und hüpfte in großen Schritten über das Schotterbett. Ralph Angersbach prüfte noch einmal beide Seiten, dann tat er es ihr gleich.
»Das glaubt einem kein Mensch«, keuchte er, als sie sich den Fahrzeugen näherten.
»Ist ja nicht unser erstes Mal«, zwinkerte sie und stupste ihn in die Rippen. Er erinnerte sich. Das war Jahre her. Und keine schöne Erinnerung. Deshalb konzentrierte er sich auf die Gegenwart. Sie erreichten den knallroten SUV, den sich Wilhelm Hack vor zwei Jahren zugelegt hatte. Weil ihm sein Rücken Schwierigkeiten bereitete, hatte er sich für ein Fahrzeug mit hohem Einstieg und bequemer Sitzposition entschieden, obwohl er diese Schlachtschiffe eigentlich verabscheute. Doch man musste eben Kompromisse machen. In diesem Fall war die Entscheidung gegen die Umwelt und für die Erhaltung seiner Arbeitsfähigkeit gefallen.
»Wow. Jeder hier, der Rang und Namen hat«, stellte Sabine fest.
»Hm.« Angersbach, der größere Menschenansammlungen nicht mochte, zögerte, und er glaubte, auch bei Sabine einen plötzlichen Zweifel zu erkennen. Formal betrachtet hatte sie hier nichts verloren. Aber Ralph wusste, dass sie es liebte, vor Ort zu sein. Im LKA saß sie viel zu oft am Schreibtisch, brütete über Papieren und Ermittlungsakten und schrieb Berichte. Die Arbeit auf der Straße fehlte ihr. Sie hatte schon des Öfteren über einen erneuten Dienststellenwechsel nachgedacht, sich bisher aber nicht dazu durchringen können.
Sabine zauderte. »Vielleicht sollte ich wirklich im Wagen warten?«
Sie wussten beide, dass er das nur vorgeschlagen hatte, damit sie überhaupt mitkam. Die Frage stellte sich allerdings tatsächlich. Aber Ralph wollte, dass sie ihn begleitete.
»Niemand wird etwas dagegen haben«, argumentierte er. »Die Kollegen werden sich freuen, dich zu sehen.«
Schließlich war man immer gut miteinander ausgekommen. Und Konrad Möbs, der damalige Dienststellenleiter, der ihnen ständig Steine in den Weg gelegt hatte, war schon lange nicht mehr im Amt.
»Okay.« Die beiden gingen auf die Absperrung zu. Als Sabine die Zivilpolizistin erkannte, die neben dem rot-weißen Flatterband stand und sich Notizen machte, ging ein Leuchten über ihr Gesicht. »Petra!«
Die Beamtin hob den Kopf. »Sabine! Was tust du denn hier?« Ihr Blick ging weiter zu Angersbach. »Hallo, Ralph. Mit dir habe ich gerechnet.« Sie wandte sich wieder an Kaufmann. »Aber ich hab gedacht, du wärst beim LKA in Wiesbaden?«
»Das stimmt schon. Ich war nur zufällig in Gießen.«
»Aha?« Petra Wielandt grinste. Sie war nie eine Frau gewesen, der man etwas vormachen konnte. »Dann habt ihr euch endlich gefunden?«
»Ja.« Sabine lächelte.
»Schön. Hat ja lange genug gedauert.« Petra zwinkerte Angersbach zu. »Aus verschiedenen Gründen.«
Es war, als hätte ihm jemand eine Faust in den Magen gerammt. Diese unschöne Episode hatte er doch tatsächlich komplett aus seinem Gedächtnis verbannt. Die Kollegin, die so offensiv mit ihm geflirtet hatte. Und er …
»Ist sie noch hier?«, fragte er und fand, dass er ein wenig wie ein Schüler klang, der eine Aufgabe an der Tafel vorrechnen sollte.
»Nein.« Petra fuhr sich durch die kurzen dunklen Haare. »Für Cordula war das hier nur eine Durchgangsstation. Sie wollte Karriere machen. Mittlerweile ist sie bei Interpol.«
»Alle Achtung«, sagte Sabine, während Ralph ein Stein vom Herzen fiel. Eine erneute Begegnung mit Cordula Scherer wäre ihm alles andere als recht gewesen.
»Kannst du uns kurz ins Bild setzen?«, bat er. Sie waren schließlich nicht ohne Grund hier. Für das Private konnte man sich später Zeit nehmen.
Petra Wielandt konsultierte ihr dickes, in Leder gebundenes Notizbuch. »Viel wissen wir noch nicht. Heute Morgen gegen fünf Uhr dreißig hat die Altenpflegerin Nadine Engel bei der Medikamentenausgabe festgestellt, dass eine der Bewohnerinnen des Altenzentrums verschwunden war. Roswitha Rösler, dreiundachtzig Jahre alt. Sie leidet an Demenz. Frau Engel ist sie suchen gegangen und hat sie auf dem Bahndamm entdeckt. Frau Rösler wäre beinahe von der S-Bahn erfasst worden, ist aber mit dem Schrecken davongekommen.« Wielandt blätterte weiter, während Ralph Sabine einen vielsagenden Blick zuwarf. »Sie hat der Pflegerin gesagt, dass in der Nidda eine männliche Leiche treibt, aber Frau Engel hat das für eine Fantasie gehalten. Der Lokführer der S-Bahn hat nachgesehen und den Toten entdeckt. Die Identität des Mannes ist noch nicht geklärt. Er hatte nichts bei sich, weder Handy noch Papiere.«
Vom Fluss her kamen zwei weiß gekleidete Gestalten auf sie zu. Sie tauchten unter dem Flatterband durch und nahmen die Kapuzen ab.
»Sabine! Ralph!«, tönte Mirco Weitzel.
Angersbach verspürte einen Stich. Er hatte lange geglaubt, Weitzel hätte ein Auge auf Sabine geworfen, bis sich irgendwann herausstellte, dass Mircos Herz längst an eine andere vergeben war. Aber war es das immer noch? Oder war der Kollege wieder auf der Pirsch?
Weitzel war gut zehn Jahre jünger als Ralph, also etwa in Sabines Alter. Durchtrainiert, mit kurz geschnittenem, sorgfältig gestyltem und beneidenswert dichtem blonden Haar, dazu mit einem charmanten Lächeln. Das Gefühl, nicht mithalten zu können, war sofort wieder da, und das, obwohl Ralph seit mehr als einem Jahr fest mit Sabine liiert war. Als müsste Mirco Weitzel nur mit dem Finger schnipsen, und sie würde auf der Stelle zu ihm überlaufen. Dabei hatte sie sich nie für Weitzel interessiert. Die beiden waren einfach Freunde gewesen. Aber Angersbachs Ängste saßen tief. Er war zu oft von Frauen enttäuscht worden, um so etwas wie Sicherheit zu empfinden.
Sabine begrüßte Mirco und seinen Kollegen. Angersbach brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, dass er ihn ebenfalls kannte. Levin Queckbörner war gleich nach der Polizeischule nach Bad Vilbel gekommen und hatte seine ersten praktischen Erfahrungen bei der Mordserie auf dem Vilbeler Markt gemacht. Es war einer dieser Fälle gewesen, die tiefe Wunden geschlagen und Narben hinterlassen hatten, bei Sabine und Ralph ebenso wie bei den Vilbeler Kollegen.
Damals war Levin ein etwas unbeholfener junger Mann mit rundem Gesicht und spärlichem Bartwuchs gewesen. Nur seine tiefe Bassstimme hatte Ralph schon damals beeindruckt. Mittlerweile hatte Queckbörner seinen Babyspeck verloren. Er wirkte ebenso durchtrainiert wie Weitzel, sein Auftreten selbstbewusst.
»Mirco. Levin.« Angersbach hob knapp die Hand zum Gruß.
»Wollt ihr euch den Toten ansehen?« Weitzel angelte zwei Tyvek-Anzüge aus einer Kiste und hielt sie Ralph und Sabine hin.
Angersbach konnte die Dinger nicht leiden, aber da es sein Fall war, blieb ihm keine Wahl. Sie kleideten sich ein und ergänzten das Outfit mit Überziehern für die Schuhe und Handschuhen. Dann setzten alle vier die Kapuze auf und tauchten einer nach dem anderen unter dem Flatterband durch. Petra Wielandt blieb an der Absperrung zurück.
Der Tote lag im feuchten Gras im Uferbereich. Im niedrigen und träge dahinfließenden Wasser der Nidda sah Angersbach dicke rote Schlieren. Jetzt verstand er, was die Frau vom KDD gemeint hatte. Konnte so viel Blut tatsächlich von einer einzigen Leiche stammen? Und weshalb schien immer neues Blut von oberhalb der Fundstelle nachzukommen? Aber mit der Frage konnte er sich später beschäftigen. Zuerst musste er sich den Toten ansehen.