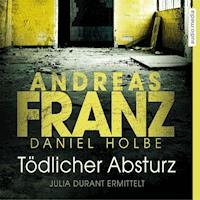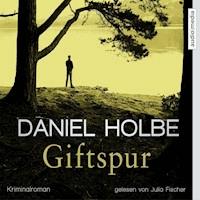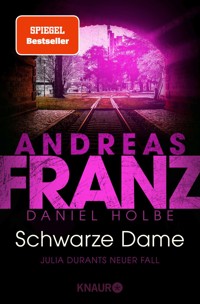9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Sabine-Kaufmann-Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Krimi »Strahlentod« kommt es zu mehreren Morden im Umfeld von Anti-Atommüll-Protesten in Hessen – Fall 6 für Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach! Während einer Protestaktion gegen Atommüll-Transporte im hessischen Knüllwald explodiert ein alter VW-Camper. Ralph Angersbach ist geschockt, als er den Tatort erreicht: Der völlig zerstörte Wagen kann nur seinem Vater gehört haben, einem Alt-Hippie – und auf dem Fahrersitz befindet sich eine verkohlte Leiche. Hat es jemand auf die Familie des Kommissars abgesehen? Oder ist der immer hitziger werdende Streit zwischen Befürwortern und Gegnern der Endlagersuche endgültig eskaliert? Ein weiterer brutaler Mord führt Ralph Angersbach und Sabine Kaufmann zurück in die Vergangenheit … Im 6. Teil der Krimi-Reihe mit Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach lassen die Bestseller-Autoren Daniel Holbe und Ben Tomasson nicht nur den Atommüll zu einem giftigen Problem für ihre Kommissare werden. Die Krimi-Reihe aus Hessen umfasst folgende Bände: 1. »Giftspur« 2. »Schwarzer Mann« 3. »Sühnekreuz« 4. »Totengericht« 5. »Blutreigen«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Daniel Holbe / Ben Tomasson
Strahlentod
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Während einer Protestaktion gegen Atommülltransporte im hessischen Knüllwald explodiert ein alter VW-Camper. Ralph Angersbach ist geschockt, als er den Tatort erreicht: Der völlig zerstörte Wagen kann nur seinem Vater gehört haben, einem Alt-Hippie – und auf dem Fahrersitz befindet sich eine verkohlte Leiche. Hat es jemand auf die Familie des Kommissars abgesehen? Oder ist der immer hitziger werdende Streit zwischen Befürwortern und Gegnern der Endlagersuche endgültig eskaliert? Ein weiterer brutaler Mord führt Ralph Angersbach und Sabine Kaufmann zurück in die Vergangenheit …
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Danksagung
Ogfanga hat des ja alles 68
Woaßt as no
Alle zwoa san ma mitglaffa
Für die Freiheit und fürn Friedn
Mit große Augn
Und plärrt habn ma
Bürger laßt das Glotzen sein
Kommt herunter
Reiht euch ein
Und du warst halt immer
Oan Dreh weiter wia mir
Immer a bisserl wuider
Und a bisserl ehrlicher
Konstantin Wecker, »Willy«
Er hasste diese Einsätze.
Dafür war er nicht zur Polizei gegangen. Er wollte gegen Verbrecher vorgehen und für Gerechtigkeit sorgen, nicht auf jene einprügeln, die im Grunde das Richtige taten.
Eine Wahl hatte er nicht. Als Frischling wurde man dazu verdonnert. Die schwere Schutzausrüstung, die wie eine mit Blei gefüllte Jacke an ihm hing, der Helm mit dem Visier, der Schutzschild und der Schlagstock. Die Fahrt mit dem Mannschaftsbus, rasant über die Autobahn, holperig auf den Forstwegen, die zum Einsatzort führten. Über ihnen das Rattern der Rotoren. Von oben sah die Kolonne vermutlich aus wie eine Prozession blau-silberner Ameisen.
Ein harter Schlag, dann stoppte der Wagen. Der Truppenführer sprang hinaus, die anderen folgten.
Weicher Waldboden unter seinen Stiefelsohlen, hohe Tannen, Nebel, der in dicken Schwaden zwischen den Stämmen waberte. Man sah kaum die Hand vor Augen.
Aufstellen in Reih und Glied, der gebellte Marschbefehl.
Vorrücken.
Sie stolperten einen mit vorstehenden Wurzeln übersäten Weg entlang. Einmal wäre er beinahe gestürzt. Im letzten Moment erwischte ihn Harald an der Schulter und hielt ihn fest. Der Kollege lachte dröhnend.
Harald und Ulf hatten sich selbstverständlich freiwillig gemeldet. Sie waren gern dabei, wenn die Systemzersetzer, wie sie sie nannten, aufgemischt wurden.
Aaron war froh darüber. Harald und Ulf hatten ihn unter die Fittiche genommen in der Polizeistation. In ihrer Gegenwart fühlte er sich sicher.
Klar, am Anfang hatten sie ihn gepiesackt und die üblichen Gemeinheiten durchgezogen. Initiationsriten. Egal, bei welcher Truppe man war, ohne ging es nicht. Aaron hatte gute Miene zum bösen Spiel gemacht: Als sie ihn in voller Montur unter die kalte Dusche gestellt hatten. Beim Trinkspiel mit den Streichhölzern, von denen er natürlich immer das kürzere zog, bis er einfach vom Stuhl gekippt war. Bei dem vorgetäuschten Einsatz, zu dem sie ihn allein losschickten, mit dem Streifenwagen, bei dem die Tankanzeige kaputt war. Fast zwanzig Kilometer war er gelaufen, um einen Kanister Sprit zu besorgen.
Dass er nicht die Kollegen angefunkt und um Hilfe gebettelt hatte, hatte ihm Respekt eingebracht. Danach war Schluss gewesen mit dem Drangsalieren. Aaron gehörte jetzt dazu, und Harald und Ulf waren seine Mentoren.
Die beiden kannten einander schon lange, waren Kollegen, Freunde und außerdem verschwägert. Ulf war mit Haralds Schwester verheiratet. Mittlerweile hatten sie ihn ein paarmal eingeladen. Aaron fühlte sich fast schon wie ein Teil der Familie.
Der Boden unter seinen Füßen wurde immer matschiger, zum Nebel gesellte sich ein feiner Nieselregen. Der dichte Wald lichtete sich. Aaron sah die Schneise.
Dort verliefen die Schienen. Nach Bad Hersfeld im Norden, nach Fulda im Süden.
Es war nur eine der möglichen Strecken und vermutlich nicht die, auf der die Wagen mit den klobigen Containern rollen würden. Doch ausschließen konnte man es nicht.
Aus dem Nebel drangen jetzt Stimmen zu ihnen. Aufgeregt. Angespannt. Entschlossen. In einiger Entfernung schälten sich die ersten Silhouetten heraus.
Es waren mehr, als er angenommen hatte. Die Gegner waren deutlich in der Überzahl.
Die Polizisten formierten sich. Aaron klappte sein Visier hinunter, hob den Schild vor den Körper und umklammerte den Schlagstock. Dann marschierten sie in geschlossener Reihe auf die Gruppe zu.
Seine Kehle war trocken, er konnte kaum schlucken. Sein Puls raste. Er schwitzte unter der dicken Montur. Seine Augen brannten. Er hatte Mühe, durch das feuchte und beschlagene Visier überhaupt etwas zu sehen.
Doch je näher sie kamen, desto besser konnte er die Demonstranten erkennen. Sie trugen die übliche Uniform des Widerstands, Parkas und Palästinensertücher, Jeans und bunte Regenjacken, selbst gestrickte Pullover und Wollmützen, schwarze Hoodies und Basecaps. Aaron sah viele Männer mit langen Haaren und zotteligen Bärten.
Die Demonstranten hatten eine Kette gebildet und Hindernisse aus bunten Kartons, umgestürzten Baumstämmen und Steinen auf dem Gleis aufgetürmt. Sie hatten Schilder und Banner dabei und schwenkten Fahnen.
Atomkraft? Nein danke!
Behaltet euren Müll!
Gegen Castor.
Der Staffelführer gab das Signal zum Anhalten. Er schaltete sein Megafon ein.
»Sie befinden sich auf Bahngelände. Verlassen Sie diesen Bereich umgehend! Andernfalls müssen wir Sie festnehmen.«
Als Reaktion bekam er Gelächter und wütende Rufe.
Aaron lauschte. In der Ferne meinte er das Geräusch eines sich nähernden Zugs zu hören. Würden die Castor-Behälter tatsächlich diesen Streckenabschnitt passieren?
Der Staffelführer hob die Hand und wies nach vorn. Die Demonstranten würden nicht freiwillig weichen, das war allen Beteiligten klar. Wenn sie die Strecke rechtzeitig räumen wollten, mussten sie schnell und konsequent vorgehen.
Aaron setzte sich in Marsch, genau wie alle anderen. Er schaltete seine Gefühle ab. Die Protestierenden hatten recht, man durfte diese Atommüll-Transporte nicht einfach hinnehmen. Aber jetzt war er im Dienst, und seine private Meinung hatte hinter der Pflicht zurückzustehen.
Die Demonstranten wichen nicht zurück. Sie hielten sich an den Händen und sahen der vorrückenden Staatsmacht finster entgegen.
Aus einem Gebüsch schoss plötzlich ein Tier hervor, ein Marder, vielleicht auch ein Iltis, und geriet Ulf, der neben ihm ging, vor die Füße. Der Kollege strauchelte, verlor seine Linie und kollidierte mit einem Baum.
Ulf Schleenbecker fluchte und nahm den Helm vom Kopf. Das Visier hatte sich verbogen und saß schief.
Aaron durchfuhr ein heißer Schreck.
»Ulf! Setz den Helm wieder auf.«
Der Kollege lachte ihn an. Er war groß, stark und selbstbewusst. Dunkle Augen, markantes Kinn und ein Dreitagebart, der seine Männlichkeit unterstrich.
»Nun mach dir mal nicht ins Hemd, Kleiner«, spottete er.
Aaron wollte das Grinsen erwidern, doch im selben Moment bemerkte er aus dem Augenwinkel, wie einer der Demonstranten den Arm hob. Eine schnelle, aggressive Bewegung, dann flog ein Stein.
Es war ein Volltreffer, genau an die Schläfe. Ulf Schleenbecker fiel wie ein gefällter Baum.
Sein Schwager Harald Faust war sofort bei ihm. »Ich kümmere mich um ihn.«
Er zog den Getroffenen zwischen die Bäume.
Der Staffelführer ballte die behandschuhte Faust. »Holt euch das Schwein!«
Aaron rannte los, genau wie die anderen. Das Blut in seinen Adern kochte.
Den Protest gegen Castor fand er richtig, aber Gewalt gegen die Beamten, die nur ihre Pflicht taten, war ein Verbrechen.
Er war bei den Ersten, die den Mann erreichten, umfasste seinen Schlagstock fester und schlug wütend zu. Der Steinewerfer schrie auf. Ein Kollege drehte ihm die Arme auf den Rücken, zwang ihn erst auf die Knie, dann zu Boden. Ein anderer versetzte ihm einen Hieb in die Nierengegend.
Aaron wollte ebenfalls noch einmal zuschlagen, doch dann fiel sein Blick auf den Jungen, der danebenstand und die Szene beobachtete. Schmal und blond, mit langen Haaren, die ihm in die Stirn fielen, acht oder neun Jahre alt vermutlich. Er schaute auf die Polizisten, die den Mann auf dem Boden festnagelten und Plastikhandschellen um seine Handgelenke festzogen, so stramm, dass sie tief ins Fleisch schnitten. Seine blauen Augen waren weit aufgerissen, sein Blick war fassungslos. Er streckte die Hand aus, ohne jemanden zu berühren. Eine Träne rann ihm über die Wange, und Aaron hörte das Wort, das er leise sagte.
Papa.
1
Seit Tagen hingen graue Wolken wie eine schmutzige Decke über der Stadt. Ab und an regnete es, aber der Himmel riss nicht auf. Die Luft war feucht, nicht eisig kalt, jedoch auch nicht warm genug, um angenehm zu sein. Die Menschen hasteten mit gesenkten Köpfen durch die Straßen, die Basecaps und Kapuzen tief ins Gesicht gezogen.
Es dämmerte bereits. Die Straßenlaternen gingen an und warfen verzerrte Schattenbilder aufs Pflaster. Trostlosigkeit breitete sich in ihr aus. Sie sehnte sich nach Sonne, nach Licht, nach Wärme. Wie schön wäre es, den Winter auf der anderen Erdhalbkugel zu verbringen. Aber sie hatte ihren Job. Sie konnte nicht einfach weg. Ihre Jungs brauchten sie.
Heute war es besonders schlimm gewesen. Es hatte Entlassungen gegeben. Für die, die zurückblieben, war es hart. Eine neue Rangordnung musste gefunden, neue Bündnisse mussten geschmiedet werden. Der Respekt, den man ihr gewöhnlich entgegenbrachte, blieb da manchmal auf der Strecke. Heute war sie nicht die allseits geschätzte Sozialarbeiterin gewesen, sondern nur die Projektionsfläche für widerliche Phantasien, ausgedrückt in einem Vokabular, das sie ihrem Verlobten nicht würde wiedergeben können. Zu unaussprechlich waren die Dinge, die die Jungs mit ihr anstellen wollten, wenn sie sie in einer dunklen Ecke in die Finger bekamen.
Zum Glück war das nicht möglich.
Trotzdem empfand sie plötzlich ein Unbehagen, das sie sich nicht erklären konnte.
Sie stoppte ihr Fahrrad an der Einmündung zum Skatepark und wandte sich um. Ein Stück hinter ihr war eine Gestalt zu sehen, dunkel gekleidet, mit Jeans und einem Kapuzenpulli, wie ihn viele hier im Viertel trugen. Kreuzberg, ihr Kiez, war einer der Stadtteile, in denen vorwiegend Alternative, Studenten und Migranten lebten. Normalerweise mochte sie das. Doch heute hätte sie sich die Sicherheit einer gediegenen Wohngegend gewünscht.
Sei nicht albern, schalt sie sich selbst. Der Typ war harmlos. Nur Spießer fürchteten sich vor jungen Männern mit dunklen Bärten, Rastalocken oder zerrissenen Jeans.
Trotzdem überlegte sie, den längeren Weg über den Columbiadamm und die Hermannstraße in Kauf zu nehmen statt der Abkürzung durch die Hasenheide. Aber sie wollte nach Hause, und der Umweg würde sie bestimmt zehn Minuten kosten. Der Mann hinter ihr war außerdem zu Fuß und würde sie nicht einholen können. Entschlossen lenkte sie ihr Rad in den Park und trat in die Pedale.
Sie passierte die Hasenschänke, das Freiluftkino und den Spielplatz. In Gedanken betrat sie bereits den schmalen Flur ihrer WG und ging direkt in die Küche. Morten und John würden bereits da sein. Morten würde am Herd stehen und etwas Leckeres kochen, während John auf einem der Stühle saß, die Füße auf einen zweiten gelegt, und in der Zeitung blätterte, aus der er Morten die interessanten Passagen vorlas. John war zwar faul, aber so charmant, dass man ihm nicht böse sein konnte. Außerdem sah er blendend aus. Trotzdem hatte Janine sich nicht in ihn, sondern in Morten verliebt. Ein warmherziger, freundlicher Mann, der nicht nur kochen, sondern auch zuhören und sich einfühlen konnte. Für Janine, die unter schwierigen Bedingungen groß geworden war, erst bei ihrer alleinerziehenden Mutter, dann bei ihrem Stiefbruder, war das wichtiger als alle Äußerlichkeiten.
Sie lächelte, als sie an den vergangenen Sommer dachte. Es hatte lange gedauert, bis Ralph sie endlich in Berlin besucht und ihren Verlobten kennengelernt hatte. Zuerst hatte er geglaubt, es wäre John, das hatte sie in seinen Augen gesehen. Er war heilfroh gewesen, dass der Mann, für den sich Janine entschieden hatte, einer war, neben dem er sich nicht so unzulänglich vorkam wie neben John, der sich sein Studium mit Model-Jobs finanzierte.
Dabei hatte Ralph keinerlei Grund, sich minderwertig zu fühlen. Er war total in Ordnung. Aber das wusste er selbst wohl nicht. Anders konnte sie sich nicht erklären, warum er es immer noch nicht geschafft hatte, seiner ehemaligen Kollegin Sabine Kaufmann seine Zuneigung zu gestehen. Dabei sah doch ein Blinder, dass sie nicht abgeneigt wäre.
Der Angriff kam vollkommen unerwartet.
Nicht von hinten, sondern von der Seite. Eine vermummte Gestalt sprang aus einem Gebüsch hervor und stieß einen Ast zwischen die Speichen ihres Vorderrads.
Das Rad blockierte, und Janine wurde nach vorn über den Lenker geschleudert. Reflexartig hob sie die Arme und rollte sich ab, trotzdem war der Sturz schmerzhaft. Für ein paar Sekunden konnte sie nur nach Luft schnappen. Dann fokussierte sich ihr Blick wieder.
Sie befand sich in einem einsamen Bereich des Parks, der nur spärlich erleuchtet war. Der Angreifer stand direkt vor ihr. Er war groß und trug einen schwarzen Umhang mit ausgepolsterten Schultern, dazu eine schwarze Maske mit rot glühenden Augen. Am ausgestreckten rechten Arm schwang ein seltsames Objekt: eine dicke, schwarz glänzende Kugel an einer kurzen Kette, die an einem stabilen Griff befestigt war.
Im ersten Moment war sie vor Schreck wie erstarrt. Halloween war doch längst vorbei. Was sollte diese Aufmachung? Dann überschwemmte sie ein Gefühl der Erleichterung. Die Waffe konnte nicht echt sein. Sicher war es nur eine Attrappe. Hier im Park trafen sich oft Gruppen zu Live-Rollenspielen. Der Mann musste sie mit einer Mitspielerin verwechselt haben.
»Hey«, sagte sie und zeigte ihm die Handflächen. »Ich gehöre nicht zu eurem Spiel. Ich bin nur auf dem Weg nach Hause.«
Der Mann stieß einen Laut aus, der an das Knurren eines hungrigen Wolfs erinnerte. Er drosch die Kugel gegen einen Baumstamm.
Das Geräusch war entsetzlich, wie ein Vorschlaghammer auf einem morschen Balken. Rindenstücke und Holzsplitter flogen umher.
Janine hatte plötzlich einen trockenen Hals. Die Kugel war nicht aus Pappe oder Schaumstoff, sondern aus Metall. Es war kein Spielzeug, sondern eine tödliche Waffe.
Wieder brachte sich der Angreifer in Position. Sie versuchte, von ihm wegzurobben, doch sie hatte keine Chance. Er folgte ihr mühelos und klemmte sie zwischen seinen Beinen fest. Wie ein Rachegott ragte er über ihr auf. »Stirb!«, spie er und holte aus.
Sie hob die Arme vors Gesicht.
Bitte nicht, flehte sie still. Sie hatte Ralph ausgelacht, wenn er sich Sorgen gemacht hatte, sie könne überfallen oder vergewaltigt werden. Ihr würde schon nichts passieren, hatte sie geglaubt. Doch jetzt erkannte sie, dass die coole Attitüde, mit der sie sich immer sicher gefühlt hatte, ihr nicht den geringsten Schutz bot.
Die Kugel sirrte durch die Luft und sauste auf sie herab.
Ralph Angersbach studierte die große Karte, die sein Vater an der Seitenwand seines Wohnraums angepinnt hatte. Nordhessen in einer Darstellung, die geographische und geologische Besonderheiten hervorhob. Der alte Gründler, wie immer mit zotteligen Haaren und wirrem Vollbart im blasslila Baumwollhemd mit weiten Ärmeln und einer Weste aus braun gemusterter, grob gestrickter Wolle, die an griechische Schafhirten erinnerte, deutete mit dem knochigen Zeigefinger darauf.
»Hier!«, polterte er. »Hier will unsere geschätzte Landesregierung ein Endlager für den Atommüll aus La Hague und Sellafield einrichten. Vielleicht. Und hier«, der Finger wanderte zu einem anderen Punkt auf der Karte, »verläuft die ehemalige Strecke der Kanonenbahn. Das ist das Zentrum unserer Aktion.«
Ralph konnte nicht verhindern, dass ihm ein Lachen entwich. »Kanonenbahn?«
Johann Gründler kniff die Augen zusammen. »Deine Kenntnis der deutschen Geschichte ist so rudimentär, dass es wehtut.« Er winkte seinen Sohn zu den beiden gemütlichen Sesseln vor dem Kamin und bedeutete ihm, Platz zu nehmen. Dann schenkte er Tee aus der bauchigen Kanne ein, die auf dem Stövchen bereitstand. Ralph roch eine fruchtige Note und dazu einen Hauch von Alkohol.
»Was ist das?«
»Kirschblüte mit einem Schuss Rum. Sehr anregend.«
»Bei dir geht auch nichts ohne Rauschmittel«, kritisierte Ralph.
Gründler verdrehte die Augen. »Wenn ich schon nicht rauchen darf, wenn du hier bist.«
»Gegen Tabak habe ich nichts.«
Sein Vater richtete den Blick zur Decke, als wolle er den Herrgott um Beistand anflehen. »Tabak«, sagte er verächtlich.
»Den Konsum von illegalen Drogen kann ich als Polizist nicht akzeptieren«, erklärte Ralph, obwohl er das bei anderen Gelegenheiten durchaus schon getan hatte. Sein Vater war nicht immer so rücksichtsvoll gewesen. Solange es nur der alte Gründler selbst war, der an seinem Joint zog, konnte Ralph damit umgehen. Ein Problem hatte er, wenn sich die alten Hippie-Freunde seines Vaters zum gemeinsamen Haschisch-Rauchen trafen. Zum Glück war aus der geplanten Wohngemeinschaft auf Gründlers Hof hier oben im Vogelsberg bisher noch nichts geworden. Dafür gab es jetzt die neue Protestgruppe.
»Die Kanonenbahn«, erklärte Gründler in belehrendem Tonfall, »ist die Eisenbahnstrecke von Berlin über Koblenz und Trier nach Metz, die in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts aus militärstrategischen Gründen angelegt wurde. Metz gehörte, wie du vielleicht weißt, damals zum Deutschen Kaiserreich.«
»Nein.«
Sein Vater seufzte theatralisch, was wohl bedeuten sollte, dass er nichts anderes erwartet hatte und sich fragte, warum er mit einem politisch derart ungebildeten Sohn geschlagen war.
»Nach dem Deutsch-Französischen Krieg, der von 1870 bis 1871 stattfand, musste Frankreich das Reichsland Elsass-Lothringen an Deutschland abtreten. Daraufhin wurde die Bahnstrecke gebaut, um das neue Territorium effizient an die Reichshauptstadt Berlin anzubinden.«
»Aha. Und warum Kanonenbahn?«
»Weil sie entsprechend dem Kanonenbahngesetz gebaut wurde. Dabei ging es um militärisch wichtige Strecken zu Orten, zu denen man Soldaten und eben Kanonen schnell befördern können wollte. Wirtschaftliche Aspekte spielten dagegen keine Rolle. Im Gegenteil führt die Strecke an den großen Ballungsräumen vorbei, sodass sie für den normalen Reiseverkehr kaum genutzt wurden. Nach der deutschen Teilung und dem Mauerbau wurden dann einzelne Streckenabschnitte stillgelegt, weil die Verbindung zwischen Hessen und Thüringen unterbrochen war.«
Angersbach gähnte. »Und was hat eure Aktionsgruppe gegen die stillgelegte Kanonenbahn einzuwenden?«
»Nichts.« Gründler stand auf und gestikulierte erregt. »Es geht darum, dass ein Konzern in Schwalmstadt die Strecke reaktivieren will.«
Ralph nippte an seinem Tee. »Das ist doch gut. Bahnverkehr ist ökologisch sinnvoller als Straßenverkehr. Für den Klimaschutz ist das der richtige Weg.«
Gründler hob die Arme zur Decke. »Darum geht es aber nicht.«
»Sondern?«
»Dieser Konzern ist ein Transportunternehmen. Die wollen sich das Monopol auf alle zukünftigen Atommülltransporte sichern. Das ist ein Riesengeschäft.«
»Wohl kaum. Der Ausstieg ist doch beschlossene Sache.«
»Aber unser Müll liegt in den Wiederaufbereitungsanlagen in La Hague und Sellafield. Dort will man ihn – verständlicherweise – nicht behalten. Also kommt er zurück. Und wir müssen sehen, was wir damit anstellen.«
»Wenn du es verstehst, warum protestierst du dann dagegen?«
»Es geht darum, dass die Castor-Behälter von A nach B gefahren werden, ohne dass es bereits eine sinnvolle Lösung gäbe. Gerade jetzt ist eine Umsetzung von Sellafield nach Biblis im Gange, von einem Zwischenlager in ein anderes.«
»Und?«
»Das gefährdet die Bevölkerung. Oder glaubst du, die verdammten Dinger sind dicht? Bei allem, was mit Kernenergie zu tun hat, tritt Strahlung aus, bei jedem Atomkraftwerk, jedem Zwischenlager und jedem Transport der Brennstäbe. Dagegen protestieren wir. Die alte Kanonenbahn darf keine Todesbahn werden.«
»Okay.« Ralph ergab sich. »Das ist sicher richtig.«
Sein Vater verdrehte die Augen, stellte aber seine Belehrungen ein. »Komm«, sagte er stattdessen. »Ich zeige dir etwas.« Er führte ihn aus der Hintertür in den Hof.
Draußen war es stockfinster. Gründler betätigte einen Schalter neben der Tür, und ein Flutlicht flammte auf, das jedem Fußballplatz eines Amateurvereins Ehre gemacht hätte. Es beleuchtete den alten Opel, mit dem sein Vater durch den Vogelsberg kutschierte – und einen VW-Bus in verblichenem Nato-Oliv mit gemusterten Stoffvorhängen, den Ralph noch nie gesehen hatte. Am Heck prangten diverse Aufkleber: »Freie Republik Wendland«, »Atomkraft? Nein danke!«, die Weissagung der Cree (»Erst, wenn der letzte Fisch …«) und die obligatorische weiße Friedenstaube auf blauem Grund. »Das ist mein neuer Bulli. Nicht so schön wie der alte, aber trotzdem. Ein T3 Syncro, Ex-Bundeswehrfahrzeug und ein Allrad, wie der Name schon sagt. Den habe ich günstig im Netz geschossen, bei den Kleinanzeigen«, verkündete Gründler stolz. »Genau das richtige Fahrzeug, um bei den Demos gegen die Kanonenbahn dabei zu sein. Da bin ich immer direkt vor Ort.« Er öffnete die Schiebetür und machte eine einladende Geste. »Schau mal rein. Waschbecken, Gaskocher und Klappbett Marke Eigenbau. Standheizung und Klo gibt’s natürlich ebenfalls, auch wenn es nur ein Porta Potti ist – eben alles, was man so zum Leben braucht.«
Ralph machte einen Schritt auf den Syncro zu, blieb aber gleich wieder stehen, weil das Smartphone in seiner Tasche vibrierte. »Sekunde«, sagte er und schaute auf das Display. Eine unbekannte Nummer, Berliner Vorwahl. Ein mulmiges Gefühl beschlich ihn.
»Angersbach«, meldete er sich zurückhaltend.
»Polizeidirektion 5, Abschnitt 53«, meldete sich eine dröhnende Stimme am anderen Ende. »Polizeihauptmeister Koschke am Apparat.«
Das war das Revier in der Friedrichstraße, das für den Straßenzug in Kreuzberg zuständig war, in dem sich Janines WG befand.
Aus dem mulmigen Gefühl wurde ein saures Brennen. Ralph hatte sich von Anfang an Sorgen gemacht, als Janine nach Berlin gegangen war und ihr soziales Jahr im Jugendknast begonnen hatte. Sabine und er hatten seine Halbschwester einmal vor der Drogenfahndung gerettet, als sie noch minderjährig gewesen war und bei ihm in Okarben gewohnt hatte. Sie hatte ihnen geschworen, dass es damit vorbei sei, doch nun war sie offenbar erneut auf die schiefe Bahn geraten. Dabei hatte er beim letzten Mal einen so guten Eindruck gehabt. Morten, ihr australischer Verlobter, der in Berlin Jura studierte, schien einen guten Einfluss auf sie zu haben.
Vielleicht war es ja auch etwas ganz anderes. Im letzten Sommer hatten Janine, Morten und der dritte WG-Mitbewohner John, ebenfalls ein australischer Gaststudent, viel Zeit mit Ralphs Vater verbracht. Ralph hatte sie mehr als ein Mal in seinem Haus angetroffen, wo sie mit Onkel Joe, wie sie ihn nannten, zusammenhockten. Der Geruch nach Marihuana war jedes Mal überwältigend gewesen.
Hatte Onkel Joe sie in seine Widerstandsbewegung hineingezogen? Gab es in Berlin auch Proteste gegen die geplanten Endlagerstätten und womöglich auch gegen die Kanonenbahn? War Janine von der Polizei verhaftet worden, weil bei einer Demonstration etwas aus dem Ruder gelaufen war?
Ralph holte tief Luft. »Kollege Koschke«, sagte er bemüht jovial. »Was kann ich für Sie tun?«
»Es … äh … geht um Ihre Halbschwester. Frau Janine Angersbach.«
Ralph schloss die Augen. Er hatte es gewusst.
Der alte Gründler zerrte an seinem Ärmel. »Was ist los?«, wisperte er.
Ralph schüttelte ihn ab. Der Beamte am anderen Ende räusperte sich. »Es tut mir leid, Herr Oberkommissar, aber ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihre Halbschwester gestern Abend von einer unbekannten Person überfallen und verletzt wurde.«
»Wie bitte?« Das Blut rauschte in Ralphs Ohren. Für ein paar Sekunden herrschte vollkommene Leere in seinem Kopf. Dann kamen seine Gedanken langsam wieder in Gang.
Auch davor hatte er Janine gewarnt. Die Gefahren der Großstadt.
»Was ist passiert?«, presste er hervor.
»Ein Mann hat Ihre Halbschwester in der Hasenheide vom Rad gestoßen und mit einer Art Morgenstern attackiert. Eine schwere Metallkugel an einer Kette mit einem gummierten Griff.«
Nein!
Ralph wollte schreien, doch heraus kam nur ein undefinierbarer Laut.
»Sie hat Glück gehabt. Der Hund eines Spaziergängers hat den Angriff bemerkt und ist auf den Mann losgegangen. In letzter Sekunde sozusagen. Allerdings …«
»Ja?« Ralph hätte den Kollegen am liebsten an der Gurgel gepackt, doch am Telefon ging das ja nicht. Wie konnte man einem Angehörigen eine schlimme Nachricht auf eine solche Weise überbringen? Was lernten die Berliner eigentlich in der Ausbildung?
»Der Schlag war zwar kein Volltreffer, doch die Kugel hat Ihre Halbschwester trotzdem am Kopf erwischt. Sie hat eine Gehirnerschütterung. Angesichts der Tatsache, dass der Täter sie offenbar töten wollte …«
Er sprach nicht weiter.
Ralph konnte nicht schlucken. Seine Kehle war völlig ausgedörrt.
Johann Gründler verschwand im Inneren des T3 und stand fünf Sekunden später wieder vor Ralph, einen silbernen Flachmann in der Hand.
»Trink das!«
Ralph setzte die Flasche an die Lippen. Es war irgendein widerliches Zeug, billiger Korn oder Wodka, der in der Speiseröhre brannte, doch es half. »Was ist danach passiert?«
»Der Angreifer hat den Hund erschlagen und ist geflohen. Die Waffe hat er verloren oder weggeworfen. Wir haben sie ein paar Hundert Meter vom Tatort entfernt im Gebüsch gefunden. Der Hundebesitzer hat ihn verfolgt, aber nicht eingeholt. Er hat dann die Polizei und den Rettungswagen informiert. Die haben sich um Ihre Halbschwester gekümmert. Sie war bewusstlos. Es hat eine Weile gedauert, ehe sie uns sagen konnte, wer sie ist.«
»Wo ist sie jetzt?«, presste Ralph mühsam hervor.
»Im Klinikum am Urban. Ich schicke Ihnen die Nummer auf Ihr Mobilgerät.«
»Danke.« Ralph drückte die Verbindung weg, ohne die Abschiedsfloskel des Beamten abzuwarten. Wenn der Mann noch Fragen hatte, konnte er sie später stellen.
Ungeduldig starrte er sein Smartphone an. In Wirklichkeit waren es nur Sekunden, doch ihm kam es vor wie eine halbe Ewigkeit, ehe das Display aufleuchtete und den Eingang einer Nachricht anzeigte.
Rasch kopierte er die Nummer, die ihm Polizeihauptmeister Koschke geschickt hatte, in sein Telefonbuch und tippte auf den grünen Hörer.
Der Ruf ging raus, aber niemand nahm ab. Er wollte schon aufgeben, als es am anderen Ende knackte.
»Ralph?«, erklang Janines Stimme aus dem Hörer, und vor Erleichterung wurden Angersbach die Knie weich.
»Janine.« Seine Augen füllten sich mit Tränen. »Wie geht es dir?«
»Na ja. Ich fühle mich ein bisschen geplättet.« Sie hustete, und Angersbach brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, dass sie gelacht hatte. »Aber mach dir keine Sorgen«, sagte sie betont fröhlich. »Es ist alles in Ordnung.«
Angersbach blinzelte. »Du bist überfallen worden. Jemand hat auf dich eingeschlagen. Er wollte dich umbringen.«
»Ach was.« Er hörte ein Rascheln und das Geräusch, mit dem bei einem Krankenhausbett Kopf- und Fußteil bewegt wurden. Janine hatte sich offenbar in eine aufrechtere Position gebracht, jedenfalls klang ihre Stimme jetzt deutlich kräftiger. »Na ja, vielleicht. Aber das kann nur ein Irrtum gewesen sein. Oder der Typ war ein durchgeknallter Psychopath. Das war nichts Persönliches. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass er es erneut versucht.«
Ralph war nicht besonders gut darin, Zwischentöne wahrzunehmen, doch in diesem Fall schrie es ihn geradezu an. Da war etwas, das ihm Janine unbedingt verheimlichen wollte. Aber warum?
»Du hast eine Idee, wer das war«, sagte er ihr auf den Kopf zu.
»Unsinn.« Wieder dieses hustende Lachen. Aufgesetzt, fand Ralph. Aber was sollte er tun, wenn Janine nicht mit ihm darüber reden wollte? »Willst du den Kerl einfach so davonkommen lassen? Er hat dich immerhin verletzt!«
»Ich hab’s ja überlebt.« Der bockige Ton, den er so gut kannte, schlich sich in Janines Stimme. Eigentlich hatten sie diese Phase längst hinter sich; ihr Verhältnis war in den letzten Jahren sehr entspannt geworden. Aber Janine konnte es nach wie vor nicht leiden, wenn er sich in ihr Leben einmischte oder ihr sagte, was sie zu tun und zu lassen hatte.
»Bitte, Janine. Lass mich dir helfen.« Er wollte es nicht, aber er konnte nicht anders, als zu betteln.
»Mach dir keine Sorgen«, wehrte sie ab. »Die Polizei hier in Berlin kümmert sich um alles. Und die Wunde am Kopf ist hübsch verarztet worden. Heute Nacht soll ich noch zur Beobachtung hierbleiben, morgen darf ich nach Hause.«
»Willst du nicht lieber irgendwo anders hingehen?«
»Wohin denn? Etwa zu dir?«
Ralph musste sich Mühe geben, nicht allzu verletzt zu klingen. »Zum Beispiel.« Warum denn auch nicht? »Oder … zu Onkel Joe.«
»Danke. Aber das ist nicht nötig. Es ist besser, wenn ich genauso weitermache wie bisher. Du weißt schon. Der Reiter, der vom Pferd gefallen ist …«
»Sollte so rasch wie möglich wieder aufsitzen, weil sonst die Angst immer größer wird.«
»Genau.«
»Okay.« Ralph wusste nicht, was er noch sagen sollte. Außer vielleicht … »Ich könnte dich besuchen kommen. Morgen. Es ist ja Wochenende.«
»Das ist lieb. Aber es ist nicht nötig. So viel Stress für dich, und ich hätte ohnehin keine Zeit. Ich habe Dienst in der Strafanstalt.«
»Wie du willst.« Ralph wollte auf keinen Fall aufdringlich erscheinen. Sonst würde sich Janine nur wieder in das Schneckenhaus zurückziehen, aus dem Sabine Kaufmann und er sie mühsam herausgeholt hatten. Stattdessen würde er sich einfach am nächsten Morgen in den Zug setzen. Wenn er vor ihrer Tür stand, würde sie ihn nicht wegschicken.
»Dann schlaf dich erst mal aus«, riet er. »Und pass auf dich auf.«
»Das mache ich.« Sie klang mit einem Mal sehr müde.
Ralph hätte gern noch einen Moment ihre Stimme gehört, doch seine Halbschwester drückte ihn weg.
Er schloss kurz die Augen. Dann erklärte er dem alten Gründler, was passiert war, ließ aber seinen Verdacht, dass der Angreifer Janine und niemanden sonst hatte töten wollen, weg. Stattdessen stellte er es so dar, als sei sie zufällig einem gewaltbereiten Betrunkenen in die Quere geraten.
Sein Vater tätschelte ihm den Arm. »Janine ist stark. Sie kommt darüber hinweg. Und sie hat ja Morten.« Er betrachtete nachdenklich den natogrünen VW Bus. »Wenn ich Zeit hätte, würde ich sie besuchen fahren. Aber ich will morgen bei unserer Kundgebung gegen die Kanonenbahn dabei sein.«
»Tu das. Janine würde nicht wollen, dass du ihretwegen den Widerstand im Stich lässt.«
Auf keinen Fall sollte sein Vater wissen, dass Ralph entgegen Janines ausdrücklichem Wunsch nach Berlin reiste.
Der alte Gründler sah ihn misstrauisch an, aber dann nickte er. »Manchmal hast du ja doch vernünftige Gedanken.«
Ralph verabschiedete sich rasch von ihm und eilte zu seinem dunkelgrünen Lada Niva, der vor dem Haus stand. Er musste nach Hause, packen.
Endlich Freitag!
Sabine Kaufmann bewegte den Kopf im Rhythmus der Musik, die ihr in den Ohren dröhnte. Viel zu laut eigentlich, wenn man es vom Standpunkt der Otologie aus betrachtete, aber genauso musste es sein, wenn sie sich den Stress der Woche aus dem Gehirn spülen wollte. Sie sang den Text des Sommerhits mit, reckte die Arme zur Decke und stampfte die Anspannung mit jedem Tanzschritt in den Boden des Clubs.
Zurzeit ermittelte sie wieder einmal in einem dieser Fälle, die sie hasste. Es ging um Wirtschaftskriminalität im großen Stil, und der Großteil der Arbeit fand am Schreibtisch statt. Recherchen, Recherchen, Recherchen. Die Verdächtigen wurden nicht befragt, sondern von den dafür zuständigen Kollegen observiert. Die Beweislage war dünn. Ehe es zu den ersten Verhaftungen kam, würden noch Wochen, vielleicht Monate ins Land gehen.
Dabei wollte sie so gern wieder einmal hinaus auf die Straße. Sie mochte diese Jahreszeit mit dem milden Licht und den bunten Blättern an den Bäumen. An diesem Wochenende würde sie endlich wieder im Taunus joggen, doch unter der Woche war sie vor Sonnenaufgang aus dem Haus gegangen und erst weit nach Einbruch der Dämmerung zurückgekehrt. Vom Herbst hatte sie nur beim gelegentlichen Blick aus dem Fenster ihres Büros etwas mitbekommen, und von dort sah sie kein gelbes und rotes Laub, sondern nichts als nüchterne Fassaden.
Nicht zum ersten Mal fragte sie sich, ob ihr Wechsel zum LKA in Wiesbaden ein Fehler gewesen war. Rückblickend schien ihr die Arbeit bei der Mordkommission abwechslungsreicher. Aber sie hatte den Schnitt gewollt, um ihrem alten Leben den Rücken zu kehren. Der Zeit in Bad Vilbel mit dem Experiment der dezentralen Mordkommission und ihrem verhassten Chef – und der Erinnerung an ihre psychisch kranke Mutter und vor allem an ihren plötzlichen Tod.
Geholfen hatte es nichts. Man konnte vor diesen Dingen nicht weglaufen, und es nützte nichts, den Schmerz zu verdrängen. Er lauerte hinter der Mauer der Abwehr, die immer brüchiger wurde, und würde erst aufhören, wenn sie sich ihm gestellt hatte. Sabine wusste das, aber sie schaffte es einfach nicht, ihrer Trauer den nötigen Raum zu geben.
Stattdessen stürzte sie sich seit einiger Zeit ins Wiesbadener Nachtleben. Seit den Ermittlungen vor drei Monaten, genauer gesagt. So vieles war wieder aufgewühlt worden, als sie im Fall eines ermordeten Kollegen in Bad Vilbel ermittelt hatte. Zusammen mit Ralph Angersbach.
Der DJ legte einen neuen Song auf, den Sabine nicht mochte. Sie wechselte in einen anderen Raum des Clubs, in dem die Musik nur gedämpft zu hören war, und setzte sich an die Bar. Der Barkeeper mixte ihr einen Caipirinha und lächelte, als er ihn vor ihr auf den Tresen stellte. Er kannte sie. Sie brauchte nur noch den Finger zu heben.
Während sie ihren Cocktail schlürfte, sah sie sich um. Es war der Bereich des Clubs, in dem man Kontakte knüpfte. Vornehm ausgedrückt. Jeder, der zu den Single-Partys kam, wusste, worum es ging. Die Männer hofften auf eine heiße Nacht, die meisten Frauen auf die große Liebe.
Deshalb wunderte Sabine sich nicht, als sich ein Mann neben ihr auf den Barhocker schob und sie von oben bis unten musterte. Er sah nicht schlecht aus, glatt zurückgekämmte blonde Haare, rasiertes Kinn, graue Augen. Nicht unbedingt ihr Typ und überdies viel zu jung, Mitte zwanzig, höchstens, aber das war auch egal. Sie wollte keinen One-Night-Stand. Wenn er mehr zu bieten hatte, spielten Aussehen und Alter keine Rolle. Und wenn nicht, dann erst recht nicht.
Der Mann stützte sich mit dem Ellenbogen auf den Tresen und wandte sich ihr zu.
»Du bist die hübscheste Frau, die ich heute Abend hier gesehen habe«, startete er sein Anmach-Programm.
Sabine lächelte müde. Sie fand sich nicht unattraktiv, war sich aber ihres Aussehens ebenso wie ihres Alters bewusst. Im nächsten Jahr wurde sie vierzig. Sie war klein, und ihre halblangen blonden Haare waren nichts Besonderes. Beim Tanzen hatte sie etliche Frauen gesehen, die mehr zu bieten hatten, langbeinige Schönheiten mit langen dunklen Haaren, Blondinen mit perfekten Kurven und eine Brünette, die getanzt hatte wie eine Göttin.
»Dann bist du wohl gerade erst gekommen«, erwiderte sie.
Ihr Gegenüber stutzte kurz. Dann lachte er. »Okay. Der Spruch war nicht der beste. Aber im Ernst: Ich mag diese aufgestylten Frauen nicht. Du siehst echt aus.«
Sabine neigte den Kopf. Saß da womöglich tatsächlich der Jackpot vor ihr? Der Mann, den es eigentlich nicht gab? Der in einen Club ging, um eine Partnerin zu finden und nicht nur ein Betthäschen für eine Nacht? Und der darüber hinaus ein Faible für reifere Frauen hatte?
Er streckte die Hand aus. »Ich heiße Carl.«
»Sabine.«
Er hielt ihre Hand zu lange fest. Sie wollte sie ihm entziehen, doch er gab sie nicht frei. Stattdessen legte er ihr die andere Hand in den Nacken und presste seine Lippen auf ihre. Sein Knie schob sich zwischen ihre Beine.
Igitt!
Sabine drückte ihm mit der freien Hand gegen die Brust, aber er ließ sich nicht wegschieben. Er drängte sich immer näher an sie heran und versuchte, seine Zunge zwischen ihre Lippen zu zwängen.
Das ging nun wirklich zu weit!
Sabine riss das Knie hoch. Carl knickte ein. Seine Hände und seine Zunge verschwanden. Er krümmte sich stöhnend auf dem Barhocker und schwankte so sehr, dass sie fürchtete, er könnte herunterfallen.
Aber das war nicht ihr Problem. Sie nahm rasch einen Geldschein aus der Tasche und legte ihn dem Barkeeper hin, der mit beiden Händen an der Schanksäule hantierte. Offenbar hatte er keinen Zweifel gehabt, dass sie mit der Situation zurechtkam. Oder er fürchtete um die Perfektion seiner Bierschaumkronen. Sie nickten einander zu, dann lief sie los.
Für heute hatte sie die Nase voll.
Sie trat aus dem Club auf die Straße und sog die kühle Nachtluft ein. Suchend schaute sie sich nach einem Taxi um. Ihr Renault Zoe hing in der Nähe ihrer Wohnung an der Elektrozapfsäule. Gekommen war sie mit dem Bus, aber jetzt hatte sie keine Lust auf den öffentlichen Nahverkehr. Sie wollte so schnell wie möglich nach Hause und eine heiße Dusche nehmen, um Carls Berührungen abzuspülen.
Im Grunde war nichts passiert, aber sie fühlte sich trotzdem beschmutzt. Was fiel diesem Mann ein, sie einfach anzufassen? Sie selbst hatte keinerlei Signale in dieser Richtung ausgesandt.
Unweigerlich musste sie an einen anderen Mann denken. Einen, den sie sogar geküsst hatte, nach einem aufreibenden Arbeitstag in seiner Wohnung in Gießen. Sie hatte geglaubt, dass etwas zwischen ihnen entstehen könnte, aber entweder war er nicht interessiert, oder er war einfach nicht in der Lage, einen Schritt auf eine Frau zuzumachen. Nun, das konnte es nicht sein, mit der anderen war er ja zur selben Zeit im Bett gewesen. Was kein Problem gewesen wäre, weil zwischen ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nichts passiert war. Das war es auch danach nicht, wenn man von dem Kuss absah. Über den er offenbar lieber hatte reden wollen, anstatt ihn zu wiederholen.
Nein, die Sache war aussichtslos. Ralph Angersbach war einfach ein Stoffel, der niemals über seinen Schatten springen würde. Warum sonst hatte er sich in den vergangenen drei Monaten nicht ein Mal bei ihr gemeldet?
Gut, sie hatte es ebenfalls nicht getan. In diesem Punkt war sie ein wenig altmodisch. Sie war eine emanzipierte Frau, aber den ersten Schritt in einer ernsthaften Beziehung musste der Mann machen, fand sie.
Ein Taxi war weit und breit nicht zu sehen.
Sabine beschloss, ein Stück zu gehen. Im benachbarten Viertel würde sie sicherlich ein Fahrzeug finden. Dort waren mehrere Restaurants und Lokale angesiedelt, und für die Taxiunternehmen war immer ein gutes Geschäft zu machen. Das ließen sich die Fahrer nicht entgehen, schon gar nicht am Freitagabend.
Sie passierte einen schmalen Durchgang zwischen zwei Häusern, als jemand sie von hinten packte und in die Gasse stieß. Der Angreifer drehte sie zu sich herum und presste sie mit dem Rücken gegen die Hauswand. Es war Carl, den sie an der Bar abserviert hatte.
»So springst du nicht mit mir um.« Er hatte sich vor ihr aufgebaut, mindestens dreißig Zentimeter größer als sie, mit breiten Schultern. Sein ausgestreckter Zeigefinger zitterte vor ihrer Nase.
Sabine versuchte, sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen.
»Und was willst du dagegen tun?«, fragte sie spöttisch.
»Ich zeige dir, wer hier das Sagen hat.« Er griff in den Halsausschnitt ihres Tops und riss den Stoff entzwei. Wieder zwängte er sein Bein zwischen ihre Beine und klemmte sie so eng zwischen sich und der Hauswand ein, dass sie keine Chance hatte, ihn noch einmal mit einem gezielten Tritt in die Knie zu zwingen. Wo waren sie, ihre Reflexe, ihre Selbstverteidigungstechniken, die sie theoretisch aus dem Effeff kannte? Wie gelähmt hing sie in seiner Schraubzwinge. Sein feuchter Mund legte sich auf ihre Lippen, seine Hände machten sich am Reißverschluss ihrer Jeans zu schaffen.
Panik schoss in ihr hoch wie eine Stichflamme. Dieser Typ wollte sie vergewaltigen, und sie konnte sich nicht wehren. Ihre Hände waren zwar frei, aber sie konnte keine Kraft in ihre Schläge legen. Sie war auch nicht in der Lage zu schreien, weil sein brutaler Kuss ihren Mund verschloss.
Würde ihr jetzt, mit fast vierzig, das widerfahren, vor dem sie sich als junges Mädchen immer gefürchtet hatte?
2
Als sie endlich den letzten Demonstranten, der Widerstand geleistet hatte, in den Polizeibus verfrachtet hatten, fühlte er sich vollkommen ausgelaugt. Das T-Shirt und die Boxershorts, die er unter seiner Schutzausrüstung trug, klebten feucht auf der Haut. Sein Kopf unter dem Helm schien zu kochen, die Gliedmaßen waren weich wie Gummi, die Füße in den klobigen Stiefeln fühlten sich an wie Klötze. Seine Finger in den schwarzen Handschuhen waren taub. Am liebsten hätte er sich die gesamte Ausrüstung vom Körper gerissen, doch damit hätte er sich lächerlich gemacht und sämtlichen Respekt verspielt, den er sich gerade erst erworben hatte.
Immerhin, der rötliche Schleier, der sich vor seine Augen gelegt hatte, lichtete sich endlich wieder, und sein Puls normalisierte sich. Aaron schob den Jackenärmel zurück und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Was ihm vorgekommen war wie eine Stunde, waren nur knapp fünfzehn Minuten gewesen.
Die meisten Protestler waren geflohen, nachdem seine Kollegen und er so energisch gegen den Steinewerfer vorgegangen waren. Nur ein paar Hartgesottene hatten sich den Beamten noch entgegengestellt, und einige, die nicht halb so cool waren, wie sie vorgaben, hatten nicht weglaufen können, weil sie sich an die Hindernisse auf den Schienen gekettet hatten und sich nun nicht so schnell hatten befreien können, wie sie es sich wünschten. Sie alle waren jetzt auf dem Weg zum nächstgelegenen Polizeirevier, zur Feststellung ihrer Personalien. Manche würden wohl auch in eine Arrestzelle wandern, und der Steinewerfer würde direkt in die Untersuchungshaft überstellt werden.
Nun galt es, die Stämme und Steine von den Schienen zu bugsieren. Aaron mobilisierte seine letzten Reserven und packte mit an. Der Zug würde tatsächlich diese Strecke passieren. Er hatte ein paar Kilometer von hier einen Stopp eingelegt, weil der Lokführer über die Blockade informiert worden war, doch sobald der Weg frei war, würden die Waggons mit den Castor-Behältern anrollen.
Es dauerte nur wenige Minuten. Eine Hundertschaft durchtrainierter Polizeibeamter konnte schnell beiseiteschaffen, was ein paar Hundert Alternative in stundenlanger mühsamer Arbeit zusammengetragen hatten.
Die Männer hatten ihre Visiere hochgeklappt, und die Mienen waren von grimmiger Zufriedenheit erfüllt. Aaron dagegen verspürte vor allem Ungeduld. Er wollte zu Ulf und Harald und sich versichern, dass mit seinem Vorgesetzten alles in Ordnung war. Eilig lief er den schmalen Waldweg entlang.
Der blonde Junge kam ihm in den Sinn. Wie mochte es sich anfühlen, wenn man mit ansehen musste, wie der eigene Vater einen Stein auf einen Polizisten warf und dann zu Boden geworfen und verhaftet wurde? Aaron war voller Mitgefühl, während er zugleich heiße Wut auf den Vater verspürte. Man konnte nur hoffen, dass er zu einer angemessenen Strafe verurteilt wurde.
Der Weg beschrieb eine Kurve, ehe er hinter dicht stehenden Tannen zum Parkplatz führte. Aaron beschleunigte seinen Schritt.
Er sah Harald Faust sofort. Der Kollege hockte mit dem Rücken an einen Baum gelehnt. Den Kopf hatte er in den Nacken gelegt, sein Blick war starr in den Himmel gerichtet. Ulf Schleenbecker lag neben ihm auf dem Waldboden.
Aarons Herz setzte aus, und er geriet ins Stolpern.
Wo war der Rettungswagen, den Harald angefordert hatte? Und warum war Ulf noch nicht auf dem Weg ins Krankenhaus?
Faust wandte ihm den Blick zu, als Aaron auf ihn zulief. Das Gesicht war nass, die Augen mit Tränen gefüllt. Aaron hörte das Geräusch eines Zugs, der sich näherte. Zwischen den Bäumen sah er die Silhouette einer schweren Diesellok, gefolgt von mehreren Waggons, auf denen sich die riesigen weißen Container mit ihrer charakteristischen Form befanden: liegende, halbierte Zylinder mit abgeflachten Rundungen. Das Schlusslicht bildete eine weitere Diesellok.
Aaron fiel neben Schleenbecker auf die Knie, während der Castor-Transport vorbeizog und in einer lang gezogenen Kurve verschwand. Ein furchtbares Kribbeln erfasste seinen gesamten Körper, als hätte die strahlende Fracht ihre Finger nach ihm ausgestreckt. Er sah den offen stehenden Mund seines Kollegen, den trüben Schleier über den Augäpfeln, doch die Erkenntnis wollte nicht in seinen Kopf. Er rüttelte an Schleenbeckers Schultern und sah Hilfe suchend zu Faust.
»Was ist denn mit ihm? Wo ist der RTW?«
Der Kollege wischte sich mit dem Handschuh übers Gesicht. »Ich habe ihn abbestellt«, würgte er hervor mit einer Stimme, die hohl klang wie aus einer anderen Welt. »Ulf ist tot.«
Vor dem Fenster dämmerte es. Sabine Kaufmann seufzte und kuschelte sich tiefer in die Decke. Erst dann fiel ihr auf, dass etwas anders war.
Sie war nicht allein.
Sie zwinkerte, um den Schlaf aus den Augen zu vertreiben. Ihr Geist wurde nur langsam wach. Die Lider waren noch schwer, die Gedanken träge. Ihr Kopf fühlte sich an wie mit Watte ausgepolstert.
Es dauerte ein paar Sekunden, bis sich die ersten Erinnerungsfetzen formierten. Zeitgleich zog ein mulmiges Gefühl ihren Magen zusammen.
Carl. Die enge Gasse. Sein Mund auf ihrem, seine Hände überall auf ihrem Körper.
Aber er würde doch nicht neben ihr im Bett liegen, in ihrer eigenen Wohnung? Dann hätte er sie betäuben müssen, sonst hätte sie nicht so entspannt, geradezu selig geschlafen. Sie fühlte sich ausgeruht und geborgen wie lange nicht mehr.
Sabine spürte einen warmen Atem im Nacken und eine Hand, die ihr über die Haare strich.
»Guten Morgen«, sagte eine tiefe Stimme.
Sie rollte sich herum und sah den Mann an, der auf der anderen Seite ihres Betts lag. Blond wie Carl, aber nicht mit streng zurückgekämmten, sondern gelockten und zudem komplett zerzausten Haaren, außerdem älter. Siebenunddreißig, das wusste sie, weil sie erst vor ein paar Wochen seinen Geburtstag gefeiert hatten.
Mit einem Schlag kehrte die komplette Erinnerung zurück.
Carl hatte es nicht geschafft, seine finsteren Absichten in die Tat umzusetzen, weil ihm zwei Männer in die Quere gekommen waren. Bernhard Schmittke und Holger Rahn, Kollegen aus dem LKA, die zufälligerweise in der Gegend unterwegs gewesen waren.
Der Club, in dem Sabine getanzt hatte, stand unter Beobachtung, weil man vermutete, dass dort mit Koks und Tabletten gedealt wurde. Die Zielperson, die Bernhard und Holger an diesem Abend festnehmen wollten, war nicht aufgetaucht. Stattdessen hatten sie gesehen, wie Sabine den Club verlassen hatte. Sie hatten auch den Mann entdeckt, der kurz nach ihr auf die Straße getreten war und sie verfolgt hatte.
Kurz entschlossen hatten sie sich an ihn drangehängt und waren deshalb zur Stelle gewesen, als Carl über sie hergefallen war.
Bernhard hatte ihm Handschellen angelegt und ihn in Polizeigewahrsam verfrachtet. Holger hatte Sabine nach Hause gebracht.
Sie hatte am ganzen Körper gezittert, und er hatte ihr ein heißes Bad eingelassen. Anschließend hatte er sie in eines ihrer großen, flauschigen weißen Handtücher gehüllt und trocken gerubbelt. Und dann hatte er sie einfach festgehalten.
Irgendwann hatten sich ihre Lippen gefunden. Sabine hatte nicht gewusst, ob es eine gute Idee war, doch der Wunsch, sich fallen zu lassen, war übermächtig gewesen.
Holger Rahn legte ihr die Hand an die Wange und strich mit dem Daumen darüber. Seine blauen Augen leuchteten. »Das war schön mit dir heute Nacht.«
Sabine lächelte, doch innerlich zuckte sie zusammen. War es nur das gewesen? Ein Trost für eine Nacht? Wollte er jetzt einfach gehen?
Sie betrachtete seinen blond gelockten Schopf, die Bartstoppeln auf dem Kinn, den muskulösen Brustkorb. Ein sportlicher, gut aussehender Typ. Single, weil er mit seinem Beruf verheiratet war, und außerdem ein Mensch, dem seine Freiheit über alles ging.
Sabine seufzte. Warum landete sie immer bei den falschen Männern?
Rahn hauchte ihr einen Kuss auf die Stirn und warf die Bettdecke beiseite. Er federte geradezu aus dem Bett und reckte sich.
Was würde er jetzt sagen?
Lass uns so tun, als wäre nichts passiert?
Die Kollegen müssen es ja nicht wissen?
Er hob seine Boxershorts vom Boden auf und stieg hinein. Schlüpfte in die dunkle Stoffhose, die er im Dienst stets trug, und das dunkelblaue Hemd, das so gut zu den blonden Haaren und den blauen Augen passte. Zuletzt zog er Socken und Slipper an und griff nach seiner schwarzen Lederjacke.
»Was hast du im Kühlschrank?«, fragte er.
Sabine blinzelte. »Kühlschrank?«
Holger Rahn grinste breit. »Ich dachte, ich koche Kaffee und besorge ein paar Brötchen. Ich würde gerne mit dir frühstücken. Aber ohne Wurst und Käse ist das nichts für mich. Wenn du nichts da hast, gehe ich schnell etwas einkaufen.«
Ein warmes Gefühl breitete sich in Sabines Brust aus. Dort, wo sich die s-förmige Narbe befand, die sie von einem Fall davongetragen hatte, der sie beinahe das Leben gekostet hätte. Holger hatte in der Nacht darüber gestreichelt und zärtliche Küsse darauf gehaucht.
»Es ist alles da«, erwiderte sie. »Wurst, Käse, Orangensaft. Ich habe sogar eine Flasche Sekt kalt gestellt.«
Rahn lehnte sich in den Türrahmen und sah ihr tief in die Augen. »Wenn du mich fragst: Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.«
Damit drehte er sich um und verließ das Schlafzimmer. Sabine hörte seine Schritte im Flur und gleich darauf die Wohnungstür, die ins Schloss fiel.
Sie ließ den Kopf auf das Kissen zurücksinken und lächelte.
Ein Mann, der Brötchen holte und Casablanca zitierte. Das war doch eine Perspektive.
Thalhausen war der ideale Ausgangspunkt. Von allen Seiten aus gut zu erreichen, nur ein paar Kilometer von Homberg an der Efze, der A7 und den Bundesstraßen 323 und 254 entfernt. Im Nordosten schloss sich ein ausgedehntes Waldgebiet an den Ort an, im Westen tangierte die stillgelegte Strecke der Kanonenbahn den Ortsrand. Der Wald lud zum Wandern ein und bot dafür einen großen Parkplatz, auf dem sich die Gruppe versammeln konnte. Fuhr man auf der schmalen Landstraße weiter nach Osten, gelangte man zum Wildpark Knüllwald.
Die alte Bahnstrecke zu reaktivieren wäre in vielerlei Hinsicht ein Gewinn für die Region. Eine bessere Anbindung der kleinen Ortschaften ans Schienennetz. Man wäre weniger abhängig vom eigenen Auto und hätte ein gutes Argument gegen den weiteren Ausbau der A49 und anderer viel frequentierter Straßen. Die Bahn wäre ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Erhaltung der Biotope für die hier beheimateten Tierarten.
Das waren die Begründungen, mit denen sein Bruder für den Wiederaufbau der Kanonenbahn warb, zusammen mit dem zu erwartenden wirtschaftlichen Aufschwung selbstverständlich. Damit waren jederzeit Befürworter zu gewinnen, wofür auch immer. Dass Dietmar sich als Bürgermeister der Gesamtgemeinde zusätzlich einen Katalysator für seine weitere politische Karriere und eine Festigung seiner Position, sprich: viele Wählerstimmen bei der nächsten Bürgermeisterwahl, erhoffte, sagte er natürlich nicht, aber Jürgen Geiger war sich sicher, dass das der eigentliche Antrieb war.
Dass sich eine Bürgerinitiative gegründet hatte, die energisch gegen die geplante Reaktivierung der Kanonenbahn protestierte, hatte jedoch nichts mit Dietmars Ambitionen auf ein Amt im Landtag oder gar im Bundestag zu tun. Vielmehr war es der Verdacht, der aufgekommen war, als ein Mitglied der kleinen, neu gegründeten Umweltpartei BioTOPP herausgefunden hatte, wer sich mit hohen Investitionen am Neuaufbau der Strecke beteiligen wollte: der im nahen Schwalmstadt ansässige Konzern ZYKLUS, spezialisiert auf die Abholung, Entsorgung und Wiederaufbereitung von Gift- und Sondermüll. Dahinter, so die Vermutung der Umweltpartei, stand der Plan, sich für die zahlreichen im Rahmen des Atomausstiegs anstehenden Transporte radioaktiven Mülls zu qualifizieren. Gerüchteweise war die Firma auch an den derzeit unter heftigen Protesten stattfindenden Rücktransporten wiederaufbereiteten Atommülls aus der Anlage in Sellafield beteiligt, der ins Zwischenlager nach Biblis auf das Gelände des stillgelegten Kernkraftwerks gebracht wurde.
Jürgen Geiger knirschte mit den Zähnen. Diese Transporte waren unsinnig. Solange es kein Konzept für die endgültige Lagerung gab, war das Verschieben von einem Ort an den anderen bestenfalls Augenwischerei. Schlimmstenfalls zerstörte man nicht nur Umweltressourcen, sondern auch Menschenleben. Als Biologe kannte er die Auswirkungen, die radioaktive Strahlen auf Lebewesen hatten. Dass die Castor-Behälter die Strahlung nicht zu hundert Prozent abschirmten, war eine durch viele Indizien belegte Vermutung.
Hinzu kam die Angst, dass sich die ZYKLUS AG nicht nur einen Wettbewerbsvorteil hinsichtlich der Transporte verschaffen wollte, sondern zusätzlich Fakten schuf, die bei der Suche nach einem Endlager eine entscheidende Rolle spielen könnten. Bisher standen die infrage kommenden Regionen Hessens nicht besonders weit oben auf der Liste. Doch mit der wiederbelebten Kanonenbahn könnte sich das ändern.
Aus diesem Grund hatte BioTOPP eine Bürgerinitiative gegründet, die gegen die Reaktivierung der alten Bahnstrecke kämpfte und stattdessen dafür warb, einen Radwanderweg daraus zu machen. Es war ein seltsamer Spagat, dass engagierte Bürger, die aus tiefster Überzeugung für öffentliche Verkehrsmittel und die Reduzierung des Individualverkehrs plädierten, sich plötzlich dagegenstellen mussten, doch Jürgen konnte die Argumentation nachvollziehen.
Er hatte sich dem Protest angeschlossen, der auch einen Graben quer durch die eigene Familie zog. Das betraf nicht nur seinen älteren Bruder Dietmar und ihn selbst, sondern zudem ihre Ehefrauen, die ohnehin schon seit der gemeinsamen Schulzeit im Clinch lagen. Von seinem Vater, einem Führer der Protestbewegung, ganz zu schweigen. Dazu kamen noch sein jüngerer Bruder Marius, der ebenfalls gegen die Kanonenbahn kämpfte, sich aber keinesfalls seinem Vater unterordnen wollte und außerdem das Vorgehen der Bürgerinitiative nicht radikal genug fand, und dessen vierzehnjähriger Sohn Elias, der ein großer Anhänger von Greta Thunberg war und sich mit seinem Großvater in Sachen Klimaschutz verbündet hatte.
Jürgen Geiger seufzte. Wenn es nach ihm ginge, würde die Bewegung mit Ruhe, Vernunft und wissenschaftlich fundiert agieren, doch dafür war sein Vater zu sehr Alt-Achtundsechziger. Für ihn war jeder Protest zugleich ein Kampf gegen das System, dem man sich auf keinen Fall unterordnen durfte.
Geiger nahm seine Brille ab und rieb sich die Augen. Es war noch früh am Morgen, die Sonne war eben erst aufgegangen, doch auf dem Parkplatz herrschte bereits reger Betrieb. Die Camper, Wohnwagen und umgebauten VW-Busse standen über den Platz verteilt, ungeordnet natürlich, wie es sich für Revoluzzer gehörte. Jemand bereitete Kaffee auf einem Campingkocher zu, die Aktivisten standen in kleinen Gruppen zusammen, vertilgten mitgebrachte Brote und diskutierten angeregt. Am Rand des Parkplatzes hatte eine Gruppe junger Frauen in selbst gestrickten Ringelpullovern ein weißes Laken auf dem Boden ausgebreitet und malte mit roter Plakafarbe große Buchstaben darauf. »Stoppt die Ka…«, konnte er entziffern. Einige Teilnehmer hatten sich bereits auf den Weg gemacht, um das erste Stück des Bahndamms von Thalhausen in Richtung Wernswig ein Stück weit abzulaufen, um festzustellen, ob die für heute geplante Aktion nach wie vor durchführbar war oder der Gegner womöglich Hindernisse installiert hatte. Nicht ohne Grund, in den letzten Wochen und Monaten hatte es schon einige scheinbar zufällige Polizeieinsätze gegeben, die ihre geplanten Proteste unterminiert hatten – auch solche, von denen die offiziellen Stellen eigentlich keine Kenntnis gehabt haben dürften. Aber heute schien alles glattzugehen, bisher waren keine Hiobsbotschaften von den Spähern eingetroffen.
Der Plan bestand darin, vom Parkplatz in Thalhausen aus die Kanonenbahnstrecke abzulaufen und Mahnmale aufzustellen. Vogelscheuchen, die »Atomkraft? Nein danke«-Schilder hochhielten, ein paar Skulpturen, die verstrahlte Lebewesen darstellen sollten, angefertigt von einem Künstler aus der Initiative. Dazu Transparente, die man an den Bäumen befestigen wollte, und mehrere Bahnen Absperrband, die sich von Thalhausen bis Frielendorf ziehen sollten, dem Ziel ihres heutigen Protestmarsches.
Jürgen blinzelte, weil er glaubte, neben einem der VW-Busse eine Bewegung wahrgenommen zu haben. Einen Schemen, eine Person? Sie ging nicht, sie huschte zum Waldrand und war gleich darauf verschwunden. Oder hatte er sich getäuscht?
Geiger setzte seine Brille wieder auf und spähte über den Platz. Fixierte den Bus, bei dem er die seltsame Gestalt zu sehen geglaubt hatte. Es war ein alter T3 Syncro in Nato-Oliv, mit zahllosen Aufklebern, die Heckscheibe glich einer Litfaßsäule.
Hatte der Mann etwas am Fahrzeug manipuliert? War das wieder ein Versuch, die geplante Demonstration schon im Vorfeld zu sabotieren?
Geiger ging näher an den Bus heran. Er war vielleicht noch fünfzehn Meter entfernt, als ihn ein gleißendes Licht aus dem Inneren des Busses blendete. Ein ohrenbetäubender Knall zerriss die Stille über dem Parkplatz. Die Metallhülle des T3 platzte auf, die Scheiben zerbarsten.
Jürgen Geiger wurde zurückgeschleudert. Glassplitter flogen ihm ins Gesicht. Etwas Hölzernes, ein Stuhlbein oder dergleichen, traf ihn vor die Brust und warf ihn zu Boden. Metallteile, Porzellanscherben und Plastikfragmente schossen durch die Luft und regneten auf ihn herab. Er spürte die Hitze der Explosion und sah Flammen, die aus dem geborstenen Fahrzeug in die Höhe züngelten.
Sein Gesicht brannte wie Feuer, Brust und Rückgrat fühlten sich an wie zertrümmert, die Beine waren taub. Sein Herz raste, das Blut rauschte laut in den Ohren, während sich sein Gehirn aufzulösen schien. Von weit her hörte er Stimmen, panische Rufe und schmerzerfüllte Schreie. Dann trug ihn eine gnädige Bewusstlosigkeit davon.
3
Es war ein merkwürdiges Gefühl, plötzlich auf der anderen Seite zu sitzen. Zwar trug er seine Uniform, und es war vollkommen klar, dass man ihn als Zeugen vernahm und ihn keiner wie auch immer gearteten Verfehlung beschuldigte, aber dennoch … Allein die Räume im Polizeipräsidium Mittelhessen schüchterten ihn ein. Dazu der Staatsanwalt mit dem grau melierten Haar in seinem teuren Anzug und dem durchdringenden Blick aus den dunklen Augen, und dieser Oberkommissar, der aussah, als hätte man ihn geradewegs aus dem Urlaub geholt mit seinen ausgebeulten Cargohosen, dem Wettergesicht und der Wuschelfrisur.
Der Staatsanwalt tippte auf das Foto, das zwischen ihnen auf dem Tisch lag.
»Sie können also bezeugen, dass dieser Mann den Stein geworfen hat?«
Seine Stimme klang so streng, dass Aaron beinahe salutiert hätte. »Jawohl.«
Der Oberkommissar kritzelte etwas in sein Notizbuch. Dann blickte er auf. »Sie kennen den Mann?«