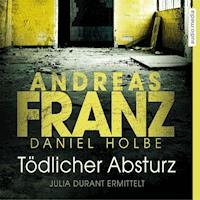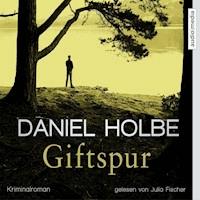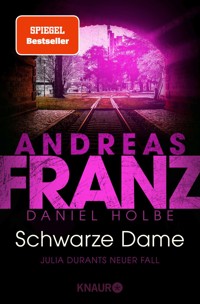9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Sabine-Kaufmann-Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Totenschädel im Edersee und Nazi-Gold im Darknet – Band 9 der Krimi-Reihe aus Hessen Im Krimi »Totengold« lassen die Bestseller-Autoren Daniel Holbe und Ben Tomasson ihre Kommissare Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach zum 9. Mal ermitteln. Das touristische Idyll am Edersee wird empfindlich gestört, als zwei Angler einen Totenschädel aus dem Wasser ziehen. Dazu kommen ein vermutlich rechtsradikaler Anschlag auf eine Politikerin sowie ein Hinweis aus dem Darknet, der ebenfalls in die Region führt: Jemand versucht, Nazi-Gold zu verkaufen. Ralph Angersbach und Sabine Kaufmann finden schnell heraus, dass der Schädel alt ist. Wahrscheinlich wurde er aus einem im See versunkenen Grab gespült. Gibt es einen Zusammenhang mit dem Gold und dem Anschlag auf die Politikerin? Im Zentrum der Ermittlungen taucht immer wieder die Familie Erdmann auf, doch konkrete Beweise fehlen. Dann gibt der Edersee weitere Leichenteile frei … Ein raffinierter und wendungsreicher Krimi mit einer brisanten Mischung aus kriminellen, politischen und privaten Abgründen und Verstrickungen Das Bestseller-Duo Holbe / Tomasson kombiniert auch im 9. Band der Krimi-Reihe klassische Polizei-Ermittlungen mit aktuellen Themen und starken Charakteren. Wer gerne Krimi-Serien wie »Tatort« oder »Polizeiruf 110« sieht, wird hier hochspannend unterhalten. Die Fälle des Ermittlerduos Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Giftspur - Schwarzer Mann - Sühnekreuz - Totengericht - Blutreigen - Strahlentod - Schlangengrube - Glutstrom - Totengold
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Daniel Holbe / Ben Tomasson
Totengold
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Alte Gräber, neue Leichen und eine Familie, die einiges zu verbergen hat
Das touristische Idyll am Edersee wird empfindlich gestört: Zwei Angler ziehen einen Totenschädel aus dem Wasser, auf eine Politikerin wird ein Anschlag verübt, und es gibt Hinweise, dass jemand aus der Gegend versucht, Nazi-Gold im Darknet zu verkaufen. Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach finden schnell heraus, dass der Schädel aus einem alten, im See versunkenen Grab gespült wurde. Gibt es einen Zusammenhang mit dem Gold und dem Anschlag auf die Politikerin? Auffallend ist, dass die Ermittlungen immer wieder um die Familie Erdmann kreisen, doch konkrete Beweise fehlen. Dann gibt der Edersee weitere Leichenteile frei …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
1
Sie hatten ihn ins Bett geschickt, aber er konnte nicht schlafen. Im Zimmer war es eiskalt, und die Decke war zu dünn. Von unten drangen die Stimmen der Männer zu ihm herauf. In der Wohnstube war die Spannung mit Händen zu greifen gewesen, hier oben in der winzigen Kammer unter dem Dach war es eine ferne Vibration. Trotzdem schien sie ihm durch Mark und Bein zu gehen.
Sein Vater war alles andere als begeistert gewesen, dass Onkel Herrmann seine Freunde mitgebracht hatte. Obwohl er nicht auf dem Hof lebte, ging Herrmann hier ein und aus, wie es ihm gefiel.
Seine Freunde waren Männer in Uniformen. Keine einfachen Soldaten, sondern solche, die etwas zu sagen hatten, mit jeder Menge Abzeichen auf Brust und Schultern. Feiste Gesichter, triefende Augen, eingehüllt in Wolken aus Tabakrauch und Alkohol. Sein Vater mochte die Männer nicht. Er mochte auch den Krieg und den Führer nicht. Das sagte er natürlich nicht laut, aber Willi hatte ihn schon manches Mal murmeln gehört.
Wir haben den Krieg längst verloren, doch diese Idioten begreifen es nicht.
Willi verstand seinen Vater nicht. Seit zwei Jahren war er Mitglied der Hitlerjugend. Sie unternahmen Wanderungen, gingen gemeinsam fischen und halfen, wo sie konnten. Es gab echte Kameradschaft. Er war nicht länger ein Hänfling, sondern stark genug, um überall mit anzupacken. Und sie hatten Spaß zusammen. Das war viel besser, als morgens in aller Herrgottsfrühe aufzustehen und die Kühe zu melken oder den stinkenden Stall auszumisten.
Allein. Seine drei älteren Brüder waren an der Front, die beiden Schwestern längst verheiratet. Nur die Eltern waren noch da und die Helfer, die man ihnen geschickt hatte. Hohläugige, ausgezehrte Männer. Sie sprachen eine Sprache, die Willi nicht verstand.
Französisch, hatte Onkel Herrmann ihm erklärt.
Die armen Kriegsgefangenen nannte seine Mutter sie.
Minderwertiges Volk, sagte Onkel Herrmann.
Unten wurden Stühle gerückt. Holzbeine schrammten vernehmlich über den Dielenboden. Die Stimmen wurden lauter.
Zu Jahresbeginn waren Bomben auf Kassel gefallen. Man hörte solche Dinge immer häufiger, die Leute fühlten sich nicht mehr sicher. Zum ersten Mal hatte er es im Frühjahr 43 mitbekommen. Der Flieger war wie aus dem Nichts gekommen. Er hatte das Brummen gehört, kurz darauf auch den Donner der Explosion. Gesehen hatte er es nicht, doch es gab genügend Zeugen, die davon berichten konnten. Eine einzelne Bombe in Form eines Fasses, das sich wie ein hüpfender Stein über die Wasseroberfläche bewegte, bis es vom tiefen Nass verschluckt wurde. Die Engländer hatten diesen Bombentyp entwickelt, die sogenannte Roll- oder Hüpfbombe, und es waren ausgerechnet deutsche Pläne von Staumauern, die ihnen dabei geholfen hatten. Das Ziel war es gewesen, eine Bombe zu kreieren, die sich von eventuellen Schutznetzen nicht abwehren ließ, sondern sich unter ihnen durchbewegte – über das Wasser, bis sie irgendwann versank. Lustig anzusehen, wie ein hüpfender Kieselstein, doch sie war alles andere als das. Zuerst brachte sie eine Unheil verkündende Stille. Dann kam die Zerstörung. Die Detonation hatte ein gewaltiges Loch in die Mauer gerissen, die Flutwelle war verheerend gewesen. Acht Meter hoch, wurde berichtet. Das Wasser wurde bis nach Kassel gespült und riss zahllose Häuser und Brücken mit sich. Bahngleise und Straßen. Doch genauso schnell, wie die Katastrophe gekommen war, hatte man sich wieder erholt. Keine Zeit für Schockstarre, man glaubte noch an den Endsieg. Die Mauer war innerhalb von Monaten von Zwangsarbeitern wiederaufgebaut worden.
Jetzt allerdings, zwei Jahre später, schien die Angst größer zu sein. Realer. Vom Gewinnen sprach schon lange keiner mehr, plötzlich war von Untertauchen die Rede gewesen, als Onkel Herrmann und seine Freunde sich allein geglaubt hatten. Den zwölfjährigen Willi nahmen sie nicht für voll. Er hatte nicht alles hören können, weil er die Körbe mit den Scheiten zum Kaminofen hatte schleppen müssen. Die Flammen prasselten und knisterten, während sie sich durchs Holz fraßen. Doch dass die Männer einen Plan für den Notfall schmiedeten, war klar.
Aber warum, wenn sein Vater recht hatte und Herrmann und seine Freunde nicht begriffen, dass es vorbei war? Oder wussten sie es längst, markierten aber die starken Männer, damit niemand ihre Zweifel zu spüren bekam?
Willi hielt es nicht länger im Bett. Er kroch unter der Decke hervor, streifte das braune HJ-Hemd, die kurze schwarze Hose und die Strümpfe über und schlüpfte in seine Holzpantinen. Nein, die machten zu viel Lärm. Er nahm die Schuhe in die Hand und schlich auf Strümpfen zur Tür.
Sie knarrte, weil das Holz verzogen war. Willi quetschte sich durch den schmalen Spalt.
Onkel Herrmann und seine Freunde verließen das Haus. Von Vater und Mutter war nichts zu sehen. Willi wartete einen Moment. Dann rannte er zur Tür und folgte den Männern in die dunkle Nacht.
Er sah flackerndes Laternenlicht, das sich zur Scheune bewegte. Die Männer gingen hinein und kamen kurz darauf mit mehreren kleinen Metallkisten zurück. Sie verluden sie auf dem Pritschenwagen, mit dem sie gekommen waren. Onkel Herrmann setzte sich ans Steuer. Die Männer kletterten auf die Ladefläche. Im nächsten Moment fuhr der Wagen vom Hof.
Willi stand mutterseelenallein in der Dunkelheit. Er sah, wie sich das Scheinwerferlicht zur Straße hin entfernte. Wenn der Wagen die Abzweigung nach Waldeck erreicht hatte, würde es verschwunden sein.
Aber das Licht tauchte wieder auf. Es bewegte sich hinter den kahlen Bäumen. Nicht nach Waldeck, sondern in Richtung Süden, hinunter zum See.
Willi dachte nicht lange nach. Er stieg in die Holzpantinen und rannte über den Hof zur Wiese. Sie lag am Hang und zog sich bis zur Talstraße hinunter.
Das Gras war nass. Mit den glatten Sohlen schlitterte er mehr, als dass er lief. Auf halber Höhe rutschte er aus und landete auf dem Hosenboden. Die Nässe drang durch den schweren Stoff und ließ ihn in der eisigen Luft frösteln. Willi wollte bremsen, aber er hatte so viel Schwung, dass er immer weiter rutschte. Ehe er es sichs versah, war er am Ende der Wiese.
Er rappelte sich auf und stolperte auf die Straße.
Das Scheinwerferlicht tauchte ein Stück entfernt wieder auf. Der Wagen bewegte sich zum See. Was wollten die Männer dort?
Willi schrak zusammen, als plötzlich Sirenengeheul einsetzte. Fliegeralarm! Das hatte es hier bisher nur wenige Male gegeben. Die winzigen Ortschaften waren kein bevorzugtes Ziel. Und nun ausgerechnet heute Nacht!
Willis Herz klopfte wie verrückt. Was sollte er tun? Zurück zum Hof? Aber der Weg den Hang hinauf war steil. Er würde nur langsam vorankommen, und vom Flugzeug aus würde man ihn sehen können. Lieber hinunter zum See. Dorthin, wo auch Onkel Herrmann und seine Freunde gefahren waren. Am Ufer gab es keine Häuser, also musste man auch keine Bomben abwerfen.
Willi rannte los und kürzte die Strecke über eine weitere Wiese ab. Der Weg war ihm vertraut. Im Sommer lief er oft hier hinunter, um schwimmen zu gehen. Was sollte man sonst tun, allein auf dem Hof, ohne Freunde?
Er sah, dass der Wagen irgendwo in der Nähe der Dorfstelle Berich hielt, jenem Bereich, an dem die Mauerreste die Einheimischen schmerzhaft daran erinnerten, dass sich hier einmal ein ganzes Dorf befunden hatte. Bis man es abgetragen hatte und das angestaute Wasser den Rest verschluckte. Onkel Herrmann und seine Freunde schienen keine Gedanken daran zu verschwenden, wie sie sich wohl auch keine Sorgen wegen des Fliegeralarms machten. Sie kletterten aus dem Wagen und klappten die Rückwand der Pritsche herunter.
Willi pirschte sich heran.
Bevor man beschlossen hatte, die Eder aufzustauen, hatten sich mehrere Dörfer entlang des Flusstals befunden. Genau wie Berich waren diese bis auf die Grundmauern abgetragen worden. Der Bericher Friedhof indes war geblieben. Statt die Toten umzubetten, hatte man die Gräber einfach mit Betonplatten verschlossen und versiegelt. Im August 1914 war der Bau der Staumauer abgeschlossen, im Herbst desselben Jahres verschwanden die Ortschaften zum ersten Mal unter Wasser.
Dieses Jahr waren die Gräber von Juni bis Mitte September überflutet gewesen. Dann war der Wasserstand langsam gesunken, und die Betonplatten waren ans Licht gekommen. Jetzt lag der Friedhof frei, und auch die Mauerreste der Häuser waren zu erkennen. Das passierte immer im Herbst, mal früher, mal später. Wie ein Wiedergänger tauchte Berich Jahr für Jahr aus den Fluten auf.
Als er jünger gewesen war, hatte Willi sich darüber gewundert, warum im Winter das wenigste Wasser im See war. Sein Vater hatte es ihm erklärt: Das aufgestaute Wasser wurde benutzt, um im Sommer die Wasserstände in der Weser und im Mittellandkanal hoch zu halten, damit die Wasserstraßen schiffbar blieben. Wenn die Sommer bis in den Spätherbst trocken blieben und ein frostiger Winter folgte, blieb der Pegel bis zum Einsetzen des Tauwetters niedrig.
Wie praktisch, dachte Willi, als er beobachtete, wie die Männer damit begannen, die Kisten vom Wagen zu laden und zu den Gräbern zu schleppen. Offenbar waren sie schwer. Onkel Herrmann lief neben den Männern her und beleuchtete den Weg über den abschüssigen Schieferhang.
Als sie die letzte Kiste hinuntertrugen, stolperte einer der Männer. Der andere konnte die Last nicht halten. Die Kiste polterte zu Boden, der Deckel sprang auf. Mehrere kleine, rechteckige Gegenstände fielen heraus und schlitterten über den steinigen Boden.
»Pass doch auf!«, fuhr Onkel Herrmann den Schuldigen an.
Willi starrte auf die Objekte, die sein Onkel hastig wieder aufsammelte. Er hatte zwar nie zuvor welches gesehen, aber trotzdem wusste er sofort, dass es Gold war. Der Glanz der rechteckigen, metallenen Stangen im Mondlicht ließ keinen Zweifel zu.
Herrmann warf die Goldbarren zurück in die Kiste. Willi beobachtete, wie die Männer eine der Betonplatten hochstemmten und die Metallkisten in das offene Grab hineinhievten. Anschließend ließen sie den Deckel wieder auf die Grabstelle sinken. Einer der Männer trug zwei große Eimer heran, die wohl Zement enthielten. Er schüttete den Inhalt rund um die Platte herum, und ein zweiter drückte die Masse mit einer Kelle fest. Nun nickten die Männer zufrieden. Sie kletterten den Schieferhang hinauf zur Straße und stiegen in den Wagen. Der Motor röhrte, die Scheinwerfer flammten auf. Einen Moment später sah Willi nur noch die roten Rücklichter.
Erneut stand er allein im Dunkel. Im fahlen Mondlicht, das ab und an zwischen den Wolken verschwand, war die Grabstelle nur noch zu erahnen.
Erst jetzt fiel ihm auf, dass das Sirenengeheul aufgehört hatte. Flugzeuge waren keine gekommen. Kein Geschützlärm, kein Donnerkrachen einschlagender Bomben wie bei einem Gewitter direkt aus der Hölle. Es war wohl ein Fehlalarm gewesen. Ihm kam ein unglaublicher Gedanke. Womöglich war sogar Onkel Herrmann dafür verantwortlich. Denn bei Bombenalarm stand niemand am Fenster und schaute hinaus. Die Verdunklung sorgte dafür, dass man sich draußen ungesehen bewegen konnte. Perfekte Bedingungen, um etwas zu verstecken, von dem niemand etwas wissen sollte.
Willi fühlte sich verwegen wie ein Abenteurer. Er wusste von dem Goldschatz! Warum sollte er dieses Wissen nicht nutzen? Wenn der Krieg tatsächlich verloren war, wie sein Vater unkte, würde man Geld brauchen, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Onkel Herrmann würde ihnen wohl kaum etwas abgeben.
Willi kramte in der Seitentasche seiner HJ-Hose und fand ein paar Streichhölzer. Wenn er einige Barren von dem Gold stibitzte, das Onkel Herrmann und seine Freunde in dem Grab versteckt hatten, würde das vermutlich gar nicht auffallen. In der Kiste, die zu Boden gefallen war, war ohnehin alles in Unordnung. Aber allein würde er die Platte nicht hochstemmen können. Er bräuchte Hilfe und das passende Werkzeug. Bestimmt könnte er das eine oder andere besorgen. Nicht jetzt. Später. Wenn er sich überlegt hatte, mit wem er teilen wollte. Aber dazu musste er sich merken, in welchem der Gräber sich der Schatz befand.
Willi stolperte über die Steine zum Friedhof und hockte sich neben die Grabplatte. Sie waren nummeriert, das wusste er.
Er riss ein Streichholz an und hielt es über die Plakette.
Nummer sieben.
2
Drei Einschusslöcher in drei Bäumen. Eine Reihe den Hang hinauf, ganz in der Nähe des Weilers Goldacker, bei der alten Mühle am Steinbach. Die zuständige Polizeistation hatte den Vorfall gemeldet.
Die Bäume standen an einem markierten Lehrpfad. Schilder erzählten die Geschichte der Entstehung von Pyrit, Kalkspat, Blei-Selen-Erz und Gold in den tiefsten Schichten des Schiefergesteins. In der alten Mühle befanden sich ein Museum und seit Neuestem auch die »Goldmühle«.
Sabine Kaufmann war bereits vor Ort gewesen, weil man beim LKA eine mögliche Gefahrenlage festgestellt hatte. Bei der routinemäßigen Suche nach verdächtigen Inhalten im Netz waren ihre Kollegen beim LKA Wiesbaden auf eine Anzeige im Darknet gestoßen, in der ein spektakulärer Fund zum Kauf angeboten wurde: Goldbarren mit aufgeprägtem Reichsadler und Hakenkreuz. Nazigold, das angeblich bei einem der hektischen Transporte zu Kriegsende auf dem Weg von der Reichsbank in Berlin nach Süddeutschland abgezweigt worden und in ein Versteck in Hessen gebracht worden war. So weit die Beschreibung.
Die Bilder, die es dazu gab, waren unscharf. Die Barren konnten ein Fake sein, davon gab es im Netz reichlich, oder das ganze Angebot war eine Finte, zusammengebastelt aus alten Fotos und leeren Versprechungen. Falls es aber tatsächlich ein echter Fund sein sollte, wäre der meldepflichtig, und der Schatz durfte nicht privat verkauft werden. Dass es sich um Stücke mit eindeutigen Nazisymbolen handelte, erhöhte die Brisanz.
Der Anbieter hatte sich mehrfach hier in der Region in unterschiedliche offene WLANs eingeloggt, das hatten die Kollegen von der IT in mühevoller Kleinarbeit herausgefunden, in Bärental, in Goldacker, in einem Restaurant unten am Edersee. Zudem wechselten die IP-Adressen und verschleierten die Identität des Verkäufers. Die Website selbst wurde auf einem Server auf den Philippinen gehostet, deren Betreiber keine Informationen herausrückten. Wer einen der Barren erwerben wollte, musste ein Angebot abgeben, seine Kontaktdaten hinterlegen und hoffen, dass sich der Anbieter bei ihm meldete. Außerdem solle das ernsthafte Interesse belegt werden, indem man Bilder schickte, die bewiesen, dass man zum »inneren Zirkel« gehörte – was auch immer damit gemeint war. Die Kollegen des LKA hatten einige Lockangebote gestartet, ohne Erfolg. Offenbar hatten sie nicht den richtigen Ton getroffen, oder die Wohnzimmer, die man mit Nazidevotionalien aus der Asservatenkammer bestückt hatte, waren nicht überzeugend gewesen. Vielleicht war auch die Sache mit dem »inneren Zirkel« anders gemeint gewesen?
Sabine Kaufmann war gemeinsam mit ihrer neuen Kollegin Lynn Burger hierhergekommen. Lynn hatte die Polizeischule mit Bestnoten absolviert und sich auf IT spezialisiert. Offenbar war sie gut, sonst hätte sie nicht mit Mitte zwanzig eine Chance im Landeskriminalamt bekommen.
Auf jeden Fall war sie sympathisch. Auch wenn es einen Altersunterschied von fünfzehn Jahren gab, konnte Sabine sich vorstellen, dass Lynn eine echte Freundin werden könnte. Davon hatte sie nach wie vor nur wenige. Petra Wielandt aus Bad Vilbel vielleicht, und Julia Durant in Frankfurt. Doch die Kontakte waren so sporadisch, dass es vermutlich übertrieben war, von Freundinnen zu sprechen.
Lynn stammte aus Wiesbaden, schien jedoch auch nicht über einen nennenswerten Freundeskreis zu verfügen. Warum, hatte Sabine noch nicht herausgefunden.
Seit zwei Wochen verfolgten sie die Spur des Nazigold-Anbieters, bislang ohne Erfolg. Ihr Chef hätte die Sache schon fast abgeblasen, doch dann waren dem LKA weitere Auffälligkeiten von den örtlichen Polizeistationen gemeldet worden. Ebenfalls am Edersee, in den Ortsbezirken Bärental und Goldacker.
Das eine Problem betraf die amtierende Ortsvorsteherin von Bärental, Laura Erdmann-Janssen. Sie hatte in den letzten Wochen mehrere anonyme Drohbriefe erhalten, bis hin zu Todesdrohungen. Man verlangte, dass sie umgehend ihr Amt niederlegte.
Das zweite Problem stand mutmaßlich mit dem ersten im Zusammenhang. Es ging um eine Gruppe junger Leute, die offenbar einer rechtsextremen Ideologie anhingen. Sie nannten sich »Die Schutzmacht« und veranstalteten Trainingscamps in einem Waldstück nahe Goldacker. Weil sich der Wald im Privatbesitz befand, konnte man das nicht verbieten. Der Eigentümer hatte auf Nachfrage erklärt, dass es nur ein Zeitvertreib seines Neffen sei. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsse.
Da Laura Erdmann-Janssen und ihr Kollege Philipp Rösner, Ortsvorsteher in Goldacker, mit allen ihnen verfügbaren Mitteln gegen die Gruppe vorgingen – unter anderem war eine Versammlung verboten, eine Kundgebung aufgelöst und eine Plakataktion unterbunden worden –, lag der Verdacht nahe, dass die Drohbriefe aus diesem Umfeld stammten. Aber Sabine und Lynn fehlten die Beweise.
Und nun hatte tatsächlich jemand auf Laura Erdmann-Janssen geschossen.
Die Politikerin hielt sich bemerkenswert senkrecht. Eigentlich war man hergekommen, um die neu eröffnete Goldmühle einzuweihen, eine Touristenattraktion, die auf den Goldabbau in der Region Bezug nahm. Früher hatte es Goldminen gegeben, und noch heute konnte man Goldflitter aus dem Fluss auswaschen. Es gab bereits die unterschiedlichsten Angebote, darunter auch solche, bei denen man das Gold vorab erwarb und in das Wasser schüttete, aus dem man es später herauswusch. Hier an der Mühle am Steinbach legte man Wert auf Authentizität, so gab es eine qualifizierte Führung durch einen Geologen, der sich auf Gesteinsformationen spezialisiert hatte, und das Angebot war außerdem mit einem Museum kombiniert, das die Geschichte der Goldsuche vom Edersee bis zum Eisenberg bei Goldhausen zeigte.
Kaufmann zog den Reißverschluss ihrer Outdoorjacke höher. Es war kalt an diesem Morgen. Ein scharfer Wind pfiff durch die Bäume, an denen nur noch vereinzelte Blätter hingen. Der Boden war von rotem und gelbem Laub bedeckt. Der Himmel war wolkenverhangen, aber zumindest sah es nicht nach Regen oder Schnee aus.
Ende November war kein besonders glücklicher Zeitpunkt für die Einweihung eines Lehrpfads im Wald, doch beim Umbau der alten Mühle zum Goldmuseum war es immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Lieferschwierigkeiten, die Insolvenz eines Subunternehmers und morsche Balken, die man erst nach Baubeginn entdeckt hatte. Als es endlich fertig war, waren der Sommer und die Herbstferien längst vorbei. Trotzdem hatte man entschieden, das Museum sofort zu eröffnen. Auch in den Wintermonaten kamen schließlich Touristen.
Tatsächlich hatten sich an diesem Samstag etliche Menschen hier versammelt, Einheimische und Feriengäste ebenso wie Tagesausflügler, darunter viele Familien mit Kindern, aber auch Erwachsene aller Altersklassen. Das Thema Gold weckte offenbar in vielen den Abenteuergeist.
Die Rede am Eingang zum Lehrpfad wäre eigentlich Philipp Rösners Aufgabe gewesen, Ortsvorsteher von Goldacker, doch der lag mit Grippe im Bett. Laura Erdmann-Janssen war für ihn eingesprungen. Anschließend war man den neu beschilderten Weg am Steinbach entlang und durch den Wald zur Mühle gegangen.
Dort waren dann die Schüsse gefallen. Dreimal kurz hintereinander, und jeweils knapp über den Kopf von Laura Erdmann-Janssen hinweg. Sabine hatte automatisch auf die Uhr gesehen. Es war elf Uhr dreiunddreißig gewesen.
Wäre Sabine dasselbe passiert, hätte sie am ganzen Leib geschlottert, da war sie sich sicher. Die Ortsvorsteherin dagegen saß kerzengerade auf der Kante zwischen den offenen Türen des Rettungswagens, die goldene Decke wie einen königlichen Umhang um sich gewickelt. Darunter sahen das edle schwarze Businesskostüm und die eleganten Pumps hervor. Allein die schwarze Pagenfrisur war ein wenig in Unordnung geraten. Davon abgesehen strahlte Laura Erdmann-Janssen ein ruhiges Selbstbewusstsein aus, um das Sabine sie beneidete. Als könnte die Welt ihr nichts anhaben, weil sie einen unsichtbaren Schutzpanzer trug.
»Wenn die jungen Leute hätten treffen wollen, hätten sie getroffen«, sagte die Ortsvorsteherin nun zu Lynn. »Schließlich absolvieren sie Schießtrainings im Wald. Die können eine Münze von einem Flaschenhals schießen. Mein Kopf, der um ein Vielfaches größer ist, wäre kein Problem gewesen.«
»Was war dann das Ziel des Anschlags?«, fragte Lynn, ihr Tablet in der einen, den zugehörigen Touchpen in der anderen Hand. Von ihrem Gesicht war kaum etwas zu sehen, weil sie einen dicken Wollschal um den Hals geschlungen hatte, der fast bis zur Nase reichte. Die passende Mütze hatte sie über die Ohren und bis zu den Augenbrauen heruntergezogen. An den Händen trug sie dünne schwarze Thermohandschuhe.
»Einschüchterung«, erwiderte Laura Erdmann-Janssen. »Die Jungs wollen, dass wir sie in Ruhe lassen. Aber den Gefallen werden wir ihnen nicht tun. Naziideologie hat hier nichts verloren. Bei uns sind alle willkommen, ob als Gäste oder ständige Bewohner. Und Trainingscamps im Wald können wir erst recht nicht dulden. Die Gegend hier bietet wunderbare Freizeitmöglichkeiten für junge Leute. Ganz sicher wollen wir nicht mit Fremdenhass und kruden Theorien in die Medien kommen. Das schadet nicht nur der Region, sondern auch den Menschen.«
Sie klang, als würde sie eine Wahlkampfrede halten. Sabine fragte sich, ob sie nicht anders konnte oder ob es ihre Strategie war, das Erlebte nicht zu nah an sich heranzulassen. Sie schob die Hände in die Jackentaschen und ärgerte sich, dass sie keine Handschuhe bei sich hatte. Aber als sie vor zwei Wochen hergekommen waren, waren die Temperaturen noch mild gewesen.
»Ein privates Motiv können Sie sich nicht vorstellen?«, fragte Kaufmann.
»Nein.« Die Ortvorsteherin kniff die Augen zusammen und schien nachzudenken. »Nein«, wiederholte sie mit fester Stimme. »Ganz bestimmt nicht.«
»Sie sind verheiratet?«
»Ja. Seit zwölf Jahren.«
»Gibt es Probleme?«
»Nicht mehr als in jeder anderen Ehe auch«, entgegnete die Ortsvorsteherin.
Sabine musterte sie. Hatte da ein Unterton mitgeschwungen?
»Haben Sie Kinder?«, fragte sie weiter.
»Nein.« Wieder war da etwas in Laura Erdmann-Janssens Stimme, das Sabine nicht so recht fassen konnte. Sie hätte gewettet, dass da noch mehr war. Trotzdem. Eine Ehekrise oder ungewollte Kinderlosigkeit waren noch lange kein Grund, auf den Partner zu schießen. Sie würden den Ehemann befragen, dann würde sich die Sache sicher klären. Im Augenblick waren die Mitglieder der »Schutzmacht« als Täter sehr viel wahrscheinlicher.
»Wir können Sie für eine Weile in einem sicheren Haus unterbringen«, schlug Lynn vor, doch Laura Erdmann-Janssen winkte ab.
»Ich sage doch: Wenn diese fehlgeleiteten jungen Leute mich hätten töten wollen, hätten sie es getan. Man muss sich deswegen keine Sorgen machen. Wichtig ist, dass man ihnen die Tat nachweist und sie zur Rechenschaft zieht, damit dieser unselige rechte Aktionismus endlich ein Ende hat.«
»Okay.« Kaufmann wusste, dass sie die Frau zu nichts zwingen konnte, auch wenn sie selbst die Lage längst nicht als so harmlos einschätzte. Extremisten, die Gewalt einübten, übten sie irgendwann auch aus, diese Erfahrung machten sie immer wieder.
Von den Polizeistationen Bad Wildungen und Korbach waren Beamte angerückt, die das Gelände der Museumsmühle und den Lehrpfad weiträumig abgesperrt hatten. Sie hatten die Besucher in die alte Mühle gebracht und führten eine erste Zeugenbefragung durch. Bisher ohne Erfolg. Alle waren schockiert. Viele hatten die Schüsse zunächst für einen Gag gehalten, eine Inszenierung, die das Abenteuerfeeling steigern sollte. Gesehen hatte niemand etwas. Die Bäume waren zwar weitestgehend kahl, aber in dem Waldstück gab es genügend dicht belaubte Büsche, hinter denen man sich verstecken konnte, oder der Schütze hatte sich einfach hinter einem der dickeren Baumstämme verborgen. Vermutlich hatte er ein Jagdgewehr benutzt, sodass er sich nicht in unmittelbarer Nähe hatte aufhalten müssen. Und nach den Schüssen war die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf Laura Erdmann-Janssen gerichtet gewesen. Niemand hatte eine flüchtende Person bemerkt.
Die Beamten fragten trotzdem weiter. Oft kam die Erinnerung zurück, wenn der erste Schock abgeklungen war. Außerdem hatten etliche Besucher die Rede und den Gang durch den Wald mit dem Handy gefilmt. Die Videos wurden gesammelt und mussten später ausgewertet werden. Vielleicht hatte ja doch jemand unbemerkt etwas eingefangen.
Das Smartphone in Sabines Jackentasche vibrierte. Sie zog es hervor und warf einen Blick auf das Display. Es war ihr Chef, Julius Haase. »Ja?«
»Hallo, Frau Kaufmann. Ich habe veranlasst, dass Sie Unterstützung bekommen. Ich nehme an, Sie haben nichts dagegen?«, sagte ihr Vorgesetzter. »Die Spurensicherung muss ohnehin anrücken. Solange das Motiv für die Tat nicht klar ist, können wir auch einen privaten Hintergrund nicht ausschließen. Das wäre dann eine Angelegenheit für das Polizeipräsidium Mittelhessen.«
Sabines Herz machte einen kleinen Satz. Sie war jetzt seit eineinhalb Jahren mit Ralph Angersbach zusammen, aber es fühlte sich immer noch frisch an. Was sicher auch daran lag, dass sie nicht zusammenwohnten. Von Wiesbaden nach Gießen waren es nur knapp hundert Kilometer, aber trotzdem fuhren sie die Strecke nicht jedes Wochenende. Schon allein, weil die Arbeit sie oft genug daran hinderte. Als Polizeibeamte kannten sie kaum geregelte Arbeitszeiten.
»Wer denn?«, fragte sie so unbeteiligt wie möglich.
»Der Kollege Angersbach«, erwiderte ihr Chef mit einem Grinsen in der Stimme. »Das ist Ihnen doch recht?«
»Ja. Klar.« Sabine bemühte sich um einen neutralen Tonfall und verabschiedete sich von Haase. Anschließend setzte sie Lynn ins Bild. Die neue Kollegin lächelte. »Dann lerne ich deinen Lover ja endlich mal kennen.«
Sabine, die eben noch voller Vorfreude gewesen war, wurde mit einem Mal mulmig zumute. Wie würde Lynn auf Ralph reagieren? Lynn war eine moderne junge Frau, zielstrebig und technikbesessen. Ralph war vielleicht nicht mehr so ein Grantler wie damals, als Sabine und er sich kennengelernt hatten, aber auch alles andere als ein smarter Typ. Die dunklen Haare mit den vielen grauen Strähnen, die sich eingeschlichen hatten, waren zu lang, die grüne Wetterjacke, die er so liebte, abgenutzt, und der Lada Niva, dieser riesige alte Geländewagen in verrostendem dunklem Grün, den er fuhr, schrie so deutlich »Umweltsünder«, als hätte es jemand in roter Farbe auf die Karosserie gesprüht. Dazu kam, dass Ralph ein ausgesprochener Technikmuffel war. Die beiden würden nicht viel miteinander anfangen können.
Egal, dachte Sabine. Das musste weder ihre beginnende Freundschaft mit Lynn stören noch Einfluss auf ihre Beziehung zu Ralph haben. Sie hoffte nur, dass Ralph die junge Kollegin nicht zu grob behandelte. Aber Lynn war tough, sie würde sich zu wehren wissen. Zumindest hoffte Sabine das.
Ralph Angersbach pfiff vor sich hin, während er den Lada Niva bei Fritzlar von der A 49 lenkte. Die Hangars der Kampfhubschrauber kamen in Sicht. Doch der Himmel blieb leer. Keine Flugbewegungen, kein Manöver. Ralph wusste, dass hier die einzigen Eurocopter-Tiger Deutschlands stationiert waren, dasselbe Hubschraubermodell, um das es in dem James-Bond-Streifen Golden Eye gegangen war. Außerdem starteten vom Heeresflugplatz Fritzlar einmal pro Jahr die Flugzeuge für ein mittlerweile recht berühmtes Manöver: den Absprung der Fallschirmspringer über dem Edersee. Das sogenannte Notverfahren Wasserlandung sollte den Ernstfall simulieren. Nicht ungefährlich, vor allem wenn ein niedriger Wasserstand herrschte. Angersbach ließ seine Gedanken noch ein wenig kreisen, während er über die Bundesstraße in Richtung Bad Wildungen fuhr. Von dort war es nur noch ein Katzensprung bis an den Edersee. Die Fahrt von Gießen aus dauerte insgesamt gut eineinhalb Stunden, aber die Zeit verging wie im Flug.
Ein wenig schämte Angersbach sich für seine gute Laune. Immerhin war ein Mordanschlag auf eine Politikerin verübt worden. Aber die Frau lebte ja noch, und Ralph freute sich einfach darauf, Sabine zu sehen.
In den letzten Wochen hatte er mit einem komplizierten Fall zu tun gehabt, und der Plan, am Wochenende an den Edersee zu fahren, hatte sich nicht verwirklichen lassen. Jetzt konnte er Sabine nicht nur besuchen, sie durften sogar wieder zusammenarbeiten. Ganz korrekt war das nicht, aber Sabines Chef im LKA war ein lockerer Typ, und er hatte ein Herz für die Liebenden.
Angersbach umkurvte Bad Wildungen auf der Ortsumgehung und fuhr weiter in Richtung Mehlen. Dahinter, auf halber Strecke zwischen Buhlen und Netze, zweigte die Straße nach Goldacker ab und kurz darauf der Weg zur alten Mühle am Steinbach.
Er musste nicht lange suchen. Mehrere Einsatzfahrzeuge standen bereits auf dem Waldparkplatz. Ralph parkte direkt dahinter, zeigte dem Beamten an der Absperrung seinen Ausweis und betrat den Pfad, der von großen, modern gestalteten Informationstafeln gesäumt war. Er warf nur einen kurzen Blick darauf. Es ging um Gold. Entstehung, Vorkommen, Abbau. Ein mühseliges Unterfangen, soweit er das im Vorbeigehen erkennen konnte. Aber vielleicht war es ja der Königsweg zum großen Reichtum?
Vor ihm tauchte das alte Mühlengebäude auf, ein imposantes Fachwerkhaus mit weiß gestrichenen Wänden, schwarzen Balken und rotem Ziegeldach. An der Seite, die dem Bach zugewandt war, befand sich ein großes Schaufelrad, das früher wohl über die breite Rinne gespeist worden war, die vom Bach zur Mühle verlief. Jetzt stand es still. Wenn überhaupt, wurde es nur noch für den Museumsbetrieb in Gang gesetzt.
Ralph sah eine Gruppe von Menschen, die um die offenen Türen eines Rettungswagens versammelt waren. Eine Frau mit einer goldenen Rettungsdecke um die Schultern saß auf dem Rand. Neben ihr stand Sabine in ihrer roten Outdoorjacke. Die kurzen blonden Haare wurden von den Windböen aufgeweht, die zwischen den Bäumen hindurchpfiffen. Ralphs Mundwinkel hoben sich wie von selbst.
Sabines Augen leuchteten auf, als sie ihn entdeckte. »Ralph!«
Für einen kurzen Moment sah es aus, als wollte sie ihn in die Arme schließen und küssen, aber dann beließ sie es bei einem Lächeln und stellte die Anwesenden vor.
Von Lynn Burgers Gesicht war zwischen Mütze und Schal kaum etwas zu sehen, abgesehen von zwei wachen, kornblumenblauen Augen und einer spitzen Nase. Sie musterte ihn neugierig, ebenso wie die Frau, die hinten im Rettungswagen hockte. Die Ortsvorsteherin Laura Erdmann-Janssen.
»Ich fürchte, Sie sind umsonst gekommen«, erklärte diese. »Ich bin mir sicher, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handelt.«
»Wenn sich Ihr Verdacht bestätigt, überlasse ich die Sache dem LKA«, sagte Angersbach, ein wenig zu schroff vielleicht. »Aber wir müssen alle Möglichkeiten prüfen. Das ist unsere Pflicht.«
»Sicher.« Die Ortsvorsteherin ließ sich von seinem harschen Ton nicht aus der Ruhe bringen. »Ich wollte Ihnen nur unnötige Arbeit ersparen.«
»Sie entschuldigen uns kurz?« Sabine griff nach Ralphs Arm und zog ihn ein paar Schritte beiseite. Lynn Burger folgte ihnen.
»Sie hat vermutlich recht«, erklärte Sabine, als sie außer Hörweite waren, und berichtete knapp über die Probleme mit der rechtsradikalen Gruppe. Andeutungen hatte sie bereits im Lauf der beiden letzten Wochen am Telefon gemacht, wenn sie abends über ihren Tag gesprochen hatten, mehr jedoch nicht. Bisher war er nicht in die Ermittlungen involviert gewesen, und obwohl sie beide Polizeibeamte waren, hielten sie sich an die Regel, Ermittlungsdetails nicht zu verraten.
Lynn zog ihr Tablet hervor. »Wir könnten uns aufteilen«, schlug sie vor. »Wir kümmern uns um die jungen Leute mit der zweifelhaften Gesinnung, während du das private Umfeld in Augenschein nimmst.« Sie lächelte Ralph an. »Ich habe das schon recherchiert. Lauras Ehemann Christian arbeitet bei einer Firma, die eng mit dem Nationalparkamt Kellerwald-Edersee und dem zuständigen WSA – dem Wasser- und Schifffahrtsamt – kooperiert. Er ist Ingenieur. Lauras Eltern leben in Düsseldorf. Ihnen gehört eine Reihe von Juweliergeschäften. Ansonsten hat sie keine lebenden Angehörigen. Christian hat noch einen jüngeren Bruder, Kai, und sein Großvater Willi besitzt einen Hof hier in der Nähe, in Bärental. Das ist der Ortsbezirk, dem Laura Erdmann-Janssen vorsteht. Die Eltern von Christian und Kai Erdmann sind bereits tot. Ein Autounfall auf regennasser Fahrbahn vor drei Jahren. Dasselbe gilt auch für weitere Verwandte. Willi Erdmann hatte fünf Geschwister, drei Brüder und zwei Schwestern, von denen nur der eine Bruder und die eine Schwester den Krieg überlebt haben, aber die sind schon vor langer Zeit kinderlos verstorben.«
Angersbach schwirrte der Kopf. »Kann ich das schriftlich haben?«
»Klar. Gib mir einfach deine Nummer, ich schicke es dir aufs Handy. Die Adressen habe ich auch schon rausgesucht.«
»Super.« Ralph fühlte sich überrumpelt. Aber Sabine hatte ja schon erwähnt, dass die neue Kollegin ein IT-Freak war. Und das einem Technik-Dinosaurier wie ihm! Wahrscheinlich würde sie sich totlachen, wenn sie herausfand, wie weit er der Entwicklung hinterherhinkte.
Er diktierte seine Handynummer, die Lynn flink in ihr Gerät tippte. Gleich darauf summte Ralphs Smartphone. Er öffnete die Datei, die Lynn ihm geschickt hatte. Es war eine ordentliche Tabelle, in der sämtliche Namen verzeichnet waren, die sie genannt hatte, dazu alle relevanten Informationen, die Adressen und sogar Fotos.
»Wow. Gute Arbeit«, sagte er.
Lynn lächelte, jedenfalls nahm er das an. Ihren Mund konnte er unter dem Schal nicht sehen, aber neben ihren Augen erschienen kleine, ausgesprochen aparte Fältchen.
»Gut.« Ralph steckte das Handy wieder ein. »Dann nehme ich mir als Erstes den Ehemann vor.« Er blickte zu der Frau im Rettungswagen. »Bringt ihr sie in ein sicheres Haus?«
»Das will sie nicht«, erwiderte Sabine.
»Okay.« Angersbach betrachtete die Frau mit dem dunklen Pagenkopf. Sie wirkte selbstbewusst und energisch, selbst in dieser Situation. Man würde ihr sicher nichts aufschwatzen können, das sie nicht wollte. »Habt ihr sie darauf angesprochen, wie ihre Ehe ist?«
»Ja.« Sabine wiegte den Kopf. »Sie sagt, es gibt keine größeren Probleme. Aber in ihrer Stimme war etwas … Ich weiß nicht. Ich kann es nicht greifen. Ich glaube, da ist mehr, als sie uns sagen will.«
»Das ist doch normal, dass nicht immer alles rundläuft«, meldete sich Lynn zu Wort. »Und dass man seine persönlichen Probleme nicht vor der Polizei ausbreiten möchte.« Sie hielt Ralph ihr Tablet hin. »Es gibt einen recht aktuellen Artikel über die beiden. Sie scheinen ein echtes Traumpaar zu sein.«
Angersbach warf nur einen kurzen Blick auf das Hochglanzfoto, das Laura mit einem attraktiven Mann vor einem hübschen Haus zeigte. »Das ist die Fassade. Dahinter kann es ganz anders aussehen.«
3
Die Kollegen von der Spurensicherung suchten systematisch den abgesperrten Bereich ab. Der Kriminaltechniker, der die Kugeln aus den drei Baumstämmen eingesammelt hatte, hielt die Tüte gegen das Licht und kniff die Augen zusammen.
»Gewehrmunition«, sagte er zu Sabine Kaufmann und Lynn Burger. »Sehen Sie die Rillen von den Zügen und Feldern?«
Die Beamtinnen nickten. Spuren, die entstanden, wenn die Patrone durch den Lauf gepresst wurde, von den Fachleuten als Züge und Felder bezeichnet, ließen eindeutige Rückschlüsse auf die verwendete Waffe zu.
»Eine Büchse also«, folgerte Lynn, »keine Flinte.«
Anders als Büchsen hatten Flinten keinen gezogenen, also mit Rillen versehenen, sondern einen geraden Lauf. Die Rillen stabilisierten die Flugbahn des Geschosses. Außerdem hinterließen sie Spuren, die eine Zuordnung zur verwendeten Waffe möglich machten.
Der Kriminaltechniker nickte. »Ein Repetiergewehr mit Zielfernrohr vermutlich. Da kommen verschiedene Modelle in Betracht. Wir können das genauer sagen, wenn wir die Geschosse im Labor unter die Lupe genommen haben. Aber halten Sie ruhig schon mal Ausschau nach einem Jagdgewehr.«
Lynn hielt bereits ihr Smartphone in der Hand. »Ich beantrage einen Durchsuchungsbeschluss für die Gebäude auf dem Gelände, wo sich die ›Schutzmacht‹ trifft. Das sind schießwütige Typen, Waffennarren – und wahrscheinlich Schlimmeres. Wenn wir jemanden suchen, der abgebrüht genug ist, in der Öffentlichkeit mit einem Jagdgewehr rumzuballern, dann wohl bei denen.«
Kaufmann beobachtete, wie die Spurensicherer versuchten, mit einem Winkelmessgerät den ungefähren Standort des Schützen zu ermitteln. Sie konstruierten aus den Eintrittsstellen der Geschosse in den Bäumen imaginäre Linien, die sich in etwa hundertfünfzig Meter Entfernung trafen. Ein Kriminaltechniker richtete einen Laserpointer auf die Stelle, ein zweiter markierte den Baum, der dort stand, mit roter Farbe. Die Kollegen untersuchten den Bereich und winkten kurz darauf Sabine und Lynn heran.
»Hier hat jemand gestanden.« Der Spurensicherer wies auf die Erde hinter dem markierten Baum, die Teilabdrücke von Sohlen mit grobem Profil aufwies.
Lynn sah hinüber zu dem Punkt, an dem Laura Erdmann-Janssen gestanden hatte. »Kein leichter Schuss.«
»Für einen geübten Schützen …« Der Kriminaltechniker zuckte mit den Schultern.
»Das bedeutet, dass unser Täter gut mit einer Waffe umgehen kann.« Sabine machte sich Notizen.
»So gut nun auch wieder nicht«, bemerkte der Kriminaltechniker. »Sonst hätte er nicht dreimal danebengeschossen.«
»Bisher wissen wir nicht, was seine Absicht war. Womöglich wollte er gar nicht treffen, sondern das Opfer nur einschüchtern. Dann wiederum wäre er ein sehr guter Schütze.«
Lynn deutete auf den Waldboden. »Können wir mit den Schuhabdrücken etwas anfangen?«
»Schwierig.« Der Kriminaltechniker beäugte die Abdrücke. »Mit Glück können wir vom Profil auf die Marke schließen. Für die Größenbestimmung sind die Fragmente zu klein, und einen vollständigen Abdruck gibt es gar nicht.«
»Sonstige Spuren?«, fragte Sabine.
»Nein.« Er wies auf den von bunten Blättern bedeckten Waldboden. Undankbarer Tatort, sagte sein Blick. »Selbst wenn es da etwas geben sollte, ein paar Fasern oder Haare – wir werden es zwischen all dem Laub nicht finden.«
»Also müssen wir uns an die Menschen halten.« Kaufmann steckte ihr Notizbuch ein. »Dann statten wir den Mitgliedern der ›Schutzmacht‹ mal einen Besuch ab.«
Lynn nickte grimmig. »Ich bin gespannt, was sie dazu zu sagen haben.«
Das Haus war in Wirklichkeit noch weitaus schöner als auf dem Foto in der Zeitschrift. Es lag direkt am See auf einem Ufergrundstück, dessen weitläufige Rasenfläche an einem Bootssteg endete. Dort dümpelte eine weiße Segeljacht auf dem Wasser. Auf der Wiese vor dem Steg stand ein gemütlich aussehender Gartenpavillon.
Ralph Angersbach versetzte es einen leichten Stich. Seit Jahren träumte er von einem eigenen Haus. Nicht am See, sondern irgendwo im Vogelsberg. Aber weder das eine noch das andere lag momentan im Bereich des Möglichen. So ein Haus am See würde er sich im Leben nicht leisten können, auch wenn er vom Erbe seiner verstorbenen Mutter ein wenig Geld auf der hohen Kante hatte. Für ein Haus im Hohen Vogelsberg würde es reichen, doch wollte er den Weg zu seiner Dienststelle in Gießen tagein, tagaus und bei jeder Witterung fahren? Selbst wenn er diese Anstrengung auf sich nähme – für Sabine wäre die Strecke nach Wiesbaden auf jeden Fall viel zu weit.
Wenn sie zusammenziehen wollten, kam im Grunde nur ein Ort irgendwo zwischen Wiesbaden und Gießen infrage. Friedberg, Bad Homburg oder Bad Nauheim vielleicht. Meilenweit vom Vogelsberg entfernt, auch wenn dafür der Taunus in greifbarer Nähe wäre, dafür vermutlich auch viel teurer. Aber für Ralph war das nicht so einfach austauschbar, und die Wege wären unterm Strich immer noch lang. Außerdem nahm der Pendlerverkehr auf den Straßen immer weiter zu. Um nicht jeden Tag Stunden im Auto verbringen, im Stau stehen oder sich in überfüllten und verspäteten Zügen drängen zu müssen, war es besser, so nah wie möglich an der Dienststelle zu wohnen.
Dachte man das Thema zu Ende, war die einfachste Lösung, dass einer von ihnen die Stelle wechseln und sie in benachbarten Dezernaten arbeiten würden. Wiesbaden und Mainz, zum Beispiel, oder Gießen und Marburg. Doch freie Stellen in ihrer Besoldungsgruppe waren schwer zu finden, und keiner von ihnen wollte den Kapitalverbrechen abschwören, was die Auswahl zusätzlich einengte.
Angersbach schob den Gedanken beiseite. Er war nicht hier, um über seine private Situation zu grübeln.
Nach kurzem Zögern lenkte er den Lada auf den Kiesweg zum Haus und stellte ihn in der Nähe des Eingangs ab. Direkt neben dem zweistöckigen Gebäude befand sich eine Garage mit Doppeltor. Eines davon stand offen und gewährte den Blick auf die beiden Fahrzeuge im Inneren, einen roten SUV und ein silbernes Mercedes-Cabriolet. Ralph nahm an, dass das Cabriolet der Ortsvorsteherin gehörte und der Jeep dem Ehemann.
Weil er ein Faible für Geländewagen hatte, betrat er die Garage. Der Jeep war ein neuer Compass Trailhawk. Angersbach hatte sich das Modell erst kürzlich in einer Zeitschrift angesehen. Ein Plug-in-Hybrid mit einem Benzinverbrauch von nur zwei Litern auf hundert Kilometer. In Grün gab es ihn nicht, aber das Modell vor ihm hätte ihm auch gefallen. Er wusste sogar noch, dass die Farbe Coloradorot hieß. Der Wagen hatte durchaus Potenzial, sich als würdiger Ersatz für seinen Niva zu erweisen. Aber solange die Sache mit dem Haus nicht geklärt war, kam es nicht infrage, über fünfzigtausend Euro für einen Neuwagen auszugeben. Natürlich, die Besoldungsgruppe A 10, die er als Kriminaloberkommissar hatte, erlaubte ihm auch eine Finanzierung. Aber die Zeit der lukrativen Zinsen war vorbei, und alles andere wurde ebenfalls ständig teurer. Außerdem fuhr sein Dinosaurier ja noch, also bestand keine Eile. Und an sich war ohnehin klar, dass auch der Neue wieder ein Lada Niva sein sollte. Die Entscheidung für den Wagen war eine Herzensangelegenheit. Er würde bei Gelegenheit nach einem guten Gebrauchten Ausschau halten, der seinem alten ähnlich war und kein Vermögen kostete.
Angersbach wandte sich von dem Fahrzeug mit der auffälligen Front ab und ging zum Haus. Er hatte bei Christian Erdmanns Arbeitgeber angerufen und erfahren, dass der Ingenieur am Vormittag dort gewesen, mittags aber nach Hause gegangen sei, weil er sich nicht wohlfühlte. Erst als er schon auf dem Weg zu Erdmanns Privatadresse gewesen war, war ihm eingefallen, dass Samstag war. War es normal, dass Erdmann auch am Wochenende arbeitete?
Tatsächlich sah der Mann, der ihm die Haustür öffnete, bemitleidenswert aus. Die Augen waren gerötet, die Lider geschwollen. Das lockige dunkle Haar hing ihm strähnig ins Gesicht. Die Lippen waren blass, die Haut fahl, und auf der Stirn standen Schweißperlen.
»Ich gebe Ihnen lieber nicht die Hand«, sagte er, nachdem Ralph sich vorgestellt hatte. »Ich fürchte, es könnte etwas Ansteckendes sein.« Er deutete in den Hausflur. »Wollen Sie trotzdem hereinkommen?«
Angersbach hatte keine große Lust, sich ein Virus einzufangen, aber er konnte den angeschlagenen Mann schlecht bitten, sich mit ihm auf dem Vorplatz zu unterhalten. Dafür war es zu kalt, auch wenn die Sonne verlockend vom klaren blauen Himmel schien. Der Wind war frisch, und die Temperaturen lagen deutlich unter der Zehn-Grad-Marke.
Er folgte Christian Erdmann ins Haus, das schlicht und modern, aber sichtlich teuer eingerichtet war. Erdmann führte ihn ins Wohnzimmer. Durch die großen Panoramafenster glitzerte das blaue Wasser des Sees in der Sonne.
Angersbach nahm in der Sitzecke Platz, Erdmann im Sessel gegenüber, in dem er offenbar auch vor Ralphs Eintreffen gesessen hatte. Er wickelte sich in die bunte Wolldecke, die über der Lehne hing, und deutete auf das Stövchen mit der Teekanne auf dem Tisch. »Bedienen Sie sich. Tassen stehen auf dem Regal hinter Ihnen.«
»Danke.« Angersbach wehrte ab. Er hatte keine Lust auf Erkältungstee.
Erdmann schenkte sich nach, rührte einen Löffel Honig in den Tee und nippte an der Tasse. »Also. Was kann ich für Sie tun?«
»Sie wissen, was passiert ist?«, erkundigte sich Angersbach.
»Nein.«
»Ihre Frau hat Sie nicht informiert?«
»Worüber denn?«
»Man hat auf sie geschossen.«
Erdmann wäre beinahe die Tasse aus der Hand geglitten. Tee schwappte auf die Wolldecke. »Wie bitte?« Seine Hand zitterte leicht. »Ist sie verletzt?«
»Nein. Der Schütze hat sie verfehlt.«
»Gott sei Dank.« Erdmann stellte die Tasse auf dem kleinen Tisch zwischen ihnen ab.
»Haben Sie eine Idee, wer das getan haben könnte?«, fragte Ralph.
»Diese Idioten von der ›Schutzmacht‹«, erwiderte Erdmann ohne Zögern.
»Weshalb?«
»Laura legt ihnen Steine in den Weg. Wir bekommen seit einiger Zeit Drohbriefe.«
»Sie beide?«
»Meine Frau. Aber mich versetzt das in Sorge. Das verstehen Sie vielleicht?«
»Klar.« Ralph zückte sein Notizbuch. »Wo waren Sie heute Morgen, zwischen elf und zwölf?«
»Ich …« Erdmann kniff die Augen zusammen. »Moment mal. Fragen Sie nach meinem Alibi?«
»Das muss ich.«
Erdmann atmete tief durch.
Angersbach dachte, er würde sich echauffieren, doch dann seufzte er nur erschöpft. »Schon okay. Ich habe nichts zu verbergen. Ich war in der Firma.«
»Arbeiten Sie immer am Samstag?«
»Wir haben viel zu tun. Ich bin froh, wenn ich den Sonntag freihabe. Samstags arbeite ich fast immer.«
»Wo?«, fragte Ralph, obwohl er das schon wusste.
»In einem Ingenieurbüro in Waldeck. Wir sind vorwiegend für das Nationalparkamt Kellerwald-Edersee und das Wasser- und Schifffahrtsamt Weser tätig, aber auch für andere Kunden. Momentan beschäftigen wir uns mit der Sanierung der Edertalsperre. Da sind Schäden an der Staumauer aufgetreten. Deshalb haben wir Anfang Oktober den Pegelstand gesenkt und Pontons installiert, von denen aus wir die schadhaften Stellen ausbessern können. Mittlerweile sind die Arbeiten fast abgeschlossen. Ende der Woche werden die Löcher zubetoniert, und ab nächsten Samstag kann das Wasser wieder steigen. Dazu ist allerdings noch einiges an Vorbereitung vonnöten. Damit habe ich mich heute Vormittag beschäftigt. Ich war um acht im Büro, doch so gegen zwölf hat mir der Schädel derart gedröhnt, dass ich entschieden habe, nach Hause zu gehen und mich hinzulegen. Ich habe das Büro nur einmal kurz verlassen, um zur Toilette zu gehen und mir einen Kaffee zu holen. Meine Sekretärin kann das bestätigen. Sie war die ganze Zeit anwesend. Obwohl sie samstags sicher auch lieber daheim wäre. Aber ich brauche sie. Sie hätte es bemerkt, wenn ich zwischendurch aus dem Haus gegangen wäre.«
Angersbach machte sich Notizen. Was Erdmann berichtete, war interessant, auch wenn er sich wunderte, dass der Ingenieur derart ins Reden kam, obwohl er sich doch nur nach seinem Alibi erkundigt hatte. »Darf ich Sie fragen, ob Sie eine gute Ehe führen?«
»Ja.«
Ralph hob die Augenbrauen.
Erdmann lachte. »Das war bereits die Antwort. Ja. Wir führen eine gute Ehe.«
»Können Sie das genauer erläutern?«
»Was wollen Sie denn hören? Wir versuchen, Zeit miteinander zu verbringen, soweit unsere Arbeit das zulässt. Wir sind beide stark ausgelastet. Wir reden viel miteinander. Das ist das Wichtigste. Wir treffen uns mit Freunden, gehen gelegentlich zusammen essen oder ins Theater, wir fahren mit dem Boot raus.« Ein Grinsen huschte über seine Lippen. »Und wir kommen mit Vergnügen unseren ehelichen Pflichten nach, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Ja. Danke.« Das war ein Thema, über das Ralph nur ungern sprach, auch mit Sabine. Ihr ging es zum Glück nicht viel anders. Sie kuschelten gern, und manchmal ergab sich mehr daraus, aber sie machten nicht viele Worte darüber. Sie genossen einfach die Nähe, das Verschmelzen mit dem anderen und das wohlige Gefühl, wenn sie erschöpft nebeneinanderlagen und ihre Herzen im Gleichklang schlugen.
»Sie haben gefragt.« Das Geplänkel mit Ralph schien Christian Erdmann gutzutun und ihm über den Schock und die Erkältung hinwegzuhelfen. Sein Gesicht bekam etwas Farbe, und in den matten Augen entdeckte Angersbach ein Funkeln.
Er dachte an die Aufstellung, die Lynn Burger ihm geschickt hatte. »Kinder haben Sie keine?«
»Nein.« Erdmann wurde wieder ernst. »Das passte nicht zu Lauras Plänen. Sie will hoch hinaus in der Politik, da bleibt keine Zeit für ein Kind.«
»Und Sie?«
»Ich hätte es mir vorstellen können, aber ich bin auch so zufrieden. Mir ist vor allem wichtig, dass Laura glücklich ist.«
»Verstehe.« Angersbach dachte nach. »Wie ist das Verhältnis Ihrer Frau zu den anderen Familienmitgliedern?«
Erdmann runzelte die Stirn. »Wen meinen Sie da? Ihre Eltern? Die leben in Düsseldorf. Laura besucht sie gelegentlich, und im Sommer verbringen sie gern ein paar Wochen hier bei uns. Wir haben ein schönes Gästezimmer im Obergeschoss, mit eigenem Bad und Zugang zum Garten. Eigentlich ist es eher ein Ferienapartment.« Er hob die Hand, bevor Ralph etwas sagen konnte. »Das Verhältnis: Laura vergöttert ihren Vater und liebt ihre Mutter, und umgekehrt ist es genauso. Eine Bilderbuchfamilie.«
»Und wie ist es mit Ihnen?«
Erdmann neigte den Kopf. »Was meinen Sie?«
»Wie kommen Sie mit Ihren Schwiegereltern zurecht?«
Erdmann fuhr sich durch die feuchten Haare. »Ich werde akzeptiert. Für Lauras Eltern ist es eine Ehe unter Stand, aber zumindest sehen sie mich nicht als völligen Fehlgriff.«
Die Eltern besaßen eine Kette von Juweliergeschäften, erinnerte sich Ralph. »Sie sind Ingenieur.«
»Richtig. Aber damit bewegt man sich nur im oberen Bereich der Mittelschicht. Laura und ihre Eltern gehören zur Oberschicht.« Erdmann machte eine Handbewegung, die Haus und Grundstück umfasste. »Anders könnten wir uns das hier nicht leisten.«
»Wenn Ihre Ehe schlecht wäre, wäre das ein Mordmotiv.«
Erdmann lächelte. »Da habe ich ja Glück, dass sie das nicht ist. Und dass ich ein Alibi habe.«
»Ja.« Angersbach erwiderte das Lächeln. Der Mann war ihm sympathisch, weil er so offen und ungezwungen war. Normalerweise war Ralph kein Typ für Small Talk oder Männergespräche, aber mit Christian Erdmann, schien es ihm, könnte er den ganzen Tag zusammensitzen und reden.
»Sie haben einen Bruder und Ihren Großvater hier in der Nähe. Wie kommen die beiden mit Laura aus?«
Erdmann zuckte mit den Schultern. »Man trifft sich gelegentlich. Die beiden mögen Laura, aber unser Verhältnis ist nicht besonders eng. Normal, würde ich sagen.«
Angersbach nickte. Es tat ihm fast leid, dass er keine weiteren Fragen hatte.
»Ich danke Ihnen.« Er stand auf und wehrte ab, als Erdmann sich ebenfalls erheben wollte. »Ich finde den Weg.«
Der Schalk verschwand aus Erdmanns Augen. »Finden Sie auch denjenigen, der auf Laura geschossen hat?«
»Ich tue, was in meiner Macht steht.«
Erdmanns Gesicht bekam etwas Flehendes. »Bitte. Sie müssen dafür sorgen, dass er es nicht erneut versucht.«
»Ich kann Ihnen nichts versprechen. Aber wir alle tun unser Bestes.«
»Danke.« Erdmann starrte durch das Fenster über den See.
Angersbach räusperte sich. »Eine Sache noch. Wir denken, es wäre besser, wenn Ihre Frau eine Weile von hier verschwindet, bis der Spuk vorbei ist.«
Erdmann nickte. »Ja. Das wäre sicher vernünftig.«
»Dann schlagen Sie ihr das bitte vor«, sagte Ralph. »Wir haben ihr angeboten, sie in ein sicheres Haus zu bringen, aber Ihre Frau hat abgelehnt. Sie ist zwar davon überzeugt, dass diese Typen von der ›Schutzmacht‹ für die Tat verantwortlich sind, aber sie glaubt nicht, dass ihr die jungen Leute ernsthaft Schaden zufügen würden.«
»Ja, so ist sie«, bestätigte Erdmann mit Verzweiflung in der Stimme. »Aber was ist, wenn sie sich irrt?«
Sabine Kaufmann und Lynn Burger fuhren fast eine halbe Stunde durch den Wald, um Uwe Ungers Jagdhütte zu erreichen. Unger hielt sich zurzeit in den Staaten auf, als Repräsentant für die Firma seines Bruders, die Maschinenteile produzierte und ihren Sitz im Rheinland hatte. Während seiner Abwesenheit hütete sein Neffe Lennard dessen geräumiges Wohnhaus, das in der Nähe der Straße lag und über mehrere Hektar Forst verfügte, für den Unger das Jagdrecht hatte.
Lennard lud in sein vorübergehendes Domizil zahlreiche Freunde ein, mit denen er regelmäßig Schießübungen abhielt. Das hatte ihnen Laura Erdmann-Janssen berichtet. Der Durchsuchungsbeschluss war schnell gekommen.
Da sie Lennard und seine Freunde im Haus nicht angetroffen hatten, hatten sie sich auf den Weg zur Jagdhütte gemacht. Die Kollegen aus Bad Wildungen und Korbach folgten in ihren Streifenwagen. Sie würden zuerst die Jagdhütte und später das Haus auf den Kopf stellen, wenn es nötig war. Mit etwas Glück fanden sie dort die Waffe, mit der auf die Ortsvorsteherin geschossen worden war.
Vom Hauptweg zweigte ein kleinerer Weg ab, neben dem eine große Holztafel aufgestellt worden war. Die Schutzmacht stand in altdeutschen Buchstaben darauf, umgeben von geschnitztem Eichenlaub, einem böse blickenden Reichsadler und stilisierten Kreuzen, die sich unschwer als Hakenkreuze lesen ließen, aber gerade noch abstrakt genug waren, um als legal durchzugehen.
»Starker Tobak«, konstatierte Lynn.
»Hm.« Kaufmann lenkte den Dienstwagen an einem zweiten Schild vorbei. Zutritt für Nicht-Mitglieder verboten, verkündete es. »Wir betreten ja nicht«, sagte sie augenzwinkernd. »Wir befahren.«
Lynn lachte heiser. »Ich hoffe, die Leute von der ›Schutzmacht‹ teilen deine Interpretation.«
Gleich darauf erreichten sie die Lichtung, auf der die Hütte stand, ein dunkles Gebäude aus geschälten und braun gestrichenen Holzstämmen. Die Fenster waren klein, das Schindeldach weit heruntergezogen. Sabine fand, dass die Behausung etwas Düsteres ausstrahlte.
Neben dem Gebäude standen zwei Quads, auf denen Metallkoffer montiert waren – groß genug für ein Jagdgewehr. Mit den Fahrzeugen könnten die jungen Leute problemlos von hier aus in den Wald bei der Mühle gelangt sein. Die beiden Waldstücke gingen ineinander über.
Kaufmann parkte den Dienstwagen vor der Hütte. Die beiden Streifenwagen hielten dahinter. Während die Beamten in ihren Fahrzeugen sitzen blieben und auf Anweisungen warteten, stiegen Sabine und Lynn aus und klopften an die Haustür. Als keiner öffnete, gingen sie um das Gebäude herum und spähten durch die Fenster. Niemand war zu sehen.
Kaufmann betrachtete die rustikale Einrichtung. Die Möbel waren ebenso dunkel und massiv wie die Stämme, aus denen die Hütte gebaut war. Es gab einen gemauerten Kamin, einen Barschrank, in dem eine Reihe von Flaschen auszumachen war, Tierfelle, die auf dem Boden und über den Sesseln lagen, und mehrere Geweihe an den Wänden.
»Nicht besonders originell«, kommentierte Lynn und zog ihr Smartphone hervor. Sie schoss ein paar Fotos durchs Fenster hindurch. »Die Hütte hat WLAN«, stellte sie nach einem Blick aufs Display fest. »Braucht man hier wohl auch. Netz habe ich nämlich keins.«
Sabine warf ebenfalls einen Blick auf ihr Handy. »Ich auch nicht.«
Sie sahen ein wenig ratlos zwischen den Quads und der Hütte hin und her.
»Irgendwo müssen sie sein«, sagte Lynn und zuckte zusammen, als im selben Moment ein lauter Knall ganz in der Nähe ertönte. Gleich darauf knallte es noch einmal.
Die uniformierten Kollegen sprangen aus ihren Fahrzeugen.
Kaufmann deutete in die Richtung, aus der die Schüsse gekommen waren. »Da.« Sie entdeckte einen Trampelpfad und folgte ihm. Lynn und die Schutzpolizisten blieben dicht hinter ihr, bis sie auf eine weitere Lichtung gelangten. An einem Ende waren ausgestopfte Puppen aufgestellt, wie sie typisch für Schießübungen waren, Körper mit elliptischen Gliedmaßen und Köpfen aus einem juteartigen Material. Am anderen Ende standen vier Personen in Tarnkleidung. Eine davon hielt ein Gewehr in der Hand.
Die uniformierten Kollegen blieben auf Sabines Zeichen am Waldrand stehen, während die beiden Frauen auf die Gruppe zugingen.
Als man sie entdeckte, richtete der Schütze die Waffe auf sie. »He! Haben Sie das Schild nicht gesehen? Sie befinden sich auf Privatgelände. Das Betreten ist verboten.«
Sabine und Lynn gingen weiter auf ihn zu.
»Wir sind mit dem Wagen gekommen«, wiederholte Kaufmann ihren lahmen Witz.
»Haha.« Der junge Mann kniff die Augen zusammen. Sabine und Lynn hatten die Sonne im Rücken, deshalb erkannte er sie wohl erst jetzt. »Ach, Sie sind das. Was wollen Sie denn noch? Ich dachte, wir hätten alle Ihre Fragen ausführlich beantwortet.« Jetzt erst schien er die Streifenbeamten am Rand der Lichtung zu bemerken. »Und jetzt auch noch mit Verstärkung?«
Sabine und Lynn kannten die jungen Leute bereits. Sie hatten die »Schutzmacht«-Mitglieder befragt, nachdem sie von den Drohbriefen erfahren hatten. Gebracht hatte es nichts.
Kaufmann betrachtete die vier jungen Leute, die alle Anfang bis Mitte zwanzig waren. Sabine und Lynn waren sich sicher, dass es weitere Mitglieder gab, doch die Befragten hatten keine Namen verraten, und Sabines und Lynns Recherchen hatten nichts erbracht, also konnten sie sich zunächst nur an diese vier halten.
Die Befragung hatten sie auf der Polizeistation in Bad Wildungen durchgeführt, wo man ihnen einen Raum zur Verfügung gestellt hatte. Alle vier waren pünktlich und gut gekleidet erschienen. Lennard Unger, den sie für den Anführer hielten, im dunkelgrauen Anzug mit Krawatte, Kilian Schneider mit Jeans und Sakko, Hannah Bernstorf im hellgrauen Businesskostüm, Alicia Hebestreit im schlichten blauen Kleid. Auffällig waren lediglich die Frisuren gewesen. Bei Lennard, Kilian und Hannah waren sie fast identisch, an den Seiten kurz rasiert, das Haupthaar mit Gel zurückgekämmt. Alicia trug ihr Haar auf der rechten Seite schulterlang, auf der linken war es auf ein oder zwei Millimeter abrasiert.
Heute präsentierten sich alle vier in gefleckter Tarnkleidung, die zusammen mit den Frisuren unangenehme Assoziationen heraufbeschwor. Aus ihren vorherigen Befragungen wussten Sabine und Lynn, dass zwei von ihnen studierten, zwei arbeiteten in der Gastronomie.
Lennard Unger, der Mann mit dem Gewehr, legte den Kopf schief. »Also?«
»Wir haben noch ein paar Fragen. Und einen Durchsuchungsbeschluss.«
»So?« Unger pflanzte sein Gewehr vor sich auf. »Wozu das?«
»An der Mühle am Steinbach wurden Schüsse abgegeben. Auf die Ortsvorsteherin von Bärental, Laura Erdmann-Janssen.«
»Hat der Schütze getroffen?«
»Nein.«
»Schade eigentlich.«
Kaufmann knirschte mit den Zähnen. Die Wut kochte in ihr, aber sie wollte sich von dem jungen Mann nicht aus der Fassung bringen lassen.
»Sie veranstalten hier Schießübungen?«, meldete sich Lynn zu Wort und zog ihr Tablet hervor.
»Ja. Und?« Unger grinste sie an. »Meinem Onkel gehört das alles hier. Es ist Privatgelände. Ich habe eine Waffenbesitzkarte, und wir haben alle vier einen Jagdschein. Was wir machen, ist völlig legal.«
»Solange Sie nur auf Puppen schießen, ja.«
»Nichts anderes tun wir.«
Lynn zog ihren Schal höher. »Wir müssen Sie fragen, wo Sie sich heute Vormittag aufgehalten haben. Zwischen elf und zwölf.«
»Hier.« Kilian Schneider strich sich durch die dunklen Haare. »Wir haben trainiert.«
»Für was?«, fragte Kaufmann.
»Für den Ernstfall.«
»Der worin besteht?«
»Wir sind so etwas wie eine private Hilfsorganisation«, ergriff Lennard Unger das Wort. »Das haben wir Ihnen doch schon ausführlich erklärt, oder nicht? Wir achten darauf, dass die Menschen hier in der Region respektvoll miteinander umgehen. Wenn sie das nicht tun, schreiten wir ein.«
»Können Sie uns ein Beispiel geben?«
»Eine Frau wird im Wald überfallen.« Hannah funkelte Sabine an. »Die Polizei findet den Täter nicht. Dann suchen wir ihn.«
»Braucht man dafür Waffen?«
»Ein Kind wird von einem Wildschwein verfolgt«, bot Lennard Unger ein neues Szenario an. »Wenn es nicht anders geht, müssen wir es erschießen. Damit das Tier nicht über Gebühr leidet, sollte der erste Treffer sitzen. Also üben wir hier. So einfach ist das.«
»Hm. Sie nennen sich ›Schutzmacht‹. Das klingt martialisch. Und die Symbole auf dem Schild an der Zufahrt sprechen ja auch eine ziemlich eindeutige Sprache.«
»Na und? Haben Sie etwas dagegen?« Kilian funkelte Sabine an. »Ich dachte, wir leben in einem Land mit Meinungsfreiheit.«
Lennard schob ihn beiseite. »Lass gut sein. Das haben wir doch alles schon besprochen.«
Kaufmann blieb am Ball. »Die Zeichen erinnern jedenfalls stark an Hakenkreuze.«
»Das ist Ihre Interpretation.« Hannah sah sie von oben herab an.
»Sie waren also den ganzen Vormittag hier«, kam Lynn auf die Ausgangsfrage zurück.
»Richtig.«
»Sie haben nicht auf Laura Erdmann-Janssen geschossen?«
»Warum sollten wir?«
»Sie versucht, Ihre Organisation verbieten zu lassen.«
»Ohne Erfolg. Wir tun nichts Illegales.«
»Sie hegen also keinen Groll gegen sie?«
»Nein.« Die vier jungen Leute bildeten eine undurchdringliche Front.
»Wie oft denn noch?«, fragte Lennard. »Wir haben ihr keine Drohbriefe geschickt, und wir haben auch nicht auf sie geschossen.« Er grinste. »Oder können Sie das Gegenteil beweisen?«
»Noch nicht.« Kaufmann präsentierte den Durchsuchungsbeschluss. »Wir werden uns jetzt Ihre Jagdhütte und das Haus Ihres Onkels ansehen. Wir werden auch das Gewehr und sämtliche anderen Waffen konfiszieren, um auszuschließen, dass es sich dabei um die Tatwaffe handelt.«
Lennard zuckte mit den Schultern. »Tun Sie, was Sie nicht lassen können.« Bereitwillig reichte er ihr die Büchse. »Bekomme ich eine Quittung über alles, was Sie mitnehmen?«
»Selbstverständlich.« Sabine musterte die vier. Genau wie Laura Erdmann-Janssen hielt sie es für wahrscheinlich, dass die jungen Leute hier nicht nur hinter den Drohbriefen steckten, sondern auch hinter den Schüssen. Aber sie waren nicht dumm. Die Waffe, mit der sie geschossen hatten, befand sich also mit ziemlicher Sicherheit nicht in den Gebäuden, die Lennards Onkel gehörten. Und die Drohbriefe hatten sie vermutlich auch nicht auf dem eigenen Rechner erstellt und zu Hause ausgedruckt. Auf der anderen Seite neigten Fanatiker häufig zur Überheblichkeit. Sie fühlten sich unangreifbar und machten deshalb leichtsinnige Fehler. Vielleicht war das ihre Chance?
Vermutlich war es nicht nötig, mit Willi und Kai Erdmann zu sprechen, doch Ralph Angersbach machte seinen Job gerne gründlich. Auch wenn der Verdacht plausibel war, dass die »Schutzmacht« hinter den Schüssen auf Laura Erdmann-Janssen steckte, ließ sich ein persönliches Motiv nicht gänzlich ausschließen. Da die Eltern von Laura Erdmann-Janssen weit entfernt wohnten und die von Christian Erdmann nicht mehr lebten, waren Willi und Kai im Grunde die Einzigen, von denen er sich auf die Schnelle Informationen erhoffen konnte.