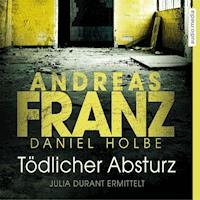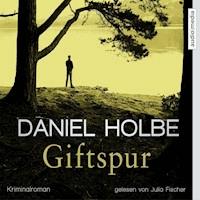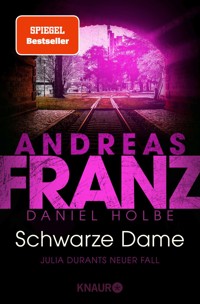9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Sabine-Kaufmann-Krimi
- Sprache: Deutsch
In Hessen wird es giftig: Im 7. Teil ihrer Krimi-Reihe um Kommissarin Sabine Kaufmann machen die Bestseller-Autoren Daniel Holbe und Ben Tomasson die hessische Provinz buchstäblich zur Schlangengrube. Ein mysteriöser Fall beschäftigt die Kommissarin Sabine Kaufmann und ihren Kollegen Ralph Angersbach: In Hessen tauchen vermehrt geschmuggelte exotische Tiere auf, und in einer Transportkiste aus dem Amazonas-Gebiet liegt eine Tote. Dann wird Sabines LKA-Kollege Holger Rahn angegriffen und schwer verletzt. Hängen die Fälle zusammen? Erste Ermittlungsergebnisse führen die Kommissare auf die Spur von Umwelt-Aktivisten in Kolumbien – und tief in die Vergangenheit von Holger Rahn. Doch Rahns Verletzungen haben sein Gedächtnis beeinträchtigt, sodass er keine große Hilfe ist. Als er sich endlich zu erinnern beginnt, geschieht ein weiterer Mord … Die raffinierte, hochspannende Krimi-Reihe um die hessischen Kommissare Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Giftspur - Schwarzer Mann - Sühnekreuz - Totengericht - Blutreigen - Strahlentod - Schlangengrube
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Daniel Holbe / Ben Tomasson
Schlangengrube
Kriminalroman
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Wer ist die Tote in der Transportkiste?
Der neue Bestseller von Holbe/Tomasson
Ein mysteriöser Fall beschäftigt Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach: In Hessen tauchen vermehrt geschmuggelte exotische Tiere auf, und in einer Transportkiste aus dem Amazonasgebiet liegt eine Tote. Dann wird Sabines LKA-Kollege Holger Rahn angegriffen und schwer verletzt. Hängen die Fälle zusammen? Erste Ermittlungsergebnisse führen die Kommissare auf die Spur von Umweltaktivisten in Kolumbien – und tief in die Vergangenheit von Holger Rahn. Doch dessen Verletzungen haben sein Gedächtnis beeinträchtigt, sodass er keine große Hilfe ist. Als Rahn sich endlich zu erinnern beginnt, geschieht ein weiterer Mord …
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Leseprobe »Glutstrom«
1
Der Regenwald dampfte. Die riesigen Blätter der Bäume, die hoch in den Himmel ragten, waren von Tropfen bedeckt, die in der Hitze verdampften. Dazu fiel unablässig Regen, so dicht, dass er auch das Blätterdach durchdrang. Der Boden unter ihren Füßen war schlammig, und auch von dort stieg Dampf auf. Ein Besuch in der Sauna war ein Witz dagegen.
Obwohl es bereits dämmerte, lag die Temperatur immer noch bei weit über dreißig Grad. Es war einer der heißesten Tage des Jahres gewesen.
Kim Helbig blieb stehen und wischte sich zum ungefähr hundertsten Mal in der letzten halben Stunde den Schweiß von der Stirn. Einfach alles an ihr war nass: die Haare unter dem Tropenhelm, das dünne, langärmelige Outdoor-Hemd und der BH, die atmungsaktive lange Hose mit den zahlreichen Taschen und die Socken in den festen Stiefeln an ihren Füßen. Der Rucksack mit der Kamera hätte aufgrund der Feuchtigkeit vermutlich auch ohne Trageriemen an ihrem Rücken gehaftet.
Es war ein Klima, an das man sich als Nordeuropäer nur schwer gewöhnen konnte. In den letzten drei Monaten, die sie jetzt hier war, war es ebenfalls heiß gewesen, aber es war eine trockenere Wärme gewesen, die sich besser ertragen ließ. Jetzt, im März, gab es häufiger Niederschläge, im Schnitt an jedem zweiten Tag. Und das war nur das Vorspiel. Im April begann die Regenzeit. Die regenreichsten Monate waren der Mai mit achtundzwanzig Regentagen und der Oktober mit neunundzwanzig Regentagen.
Ihre Gruppe war deshalb Mitte Dezember angereist, und sie hatten Glück gehabt. Es hatte weniger geregnet als im Schnitt, doch es war immer noch nass genug. Sämtliche Sachen im Camp fühlten sich ständig irgendwie feucht an, und der Schweiß lief ihnen Tag und Nacht über den Körper. Trotzdem war es einfach großartig, hier zu sein.
Kim hatte Biologie studiert und sich auf den Amazonas-Regenwald spezialisiert. Im Moment arbeitete sie an ihrer Doktorarbeit, die sich mit geschützten Tierarten in Kolumbien beschäftigte. Ihr Doktorvater lehrte in Frankfurt und hatte das Thema begeistert aufgegriffen. Er ging auf den Ruhestand zu und saß seit einigen Jahren im Rollstuhl, nachdem er die Bruchlandung eines Sportflugzeugs in Peru mit knapper Not überlebt hatte. Deshalb konnte er den Amazonas nicht mehr selbst bereisen, aber er nahm an ihrer Expedition regen Anteil. Kim schickte ihm E-Mails, Bilder und Videos, sobald sie irgendwo ein Netz hatte.
Die Gruppe, mit der sie hier war, gehörte zur Umweltorganisation RWR, RegenWaldRetter. Kim arbeitete seit einigen Jahren ehrenamtlich dort mit. Entsprechend dem Thema ihrer Doktorarbeit beschäftigte sie sich mit bedrohten Arten. In erster Linie ging es um die Dokumentation, doch ihre Begleiter und sie wollten mehr: Sie hatten es sich zum Ziel gesetzt, die Wilderer aufzuspüren, die unter Artenschutz stehende Tiere fingen und als angebliche Zuchttiere nach Europa verkauften.
Deswegen patrouillierten sie Abend für Abend durch den Wald. Bisher ohne Erfolg, und langsam lief ihnen die Zeit davon. Ende der Woche würde die Gruppe ihre Zelte abbrechen und nach Deutschland zurückkehren. Während der Regenzeit war eine sinnvolle Arbeit mitten in der Wildnis nicht möglich. Kim hatte sich so sehr gewünscht, eine Spur von den Wilderern zu entdecken, doch der Regenwald war riesig, und die Wilderer waren vorsichtig. Sie jagten die Tiere in den frühen Abendstunden, wenn sie sich ihre Schlafplätze für die Nacht suchten. Sie stellten Beobachtungsposten auf, die sie warnten, wenn sich jemand näherte. Zum Beispiel Indios, die eigentlich ihre Heimat schützen sollten, aber der Verlockung des Geldes nicht widerstehen konnten, weil große Armut herrschte und es kaum andere Einnahmequellen für sie gab.
Anfangs waren sie immer zu zweit unterwegs gewesen, doch mittlerweile kannten sie das Gebiet und bewegten sich einzeln durch den Wald. So schafften sie eine größere Fläche, und das Risiko, von den Wilderern entdeckt zu werden, war geringer.
Kim nahm ihre Trinkflasche aus dem Rucksack und trank ein paar Schlucke. Dann ging sie weiter. Sie würde allerdings bald umkehren müssen, sonst wurde es zu dunkel, und sie würde den Weg zurück ins Camp nicht mehr finden.
Um sie herum raschelte es. Man sah nur selten ein Tier, aber sie wusste, dass es hier von Schlangen, Geckos und Fröschen wimmelte.
Sie wollte gerade den Rückweg antreten, als sie Stimmen hörte. Männer, die sich mit knappen, harten Worten verständigten.
Kim verbarg sich rasch hinter einem ausladenden Baumstamm und spähte zwischen den tief hängenden Blättern hindurch.
Im nächsten Moment tauchte die Gruppe auf, fünf oder sechs Männer. Braun gebrannte Indios, die mit kurzen Hosen, T-Shirts und Turnschuhen bekleidet waren, und ein Europäer in tarnfleckiger Outdoor-Kleidung mit festen Stiefeln und einem stabilen Helm mit Gesichtsschutz. Zwei Indios trugen große Kisten, die anderen Netze und Stangen, die zweifellos zum Fangen von Tieren gedacht waren.
Kim hielt den Atem an, während ihr das Blut durch die Adern rauschte und ihr Puls wie verrückt hämmerte.
Sie hatte die Wilderer entdeckt!
2
Mona Seeberg hatte nie etwas anderes werden wollen als Erzieherin. Das hatte sie schon in der Mittelstufe gewusst. Ihre Eltern waren beide Lehrer, und Mona hatte drei jüngere Geschwister, zwei Brüder und eine Schwester. Mona war mit Abstand die Älteste. Die Schwester war erst auf die Welt gekommen, als sie sechs war, die beiden Brüder jeweils ein Jahr später.
Mona hatte es geliebt, die Kinder zu füttern und zu wickeln, sie im Kinderwagen herumzuschieben, mit ihnen zu spielen und ihnen die ersten Wörter beizubringen. Sie hatten Mona gesagt, bevor sie Mama und Papa sagen konnten. Zumindest behauptete Mona das. In Wirklichkeit hatten sie alle etwas gesagt, das wie Moma klang und ebenso gut Mama hätte heißen können. Aber das war nicht wichtig. Mona war vernarrt in ihre kleinen Geschwister, und sie tat nichts lieber, als sich um sie zu kümmern.
Diese Begeisterung hatte Mona sich bis zum Abitur erhalten und anschließend Sozialpädagogik studiert. Eine Fachschulausbildung hätte zwar auch gereicht, um Erzieherin zu werden, aber Mona war klug und vorausschauend. Sie wollte momentan nichts lieber, als im Elementarbereich zu arbeiten. Die Arbeit mit kleinen Kindern erfüllte sie, doch sie wusste, dass sich das eines Tages ändern konnte. Wenn das Team sich veränderte oder wenn sie selbst älter war und neue Ziele ins Auge fasste. Einen Kindergarten zu leiten oder eine Stelle beim Jugendamt zum Beispiel. Dann war es gut, ein entsprechendes Studium vorweisen zu können.
Sie hatte hervorragende Noten und gute Zeugnisse von ihren Praktika während des Studiums, so dass es kein Problem gewesen war, direkt nach dem Abschluss eine Anstellung zu bekommen, in einem Kindergarten im wohlhabenden Gießener Stadtteil Lützellinden, der früher vor allem von Adeligen und reichen Bauern bewohnt worden war und mit vielen traditionellen Fachwerkhäusern beeindruckte. Dort betreute sie die Blauen Füchse, eine Gruppe von Vier- bis Fünfjährigen, deren Eltern Wert darauf legten, dass ihre Kinder schon vor der Schule das Maximum an Bildung erhielten.
Mona hätte es bei manchem dieser Kinder lieber gesehen, dass es mit den sozialen Kompetenzen etwas besser klappte. Oder auch mit vermeintlich banalen Dingen wie dem eigenständigen Anziehen. Sie wusste, dass die meisten Lehrer sich mehr über Erstklässler freuten, die eigenständig auf die Toilette gehen oder sich die Schuhe binden konnten, anstatt bereits die ersten Sätze zu schreiben oder Englisch zu sprechen. Vom Umgang untereinander ganz zu schweigen. Die Bedürfnisse seines Gegenübers verstehen zu können und auch zu wollen.
Deshalb hatte sie sich eine Tier-Einheit ausgedacht. Zweimal pro Woche brachte eines der Kinder sein Haustier mit. Sie sprachen dann darüber, zu welcher Art und Rasse das Tier gehörte, wo seine Wildform zu Hause war, wie es sich in freier Wildbahn ernährte und wie man mit den domestizierten Tieren artgerecht umging. Sie versuchten zu ergründen, wie das Tier sich fühlte. Was seine Körpersprache verriet.
Heute war Nathan an der Reihe. Er hatte nicht verraten, um was für eine Art es sich bei seinem Haustier handelte, nur, dass es besonders cool sei. Mona nahm an, dass es sich um irgendeine Echse handelte. Sie hielt nicht viel davon, exotische Tiere als Haustiere zu halten, aber das würde sie nicht mit Nathan, sondern, wenn überhaupt, mit seinen Eltern besprechen, wenn sie zum nächsten Elternabend in den Kindergarten kamen.
Tatsächlich hatte Nathan einen Käfig von vielleicht einem halben Meter Länge und jeweils dreißig Zentimeter Breite und Höhe dabei, an dem er schwer zu tragen hatte. Trotzdem schaffte er es, dass das Tuch, das er über den Käfig gebreitet hatte, nicht herunterrutschte.
»Das ist eine Überraschung, Mona«, sagte er wichtig und stellte den Käfig in der Mitte des Raums ab.
Nathan war fünf und relativ groß und kräftig für sein Alter. Er trug Jeans, Turnschuhe und Sweatshirt von einem angesagten Kindermode-Designer. Seine blonden Haare waren nach der aktuellen Mode geschnitten, und der Blick aus seinen blauen Augen war selbstbewusst und eine Spur arrogant.
Mona wusste, dass Nathans Eltern reich waren. Sie bewohnten eine moderne Villa in unmittelbarer Nachbarschaft des Kindergartens, die nicht recht ins Viertel passte. Alle anderen Häuser in der Gegend waren weitaus traditioneller. Genau das, dachte Mona, die auf dem Weg nach Hause jeden Tag an der Villa vorbeikam, gefiel Nathans Eltern wahrscheinlich, weil sie sich auf diese Weise abheben konnten.
In der Einfahrt standen immer mindestens drei Autos, ein schwarzes Porsche-Cabrio, ein schneeweißer SUV desselben Herstellers sowie ein fetter BMW in Dunkelblau metallic. Letzterer war der Wagen, den Nathans Vater für die Fahrten zu seinen Geschäftsterminen benutzte. Das Cabrio war sein Spielzeug, der SUV der Wagen der Mutter, den sie fuhr, damit ihr kostbarer Nachwuchs sicher war.
Mona, die selbst mit dem Fahrrad zur Arbeit kam, konnte diese aufgeblasenen Fahrzeuge nicht leiden. Dank der höheren Stoßstange verursachten sie bei Unfällen häufiger tödliche Verletzungen als jedes andere Auto. Gerade Kinder hatten kaum eine Chance, wenn sie von einem SUV erfasst wurden. Daneben verstopften sie Straßen und Parkraum, weil sie so riesig waren, und mit ihrem immensen Spritverbrauch waren sie außerdem die größten Klimaschädlinge unter den Privatfahrzeugen.
Aber für all das konnte Nathan ja nichts. Er hatte sich seine Eltern nicht ausgesucht und war nur ein Produkt ihres Lebensstils.
Also nickte Mona ihm freundlich zu, als er sich im Schneidersitz neben dem Käfig niederließ. Die anderen Kinder saßen bereits im Kreis um ihn herum, jedes auf einem dicken Kissen.
»Also, Nathan. Dann zeig uns mal, was für ein Tier du mitgebracht hast.«
Nathan schaute stolz in die Runde. »Passt auf«, sagte er. »Das ist der Hammer.« Er griff unter das Tuch und wollte offenbar die Käfigtür öffnen.
»Moment mal«, griff Mona ein, die am Fenster stand und die Gruppe beobachtete. »Die Tiere bleiben in ihren Käfigen, das haben wir so ausgemacht.«
Sie erlaubte Ausnahmen, wenn es Tiere waren, die alle Kinder streicheln wollten, Hamster, Meerschweinchen oder dergleichen, aber zuerst wollte sie sich davon überzeugen, dass die Tiere harmlos waren und keine Krankheiten hatten. Katzen durften nur im Katzenkorb mitgebracht werden, der erst geöffnet wurde, wenn die Katze den Eindruck machte, dass sie sich an die Situation und die vielen Kinder gewöhnt hatte. Hunde kamen ohnehin nicht im Käfig, sondern auf den eigenen vier Beinen. Aber andere Tiere, Vögel, Reptilien, Mäuse oder gar Ratten, wollte sie nicht frei im Raum herumlaufen haben.
Doch Nathan war ein Kind, das sich nichts sagen ließ.
»Keine Sorge, Mona«, verkündete er. »Der tut nichts.«
Mona hörte das Klappern von Metall auf Metall. Dann schoss etwas Schuppiggrünes unter dem Tuch hervor und sauste in schnellem Tempo auf eines der Mädchen in der Gruppe zu. Das Mädchen und die Kinder neben ihm fingen an zu kreischen.
Das Reptil stoppte, offenbar irritiert von dem Geschrei. Es drehte sich einmal um die eigene Achse und riss das Maul auf, so dass man die langen Reihen spitzer weißer Zähne sah. Das Geschrei der Kinder wurde noch lauter.
Mona fingerte hektisch ihr Smartphone aus der Tasche und suchte nach der Nummer der nächstgelegenen Zoohandlung. Sie drückte auf die Direktwahl, und gleich darauf meldete sich der Besitzer.
»Bitte«, sagte Mona. »Sie müssen schnell jemanden vorbeischicken, der sich mit exotischen Tieren auskennt. Wir haben hier ein Krokodil im Kindergarten.«
Der Zoohändler reagierte schroff. »Das ist nicht lustig, junge Frau.«
»Bitte«, wiederholte Mona, ehe er auflegen konnte. »Das ist kein Scherz. Wir haben hier wirklich ein Krokodil. Eines der Kinder hat es mitgebracht. Es greift die anderen Kinder an.«
»Im Ernst?«
»Ja.« Monas Stimme zitterte, und das bemerkte wohl auch der Zoohändler. Vielleicht hörte er auch das ängstliche Geschrei der Kinder.
»Okay«, sagte er. »Ich schicke jemanden vorbei. Sagen Sie mir, wo Sie sind.«
Mona nannte die Adresse des Kindergartens und beendete das Gespräch.
Das Krokodil kreiselte noch immer in der Mitte des Raums. Die großen Augen rollten von rechts nach links. Dann entschied es sich für ein Opfer, hielt auf eines der Mädchen zu und versenkte seine großen, spitzen Zähne in einem dünnen Kinderbein.
3
Sabine Kaufmann schob die Papierstapel auf ihrem Schreibtisch von einer Seite auf die andere. Es war ein grauer Wintermorgen, und das Büro kam ihr dunkel vor, obwohl sämtliche Deckenlampen eingeschaltet waren. Draußen trieben nasse Schneeflocken vorbei. Bis zum Frühlingsanfang war es nur noch eine Woche, doch bisher war davon wenig zu merken. Auf den Straßen lagen Reste von braunem Schneematsch. Und mit ihren Ermittlungen war sie seit Wochen keinen Zentimeter vorangekommen.
Sie gehörte seit Jahresbeginn zur neu eingerichteten Ermittlungsgruppe »Exotische Tiere«, kurz ET. Irgendein Witzbold hatte sich die Abkürzung ausgedacht. Wahrscheinlich Holger Rahn. Tatsächlich bestand die sogenannte Gruppe nur aus ihnen beiden.
Der Schmuggel mit exotischen Tieren nahm immer mehr zu, und die Landesregierung hatte beschlossen, dass endlich etwas dagegen getan werden musste. Die Zollkontrollen an den Flughäfen und Grenzen waren verstärkt worden, aber das allein genügte nicht. Die Tierschmuggler hatten sich zunehmend auf Tiere verlegt, die in ihrem Herkunftsland, nicht aber in Deutschland unter Artenschutz standen. Einmal gewildert und eingeführt, konnten sie hier legal verkauft werden. Gegen diese Verbrechen konnte man nur vor Ort vorgehen, und das LKA war deshalb nicht nur mit dem Veterinäramt und dem Zoll in Kontakt, sondern auch mit verschiedenen Umwelt- und Tierschutzorganisationen, die in diesen Ländern aktiv waren.
Zugleich wurden nach wie vor Tiere geschmuggelt, die nicht nur in ihrem Herkunftsland, sondern auch hier unter Artenschutz standen, und außerdem solche, die zwar nicht vom Aussterben bedroht, aber aufgrund ihrer Gefährlichkeit verboten waren. Man handelte sie nicht als Massenware wie die Tiere, die hier legal waren, sondern als exklusive Artikel. Meist wurden sie nicht auf Verdacht importiert, sondern auf Bestellung. Dahinter steckte ein verbrecherisches Netzwerk, und genau dieses sollte ET aufspüren und zerschlagen.
Das Problem war nur, dass sie bisher nicht die kleinste Spur hatten. Die Schmuggler und ihre Auftraggeber waren ausgesprochen vorsichtig und offenbar auch technisch versiert. Jede Seite im Internet, auf der illegale Tiere angeboten wurden, verbarg sich hinter einer Nebelwand. Der Kontakt lief über eine ganze Reihe ausländischer Server, und die Seiten zogen regelmäßig um. Holger Rahn, der ein großer Technikfreak war, und die Kollegen der IT, die sich ebenfalls darum kümmerten, waren frustriert.
Mittlerweile war Mitte März, und ihnen war noch nicht mal ein kleiner Fisch ins Netz gegangen. Von den großen ganz zu schweigen.
Davon abgesehen fand Sabine die Zusammenarbeit mit Rahn schwierig. Nicht, weil er sich jemals anders als mustergültig verhielt, sondern weil sie nicht aufhören konnte, an die kurze Affäre zu denken, die sie im letzten Herbst mit ihm gehabt hatte. Es waren nur ein paar Tage gewesen, dann hatte sie der Sache ein Ende gemacht, weil sie Ralph Angersbach geküsst hatte. Aber auch daraus war natürlich nichts geworden.
Seit einem knappen halben Jahr herrschte wieder Funkstille. Kaum war der Fall mit den Atomkraftgegnern abgeschlossen, war Angersbach in der Versenkung verschwunden und hatte sich nicht mehr gemeldet. Kaufmann verbrachte die Abende allein in ihrer schicken Wiesbadener Wohnung oder ging in einen Club. Es herrschte weiß Gott kein Mangel an Männern, die ihr Offerten machten, aber sie war bisher auf keines dieser Angebote eingegangen. Weil sie immer, wenn sie es ernsthaft in Erwägung zog, sofort an Ralphs zerknautschtes Gesicht mit den warmen braunen Augen denken musste.
Deshalb hielt sie auch Holger Rahn auf Distanz, aber natürlich entgingen ihr seine Blicke nicht. Er hatte akzeptiert, dass sie keine Beziehung wollte, doch offensichtlich konnte er seine Gefühle für sie nicht abstellen. Immer wieder ertappte sie ihn dabei, wie er sie heimlich von der Seite musterte. Und wenn sie einander gegenübersaßen, bei der Arbeit oder beim gemeinsamen Essen, sah sie die Sehnsucht in seinen klaren blauen Augen.
Warum konnte sie sich nicht in ihn verlieben? Mit ihm wäre alles so viel einfacher. Und die Sache mit Ralph war ohnehin aussichtslos. Schon immer gewesen. Aber sie konnte nichts an ihren Gefühlen ändern.
Die Bürotür öffnete sich, und Rahn stürmte herein, wie gewohnt frisch und dynamisch, mit seiner gut sitzenden grauen Stoffhose, dem gebügelten blauen Hemd und den akkurat gestutzten blonden Haaren. Dazu hatte er ein Lächeln auf den Lippen, das sie lange nicht mehr bei ihm gesehen hatte.
»Wir haben eine Spur«, sagte er und schwenkte das Blatt, das er in der Hand hielt. »Ein verbotenes Krokodil.«
»Wo?«
Rahns Lächeln verschwand. »Das ist die schlechte Nachricht. In einem Kindergarten.«
»Wie bitte?«
»Wenn ich’s doch sage! Die machen da irgend so eine Einheit mit Haustieren. Nicht so wichtig. Aber jetzt hat eines der Kinder eben das Krokodil angeschleppt. In den Kindergarten! Es ist zum Glück noch relativ klein, ein Baby-Krokodil. Doch es hat eines der Kinder ins Bein gebissen. Das Kind ist mit dem Schrecken davongekommen, weil die Zähne noch nicht ausgewachsen sind. Nur ein paar Blutergüsse und blaue Flecken. Aber das Kind hat sicherlich ein seelisches Trauma. Würde mich wundern, wenn es in seinem Leben jemals in einem Zoo ins Reptilienhaus gehen können wird. Ganz zu schweigen von einer Reise in die Everglades oder sonst wohin, wo Krokodile in freier Wildbahn vorkommen.«
Er legte Sabine den Zettel auf den Tisch. »Das ist die Adresse der Eltern des Jungen, der das Krokodil mitgebracht hat. Ich bin sicher, sie verraten uns, wo es herkommt.«
Kaufmann schob die Aktenstapel beiseite, steckte das Smartphone in die Handtasche und stand auf. »Ich bin so weit.«
»Gut.« Rahn knipste sein Lächeln wieder an. »Dann fahren wir.«
4
Die Männer gingen weiter, bis sich der dichte Regenwald vor ihnen öffnete. Eine kleine, überwucherte Lichtung, umstanden von turmhohen Bäumen mit riesigen Blättern. Kim hatte diesen Ort noch nie gesehen, obwohl sie seit drei Monaten den Regenwald durchstreifte. Aber das Gebiet war so groß, dass man unmöglich jeden Flecken kennen konnte.
Wenn man sich zu weit von Leticia, dem kleinen Ort am Fluss, an dem auch die Fähre anlegte, entfernte, gab es kein Handysignal mehr, kein Kartenprogramm, keine GPS-Daten. Man musste sich auf seinen Orientierungssinn verlassen und darauf achten, nicht zu weit von den Pfaden abzukommen, die die Gruppe bereits erkundet hatte. Die Lichtung konnte sich also durchaus in der Nähe des Camps befinden, ohne dass sie jemals einen Fuß dorthin gesetzt hatte, weil sie abseits des Weges lag. Oder aber sie war den Wilderern viel tiefer in den Dschungel hinein gefolgt, als ihr bewusst war.
In diesem Fall hätte sie ein Problem, wieder zurückzufinden. Schon bei Tag sah im Regenwald fast alles gleich aus. Bei Einbruch der Dunkelheit verwischten sich die Unterschiede weiter, und nachts sah man gar nichts mehr. Kim hatte zwar eine starke Taschenlampe dabei, aber zwischen den dicht stehenden Bäumen und im feuchten Nebel konnte sie höchstens ein paar Meter weit sehen. Und solange die Wilderer in der Nähe waren, durfte sie die Lampe ohnehin nicht benutzen. Sonst hätte sie sich auch gleich eine Signalleuchte umhängen können.
Die Vernunft gebot ihr umzukehren. Schon jetzt fiel nur noch spärliches Tageslicht durch das dichte Blätterdach. Maximal noch eine halbe Stunde, dann würde sie die Hand nicht mehr vor Augen sehen. Und der Weg zurück ins Camp dauerte mit Sicherheit länger.
Aber sie konnte jetzt nicht aufgeben. Drei Monate lang hatten sie Ausschau nach den Wilderern gehalten, die geschützte Tiere fingen und sie illegal außer Landes beförderten. Jetzt hatte sie sie gefunden, und sie wollte sie auf keinen Fall entkommen lassen. Sie musste wissen, wer die Männer waren und was sie taten, und sie brauchte Beweise. Fotos, Videos, Namen.
Also kauerte sie sich hinter einen großen Busch und sah zu, wie die Männer die Kisten in der Mitte der Lichtung abstellten. Mit etwas Glück konnte sie sich heranschleichen. Auf den Kisten stand sicher der Name der angeblichen Zuchtstation.
Die Männer nahmen ihre Netze und Stangen und tauchten wieder in den Wald ein.
Kim wartete eine Minute, dann noch eine. Sie konnte die Männer nicht mehr sehen und auch nicht hören. Rasch huschte sie zu den Kisten.
Tatsächlich stand in großen schwarzen Buchstaben ein Name an der Seite. LAF, Leticia Animal Farm, darunter eine Adresse und eine Telefonnummer. Am Bestimmungsort der Kiste würde vermutlich niemand diese Bezeichnung in Zweifel ziehen, aber Kim und ihre Gruppe waren seit drei Monaten hier. Sie wusste, dass es in Leticia keine Reptilienfarm gab.
Kims Herz schlug höher. Das war eine echte Spur. Mit diesen Informationen konnte die kolumbianische Polizei die Wilderer identifizieren, und der deutsche Zoll könnte die entsprechenden Kisten konfiszieren. Ganz sicher fanden sich darin nicht nur Tiere, die in Kolumbien, nicht aber in Europa unter Artenschutz standen, sondern auch solche, die auf der weltweiten Artenschutzliste aufgeführt oder im Bestimmungsland verboten waren. Man versteckte sie einfach unter den angeblich legalen Tierimporten, das war gängige Praxis.
Kim aktivierte ihre Handykamera und machte ein paar Fotos. Rasch kontrollierte sie die Aufnahmen und fluchte leise.
Man konnte nichts erkennen.
Sie musste den Blitz benutzen, aber das war riskant. Je nachdem, wo sich die Wilderer aufhielten, könnten sie das Licht bemerken. Doch sie hatte keine andere Wahl. Ohne Beweise konnte sie nichts bewirken.
Noch einmal sah sie sich zu allen Seiten um und lauschte. Sie hörte die typischen Geräusche des nächtlichen Regenwalds, ein Tropfen, Rauschen, Plätschern, das Rascheln von Blättern, das Huschen von Tieren, die sich durch die Nacht bewegten, aber keinen Laut, der von einem Menschen stammte.
Entschlossen schaltete sie den Blitz ein und machte in schneller Folge ein paar Bilder.
Sie wollte gerade zurück zu ihrem Versteck laufen, als vor ihr ein Mann zwischen den Bäumen hervortrat. In der rechten Hand hielt er eine lange Stange mit einem Haken daran, in der linken ein Netz, in dem sich eine große Schlange wand. Eine Abgottschlange, Boa constrictor, das konnte Kim sogar im letzten Zwielicht des Tages erkennen.
Der Mann schrie etwas in der Sprache der Einheimischen, das sie nicht verstand.
Innerhalb von Sekunden tauchten die anderen Männer auf der Lichtung auf, die Indios und der Europäer mit dem Helm und dem Moskitonetz. Sie liefen von allen Seiten auf sie zu.
Kim schob ihr Handy in die Tasche und suchte nach der größten Lücke, die sie zwischen den Männern finden konnte. Dann rannte sie los.
5
Yes!« Holger Rahn ballte die Siegerfaust. »Er hat angebissen.«
Sabine Kaufmann sah von ihrem Rechner auf. Zwei Tage waren vergangen, seit sie den Vater des Jungen aufgesucht hatten, der mit seinem Mini-Krokodil die Blauen Füchse im Kindergarten in Lützellinden in Panik versetzt hatte.
Es hatte sich um ein echtes Krokodil gehandelt, aber an solchen Details hielten sich die wenigsten auf. Genau wie bei Kamel und Dromedar redete man – mal willkürlich, mal in dem Glauben, es besser zu wissen – von Krokodilen, Alligatoren und Kaimanen. Krokodile lebten in Afrika, Kaimane in den Everglades und Alligatoren in Südamerika und Australien. Völliger Quatsch, wie Sabine und Holger mittlerweile wussten. Kaimane waren eine Unterfamilie der Alligatoren und diese eine Familie der Krokodile, zu denen neben den Alligatoren auch die echten Krokodile gehörten. Der Unterschied lag in den Zähnen. Bei den echten Krokodilen lagen die großen Unterkieferzähne außerhalb der Zahnreihe des Oberkiefers, bei den Alligatoren innen, aber sowohl die echten Krokodile als auch die Alligatoren gehörten zur Ordnung der Krokodile. Das war interessant, änderte jedoch nichts an der Tatsache, dass solche Tiere nichts in einer Kindertagesstätte verloren hatten. Egal, wie klein sie waren.
Kaufmann und Rahn waren wenig überrascht, aber dennoch schockiert gewesen, wie gleichgültig der Vater von Nathan sich bei der Befragung verhielt. Natürlich tue ihm das kleine Mädchen leid, das von dem Krokodil attackiert worden sei, aber es sei ja nicht wirklich etwas passiert. Selbstverständlich hätte sein Sohn das Krokodil nicht in den Kindergarten mitnehmen sollen. Das hatte er ihm klar und deutlich gesagt. Das Krokodil wohnte im Schwimmbad im Keller, und nur dort. Doch Nathan sei eben so stolz auf sein Krokodil, und außerdem sei er nun mal ein Kind mit einem eigenen Willen. Er habe das Krokodil heimlich mit in den Kindergarten genommen. Sein Vater war an diesem Tag auf einer Dienstreise, die Mutter bei ihrem wöchentlichen Wellness-Tag, und die Haushälterin habe nicht aufgepasst. Das sei zwar bedauerlich, aber so etwas komme eben vor.
»Es kommt vor, dass ein Kind ein Krokodil in den Kindergarten mitbringt?«, hatte Holger Rahn gefragt, und ihm war anzusehen, dass er in dieser Sache keinen Spaß verstand.
Der Vater hatte zurückgerudert. Er habe wohl einen Fehler gemacht. Das Krokodil habe er im Internet entdeckt, und Nathan hätte es unbedingt haben wollen. Er liebe seinen Sohn, deshalb habe er ihm den Wunsch nicht abschlagen können. Dass die Haltung gefährlicher Wildtiere in Hessen genau wie in einigen anderen Bundesländern verboten war und mit Geldstrafen bis zu fünftausend Euro und außerdem dem Entzug des Tieres geahndet wurde, war ihm angeblich nicht bekannt gewesen. Ein bedauerlicher Irrtum.
Kaufmann war angesichts dieser Haltung die Galle hochgekommen, aber sie hatte sich genauso beherrscht wie Rahn. Zumindest hatten sie am Ende die Adresse der Internetseite, auf der der Vater das Krokodil bestellt hatte. Es war eine Agentur für seltene und verbotene Reptilien, die der Ermittlungsgruppe ET bisher nicht aufgefallen war. Wie viele mochte es noch geben?
Rahn hatte sich dort unter einem Alias als Kaufinteressent angemeldet und darauf gewartet, dass man ihn kontaktierte. Achtundvierzig Stunden lang war nichts passiert. Doch jetzt schien sich etwas zu tun.
»Wir haben eine Verabredung«, verkündete Rahn. »Morgen früh um zehn. Autobahnraststätte Römerwall. Das ist an der A5, in der Nähe von Gießen.«
Kaufmann neigte den Kopf. »Und was passiert dort?«
»Wir bekommen eine Abgottschlange.«
»Eine was?«
»Eine Boa constrictor, direkt aus Kolumbien, aus dem Amazonas-Regenwald. Zwei Komma vier Meter lang, zwölf Kilo schwer.«
Kaufmann zog die Mundwinkel nach unten. »Danke. Kein Interesse.«
»Sie steht in Kolumbien unter Artenschutz und ist illegal, weil sie nicht aus einer Zucht stammt.«
Kaufmann blinzelte ihm zu. »Das ist natürlich etwas anderes.«
Rahn sah auf die Uhr. Kaufmann tat es ihm gleich. Es war kurz vor vier, draußen begann es bereits zu dämmern.
»Wir sollten heute Abend schon hinfahren«, schlug Rahn vor. »Uns die Raststätte und die Umgebung ansehen. Damit wir wissen, wo wir unsere Leute postieren können.«
Kaufmann war schon aufgestanden und hatte sich ihre warme Jacke gegriffen. Der Schnee, der in den beiden ersten Monaten des Jahres gefallen war, war zwar endgültig geschmolzen, aber der Frühling hatte es noch nicht geschafft, dem März seinen Stempel aufzudrücken.
»Kein Problem. Mein Koffer ist schnell gepackt.«
Rahn grinste. »Meiner auch.«
Der Rastplatz Römerwall befand sich auf der Ostseite der A5, auf der Kuppe einer lang gezogenen Anhöhe nördlich von Butzbach. Das Panorama war atemberaubend. Der Taunus, wo vor zweitausend Jahren der Limes die Römer von den germanischen Stämmen getrennt hatte, dann die Wetterau, mitten darin die beiden Türme der Münzenburg und am anderen Rand des Horizonts der Vogelsberg. Der etwas beengte Parkplatz war im Laufe der Achtziger zu einer Rastgelegenheit umgebaut worden. So gab es nun einen Imbiss und, auf der gegenüberliegenden Seite der Zufahrtsstraße, ein kleines Hotel für Fernfahrer. Rahn hatte das vorher recherchiert und angeregt, dort zu übernachten. In zwei Einzelzimmern natürlich.
Kaufmann hatte zugestimmt. Es gefiel ihr zwar nicht, die Nacht in einem Hotel zu verbringen, dem man den Zahn der Zeit deutlich ansah, aber andererseits war sie froh, dem Büro zu entkommen und endlich wieder einmal draußen auf der Straße zu ermitteln.
Das Hotel war eine typische Fernfahrerunterkunft. Wenig Komfort – ein Einzelbett mit durchgelegener Matratze, ein Kleiderschrank aus Sperrholz mit nur drei Bügeln an der Stange und einem einzigen Einlegeboden, dazu ein wackliger Stuhl und ein an der Wand montiertes Holzbrett, das wohl den Schreibtisch ersetzen sollte –, dafür aber ein 80-Zoll-Fernseher an der Wand und kostenloses Pay-TV. Alles zu einem Preis, für den man in einem Sternehotel nicht mal ein Bett in der Besenkammer bekam.
Kaufmann seufzte. Sie sah nicht viel fern. Ein Lesesessel hätte ihr besser gefallen. Immerhin, das Bad war sauber, und die Dusche hatte einen Regenwasser-Duschkopf. Damit konnte sie zumindest die Verspannung abwaschen, die sie nach der fast zweistündigen Fahrt mit Rahn empfand. Das Unbehagen über die unterschiedlichen Beziehungswünsche, das sich im Büro beiseiteschieben ließ, gerann im engen Wagen zu einem Sirup, der das Atmen schwer machte.
Nach der Dusche war sie zufrieden, aber auch hungrig. Als hätte er es geahnt, klopfte Rahn bei ihr an.
»Sollen wir im Imbiss eine Currywurst oder einen Burger essen? Das wäre eine gute Gelegenheit, sich dort umzusehen.«
»Gern.« Kaufmann, die sich umgezogen hatte – Bluejeans, dazu einer ihrer geliebten flauschigen Pullover in Hellblau –, lächelte. Das war wieder so ein Punkt, der es mit Holger Rahn einfacher machte. Der Vegetarier Angersbach hätte an einem solchen Imbiss vermutlich wenig Vergnügen. Kaufmann konsumierte Fleisch nur in Maßen – dem Tierwohl ebenso wie der Umwelt zuliebe –, aber ganz darauf verzichten wollte sie nicht. Es gab einfach nicht für alles adäquaten Ersatz, und manche vegetarischen Gerichte empfand sie als ungenießbar. Wenn sie nur an Angersbachs vegetarische Klöße in grüner Soße dachte …
Als sie den Imbiss betraten, blieb Rahn wie angewurzelt stehen. Seine Augen waren auf die Frau gerichtet, die auf einer Trittleiter stand und an der Leuchtstoffröhre an der Decke herumschraubte. Das Top war ihr hochgerutscht und gab den unteren Rücken frei, die Hose dagegen nach unten, so dass sie ihr knapp auf den Hüften hing.
Die Frau war mittelgroß und schlank, die glatten blonden Haare reichten ihr über den Rücken bis fast zum Po. Rahn starrte sie an, als hätte er eine Erscheinung. Kaufmann stieß ihm den Ellenbogen in die Seite.
»Pass auf, dass dir nicht die Augen aus dem Kopf fallen.« Sie hatten die Frau jetzt halb umrundet, und Kaufmann konnte ihr Gesicht sehen. Es war mager, fast verhärmt, die Augen tief in die Höhlen gesunken, das Kinn spitz. »So hübsch ist sie nun auch wieder nicht.«
»Was?« Rahn stoppte und hob die Hand. »Darum geht es nun wirklich nicht.« Er griff nach Kaufmanns Arm und zog sie in die Ecke mit den Kühlschränken, wo sie am weitesten von der Frau entfernt waren.
Kaufmann machte sich los. »Was soll denn das?«
»Entschuldige. Ich war nur kurz irritiert«, sagte Rahn. »Weil ich die Frau kenne.«
»So?« Kaufmann schaute wieder hin. »Woher denn?«
»Das ist Sonja Lippert. Ihre Schwester Sybille hat bis vor ein paar Jahren als Undercover-Ermittlerin für das LKA gearbeitet.«
»Aha?«
Rahn winkte ab. »Lange her.«
Sabine schaute wieder zu der Frau auf der Leiter. »Warum gehst du nicht hin und begrüßt ihre Schwester?«
»Weil sie mich nicht kennt.«
Kaufmann blinzelte. »Woher weißt du dann, wer sie ist?«
»Die beiden sind Zwillinge. Sonja ist Sybille wie aus dem Gesicht geschnitten.«
»Verstehe.« Kaufmann sah aus dem Fenster des Imbisses. Draußen war es mittlerweile dunkel geworden. Man sah nur noch die Silhouetten der Lkws, die dicht an dicht auf dem Parkplatz standen, und die weißen und roten Lichter, die in beide Richtungen auf der Autobahn vorbeisausten.
Rahn ging an der Leiter vorbei auf den Verkaufstresen zu. Dahinter stand ein kräftiger, breitschultriger Mann mit weißer Kochjacke und passender Hose. Glatt rasiert, am Kinn ebenso wie auf dem Schädel. Praktisch für einen Koch, dachte Kaufmann. So musste er sich keine Sorgen machen, dass ihm ein Haar in die Suppe geriet.
»Für dich auch einen Burger mit Pommes?«, fragte Rahn.
Kaufmann studierte die Speisekarte hinter der Theke und nickte.
»Also zweimal den Burger. Was zu trinken dazu?«, erkundigte sich der Koch.
»Ein Pils«, sagte Rahn, und Kaufmann schloss sich an. »Für mich auch.«
»Kommt sofort.« Der Koch deutete in den leeren Gastraum. »Suchen Sie sich den besten Platz aus.«
Kaufmann und Rahn setzten sich ans Fenster. Von hier hatten sie einen guten Überblick über den Parkplatz. Zwei lange Reihen Lkw-Abstellplätze, zwei Reihen für Pkws. Jetzt, am späten Abend, parkten nur wenige Pkws dort. Die Stellplätze für die Lkws dagegen waren alle belegt. Dazwischen ein Grünstreifen, auf dem Picknicktische und Bänke standen, alle mit einem Abstand von vielleicht fünf Metern zueinander. Es gab auch ein paar Bäume, die allerdings so aussahen, als hätten die Abgase ihnen sämtliche Lebenskraft entzogen. Aber das konnte auch an der Jahreszeit liegen. Bisher war keine einzige Knospe jungen Grüns zu sehen, und kahle Bäume hatten immer etwas Trostloses. Kaufmann musste schon wieder an Tod und Vergänglichkeit denken.
Hinter dem Imbiss, auf der Seite, die sie von ihrem Platz nicht einsehen konnten, gab es einen schmalen asphaltierten Streifen, den man anfahren konnte, der aber keine Parkmöglichkeit bot. Die Zone war als Ladezone gekennzeichnet. Die Fenster, die zu dieser Seite hinausgingen, gehörten offenbar zu einem Lagerraum und waren mit Milchglas und Gittern versehen. Die Tür war aus dickem Metall und fest verriegelt. Das alles hatten sie festgestellt, als sie den Imbiss bei ihrem ersten Rundgang umrundet hatten. Es war eine düstere Ecke, an der man weder vom Imbiss noch von der Autobahn oder dem restlichen Rastplatz aus beobachtet werden konnte. Der ideale Platz für ein heimliches Treffen, um Schmuggelware zu übergeben. Nur eine einzelne gelbliche Lampe brannte über der Hintertür.
Das Problem war, dass es keine Möglichkeit gab, diesen Bereich des Rastplatzes heimlich zu überwachen. Das einzige Versteck boten die Müllcontainer, die in langer Reihe neben dem Hintereingang standen, aber um dort auf keinen Fall entdeckt zu werden, müsste man schon hineinklettern. Abgesehen davon, dass der Gestank aus den Containern übelkeiterregend war, wäre das auch kein guter Platz, um schnell und zielgerichtet ins Geschehen einzugreifen.
Direkt hinter der Ladezone verlief die Zufahrtsstraße, die ein Stück weiter in die L3131 mündete. Auf der anderen Seite befand sich das Hotel, in dem Kaufmann und Rahn untergekommen waren. Es war die Dependance einer Gießener Hotelkette. Das Einchecken erfolgte vollautomatisch. Bezahlt wurde vorab bei der Onlinebuchung, den Schlüssel bekam man mit einem Nummerncode aus einem der Schließfächer vor dem Hotel. Die Rezeption war nur vormittags besetzt, wenn auch das Reinigungspersonal anwesend war, um die Zimmer herzurichten, und im Frühstücksraum das Buffet aufgebaut wurde. So hatte es jedenfalls in der Hotelbeschreibung im Netz gestanden. Zu Gesicht bekommen hatten sie bisher niemanden, aber sie waren ja auch erst am frühen Abend angereist. Und die Sache mit den Schlüsseln hatte funktioniert.
Der Koch stellte zwei gut gezapfte Biere auf den Tisch. »Zum Wohl.«
»Danke.« Kaufmann und Rahn stießen an und tranken, ehe sie sich wieder dem Blick aus dem Fenster widmeten.
Hinter dem Hotel, auf der anderen Seite der Zufahrtsstraße, befanden sich ausgedehnte Felder, die jetzt, Mitte März, noch kahl waren. Satte schwarze Erde mit tiefen Furchen, in die das Saatgut schon eingebracht worden war, doch bis es zu keimen begann, brauchte es noch mehr Sonne und Wärme. Jenseits der Felder erhoben sich bewaldete Hügel, doch die Bäume waren zu weit weg, um ein geeignetes Versteck abzugeben.
Ihnen würde wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Kollegen des Spezialeinsatzkommandos in getarnten Fahrzeugen auf dem Parkplatz zu postieren. Rahn würde als angeblicher Kaufinteressent in seinem Wagen hinter dem Imbiss warten. Kaufmann konnte sich im Fußraum vor dem Rücksitz verstecken. Ein Vorteil ihrer geringen Körpergröße von kaum mehr als einem Meter sechzig. Sie wäre in Rahns unmittelbarer Nähe, doch es würde trotzdem wertvolle Sekunden kosten, aus dem Wagen zu springen und sich in Schussposition zu begeben. Aber es sah so aus, als gäbe es keine Alternative.
Der Koch erschien erneut und servierte ihnen die Burger und Pommes. Sie sahen appetitlich aus, und Kaufmann und Rahn machten sich heißhungrig darüber her.
»Was meinst du?«, sagte Rahn, nachdem er den halben Burger vertilgt und dabei seltsam abwesend gewirkt hatte. Aber wahrscheinlich dachte er nur intensiv über den Einsatz nach. Rahn war ein Mann, der alles bis ins Detail plante. »Ein Lkw mit zwei Einsatzkräften an der Einfahrt, ein Sprinter mit zwei Leuten an der Ausfahrt und einer mit zwei Kollegen vor dem Hotel, falls er nicht über die Autobahn kommt, sondern die Zufahrtsstraße benutzt? Dazu noch wir mit dem flotten BMW?« Rahn hatte sich von der Fahrbereitschaft einen der leistungsstärksten Wagen aus dem Fuhrpark des LKA geben lassen.
»Das scheint das Beste zu sein, was wir tun können.«
»Gut.« Rahn widmete sich wieder seinem Burger und betrachtete ihn einen Moment nachdenklich, bevor er hineinbiss. »Dann veranlasse ich das.«
Nach dem Essen und nachdem Rahn seine Anrufe erledigt hatte, tranken sie noch ein weiteres Bier, ehe sie sich auf den Rückweg zum Hotel machten.
In einigen der Wagenfenster der langen Reihe von Lkws brannte noch Licht, doch die meisten waren dunkel. Es war eine merkwürdige Atmosphäre, die kalte Nacht, die schlafenden Riesen aus aller Herren Länder und die Nähe so vieler Menschen, die man nicht sah. Rahn legte ihr den Arm um die Schultern, und Kaufmann hatte nichts dagegen. Es tat gut, sich ein bisschen anzulehnen. Sie verbrachte viel zu oft die Abende allein.
Vor ihrem Hotelzimmer blieben sie stehen. Rahn drehte sich zu ihr und umfasste ihre Taille. Seine Lippen näherten sich ihren.
Kaufmann spürte, wie in ihrem Inneren alles weich wurde. Sie wollte sich fallen lassen. Aber es wäre nicht fair, Holger aus einer Laune heraus wieder Hoffnungen zu machen. Zuerst sollte sie endgültig klären, wie sie mit ihren Gefühlen für Ralph Angersbach umgehen wollte. Erst wenn sie ihn aus dem Kopf bekommen hatte, durfte sie sich auf etwas ernsthaftes Neues einlassen.
Sie legte Rahn die Hände auf die Brust und schob ihn sanft von sich weg.
»Besser nicht«, sagte sie leise.
Rahn presste die Lippen zusammen und ließ sie los.
»Okay«, sagte er und ging mit erhobenen Händen ein paar Schritte zurück. Mit sichtlicher Mühe rang er sich ein Lächeln ab. »Ich weiß es zu schätzen, dass du nicht mit mir spielst.« Er kramte nach seiner Schlüsselkarte und öffnete die Tür des Zimmers, das direkt neben ihrem lag. »Gute Nacht.«
Kaufmann holte ebenfalls ihre Karte hervor und betrat ihr Zimmer. Sie schloss die Tür und lehnte sich mit dem Rücken dagegen.
»Bravo«, murmelte sie halblaut. »Mach nur so weiter. Dann wirst du als einsame alte Frau sterben.«
6
Kim rannte, so schnell sie konnte. Sie sah nicht, wohin sie trat, spürte nur den aufgeweichten Boden unter den Sohlen ihrer Stiefel, die Zweige und Blätter, die ihr ins Gesicht klatschten, und den Regen, der von den Bäumen auf sie heruntertropfte. Sie hörte das Platschen flacher Turnschuhsohlen und die schweren Stiefeltritte des Europäers hinter sich, die aufgeregten Stimmen der Einheimischen und den scharfen Befehlston des Anführers.
Laufen gehörte nicht gerade zu Kims Stärken. Zu Hause hatte sie einen Job, bei dem sie die meiste Zeit des Tages am Schreibtisch saß. Einmal pro Woche schaffte sie es ins Fitnessstudio und strampelte sich eine halbe Stunde auf dem Stepper ab, doch zu mehr fehlte ihr gewöhnlich die Energie. Dafür stopfte sie den Rest der Woche ständig irgendwas in sich hinein. Kekse, Nüsse, Schokolade. Wenn sie stundenlang am Rechner saß, wurde sie hibbelig und hungrig. Sie musste dann einfach etwas essen. Sie war nicht dick, aber auch nicht besonders gut in Form. Beschämend eigentlich für ihre gerade mal fünfundzwanzig Jahre.
Hier im Regenwald hatte sie ordentlich an Kondition gewonnen. Die täglichen Märsche durch den Dschungel auf der Suche nach Exemplaren einer seltenen Spezies hatten ihre Muskeln trainiert. Das Essen war einfach und gesund. Seit sie hier war, hatte sie einige Kilo abgenommen, das merkte sie an den Bündchen ihrer Outdoor-Hosen, die inzwischen so locker saßen, dass sie einen Gürtel brauchte, damit sie ihr nicht über die Hüfte rutschten.
Doch allein im Dunkeln auf rutschigem und unebenem Untergrund, zwischen dichtem Gestrüpp und mit fünf oder sechs Jägern im Nacken, kam sie trotzdem rasch ins Stolpern. Ihr Atem ging rasend schnell, und ihr Herz hämmerte so heftig, dass sie das Gefühl hatte, es müsste ihr aus der Brust springen. Kim spürte, dass ihre Verfolger aufholten.
Sie durfte nicht kopflos davonrennen. Sie musste versuchen, die Jäger in die Irre zu führen. Vielleicht könnte sie sich irgendwo im Dickicht verstecken und warten, bis die Wilderer an ihr vorbeigerannt wären. Dann könnte sie sich in die andere Richtung davonschleichen.
Kim stürmte zwischen zwei Bäumen nach rechts, zehn, zwanzig, dreißig Meter weiter wieder nach links und nach noch einmal zehn oder zwanzig Metern wieder nach rechts. Neben ihr ragte ein riesiger Strauch auf. Kim warf sich dahinter auf den Boden, machte sich ganz klein und versuchte, lautlos zu atmen, was nicht ganz einfach war.
In einiger Entfernung hörte sie die Männer vorbeilaufen. Die Stimmen entfernten sich.
Kim stieß die Luft aus und stemmte sich vorsichtig auf Hände und Knie. Ihre Kleider waren komplett mit Matsch verschmiert, aber das spielte jetzt keine Rolle. Sie lauschte in die Dunkelheit. Als sie sicher war, dass niemand mehr in der Nähe war, richtete sie sich auf.
Mit vorsichtigen Schritten ging sie in die entgegengesetzte Richtung, mitten hinein in die undurchdringliche Dunkelheit. Das war nicht ungefährlich, aber was sollte sie tun? Sie hatte keine andere Wahl.
Der Mann tauchte so unvermittelt vor ihr auf, dass sie vor Schreck aufschrie. Sie fühlte einen Schlag gegen den Brustkorb, dann noch einen. Das Licht einer Taschenlampe flammte auf und blendete sie. Kim hob die Arme und schlug um sich, traf den Angreifer aber nicht. Stattdessen fühlte sie weitere dumpfe Schläge auf der Brust, gefolgt von einem heftigen Ziehen, als würde ihr jemand ganze Stücke aus dem Körper reißen. Etwas Metallisches blitzte im Licht der Taschenlampe auf, und erst jetzt begriff sie, dass der Mann mit einem Messer auf sie einstach. In diesem Moment kam auch der Schmerz.
Sie versuchte, dem Angreifer gegen das Schienbein zu treten, doch der Tritt ging ins Leere. Wieder stach der Mann zu, und der Schmerz raubte ihr den Atem. Sie spürte, wie das Blut aus ihrem Körper strömte. Ihre Bewegungen wurden kraftlos und unkoordiniert. Vor ihren Augen tanzten bunte Punkte.
Der Mann stieß sie von sich weg, und sie stolperte und fiel rücklings ins dichte Gebüsch. Das Licht der Taschenlampe erlosch.
Kim schwanden die Sinne. Der Regen tropfte von den Bäumen und vermischte sich mit den Tränen auf ihrem Gesicht. Kim spürte nichts mehr davon.
7
Sabine Kaufmann erwachte, als es draußen noch dunkel war. Sie hatte nicht besonders gut geschlafen. Die Matratze war durchgelegen, und irgendwann in den frühen Morgenstunden hatte sie Stimmen auf dem Flur gehört. Lautes Türenknallen, schwere Schritte und Gelächter. Wenig später dröhnten auf dem Parkplatz die ersten Dieselmotoren. Scheinwerfer schnitten für ein paar Sekunden durch die Gardinen und warfen Lichtspuren an die Wand, als die ersten Trucks den Parkplatz verließen. Dann wieder Stille.
Kaufmann war noch einmal eingeschlafen, doch es war ein unruhiger Schlaf gewesen. In Gedanken hatte sie immer wieder den geplanten Zugriff durchgespielt. Es gefiel ihr nicht, dass die Kollegen in so großer Entfernung vom Treffpunkt postiert werden mussten. Auf der anderen Seite – der Mann, mit dem sich Rahn treffen wollte, war Tierschmuggler. Es würde nicht ein halbes Dutzend mit Maschinengewehren bewaffneter Männer aus dem Wagen springen und auf ihn feuern. Eher würde der Lieferant eine giftige Schlange oder eine Giftspinne auf ihn hetzen. Ob sie vorsorglich einen Rettungswagen in die Nähe beordern sollte, der Gegengifte gegen die Giftstoffe von Regenwaldreptilien an Bord hatte? Aber auch das war Unsinn. Schlangen und Spinnen ließen sich nicht abrichten wie Kampfhunde.
Um sieben gab sie den Kampf gegen die Schlaflosigkeit und die abstrusen Fantasien auf und schwang die Beine aus dem Bett. Sie stellte sich unter die heiße Dusche und schlüpfte in bequeme Jeans und einen flauschigen grünen Pullover. Für den Einsatz würde sie die dunkelblaue Polizeiregenjacke überziehen und darunter eine kugelsichere Weste. Sicher war sicher.
Holger Rahn erwartete sie bereits im Frühstücksraum. Auch er hatte offensichtlich geduscht. Sein Gesicht war rosig, Wangen und Kinn glatt rasiert, die noch feuchten blonden Haare sorgsam zurückgekämmt. Er trug eine dunkelgraue Stoffhose und ein rosafarbenes Hemd, das ihm gut stand. Ein Mann, der keine Angst hatte, sich modisch zu kleiden, das gefiel ihr. Er lächelte, als er Sabine erblickte, und sie erwiderte das Lächeln und setzte sich zu ihm an den Tisch.
Bei Kaffee, Pfannkuchen und Rührei erläuterte er die Absprachen, die er bereits mit den Kollegen des Spezialeinsatzkommandos getroffen hatte. Es war alles so gut organisiert, wie es nur möglich war. Kaufmann erzählte ihm von ihrer Vision mit den abgerichteten Reptilien, und Rahn lachte. Solange der Händler kein ausgewachsenes Krokodil dabeihatte, machte er sich keine Sorgen.
Mittlerweile war es kurz vor neun. Der Frühstücksraum hatte sich gefüllt, an mehreren Tischen saßen jetzt Berufskraftfahrer, die keine so weiten Strecken vor sich hatten wie jene, die in aller Herrgottsfrühe aufgebrochen waren.
Kaufmann und Rahn gingen noch einmal auf ihre Zimmer, um ihre Schutzwesten anzulegen. Anschließend trafen sie sich vor dem Hotel. Kaufmann kroch in den Fußraum vor dem Beifahrersitz, und Rahn lenkte den Wagen auf den Lieferantenparkplatz hinter dem Römerwall-Imbiss.
Jetzt hieß es warten.
Ralph Angersbach schob frustriert die Tastatur zurück und stand auf, um sich eine weitere Tasse Kaffee einzuschenken. Seit zwei Stunden klickte er sich immer wieder durch dieselben Seiten im Internet, aber er kam keinen Schritt voran. Nicht, weil er es mit einem besonders schwierigen Fall zu tun hatte, sondern weil er sich einfach nicht entscheiden konnte.
Sein Blick fiel zum hundertsten Mal auf die Karte, die neben der Tastatur lag.
Happy to marry, stand in geschwungener Schrift auf der Vorderseite über dem Foto des Paars, das so glücklich darüber war, dass es heiraten würde. Im Inneren befand sich die Einladung, an der Feier teilzunehmen, zusammen mit dem Datum und dem genauen Ort.
Melbourne, Australien
Das war auf der anderen Seite der Welt. Die Reise dorthin dauerte einen kompletten Tag. Für Ralph, der ungern verreiste, eine Horrorvision. Er wollte nicht endlose Stunden eingezwängt in einem Flugzeug sitzen. Aber die Braut war seine Halbschwester. Er konnte nicht einfach absagen.
Janine und Morten hatten die Hochzeit verschoben, weil Mortens Mutter im Herbst von der Leiter gefallen war und sich das Bein gebrochen hatte. Auf der Hochzeit ihres Sohnes nicht tanzen zu können, war eine schreckliche Vorstellung für sie gewesen, und so hatten Janine und Morten ihr zuliebe einen neuen Termin festgelegt. Im April. Genauer gesagt: in vier Wochen.
Deswegen beschäftigte sich Angersbach mit den Angebotsseiten der Fluggesellschaften und studierte Flugpläne, Tariflisten und zubuchbare Optionen. Aber er schaffte es nicht, etwas auszuwählen.
Was nicht zuletzt an dem Text auf der Innenseite der Karte lag.
Die Einladung galt für ihn und eine Begleitperson.
Im letzten Herbst, als sie den Atommüll-Fall bearbeitet hatten, waren Sabine Kaufmann und er sich wieder nähergekommen. Janine, Ralphs Halbschwester, hatte erklärt, dass Sabine ebenfalls zur Hochzeit eingeladen war. Aber seitdem war ein halbes Jahr vergangen. Er hatte Sabine in dieser Zeit nicht gesehen, nicht mit ihr telefoniert, ihr keine E-Mails geschrieben. Die sozialen Netzwerke kamen für ihn ohnehin nicht in Frage. Eher würde er sich ein Loch ins Knie schießen, als sich eine Messenger-App oder gar Facebook auf seinem Smartphone zu installieren.
Also war der Kontakt wieder einmal abgebrochen. Er war einfach ein hoffnungsloser Fall. Aber Sabine hätte sich ja auch melden können.
Wahrscheinlich war sie längst wieder mit diesem LKA-Schnösel Holger Rahn zusammen, mit dem sie im letzten Herbst herumgeturtelt hatte. Den Gedanken, dass sie ihn, Ralph, in dieser Zeit geküsst hatte, schob er lieber beiseite. Das war nur ein Moment der Schwäche gewesen, weil sie beide müde und vom Wein anlehnungsbedürftig gestimmt gewesen waren.
Sabine konnte tun und lassen, was sie wollte, doch die Frage, die ihn quälte, war: Hatte sie ebenfalls eine Einladung zu Janines und Mortens Hochzeit bekommen? Oder hatten die beiden nur ihm eine Einladung geschickt, weil sie davon ausgingen, dass er Sabine mitbrachte? Wie würden sie reagieren, wenn er allein käme?
Weil er darauf keine Antwort fand, war er auch nicht in der Lage, einen Flug zu buchen. Er wusste ja nicht, ob er ein Ticket für eine Person oder für zwei brauchte.
Das Einfachste wäre gewesen, Sabine anzurufen und sie zu fragen, ob sie mitkommen wollte. Aber wollte er das auch?
Angersbach kippte den schwarzen Kaffee hinunter und schenkte sich eine weitere Tasse ein. Die Flüssigkeit in der Glaskanne der Maschine stand schon eine halbe Ewigkeit auf der Warmhalteplatte, war nur noch lauwarm und schmeckte inzwischen bitter, doch das war ihm egal.
Er stellte die Tasse neben den Rechner und setzte sich wieder auf seinen Platz. Dann rief er erneut die Seite einer Fluggesellschaft auf und gab die Reisedaten ein.
8
Der Regen tropfte auf die dicke Plane des Küchenzelts. Lara zupfte an ihrem Top. Sie hatte es an diesem Morgen frisch angezogen, aber es war schon jetzt, eine halbe Stunde später, verschwitzt. Ein Glück, dass die Dusche, die sie gebaut hatten, dank des ständigen Regens immer genug Wasser bereithielt und dass es in Leticia eine Wäscherei gab, in der all ihre Sachen regelmäßig gewaschen wurden.
Mittlerweile war sie daran gewöhnt, dass man sich drei-, viermal am Tag umziehen musste, manchmal auch öfter. Die schwüle Wärme presste den Schweiß aus allen Poren und legte sich wie ein Film darüber. Lara konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann sie zuletzt einmal richtig trocken gewesen war. Trotzdem hätte sie an keinem anderen Ort der Welt sein wollen.
Als kleines Mädchen hatte sie ihre erste Echse bekommen und alles über Reptilien verschlungen, was es in Büchern und im Netz zu lesen gab. Sie war eine regelrechte Expertin geworden.
Sie hatte darüber nachgedacht, das Abitur zu machen und Biologie oder Umweltschutz zu studieren, sich dann aber doch dagegen entschieden. Stattdessen war sie nach dem Realschulabschluss abgegangen, weil sie rauswollte aus dem stickigen Mief bei ihren Eltern. Sie wollte leben und etwas von der Welt sehen.
Seit ein paar Jahren engagierte sie sich ehrenamtlich bei den RegenWaldRettern. Luca, ihre erste Echse, lebte nicht mehr, aber Lara hatte in ihrer Wohnung ein Terrarium mit etlichen Amazonas-Bewohnern. Zuchttiere, darauf legte sie großen Wert. Als sie erfahren hatte, wie im Amazons-Regenwald der Artenschutz umgangen wurde, hatte sie angefangen, ihren Jahresurlaub aufzusparen. Vier Jahre lang, und dann hatte ihr Chef ihr die Teilnahme an der Expedition bewilligt. Gute drei Monate im Regenwald, und für einen Teil der Zeit hatte er sie freigestellt, so dass sie nicht einmal die Hälfte ihres aufgesparten Urlaubs verbrauchen musste und später im Jahr sogar noch einmal wiederkommen könnte.
Die drei Monate waren vergangen wie im Flug, und Lara bedauerte es sehr, dass sie in knapp einer Woche die Zelte wieder abbrechen würden. Vor allem, da sie nicht die geringste Spur zu den Wilderern gefunden hatten.
Irgendwann, das hatte sie sich geschworen, würde sie ihre eigene Organisation gründen, deren Hauptziel nicht Dokumentation und Forschung war wie bei den RegenWaldRettern, die Material sammelten, um politisch etwas zu bewirken, sondern schlicht und direkt die Jagd auf die Wilderer. Als Polizistin wusste sie, wie man so etwas anpacken musste. Ihr fehlten nur noch das Geld und die Mitstreiter, aber das würde sich in den nächsten Jahren ändern.
Die erste Kandidatin hatte sie auf dieser Exkursion bereits gefunden. Kim, die im selben Alter war wie Lara und mit der sie sich wunderbar verstanden hatte. Gemeinsam würden sie etwas erreichen, da war sich Lara sicher.
Die Zeltplane wurde beiseitegeschoben, und Danny Bender betrat das Küchenzelt. Er nahm sich einen Becher aus dem Regal, füllte ihn mit Kaffee aus der Kanne, die Lara bereitgestellt hatte, und setzte sich an den Tisch, den sie gedeckt hatte. Lara hatte in dieser Woche Frühstücksdienst.
»Morgen«, sagte er, stellte seine große Umhängetasche ab und holte die Kamera heraus. Mit konzentrierter Miene studierte er die Bilder, die er am Vortag geschossen hatte, und löschte die Aufnahmen, die nichts geworden waren.
Danny war einer der beiden fest angestellten Mitarbeiter der RegenWaldRetter und zugleich der Fotograf des Teams. Er war nur ein paar Jahre älter als Lara, aber sie war mit ihm nicht warm geworden. Danny war wortkarg und offenbar nur an seiner Arbeit interessiert, nicht daran, Kontakte zu knüpfen. In den drei Monaten, die sie jetzt hier waren, hatte sie nicht viel mehr über ihn erfahren, als dass er aus Fulda stammte und in München nicht nur Biologie, sondern auch Fotografie studiert hatte.
Der andere Festangestellte, Markus Kießling, betrat kurz darauf das große Zelt, in dem nicht nur die Kochstelle mit dem Gaskocher und eine große Spüle, sondern auch ein Esstisch mit Stühlen für fünf Personen Platz fanden. Er war in jeder Hinsicht das komplette Gegenteil von Danny. Markus sah umwerfend gut aus, ein Abenteurer wie aus dem Bilderbuch. Halblange, zerzauste dunkle Haare, warme braune Augen und ein Sechstagebart, der sein markantes Kinn betonte. Die Outdoor-Kleidung wirkte an ihm, als sei sie eigens für ihn erfunden worden.
»Hey, Lara. Das sieht fantastisch aus.« Markus deutete auf den Tisch, auf dem sie Maisfladen, Tortillas, gebackene Eier und Bohnen, gebratene Würste, Honig, Marmelade und Nutella arrangiert hatte. Genau wie Danny nahm er sich einen Kaffee, warf im Gegensatz zu jenem aber zwei Stück Würfelzucker hinein. Er setzte sich zu Danny an den Tisch und lächelte ihr zu. »Ehrlich. Wenn sie dich irgendwann bei der Polizei nicht mehr wollen, solltest du ein Restaurant aufmachen.«
Lara erwiderte das Lächeln. Tatsächlich kochte sie leidenschaftlich gern, vor allem für andere. Sie selbst musste sich beim Essen zügeln. Wenn sie ihre schlanke Figur halten wollte, durfte sie nicht über die Stränge schlagen und musste außerdem regelmäßig Sport treiben. Ihr straffer Körper, den viele Männer mit Wohlgefallen betrachteten, war die Belohnung dafür. Markus und Danny gehörten allerdings nicht zu den Bewunderern.
Bei Danny war es Lara egal, doch Markus war genau der Typ Mann, den sie sich als Partner wünschte. Aber er war elf Jahre älter als sie, und sie war ihm vermutlich einfach zu jung. Davon abgesehen war er ebenso wie Danny vollkommen auf seine Aufgabe fokussiert, und das Gefühl, sich Tag und Nacht in einer zu heiß eingestellten Sauna zu befinden, weckte auch nicht gerade die Sehnsucht nach körperlicher Nähe. Vielleicht später einmal, wenn sie zurück in Deutschland waren.
Markus war Journalist, er hatte schon für verschiedene Umweltorganisationen die PR gemacht und war vor einem halben Jahr zu den RegenWaldRettern gekommen. Die Broschüren, die er seitdem gestaltet hatte, waren toll, und hier im Regenwald sammelte er Informationen für das Buch, das RWR nach dem Aufenthalt im Amazonas-Gebiet herausgeben wollte.
»Die Letzten ihrer Art« sollte es heißen, und Markus hatte ihnen abends bereits einige der Texte vorgelesen, die er für das Buch geschrieben hatte. Sie waren großartig, sachlich und trotzdem voller Wärme. Man merkte, dass Markus den Amazonas und seine Bewohner liebte.
Erneut wurde die Zeltplane beiseitegeschoben, und Florian Waldschmidt, der Leiter der Expedition, kam herein. Er nahm sich einen Tee.
Waldschmidt war sechsundvierzig, Professor für Biologie an der Uni Frankfurt und ein begeisterter Wissenschaftler. Die Lehre dagegen leistete er nur widerwillig ab. Nicht, weil er jungen Menschen nicht gerne etwas beibringen wollte. Das war ihm sogar sehr wichtig. Aber Waldschmidt war menschenscheu. Sobald mehr als zehn Studenten in seinem Hörsaal saßen, fühlte er sich unwohl. Und zu seinen Veranstaltungen kamen meist mehr als hundert, weil sie so anschaulich und spannend waren.
Die RegenWaldRetter waren Waldschmidts Baby. Er hatte das Projekt geplant und beim Bundesumweltministerium Gelder dafür eingeworben. Die Rettung des Regenwalds spielte eine wesentliche Rolle, wenn es darum ging, die Klimakatastrophe zu verhindern.
Waldschmidt nickte grüßend in die Runde und nippte an seinem Tee. Anschließend sah er auf die Uhr. »Wo ist Kim?«
Lara und die beiden Männer tauschten ratlose Blicke. Sie alle wussten, dass Waldschmidt Unpünktlichkeit nicht leiden konnte. Sie hatten einen eng gesteckten Zeitplan, jeder Tag hier im Regenwald musste optimal genutzt werden. Alles andere wäre eine Verschwendung von Forschungsgeldern gewesen, und in diesem Punkt verstand Waldschmidt keinen Spaß.
Danny legte die Kamera beiseite und stand auf. »Ich sehe mal nach.«
Florian Waldschmidt setzte sich an den Tisch. »Wir fangen schon mal an.«
Lara nahm neben ihm Platz und füllte ihren Teller mit Eiern, Würstchen und Bohnen. Sie aßen eine Weile schweigend.
Als Danny zurückkam, wirkte er beunruhigt. »Ich kann sie nicht finden. Sie ist nicht in ihrem Zelt, nicht unter der Dusche und auch nicht auf der Toilette. Und der Schlafsack sieht aus, als hätte sie gar nicht darin geschlafen.« Danny hielt sein Funkgerät hoch. »Ich habe versucht, sie anzufunken, aber sie meldet sich nicht.«
Waldschmidt legte seine Gabel beiseite. »Moment mal. Soll das heißen, sie ist gestern Abend überhaupt nicht zurückgekommen?«
Lara riss erschrocken die Augen auf. Sie waren am Abend ausgeschwärmt wie an jedem Tag der vergangenen Wochen, in der Hoffnung, doch noch eine Spur der Wilderer zu finden. Sie selbst war kurz vor Einbruch der Dunkelheit zurückgekehrt und sofort in ihr Zelt gekrochen, weil sie todmüde war. Aber irgendeiner der Männer musste Kim doch gesehen haben?
»Ich war bis kurz vor Mitternacht unterwegs«, sagte Danny. »Habe ein paar großartige Nachtaufnahmen gemacht. Als ich zurückgekommen bin, war im Camp alles dunkel. Ich habe hier im Zelt noch ein Bier getrunken und bin dann schlafen gegangen. Getroffen habe ich niemanden mehr.«
Lara schaute Waldschmidt und Kießling an. »Und ihr? Seid ihr Kim auch nicht begegnet?«
»Nein.« Kießling kniff die Augen zusammen, ließ offenbar den späten Abend des gestrigen Tages Revue passieren. »Ich hatte mich verirrt. Bin zu tief in den Dschungel geraten. Es war bestimmt schon halb zehn, als ich den Weg wiedergefunden habe. Auf dem letzten Stück bin ich Florian begegnet.«
Waldschmidt bestätigte das mit einem Nicken. »Ich war unten am Fluss«, erklärte er. »Habe dort ein paar Einheimische beobachtet, die ein Boot klargemacht haben. Sie hatten Stangen und Netze dabei. Ich dachte, das wären vielleicht die Wilderer. Ich habe versucht, ihnen an Land zu folgen, doch das hat nicht funktioniert. Ich bin im Dickicht stecken geblieben, und irgendwann waren sie weg. Ich bin dann noch eine ganze Weile weiter am Fluss entlanggegangen, weil ich dachte, ich finde sie wieder, aber ich hatte kein Glück. Als es dunkel geworden ist, bin ich umgekehrt. Die Batterien in meiner Taschenlampe waren schon reichlich schwach. Wenn ich Markus nicht getroffen hätte, wäre ich wahrscheinlich in der Dunkelheit verloren gegangen.« Er warf Kießling einen dankbaren Blick zu. »Wir haben noch ein paar Tortillas gegessen, und dann haben wir uns hingelegt.« Er hob unbehaglich die Schultern. »Ich bin davon ausgegangen, dass Kim längst zurück wäre und in ihrem Schlafsack liegt.«
»Verdammt.« Danny ballte die Fäuste. »Soll das heißen, Kim irrt seit gestern Abend ganz allein irgendwo da draußen herum?«
Lara sah den feuchten Glanz in seinen Augen. Anscheinend war Danny doch nicht so kontaktscheu, wie sie gedacht hatte. Zwischen ihm und Kim schien es gefunkt zu haben. Jedenfalls empfand er etwas für sie. Ob sie davon etwas mitbekommen und seine Gefühle erwidert hatte, stand auf einem anderen Blatt.