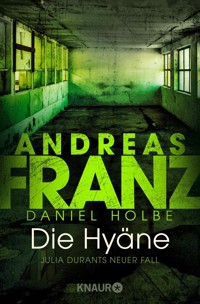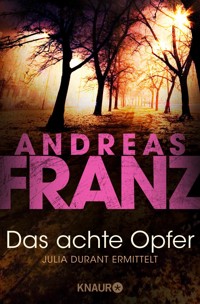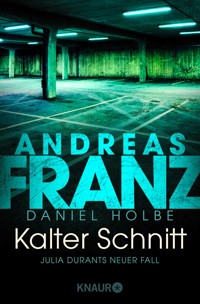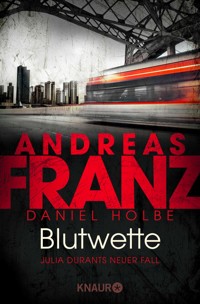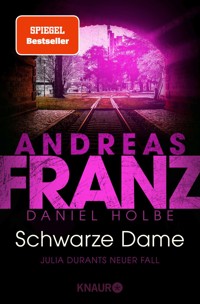
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Julia Durant ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein gerissener Killer fordert Julia Durant heraus – zu einer tödlichen Partie Schach … »Schwarze Dame« ist der 24. Frankfurt-Krimi mit der ebenso mutigen wie kompromisslosenKommissarin Julia Durant von den Bestseller-Autoren Daniel Holbe und Andreas Franz. In Frankfurt geht die Angst um, nachdem ein Obdachloser mit einem Hammer erschlagen wurde. Hat ein berüchtigter Frankfurter Serienmörder hier etwa einen Nachahmer gefunden? Für Kommissarin Julia Durant und ihr Team gestalten sich die Ermittlungen äußerst zäh: Es gibt keine Zeugen und kaum verwertbare Spuren. Als kurz darauf eine Frau ermordet wird, scheinen die Fälle nicht zusammenzuhängen, denn der Modus Operandi ist ein völlig anderer. Erst ein weiterer Hammer-Mord bringt Julia Durant ins Grübeln. Dann wird ihr ein alter Stadtplan zugespielt, auf dem Frankfurt in acht mal acht Felder unterteilt ist – wie ein Schachbrett! Jeder Tatort passt zu einem Spielfeld. Und das Feld der schwarzen Dame ist das Polizeipräsidium … 1996 schrieb Andreas Franz seinen ersten Krimi mit der toughen Kommissarin Julia Durant. Seit dem Tod des Bestseller-Autors 2011 führt Daniel Holbe die erfolgreiche deutsche Krimi-Serie fort. Alle Fälle von Julia Durant im Überblick: - Jung, blond, tot - Das achte Opfer - Letale Dosis - Der Jäger - Das Syndikat der Spinne - Kaltes Blut - Das Verlies - Teuflische Versprechen - Tödliches Lachen - Das Todeskreuz - Mörderische Tage - Todesmelodie - Tödlicher Absturz - Teufelsbande - Die Hyäne - Der Fänger - Kalter Schnitt - Blutwette - Der Panther - Der Flüsterer - Julia Durant. Die junge Jägerin - Todesruf - Der doppelte Tod - Schwarze Dame
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Daniel Holbe / Andreas Franz
Schwarze Dame
Julia Durants neuer Fall
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein gerissener Killer fordert Julia Durant heraus: zu einer tödlichen Partie Schach
Ein Mordopfer weist offensichtliche Verletzungen von einem Hammer auf. Genau wie ein ermordeter Obdachloser ein Jahr zuvor. Julia Durant ist alarmiert: Hat der berüchtigte Frankfurter Hammermörder einen Nachahmer gefunden?
Erst ein weiterer Mord bringt die entscheidende Spur: eine Schachfigur. Jeder Tatort passt zu einem Spielfeld, und der Täter ist immer einen Zug voraus. Und ausgerechnet das Polizeipräsidium ist das Feld der schwarzen Dame …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Zitat
Prolog
Sonntag
Ein Jahr später
Donnerstag
Freitag
Samstag
Montag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Epilog
Die Leidenschaft des Schachspielens ist eine der unverantwortlichsten der Welt. Keine andere Beschäftigung nimmt dich so gefangen mit Haut und Haar, keine befriedigt dein Verlangen weniger – ein zielloser Auswuchs des Lebens. Wenn du jemanden vernichten willst, dann nimm keinen Dolch oder eine Bombe, das wäre plump und unzuverlässig.
Lehre ihn Schach, und du wirst ihn zerstören!
(nach H. G. Wells)
Prolog
Er hatte die Welt gesehen.
Mit bebendem Oberkörper verharrte er am Fenstersims seiner Küche. Die Ellbogen hatten breite Spuren in den fettigen Staub gezogen. Der Mülleimer aus Blech lag umgestürzt auf den Kunststofffliesen, die sich bereits an den Ecken ablösten und einen gelb-fleckigen Schimmer hatten. Aus dem Eimer rann Milch. Sie war sauer, er hatte den halb vollen Tetra Pak mit wütendem Schwung in die Tonne geworfen, wo er explodiert war.
Als Nächstes hatte ihm der Postbote nach einer Klopforgie an der Wohnungstür einen Brief durch den Schlitz geschoben. Das Klopfen hallte wie Hammerschläge in seinem Kopf. Beinahe wäre er losgerannt, etwas in ihm sagte ihm, dass er einfach nur die Tür aufreißen und den stämmigen Mann mit den verschwitzten Koteletten die Treppe hinabtreten solle.
Endlich wieder Ruhe. Stille.
Es war nur selten richtig still, auch wenn er allein lebte.
»Sie sind doch da, das weiß ich genau!«, hatte der Mann in der blauen Uniform gerufen.
Warum hatte er sich überhaupt nach oben bemüht? Sonst tat er das doch auch nicht. Stattdessen stand er nutzlos rum, drückte der neugierigen Kratzbürste im Parterre den Papierstapel in die Hand und ließ sich zuweilen auf einen Schnaps oder eine Zigarette einladen.
Lag es daran, dass er seinen Briefkasten seit Wochen nicht geleert hatte oder an der mit dunkler Handschrift vermerkten Notiz, das Schreiben »bitte nur persönlich auszuhändigen«?
Doch noch bevor er sich aus seiner Starre hatte lösen können, war der Lärm verstummt. Innen und auch außen. Die Treppenstufen knarzten, besonders die dritte von oben. Irgendwann würde das wurmstichige Holz nachgeben und jemanden ins Verderben stürzen.
Er mochte diesen Gedanken. Denn er hasste das Haus und die Gegend. Im Grunde hasste er die ganze Welt.
Was kannte der Schweißgesichtige schon von ihr?
Frankfurt-Bornheim. Vielleicht noch die Nachbarbezirke.
Jeden Tag dieselbe Route. Er stellte Briefe und Postkarten aus den entferntesten Gebieten auf dem Globus zu, aber hatte er selbst schon einmal etwas davon gesehen und erlebt? Die Hitze Arabiens, die Wildheit Australiens?
Nein. Und dafür hasste er auch ihn.
Doch genau genommen hasste er nur sich selbst.
Deshalb hatte er, sobald die Haustür zugefallen war, seinen Mülleimer so hart getreten, dass er quer durch die Küche geflogen war und eine tiefe Schramme im Furnier des Unterschranks hinterließ. Dabei schrie er. Es war ein kurzer, befreiender Lärm. Gerade kurz genug, dass die Alte mit den Lockenwicklern und dem spitzen Gesicht nicht zu kreischen begann und den Besenstiel gegen ihre Decke rammte, die gleichzeitig sein Fußboden war.
Bloß kein Geschrei. Keine Stimmen.
Dabei wusste er, dass sie immer wiederkehrten.
So wie die Welt, die in diesen Tagen nach Frankfurt zu strömen schien.
Der »Wind of Change« hatte den Eisernen Vorhang einfach umgeweht und war wie ein Tornado über Europa gefegt. Doch mit seiner Urwucht kamen die Trümmer. Man konnte ihnen nicht entfliehen. Menschliches Treibgut, das am Hauptbahnhof strandete und darauf hoffte, in der Stadt das Glück zu finden.
Manche fanden es. Der Rest wogte durch die Vergnügungsstraßen und endete in der Taunusanlage oder unter den Mainbrücken. Im Schatten der Hochhausschluchten und in den U-Bahn-Stationen. Im Allerheiligenviertel und in den Arkaden der Weißfrauenstraße.
Sie alle hasste er auch.
Er stand auf und sammelte lustlos einen Apfelkrotzen, eine Konservendose und einen Joghurtbecher zusammen. Es stank. Doch das störte ihn nicht. Mit einem angedeuteten Grinsen öffnete er das Fenster. Er sah nicht nach unten, es war ihm gleichgültig, ob der Mann mit der blauen Postuniform oder die schrille Frau aus dem Erdgeschoss noch miteinander kokettierten. Die Konservendose traf mit einem nicht zu überhörenden Aufprall auf das Trottoir. Eine vergammelte Bananenschale und eine bunte Ladung von zerknülltem Papier folgten dem ersten Abwurf. Jemand schrie.
Doch da war das Fenster schon wieder zu.
Er zog sich einen Stuhl heran und beobachtete den Himmel und die Hausdächer. Den fleckigen Putz an graubraunen Fassaden. Unten Autolärm. Irgendwann klingelte es an der Tür. Er ließ es geschehen. Schaltete sein Gehör nach innen. Jeder andere hätte vermutlich ein Stück Kaugummi oder einen Wattebausch zwischen Hammer und Metallschale der offenen Türklingel gesteckt. Er brauchte das nicht.
Gegen den Lärm und die Stimmen der Welt konnte er sich schützen. Meistens jedenfalls.
Gegen seine inneren Stimmen leider nicht.
Sie sprachen mit ihm, als es Nachmittag wurde. Sie zogen an ihm, sie lockten, manchmal drohten sie, aber das konnte er nicht leiden. Dann schlug er auf den Tisch oder trat gegen eine Wand. Oder gegen den Mülleimer. Meistens half das für eine Weile. Die Stimmen flüchteten so wie Kinder, die Schneebälle auf Autos feuerten und verängstigt auseinanderstoben, wenn ein Fahrer anhielt und Drohungen durch das heruntergekurbelte Fenster brüllte. Dann hockten sie sich hinter Mauern oder geparkte Fahrzeuge und warteten, bis sich die Lage beruhigt hatte. Sie lauerten. Aber sie waren niemals so richtig weg.
Genau wie sie.
Er stand auf, griff sich Jacke und Schal und noch ein paar andere Dinge. Machte sich auf seinen Weg mit unbekanntem Ziel. Nur weg, bevor sie wiederkamen. Die feigen Gören mit ihren Schneebällen.
Draußen war es kalt. Februar. Kein Vergleich zu den heißen Monaten Arabiens, an die er sich so gerne erinnerte. Als er noch nicht alleine gewesen war mit den Stimmen. Als es eine Stimme gegeben hatte, die sie übertönte. Und friedliche Einsamkeit um ihn herum herrschte.
Als die Dunkelheit sich vollends über die Stadt gelegt hatte, war er bereits mehrere Kilometer gelaufen. Ziellos, so mochte es zumindest auf andere wirken. Jeden Tag mit einer anderen Route sah er doch stets dasselbe, das Treibgut der Zeitenwende. Gestrandete Menschen. Obdachlose und Junkies. Sie waren plötzlich überall.
Es waren diese und schlimmere Begriffe, die seine Stimmen für die Menschen mit den verblichenen Plastiktüten und den löchrigen Schlafsäcken kannten. Böse Worte, für die ihm seine Mutter jede Menge Ohrfeigen gegeben hätte. Oder sie hätte gleich den hölzernen Rührlöffel zur Hand genommen. Oder gar den Teppichklopfer.
Er blieb stehen und rieb sich das Gesäß. Die Tüte in der anderen Hand raschelte. Der Teppichklopfer hatte nur selten zu ihm gesprochen, und gleichzeitig war es die leiseste aller Stimmen gewesen. Ohrfeigen klatschten. Der Rührlöffel verursachte hauptsächlich ein gedämpftes Ziehen, je nachdem, wo er traf. Der Teppichklopfer traf großflächig auf den Hosenstoff und trieb den Schmerz indirekt durch ihn hindurch. Ein leises Patschen.
Mit Bedacht rollte er den Hammer aus der Plastiktüte. Es knisterte. Der Mann, zu dem sie ihn gelenkt hatten, lag in einem Gebüsch. Friedberger Anlage. Bethmannpark. So genau nahm er es wohl kaum wahr. Eingerollt in alles, was er besaß, um den eisigen Nachtstunden des Winters zu trotzen. Der karge Strauch schützte ihn weder vor dem Wind noch vor ihm.
Er holte aus. Zitterte. Seine Muskeln schienen sich gegen die Kommandos aus dem Gehirn zu wehren, doch sie hatten keine Chance. Mit voller Wucht schlug er zu. Es klatschte nicht, es patschte nicht einmal richtig. Es war eine kaum in Worte zu fassende Mischung aus dem Knacken einer Kokosnuss und dem Halbieren einer Melone. Nur mit mehr Blut.
Viel mehr Blut.
Sonntag
Weltkriegsbombe!
Für die Presse war das eine Schlagzeile, die sie dankbar annahm. Für eine Handvoll Frankfurter der älteren Jahrgänge weckte diese Meldung allerdings Erinnerungen an eine dunkle Zeit. Schatten, die im Lodern der Flammen umhersprangen. Sirenenheulen und die beklemmende Enge von Schutzkellern. Dröhnen am Himmel, Sirren in der Luft. Ohrenbetäubende Detonationen und einstürzende Fassaden. Ein Inferno von fünfundsiebzig Bombenangriffen hatte die Stadt in Schutt und Asche hinterlassen. Man hatte sie wiederaufgebaut. Zuerst notdürftig, dann kamen die Hochhäuser. Und jetzt gab es eine neue Bauwelle. Alt gegen neu. Gebäude. Straßen. Und unter den Fundamenten und Asphaltschichten der Fünfzigerjahre wurden immer wieder Blindgänger gefunden, zentnerschwere Metallhüllen, die vor einem Dreivierteljahrhundert vom Himmel gefallen waren und ihre zerstörerische Ladung noch immer in sich trugen; hinter Zündern, die so sensibel waren, dass man am besten einen weiten Bogen um sie schlug. Der Kampfmittelräumdienst war praktisch wöchentlich im Einsatz, um verdächtige Funde zu überprüfen. Die meisten Einwohner der Stadt hatten sich an die Schlagzeilen gewöhnt. Man checkte meistens nur noch, in welchem Stadtteil sich das Ganze abspielte. Ob der Evakuierungsradius die eigene Wohnung oder den Arbeitsplatz betraf. Wie stark der Verkehr davon betroffen war. Der Rest war Routine – zumindest für einen selbst. Bomben wurden ausgegraben. Bomben wurden entschärft. Der Mensch war ein Gewohnheitstier und wollte in seinem Komfort nicht gestört werden.
Doch mit dieser Bombe war es anders, denn sie lag nicht auf einer Baustelle, nicht an einem Verkehrsknotenpunkt, jedenfalls nicht so, wie man es erwartet hätte. Einige Tage zuvor war sie im Rahmen einer Übung zufällig von Feuerwehrtauchern entdeckt worden. Ein verdächtiges Objekt auf dem schlammigen Grund des Mains unter der Alten Brücke. Und diesmal hielt die Stadt den Atem an.
Am Palmsonntag feiert das Christentum den Einzug Jesu in Jerusalem. Damals, so heißt es, säumten die Menschen die Straßen, jubelten ihm zu und warfen Palmzweige auf seinen Weg. Heute standen die Gläubigen mit wachsender Verärgerung vor dem Dom, manche rüttelten an der verschlossenen Tür, einige stießen unschöne Worte aus. Sperrzone. Evakuierung. Die Anwohner gingen auf die Straße, aber nicht mit Palmzweigen, sondern mit dicken Jacken und ohne Feierlaune. Noch eine Woche bis Ostern. Es war unwirtlich. Dreihundertfünfzig Einsatzkräfte durchkämmten die Straßenzüge, um sechshundert Menschen zu evakuieren. Einer der Schutzräume befand sich im Gemeindehaus am Römer, nur knapp außerhalb des gesperrten Bereichs. Es war eines der rekonstruierten Häuser der neuen Altstadt, unten Sandstein, oben Schiefer, dazwischen gelber Putz und Unmengen an Sprossenfenstern. Wie viele Scheiben drohten zu zerbersten, wenn der große Knall kam?
Uniformierte gingen von Haus zu Haus, mehrstöckige Gebäude, die sich an der Uferpromenade des rechten Mainufers aneinanderreihten. Ein breiter Grünstreifen, auf dem sich sonst die Menschen tummelten. Radfahrer, Gassigänger, Pärchen. Alte und junge Menschen. Einheimische und Touristen. Heute jedoch war der Bereich wie ausgestorben. Leer gefegt. Eine Geisterstadt. Endlich waren die Einsatzkräfte bis zu den Obdachlosen vorgedrungen, die in der Nähe des Wassers Unterschlupf gesucht hatten.
»Nein, Sie dürfen hier auch nicht im Freien bleiben.«
»Wir wissen nicht, wie lange die Sperrung andauern wird.«
»Ich will aber nicht hier weg!«
Es waren stets dieselben Dialoge. Plötzlich schien es gleichgültig, woher man stammte oder welcher Schicht man angehörte. Alle mussten aus diesem Bereich verschwinden, der zur Evakuierungszone geworden war.
Hausbesitzer. Mieter. Durchreisende. Menschen, die ihre Komfortzone verlassen mussten, weil sie zum Sperrgebiet geworden war. Wenn auch nur vorübergehend. Würde die »kontrollierte Sprengung« – falls es so etwas überhaupt gab – die Fensterscheiben zersplittern lassen? Was war mit dem teuren Porzellan, dem Aquarium oder dem Spülkasten im Bad? Wie wurde das Gebiet gegen Einbrüche gesichert? Was passierte mit Haustieren, die nicht ohne Weiteres zu transportieren waren?
»Wo sollen wir denn hin?«
»Es wurden extra Schutzräume eingerichtet.«
»Ja. Es tut uns leid, aber Sie müssen den Bereich jetzt verlassen.«
Jedes Mal dieselben Gespräche. Viele reagierten mit Verständnis, wenige mit Trotz. Und zusätzlich stieß die Polizei bei fast jeder Evakuierungsaktion auf delikate Situationen wie illegal gehaltene Exoten, Hehlerware oder auch mal einen gesuchten Kriminellen mit falscher Identität.
Eine Leiche allerdings war etwas Neues.
In einem der weißen Gebäude mit bestem Blick auf das Geschehen warteten zwei uniformierte Polizeibeamte vor einer Wohnungstür im zweiten Stock. Der eine der beiden, ein hagerer Mittfünfziger, den alle Welt nur mit seinem Vornamen Rainer ansprach, tastete nach seinen Zigaretten. Er war mehr grau- als braunhaarig, und unter dem Hemd zeichnete sich ein deutlicher Spitzbauch ab. »Jedes Mal dieselbe Scheiße«, murrte er.
»Du solltest das besser lassen«, mahnte ihn seine Kollegin, die kaum halb so alt war wie er. Die dunkelblonden Haare lugten zu einem Pferdeschwanz gebunden unter der Dienstmütze hervor. Der Zeigefinger deutete auf einen Rauchmelder an der Decke.
Der Polizist schnaubte. »Die reagieren doch nicht auf Zigarettenrauch. Wer weiß, wie lange wir uns hier noch die Beine in den Bauch stehen müssen.«
»Eben«, grinste sie und hob die Augenbrauen. »Ich muss immerhin neben dir stehen und den Dreck mit einatmen.«
»Touché.« Seine Hände gaben die Suche nach den Glimmstängeln auf. »Aber wenn sich in zehn Minuten immer noch nix getan hat, hast du Pech gehabt.«
Sie nickte. Erneut presste sie den Finger auf den Taster der Klingel und lauschte. Nichts. Dabei hätte sie schwören können, dass sie irgendwo im Haus ein Bellen gehört hatte. Einbildung vielleicht, denn wie konnte das sein? Sie zog die Liste hervor, auf der sämtliche Bewohner des Hauses verzeichnet waren. Alle Wohnungen waren seit zwei Stunden evakuiert. Nur diese hier nicht. Einer Nachbarin zufolge war Frau Sämann verreist. Doch hätte sie dann nicht ihren Hund mitgenommen? War es überhaupt ihr Hund?
Auch hier hatte eine schnelle Befragung der Hausbewohner geholfen, von denen die meisten im Ratskeller saßen, wo sie mit Kaffee, Tee und Gebäck versorgt wurden.
»Dieses kleine Mistvieh!«
»Wieso, den sieht und hört man doch kaum.«
»Doch, wenn es regnet und er den ganzen Dreck mit reinbringt!«
Jedenfalls würde Frau Sämann wohl kaum ohne ihren Hund verreisen, da war man sich einig gewesen. Und die Rollläden waren seit mindestens zwei, wenn nicht sogar vier Tagen nicht mehr geöffnet worden.
Die Polizistin nahm ihre Mütze ab und legte das Ohr ans Türblatt. »Wenn da ein Hund drinnen ist«, murmelte sie, »warum schlägt er dann nicht an?«
Rainer schnaubte. »Ach, Cora, weil da keiner drin ist. Wer weiß, woher das kam. Du wirst das Gewäsch der Nachbarn ja wohl nicht für bare Münze nehmen. Das kannst du dir direkt mal einprägen, wenn du die lieben Mitmenschen befragst …«
Cora schaltete auf Durchzug. Auf einen Vortrag des alten Griesgrams hatte sie keine Lust. Mansplaining. Manche Typen ergingen sich förmlich darin, junge Kolleginnen als Dummchen dastehen zu lassen. Stattdessen presste sie die Ohrmuschel noch fester an die Tür und klopfte. »Hallo? Ist jemand zu Hause?«
Stille. Und dann glaubte sie, ein Winseln zu hören. Es ging unter im Klacken des Feuerzeugs, als ihr Kollege sich den Glimmstängel entzündete.
»Verdammt!«, zischte sie und schenkte ihm einen vernichtenden Blick.
»Was denn?« Er inhalierte tief.
»Ich glaube, da war was.«
Das hustende Lachen wurde von Rauchwolken begleitet, die aus sämtlichen Gesichtsöffnungen zu strömen schienen. »Du siehst Gespenster!«
Doch noch bevor sein Zeigefinger die Stirn erreichen konnte, hämmerte sie erneut an die Tür und drückte mit der anderen Hand auf die Klingel.
»Hallo!«
»Pizzaservice!«
Cora kam nicht mehr dazu, die Augen zu verdrehen.
Dieses Mal hörten sie es beide. Ein Jaulen.
»Scheiße, verdammte.« Er sah auf die Armbanduhr. »Wir haben keine Zeit mehr für so was. Die wollen sprengen.«
Doch die Gedanken der jungen Frau rasten im Karussell. »Wenn der Hund dort drinnen ist, muss sie es auch da sein.«
Spitzbauch aschte sich in die Handfläche. »Oder spazieren. Joggen. Im Kino. Oder Zoo. Herrje.«
»Oder ohnmächtig?«
»Schon kapiert. Ich hole jemanden von der Feuerwehr. Die sollen die Tür aufbrechen.«
Er setzte sich in Bewegung. Vermutlich auch, weil er seine Kippe loswerden musste. Cora fragte sich, ob es nicht einfacher wäre, einen Generalschlüssel zu besorgen. Es musste einen Hausmeister geben, und dieser dürfte so wie alle anderen Hausbewohner am selben Ort anzutreffen sein, um die Entschärfung abzuwarten. Doch die Zeit lief ihnen davon. Jede Minute Verzug bedeutete einen immensen Aufwand für alle Beteiligten. Bis zum Mittag wollte der Kampfmittelräumdienst die Bombe entschärft haben. Nach der Evakuierung würde man entscheiden, wie das Ganze vonstattengehen sollte. Ob man die Bombe wie geplant in eine Wassertiefe von sechs Metern ziehen würde. Unter der Alten Brücke hindurch. Ob die Fliegerbombe einst für sie bestimmt gewesen war? Tatsächlich war die Brücke trotz heftiger Bombardierungen weitgehend unbeschädigt geblieben. Erst Ende März 1945 hatten deutsche Soldaten das durch gezielte Sprengungen erledigt, wohl wissend, dass sie die Amerikaner damit nicht mehr würden aufhalten können. Einen Tag nach Palmsonntag.
Insgeheim erwartete niemand eine spektakuläre Detonation. Ein dumpfer Knall, eine Fontäne. Ein Geschenk für all jene, die mit ihren Smartphones am Rande der Schutzzone warteten und froren.
Cora ließ sich auf die Knie sinken, um unter dem Türspalt hindurchzusehen. Was ihr das bringen sollte, wusste sie nicht. Aber untätig herumstehen konnte sie nicht. Der Spalt war so schmal, dass nichts zu erkennen war.
»Hey! Bist du da?«
Galt das eher dem Hund oder galt das seinem Frauchen? Es spielte keine Rolle, denn eine Antwort blieb aus. Cora drückte den Kopf so weit nach unten wie möglich. Die Fliesen waren kalt an ihrer Wange. Wenn jemand sie so sehen würde … Im Treppenaufgang hallten Schritte. Cora wollte sich nach oben drücken, da stieg ihr ein schwerer Geruch in die Nase. Süßlich irgendwie und gleichzeitig erinnerte er an die Kanalisation.
»O Gott!«
Wie ein Pfeil schnellte sie zurück in die Senkrechte, Sterne tanzten vor ihren Augen, und ihr wurde schlecht.
»Wir müssen da ganz schnell rein«, sagte sie, als ihr Partner die Treppe heraufkam, begleitet von einem Feuerwehrmann, der eine Werkzeugtasche trug.
»Wieso? Hab ich was verpasst?«
»Ich glaube … dieser Gestank …«
Der Feuerwehrmann lachte spöttisch. »Kein Wunder, wenn da seit Tagen kein Fenster aufgeht und der Hund überall hinscheißt.« Er griff nach einem kleinen Werkzeug, vermutlich wollte er es zuerst mit sanften Mitteln versuchen.
»Brechen Sie die Tür auf!«, herrschte Cora ihn an und erschrak im selben Augenblick vor sich selbst. Ihre Stimme war ruhiger, aber bebte noch immer, als sie hinzufügte: »Für Experimente fehlt uns die Zeit.«
Kurz darauf knackte es, und fingerlange Holzsplitter lösten sich rings um den Metallknauf aus dem Rahmen. Die unsichtbare Duftwolke mit ihrem bittersüßen Aroma folgte sogleich.
Am Niddaufer zwischen der Unterführung der Ludwig-Landmann-Straße über Brentano- und Solmspark bis hin zur Bahnbrücke in Rödelheim konnte man leicht vergessen, dass man sich im pulsierenden Herzen Frankfurts befand. Von hier aus sah man weder Hochhäuser noch Verkehrschaos. Und wenn man nicht gerade nachts unterwegs war, konnte man sich hier auch sicher bewegen.
Mit einer gelassenen Sicherheit bewegten sich auch die Hände. Gepflegte, narbenfreie Haut, etwas blass vielleicht, und ebenso gepflegte Nägel. Das Schnitzmesser, das die schlanken Finger hielten, war frisch geschärft und gesäubert. Stück für Stück nahm es das Material ab; manchmal war es nur ein Span, der lautlos zu Boden fiel. Niemand interessierte sich für das Zusammenspiel der Hände. Ab und an hoben sich die Augen in Richtung Wasser. Radfahrer, Jogger, Mütter mit Kinderwagen und Großeltern mit ihren Enkeln. Sie alle zog es hierher ins Idyll. Für sie alle bot die Niddaroute eine Möglichkeit, ohne weit zu reisen, in die Natur einzutauchen. Doch jeder blieb für sich. Keiner interessierte sich für die Hände, die auf einer Bank einen kleinen Holzklotz zum Kunstwerk werden ließen.
»Die Skulptur ist schon darin, man muss sie nur von ihrem Drumherum befreien.«
So oder so ähnlich hatte der Kunstlehrer es gerne verkündet und im selben Atemzug behauptet, dass dieses Zitat von Michelangelo stamme.
Stein für Stein, Span für Span. Immer tiefer drang die Klinge in das Material, doch ihr Antlitz wollte sich noch nicht zeigen. Und plötzlich geschah es. Eine halbe Sekunde der Unachtsamkeit, ein Quäntchen zu viel Kraft, ein unterdrückter Schrei. Die Klinge fraß sich in die Haut des linken Daumens. Blut trat aus der Schnittwunde und verschmolz mit dem Werkstück. Verdammt.
Die Skulptur fiel zu Boden. Den Finger im Mund bückte sich die Person nach vorn, und die rechte Hand nahm das unvollendete Werkstück wieder auf. Schmatzend löste sich der Daumen aus den Lippen. Es blutete noch immer, aber nur schwach. Doch das Holz war ruiniert.
Eine leere Plastikflasche trieb in der Nidda vorbei, und um ein Haar – wäre da nicht in diesem Moment ein Gassigänger aufgetaucht – wäre das unvollendete Schnitzwerk ins Wasser geflogen.
Es sollte ja Blut tragen. Es würde.
Aber nicht das eigene.
Ein Jahr später
Die Herzen. Wie sehr sie ihr fehlten.
Mit quietschendem Zeigefinger auf den dunstüberzogenen Badezimmerspiegel gemalt. Sie verwandelten sich zu Tropfen oder wurden von neuem Beschlag überdeckt. Und trotzdem blieb etwas zurück, so lange jedenfalls, bis man den Spiegel abwischte.
Kleine Gesten, die im Alltag viel zu oft untergingen. Er hatte an ihnen festgehalten. All die Jahre. Manchmal hatte sie es als kindisch abgetan, aber insgeheim frohlockte ihr Herz, und es streichelte die Seele. Besonders an Tagen, an denen die Welt ihr die kalte Schulter zeigte.
Kleine Rituale, die eine Beziehung über die Jahre und Jahrzehnte trugen. Eine Gratwanderung zwischen langweiliger Wiederholung und romantischen Gefühlen, die er mit Leichtigkeit meisterte. Und erst kürzlich war es in einer Talkrunde im Abendprogramm genau um dieses Thema gegangen:
Was ist das Erfolgsrezept von langen Beziehungen?
Die kleinen Dinge, da war man sich einig. Zumindest waren sie ein wichtiger Teil des großen Ganzen.
Zuerst starben diese Gesten, dann starb der Rest. Ein Tod auf Raten. So drastisch hatte sich der Experte (oder war es eine Expertin gewesen?) in der Talkrunde sicher nicht ausgedrückt, aber das Ergebnis war dasselbe.
Leere. Einsamkeit.
Ein emotionaler Lockdown.
Julia Durant hatte den Spiegel seit Wochen nicht mehr gewischt. Manchmal, im leichten Dunst der feuchtwarmen Luft, zeichneten sich Überbleibsel ab. Überschneidende Bogen, wo einmal seine Fingerkuppe über das Glas gefahren war. Verblassende Reste, so wie Höhlenmalereien, die vom Sonnenlicht und der Atemluft ihrer Besucher gefressen werden.
Claus Hochgräbe malte ihr keine Herzen mehr, und sie hatte auch nicht die Macht, das zu ändern.
Sie war hier.
Er nicht.
Lockdown.
Donnerstag
Manchmal geschehen Dinge, bei denen man sich fragt, wie man es dazu hat kommen lassen können. Vermeintliche Zufälle, die man im Nachhinein analysiert und die mit einem einfachen »Hätte ich bloß« völlig anders abgelaufen wären. Bei Julia Durant war es die Mischung aus alten Gewohnheiten und einem unerwarteten Impuls gewesen. Tomatensuppe und die Türklingel. Sie hatte auf dem Sofa gesessen und eben erst damit begonnen, aus einer Müslischale zu löffeln. Dann ertönte der elektronische Gong. Sie zuckte zusammen und sah auf die Uhr. Die Post. Leckte den Löffel ab und legte ihn auf den Couchtisch. Warum sie die Schale nicht ebenfalls abstellte, konnte sie sich hinterher nicht mehr erklären. In wenigen Schritten erreichte sie den Flur. Die Augen bereits auf den Türöffner gerichtet, nahm sie die Kurve zu eng. Stieß sich die Schulter und geriet ins Schlingern. Sofort dachte sie an die Suppe, vermutlich auch deshalb, weil sie ihr heiß über den Daumen schwappte, den sie in die kleine Schüssel geklappt hatte. Erschrocken wollte sie gegensteuern, während sie selbst noch nicht ausbalanciert war. Das Unvermeidliche nahm seinen Lauf. Ein dumpfer Laut, als das Porzellan auf dem Teppichläufer aufkam und sich eine rote Flut wie Lava über das Gewebe ergoss.
»Scheiße!«
Um ein Haar hätte sie den Türöffner vergessen, doch dann läutete es ein zweites Mal. Vermutlich waren es die beiden Sommerblusen, die sie im Internet bestellt hatte. Durant drückte auf den Knopf, und im Erdgeschoss knackte die Haustür. Schwere Schritte polterten die Treppe herauf, während sie die Bescherung betrachtete, die auf dem orientalischen Muster angerichtet war. Immerhin das Schälchen war heil geblieben. Ein Mitbringsel aus Südfrankreich, sie hatte es gemeinsam mit Claus in einem winzigen Laden in der Camargue gekauft. Es war das Letzte seiner Art, denn das Geschirr war unerwartet anfällig, besonders in der Spülmaschine, auch wenn die Verkäuferin es anders angepriesen hatte. Doch um den Teppich war es wohl geschehen, wenn nicht schnelle Hilfe kam.
Es klopfte zweimal an der Wohnungstür. Dann rief es: »Steht alles da. Schönen Tag noch!«
»Danke ebenso!«, antwortete Durant und lauschte den Schritten, die ihren Weg treppabwärts nahmen. Kontaktlose Zustellung, dachte sie in einem Anflug von Schwermut. Was man nicht alles für Routinen entwickelt. Die explodierende Zunahme von Onlinebestellungen setzte sämtliche Zustellfirmen auch ohne dieses bescheuerte Virus unter einen Druck, den man sonst höchstens von Weihnachten kannte. Aber dann sollte das Ganze auch noch möglichst ohne persönlichen Kontakt stattfinden. Effizient, keine Frage. Spätestens bei einem Einschreiben oder wenn eine Identifizierung des Empfängers vonnöten war, stieß diese Praxis aber an ihre Grenzen. Und wie sah es in all den anderen Bereichen des Lebens aus?
Solche Gedanken kannte sie nur allzu gut von ihrer Tätigkeit. Wie sollte sie einen Verdächtigen befragen, der eine Maske trug, unter der sie weder das Beben der Nasenflügel noch die zuckenden Mundwinkel erkennen konnte? Woran erkannte sie, wenn ihm eine Frage unangenehm war oder wenn er eine Lüge auftischte? Wie gut, dass der Sommer eine gewisse Entspannung in das Ganze gebracht hatte.
Sie schob die Gedanken beiseite, um sich dem Teppich zu widmen. Er war zwei Meter lang und mindestens sechzig Zentimeter breit. Nicht unbedingt der Stil, den sie ausgewählt hätte, aber sie hing an ihm, denn er stammte von Susanne Tomlin, der Vorbesitzerin dieser Eigentumswohnung und Julias engster Freundin. Seit diese ihren Lebensmittelpunkt an die Côte d’Azur verlagert hatte, gehörte die Wohnung der Kommissarin. Den Teppich hatte sie behalten und wollte daran auch in Zukunft nichts ändern. Statt sich also um ihre Post zu kümmern, eilte sie zurück zum Couchtisch, wo neben dem Esslöffel ihr Smartphone lag.
Was hilft gegen Tomatenflecken
Das Internet hatte sofort eine Antwort parat: Essig oder Essigessenz.
Aber galt das auch für alte Teppiche? Für diesen Teppich? Sie wusste nicht einmal, aus welchem Material er bestand. Wolle vermutlich. Aber von welchem Tier?
Längst war ein Gedankensturm entfacht, der immer wieder auch die Gesichter von Susanne und von Claus beinhaltete. Und die Erinnerung daran, dass sie hier und jetzt alleine dastand und sich hoffnungslos überfordert fühlte. Wegen einer bescheuerten Müslischale voller Tomatensuppe, die sie einfach nur auf diesem verdammten Couchtisch hätte stehen lassen sollen!
Sie tippte gerade den Begriff »Teppichreinigung« in die Suchmaske, da veränderte sich der Bildschirm. Claus Hochgräbe – nein: um genau zu sein, war es sein Anschluss im Büro. Dort saß nun Doris Seidel als Kommissariatsleitung. Jene hochintelligente, analytisch denkende Kollegin, auf die Julia künftig bei ihren Ermittlungen verzichten musste. Doch der Chefsessel hatte besetzt werden müssen, und es gab für diesen Job niemand Besseren als Doris. Julia sagte sich, dass sie den Telefoneintrag dringend ändern müsse.
»Hi, Julia«, meldete sich die Chefin. »Es gibt was zu tun.«
»M-hm.« Julia versuchte, alles andere abzuschütteln und sich zu konzentrieren, doch es gelang ihr nur teilweise. »Ich bin ganz Ohr.«
»Du klingst irgendwie … zerknirscht. Ist alles okay bei dir?«
»Frag besser nicht.« Julia sah sich vor dem geistigen Auge noch einmal in Richtung Flur stolpern und die Tomatensuppe verschütten. Die Szene hatte etwas ungewollt Komisches, sie musste schmunzeln. »Ich hatte hier gerade ein Malheur«, erklärte sie. »Tomatensuppe und Perserteppich.«
»Verstehe. Dann bringe ich dich am besten mal direkt auf andere Gedanken, hm?«
Die Kommissarin wusste es im Grunde schon. Wenn ein Anruf von der Mordkommission kam, ging es in der Regel um etwas Dienstliches. Und das war nicht weniger als der gewaltsame Tod eines Menschen.
»Wie gesagt«, wiederholte sie, »ich bin ganz Ohr.«
»Es gab heute Nacht einen Brand«, berichtete Seidel und nannte den Stadtteil und die Straße. »Im Zuge der Löscharbeiten hat man eine Leiche gefunden.«
»Ein Brandopfer? Also reden wir von Brandstiftung?«
»Nein. Das Opfer war schon vor dem Feuer tot. Ihm wurde der Schädel eingeschlagen.«
Durant schluckte. »Eingeschlagen, also mit Vorsatz. Nicht von einem herunterfallenden Balken oder Ähnlichem?«
»Das Feuer war relativ schnell gelöscht«, erklärte Doris, »es gab also keine Einstürze. Das Opfer befand sich außerdem in einem Raum, in dem es überhaupt nicht gebrannt hat. Hatte ich schon gesagt, dass dort eigentlich gar niemand wohnt?«
Durant wurde hellhörig. »Leer stehend?«
Sie fuhr im Geiste am Frankfurter Messegelände vorbei. Bockenheim, Gallus, das Europaviertel. Gab es dort so etwas wie Leerstand überhaupt? Andererseits hatte sich das Antlitz der Stadt gerade dort, wo früher einmal gigantische Bahnanlagen gelegen hatten, in den vergangenen Jahren rapide verändert. Sie musste sich eingestehen, dass sie sich im Frankfurt westlich der Festhalle nur noch schwer zurechtfand. Das galt ebenso für den Bereich am Riedberg, wo Doris Seidel und Peter Kullmer sich niedergelassen hatten. Eine völlig neue Siedlung mit Straßennamen, von denen man kaum eine der namensgebenden Personen auf Anhieb kannte.
Seidel räusperte sich: »Ich wollte dich bitten, dir vor Ort selbst ein Bild zu machen. Du kannst direkt hinfahren. Die Spurensicherung ist bereits informiert und sollte schon da sein.«
»In Ordnung. Was ist mit Frank?«
»Frank ist anderweitig unterwegs, Peter leider auch.« Seidel druckste. »Ich könnte dir höchstens Uwe schicken.«
Uwe Liebig. Die Kommissarin schloss für einige Sekunden die Augen und atmete durch die Nase. Wenn es jemals einen Kollegen gegeben hatte, auf den der Begriff »schwarzes Schaf« wie die Faust aufs Auge passte, dann war es Liebig. Er war aus Offenbach zum Team gestoßen (das alleine mochte manchen Frankfurter Kollegen ja schon genügen), tauchte fast jeden Tag mit Essensflecken auf der Kleidung auf und schien in seinem Minivan zu leben. Mit akribischer Polizeiarbeit nahm er es nicht so genau, auch wenn seine Erfolge für sich sprachen. Doch man hatte stets das Gefühl, seine Urgewalt kontrollieren und die Grenzen im Auge behalten zu müssen. Dazu kam, dass Liebigs Humor ebenso schnoddrig war wie sein Auftreten. Alles in allem kein Typ, mit dem Julia sich privat anfreunden würde. Andererseits war er einer von ihnen, und er hatte ein traumatisches Schicksal erlitten, wie nur wenige Kollegen es kannten. Vor einigen Jahren war Liebigs Tochter unter die Räder eines flüchtenden Fahrzeugs geraten. Sie wurde mitgeschleift und so schwer verletzt, dass sie wenig später starb. Liebigs Familie war zerstört, seine Ehe zerbrach, er ließ sich gehen. Einzig die Jagd auf den Flüchtigen hielt ihn am Leben – und bei der Kriminalpolizei. Nach einer Ermittlung im Bandenmilieu, wo er sich (auch aufgrund der Suche nach dem Todesfahrer) besser auskannte als irgendjemand sonst, war er zum K11 in Frankfurt gewechselt.
Die Kommissarin schüttelte den Kopf, auch wenn Doris das nicht sehen konnte. »Ich versuch’s erst mal alleine. Ist jemand von der Rechtsmedizin vor Ort?«
»Fehlanzeige. Der Notarzt hat alles Notwendige erledigt und dokumentiert.«
Durant verkrampfte sich. Das war nicht unüblich, aber sie hatte etwas anderes im Kopf. »Ich würde gerne Andrea Sievers dazurufen«, schlug sie vor. »Dann bin ich erstens nicht alleine, und zweitens kann sie sich ein unverfälschtes Bild machen. Ein eingeschlagener Schädel klingt nach heftigen Emotionen.«
»Oder nach einem besonders kaltblütigen Mörder«, ergänzte Seidel.
»Möglich. Jedenfalls spricht beides dafür, dass wir uns den Tatort sehr genau ansehen.«
Das galt zwar für alle Tatorte, doch die neue Kommissariatsleiterin brachte keine Einwände vor. Dafür kannten sich die beiden Frauen schon viel zu lange. Beide wussten, wann es angebracht war, auf das Bauchgefühl zu vertrauen – sei es nun das eigene oder das der anderen.
Sie hatte es noch immer nicht geschafft, ein neues Auto zu kaufen. Immer grätschte ihr etwas dazwischen. Der Job. Das Privatleben. Und dann auch noch ein Lockdown. So positiv es in vielen Bereichen für sie lief, Julia Durant hatte in den vergangenen Monaten eine Menge durchgemacht. Doch genau genommen hatte es Claus Hochgräbe, ihren frischgebackenen Ehemann, noch viel härter getroffen. Binnen weniger Monate hatte er von der Existenz einer Tochter erfahren und diese dann direkt wieder verloren. Ausgelöscht durch einen nicht mehr heilbaren Krebs und doch für immer ein Teil seines Lebens. Denn Lynel, ihr vierjähriger Sohn, war geblieben, um diese Erinnerung lebendig zu halten. Jemand musste sich fortan um ihn kümmern. Und wenn Claus das sein sollte, der einzige leibliche Verwandte, der noch greifbar war, dann betraf das zwangsläufig auch Julia selbst.
Im Dienstwagen roch es nach kaltem Rauch, ein Pappbecher mit einem Rest Cola steckte im Getränkehalter. Uwe Liebig, kam es der Kommissarin sogleich in den Sinn. Er ernährte sich vorwiegend von Fast Food, zumindest konnte man den Eindruck gewinnen. Aber wenn sie ehrlich war, konnte es auch von jedem anderen Kollegen stammen. Das Rauchverbot jedenfalls interessierte fast niemanden. Nachdem Durant Fahrersitz und Lenkrad eingestellt hatte, verließ sie den Innenhof des Präsidiums und steuerte den rauchgrauen Kombi kurz darauf auf den Bordstein vor ihrem Wohnhaus in der Nähe des Holzhausenparks. Sie öffnete die Heckklappe, holte den bereits zusammengerollten Teppich, den sie im Flur des Erdgeschosses deponiert hatte, und fuhr ihn in die nächstgelegene Reinigung. Danach schaltete sie das Radio ein und suchte einen Sender, der Rockmusik spielte. Bald schon trommelten ihre Finger im Takt zu den Rolling Stones aufs Lenkrad, und sie steuerte den Wagen über die Friedberger Landstraße in Richtung Konstabler Wache.
Andrea Sievers war sofort ans Telefon gegangen, als hätte sie auf den Anruf gewartet. Das geschah häufiger, und manchmal fragte sich Julia, wie sie das handhabte, wenn sie in voller Montur an einer geöffneten Leiche hantierte. Dr. Sievers leitete das rechtsmedizinische Institut. Eine Meisterin ihres Fachs und eine enge Vertraute der Kommissarin. Wenn es etwas zu finden gab, war sie es, die es fand, wenn alle anderen es übersahen. Und obwohl sie täglich dem Tod ins Antlitz blickte, versprühte sie stets einen gewissen Humor, wenn auch manchmal recht schwarz gefärbt. Eine innere Leichtigkeit, um die Julia Durant sie insgeheim beneidete.
Als der Dienstwagen den Main überquert hatte und das erhabene Sandsteingebäude in der Kennedyallee erreichte, in dem sich die Rechtsmedizin befand, wartete Andrea bereits in der Sonne. Sie war im Begriff, sich eine Zigarette anzuzünden. Sie unterbrach ihre Handlung und bückte sich stattdessen, um den Lederkoffer aufzunehmen, der neben ihr auf dem Boden stand. Ein in die Jahre gekommenes Modell mit abgestoßenen Kanten, doch sie würde sich vermutlich erst davon trennen, wenn sie in den Ruhestand ging. Und der war noch lange nicht in Sicht. Andrea öffnete zuerst die hintere Tür, schob den Koffer auf die Rückbank und ließ sich anschließend auf den Beifahrersitz plumpsen.
»Gehört das ab jetzt zum Service?«, flachste sie mit einem Grinsen.
»Vergiss es.« Julia lachte. »Ich hole dich erst wieder ab, wenn ich ein eigenes Auto habe. Aber dann sicher nicht dienstlich.«
»Klingt verlockend.« Andreas Blick fiel auf ein halbes Dutzend eingeschweißter FFP2-Masken, die in die Mittelkonsole gequetscht waren. Sie deutete darauf. »Wie machen wir es?«
»Ich hab eigentlich keine Lust drauf«, gestand Julia. »Außerdem habe ich seit drei Tagen kaum einen Menschen gesehen.«
»Geht mir ähnlich.« Andrea zwinkerte vielsagend. »Jedenfalls keine lebendigen. Außerdem steckt mein Gesicht ohnehin ständig hinter einer Maske. Nachher am Tatort müssen wir ja auch wieder, also lass uns die Fenster aufmachen und die frische Luft genießen.«
Julia lächelte und setzte den Wagen in Bewegung. Wie schön, dass sie sich einig waren. Immerhin war Andrea Ärztin. Wenn sie die Sache entspannt sah, dann konnte sie das doch ebenso. Der Sommer hatte einen deutlichen Rückgang der Inzidenzen gebracht. Überall kehrte das Leben zurück, die Sehnsucht nach Normalität griff um sich, und man konnte trotzdem vorsichtig bleiben. Hygiene, ein wenig Umsicht, es war ja nicht so, dass die Kommissarin sich nicht vor einer Corona-Infektion fürchtete. Sie war zwar körperlich relativ fit, aber eben keine dreißig mehr, und sie hatte ihr Leben lang stark geraucht. Ein wenig mehr Gemüse und weniger Salamibrot versuchte sie in ihren Alltag zu integrieren, aber wenn Claus nicht da war, verfiel sie gerne in ihre alten Muster. Sie gehörte also nicht zu einer Hochrisikogruppe, aber vermutlich auch nicht zu jenen, die einen Infekt mit einem Päckchen Tempo und einem Serienmarathon überstehen würden.
Hinter dem Messegelände hatte sich ein völlig neuer Stadtteil entwickelt. Jedenfalls empfand Julia Durant das so. Neue Reihenhäuser, Hotels, Supermärkte und Kneipen waren entstanden. Dahinter die vertrauten verwinkelten Straßenzüge. Alt und neu in Einklang. Längst hielt Andrea Sievers ihr Smartphone mit der Navigation in den Händen, um sie durch das Labyrinth der Häuserfassaden zu leiten, von denen alle ein wenig anders waren, aber in ihren Augen nahezu gleich aussahen. Es waren die Einsatzfahrzeuge, die zum Erfolg führten. Ein Auto der Feuerwehr, vermutlich zur Brandwache, sowie der Transporter der Spurensicherung. Außerdem ein Streifenwagen. Hinter den benachbarten Fenstern war wenig Bewegung zu erkennen. Passanten sahen sie keine, vermutlich, weil es keinen Durchgangsverkehr gab. Wer hierherkam, wohnte hier oder hatte ein bestimmtes Ziel.
Die Kommissarin musste ein ganzes Stück weiterfahren, um eine Parklücke zu ergattern. Dann stiegen die beiden Frauen aus, Andrea nahm ihren Koffer von der Rückbank, und sie gingen zum Haus zurück. Es war nun eindeutig zu erkennen. Schwarze Schatten über zwei Erdgeschossfenstern, verursacht durch herauslodernde Flammen. Doch das Feuer war nicht bis zum Dach gekommen, genau, wie Doris es gesagt hatte. Ein Wohnungsbrand. Konnte es Zufall sein, dass es ausgerechnet dort brannte, wo eine erschlagene Leiche lag?
Eine junge Polizeibeamtin in Uniform begrüßte Durant und führte sie nach einem Blick auf den Dienstausweis zu Platzeck, dem Leiter der Forensiker.
»Ah, da seid ihr ja endlich«, murmelte er. Schweiß trat unter der Kapuze seines Flatteranzugs hervor, und er schnaufte. »Es wird Zeit, dass der Tote hier rauskommt. Na ja, ihr kennt das Prozedere ja.«
»Klaro«, antwortete Sievers. »Wo können wir uns umziehen?«
»Am besten im oberen Flur. Hier unten ist zwar mehr Platz, aber überall Ruß und Löschmittel. Davon möchte ich nichts im ersten Stock sehen.«
»Die Leiche liegt in der oberen Wohnung«, konstatierte Durant, »und die ist vom Feuer unberührt geblieben?«
»Kann man so sagen. Die Feuerwehr musste, soweit ich weiß, nur rein, weil die Flammen hier unten an die Decke geschlagen haben. Hätte ja sein können, dass da irgendwas in Mitleidenschaft gezogen wurde.«
»Verstehe. Ich wollte nur sichergehen. Ohne das Feuer also kein Leichenfund. Aber wenn das Feuer nach oben gelangt wäre, wäre die Leiche verbrannt. Hmm. Weiß man schon etwas über die Brandursache?«
»Da fragst du den Falschen. Aber bitte … können wir uns erst mal um den Verblichenen kümmern?«
Platzeck deutete ein Tippen auf seine Nasenspitze an.
Die Schutzanzüge knisterten, als die beiden Frauen ihm durch die Wohnungstür folgten. Der süßliche Leichengeruch war sofort wahrzunehmen, wobei der saure Geschmack, den das gelöschte Feuer hinterlassen hatte, das meiste überdeckte. Die Gesichtsmaske mochte vieles fernhalten, gegen solche Reize war sie machtlos. Durant sah sich um. Als Erstes fielen ihr die Möbel auf. Gebraucht, aber nicht verwohnt. Zeitloses Design in Grau und Weiß. Glatte Oberflächen. Für ihren Geschmack wirkte alles sehr steril.
Ihr fiel etwas ein. »Ich dachte, die Wohnung sei unbewohnt.«
»Die im Erdgeschoss«, korrigierte Platzeck. »Hier oben wohnt laut Klingelschild eine Kirsten Riemann.«
»Nur sie allein?«, hakte Durant nach.
Hinter einer der Masken lachte es spöttisch. »Allein ist gut.«
Noch bevor Julia Durant den verräterischen Gegenstand, der hinter einer Kommode hervorlugte, als Katzentoilette identifizierte, richtete sich ein Mann in Schutzkleidung auf. Er ächzte und verdrehte die Augen, dann deutete er auf die Plastikwanne: »Mit vier Katzen wohnt man wohl kaum allein.«
Sievers kicherte. »Da fragt man sich, ob sie die Katzen hatte, weil sie Single war, oder ob es nicht eher andersherum ist.«
Durant musste grinsen, dann drängte sich eine wichtigere Frage auf: »Die Rede war aber von einem männlichen Toten. Oder stimmt das auch nicht?«
»Doch, doch. Männlich, Mitte dreißig«, bestätigte Platzeck und richtete den Zeigefinger auf einen Türrahmen. »Liegt in der Küche auf dem Boden. Und ich möchte jetzt wirklich darauf drängen, dass wir ihn untersuchen. Der Rest kann warten.«
Durant wollte einen Schritt machen, hielt dann aber inne. »Moment. Was ist mit den Katzen?«
Sie hatte es nie geschafft, sich an ein Haustier zu binden, und vielleicht war sie auch mehr ein Hundetyp. Das hatte sie noch nicht herausgefunden, und in absehbarer Zeit würde sich da auch nichts dran ändern. Nicht mit Lynel, dachte sie unwillkürlich, und ein Schauer überlief sie. Der Gedanke, was mit dem vierjährigen Enkel von Claus geschehen würde, übermannte sie. Wie immer, wenn das geschah, kämpfte sie diese Sorge nieder. Nicht hier. Nicht jetzt, mahnte sie sich im Stillen. Doch irgendwann würde sie die Gedanken zu Ende denken müssen.
»Im Bad«, erklärte Platzeck, und seine Stimme klang grimmig. »Zwei von ihnen hockten sowieso dort, unters Regal gekauert. Die dritte war apathisch und ließ sich einfach hintragen. Über die vierte, na ja, reden wir nicht davon.«
Er trat durch die Küchentür, und Julia und Andrea folgten ihm. Aus den Augenwinkeln bemerkte die Kommissarin, wie sich der Kollege an den Unterarm griff. Dann wechselte das Bild wie ein Sprung ins kalte Wasser. Es war nicht wie im Fernsehen, wenn ein Toter aufgefunden wurde. Zuerst ein Paar Schuhe, dann spannende Musik, und dann lugte irgendwo ein Körperteil ins Bild. Das Erste, was sie sah, war eine geplatzte Schädeldecke und die Gehirnmasse, die zwischen den verklebten Haaren hervorquoll. Das getrocknete Blut auf dem zweifarbigen Karoboden und die Spritzer auf den Türen der Küchenzeile sowie der Arbeitsplatte ließen darauf schließen, dass der Mann in diesem Raum gestorben war.
»Scheiße«, sagte Andrea fast tonlos, verharrte einen Augenblick und stieg dann an dem Leichnam vorbei. Sie stellte den Lederkoffer ab, ging auf alle viere und betrachtete den Mann eingehend. Er war lässig gekleidet. Ein T-Shirt mit dem Logo von »Rock am Ring«, Hawaii-Shorts und Slipper. Ein Schuh war vom Fuß gerutscht und lag etwa einen Meter entfernt. Ansonsten waren weder Kampfspuren noch andere Verletzungen zu erkennen. Ein unangenehmer Geruch drang in Julias Nase. Bevor sie etwas sagen konnte, hörte sie Andrea fragen: »Darf ich ihn bewegen?«
Platzeck nickte. »Ich verschwinde dann mal wieder.«
Die Rechtsmedizinerin wartete einige Sekunden, bis er den Raum verlassen hatte. Dann wisperte sie: »Weichei.«
»Hat er …«, begann die Kommissarin und zeigte auf die Hose des Toten. Der Geruch nach Fäkalien beantwortete die Frage im Grunde von selbst.
Sievers hob die Schultern. »Das tun wir wohl alle, wenn’s so weit ist. Armer Kerl. Ist ein ganz Hübscher, findest du nicht?«
Durant rollte mit den Augen. »Darüber möchte ich mir im Moment keine Gedanken machen.«
»Wie du meinst.« Sievers schob das T-Shirt nach oben und betrachtete den Brustkorb. »Keine Hämatome, keine Abschürfungen. Auf den ersten Blick würde ich sagen, er hatte einen schnellen Tod.« Sie krabbelte in Richtung Kopf und leuchtete mit einer kleinen Taschenlampe auf die zerschmetterte Stelle. »Zwei, drei kräftige Schläge. Beim ersten ging das Licht aus, der Rest ist im Grunde Beiwerk.«
»Also wollte der Mörder auf Nummer sicher gehen«, dachte Durant laut, »oder er war sehr emotional. Wut, Hass, Abscheu. Spricht das eher für eine geplante Tat oder einen Affekt?«
Sievers wippte mit dem Kopf. »Das überlasse ich dir.«
»Was ist mit dem Todeszeitpunkt?«
»Mehr als vierundzwanzig, weniger als achtundvierzig Stunden«, antwortete Sievers, und Durant fragte nicht weiter. Sie hatte es schon zu oft gehört. Totenstarre, Totenflecke. Die Rechtsmedizinerin wusste, was sie tat. Nach der Obduktion würde sie den Zeitraum vermutlich enger eingrenzen können. Auch hierüber mussten sie nicht reden.
Die Kommissarin rechnete nach. »Also entweder gestern Vormittag oder Dienstagnachmittag. Das heißt aber doch, dass das Feuer und der Mord in keiner Verbindung zueinander stehen.«
»Wer weiß, was der Täter vorhatte. Das kann mir unser toter Freund hier leider nicht beantworten.«
Durant dachte weiter. »Vielleicht ist er auch zurückgekommen. Aus Panik. Aber warum hat er dann unten Feuer gelegt und nicht gleich hier?«
»Die Katzen?« Sievers zuckte mit den Achseln.
»Wenn jemand einen Menschen derart brutal erschlägt, dürften ihm ein paar Tiere wohl egal sein«, erwiderte Durant. »Apropos schlagen: Hat es ihn von hinten oder frontal getroffen?«
»Gute Frage. Je nach Körpergröße, Armlänge und Tatwerkzeug ginge theoretisch erst mal beides. Die Wunde ist allerdings am Hinterkopf, und der Typ ist sicher eins achtzig groß. Um ihn so zu treffen, muss der Täter eher hinter ihm gestanden haben, und er dürfte entweder gleich groß sein, oder das Opfer hat gesessen. Oder gekniet.«
»Knien schließe ich aus«, sagte Durant. »Wer kniet sich denn freiwillig hin, wenn sein Mörder mit – womit eigentlich? – hinter ihm steht?«
Platzeck steckte den Kopf in die Küche. »Sitzen scheidet allerdings auch aus! Die beiden Stühle stehen ordentlich am Tisch. Keine Blutspritzer. Und es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass der Täter hier aufgeräumt oder etwas abgewischt hat.«
»Hm.« Die Kommissarin wollte sich ins Gesicht greifen, aber unterdrückte den Impuls noch rechtzeitig. Unter der Kleidung wurde es unangenehm warm, außerdem juckte es an der Nase. »Bleibt die Frage nach der Waffe. Habt ihr etwas in die Richtung gefunden?«
Platzeck verneinte.
»Baseballschläger?« Durant dachte laut. »Oder Eisenstange?«
»Eher Variante zwei«, antwortete Sievers. »Die Wunde ist ziemlich tief. Dafür ist ein Baseballschläger zu dick.«
Julia Durant kam ein Gedanke, ein flüchtiges Bild, das ihr aus einem der zahlreichen Serienabende nachhing, die sie alleine auf dem Sofa verbracht hatte.
»Frag mich nicht, warum«, sagte sie mit einem Zwinkern, »aber ich musste gerade an einen Eispickel denken. Zu viel Fernsehen, ich weiß. So etwas hat heutzutage ja keiner mehr, außer Bergsteigern, und die sind sicher zurzeit alle in den Alpen. Außerdem trägt man so was nicht mit sich herum, jedenfalls nicht, ohne aufzufallen.« Sie stutzte. »Aber warte mal. Was ist mit einem Brecheisen? Das ist lang genug, um kräftig Schwung zu holen, und die Spitze dringt tief ein.«
»Warum so kompliziert?«, erwiderte die Rechtsmedizinerin und stemmte sich nach oben. »Ein stinknormaler Hammer kann das auch. Und es wäre nicht zum ersten Mal, dass das hier passiert.«
Durant schluckte hart. »Moment mal, was meinst du damit?«
Sievers schniefte unter ihrer Maske. »Vorletzten Winter, also 2018 müsste das gewesen sein. Ein Obdachloser in der Nähe des Mainufers. Ich erinnere mich nur deshalb, weil man nicht alle Tage mit zerplatzten Schädeln zu tun hat.« Sie machte eine vielsagende Pause. »Selbst ich nicht.«
Julia Durant schwieg.
Während die Rechtsmedizinerin in der Küche ihr gewohntes Prozedere abspulte, versuchte die Kommissarin sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Wer hatte den Toten gefunden? Wer hatte die Kriminalpolizei verständigt? Das musste nicht zwangsläufig dieselbe Person sein. Gab es Zeugen? Hatte man die Bewohnerin schon benachrichtigt … und was passierte mit den vier Katzen?
Die Informationslage war so dünn wie der Filterkaffee von Claus. Immer wieder musste Julia an ihn denken, auch wenn sie im Moment keine Ablenkung gebrauchen konnte. Sie stand mit einer Polizistin vor dem Haus, diese mochte halb so alt sein wie sie selbst. Etwa gleich groß, dunkelblondes Haar, Pferdeschwanz. Wenig Taille, dafür sehr weibliche Rundungen. Wachsame Augen und eine spitze Nase. In den Fingern hielt sie eine Zigarette, an der sie unregelmäßig zog und den Rauch sofort wieder herauspaffte.
»Eigentlich rauche ich nicht«, gestand die Frau und rieb sich den Nacken. Sie hatte sich als Cora Danner vorgestellt. Ursprünglich beim achten Revier in Sachsenhausen, aber nun beim dreizehnten, das für Bockenheim und für Teile des Westends und vom Gallus zuständig war.
»Haben Sie den Toten als Erste gesehen?«
Danner wich ihrem Blick zunächst aus, kurz darauf nickte sie. »Ich möchte nicht gleich als Weichei abgestempelt werden, aber das war echt eine harte Nummer.«
Durant nickte ebenfalls und antwortete mit warmer Stimme: »Das hat nichts mit Weichei zu tun. Es ist eine krasse Szene, und wem das nicht nahegeht, dem fehlt es eindeutig an Empathie. Mag sein, dass ich schon Schlimmeres gesehen habe. Aber es ist immer wieder ein heftiges Drama, das sich rund um die Tat abgespielt hat. Da ist es egal, ob man schon ein Dutzend Tote gesehen hat oder zum ersten Mal über einen stolpert.«
Danner schnaubte, und ihre Stimme überschlug sich beinahe, als sie erwiderte: »Es war nicht mein erstes Mal!«
»Ach so?«
»Ich habe heute nur überhaupt nicht damit gerechnet. Genau wie damals. Und dann liegt er einfach so da …«
»Damals«, wiederholte die Kommissarin in der Hoffnung, dass die junge Frau sie aufklärte.
»Na ja, letztes Jahr. Als das mit der Fliegerbombe war.«
»Welche Fliegerbombe denn genau?«, fragte Durant lakonisch. »Wir haben doch irgendwie alle paar Wochen mit diesen Dingern zu tun.« Jedenfalls fühlte es sich manchmal so an. Überall dort, wo man die ersten Nachkriegsbauten gegen höhere Gebäude mit tieferem Bodenaushub ersetzte, war der Kampfmittelräumdienst Dauergast. Wenn Straßen erneuert oder neue Quartiere erschlossen wurden. Das Ausmaß des Bombenteppichs, der in fünfundsiebzig Luftangriffen über die Stadt gelegt worden war, war kaum zu erfassen. Die Hälfte aller Wohnungen sowie die gesamte öffentliche Infrastruktur und alle namhaften Kulturdenkmäler der Stadt waren dem Feuersturm zum Opfer gefallen. Und dabei drängte sich heute der Verdacht auf, dass alles noch viel schlimmer hätte kommen können, wenn unter den Bomben nicht derart viele Blindgänger gewesen wären. Ein Hinweis auf Sabotage? Sie schüttelte den Gedanken ab und musterte ihr Gegenüber.
Cora Danner warf ihre Zigarette auf den Bordstein und trat sie aus. »Ich rede von der Unterwassersprengung an der Alten Brücke. Wir haben im Zuge der Evakuierung eine tote Frau gefunden. Die Wohnung war verrammelt, aber der Hund war noch drinnen. Tagelang hat er keinen Mucks von sich gegeben, außer leisem Winseln. Von den Nachbarn hat keiner was gemerkt.«
Durant horchte auf. Eine tote Frau mit Haustier. Urlaub. Sie kramte in ihren Erinnerungen, doch da war nichts. Außerdem war es hier ein Mann, der in einer fremden Wohnung lag. Und vor einem Jahr ein Hund, heute Katzen.
»Was war denn damals die Todesursache?«, wollte sie wissen. Von einer Mordermittlung jedenfalls hatte sie nichts mitbekommen.
Danner kniff die Augen zusammen, es schien, als wolle sie sich vor allzu lebhaften Erinnerungsbildern schützen. »Alkohol und Tabletten, außerdem hatte sie sich die Pulsadern aufgeschnitten. Sie lag vor dem Sofa, vielleicht ist sie runtergerutscht.« Sie machte eine Pause. »Aber für meinen Geschmack wurde das Ganze sehr oberflächlich behandelt und viel zu rasch als Selbstmord abgetan. Diese Bilder und dieser Gestank …« Sie wischte mit beiden Händen durch die Luft. »Klar, da wollte keiner von uns länger drinnen sein als unbedingt notwendig. Deshalb trage ich ja auch Uniform statt Bluse. Mir sind die Lebenden lieber als die Toten.«
»Mir auch.« Durant lächelte. »Jedenfalls die meisten. Aber was genau schien Ihnen an diesem Fall so verdächtig?«
Die junge Kollegin seufzte erleichtert, offenbar, weil sie endlich jemanden gefunden hatte, der ihr Gehör schenkte. »Nichts Konkretes. Aber Sie sehen ja, ich habe den Fall noch immer parat, als wäre es gestern gewesen. Und es bedeutet mir viel, dass Sie dieses, hm, Bauchgefühl ernst nehmen. Danke schön. Darf ich Ihnen von dem Fall erzählen? Schauen Sie sich die Sache vielleicht selbst mal an?«
Julia wollte instinktiv die Hand heben, um das Ganze abzuwehren, entschied sich dann aber doch anders. »Ich kann Ihnen da keine Versprechungen machen. Nicht am Tatort eines Mordfalls, der erst einmal oberste Priorität hat. Aber ich höre Ihnen gerne zu, vor allem, weil wir ja ohnehin schon darüber geredet haben.« Sie zwinkerte Cora zu. »Jetzt will ich auch noch den Rest hören.«
Die Polizistin lächelte warm. »Danke. Ich fasse mich auch kurz, das heißt, ich versuche es. Also, wie gesagt, die ganze Wohnung hat gestunken, das war richtig übel. Mein Kollege ist direkt rausgerannt, und ich musste mich übergeben. Aber natürlich haben wir das Ganze untersucht, und bis heute sind es vor allem zwei Aspekte, die mir zu denken geben: erstens die Sache mit dem Selbstmord. Da waren jede Menge Pillen im Spiel. Schlafmittel, Beruhigungsmittel. Also mehr, als man in einem normalen Haushalt findet.«
»Okay.« Durant neigte den Kopf. »Aber das spricht ja eigentlich für einen Selbstmord. Dazu die aufgeschnittenen Pulsadern. Als wollte sie auf Nummer sicher gehen.«
»Das ist ihr definitiv gelungen«, entgegnete Cora Danner düster. Sie tippte sich aufs linke Handgelenk. »Ein Schnitt mit der Rasierklinge. Das Komische daran ist aber, wie sie es gemacht hat, quer, nicht längs. Wenn man sicher sein will, macht man es doch anders? So ist es eigentlich mehr ein Ritzen, nicht unbedingt eine ernsthafte, lebensbedrohliche Verletzung.«
Julia Durant zuckte mit den Schultern. »Wer weiß, ob sie in dem Moment so klar denken konnte, dass sie das bedacht hat.«
»Dann stellt sich für mich allerdings noch eine Frage«, setzte Danner nach. »Macht man das, wenn man mit seinem Haustier alleine ist? Ich kenne mich da nicht so aus, aber möchte man sein Tier nicht wenigstens versorgt wissen, bevor man abtritt?«
»Guter Punkt, aber das sind alles nur Überlegungen, keine wirklichen Indizien.«
In dem Moment hörte Durant, wie jemand ihren Vornamen rief. Sie drehte den Kopf, im ersten Stock war ein Fenster geöffnet, und darin stand Andrea Sievers. »Kommst du noch mal hoch?«
Julia streckte den Daumen nach oben und wandte sich noch einmal Cora zu. »Tja. Jetzt müssen wir leider abbrechen, und ich darf mir den Tatort ein zweites Mal ansehen. Und glauben Sie mir: Darauf könnte ich gut verzichten!«
Auf dem Weg nach oben ging sie noch einmal die Fakten durch, die sie in Erfahrung gebracht hatte. Keine Zeugen. Die Feuerwehr erhielt einen Alarm, und im Zuge der Löschaktion hatte einer der Kameraden sich Zutritt zur Wohnung verschafft und nach dem Fund der Leiche die Polizei verständigt. Da es sich offensichtlich um eine Gewalttat handelte, kam sofort die Kriminalpolizei ins Spiel. Und es blieb damit ihre Aufgabe, sich um die Kontaktaufnahme zu der hier gemeldeten Katzenbesitzerin zu kümmern.
Und irgendjemand würde sich um die Katzen kümmern müssen …
Andrea Sievers war mit den »Gnadenlosen« mitgefahren, etwas, das sie sonst nie tat. Jene Männer mit ihrem dunklen Transporter, die immer dann auftauchten, wenn sich ein Gewaltverbrechen ereignet hatte. Wer ihnen diesen Namen verpasst hatte, wusste keiner mehr so genau. Aber jeder wusste, wer gemeint war. Sie hatten den Toten in einen Zinksarg gebettet und zum Wagen getragen. Hinter den Fenstern der Nachbarhäuser tauchten Gesichter auf. Manche mit anteilnehmender Miene, andere neugierig. Die beiden trugen dunkle Anzüge, Stangenware, und wechselten kaum ein Wort. Was hätten sie auch sagen sollen?
Die Leiche kam direkt ins rechtsmedizinische Institut, wo Dr. Sievers sich nun mit ihr befasste. So zumindest hatte sie es der Kommissarin versprochen.
Julia Durant saß zwischenzeitlich im Büro von Doris Seidel. Einen Kaffee hatte sie abgelehnt. Noch immer bildete sie sich ein, den eisernen Geschmack nach Blut in Mund und Nase zu haben. Dazu eine Mischung aus Katzenstreu und Verwesung. Doris saß in dem überdimensionierten Sessel, den Claus seinerseits von seinem Vorgänger Berger übernommen hatte. Ein orthopädisches Möbel, ausgelegt für Männer jenseits der eins achtzig und mit neunzig Kilogramm oder mehr. Doris war mit ihren eins fünfundsechzig kaum größer als Julia, und obwohl sie regelmäßig trainierte, wirkte sie eher zierlich. Der blonde Haarschopf schien fast verloren auf dem dunklen Leder.
»Von den Nachbarn sind bereits einige abgeklappert worden, aber das war nicht sehr ergiebig«, schloss Julia ihren Bericht. »Zumindest wissen wir ein paar grundlegende Details, zum Beispiel, wo die Eigentümerin Urlaub macht.«
»Ihr gehört die Wohnung also?«
»Ihr gehört das ganze Haus.«
»Wow.« Doris Seidel nickte, und in ihrer Stimme lag Ehrfurcht. Vor ein paar Jahren hatten sie und ihr Mann eine Eigentumswohnung auf dem Riedberg erworben und ein Vermögen dafür bezahlen müssen.
Durant musste lächeln. »Es ist kein riesiger Wohnkomplex, in der Straße stehen hauptsächlich Zweifamilienhäuser«, erklärte sie. »Älteres Baujahr. Wohnung oben, Wohnung unten. Quadratischer Grundriss und ein kleiner Garten. Die Besitzerin wohnt oben, und unten die Wohnung steht seit Längerem leer. Kein Kühlschrank, kein Herd, keine Elektrogeräte. Das wirft die Frage auf, was genau dort einen Brand verursacht hat.«
»Und ob man mit dem Feuer den Mord vertuschen wollte«, sagte Doris und nickte. »Wobei man das Feuer dann wohl besser in der oberen Wohnung gelegt hätte.«
»Bloß nicht!« Durant hob die Hand. »Da sitzen ja vier Katzen drin.«
»Gleich vier«, murmelte die Kommissariatsleiterin beeindruckt. »Wer soll die denn da rausholen, und wo bringen wir die Tiere unter? Die Tierheime sind voll, zumindest hört man das ständig. Das ist durch die ganzen Corona-Haustiere bestimmt nicht besser geworden.«
Durant hob die Schultern. Solche Fragen hatte sie sich bisher nicht stellen müssen. »Die Besitzerin heißt Kirsten Riemann, vierundvierzig Jahre alt. Arbeitet für eine Werbeagentur oder so was in der Art, aber momentan ist sie in der Bretagne unterwegs. Ich habe es zweimal bei ihr auf dem Handy versucht und ihr eine Nachricht hinterlassen.«
»Hm. Wenn sie im Urlaub ist, muss sich ja jemand um die Katzen gekümmert haben.«
»Das stimmt. Laut den Nachbarn …«
»Aber es ist nicht der Tote«, unterbrach Seidel sie. »Oder etwa doch?«
Durant zuckte mit den Achseln und wollte gerade etwas erwidern, als das Telefon sich meldete.
Seidel sah aufs Display und formte den Vornamen der Rechtsmedizinerin mit den Lippen. Dann griff sie zum Hörer.
»Hallo, Andrea. Ich schalte dich auf Lautsprecher, Julia sitzt hier.«
»Prima. Dann hast du eine angenehmere Gesellschaft als ich.«
»Was ist denn mit dem Toten nicht in Ordnung?«, frotzelte Doris.
»Na ja. Einerseits ist es ganz schön, wenn man einem Mann mal in den Kopf schauen kann. Aber er ist trotzdem nicht mein Typ.« Sie gluckste. »Zu blass und zu schweigsam.«
Julia rollte mit den Augen. »Gut. Jetzt, wo wir das geklärt haben …«
»… kommen wir zur Sache«, vervollständigte Andrea ihren Satz. »Es ist, wie ich’s vermutet habe. Die Verletzungen stimmen mit denen des Obdachlosen überein.«
»Welcher Obdachlose?«, wollte Doris wissen.
Davon hatte Julia ihr nicht berichtet, sie hatte lediglich das Brecheisen erwähnt.
»Es gab eine tödliche Attacke, schon etwas länger her«, erklärte Julia daher hastig.
»Genau«, sagte Andrea. »Und die Verletzungen von damals weisen eine große Ähnlichkeit mit denen auf, die wir heute gefunden haben.«
»Wir reden von Schlagverletzungen an der Schädeldecke«, sagte Doris und kniff die Augen zusammen. »Wie kannst du dir da so sicher sein?«
»Weil es nicht die typischen Verletzungen sind«, antwortete Andrea. »Baseballschläger, Eisenstangen, Steine – oder jeder beliebige andere schwere Gegenstand. Sie alle führen nicht zu derart tiefen Verletzungen wie hier. Es gab damals bei dem Obdachlosen ein paar Augenzeugenberichte, die recht schwammig waren. Ein Zeuge beharrte darauf, einen Typen mit einem Hammer gesehen zu haben.«
»Einem Hammer?« Durant überlief es kalt.
»Ja. Daran kann ich mich deshalb noch so gut erinnern, weil ich beurteilen sollte, ob ein Hammer zu den Tatverletzungen passen würde.«
»Was er wohl tat«, mutmaßte Julia Durant.
»Allerdings.«
Doris Seidel pustete Luft aus. »Und du siehst diese Verletzungsart auch bei dem Opfer von heute?«
»Ich sehe eine Wahrscheinlichkeit von siebzig, achtzig Prozent, dass es wieder ein Hammer oder zumindest etwas sehr Ähnliches war.«
»Hmm.«
Eine Männerstimme ließ die beiden Frauen zusammenfahren.
Uwe Liebig schob sich durch die Tür. Wie lange er schon mitgehört hatte, wusste niemand.
»Ein Hammermörder. Das ist heftig.«
»Wer ist da?«, tönte es blechern aus dem Lautsprecher.
»Uwe hier, Gude«, rief dieser und winkte, auch wenn Andrea das nicht sehen konnte. Wie meistens trug er ein T-Shirt mit ausgeleiertem Kragen. Es war eine Nummer größer, damit es nicht zu sehr über dem Bauch spannte. Die Jeans war an den Oberschenkeln ausgeblichen und abgenutzt. Am grellsten jedoch stach sein Hawaiihemd in die Augen. Manche Trends aus den Achtzigern wären am besten auch dort verblieben. Julia musste schmunzeln. Wenigstens einer der drei Frauen blieb dieser Anblick vorerst erspart. Diese Frau erwiderte Uwes Gruß und räusperte sich. »Das wollte ich euch nur schon mal wissen lassen. Für den Fall, dass sich doch so etwas wie ein Tatwerkzeug findet. Oder dass es im Haus einen Werkzeugkasten gibt, in dem man mal checken könnte, ob der Hammer fehlt.«
»Viel Spaß mit der Presse«, kommentierte Uwe, der sich ungefragt hinter den Monitor der Chefin gestellt hatte, auf dem unter anderem die Tatortfotos zu sehen waren.
Doris verabschiedete sich von Andrea und fragte dann: »Wieso Presse?«
»Na, weil sich sämtliche Medien wie die Aasgeier darauf stürzen werden.«
Julia Durant dämmerte etwas. Es hatte in der Stadtgeschichte ein paar Morde gegeben, die man nicht so schnell vergaß. Berühmte Mörder, so wie Arthur Gatter. Berühmte Opfer. Ihr kam Rosemarie Nitribitt in den Sinn. Eine Prostituierte, die in den höchsten Kreisen verkehrt hatte, und vermutlich aus diesen Reihen stammte auch ihr Mörder. Sie war 1957