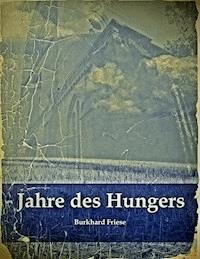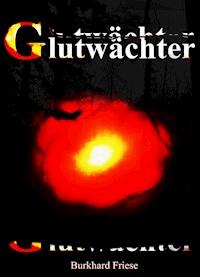
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Dorf in Mecklenburg. Ein Moor. Ein Haus. Der Zweite Weltkrieg. Die Wiedervereinigung. Nationalsozialismus. Fremdenhass. Neonazis. Eigentlich wollten Stefan und Tanja nur ein Haus kaufen. Im mecklenburgischen Krähenstein, einem verschlafenen Dreihundert-Seelendorf. Was daraus werden würde, und welche Fäden dort zusammenlaufen, war nicht absehbar. Eine Geschichte, wie sie das Leben schreibt. Dunkel, grausam, berührend. Eines haben alle Geschichten gemein. Das Moor vergisst keine von ihnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Burkhard Friese
Glutwächter
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Kapitel 1
Hans
Kurt
Elisabeth
Peter
Maria
Murat
Stefan
Tanja
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Epilog
Quellennachweis & Copyright
Impressum neobooks
Prolog
Glutwächter
Roman
Mein Dank gehört Jana, für die unermüdliche Kritik, für die Hilfe bei den Korrekturen und für die Unterstützung bei den nicht immer einfachen Überarbeitungen.
Er gilt auch den Lesern meiner Geschichten und deren Neugier, sowie der Ermunterung zum Beenden dieses Romanes. Alle Zeiten, Figuren, Orte und Handlungen sind frei erfunden.
Ich war lange hier! Noch bevor es die Menschen gab. Lange bevor sie versuchten, mich zu kultivieren und zu erobern. Ich wurde verehrt, geheiligt und entweiht. Ich kann Leben schenken und auch Leben nehmen. Ich wurde angebetet und zum Teufel gejagt. Opfer wurden mir dargebracht und Geheimnisse in mir versteckt. Ich war ein Ort des Anfangs und ein Ort des Endes. Was nie wieder auftauchen sollte, wurde mir anvertraut. Mit Gewalt wurden mir Geheimnisse entrissen; die Meisten aber konnte ich bewahren.
Ich bin die Welt in der Welt und bewahre für die Menschen Neugier und die Fähigkeit sich zu wundern. Doch der hat sich im Laufe der Jahrhunderte an mich gewöhnt. Sie haben den Respekt vor mir verloren, und doch bin ich der Ort von Furcht und ängstlichen Träumen. Die Menschen ahnen es, doch ich weiß es. Immer näher rücken die Menschen mir. Doch wirklich erfassen können sie mich nie. Ich bin der Bewahrer von Mythen, Geheimnissen und Schätzen. Ich erzähle die wahren Geschichten.
Es ist an der Zeit die Ohren zu spitzen und sich umzusehen. Zeit für neue Geschichten.
Kapitel 1
Nur der Vollmond konnte als verschwommene Scheibe den feuchten Nebel durchdringen.
Hinter dem Nebel war alles, im Nebel war nichts, unter dem Nebel war ich. Jedes Geräusch wurde rasch verschluckt.
Ein Schwarm Enten schreckte lautstark hoch und schlug wild mit den Flügeln auf meine ölige Oberfläche. Jede Farbe verblasste. Die Glocke vom entfernten Gutshof schlug dreimal auf alter Bronze. Büsche quälten sich aus meinem Leib und zeigten sich schamhaft.
Stefan schalt sich einen Narren. Hinter ihm war nichts. Der feuchtkühle Nebel drang in seine Lungen und lockte Husten aus seinem Hals. Eine Ahnung von alten Pappeln hing im Dunst. Stefan widerstand dem Bedürfnis, seinen Kopf zu wenden.
Der Boden schmatze gierig bei jedem seiner Schritte. Tief in ihm steckten seine Stiefel.
Hinter dem Nebel war alles, im Nebel war nichts, unter dem Nebel war ich.
Es knackte im Unterholz. Stefan zuckte. Wind schlich aus Osten heran. Vielleicht der Vorbote eines Sturmes, der den Nebel und alles, was in ihm war, mit sich reißen würde. Schon verfing er sich im Knick. Stefan musste sich beeilen.
Noch klebte der Nebel auf der fauligen, halbgefrorenen Oberfläche. Gefangen war er im Tal. Verfangen zwischen den Ästen im lichtschluckenden Wald.
Stefans Lungen stemmten sich gegen das nasse Tuch. Das dämmrige Licht des Mondes ließ den Nebel von innen herausleuchten. Eine Katze schrie. Dann wieder dichter werdende Stille. Stefan konnte nur schwerlich dem Impuls widerstehen, sich in den Umbau hinter der Fahrerkabine zu legen, die Standheizung anzumachen, etwas Musik zu hören und sich zur Seite zu drehen. Er war müde und angespannt. Selbst das Rascheln seiner Jacke war ihm zu laut. Er zog sie aus und ließ sie auf die morastige Haut zu seinen Füßen sinken. Seine Finger tasteten sich am Aufbau des Transporters zum Anhänger nach hinten. Die farblosen Umrisse des Minibaggers ahnten seinen Blick. Stefan kniff die Augen zusammen. „Merde!“, fluchte er, als er sich die Hand an einer scharfkantigen Ecke der Ladeklappe riss. Er fluchte immer auf Französisch. Es drückte alles aus, aber klang nicht so hart wie das deutsche Pendant. Stefan schaute sich um. Seine Jacke verschmolz mit der matschigen Fläche. Er löste die linke Verriegelung der Ladeklappe, langsam, viel zu laut. Dann löste er die rechte. Metall schlug gegen Metall. „Zut alors!“ Stefan zuckte zusammen und riss den Kopf herum. Wieder die schreiende Katze. Kein Licht, kein weiteres Geräusch. Stefan zog die beiden Auffahrrampen aus Aluminium von der Ladefläche und drückte sie in die Verankerungen über der Klappe. Dabei schaute er sich ständig um und versuchte die Wand aus Nebel und greifenden Ästen zu durchdringen. Die nasse Luft lockte erneut den Husten. Stefan ging zurück zur Fahrerkabine. Wieder trat er auf seine Jacke und drückte sie tiefer in den morastigen Untergrund. „Oh flûte!“ Stefan lachte. Es brach aus ihm heraus, unbändig laut. „Nun mal leise“, kicherte er und zog sich in die Fahrerkabine seines VW LT. Seine Finger zitterten am Knopf der Standheizung. Er stierte durch die Windschutzscheibe in den Nebel. Zweimal wischte er das Kondenswasser von der Scheibe, bis das Gebläse endlich das Fenster frei und die Kabine warmhielt. Stefan griff nach rechts auf den Beifahrersitz zum Thermobecher. Er wusste, dass er leer war. Dennoch setzte er den Becher fordernd an seine Lippen. Jeder Tropfen Espresso half ihm, sich zu konzentrieren. Die letzten Tropfen folgten nur widerwillig seinem Schlürfen.
„Ich könnte mir einen in der Kabine machen“, dachte er. Ein tiefhängender kahler Weidenast klopfte an das Kabinendach. Stefan wusste, dass es Zeit wurde, und nahm das Klopfen als Startsignal. Er setzte sich seine blaue Wollmütze auf und zog sie über die Ohren tief ins Gesicht und weit in den Nacken. Dann schlüpfte er in die verdreckte Arbeitsjacke und stellte den Kragen auf. Diesmal schlug er die Tür ins Schloss. Der Nebel schluckte jedes Geräusch und gab es nur zögerlich wieder frei. Es gab keinen Grund still zu sein. Stefan drückte seinen Kopf zwischen die Schultern und rollte ihn von links nach rechts. Sein Nacken schmerzte. Er roch den fauligen Matsch an seiner Jacke. Die wenigen Schritte am VW LT vorbei rutschte Stefan nach hinten. Dabei wühlte er in seinen Taschen nach dem Schlüssel für den Kubota Minibagger.
Mit einem Ruck öffnete Stefan dessen Kabinentür. In seinem Kopf kreisten die Anweisungen des Vermieters. Er hoffte, den Bagger ohne abzurutschen von der Rampe zu bekommen. Dabei lachte er kurz auf, welch tolles Bild: Ein Minibagger auf der Seite und er darin eingeklemmt.
Stefan dachte an seine Mutter, die wenige hundert Meter weiter im Haus saß. „Ich muss mich konzentrieren“, flüsterte er in die Kabine.
Sein Blick schweifte über Hebel und Anzeigen. Bei kalter Witterung den Motor vorglühen und zehn Minuten warmlaufen lassen, fiel ihm ein. Stefans Hand zitterte, als er den Schlüssel in das Zündschloss steckte. Die Vorglühanzeige leuchtete kurz und erlosch wieder. Stefan drehte den Schlüssel ganz herum. Der Motor stotterte erst und lief dann unruhig an. „Ich verzichte auf das Warmlaufen“, murmelte er, legte die Hände um die Lenkhebel, öffnete sie wieder und ballte sie um die Hebelköpfe herum zu Fäusten. Stefan zog beide Lenkhebel nach hinten. Der Anhänger wackelte. Die Raupen quietschten. Der Bagger rumpelte rückwärts.
„Merde, Merde!“ fluchte Stefan die Lenkhebel an, als der Bagger auf die Rampen schwankte. Kurz ließ er den rechten Hebel los. Die linke Kette drehte weiter. Stefan zog den rechten Hebel wieder nach hinten und merkte, wie der Bagger schräg wegrutschte. „Nicht loslassen!“ befahl er seinen Händen. Langsam richtete sich der Bagger aus, rollte von der Rampe und blieb stehen. Die Kabine war beschlagen. Stefans Stirn war nass. Er holte zweimal tief Luft und drehte den Bagger auf der Stelle, indem er den linken Lenkhebel nach hinten und den rechten nach vorne schob. Die Raupen fraßen sich schmatzend durch den matschigen Untergrund. Dann rollte er vorwärts.
Ich empfinde keine Schmerzen; ich habe keine Gefühle.
Stefan hatte die Kabinentür geöffnet. Es roch faulig. Blätter und Gräser westen. Es stank nach sterbender Erde, es stank nach Leben.
Nach einigen Metern blieb Stefan stehen. Der Nebel verweigerte dem Scheinwerferlicht die Sicht.
Der Nebel ist mein Freund. Genau wie die Nacht die Verbündete der Liebenden und der Bösen ist; und das seit Jahrtausenden.
Stefan schüttelte seinen Kopf. Erst jetzt erkannte er die Unsinnigkeit seiner Suche. Er wagte sich kaum tiefer ins Moor und wusste nicht, wo er anfangen sollte.
Ich könnte es ihm sagen, ihm den Weg weisen. Ich habe mich nie eingemischt.
Der Wind blies stärker und lockte den Nebel ihm zu folgen. Stefan rollte zu der Stelle, an der er Tage zuvor die Lichter gesehen hatte. Von dort ließ sich der Hügel erahnen, auf dem er gelegen hatte.
Er seufzte schwer, griff beide Steuerhebel und begann zu graben. Überall hieb er die Schaufel in den sumpfigen Leib und riss große Fetzen aus ihm heraus. Wasser, Pflanzen und Erde spritzen auf und ergossen sich von der Schaufel zurück in die frisch gerissenen Wunden. Bereitwillig nahm der Sumpf sie wieder auf und bildete eine Einheit, die gefällig war. Allmählich gab sich der Boden der gefräßigen Schaufel hin. Bei jeder Bewegung des Auslegers stöhnte Stefan, als müsste er selbst einen Spaten in die Erde treiben. Er rollte mit dem Bagger vor und zurück, drehte sich, fuhr tiefer ins Moor. Die Narben im Untergrund blieben zurück. Wasser füllte sie, wie Blut den Riss in Stefans linker Hand.
Noch dauerte es, bis der Morgen die Nacht von ihrer Wacht ablösen konnte. Aber er würde kommen und die Nacht erlösen, wie der Wind den Nebel aus seiner Starre befreite. Stefan hieb die Schaufel erneut in die Erde und traf auf etwas Hartes. „Eine Wurzel?!“ Ein weiterer Hieb, dann setzte er den Bagger ein Stück vor und schwenkte den Ausleger weiter aus. Vorsichtig zog er ihn zurück. Die Schaufelzinken kratzen über etwas, es quietschte metallend. Stefan stellte sich in die Hocke auf den Sitz und verharrte in der Kabine. Er starrte durch die beschlagene Scheibe. Dann rutschte er in den Sitz zurück. Minuten verstrichen, bis sich sein Atem und seine Seele beruhigten. Dann stieg er aus und ging zur Schaufel. Verwundete Erde, schwarz, nass. Es stank nach Kloake. Stefan hielt sich die Hand vor die Nase. Bei jedem Schritt sank er tief in den moorigen Grund. Seine Zehen spielten in den Stiefeln und er hielt sie beim Gehen am oberen Rand fest, um nicht stecken zu bleiben. Stefan versuchte das Dunkel zu durchdringen; erkennen konnte er nichts.
Er fuhr einen weiteren Meter nach vorne und stieß die Schaufel, so tief er konnte, in den Boden. Dann zog er sie an. Sie hing, nur ein leichter Widerstand, aber sie hing. Stefan ließ die Steuerhebel los.
Der derbe Ostwind schaute sich merklich um. Einzelne Birken waren zu erahnen. Hinten wuchs Tanjas Haus aus dem Dunst. Die bronzene Glocke klagte über dem langsam schwindenden Nebel. Stefan stellte den Motor ab. Eine beengende Stille nahm Besitz von der Luft um ihn herum. Sein Gesicht streckte sich dem Wind entgegen und jede Brise streichelte mit Eishänden den Schweißfilm von seiner glühenden Haut. Stefan seufzte tief in seinem Sitz.
Viel war passiert! Viel zu viel, seit er und Tanja das Haus mit dem riesigen Grundstück in Krähenstein gekauft hatten. „Es soll wohl ein Schatz im Thorsberg liegen“, sagte der Warder damals beim Verkauf und zeigte über das Moor, das zum Haus gehörte. „Aber es gibt ja immer Geschichten um Moore.“
Stefan haderte mit einer Böe. Sie trieb seine Gedanken über den Bodennebel hinweg durch das Tal, über die kahlen Baumwipfel und ließ die Bilder der letzten Wochen zurück.
Das Haus erinnerte Stefan sehr an das Haus seiner Oma.
Von der Straßenseite führten einige Stufen nach oben zur Haustür. Die linke Seite der unteren Stufen war von einer Mauer begrenzt. Bei schönem Wetter konnte man darauf sitzen und in der Morgensonne seinen Kaffee trinken. Auf der Rückseite kam man über eine Feldsteinterrasse zur Klöntür. Davor lümmelten ebenfalls drei Stufen. Von dort sah man über eine Wiese, in deren Mitte drei große Kirschbäume lebten. Eine Reihe Apfelbäume, am linken Rand der Wiese, grenzte das danebenliegende Stück Bauland ab. Hinter Wiese und Bauland lag das Moor.
Stefan stand während der Besichtigung vor dem Haus und erinnerte sich an seine Oma, wie sie auf ähnlichen Stufen mit Tante Traudl und seiner Mutter saß. So sitzend hatten sie Erbsen gepuhlt, Bohnen geschnippelt, Johannesbeeren gestrippelt oder Erdbeeren von ihren Blättern befreit.
Tanja lief aufgeregt um das Haus und sprühte vor Ideen. Spooki, ihr kleiner Havaneser, der stark an einen Gremlin erinnerte, stand auf dem Fahrersitz, machte sich lang und versuchte durch den geöffneten Spalt im Fenster möglichst viele Gerüche aufzunehmen.
Wenn man durch die Klöntür ins Haus trat, war linker Hand eine Wohnküche. Rechts die Werkstatt und dahinter die Waschküche. In der Waschküche standen ein alter verruster Badeofen und eine Zinkwanne. Den Badeofen musste man mit Holz anheizen, wenn man im warmen Wasser liegen wollte. Ging man durch die Wohnküche, kam man gerade durch in eine Stube und von dort nach rechts in ein Schlafzimmer. Zur rechten Hand der Wohnküche lag ein weiteres Zimmer. Hinten links, vor der eigentlichen Haustür, führte eine Treppe nach oben. In der Diele, direkt rechts neben der Klöntür, lag unter einer Bodenklappe eine hohl ausgetretene Holztreppe, die in den halben Kriechkeller führte. Auf der einen Seite lagen Eierkohlen, Holz und Kohlebriketts und auf der anderen lagerten Kartoffeln, Eingemachtes und Äpfel auf einem Holzrost. Es roch feucht nach Kohle, Kartoffeln und überreifen Äpfeln. Im Keller gab es nur eine Leuchte. Die musste man in Höhe der obersten Stufe mit einem Drehschalter einschalten. Das diffuse Licht verbreitete mehr Schatten und Unbehagen, als es die Kirche tat, in der sie als Kinder Messdienst leisteten. Ihre Oma war immer stolz und saß in der ersten Reihe.
Ging man die steile Treppe in der Diele nach oben, kam man rechts in ein großes und links ein kleines Schlafzimmer, dahinter war unausgebauter Bodenraum. Von dort ging es durch eine Luke auf einen staubigtrockenen Spitzboden.
Stefan erinnerte sich an seine Oma und wie sie bei jedem Gewitter und jeder Sirene auf der Kellertreppe kauerte. Oma saß in ihrer Kittelschürze da, auf dem Schoß hielt sie eine grüne verbeulte Metallkiste, in der sie die wichtigsten Papiere und Schmuck aufbewahrte. Stefans Mutter saß daneben, er auf ihrem Schoß. In der Zeit, in der Stefan aufwuchs, gab es regelmäßig Probealarme von den Dächern der Häuser in der Nachbarschaft. Die Rhythmen der Sirenen waren unterschiedlich. Die Auswirkungen immer gleich: Oma auf der Kellertreppe.
Oma weinte jedes Mal, wie auch seine Mutter. Und jedes Mal, wenn es gewitterte, erinnerte Stefan sich daran. Er ahnte den Grund hinter den Tränen, aber verstanden hatte er es nie.
Der Warder stand mit breit aufgestellten Beinen vor Stefan. Seine Arme hielt er hinter dem Rücken verschränkt, während Tanja ihn mit technischen Fragen bombardierte. Stefan hatte keine Lust mehr, sich weiter umzusehen. Er fühlte sich unwohl und heimisch zugleich. Tanja wollte unbedingt ein Angebot abgeben. Stefan hatte nur die Bilder aus dem Internet auf sich wirken lassen und versuchte den jetzt aufkeimenden Smaltalk zu ignorieren.
„Sie kommen also aus Kiel; haben Sie gut hergefunden? Krähenstein ist ja nicht einfach zu finden.“
„Doch, das ging ganz gut“, sagte Tanja.
„Zum Haus gehört auch der Thorsberg, das Moor dort unten“, erklärte der Warder weiter. „Die Gegend ist wirklich sehr schön. Haben Sie schon vom Moor gehört?“ wollte er wissen und drehte sich auf der Kellertreppe um.
„Nein, wir sind fremd hier.“ Tanja lächelte.
„Ich könnte Ihnen noch so viel erzählen, auch von den Vorbesitzern, Hans und seinem Sohn! Ich bin hier quasi groß geworden. Aber das können wir ja mal nachholen, wenn Sie an dem Haus wirklich interessiert sind.“ sagte der Warder weiter. Stefan sah die Enttäuschung in Tanjas Gesicht. „Ja gern, ich will alles wissen.“ Tanja hoffte noch mehr zu erfahren, doch der Warder drehte sich weg.
„Warum wollen Sie es wieder verkaufen? Sie haben noch nicht einmal die Renovierung beendet.“ wollte Tanja wissen.
„Ich habe meine Gründe! Sind Sie schon im Moor gewesen? Und schauen Sie mal, der Ofen hier, der ist fast neu! Sommer und Winter sind immer die besten Zeiten, um Moore zu begehen“, lenkte Warder ab.
„Das habe ich mir gedacht“, log Tanja.
„Kennen Sie die Geschichte?“
„Was für eine Geschichte?“
„Während des Dritten Reiches sollen die Einwohner von Krähenstein und aus dem Umland ihr Hab und Gut vor den Nazis im Thorsberg versenkt haben. Ein richtiger Schatz soll da liegen! Von irgendwelchen Kisten ist die Rede.“
„Oh, das klingt spannend. Hat schon jemand danach gegraben?“
„Soviel ich weiß schon. Wenn Sie selbst dort graben wollen, ich kenne den Besitzer vom Kieswerk. Der hilft bestimmt mit einem Bagger aus.“ Warder blinzelte: „Und ich helfe natürlich auch gern!“
„Naja, erstmal kaufen, dann renovieren und einziehen. Vielleicht irgendwann mal.“
„Es ist nur eine Geschichte, die man sich über das Moor erzählt. Während der Besatzung hat die Stasi im Moor gegraben, erzählt man sich. Die haben tagelang gesucht aber nichts gefunden. Sie wissen ja, wie das mit Geschichten und Gerüchten ist. Die gibt es überall.“
„Ja, da haben Sie recht. Kommen sie aus Krähenstein?“
„Nein, aber mein Opa. Hatte ich das nicht erwähnt?“
„Nein, hatten Sie nicht.“ Tanja holte tief Luft und stellte eine drückende Frage: „Wie sieht es mit dem Preis aus?“
„Da gibt es nichts zu verhandeln. Das ist ein Festpreis. Ich will schnell verkaufen, deshalb ist es schon so günstig. Und die wichtigsten Arbeiten sind auch erledigt. Entweder wollen Sie es, oder sie lassen es!“ Die Stimme vom Warder wurde bestimmter.
Stefan war in Gedanken im Thorsberg.
Bei mir, um mir meine Geheimnisse zu entreißen.
„Gut, dann habe wir alles gesehen“, Stefan drehte sich um, „danke für Ihre Zeit. Falls wir noch Fragen haben, werden wir uns melden.“
„Ja gern, aber machen Sie schnell. Es gibt noch mehr Interessenten.“
Natürlich gab es keine Fragen, dachte sich Stefan. Tanja hatte sich längst entschieden. Und nun stand er mit einem Bagger im Moor.
Ich wartete, war gespannt und spürte die Unsicherheit von Stefan. Er war nahe, vielleicht zu nahe. Er war der Erste seit Jahren, der kam, um mir etwas zu entlocken.
Stefan holte noch einmal Luft. Die Ketten fraßen sich tiefer ins Moor. Er hielt inne und nahm die Hände von den Lenkhebeln. Seine Gedanken glitten mit dem Wind durch den Nebel, zu dem Haus, zu Hans.
Hans
Hans klagte nie.
Das Kindbettfieber raubte ihm die Frau. Sein Junge blieb. Haus und Grundstück nährten ihn und seinen Sohn Jürgen. Hans hatte nichts gelernt, doch er konnte alles etwas. So schaffte er es immer wieder, ein wenig Geld für das Nötigste zu raffen. Sie kamen über die Runden. Mehr erwartete Hans nicht vom Leben. Essen, Trinken, Wärme. Und wenn Gott es zuließ, vielleicht noch Schnaps und Tabak. Von Zeit zu Zeit ging er in den Thorsberg, stach Torf und sammelte Holz für den Winter, ging auf die Jagd oder pflückte Beeren. Der Thorsberg war gut zu ihm und mehr brauchte er nicht.
Zu seinen Nachbarn hatte Hans kaum Kontakt. Das lag nicht daran, dass er nicht beliebt war, sondern daran, dass Hans nach dem Tod seiner Frau die Ruhe seiner Räume suchte. Anfangs ging er in den Dorfkrug und trank mit den Bauern aus der Umgebung. Dort bediente auch die etwas jüngere Elisabeth, die in die Bäckerei eingeheiratet hatte. Hans und Elisabeth kannten sich von Kindesbeinen an. Sie spielten und wuchsen gemeinsam auf. Noch bevor Achselhaare das andere Geschlecht locken konnte, schliefen sie zusammen im Stroh oder saßen im Sommer gemeinsam in einem Holzbottich voll mit kaltem Regenwasser.
Hans lächelte still.
„Wenn du dein Hemd ausziehst, ziehe ich meins auch aus“, hatte er Elisabeth am Rande eines Roggenfeldes einmal vorgeschlagen. Sie waren unzertrennlich, so auch auf dieser Schnitzeljagd. Sie versteckten sich in einer Schneise, die der Wind ins Korn geschlagen hatte.
„Aber ich will mein Hemd nicht ausziehen“, sagte Elisabeth bestimmt. „Schade!“ Hans drehte sich beleidigt zur Seite.
„Hans, Hans, ist alles gut?“ fragte Elisabeth.
„Jaja, ich dachte nur, wir wären Freunde“, sagte er leise.
„Das sind wir doch auch.“
„Na, also. Wenn du dein Hemd ausziehst, mache ich es auch.“ Hans glühte. Elisabeths Wangen wurden rot. Sie musste die Träger ihrer Schürze herunterklappen und hatte ihr Leibchen schnell über den Kopf gezogen.
„Jetzt du!“ Verlegen schaute sie auf ihre Füße.
Hans war schneller aus seinem Hemd als französische Seemänner in Singapur.
Minutenlang wagten sie nicht sich anzusehen.
„Nun wird mir aber kalt“, klagte Elisabeth leise.
Hans hörte die Enttäuschung in ihrer Stimme, und noch bevor sie ihr Leibchen wieder überstreifen konnte, linste er wie zufällig zur Seite. Er lugte auf die festen apfelförmigen Brüstchen, die stramm aufblühten. Er sah roten Flaum in den Achseln, die kecken Brustwarzen und den langen roten Zopf, der davor baumelte. Er schämte sich ob seines Blickes und seiner eigenen Brust. Er hatte mehr, und die hingen auch noch. Hans zog sein gräuliches Hemd über.
„Komm, lass uns gehen, die finden uns nicht“, sagte Elisabeth. Sie sprachen nie wieder darüber. Sie haben sich nie wieder so gesehen.
Hans war eingedöst und schreckte aus einem Traum hoch. Er stöhnte sich von der Bettkante und hielt sich an Wand und Türrahmen fest. Hans spürte klebrigen Schweiß auf seiner Stirn. Nicht von der Anstrengung. Nicht vom Schreck. Erinnerungen machen Schweiß klebrig. Er glaubte, etwas aus Richtung des Schuppens gehört zu haben. Es klang wie ein Husten. Hans ächzte sich einen Raum weiter, stöhnte auf und sackte in seinen Ohrensessel vor dem Ofen in der guten Stube. Er setzte die Flasche mit Selbstgebrannten an seine Lippen und der Inhalt brannte im Rachen. Drei Mal fand die betäubende Flüssigkeit ihren Weg. Die klebrigen Bilder der Erinnerung aber blieben. Hans seufzte und drückte seinen Kopf in den speckigen Nacken. Er döste wieder weg und sein Körper wurde von der Macht des Schlafes im Sessel gehalten. Er zuckte und schnell sickerten Erinnerungen wie ölige Tropfen in seinen Traum.
Hans wurde nach oben gerissen. Er spürte den Alkohol in seinem eigenen Atem und roch seinen alten Schweiß. Säuerlich, herb. Frischer floss dazu. Sein Kopf ruckte herum.
„Sind Sie Herr Haack? Hans Haack?“ fragte SS-Hauptmann von Harenburg. „Sie haben Ihren Sohn im Haus versteckt!?“
„Er ist mein einziger Junge!“ Hans war mit einem Schlag hellwach.
„Sie können damit unseren geliebten Führer ehren. Da Sie selbst so maßlos fett sind und keinen Dienst für ihr Heimatland leisten können, geben Sie uns Ihren Sohn.“
„Herr Hauptmann, bitte! Ich brauche ihn für die Feldarbeit und im Haus.“
„Wenn Sie in der Jugend mehr Sport getrieben hätten, könnten Sie ihrem Vaterland selbst dienen. So, wie der Führer es erwartet!“
„Erwartet der Führer, dass wir für ihn sterben?“
„Für Führer und Vaterland zu sterben, ist der ehrenvollste Tod, den wir erringen können.“
„Wieso den Tod erringen? Der ereilt uns sowieso. Dafür brauche ich nicht zu kämpfen.“
„Der Deutsche kennt nur Führer und Vaterland!“
„Das Vaterland soll uns erst leben lassen, bevor wir dafür sterben.“
„Das ist ...“ Hauptmann Harenburg lief rot an und griff nach seiner Walther.
„Den Tod erringen?“ spottete Hans. „Ist das ein Wettkampf? Den kann jeder gewinnen!“ Und als er in die Mündung der Pistole schaute, fragte er lachend: „Wie es aussieht, bin ich jetzt Sieger?!“
Gleichzeitig bäumte sich die Walther auf. Beißender Pulverdampf umschmeichlte das finstere Gesicht von Hauptmann Harenburg. Hans stolperte und verlor den Halt, als die Kugel in sein Muskelfleisch eindrang und im Oberschenkelknochen steckenblieb. Er brach unter der Last seines Körpers zusammen und stürzte zu Boden. Befreit von jeglichen Barrieren sprudelte das Blut lebenslustig auf die Feldsteine. Es dampfte leicht. Hans sah ungläubig lächelnd auf die zarten Wölkchen, dann kam der Schmerz. Er schrie und umfasste sein Bein; schwer und kalt.
„Sei froh, dass ich dich am Leben lasse, du fette Sau!“
Jürgen hatte den Schuss gehört und stolperte die Veranda nach oben. Atemreich und wortlos stürzte er sich auf seinen Vater, dann, in wilder Wut, auf Hauptmann Harenburg. Dreimal schlug Jürgen dem Hauptmann auf die Brust; die Orden klirrten. Es dauerte nur fünf Sekunden. Eine Ewigkeit für den Tod, zu kurz für das Leben, dann lag Jürgen im Blut seines Vaters. Der Sohn zuckte, strampelte, das halbe Gesicht war nicht mehr, sein letzter Atemzug bestand nur aus schaumigen Blutblasen. Hans zog sich durch beider Blut zu seinem Sohn.
„Ein Angriff auf einen SS-Offizier, darauf steht die Todesstrafe!“ schrie Hauptmann Harenburg den Soldaten entgegen, die aus dem Mannschaftswagen in die Diele stürmten. Dann spie er vor Hans auf den Boden. „Du dreckiger kommunistischer Judenfreund!“
Ein Soldat hob seine Mauser und richtete den Lauf auf Hans. Hauptmann Harenburg ersetzte die verschossenen Patronen in seiner Walther. Hans berührte den offenen Schädel seines Sohnes. Weißlich, blutig. Die Hoffnung eines jungen Lebens quellte aus Jürgen heraus, in die Hand seines Vaters. Nie hatte Jürgen die Hitze einer Frau geliebt. Schon wurde er kalt.
Hauptmann von Harenburg schob die Walther in das gefettete Halfter. Sie erzeugte ein sattes, leise quietschendes Geräusch. Dann hob er den Kopf und musterte Hans. „Wie ein Schwein vor seiner Schlachtung!“ lachte er. Die beiden Soldaten lachten mit. „Deine Judenfreunde fressen doch nur ausgeblutetes Getier“, lachte Harenburg weiter. Dabei legte er seine Hand auf den erhobenen Gewehrlauf des Soldaten neben ihm und drückte ihn hinunter. Hauptmann Harenburg ging zwei Schritte auf Hans zu und wäre beinahe ausgerutscht. Er hielt sich am Tisch fest und drückte seinen Stiefelabsatz in Hans' offenes Bein. Dunkles Blut quoll hervor.
Hans schrie auf. „Verblute, wie der Fraß deiner Judenfreunde.“ Dann drehte er sich um und verließ die Diele. Die beiden Soldaten gingen rückwärts. In der Tür drehten sie sich um und blickten nicht mehr zurück. Vor Hans drehte sich alles, er sah wie durch einen Nebel. Jürgen, die Diele, alles kreiste immer schneller und verschwommener. Wie im Wahn schaffte er es noch, den Gürtel aus seiner groben Cordhose zu ziehen. Hans schrie auf und band den Gürtel, das einzige Geschenk seines Vaters, fest um den Oberschenkel. Dann wurde es schwarz.
Als Hans die Augen öffnete, schüttelte er seinen Kopf und schloss sie wieder. Beim zweiten Mal sah er in das Gesicht von Elisabeth. Sein Blick wurde klarer. Dann kam der Schmerz. Hans zitterte, lag noch immer auf dem Feldsteinboden seiner Diele, doch sein Bein war jetzt verbunden. Hans sah, wie der Körper seines Jungen auf die Terrasse und dann um die Ecke gezogen wurde. Es blieb eine zähe dunkelrote Schleifspur. Robert Flisch und Herbert Hirsch drückten Hans zu Boden. Auf den Blutlachen lagen mehrere Laken und Leinensäcke, doch das Blut kämpfte sich durch alle Schichten ans Licht.
Robert stand links und Herbert rechts von ihm. Sie schafften es kaum, Hans zu bewegen. Sie stöhnten unter der lebenden Last, und Hans schrie und wimmerte in ihren Armen. Dann wurde es wieder schwarz.
Tage und Wochen dämmerten an Hans vorbei. Mit ihnen schlich sich der Herbst ins Moor. Der Winter blieb. Sein Bein heilte nicht. Die Kugel steckte noch immer in seinem Knochen. Hans hatte Fieber. Hatte er kein Fieber, fehlte ihm die Luft. Dann wieder Fieber.
Die Beerdigung seines Sohnes fand ohne ihn statt. In der elften Woche kämpfte Hans sich auf die Bettkante, in der zwölften rutschte er auf faltigen Hautlappen auf einen Stuhl. Beide ächzten nicht.
„Wo liegt mein Sohn?" Hans stotterte und drückte sich vom Stuhl auf die Bettkante. Seine Wunden brachen auf. An seinem Schenkel fühlte Hans den Rinnsaal aus Blut und Eiter. Bei jeder Bewegung im Schlaf wachte er auf. Gegen das Vergessen brach die Wunde immer wieder auf.
„Er liegt draußen, bei deinem Vater.“
„Aber“, unterbrach Hans, „dort darf niemand liegen. Das ist kein geweihter Boden!“
„Der neue Pastor, Pastor Banger, hat ihn geweiht. Er ist jung ...“, Elisabeths Stimme brach. Hans wischte sich eine Träne aus dem Gesicht.
„Hans, es wird schlimmer. Die Nazis nehmen alles. All unser Hab und Gut und wer nicht mitjubelt, der wird fortgebracht.“
„Fortgebracht?“
„Du weißt doch, was sie über Dachau und Auschwitz erzählen. Und wenn sie nicht dorthin gebracht werden, gehen sie direkt in den Osten. Keiner wagt den Mund aufzumachen.“ Elisabeth griff die Hand von Hans.
„Wir brechen morgen auf, wir fliehen. Dein Mann ...“
„Mein Mann ist tot. Im Osten erfroren. Du warst im Wundfieber.“
Hans legte seine freie Hand auf die von Elisabeth. „Er ist bei meinem Sohn. Sie beschützen einander und passen auf uns auf.“ Elisabeth wurde von Tränen geschüttelt. Hans horchte auf: „Still! Ich höre was.“
Über die Veranda dröhnten scharfe Schritte von schweren Ledersohlen näher. Die Tür wurde aufgestoßen.
Die Stiefel: blank poliert. Die Uniform: sauber und korrekt. Der Scheitel saß wie eingemeißelt. Hinter dem Unteroffizier erschienen zwei weitere Soldaten.
„Ach sieh an“, höhnte der Unteroffizier. „Ich habe schon gehört, dass sich der Judenfreund wieder bewegen kann. Aber fett ist er noch immer.“
Hans schaute auf den Boden.
„Na, willst' wohl immer noch nicht an die Front“, höhnte er weiter, „und hast dir auch gleich die geile Bäckerin kommen lassen. Der Herr Hauptmann hat uns alles erzählt.“
„Gar nichts hat er ...“
Der Unteroffizier schlug mit seiner Faust auf den Tisch. „Durchsucht das Haus! Hier sollen Juden versteckt sein!“
„Ich habe hier keine ...“ Der Unteroffizier schlug Hans ins Gesicht. „Seht euch nur diesen feisten Feigling an. Der hat sich durchs Fressen vor dem Dienst an unserem Führer gedrückt!“
Eine Handvoll Soldaten stürmte das Haus. Sie rissen Schränke um, traten das Bett zusammen und hebelten Dielenbretter aus dem Boden. Als alle Möbel zerbrochen, das Haus fast unbewohnbar war, hielt der Unteroffizier Hans eine Pistole unters Kinn: „Pass auf, Judenfreund. Solche wie dich kennen wir. Wir wissen, was wir machen müssen. Bewege dich einmal, bitte, nur einmal. Dein Sohn ist nicht mehr hier um dich zu beschützen.“
Elisabeth drückte ihre Hand fester um die von Hans. Sie spürte, wie seine zitterte und feucht wurde.
„Na, hoffentlich tröstet dich die Witwe gut.“ Und zu Elisabeth gewandt: „Wenn ich mal einsam bin, kannst du auch zu mir kommen!“
„Heil Hitler!“ Die Soldaten schlugen ihren Hacken zusammen: „Heil Hitler“
Elisabeth hatte dem Führer schon alles Heil der Welt gewünscht. Hans schaute auf. Er sah in die Augen des Unteroffiziers und wusste, dass dies sein letzter Abend im Haus seiner Eltern sein könnte. „Heil Hitler!“ presste er hervor und hob seinen Arm.
Hans schreckte hoch, rutschte in seinem Sessel hin und her und nur zaghaft kam das Hier und Jetzt zurück. Schweiß perlte von seiner Stirn. Im Halbschlaf griff er die Flasche neben dem Sessel und nahm einen tiefen Schluck. Noch bevor er ganz aus den Träumen und Erinnerungen zurück war, baute er das Husten, das von draußen in seine Ohren drängte, in seinen Traum ein und sackte zurück.
Elisabeth und Hans saßen im alten Hanomag vor der Bäckerei. Der Motor stotterte widerwillig. Der Abend dämmerte früh, auf dem Weg von Wismar zurück nach Krähenstein.
Hans half Elisabeth Mehl und Holz abzuladen und ging über die Moorbrücke zurück zu seinem Haus. Zwei Soldaten standen vor seiner Tür.
„Der Herr Hauptmann von Harenburg will ein paar Worte mit dir wechseln“, sagte der rechte und ließ seine Mauser am Ledergurt von der Schulter rutschen. Der andere machte zwei Schritte auf Hans zu.
Hans sah durch die offenstehende Tür. Die wenigen geliehenen Möbel waren zertrümmert. Alles von Wert hatten sie mitgenommen. Hans griff sich seine Lodenjacke und folgte den Gefreiten. Er musste immer wieder stehen bleiben, um sich irgendwo festzuhalten. Sein Bein schmerzte.
Nach der Begrüßung für den Führer wurde der Ton des Hauptmanns lauter.
Hans stand zwischen den beiden Soldaten. Das Gewicht hatte er auf sein linkes Bein verlagert. Er wankte.
Hauptmann von Harenburg hatte sich im Tanzsaal des Dorfkruges niedergelassen. Einem Anbau hinter Elisabeths Bäckerei. An der Stirnseite des Raumes stand ein großer eichener Schreibtisch. Links und rechts dahinter hingen Hakenkreuzfahnen an der Wand, dazwischen ein übergroßes Portrait vom Führer. An der Tür saß Harenburgs Adjutant an einem Metalltisch vor seiner Schreibmaschine. Ein Feldtelefon, ein blecherner Aktenschrank. Vor dem Schreibtisch des Hauptmanns standen zwei Stühle, die ganz an den Schreibtisch herangerückt waren. Das Licht wurde durch schwere samtrote Vorhänge ausgesperrt. Ein paar Strahlen versteckten sich dahinter und lugten neugierig durch schmale Schlitze ins Halbdunkel.
Hans schwitzte. Das tat er immer, wenn er sich anstrengte oder aufregte. Vor Schmerzen wusste er nicht, wie er stehen sollte. Sein Bein pochte und brannte und er fühlte, wie ihm der so vertraute Rinnsaal aus Eiter und Blut die Hose durchfeuchtete. Immer wieder schaute er auf die beiden Stühle. Doch jedes Mal, wenn Schwäche oder Schmerzen ihn zu übermannen drohten, dachte er an Jürgen.
„Wir sind noch einmal in deinem Haus gewesen. Wir waren wohl nicht gründlich genug.“ Hauptmann von Harenburg grinste und zog ein Laken, gefüllt mit Gegenständen, auf seinen Schreibtisch. Hans konnte einen Kerzenständer und eine Schriftrolle erkennen. Daneben lag eine Chupa.
„Das sind nicht meine Sachen“, stammelte Hans. Er spürte den härter werdenden Griff der Wachsoldaten links und rechts. Ein Dritter schlug ihm einen Gewehrlauf in den Rücken. Hans klappte zusammen. Harenburg drehte sich um und sprach zum Führerbild. „So ergeht es jedem, der unserem geliebten Führer und unserem großartigen Vaterland Schaden zufügt.“ Er drehte sich nicht einmal mehr um. Hans wurde gestoßen und geschoben. Aus dem Augenwinkel heraus sah er Elisabeth an der Tür vorbeihuschen. Die Soldaten stießen Hans die Kellertreppe hinunter. Die Luft wurde aus seinen Lungen gepresst. Hans schlug mehrmals auf die Steinstufen. Er konnte nicht schreien, als eine Rippe krachend brach. Er konnte nicht schreien, als sich sein Knöchel verdrehte. Aber er schrie, als seine Wunde tiefer aufriss. Er schrie! Niemand drehte sich um. Niemand sagte ein Wort. Niemand half ihm.
Die Luft war schwer, muffig und kohlig. Es war dunkel. Das Atmen fiel Hans schwer und noch schwerer fiel es ihm, sich zu bewegen. Dennoch stemmte er sich hoch. Hans torkelte mit seinem Oberkörper an einer modrigen Wand entlang. Warmes Leben lief an seinem Bein hinunter. Der Eiter roch süßlich. Hans stützte seinen Rippenbogen und tastete sich mit der anderen Hand am moosigen Fels entlang. Fast wäre er gestolpert, als er gegen einen Haufen stieß. Wie im Wahn tastete er sich weiter. „Kohlen, das sind Kohlen“, wollte er hinausschreien. Die Bilder vom Saal schlichen in seine Erinnerung. Der Tanzsaal der Gasstätte. An der hinteren Wand war die Rutsche in den Kohlenkeller. Hans schob sich auf den Haufen loser Eierbriketts. Bei jedem Versuch, sich über den Haufen nach oben zu drücken, kullerten und klickerten die Briketts nach unten. Hans lag auf dem Bauch, er kroch, zerrte, weinte, wollte schreien. Er keuchte. Jeder zweite Atemzug blieb ihm hustend im Rachen stecken. Er bekam kaum noch Luft. Sein Hemd war nassgeschwitzt. Er reckte sich und seine Finger erreichten den eisernen Riegel der Schüttklappe. Unwillig gab der rostige Riegel nach. Schattenlicht drang durch den hochgedrückten Verschlag zu ihm. Hans presste sein Gesicht in den Spalt. Seine Lungen giemten nach frischer Luft, seine Seele nach Freiheit und sein Körper nach Leben. Seine Brust gierte und die kühle Brise ließ ihn frösteln. Hans blieb liegen. Das Dunkel im Keller wurde dunkler. Die Sterne übernahmen die Nacht. Stimmen und Geräusche versiegten. Nun wagte er die Klappe ganz aufzustoßen, konnte sie aber nicht halten. Sie schrie im Scharnier und das Holz schlug dumpf auf den Boden. Ein Hund beschwerte sich und zerrte an seiner Kette. Auf dem Kies: lederne Stiefel. Hans blieb auf dem Kohlehaufen liegen. Dann packte er zu. Das weiße Gesicht der Wache, das durch die Luke schaute, quiekte erschrocken auf. Im Todesringen gab es keinen einzigen Wimpernschlag Zeit, um Alarm zu schlagen. Beide keuchten auf dem Kohlehaufen. Gesicht an Gesicht erkannten sie einander. Das Grammophon im Tanzsaal tönte bis in den Keller: „Mein kleiner grüner Kaktus.“
Ineinander verschlungen, und wie auf ewig verbunden, rollten sie auf der Kohle.
Und der Thorsberg seufzte.
Hans kramte in seinen Erinnerungen, in seinen Träumen, doch die stießen ihn zurück.
Jetzt hörte er es ganz deutlich: das Husten. Hans öffnete seine Augen.
Kurt
Kurt schrie, das hörte ich. Kinderschreie berühren selbst mich.
Kraftvoll riss die Lok die Waggons nach vorne, stockte, zog an den Kupplungen. Der Zug ruckte an. Metall knirschte auf Metall. Er reckte und streckte sich, dann der Knall. Metall wurde gebogen und zerdrückt.
Kurt wurde von der Druckwelle zu Boden gerissen. Das Zerbersten menschlichen Schaffens hörte er nicht, als er auf die gesprengten Steine schlug. Kurt rang nach Luft. Er hustete und spürte die scharfkantig zerrissenen Steine unter sich. Splitter flogen wie Blütenstaub durch die Luft. Kurt rang nach Atem und spuckte feinen Steinstaub. Die Hitze war unerträglich und raubte der Staubluft den Rest Sauerstoff, den das Feuer übrig ließ. Kurt wischte sich durch die Augen. Er schmeckte Ruß und Blut. Flammen fraßen sich durch seine kleine Kinderwelt. Mauern barsten, Metall schmolz. Entfernte Schreie. Von den Zügen war nichts zu hören oder zu sehen. Kurt riss seine Augen auf. Das Gleisbett war zerfleischt, die Gleise verbogen. Waggons, wie in einer Spielzeugkiste, unachtsam übereinandergeworfen. Kurts Hirn hämmerte und in seinen Ohren pochte es. Ihm war schwindelig und er sah alles wie durch einen Schleier. Die Bomben, die Steine, das Eisen, die Schreie schwollen an, wie in einer einzigartigen Symphonie aus Leid und Krach.Zwei kräftige Arme rissen Kurt nach oben und stießen ihn vorwärts. Er stolperte, wurde gestoßen. „Lauf Junge, lauf um dein Leben!“ hörte er durch die gierig fressenden Flammen. Hinter Kurt: Husten, Röcheln. Die harte Hand stieß ihn weiter, stieß in seinen Rücken, stieß ihn vorwärts, weiter von Gleisen fort. Fort von seinen Schwestern. Fort von seiner Mutter. Watte legte sich auf Kurt, dann ein immer höher werdendes Pfeiffen. Ein lauter Knall. Er spürte eine weitere Druckwelle und das Röcheln hinter sich hörte er ein letztes Mal. Kurt rannte. Die Stimme war nicht mehr bei ihm. Kurt war allein. Allein mit sich und dem Pfeiffen in seinen Ohren.
Ich war bei ihm und folgte jedem seiner Schritte.
Kurt lief, fiel erschöpft in einen Graben. Kurt fror. Kurt hustete und rannte weiter. Er blieb erst stehen, als der Husten keine Luft mehr rein- und rausließ, er nicht mehr atmen konnte. Kurt fiel auf die Knie und erbrach sich. Er schnappte nach Luft, hustete und übergab sich erneut. Seit Tagen hatte er nichts Richtiges mehr gegessen, nur Baumrinde gekaut. Er würgte nur Schleim, Galle und fädrig bittere Säure nach oben. Kurt wischte sich mit dem Ärmel der gestrickten Jacke sein Gesicht ab.
Seine Mutter strickte den ganzen Tag, zumindest als es noch Wolle gab. Sie strickte sogar kurze Hosen, die er und seine Geschwister im Sommer anziehen mussten. Ging eine Hose kaputt, mussten die Kinder beim Aufribbeln der Wolle helfen. Sie hielten das kaputte Kleidungsstück, ob nun Socken, Hosen, Leibchen oder Jacken hoch, während die Mutter das Gestrickte aufribbelte. Den Faden dann durch eine Wasserschüssel gleiten ließ, danach um eine Stuhllehne spannte und nach dem Trocknen wieder in ein Wollknäuel verwandelte. Kurze Zeit später klickerten die Nadeln ihre Heimatmelodie. Das war schon immer so. Doch schien es weit her.
Kurt sah sich um. Er wusste nicht, wie weit er gelaufen war. Die Sonne versteckte sich früh in diesen Tagen. Es hatte wieder angefangen zu schneien. Hinter Kurt lag ein kleines Waldstück, rechts und links nur brache Krume. Einige beleuchtete Häuser winkten ihm durch das wirre Geäst des Knicks zu. Kurt setze sich auf einen verwitterten Kilometerstein vor einer Heckenrose und legte die Arme um seine Brust. Immer wieder suchten seine Augen die Wärme der Lichter. Erst als sich zwischen den Häusern niemand mehr bewegte, drückte er sich hoch. Seine Knie gaben nach, seine Füße gehorchten ihm nicht. Er fühlte weder Kälte noch Schmerzen. Kurt streckte behutsam seine Zehen und trampelte langsam auf. Immer und immer wieder, bis es anfing zu kribbeln. So machte er es immer nach langen Schneeballschlachten zu Hause. Früher, vor der Flucht. Auch das war schon weit her. Kurt fürchtete sich vor diesem Kribbeln. Es tat weh und keine Mutter war da, die die Füße hätte reiben können. Als das Kribbeln nachließ, duckte er sich und schlich am Knick entlang.
Er kam näher. Ich sah seinen kleinen Körper und sein Gesicht zittern. Ich roch seine Angst.
Kurt drückte sich am ersten Haus vorbei und an einem zweiten. In beiden Häusern brannte Licht. Am dritten Haus quetschte er sich hinter eine Ligusterhecke. Die blutig verkrusteten Händchen drückten die knorrigen Äste langsam auseinander. Schräg hinter dem Haus stemmte sich ein verwitterter Holzschuppen gegen eine Schneewehe.
Kurt kroch auf allen Vieren an der Hecke vorbei. Er nahm sich zwei Hände voll Schnee und steckte ihn in den Mund. Dann zwängte er sich durch einen Spalt in der Schuppentür. Eggen, Spaten, Seile, Hacken und Harken ruhten sich an den Wänden aus. Gerätschaften standen nach fleißiger Arbeit in der Ecke und sammelten Kräfte für das kommende Frühjahr. Eine Schubkarre lag auf der Seite. Holzscheite daneben. Kurt tastete sich langsam vor. Alte Säcke und Strohballen stapelten sich bis unter die brüchige Decke. Seine Zähne klapperten wie die Äste auf dem Schuppendach. Einige Triebe wuchsen durch Spalten in der Schuppenwand ins Innere und eroberten ihre neue Heimat. Kurt setze sich auf einen Strohballen und schaute sich um. Es war viel dunkler, aber auch wärmer als draußen. Kurt klemmte sich zwei Leinensäcke unter den Arm und kletterte an den Strohballen hoch. Oben angekommen riss er einen Ballen auseinander und formte das Stroh zu einem Bett. Einen Sack legte er auf das Stroh, damit es nicht piekte und in den anderen kroch er bis zum Hals. Das restliche Stroh kratzte er über sich zusammen. Kurt zog Kopf und Arme ein. Der Sack roch nach Kohle. Sofort erinnerte er sich an den Bahnhof, an seine Geschwister, an seine Mutter. Aber noch bevor sich weitere Erinnerungen in einem salzigen Strom den Weg durch seine Augen bahnen konnten, schlief er ein.
Kurt schreckte hoch. Etwas raschelte im Stroh. Irgendwo schrie eine Krähe. Eine Zweite antwortete. Kurt kämpfte darum wach zu bleiben, doch der Schlaf zog ihn zurück in sein Reich. Einmal glaubte Kurt Stimmen zu hören, einmal die Sonne durch den Holzverschlag zu sehen. Alles nur Blitzlichter der Erinnerung. Er schlief weiter.
Zuerst wusste Kurts Unterbewusstsein, dass er wach wurde. Noch bevor er seine Augen öffnen konnte und sein Körper aus der Schlafenswelt zurück war, rieb er sich mit beiden Händen seine verklebten Augen auf. Sein Hals war geschwollen. Schlucken fiel ihm schwer. Kurt öffnete seine Augen und rieb an ihnen, bis sie schmerzten. Ruß und Heu kitzelten in seiner Nase. Er hustete und erschrak. Er krächzte. Er nieste, alles tat ihm weh. Sein Magen forderte lautstark sein Recht. Seine Zunge war trocken, klebte am Gaumen und er konnte den Husten nicht unterdrücken. Es hörte nicht auf. Seine Augen tränten und eine salzige Spur zog sich durch das geschwärzte Gesicht. Kurt rang nach Luft. „Mama, bitte! Mama!“ rief er und schlug sich vor Schreck eine Hand vor den Mund. Er wurde herumgerissen. Er spürte eine schwere Hand auf seiner Schulter, dann eine zweite auf seinem Arm. Hände, die zugriffen wie ein Schraubstock. Es wurde feucht und warm in seinem Schritt. Kurt spürte, wie es seine Schenkel hinunterlief. Der Dunst des warmen Urins kroch aus dem Geruch von kalter Kohle. Kurt strampelte, zerrte und fing an zu schreien. Er hatte nicht bemerkt, wie tief er in das Stroh geraten war. Draußen war es hell. Die kräftigen, schorfigen Hände hielten ihn fest. Sie zerrten Kurt aus dem Stroh und drehten ihn um.
„Ist schon gut, kleiner Mann, ist schon gut. Wer bist du denn?“
Kurt strampelte und biss in die Hand, die ihn hielt. Mit einem Aufschrei löste sich der Griff. Rücklings robbte Kurt bis in die letzte Ecke des Speichers. Er blinzelte direkt in die Sonne. Der Mann blieb Schatten und Stimme.
„Bleib ruhig“, sagte die tiefe Stimme. „Bleib ruhig, ich tu' dir nichts!“
Die Nässe in Kurts Hose wurde kalt. Er zitterte. „K-Ku-Kuuurt. Kurt bin ich.“
„Hallo Kurt, ich bin Hans. Hast du Hunger Kurt, ist dir kalt?“
Kurt nickte und kroch noch tiefer in die Ecke.
„Willst du mit mir ins Haus kommen? Da ist es warm. Ich hab den Ofen angefeuert.“
Kurt nickte. Die Kälte, der Hunger, der Durst, alles war stärker als die Angst, war stärker als die Scham über den feuchten Fleck in seiner Hose. Kurt schnäuzte sich die Nase im Ärmel seiner zerrissenen Wolljacke und kroch nach vorne. Er konnte sich kaum auf allen Vieren halten und rutschte auf seinem Bauch weiter.
„Komm Kurt, keine Angst! Ich gehe vor und lass die Tür offen. Nimm dir Zeit, und wenn du magst, komm einfach rüber.“
Die Leiter stöhnte unter der Last von Hans.
Durch einen Spalt in der Schuppenwand lockte das warme Haus. Kurt presste sein Gesicht fest gegen das rissige Holz. So, als könne er die Wärme durch die Winterluft hinweg in sich aufsaugen. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen als Hans ein Stück Brot, etwas Wurst und ein Glas Milch auf den Tisch stellte. Kurt rieb seinen Bauch und spürte sein Innerstes rebellieren.
Der massige Mann setzte sich mit dem Rücken zur Tür an den Tisch in der Diele und wartete. Hans war groß, Hans war breit, Hans war schwer und sein Hosenbund war der Äquator seines Bauches. Die geflickte Lodenjacke vermochte diesen Berg Mensch kaum zu halten. Hans war noch immer außer Atem.
Kurt zog es aus dem Stroh. Er rutschte auf dem Rücken den Strohberg hinunter, riss einen Ballen um und stürmte die wenigen Meter zum Haus. Auf der Terrasse aus groben Feldsteinen wurde er langsamer.
Hans drehte sich nicht um, als Kurt durch die Tür schlich.
„Schön, dass du mir Gesellschaft leistest, Kurt. Allein essen macht einsam. Keiner sollte allein essen. Hab ich recht? Machst du die Tür noch zu, bitte?“
Kurt nickte, seinen Blick auf den Tisch geheftet.
„Hier Kurt, du kannst ...“ Noch bevor Hans ausgesprochen hatte, stürzte Kurt über den Tisch. Er grabschte und schmatze und das Brot schmeckte gut wie nie. Die Wurst nährte den Körper, die Milch die Seele, doch der fremde Mann die Angst.
Hans lachte, und wenn Hans lachte, bebte das Fleisch. Der Stuhl ächzte mit den Wellen des massigen Körpers.
Kurt verschluckte sich und prustete einen Mundvoll Milch über den Tisch. Dann lächelte er unschuldig und schlang ungekaut ein weiteres Stück Dauerwurst hinunter.
Hans lachte: „Macht nichts Kurt. Schnell zu sein ist das Vorrecht der Jugend, ungestüm zu genießen, das der Menschen!“
Kurt nickte, ohne den Blick vom Tisch zu nehmen. Etwas Brot fiel auf das Holz. Er rülpste. Das Zittern war verschwunden. Es roch nach Kohle und Urin. Kurt ließ beide Arme fallen. Tränen rollten seine Wangen runter. Dann schluchzte sein junger Körper auf.
„Wo kommst du her, Kurt?“ Hans schabte mit seinen Füßen und rutsche auf dem Stuhl hin und her. Die Rückenlehne bog sich gefährlich nach hinten. Kurt lief erneut eine Träne über seine schwarze Wange und der Uringestank stand zwischen ihm und Hans. Kurt zog seine Schultern hoch und starrte auf seine Füße. Nur mit Mühe blieb er sitzen. Kurt zitterte, er war dreckig und müde. Die Verlockung noch eine Nacht im Stroh zu schlafen und etwas Essen zu bekommen, war größer als seine Angst.
„Ich komme aus ... aus ...“, flüsterte Kurt schüchtern und stierte auf das leere Glas Milch.
„Nimm dir noch was. Die Kanne steht hinten, neben der Dielentür“, lächelte Hans.