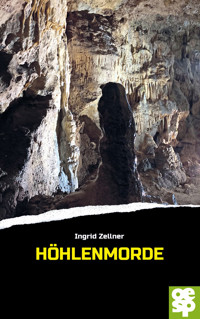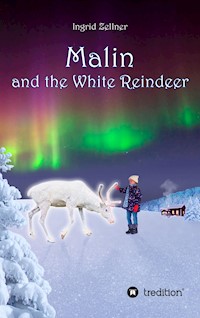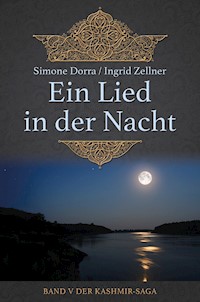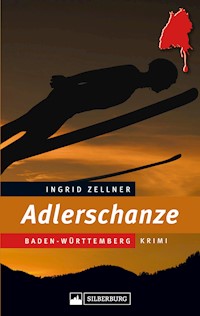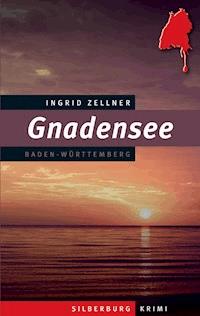
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
An Lonas vierundzwanzigstem Geburtstag beginnt eine Serie von rätselhaften Ereignissen: Ihr Freund Dirk verschwindet spurlos. In seiner Wohnung in Konstanz trifft sie auf einen Fremden, der sich als Dirks Vater ausgibt, obwohl dieser schon seit Jahren tot ist. Dirks Schwester Claudia findet auf ihrer Mailbox eine Nachricht ihres Bruders mit dem seltsamen Ausruf "Die Sonne schmeckt am besten rückwärts". Und auch Dirks Studienkollege Brynjar ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Die polizeilichen Ermittlungen bleiben zunächst erfolglos. Um sich abzulenken, reist Lona für ein Wochenende in die isländische Hauptstadt Reykjavík, wo sie Brynjars älteren Bruder Arnar kennenlernt. Da dieser um Brynjar ebenso besorgt ist wie Lona um Dirk, begibt er sich mit ihr auf Spurensuche. Was hat es mit Dirks Recherchen über die Droge Crystal Meth auf sich? Welche Rolle spielen Claudia und ihr Chef Morten, der in Meersburg ein Tattoo-Studio betreibt? Hat der Überfall auf die Villa von Lonas Mutter auf der Reichenau etwas mit Dirks und Brynjars Verschwinden zu tun? Und was steckt hinter Dirks geheimnisvoller Nachricht? Bald weiß Lona nicht mehr, wem sie überhaupt noch vertrauen kann …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INGRID ZELLNER
Gnadensee
Ein Baden-Württemberg-Krimi
Ingrid Zellner wurde 1962 in Dachau geboren. Nach ihrem Theaterwissenschafts-, Literatur- und Geschichtsstudium in München war sie am Stadttheater Hildesheim und zwölf Jahre an der Bayerischen Staatsoper München Dramaturgin. Heute ist sie Übersetzerin (Schwedisch) und Autorin. Sie hat bereits Romane, ein Kinderbuch, Kurzgeschichten und Theaterstücke veröffentlicht. Daneben ist sie Regisseurin und Theaterschauspielerin.www.ingrid-zellner.de
1. Auflage 2017
© 2017 by Silberburg-Verlag GmbH,
Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung:
Christoph Wöhler, Tübingen.
Coverfoto: © Viktoriya Malova.
Druck: CPI books, Leck.
Printed in Germany.
E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1782-0
E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1783-7
Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-2056-1
Besuchen Sie uns im Internet
und entdecken Sie die Vielfalt
unseres Verlagsprogramms:
www.silberburg.de
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Dank
Prolog
Der Faustschlag traf ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel und direkt in die Magengrube. Er krümmte sich vor Schmerz, die Hände vor den Leib gepresst, rang mühsam nach Luft und taumelte.
Nicht umfallen. Bloß auf den Beinen bleiben. Er musste hier irgendwie raus.
Ein weiterer Schlag landete krachend auf seiner linken Schläfe und schleuderte ihn mit Wucht rücklings gegen die Wand. Ihm wurde schwarz vor Augen, seine Beine knickten ein, und er brach auf dem dicken, plüschigen Teppichboden zusammen.
Verdammt. Der würde doch nicht … Verflucht noch mal, wie hatte er nur so leichtsinnig sein können!
Er hörte, wie neben ihm eine Klinke heruntergedrückt wurde; jemand packte ihn am Oberarm, riss ihn hoch und stieß ihn durch eine geöffnete Tür in einen dämmerigen Vorraum … oder war es ein Flur? Panik stieg in ihm hoch. Das war in jedem Fall nicht die Tür, durch die er hereingekommen war.
Er musste zurück – zurück in das Zimmer mit dem plüschigen Teppichboden … und mit der anderen Tür, die hinaus in die Freiheit führte …
»Nichts da!«
Ein brutaler Stoß gegen die Brust trieb ihn noch weiter in den dunkelgrauen Raum hinein. Halb benebelt sah er, wie die Faust sich erneut zum Schlag erhob, dann flog sein Kopf zur Seite. Er spürte, wie etwas warm und feucht über sein Kinn und den Hals hinunterlief, und presste den Handrücken gegen den aufgerissenen Mundwinkel.
»Da geht’s lang!«
Wieder ging irgendwo eine Tür, und im nächsten Moment wurde er an den Schultern gepackt, herumgedreht und grob vorwärtsgestoßen. Blind stolperte er über eine Türschwelle; sein nächster Schritt ging ins Leere, er verlor jeden Halt, flog nach vorne und abwärts, über kalte, kantige Steinstufen – bis er plötzlich auf einem harten Boden aufprallte, noch ein Stück weiterrollte und schließlich benommen liegenblieb.
Das war’s dann wohl.
Instinktiv versuchte er, sich aufzurichten. Schmerzen schossen durch seinen Körper, auf das linke Handgelenk konnte er sich nicht stützen, und jeder Atemzug jagte ihm ein halbes Dutzend Messerstiche durch die Lunge. Blut rann ihm langsam und klebrig in die Augen und über die Wangen. Als er das rechte Bein leicht anzog, schrie er auf vor Pein; vorsichtig wandte er den Kopf und sah, wie der Unterschenkel in einem unnatürlichen Winkel von seinem Körper abstand.
Rings um ihn herum war es still. Und dunkel. Bis auf das dämmergraue Flurlicht – dort oben, mehrere Meter über ihm –, das durch die halbgeöffnete Tür gleichgültig in den Keller hinabfiel.
Er war allein.
Das war vielleicht seine letzte Chance.
Mühsam tastete er nach dem Smartphone in seiner Tasche. Jede Bewegung, jeder Atemzug wurde zur Qual, und sein Gehirn begann sich allmählich in Watte zu verwandeln.
Da war es … Zum Glück bewahrte er es stets in einer stabilen Hülle auf. Es gelang ihm, mit der einen Hand, die noch funktionierte, die Hülle aufzuklappen und das Display zu aktivieren. Es war noch ganz. Und er hatte sogar tatsächlich Empfang. Nur sehr schwach, aber es sollte reichen.
Das Display verschwamm leicht vor seinen Augen. Statt der Kontaktliste traf seine Daumenkuppe die Anrufliste. Mechanisch tippte er auf die zuletzt angerufene Nummer ganz oben. Eine freundliche Automatenstimme eröffnete ihm, dass der gewünschte Teilnehmer derzeit nicht erreichbar war. Er fluchte in sich hinein, doch noch während er überlegte, ob er es riskieren sollte, Zeit mit dem Wählen einer zweiten Nummer zu verlieren, hörte er von oben Geräusche – gleichzeitig mit dem Signalton, der ihn aufforderte, gerne eine Nachricht zu hinterlassen.
»Hallo – verdammt noch mal, geh ran …«
Oben erschien eine schwarze Silhouette vor dem dämmergrauen Hintergrund im Türrahmen.
»Geh ran!!!«
»Hey – hör sofort auf mit dem Scheiß!«
Er sah die Gestalt eilig die Kellertreppe herunterkommen, sah die Stricke in der einen und ein blitzendes Messer in der anderen Hand.
Aber vielleicht gab es noch eine Hoffnung. Vielleicht, wenn er …
Die Gestalt hatte ihn fast erreicht.
Jetzt oder nie.
»Die Sonne schmeckt am besten rückwärts!«
Mehr Zeit blieb ihm nicht mehr. Ein gut gezielter Tritt traf seinen Kopf, er ließ das Smartphone fallen und sackte zusammen. Panisch rang er nach Atem und spürte sofort, wie sich die imaginären Klingen einmal mehr in seine Lungenflügel bohrten. Er kniff die Augen fest zu, als könnte er damit die Schmerzen unterdrücken, und hörte neben sich am Boden ein ächzendes Knarzen und Splittern aus der Richtung seines Smartphones.
Er holte mühsam Luft und hob langsam den Blick; vor seinen Augen tanzten Funken.
»Hör zu … ich hab dich nicht verpfiffen … Du hast doch gehört, ich hab dich nicht verpfiffen …«
Die Funken tanzten beiseite und gaben den Blick frei auf eine blinkende Messerklinge, die sich seinem Gesicht näherte.
Oh Gott – wie sollte er das alles jemals Lona beibringen …
Das war das Letzte, was er dachte, bevor es Nacht um ihn wurde.
1
Rabenschwarze Nacht. Regennasse Fahrbahn. Grell blendende Scheinwerfer entgegenkommender Autos. Noch einmal voll von Träumen sein. Hektisches Hin und Her der Scheibenwischer im Kampf gegen die Niagarafälle vom Himmel. Sich aus der Enge hier befrein. Nicht mehr lange. Bald. Bald. Er müsse einfach gehn für alle Zeit, für alle Zeit …
»Papa, pass auf!!«
Ein ohrenbetäubendes Kreischen. Ein Knall. Ein endloses Krachen und Splittern.
War was?
»Papa!!!«
Mit einem lauten Aufschrei fuhr Lona hoch, und es dauerte eine Weile, bis ihr bewusst wurde, dass sie aufrecht in ihrem Bett saß.
Wieder dieser Traum. Wieder und wieder der gleiche Traum.
Sie fuhr sich mit beiden Händen über das Gesicht und wischte dabei den Schweiß von der Stirn. Die mattblauen Digitalziffern ihres Radioweckers leuchteten träge in der Dunkelheit. 3.54 Uhr.
Müde ließ sie sich zurück in das weiche Kopfkissen sinken und schloss die Augen. Sie kannte diesen Traum. Seit fünf Jahren träumte sie ihn nun schon, immer wieder. Seit jener Regennacht, in der sie während der Heimfahrt von Stuttgart im Wagen neben ihrem Vater gesessen hatte. Die Melodien aus dem Udo-Jürgens-Musical klangen noch in ihren Ohren, und sie waren schon fast zu Hause angekommen, als ihnen plötzlich ein Auto mit grell blendenden Scheinwerfern auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Ihr Vater verriss das Steuer, um ihm auszuweichen, geriet dabei auf der regennassen Straße ins Schleudern und krachte frontal in die Leitplanke. Lona hatte sagenhaftes Glück gehabt und war mit zwei gebrochenen Rippen und einer Gehirnerschütterung davongekommen. Ihr Vater war auf der Stelle tot gewesen.
Das Verhältnis zu ihrer Mutter, schon vorher nicht das beste, war seitdem noch komplizierter geworden. Ute Mende stammte aus einer angesehenen Anwaltsfamilie in Konstanz, die Heirat mit dem wohlhabenden Steuerberater Anton Mende sicherte ihr eine in ihren Augen standesgemäße Versorgung. Dass die Familienvilla ihres Mannes auf der Bodensee-Insel Reichenau stand, war ihr zunächst zwar nicht ganz recht gewesen; irgendwann hatte sie sich jedoch damit arrangiert und machte es sich zur Aufgabe, das noble Anwesen in Mittelzell mit unverstelltem Blick auf den Untersee zu einem innenarchitektonischen Juwel auszubauen. Ihr kahler, nüchterner Möblierungsstil entsprach nicht ganz Anton Mendes Vorlieben, aber solange es seine Frau glücklich machte, nahm er es hin.
Ziemlich inkompatibel war auch ihr Musikgeschmack. Zwar mochten beide klassische Musik, aber Anton Mende hatte darüber hinaus auch ein Faible für Unterhaltungsmusik und Schlager, womit Ute so gar nichts anfangen konnte. Nicht im Traum wäre es ihr eingefallen, sich ihnen für den Besuch des Musicals »Ich war noch niemals in New York« anzuschließen, den Lona seinerzeit ihrem Vater zum Geburtstag geschenkt hatte. Also waren Anton Mende und Lona allein nach Stuttgart gefahren. Auf eine Übernachtung dort hatten sie verzichtet. »Die Fahrt zurück auf die Reichenau dauert höchstens zwei Stunden«, hatte Lonas Vater gesagt, »das ist überhaupt kein Problem.« Bis dann auf der B 33 kurz hinter Radolfzell von einer Sekunde zur nächsten alles vorbei war.
Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Er wurde nie gefasst.
Seitdem verging kein Tag, an dem Lona in den Augen ihrer Mutter nicht irgendwo den Vorwurf zu lesen glaubte, dass sie schuld am Tod des Vaters sei. Schließlich war es damals Lonas Idee gewesen, dieses Musical zu besuchen. Hätte sie ihrem Vater etwas Vernünftiges zum Geburtstag geschenkt, dann wäre er noch am Leben.
Und das Schlimmste war: Genau genommen stimmte das ja auch.
Finster entschlossen stieg Lona aus dem Bett. Sie würde ohnehin nicht wieder einschlafen. Wenn sie einmal anfing, nach einem solchen Traum über den Unfall ihres Vaters und das Verhältnis zu ihrer kühl-distanzierten Mutter nachzugrübeln, dann war es mit der Ruhe für den Rest der Nacht erfahrungsgemäß vorbei.
Sie ging durch den dunklen Flur in die kleine Küche des Appartements, das sie sich in der oberen Etage der Familienvilla eingerichtet hatte. Als einziges Kind der Mendes war sie Miterbin des Hauses gewesen und hatte sich durch diesen abgetrennten Wohnraum wenigstens ein bisschen Privatsphäre geschaffen. Es war schwer genug, mit ihrer eigensinnigen Mutter, die seit zwei Jahren obendrein zu Depressionen neigte, unter einem Dach zu leben und ihr beinahe tagtäglich über den Weg zu laufen. Ohne diese Zuflucht mit einer Tür, die sie hinter sich verriegeln konnte, würde sie es vermutlich schon lange nicht mehr hier aushalten.
Im Kühlschrank standen neben einer halbvollen Flasche Mineralwasser ein Tetrapak Orangensaft und zwei Flaschen Prosecco, die Lona am Vortag kaltgestellt hatte. Nur für den Fall, dass sich heute im Laufe des Tages irgendwelche Bekannte einfinden würden, die daran gedacht hatten, dass Lona Mende an diesem 10. Mai vierundzwanzig Jahre alt wurde.
Sie warf einen Blick auf die Küchenuhr. Viertel vor fünf. Eigentlich eine völlig unchristliche Zeit, um … aber so what? Es war ihr Geburtstag!
Wenig später saß Lona in dem schweren, bequemen Ledersessel in ihrem Wohnzimmer. Kerzen verbreiteten warmes, flackerndes Licht in dem dunklen Raum, und aus den Lautsprechern der Stereoanlage erklang leise der zweite Satz aus Mozarts Klarinettenkonzert. Goldener Prosecco perlte in der schlanken Sektflöte, die sie zu einem stummen Toast erhob.
Happy birthday, Lona!
Stumm lauschte sie den sanften, schwebenden Tönen des Orchesters. Diese Mozart-CD war das letzte Geschenk ihres Vaters an sie gewesen vor seinem tragischen Unfalltod. Nie fühlte sie sich ihm so nahe, wie wenn sie diese wunderbare Musik hörte.
Du fehlst mir, Papa.
Das Adagio verklang. Die Klarinette stimmte das heitere Rondo-Thema des Schlusssatzes an, und wie immer empfand Lona es wie ein helles, fröhliches und ansteckendes Lachen. Unwillkürlich lächelte sie, trank ihr Glas leer und erhob sich, um die Kerzen auszupusten. Draußen dämmerte das erste schwache Tageslicht herauf.
Es versprach ein schöner Tag zu werden.
Gegen halb zehn Uhr klingelte es an Lonas Haustür. Es war ihre Jugendfreundin Andrea Strobl, die vorbeikam, um zu gratulieren, und natürlich gerne auf ein Glas Vormittags-Prosecco blieb.
»Ein halbes Stündchen hab ich Zeit«, erklärte sie und ließ sich auf das flauschige, hellgraue Kuschelsofa sinken. »Danach muss ich in den Laden, Mama ablösen – die hat dann einen Arzttermin. Sie lässt dich übrigens herzlich grüßen, und Papa auch.«
»Danke.« Lona reichte Andrea ein gefülltes Proseccoglas und setzte sich in ihren Sessel. »Hat deine Mutter irgendwelche Beschwerden?«
»Nein. Nur eine Routineuntersuchung.« Andrea hob ihr Glas. »Also dann – sehr zum Segen, Lona!«
»Santé!«
Sie prosteten einander zu. Lona nippte nur ein wenig und beobachtete ihre Freundin, die ihr Glas mit sichtlichem Genuss schon beim ersten Zug halb leerte. Andrea stammte aus einer alteingesessenen Obst- und Gemüsebauern-Familie auf der Reichenau; ihre Eltern betrieben den Hof bereits in dritter Generation. Als Kind war Lona bei den Strobls ein und aus gegangen – allein schon deshalb, weil die gemütlich gerundete Mutter Strobl ihr jedes Mal einen glänzenden, rotbackigen Apfel oder sonst eine Leckerei zusteckte, aber natürlich auch wegen Andrea, die nur wenige Monate jünger war als sie selbst und mit der Lona von klein auf eine dicke Freundschaft verband. Dass Lona nach der Grundschule aufs Gymnasium wechselte, während Andrea auf der Hauptschule blieb, änderte daran nicht das Geringste.
»Himmel, ist der gut!« Andrea betrachtete den restlichen Prosecco in ihrem Glas anerkennend. »Zu dumm, dass ich heute noch arbeiten muss. Davon hätte ich mir gerne noch etwas mehr gegönnt.«
»Das können wir ja gelegentlich nachholen«, erwiderte Lona gelassen. »Ruf mich einfach an, wenn du das nächste Mal einen freien Abend hast.«
»Du meinst, wenn meine gestrengen Eltern der schwer gestressten Juniorchefin ausnahmsweise freien Ausgang gewähren?« Andrea lachte; ihre Augen, die von der gleichen kastanienbraunen Farbe waren wie ihre schulterlangen Locken, blitzten amüsiert.
»Na komm – sie werden dich ja wohl nicht rund um die Uhr beschäftigen, oder?«
»Nein, natürlich nicht.« Andrea nahm einen weiteren, diesmal deutlich kleineren Schluck. »Aber Papa hat damit angefangen, mich in die Buchhaltung des Betriebs einzuarbeiten, und dafür hat er eben am besten Zeit, wenn das restliche Tagwerk erledigt ist. Sprich: meistens eher spätabends.«
Lona betrachtete ihre Freundin nachdenklich.
»Das heißt also, du bist mittlerweile entschlossen, eines Tages den Hof zu übernehmen?«
»Derzeit ja«, antwortete Andrea. »Ich weiß, ich hatte lange Zeit meine Bedenken … aber inzwischen hab ich mich an den Betrieb gewöhnt, und im Moment kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich irgendwann in die Fußstapfen meiner Eltern trete.« Sie grinste Lona breit an. »Hätten wir vor ein paar Jahren noch nicht gedacht, was?«
»Ganz bestimmt nicht.«
Lona lächelte in sich hinein. Als Kind hatte Andrea noch Lehrerin werden wollen, als Teenager hatte sie eine Weile von einer Karriere als Filmschauspielerin geträumt, und danach hatte sie mit allen möglichen Berufssparten geliebäugelt, von Modeverkäuferin über Buchhändlerin bis zu Reisebusfahrerin … alles, nur kein Leben zwischen Treibhäusern und Obstkisten. Und Lona hatte volles Verständnis dafür gehabt; sie hatte sich ebenfalls niemals vorstellen können, sich wie ihr Vater jahraus, jahrein mit Akten und Steuerangelegenheiten zu befassen.
Sie spürte, wie ihr Lächeln erstarb. Jetzt musste sie das auch nicht mehr. Anton Mende hatte seiner Frau und seiner Tochter neben der Villa auf der Reichenau noch ein stattliches Vermögen vererbt, das ihnen ein weitgehend sorgenfreies Auskommen sicherte – auch ohne die Einnahmen aus der Kanzlei, die an einen anderen Steuerberater übergeben wurde. Lona war daher in der – aus der Sicht ihrer Umgebung – »beneidenswerten« Situation, sich ihren Lebensunterhalt fürs Erste nicht verdienen zu müssen. Sie selbst konnte über solche Ansichten nur den Kopf schütteln.
Ihr habt doch keine Ahnung. Glaubt ihr nicht, ich würde auf dieses Geld liebend gerne pfeifen, wenn dafür mein Vater noch am Leben wäre? Abgesehen davon, dass es weiß Gott kein Vergnügen ist, mit meiner Mutter allein unter einem Dach zu leben. Und außerdem …
»Lona?«
Lona blinzelte. Andrea hielt ihr leeres Sektglas hoch und sah sie fragend an. »Ich glaube, du träumst am helllichten Tage«, stellte sie fest.
»Tut mir leid«, murmelte Lona. »Ich war gerade mit meinen Gedanken woanders. Möchtest du noch einen Schluck?«
»Einen kleinen«, grinste Andrea. »Sonst verkaufe ich nachher aus Versehen noch Boskoop- statt Gala-Äpfel, und das wäre doch außerordentlich peinlich.«
Sie ließ sich von Lona das Glas nachfüllen und betrachtete sie dabei kritisch.
»Aber jetzt mal im Ernst, Süße, ich hab mir vorhin schon gedacht, dass du nicht ganz taufrisch aussiehst. Fehlt dir was?«
»Ach was«, winkte Lona ab. »Ich hab heute Nacht nur ein bisschen schlecht geschlafen, das ist alles. Ich denke, ich werd mich nachher noch ein Weilchen hinlegen, bevor Dirk kommt.«
»Aha.« Andreas Augen funkelten vergnügt. »Und, habt ihr noch was Schönes vor heute?«
»Keine Ahnung«, erwiderte Lona mit einem kleinen Lächeln. »Ich denke, er wird mich zum Essen ausführen, aber was genau er sich vorgenommen hat, weiß ich nicht. Er hat sich da im Vorfeld überhaupt nichts entlocken lassen.«
»Also eine klassische Geburtstags-Überraschung.« Andrea trank einen Schluck und stellte ihr Glas ab. »Find ich prima. Manchmal könnt ich dich um den Kerl glatt beneiden … sieht gut aus, hat Kohle und ist dazu auch noch nett und großzügig. Wieso läuft mir so was nicht auch mal über den Weg?«
»Kommt schon noch«, versicherte Lona; sie merkte, wie ihre Stimmung allmählich wieder besser wurde. »Bloß keine Torschlusspanik, du bist noch nicht mal vierundzwanzig, im Gegensatz zu mir.«
»Stimmt«, meinte Andrea lakonisch. »Ich hab noch viel Zeit.« Sie leerte ihr Glas und warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Aber heute nicht mehr, ich muss jetzt los. Ich ruf dich morgen an, Süße, und dann will ich ganz genau wissen, wo ihr wart und was dein Dirk dir geschenkt hat, ja?«
»Neugierig bist du überhaupt nicht, was?« Lona schüttelte amüsiert den Kopf.
»Das ist keine Neugier, das ist seriöser innerer Forscherdrang«, erklärte Andrea mit todernster Miene. »Hab einen schönen Tag und einen noch schöneren Abend!«
Die beiden Freundinnen erhoben sich und umarmten einander, dann begleitete Lona Andrea die Treppe hinunter. Gerade hatten sie die Vorhalle erreicht, als dort eine Tür geöffnet wurde; im Türrahmen stand, in ein elegantes mintfarbenes Satin-Negligé gehüllt, Ute Mende.
»Dachte ich mir doch, dass ich Schritte gehört habe«, sagte sie mit ihrer dünnen, kühlen Stimme. »Hallo, Andrea … guten Morgen, Lona, und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.«
»Danke.«
Lona seufzte innerlich. Das war für ihre Mutter ja mal wieder perfekt gelaufen; auf diese Weise hatte sie die Gratulation an ihre Tochter sozusagen abgefrühstückt, ohne sich dafür extra zu ihr nach oben bemühen oder womöglich sogar einen Kaffee oder ein Glas Prosecco zusammen mit ihr trinken zu müssen. Wenn Ute Mende etwas nicht war, dann gesellig.
»Ich muss mal schauen … Irgendwo hab ich was für dich, warte.«
Ute verschwand. Lona wandte sich Andrea zu und verdrehte die Augen. »Was wetten wir, dass sie jetzt ihren Badezimmer-Schrank plündert und mit einem ihrer Chanel-Parfums ankommt, von denen sie mittlerweile wissen müsste, dass ich sie auf den Tod nicht ausstehen kann«, raunte sie ihrer Freundin in resignierendem Tonfall zu.
»Dann schmeiß es weg oder gib’s mir«, gab Andrea ungerührt und ebenso leise zurück.
»Voilà!« Ute kehrte zurück und hielt Lona auf ihrer Handfläche einen eleganten Flacon mit Coco Eau de Parfum von Chanel entgegen. »Für dich.«
Eines Tages – wenn nicht gerade Andrea oder sonst jemand danebensteht – mach ich das Ding auf und schütte dir das Zeug über den Kopf, dachte Lona verbissen. Egal wie sündteuer es ist.
Sie schaffte es, sich zusammenzunehmen und ein halbwegs freundliches Lächeln zu fabrizieren. »Vielen Dank.«
»Keine Ursache«, entgegnete Ute. »Und, geht ihr jetzt schön feiern?«
»Ähm … nein«, meldete Andrea sich zu Wort. »Ich geh jetzt schön arbeiten. Die schnöde Pflicht ruft.«
»Verstehe.« Ute nickte leicht. »Dann einen schönen Tag noch euch beiden.«
Und damit wandte sie sich um, rauschte ab und schloss die Tür hinter sich.
Lona und Andrea wechselten einen vielsagenden Blick, dann drückte Lona ihrer Freundin mit einem bitteren Lächeln den Chanel-Flacon in die Hand.
»Bitte schön – werd glücklich damit.«
Wenig später stand Lona wieder oben in ihrem Wohnzimmer und schenkte sich ein weiteres Glas Prosecco ein. Das war nun schon das dritte an diesem Tag und mindestens eines zu viel – aber nach dieser Begegnung mit ihrer Mutter brauchte sie jetzt einfach einen Alkoholstoß. Zum Glück musste sie heute nicht mehr ans Steuer; das konnte sie nachher vertrauensvoll Dirk überlassen, wenn er sie abholte.
Dirk.
Bei dem Gedanken an ihn entspannte sich Lona wieder ein wenig. »Manchmal könnt ich dich um den Kerl glatt beneiden«, hatte Andrea gesagt, und dazu hatte sie allen Grund, wie Lona fand. Dirk Reisacher war definitiv das Beste, was ihr in den Jahren seit dem tödlichen Unfall ihres Vaters passiert war. Er war Student an der Universität Konstanz und dort ziemlich umschwärmt; kein Wunder, er war ein Frauentraum auf zwei Beinen – groß, schlank, blond und mit leuchtend blaugrünen Augen, Sohn wohlhabender Eltern und dazu auch noch intelligent. Dass seine Wahl auf Lona gefallen war, die mehr oder weniger ziellos ein Literatur- und Geschichtsstudium abfeierte und sich unter seinem Studienfach »Nanoscience« bis heute nichts wirklich Konkretes vorzustellen wusste, konnten viele seiner ehrgeizigen Kommilitoninnen vermutlich nach wie vor nicht fassen. Manchmal begriff Lona es ja selbst noch immer nicht, dass sie so viel Glück gehabt hatte.
Gut, sie war alles andere als unattraktiv und fiel durchaus in so manches männliche Beuteschema, wie sie aus langjähriger Erfahrung nur zu gut wusste. Sie hatte von ihrer Mutter die hochgewachsene, sehr schlanke Gestalt geerbt und vor allem auch das reiche, tizianrote Haar, das ihr (anders als bei Ute, die es seit Jahren kurzgeschnitten trug) in sanften Wellen bis zur Taille hinabfiel und einen reizvollen Kontrast bildete zu ihren großen, dunkelgrauen Augen – einem Erbe ihres Vaters. Viele junge Männer hatten bereits versucht, bei ihr zu landen, aber Lona hatte alle abblitzen lassen. Bis sie dann vor zwei Jahren bei einem Konzert im Konstanzer Münster zufällig neben diesem gut aussehenden Studenten zu sitzen kam, der so gewandt über Mozart und Mendelssohn plaudern konnte, dass er auf der Stelle Lonas Neugier weckte. Als er sie nach dem Konzert noch auf ein Glas Wein einlud, sagte sie nicht nein. So begann eine Freundschaft, aus der schnell eine feste Beziehung wurde. Auch wenn sie in vielerlei Hinsicht verschieden waren – im Gegensatz zu Dirk, der sein Nanoscience-Studium sehr fokussiert absolvierte, wusste Lona noch immer nicht wirklich, was sie aus ihrem Leben machen wollte –, war es vor allem das gemeinsame Interesse für Musik, das sie verband.
Sie trank von ihrem Prosecco, streckte sich der Länge nach auf dem Sofa aus und schloss die Augen. Wohin würde Dirk sie an diesem Abend wohl ausführen? Zu einem Italiener vielleicht … oder in dieses prächtige marokkanische Restaurant, in das sich Lona bei ihrem ersten Besuch vor ein paar Wochen verliebt hatte. Und Dirk pflegte sich üblicherweise sehr gut zu merken, was Lona gefiel und was sie sich wünschte.
Im vergangenen Dezember hatte sie nach einer TV-Sendung über Reykjavík eine beiläufige Bemerkung fallen lassen, diese junge, hippe Stadt auf Island würde sie gerne einmal sehen – und prompt fand sie unter dem Weihnachtsbaum einen Reisegutschein für ein verlängertes Wochenende in der nördlichsten Hauptstadt der Welt vor, inklusive einem Konzertbesuch in dem hochmodernen Konzerthaus Harpa. Für zwei Personen. »Glaub bloß nicht, dass die Harpa nur dich interessiert«, hatte Dirk schmunzelnd erklärt, als Lona ihn nur noch sprachlos anstarrte. »Tu mir bitte lediglich den Gefallen und lös den Gutschein erst im Frühjahr oder Sommer ein – jetzt im Winter ist es da oben doch etwas arg dunkel und kalt.« Ein Lächeln spielte in Lonas Mundwinkel. Diesen Wunsch hatte sie Dirk nur zu gerne erfüllt. Inzwischen war der Trip fest gebucht; in zwei Wochen würden sie in dem feuerroten Konzertsaal »Eldborg« sitzen und dem Iceland Symphony Orchestra unter seinem Ehrendirigenten Vladimir Ashkenazy lauschen. Bei dem Gedanken daran wurde Lona beinahe schwindelig vor Vorfreude.
Und heute Abend würde sie mit Dirk ihren Geburtstag feiern. Nur mit ihm.
Als sie einige Zeit später erwachte, war es bereits vier Uhr nachmittags; sie hatte tatsächlich ein paar Stunden geschlafen und fühlte sich nun ausgeruht und frisch. Sie nahm eine Dusche, kämmte ihre Haarfluten und schminkte sich sorgfältig. Dann inspizierte sie den Inhalt ihres Kleiderschranks und entschied sich für schwarze Marlenehosen und ein eng anliegendes dunkelgraues, mit schwarzen Pailletten besetztes Top. Das waren ihre bevorzugten Farben; sie fand, dass auf diese Weise das leuchtende Tizianrot ihrer Haare am besten zur Geltung kam.
Sie schlüpfte in schwarze High Heels und warf einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel. Ja. Gut so. Dirk würde hingerissen sein.
Sie setzte sich ins Wohnzimmer und wartete.
Eine halbe Stunde später wartete sie immer noch, zunehmend beunruhigt. Es sah Dirk nicht ähnlich, sich derart zu verspäten – oder sich nicht wenigstens per Smartphone zu melden, damit sie Bescheid wusste und sich keine Sorgen zu machen brauchte. Dass auf die Nachrichten, die Lona ihm nun ihrerseits per SMS und über WhatsApp schickte, keine Antwort kam und sich, als sie seine Nummer wählte, nicht einmal die Mailbox meldete, machte die Sache nicht besser.
Schließlich hielt sie es nicht mehr aus. Sie griff nach ihrer Tasche und dem Autoschlüssel und eilte die Treppe hinunter ins Freie. Für einen Moment dachte sie schuldbewusst an die drei Gläser Prosecco, die sie heute bereits getrunken hatte, aber da war jetzt eben nichts zu machen. Sie musste wissen, was mit Dirk los war.
Wenig später saß sie am Steuer ihres silberfarbenen Opel Adam und fuhr los in Richtung Konstanz.
Es dauerte gut eine halbe Stunde, bis Lona den Konstanzer Stadtteil Petershausen erreichte und endlich ihren Wagen abstellen konnte. Dreimal war sie bis dahin auf der Suche nach einer freien Parklücke an dem Haus vorbeigefahren, in dem Dirk seine hübsche kleine Altbauwohnung hatte, und zumindest hatte sie dabei schon seinen dunkelblauen Mercedes erspäht, der nicht weit vom Hauseingang entfernt auf einem Parkplatz stand. Offenbar war er also zu Hause. Vielleicht war er über einer Studienarbeit eingeschlafen oder sonst irgendwie aufgehalten worden.
Sie schloss die Haustür auf – Dirk hatte ihr vor einiger Zeit den Ersatzschlüssel zu seiner Wohnung anvertraut, damit sie ungehindert bei ihm ein und aus gehen konnte – und stieg die Treppe in den zweiten Stock hinauf. Dort klingelte sie noch einmal pro forma, aber dann öffnete sie die Wohnungstür mit dem Schlüssel und trat ein.
»Dirk?«
Keine Antwort. Lona ließ die Tür hinter sich ins Schloss schnappen.
»Dirk, bist du da?«
Totenstille. Der Flur war ebenso leer wie das Bad und das große Zimmer mit der Küchenecke.
Ihr Blick fiel auf den Garderobenhaken im Flur. Die Jacke, die Dirk derzeit üblicherweise trug, hing nicht dort, und auch seine Lieblingssneaker fehlten. War er noch einmal losgezogen, um etwas für den Abend zu besorgen? Hatte er die Zeit übersehen?
Sie wählte noch einmal Dirks Handynummer. Vergeblich.
In der Küchenecke fand sie einen kleinen Stapel ungespültes Geschirr neben der Spüle und auf dem Esstisch Brösel und eine Tasse mit einem eingetrockneten Rest Kaffee. Nichts, was auf irgendein ungewöhnliches Ereignis hindeutete. Dirk gehörte nicht zu der Sorte Mensch, die regelmäßig Geschirr spülte und alles penibel blankpolierte.
Gedankenverloren zerrieb sie einen trockenen Brösel zwischen den Kuppen ihres Daumens und Zeigefingers.
Wo zum Teufel bist du, Dirk?
Sie ging zum Schreibtisch hinüber. Er war übersät mit Büchern, Kopien und Notizen, als hätte Dirk bis eben noch hier gesessen und gearbeitet. Der Laptop jedoch war ausgeschaltet und kalt.
Etwas Kleines, Buntes blitzte zwischen den Papieren hervor, und unwillkürlich griff Lona danach. Es war ein Geschenkpäckchen. Mit einer Schleife und einem Anhänger. »Für Lona« stand darauf.
Einen Moment lang zögerte Lona, dann hielt sie das Päckchen mit ihren Fingerspitzen hoch, behutsam wie ein rohes Ei, und betrachtete es von allen Seiten. Es fühlte sich eindeutig an wie eine Schmuckschachtel. Sofort erinnerte sie sich daran, wie sie und Dirk vor einiger Zeit in der Innenstadt am Schaufenster eines Juweliers stehengeblieben waren. Ein schmaler Ring aus Gelbgold hatte Lonas Aufmerksamkeit gefesselt; in einer schlichten Zargenfassung saß ein ausgesprochen schön geschliffener Rubin. Dirk war ihrem Blick gefolgt und hatte anerkennend gelächelt. »Ein schönes Stück«, hatte er gesagt, »würde gut zu deinen Haaren passen.« Sie hatte zustimmend genickt; aber dann waren sie weitergegangen, ohne den Ring noch einmal zu erwähnen.
Lona merkte, wie ihre Hand, die das Päckchen hielt, zu zittern begann. Dieser Verrückte hatte doch nicht etwa …
Ein Geräusch durchbrach die Stille des Raumes. Ein Schlüssel, der von außen in das Schloss der Wohnungstür gesteckt und herumgedreht wurde.
Dirk. Gott sei Dank. Die Erleichterung, die Lona empfand, war unbeschreiblich. Schnell legte sie das Päckchen zurück auf den Schreibtisch und versteckte es unter den Papieren, während hinter ihr die Wohnungstür geöffnet wurde. Sie drehte sich um, ein strahlendes Lächeln auf den Lippen – und dann erstarrte sie.
Ein Mann betrat das Zimmer. Und es war nicht Dirk.
Der Fremde schien nicht minder überrascht und erschrocken über Lonas Anwesenheit zu sein als sie über sein unerwartetes Auftauchen. Jäh und wie angewurzelt blieb er in der Tür stehen.
Lonas Herz pochte heftig; unwillkürlich krallte sie sich mit beiden Händen an der Schreibtischkante hinter ihr fest. Sie war sich sicher, diesen Mann nie zuvor gesehen zu haben. Er war von mittelgroßer, kräftiger Gestalt und trug Jeans und einen abgewetzten Parka. Für einen Kommilitonen von Dirk schien er zu alt zu sein – wobei das schwer zu schätzen war, denn er verbarg seine Augen hinter einer Sonnenbrille.
»Wer sind Sie?« Ihre Stimme klang heiser und gehorchte ihr kaum. »Was wollen Sie hier?«
Für einen Moment kam es Lona so vor, als hätte ihre Frage den Fremden überrumpelt und er müsste erst einmal nach einer Antwort suchen.
»Ich … ich muss nur schnell was holen«, sagte er mit einer kratzigen Stimme, die regelmäßigen Zigarettenkonsum vermuten ließ. »Für Dirk.«
»Für Dirk?« Jetzt begannen auch noch ihre Knie zu zittern. »Wo ist er, und was haben Sie mit ihm zu tun?«
»Er ist mein Sohn.« Es kam so gelassen wie prompt. »Er hilft mir bei einer wichtigen Familienangelegenheit und braucht dafür seinen Laptop.«
»Und wieso holt er ihn nicht selber?«, entfuhr es Lona, noch bevor ihr das ganz und gar Absurde dieser Behauptung zur Gänze bewusst wurde.
»Was geht das dich an?« Jetzt wurde der Mann hörbar unwirsch. »Er kann jetzt gerade nicht weg, deshalb hat er mir den Schlüssel gegeben, damit ich das Teil für ihn hole. Also mach jetzt hier keinen künstlichen Aufstand.«
Er steuerte zielbewusst auf den Schreibtisch zu. Lonas Herz hämmerte wild. Dieser Kerl machte ihr zunehmend Angst. Zumal er sie definitiv belog.
»Moment!« Sie verkrallte sich noch fester in die Schreibtischkante und nahm ihren ganzen Mut zusammen. »Sie nehmen hier gar nichts mit. Nicht bevor Dirk mir persönlich bestätigt, dass Sie das dürfen.«
Er blieb dicht vor ihr stehen und musterte sie durch seine schwarze Sonnenbrille.
»Sieh mal an«, sagte er, und jetzt klang er eindeutig ironisch. »Und wer bist du, dass du dich hier aufführst wie die Herrin des Hauses?«
»Das geht Sie nichts an«, entgegnete Lona. »Sie sagen mir ja auch nicht, wer Sie sind. Und jetzt verschwinden Sie, oder ich rufe die Polizei!«
Was leichter gesagt als getan war – ihr Smartphone lag außerhalb ihrer Reichweite in der Handtasche, drüben am Esstisch. Verdammt.
Zu ihrem Entsetzen schien der Mann weit davon entfernt zu sein, sich von ihr einschüchtern zu lassen. Unbeirrt trat er ganz nahe an sie heran. Der unangenehme Geruch von kaltem, abgestandenem Zigarettenrauch stieg ihr in die Nase, und ihr Magen hob sich.
»Ich sagte dir doch«, zischte er direkt vor ihrem Gesicht, »ich bin Dirks Vater.«
»Nein.« Ihre Stimme war nur noch ein mühsames Flüstern; Eiseskälte kroch durch ihre Glieder, und sie bebte vor Angst. »Das sind Sie nicht. Dirks Vater ist tot. Schon seit drei Jahren.«
Für einen Augenblick brachte diese Antwort den Mann scheinbar aus dem Konzept. Dann aber stieß er sie mit einem Mal grob zur Seite und griff hastig nach dem Laptop.
»Nein!!«
Die unerwartete Aktion des Fremden löste Lona aus ihrer Schockstarre. Instinktiv stürzte sie sich auf ihn, entriss ihm den Laptop und versetzte ihm einen schmerzhaften Tritt gegen das Schienbein. Dann rannte sie zu dem Esstisch, klemmte sich den Laptop unter den Arm und suchte hektisch in ihrer Tasche nach dem Smartphone.
»Du miese kleine Schlampe …«
Panik stieg in Lona hoch, als der Mann drohend auf sie zukam.
»Hilfe!«, schrie sie laut. »Hilfe!!«
Im gleichen Moment ertasteten ihre Finger endlich das Smartphone, und sie zog es hervor, auch wenn sie keine Ahnung hatte, wie sie die 110 wählen sollte, ohne dafür den Blick von dem Mann zu nehmen, der sie schon fast erreicht hatte …
»Hilfe!«, stieß sie noch einmal hervor und riss das Smartphone hoch.
Und dann blieb der Fremde plötzlich stehen, als hätte Lona statt eines Handys eine Pistole auf ihn gerichtet. Eine endlose Sekunde lang starrte er sie an, dann wandte er sich ab und verließ mit schnellen Schritten den Raum.
Ungläubig sah Lona ihm nach. Sie hörte, wie draußen im Flur die Wohnungstür aufgerissen wurde und wieder ins Schloss fiel.
Lange wagte sie es nicht, sich zu rühren. Was, wenn das eine Falle war und der Mann draußen im Flur wartete, bereit, sich bei nächster Gelegenheit auf sie zu stürzen …
Aber alles blieb still.
Langsam und so lautlos wie möglich begann Lona sich an dem Esstisch entlangzutasten, bis sie einen vorsichtigen Blick hinaus in den Flur werfen konnte.
Er war leer. Der Mann mit der Sonnenbrille war verschwunden.
Die Anspannung fiel von Lona ab und wich dem Schock. Ihre Beine versagten ihr den Dienst, und sie ließ sich auf einen der Stühle sinken. Dann wurde ihr bewusst, dass sie noch immer das Smartphone in der Hand hielt.
Mit zitternden Fingern aktivierte sie das Display und wählte die Nummer der Polizei.
2
Erst Stunden später kam Lona endlich wieder zu Hause auf der Reichenau an. Sie war noch immer völlig verstört von den Ereignissen des Abends, dazu müde von den Vernehmungen durch die Polizei und darüber hinaus krank vor Sorge um Dirk, von dem nach wie vor kein Lebenszeichen gekommen war.
Der Gedanke, den Rest des Abends allein in ihrer Wohnung zu verbringen, war so niederschmetternd, dass sie sogar bereit gewesen wäre, die Gesellschaft ihrer Mutter zu suchen … doch die war nach ihrer abendlichen Dosis Antidepressiva derart unzugänglich, dass Lona schon nach wenigen Minuten hinauf in ihre Wohnung flüchtete und in ihrer Verzweiflung Andrea anrief. Zum Glück reagierte ihre Jugendfreundin prompt, ließ alles stehen und liegen und kam zu ihr.
»So«, sagte sie, nachdem sie Lona lange und fest umarmt hatte, »jetzt machen wir uns erst mal einen ordentlichen Kaffee – ja, ich weiß, wie spät es ist, aber so, wie du aussiehst, kannst du ihn dringend brauchen, und ich hab ein paar Stücke Marmorkuchen von meiner Mutter abgestaubt, die schaden dir sicher auch nicht. Und dann erzählst du mir ganz genau, was los ist.«
Wenig später saßen sie vor dampfenden Kaffeetassen und Lona spürte überrascht, wie allein schon der Duft ihre Lebensgeister wieder ein wenig weckte. Sie hatte zwar auch bei der Polizei einen Kaffee bekommen, die dünne schwarze Brühe dort aber eher nebenbei und achtlos in sich hineingegossen. Jetzt, in der Gegenwart ihrer vertrauten Freundin, die gerade eine dicke Kerze auf dem Tisch entzündete, merkte sie, wie die Anspannung zumindest ansatzweise von ihr abfiel, und nach einem ersten Schluck von dem aromatischen Gebräu erzählte sie Andrea alles über die seltsame Begegnung mit dem Fremden in Dirks Wohnung.
»Da hast du aber Glück gehabt«, stellte Andrea fest, als Lona bei dem unerwarteten Rückzug des Mannes angelangt war. »Dass der Kerl urplötzlich einfach so die Flucht ergreift, meine ich. Er hätte dich ja auch ebenso gut vorher noch unschädlich machen können.«
»Ja, vielen Dank auch!«, versetzte Lona sarkastisch. »Das ist genau die Vorstellung, die ich jetzt brauche, um die Nacht ruhig und friedlich zu überstehen.«
»Entschuldige!«, erwiderte Andrea beschwichtigend und brach eine Ecke von ihrem Kuchenstück ab. »So war’s nicht gemeint. Im Übrigen … wenn du willst, dann bleib ich heute Nacht gerne hier. Damit du nicht allein bist und … ja, vielleicht fühlst du dich dann ja sicherer.«
Lona blickte in ihre Kaffeetasse hinein und atmete tief durch.
»Das ist lieb von dir«, sagte sie leise. »Vielleicht komm ich tatsächlich darauf zurück. Mal sehen, wie’s mir nachher geht.« Sie trank einen weiteren kleinen Schluck. »Und abgesehen davon – du hast ja recht. Das frag ich mich auch schon die ganze Zeit: Warum hat der Mann plötzlich Fersengeld gegeben? Bei der Polizei meinten sie, vielleicht haben meine Hilfeschreie ihn aus dem Konzept gebracht; immerhin bestand die Möglichkeit, dass Nachbarn auf uns aufmerksam werden. Und als ich dann auch noch das Handy gezückt habe, wurde es ihm zu heiß, und er ist verschwunden.«
»Möglich«, meinte Andrea nachdenklich. »Aber was, wenn er später wiederkommt? Er hatte doch einen Schlüssel, oder?«
»Ja, aber der wird ihm dann nicht mehr viel nützen«, erwiderte Lona grimmig. »Die Polizei hat mir geholfen, einen Schlüsseldienst zu finden, der das Schloss sofort ausgewechselt hat. Und sollte der Kerl auf die Idee kommen, die Tür aufzubrechen, dann wird er zumindest den Laptop nicht mitnehmen können – der ist jetzt hier bei mir. Sicher ist sicher.«
»Was uns zu der nächsten Frage bringt«, versetzte Andrea. »Wer war der Mann, und warum wollte er Dirks Laptop?«
»Und vor allem«, ergänzte Lona, »woher hatte er den Schlüssel zu Dirks Wohnung? Eigentlich … kann er ihn ja nur von Dirk selbst haben.«
Sie begann gedankenverloren, ein kleines Stück von dem Marmorkuchen auf ihrem Teller zwischen Daumen und Zeigefinger zu einem Kügelchen zu rollen.
»Und was, wenn Dirk ihm tatsächlich den Schlüssel gegeben hat, damit der Mann den Laptop holt?«, überlegte Andrea. »Du sagst, sein Auto stand vor dem Haus; das heißt, er war zu Fuß oder mit Öffis unterwegs, und dann konnte er eben nicht schnell selber losfahren, um …«
»Und wieso ruft der Kerl dann nicht einfach Dirk an, damit der mir bestätigen kann, dass alles in Ordnung ist?«, fuhr Lona ihr ins Wort. »Wieso läuft er im Haus mit Sonnenbrille rum, damit ihn ja niemand erkennt? Und warum in drei Teufels Namen behauptet er, Dirks Vater zu sein – ein Mann, der schon seit drei Jahren tot ist?«
»Vielleicht ist er ja gar nicht tot«, versetzte Andrea. »Das hört man doch öfter, dass Menschen ihren Tod nur vortäuschen, um sich abzusetzen. Oder dass sie verunglücken und ihr Gedächtnis verlieren, und dann leben sie irgendwo unerkannt, während ihre Angehörigen sie für tot halten. Wer weiß, vielleicht lebt Dirks Vater noch und ist jetzt wieder aufgetaucht und hat Dirk irgendwie um Hilfe gebeten?«
Lona legte nachdenklich das Kuchenkügelchen auf den Teller und presste es mit der Zeigefingerkuppe platt.
»Bisschen unwahrscheinlich, aber möglich wär’s«, sagte sie schließlich. »Ich hab Dirks Vater nie kennengelernt; er war schon tot, als ich Dirk begegnet bin. Wenn er denn tatsächlich tot ist.«
»Wird die Polizei da jetzt ermitteln?«
»Frag mich nicht.« Lona winkte müde ab. »Ich hab denen erst mal jede Menge Fragen beantwortet, dann durfte ich helfen, ein Phantombild von dem Typen anzufertigen, und schließlich hab ich noch offiziell Dirk als vermisst gemeldet. Aber da war mein Kopf schon so was von leer … Ich fürchte, ich hab da nicht mehr alles um mich herum richtig mitgekriegt.«
»Kein Wunder«, meinte Andrea mitfühlend. »Kann ich dir irgendwas Gutes tun, Süße?«
Lona starrte auf ihre Hände hinunter.
»Wenn ich wenigstens wüsste, wo Dirk ist«, murmelte sie. »Sein Handy ist immer noch wie tot, keine Spur von ihm – und seinen Wohnungsschlüssel hat ein Mann, der alles Mögliche sein kann.« Sie hob den Kopf und sah Andrea an. »Ich hab Angst um Dirk«, sagte sie leise. »Ich hab solche Angst.«
Wortlos erhob sich Andrea, setzte sich neben Lona und legte die Arme um sie. Lona ließ sich in ihre Umarmung hineinsinken und begann erschöpft zu weinen.
Andrea hielt ihr Versprechen und blieb die ganze Nacht über bei Lona. Ihre tröstliche Nähe gab Lona so viel Sicherheit, dass sie es irgendwann tatsächlich fertigbrachte, sich hinzulegen. Allerdings fuhr sie nur wenige Stunden später aus einem Albtraum hoch, in dem sie und ihr Vater mit ihrem Wagen ins Schleudern gerieten, weil vor ihnen plötzlich schemenhaft Dirk auf der regennassen Straße auftauchte. An Schlaf war danach nicht mehr zu denken – aber wenigstens war sie nicht allein in ihrer Wohnung, auch wenn Andrea mittlerweile friedlich auf dem Wohnzimmersofa eingeschlummert war.
Als es draußen allmählich hell wurde, kochte Lona Kaffee und weckte ihre Freundin. Sie frühstückten gemeinsam, dann verabschiedete sich Andrea, nicht ohne eine strenge Anweisung an Lona, sich sofort zu melden, wenn sie noch einmal seelischen Beistand brauchte.
Nachdem Andrea gegangen war, räumte Lona in der Küche auf und spülte das Geschirr vom Frühstück. Dabei wanderten ihre Gedanken zu dem Geschirrstapel in Dirks Wohnung, der vermutlich immer noch so schmutzig neben der Spüle stand wie am Abend zuvor. Jedenfalls war Dirk offensichtlich nicht nach Hause gekommen – da er für das neue Schloss keinen Schlüssel besaß, hätte er mit Sicherheit entweder Lona angerufen oder die Sache rechtschaffen verwundert der Polizei gemeldet. Und diese hätte wiederum ganz bestimmt Lona informiert.
Aber offenbar gab es nichts zu informieren.
Normalerweise wäre Lona an diesem Tag gegen halb zehn Uhr zu einem Seminar in die Uni gefahren. Doch schon bei der bloßen Vorstellung winkte sie innerlich müde ab. Geschichtsfakten und -daten waren das Letzte, wofür sie jetzt einen Kopf hatte.
Stattdessen fuhr sie wenig später nach Konstanz und zu Dirks Wohnung.
Sie hatte den Schlüssel bei sich, der ihr am Vorabend bei der Polizei ausgehändigt worden war. Dass niemand außer ihr das neue Schloss öffnen konnte, war ein beruhigender Gedanke; dennoch fühlte Lona sich sicherer, als sie die Wohnungstür hinter sich geschlossen und die Sicherheitskette vorgelegt hatte.
Um sie herum war es still und leer wie am Abend zuvor. Die Tasse mit dem eingetrockneten Kaffeerest stand noch immer auf dem Tisch, ebenso wie das gebrauchte Geschirr in der Küchenecke. Der Anblick wurde Lona mit einem Mal derart unerträglich, dass sie mit einer heftigen Bewegung den Heißwasserhahn über dem Becken aufdrehte und Teller, Tassen und Besteck blankscheuerte. Danach feuerte sie frustriert den Lappen in die Spüle und ließ sich auf einen Stuhl sinken, während ihr Tränen in die Augen stiegen und überliefen.
Irgendwann hatte sie sich wieder so weit im Griff, dass sie damit anfangen konnte, wofür sie eigentlich hergekommen war: die Suche nach Hinweisen, wo Dirk stecken könnte – Notizen über eventuelle Verabredungen, Termine oder was auch immer.
Auf dem Schreibtisch stach ihr die leere Stelle ins Auge, wo am Vorabend noch der Laptop gestanden hatte. Im gleichen Moment wurde ihr bewusst, dass sie auch den bereits hätte durchsuchen können, vorausgesetzt, Laptop beziehungsweise Mailaccount waren nicht durch Passworte geschützt. Nun gut, das konnte sie ja später nachholen. Falls sie nicht ohnehin hier in Dirks Papierwust schon fündig wurde.
Sie schob ein paar Blätter zur Seite, und für einen Moment blieb ihr das Herz stehen, als das Päckchen mit dem Anhänger »Für Lona« zum Vorschein kam. Sie hatte es am Abend zuvor nicht mehr angerührt – und auch jetzt erschien ihr die Vorstellung, es an sich zu nehmen oder gar zu öffnen, wie ein Sakrileg. Es war ein Geschenk von Dirk. Und nur von ihm wollte sie es bekommen. Egal wie lange sie dafür warten musste.
Sie biss sich auf die Lippen, schob das Päckchen beiseite und begann, die Papierstöße durchzublättern. Die meisten entpuppten sich als Unterlagen, die mit Dirks Studium zu tun hatten – aus Büchern herauskopierte Artikel, mit vielen markierten Stellen und Randnotizen versehen, dazu vollgeschriebene Zettel, aber nichts, was für Lona von Interesse war. Ein paar geöffnete Briefe weckten ihre Aufmerksamkeit, und sie inspizierte kurz den Inhalt. Ein Schreiben von der Uni, eines von einer Versicherung, eine Autowerkstatt-Rechnung, ein paar Werbebriefe … nichts, was ihr irgendwie weiterhalf.
Ganz unten fand sie einen Umschlag, auf dem Dirks Adresse von Hand geschrieben stand. In einer eindeutig weiblichen Handschrift.
Stirnrunzelnd drehte Lona den Brief um und las den Absender. Claudia Reisacher.
Verblüfft starrte sie auf den Namen. Sie wusste, dass Dirk eine jüngere Schwester namens Claudia hatte – aber konnte dieser Brief wirklich von ihr sein? Nach dem, was Dirk ihr erzählt hatte, hatten sie seit Jahren nicht mehr miteinander geredet; er wusste nicht einmal, wo sie lebte, seit sie mit achtzehn im Streit das Haus und die Familie verlassen hatte.
Kurz entschlossen zog sie die Karte hervor, die in dem Umschlag steckte.
»Lieber Dirk,
das Wichtigste zuerst: Alles Gute zum Geburtstag! Und dann zu der Frage, die du dir sicher gerade stellst: Wieso meldet sie sich jetzt plötzlich nach all den Jahren? Ganz einfach: Du fehlst mir. Ich würde gerne wieder mit dir in Kontakt kommen. Ich lebe mittlerweile in Meersburg und arbeite in einem Tattoo-Studio. Ich lege eine unserer Geschäftskarten bei – meld dich doch mal, ich würd mich riesig freuen!
Deine Claudia.«
Spontan warf Lona noch einmal einen Blick in den Umschlag, aber er war leer. Keine Karte von einem Tattoo-Studio oder dergleichen. Aber das sollte herauszufinden sein, zumal ja auch eine Absender-Adresse in Meersburg auf dem Kuvert stand. Rein interessehalber überprüfte Lona den Poststempel; der Brief war im vergangenen März abgeschickt worden. Das passte, Dirk hatte Ende März seinen fünfundzwanzigsten Geburtstag gefeiert.
Ob er seiner Schwester wohl irgendwie geantwortet hatte? In jedem Fall hatte er Lona nichts davon erzählt, dass Claudia plötzlich wieder aufgetaucht war.
So wie womöglich auch sein Vater wieder aufgetaucht war.
Für einen Moment hielt Lona den Atem an. Hing das alles am Ende irgendwie zusammen?
Eins stand fest: Sie musste diese Claudia finden. Je eher, desto besser.